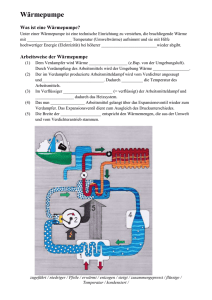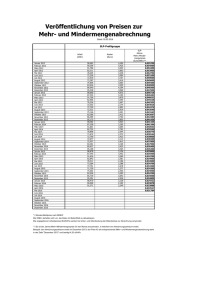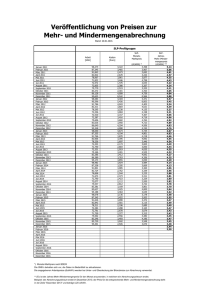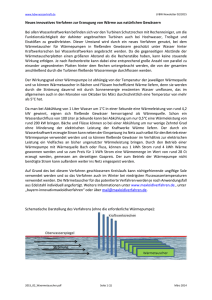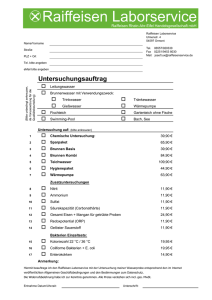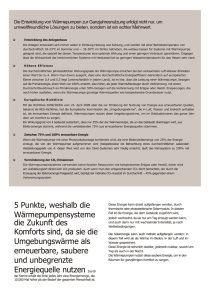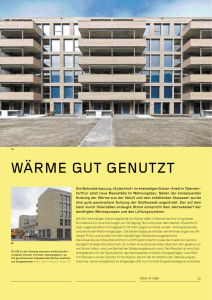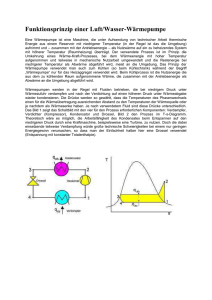Modul 1.2 - 1.3 Prof. Dunja Karcher Prof. Tomáš Valena One Man
Werbung

Modul 1.2 - 1.3 Prof. Dunja Karcher Prof. Tomáš Valena One Man Shelter 150 Das Thema „Shelter“ war Leitmotiv für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den essentiellen und existenziellen Grundfragen der Architektur. In 12 wöchentlichen Seminareinheiten näherten sich die Studenten dem Thema auf spielerisch experimentelle Weise mit gestalterischen, multimedialen und handwerklichen Mitteln an. Ausgehend vom Ursprung der Architektur, der „Urhütte“, führte die Diskussion weiter über die Definition und den Stellenwert von öffentlichem und privatem Raum in der Stadt bis hin zur grundsätzlichen Untersuchung von Formen von Unbehaustheit und Obdachlosigkeit und deren gesellschaftlichem Hintergrund. Mit der Idee des Shelters als temporäre Installation im öffentlichen Raum sollte ein geeigneter Aufstellungsort bestimmt werden. Unter Berücksichtigung von klimatischen Bedingungen und Anforderungen an Sicherheit, Mobilität und kostengünstige Lösungen sollten mögliche konstruktive Konzepte ermittelt werden. Von ersten Ideenskizzen bis hin zur Darstellung und Präsentation eines Entwurfs fand die Aufgabe ihren Abschluss in der Herstellung eines zerlegbaren und transportierbaren Shelters. Im Rahmen einer „Spontan Aktion“ wurden alle Shelter in der Stadt für eine Nacht im Freien aufgestellt. 151 One man cosmos Alles begann mit dem Shelter, so auch für uns Erstsemestler unser Konstruktionsprojekt. Als ich nach der ersten Aufgabenstellung den Berg Bücher mit nach Hause trug und abends vor dem dicken leeren Sketchbook versuchte, die erste Seite zu beginnen, dachte ich nie, dass dies nach nur vier Monaten wirklich voll sein wird. Wie beginne ich etwas zu bauen, was ich bereits in einer viel besseren Form schon habe? Die Vorstellung nichts von all dem zu haben, was sich Zuhause nennt, lässt einen schnell kreativ werden. Recherchen über die verschiedensten Methoden wie die Menschen in jeder Kultur und Zeit diese Herausforderung meisterten, ließen meinen Ordner, namens „RESEARCH“ unübersichtlich voll werden und lieferten Ideen in fast jeder erdenklichen Form und Materialität. Einige Wochen und Aufgabenstellungen später häuften sich die Bücher über die Urhütte. 152 Lena Kwasow, Betina Kleber Mein Shelter Sketchbook lag jetzt immer neben dem Bett und jeden Morgen waren wieder einige Seiten gefüllt. Stunden wanderte ich durch den Baumarkt auf der Suche nach der Lösung für meine Konstruktion. Die Angestellten grüßten freundlich, wissend, dass sie mir nicht helfen konnten. Zu viele Möglichkeiten und Ideen überschwemmten das klare Ziel der Aufgabenstellung und es schien, als würde dieses doch so kleine Thema in den Kosmos hinaus wachsen. Und das war die Antwort, nach der ich gesucht habe: „One man cosmos“ nannte ich meinen Shelter und plötzlich beantworteten sich alle folgenden Fragen wie von alleine. Einige Zeit später entstand dann der erste realisierbare Plan und auch mein Sketchbook, das ein Teil unserer Aufgabe war und sich als wichtigstes Werkzeug erwies, wurde sehr schnell komplett. 153 Modul 1.4 Bauaufnahme und Vermessen Prof. Dr. Florian Zimmermann LB Reinhold Winkler Aufmaß eines Stuhles Maßstab 1:1 Bleistift auf Karton 154 Das Aufmaß eines Stuhles ist seit vielen Jahren eine immer wiederkehrende erste Aufgabenstellung im Fachgebiet Bauaufnahme und Vermessen. Denn ein Stuhl ist handlich und transportabel und kann gut im Maßstab 1:1 durch geeignete Projektion mit Lot, Wasserwaage und anderen Hilfsmitteln mit Bleistift auf Karton übertragen werden. Das Objekt ist also relativ einfach im Sinne einer Dreitafelprojektion zu zeichnen. Die Darstellung erfolgt formgerecht, also nicht idealisiert, und ist hinsichtlich ihrer Korrektheit leicht und anschaulich überprüfbar. Stühle folgen ähnlichen Prinzipien wie Architektur, indem sie funktionale, konstruktive und ästhetische Kriterien erfüllen müssen. Nicht zuletzt deshalb haben sich auch namhafte Architekten häufig der Konstruktion und Gestaltung von Stühlen angenommen. Geschult werden in der Übung neben den Grundlagen des differenzierten Zeichnens und den Grundsätzen einfacher Messtechniken vor allem die Fähigkeiten genauen Beobachtens: dabei geht es um vielfältigen konstruktiven Möglichkeiten des Stuhls, die Verbindung seiner Teile, die Eigenschaften seiner Materialien, die Qualitäten seiner Oberflächen und die Spuren seines Gebrauchs. Das Aufmaß eines Stuhles bildet in Bezug auf die zeichnerischen und messtechnischen Fragestellungen und vor allen in Hinblick auf die detaillierte und umfassende Schulung der Beobachtung die ideale Grundlage für die Bauaufnahme des 2. Semesters, in der dann Gebäude oder Gebäudeteile formgerecht dargestellt werden. 155 Aufmaß eines Stuhles Andrea Schelle 156 Semesterarbeit Patrick Rychtarik 157 Florian Völklein 158 Lucia Maier 159 Elisabeth Wulf 160 Benjamin Michels 161 Modul 3.2 Konstruktion Prof. Martin Zoll Halle für einen Wochenmarkt in Erfurt 162 Auf einem Hügel mitten in der Stadt Erfurt erhebt sich ein gewaltiger mittelalterlicher Dom und im Abstand von etwa 10 m eine zweite riesige Hallenkirche aus der selben Epoche. Diese Nachbarschaft zweier gewaltiger Sakralbauten- auf einem Hügel von der Stadt und ihrem alltäglichen Leben abgehoben - ist in Europa einzigartig. Leider steht dieses Ensemble nicht mehr in seinem ursprünglichen Zusammenhang. Nachdem 1806 die Herrschaft in Erfurt an die Fanzosen überging, wurde die Stadt 1813 durch preußische, russische und österreichische Truppen von der Zitadelle aus beschossen. Ein ganzes Stadtviertel (170 Häuser) am Fuße des Hügels wurden zerstört und nicht wieder aufgebaut. Dadurch entstand, zusammen mit dem schon vorher bestehenden Domplatz, eine riesige Platzfläche, die den Domhügel klein erscheinen läßt und die Altstadt vom Domplatz abrückt. Der Platz wird heute für verschiedene Veranstaltungen und Volksfeste genutzt. AUFGABE Für den Wochenmarkt ist eine gedeckte Halle zu entwickeln. Sie soll einfachen Ständen dienen, und folgende Funktionen sollen integriert werden: Infrastruktur für Bushaltestellen und Touristen, tägliche geöffnete Kioske für Grundbedürfnisse 163 Markthalle Erfurt Der Domplatz im Innenstädtischen Erfurt wird derzeit als wöchentlicher Marktplatz genutzt. Durch das Errichten einer Markthalle besteht die Möglichkeit, eines der letzten großen noch zu entwickelnden Grundstücke der Innenstadt mit einer publikumswirksamen und damit belebenden Nutzung neu zu beleben. Flanieren und Einkaufen unter großen Dächern ist das Leitmotiv des Entwurfes. Die Markthalle orientiert sich an historischer Architektur großer Markthallen des 20. Jahrhunderts, wie beispielsweise die große Markthalle Nagy Vásárcsarnok, die Markthalle von Santander in Spanien oder der Großmarkthalle in München. Die weit auskragenden Dächer über der gläsernen Fassade kennzeichnen als einladende Geste schon von weitem die Markthalle. Unter der konstruktiven Form des aus Stahl und Glas konstruierten Dachs ist die Markthalle mit einer Haupterschließungsachse konzipiert, von der aus die einzelnen Kioske, Cafés und Geschäfte, zwei Treppen und ein Aufzug zu erreichen sind. Die Treppen und der Aufzug verbinden hierbei das Erdgeschoss mit der im 1. Geschoss liegenden Galerie, von der aus sich ein guter Überblick über das Treiben und Leben auf dem Marktplatz bietet. Große Lufträume hinter den Fassaden führen Tageslicht bis auf alle Ebenen, wodurch eine angenehme Großzügigkeit entsteht. Nachts kann die Markthalle für Veranstaltungen und Festivals genutzt werden. Sie ist flexibel. Die markante Markthalle fügt sich behutsam in den städtischen Kontext ein. An diesem Ort verschränkt sich die moderne Architektur der Markthalle mit der historischen Bausubstanz der Umgebung. Die Marienkirche, im gotischen Stil erbaut, ist der wichtigste und älteste Kirchenbau in Erfurt. Sie bildet mit der Severinkirche das Zentrum des Domplatzes, welches durch unseren Entwurf unterstrichen wird. Mit seinen klaren Strukturen und der Konzentration auf das Wesentliche entsteht ein unverwechselbarer und kraftvoller Charakter, der sich gleichermaßen in das Umfeld integriert und doch seine Eigenständigkeit bewahrt. Die Vielschichtigkeit der Umgebenden städtischen Strukturen, die urbane Dichte und die Weite des Domplatzes werden Impulsgeber für die räumliche Konzeption des Gebäudes. Die Dualität von Offenheit und Introvertiertheit entsteht durch prägnante stützenhohe Verglasungen für die Marktstände und Freibereiche. Gleichzeitig soll die Grundrisskonstellation der festen Läden auch die Möglichkeit des Rückzugs bieten. 164 Benedict Esche, Aron Udjbinac 165 HEB 160 Querschnitt Deckenmontage Deckenbeleuchtung L-HL-W-ST3 Helestra Edelstahl Leuchtmittel TC-F 18W Fassung 2G10 Storenkasten 8.3cm 4.3cm 11.8cm 4.3cm 8.3cm 37cm Detail Geländer 100cm Handlauf 2x3,5cm -0.06m 23cm 28 7.6 HEBHEB 160 160 Querschnitt Querschnitt -0.15m Abflussrinne Steinwollplatte (Flumroc Dämmplatte 3) 80 mm Kote +3.33m 3.5 16 28 0.0m mind. 1% HEB 160 Kote +3.17m 5cm 20 20 Leichtbeton HEB 160 Flansch und Steg gedämmt Glasschwert rechtwinklig Storenkasten 0.92m Detail Auskragung Galerie 166 Betonsteinplatten OK Rohbau +3.40m UK Rohbau 3.13m 20 Glasschwert OK Fußboden +3.55m 5 10 Terrazzo 10 cm Trittschaldämmung 5 cm Ortsbeton 48/28 cm 123cm Schwere Folie 3mm Steinwollplatte 80mm 0.20m 0.066m UAP- Träger mit Brandschutzaufstrich F30 0.40m 3.40m 1. Obergeschoss Innenraum 167 Modul 3.1 Entwerfen CAX Prof. Ruth Berktold Baulücke München 168 Die Aufgabenstellung beschäftigt sich mit dem Thema Baulücke. Die selbstgewählte Baulücke in unterschiedlichsten städtebaulichen Situationen in München soll mit 3 unterschiedlichen Funktionen gefüllt werden. Nach eingehender Kontextanalyse wird das Programm des Gebäudes festgelegt. Durch ‘Crossprogramming’ ergeben sich neue Typologien und Funktionen. Verschiedene Funktionen unter einem Dach mit oft unterschiedlich hohen angrenzenden Gebäuden oder Ecklösungen führen zu komplexen Raumgebilden, spannenden räumlichen Vernetzungen im 3-dimensionalen Raum und abstrakten Raumzusammenhängen. Es muss auf den Kontext eingegangen werden und dennoch sollen eigene konzeptionelle Denk- und Entwurfsansätze entwickelt werden. 169 Baulücke München – the space inbetween Das ausgewählte Grundstück befindet sich in der Westenriederstraße im Herzen Münchens. Bisher stand das Grundstück leer und diente lediglich als Abstellfläche für PKWs. Die Aufgabenstellung fordert ein Gebäude das drei dem Ort entsprechende Funktionen miteinander verknüpft. Aus der Ortsanalyse entwickeln sich die Hauptthemen des Entwurfs: Kultur und Wohnen, Bewegung und Grün. Im Erdgeschoss befinden sich Atelierwohnungen die Künstlern als Arbeitsstätte dienen und der Öffentlichkeit Einblick in das Schaffen dieser bietet. In den darauffolgenden Geschossen sind Wohnungen mit unterschiedlichsten Zuschnitten und Größen angeordnet um ein möglichst breites Spektrum von Klienten anzusprechen. Auf dem Dach ist ein Garten angelegt, der Bewohnern und Besuchern als Erholungsraum dient und einen Ausgleich zum Mangel an Grünflächen in der Umgebung ist. Aus dem Fußgängerstrom entwickelt sich eine Drehbewegung, welche sich im ganzen Gebäude fortsetzt und prägend für den Zentralen Raum und die Fassadengestaltung ist. Der haushohe Ausstellungs- und Erschließungsraum lässt die Grenzen zwischen öffentlich und privat unscharf werden, lädt die Passanten zum Verweilen und Rasten ein und bietet somit den Ausstellern ein Publikum. Ähnlich wie bei einem Luftwirbel weitet sich der Raum nach oben und ebenso nimmt auch das Tempo bis hin zum Dachgarten als absoluten Ruhepunkt ab. So ergibt sich ein Weg von der Straße bis in die Spitze des Gebäudes, der zum Entspannen einlädt und somit einen ruhenden Gegenpol zum ständig pulsierenden Stadtraum bildet. Die Geschosshöhen sowie die Entwicklung des rotierenden Ausstellungsraums basieren auf Exponentialfunktionen welche der Natur des Wirbels entsprechen. 170 Daniel Seyfang Grundriss EG Grundriss 1.OG Grundriss 2. OG Grundriss 3.OG Grundriss 4. OG 171 Baulücke München Leoni Schmid Die Aufgabe bestand darin, einen Entwurf für eine selbst gewählte Baulücke in München zu entwickeln. Es galt drei Funktionen in dem Bau unterzubringen. Ich habe die Baulücke in der Zwingerstraße, nahe dem Isartor, ausgesucht. Als Funktionen habe ich ein Theater, eine Bar und eine Kreativwerkstatt gewählt. Die Struktur habe ich entwickelt indem ich einen immer fortlaufenden Papierstreifen gefaltet habe. Alle Knicke und Richtungsänderungen passieren im 45 Grad Winkel oder 90 Grad Winkel. Das Band läuft beliebig durch das Gebäude. Es ergeben sich spannende Sichtachsen, Volumen und Raumformen. Schnitt 172 Erdgeschoss 1. Obergeschoss 2. Obergeschoss 3. Obergeschoss 173 Modul 5.1 Entwerfen Städtebau Prof. Ulrich Holzscheiter SIXPACK 174 Drei Kurzentwürfe – Drei Kurzexkursionen / Wohnungsbau pur / intensive Basisauseinandersetzung mit klassischen Typologien: verdichteter Flachbau, kompakter Geschossbau und mittelhoher Wohnhochhausbau/ drei städtebauliche Entwürfe für drei kleinere Ensembles auf einem Baufeld von 3 ha Umgriff im Maßstab 1:1000 / drei komplette Bauentwürfe für je einen Typus im Maßstab 1:200 / Bearbeitung in Zweier-Teams / drei jeweils viertägige Kurzexkursionen zu exemplarischen Wohnungsbaubeispielen in Berlin, Basel, Hamburg 175 SIXPACK Die Nordseite zur Truderingerstraße und die Ostseite zu einem durch Einfamilienhäuser zersiedeltes Gebiet wird durch einen Riegel geschlossen, dessen starre Geometrie durch gemeinschaftlich genutzten „Gartenboxen“ gebrochen wird. Um sechs Quatiersplätze gruppiert sich eine vorwiegend flächige, zweigeschossige Bebauung mit Hofhäusern. Die Hofhäuser sind in ihrer Gestaltung homogen. Farbige Hochpunkte makieren diese und sorgen für Orientierung. Die nach innen orientierten Hofhäuser stehen im Kontext zu den geschlossenen Quatiersplätzen. Im SüdWesten ragt ein 17-geschossiges Hochhaus aus der Teppichbebauung hervor. Er korrespondiert mit dem in der Nähe befindlichen Turm der Süddeutschen Zeitung und wirkt als Stadtmarke. In dem Turm befinden sich ebenfalls „Gartenboxen“. Seine Nutzung ist durchmischt. Unter anderem ergibt sich im obersten Geschoß die Möglichkeit zur gastronomischen Nutzung. 176 Helene Neubauer, Stephan Köllinger, Daniel Orth II II II II II XIIX II II V II II II II II II V V II II II II II II II II II II II V II V II II II II V II V 177 SIXPACK DAS KONZEPT - EIN DREIKLANG. Der obere Bauabschnitt besteht aus zweigeschossigen Maisonettewohnungen. Eine weitere Singlewohnung ergibt die Dreigeschossigkeit. Die Erschließung erfolgt über Zweispänner. Die Treppenkerne bieten ebenfalls den Durchgang in die Innenhöfe der Wohnanlage. Im mittleren Bauabschnitt finden sich ebenfalls Maisonettewohnungen, jedoch wird hier eine großzügige Loftwohnung als vertikaler Abschluss angeboten. Diese werden von Norden über einen Laubengang erschlossen. Dieser bildet auch den Zugang zur gemeinschaftlich genutzten Dachterrasse. Die Innenhöfe sind mit Birken bepflanzt und bilden sprichwörtlich den Kern der Anlage. Der unterste Bauabschnitt - getrennt von der oberen Spange durch eine Spielstraße - wird von Hofhäusern gebildet. In den Achsen der Komposition finden sich die Spielplätze. Diese entstehen durch eine Reliefbewegung und unterstreichen durch in den Boden installierte Lichtachsen die Perspektive der räumlichen Figur. Wohnen im Grünen. Ja das möchste! Ja das kriegste! 178 Daniel Pihale ESSEN ARBEITEN 15 15 21 21 WC 43 WOHNEN WOHNEN WOHNEN/ESSEN 41 20 20 SCHLAFEN/ARBEITEN ESSEN ARBEITEN 52 15 15 21 21 WC SPIELEN SPIELEN WOHNEN WOHNEN WOHNEN WC 50 29 SCHLAFEN STELLPLATZ 42 WOHNEN WOHNEN/ESSEN GARTEN ESSEN ARBEITEN 15 15 21 21 WC ESSEN 15 ESSEN ARBEITEN ESSEN 15 15 15 WC WC 43 WOHNEN 21 21 21 WOHNEN 21 WOHNEN/ESSEN WOHNEN WOHNEN/SCHLAFEN WOHNEN ARBEITEN ESSEN 15 15 20 20 SPIELEN SPIELEN 52 WC WC 21 WOHNEN/SCHLAFEN WOHNEN 21 WOHNEN WOHNEN 179 Modul 5.1 Entwerfen und Konstruktion Prof. Andreas Meck Gastkritik: Beate Kreutzer Hochschulparasiten Parasites for University 180 Szenario „Die Hochschule München hat beschlossen, das wertvolle Grundstück an der Karlstraße zu vermarkten und Investoren zur Verwertung zur Verfügung zu stellen. Bis zu diesem Zeitpunkt X verbleibt die Architekturfakultät in den Räumen der Karlstraße. Die Fakultäten Bauingenieurwesen und Vermessungskunde werden ins Gebäude am Zentralstandort an der Lothstraße umgelagert. Die Architekturfakultät hat dadurch die Möglichkeit, die Räumlichkeiten an der Karlstraße, an denen keine Instandhaltungsmaßnahmen mehr erfolgen, für ihre Zwecke nach Belieben zu nutzen. Da Arbeitsplätze für Architekturstudenten fehlen und gleichzeitig Wohnungen für Studenten dringend benötigt werden, beschließt die Fakultät, die Gebäude an der Karlstraße zur „Besiedelung“ freizugeben. Um die Besiedelung in gestalterisch kontrollierbare Bahnen zu lenken, wird ein Wettbewerb für ein „parasitäres Besiedelungsmodul“ ausgelobt.“ Ziel war es, drei bis fünf (intelligent) minimierte Arbeitsraum- und Wohnmodule prototypisch in einem ersten Bauabschnitt in direkter Verbindung mit dem bestehenden Gebäudekomplex zu realisieren. Die Standortwahl der Parasiten war frei gestellt – ob gelandet, gedockt, gehängt, unter, über, in ... Bei der Situierung der Arbeitsraum- bzw. Wohnmodule war es wichtig, sich sowohl mit dem Verhältnis der „Parasiten“ untereinander als auch mit dem Verhältnis zum Hochschulgebäude zu beschäftigen und einen spannungsvollen räumlichen und gestalterischen Dialog zu suchen. 181 Hochschulparasiten „zweipluseinsgleicheins“ ENTWURFSKONZEPT „zweipluseinsgleicheins“ an der hochschule münchen sollen 5-7 arbeitsraum- und wohnmodule entstehen. unser konzept ist es, die arbeitsräume und wohnungen räumlich zu trennen. die arbeitskuben finden ihren platz im lichthof des kanterbaus; auf drei etagen verteilt sollen 2 studenten pro kubus eingeteilt werden. die plätze sind mit funktionalen arbeitstischen ausgestattet, die sich an einer wandseite erstrecken. dieser „innere parasit“ soll den weg durch das vorhandene treppenhaus zu den wichitgen räumlichkeiten, wie bibliothek, cad-raum und der mensa verkürzen und erleichtern. dieses arbeiten im inneren stellt die lebendigkeit und den fleiß des studentenlebens dar, durch die aufgebrochene fassade wird das innere leuchten nach außen getragen und bezieht gleichzeitig die innerstädtische umgebung mithinein in die räumlichkeiten. durch das einrücken und öffnen der fassade wird natürliches licht in den neuen „lichthof“ geführt, unterstützt durch künstliches licht, welches am unterboden der arbeitskuben mit integriert ist, und zusätzlich den lichthof durchflutet. die kuben sind in richtung der fassade orientiert um den bezug nach außen zu verstärken. „theCubicStudentVille“ siedeln sich auf dem dach an und werden mit dem vorhandenem gleichen, jedoch eine etage erweiterten treppenhaus erschlossen. nach der getanen arbeit kann jeder student sich in seine wohnkapsel zurückziehen, abschalten und einen schönen ausblick über die stadt münchen genießen. auf dem dach werden 6 kuben angebracht, in denen 6 studenten ihr eigenes reich finden,die hochschule erweitern und aufwerten. die cubes sind mit einer multifunktionswand ausgestattet, in dem alle öffnungen zu klappen, ziehen oder aufzuschieben sind, wie beispielsweise auch das studentenbett. bei bedarf kann das bett heraus gezogen werden, und wenn in der kleinen zelle besuch da ist, kann durch zuklappen für ordnung gesorgt werden. kochnische und sanitär sind ebenfalls in die wand kompakt integriert. die Fassade der wohnkuben ist von jedem einzelnen studenten individuell in ihrer farbigkeit gestaltbar. inspiriert von den containererkennungsnummern soll jeder student seine identifizierungsnummer erhalten so wie er seine matrikelnummer erhält. die einfache minimalistische form der kuben schaffen klare strukturen innerhalb der verspielten anordung und der farbigkeit der module. dies jedoch spiegelt den passenden flair der architekturstudenten wider. die Living_Cubes sind in richtung münchner innenstadt ausgerichtet, um einen schönen ausblick über die stadt zu gewähren. Burcin Eshaghi Farahmand, Verena Ertl Piktogramme Innenraum Wohnkuben Der name „zweipluseinsgleicheins“ setzt sich somit aus den zwei komponenten wohnen und arbeiten und der „einzigartigen“ hochschule und bilden zusammen wiederum ein GANZES. Die grundidee entwickelte sich aus unseren assoziativmodellen, gewählt einmal die spirale und den trichter, deren hintergrundsinhalt sehr eng zusammenhängen, wie wir feststellen konnten und wir sie deswegen mit der hochschule verbinden konnten. Der trichter steht nämlich für den “input“ an wissen, welches uns die hochschule vermitteln soll, und deswegen auch der gewählte innenraum für die arbeitskuben, die sich im lichthof übereinander „stapeln“ und den inneren organismus symbolisch auch darstellt. Die spirale steht für den arbeits- und entwurfsprozess, während der ganzen studiumsphase. Durch das verbinden dieser assoziativmodelle hat sich unser projekt entwickelt. Ansicht Wohnkuben 182 Schnitt Grundriss Wohkubus Innenraum Wohkubus Innenraum Arbeitsraum Grundriss Arbeitsraumkubus 183 Hochschulparasiten Philipp Kohen Durch einen parasitären Anbau am Hochschulgebäude werden weitere dringend benötigte Arbeitsräume zur Verfügung gestellt sowie Wohnräume für die Studenten geschaffen. Um den parasitären Gedanken zu stärken, setzt sich der Anbau bewusst durch seine plastische Form von der städtebaulichen Umgebung ab, fügt sich aber dennoch durch Positionierung, Größe und Materialität ein. Der Anbau ist ekto-, wie auch endoparasitär zu verstehen, da er die Körperoberflächen des Bestandsgebäudes nutzt und seine beiden außen liegenden Volumen mit einem im inneren schwebenden Verbindungsgang verknüpft. Der konzeptionelle Gedanke hierbei ist die beiden Situation Kantergebäude durch weitere Erschließungsebenen (barrierefrei) vom 2Durch - 3. Stock zu verbinden und sie somit klar und funktional einen parasitären Anbau am optisch Hochschulgebäude zu vereinen. werden weitere dringend benötigte Arbeitsräume zur verfü- Philipp Kohen Die großen abgeschrägten Fensterflächen im Arbeitsraum dienen der transparenz und erlauben es, tief in den Innenraum der Architekturfakultät und deren Arbeiten hineinzusehen (Innen-/ Außenbeziehung). der Wohnraum ist in Wohnmodule und gemeinschaftsfläche gegliedert. Die großen abgeschrägten Fensterflächen im Arbeitsraum dienen der Die Module natürliche durch obere Transparenz underhalten erlauben es, tief in den Belichtung Innenraum der ArchitekturfaLichtbänder in den Trennwänden, wodurch die Privatsphäkultät und deren Arbeiten hineinzusehen (Innen-/ Außenbeziehung). reWohnraum gewährleistet ist. Sitzstufen Panoramafenster im Der ist in Wohnmodule undund Gemeinschaftsfläche gegliedert. Die Module erhalten natürliche Belichtung durch obere LichtbänGemeinschaftsbereich unterstützen die Aufenthalsqulität. der in den Trennwänden, die Privatsphäre gewährleistet ist. Die Küchenzeile istwodurch als Teeküche zu verstehen. Küche Sitzstufen und Panoramafenster Gemeinschaftsbereich unterstützen und Sanitärraume sind imimbestehenden Gebäude untergedie Aufenthaltsqulität. Die Küchenzeile ist alsDach Teeküche zuim verstehen. bracht. Terrassenbereiche auf dem und 3 Stock Küche und Sanitärraume sind im bestehenden Gebäude untergeermöglichen den Bezug nach außen. bracht. Terrassenbereiche auf dem Dach und im 3. Stock ermöglichen den Bezug nach außen. gung gestellt, sowie Wohnräume für die Studenten geschaffen. Um den parasitären Gedanken zu stärken setzt sich der Anbau bewußt durch seine plastische Form von der städtebaulichen Umgebung ab, fügt sich aber dennoch durch Positionierung, Größe und Materialität ein. Der anbau ist ekto-, wie auch endoparasitär zu verstehen, da er die Körperoberflächen des Bestandsgebäudes nutzt und seine beiden außen liegenden Volumen mit einem im inneren schwebenden Verbindungsgang verknüpft. Der konzeptionelle Gedanke hierbei ist die beiden Kantergebäude durch weitere Erschließugsebenen (barrierefrei) vom 2 - 3 Stock zu verbinden und sie somit klar optisch und funktional zu vereinen. Südansicht 184 Wohnmodul 185 Modul 5.2 Theorie Gestalten Prof. Siegfried H. Bucher Endstation Sehnsucht von Tennessee Williams. Bühnenbild 186 Aufgabe ist der Entwurf eines Bühnenbildes. Das Seminar beinhaltet die allgemeine Theorie des Theaters im 20.Jhdt., die Analyse des Textes: Endstation Sehnsucht von Tennessee Williams, die Konzeption, den Entwurf und den Modellbau des Bühnenbildes im Maßstab 1: 20 und den Besuch der Aufführung von Endstation Sehnsucht an den Kammerspielen in der Neuinszenierung von Sebastian Nübling. Bühne und Kostüme von Muriel Gerstner im Januar 2010. Inhalt des Stückes: Die Lebensverhältnisse des einstigen SüdstaatenGeldadels sind längst passe, die Reste des Familienbesitzes der Schwestern DuBois unlängst unter den Hammer gekommen. Als Blanche DuBois auch ihre Anstellung als Lehrerin verliert, macht sie sich auf, ihre jüngere Schwester zu besuchen und sich auf unbestimmte Zeit bei ihr einzuquartieren. Stella lebt mit ihrem Mann, dem polnischen Einwanderer Stanley Kowalski, in beengten Wohnverhältnissen. Während sich Stella von der triebhaften, pulsierenden und zerstörerischen Kraft seiner Liebe mitreißen lässt, kann sich Blanche von den sozialen Wertvorstellungen und Attitüden ihrer besseren Herkunft nicht freimachen. Das Milieu der Verlierer ist ihr zuwider. So gibt sie sich fortgesetzt träumend als etwas Besseres aus, eine Meisterin der Vorspielung falscher Tatsachen. Nur dass die Taschenspielertricks der vermeintlich Elitären von Kowalski und seinen Pokerfreunden durchschaut und verabscheut werden. Die Absteiger von oben begegnen dem rohen, energischen Aufstiegswilligen von unten. Blanches letzte Hoffnung auf irgendwie gehobene und geordnete Verhältnisse ist die Ehe mit dem schüchternen Mitch. Doch als Kowalsky diese Verbindung kappt, gibt es kein Halten mehr ... Auszug aus der Ankündigung der Münchner Kammerspiele zur Spielzeit 2009/2010 Literatur: Tennessee Williams. Endstation Sehnsucht. Drama in drei Akten. Fischer Taschenbuch Verlag 2008. (7,95 Euro) Muriel Gerstner. Zu bösen Häusern gehen – Number Nine Barnsbury Road, Soho. Christoph Merian Verlag 2007 Eleonora Louis. Kunst auf der Bühne. Les grands spectacles II. Katalog Museum der Moderne Salzburg 2006 K.Lazarowicz und C.Balme. Texte zur Theorie des Theaters. Reclam 2003 Architekturmuseum TU München. SchauSpielRaum. Theaterarchitektur 2003 187 Bühnenbild Theaterstück „Endstation Sehnsucht“ in dem drama gestaltet tennesse williams ein schicksal aus dem leben der gegenwart, das der hilflosen blanche dubois, die durch enttäuschung um ihr glück betrogen wurde. er hat sie mit klarem wirklichkeitssinn, der mit dem dichterischen empfinden gepaart ist, dargestellt. die spannung der handlung und die vibrierende atmosphäre des stückes teilt sich dem leser nicht weniger mit als dem zuschauer im theater oder im kino. nun ist die aufgabe eine neue moderne atmosphäre für diese bühne aus den 40er jahren zu schaffen. die leitidee besteht darin, den zuschauer in die welt der verwirrten blanche einblick zu gewähren. dadurch entsteht eine illusionistische abstrahierte nicht reale welt. die wahrnehmung des betrachters soll beansprucht werden und in die irre führen, für den zuschauer soll eins plus eins nicht gleich zwei sein, alles wird in frage gestellt und die sinnesfrage soll bewusst angestrebt werden. wie die darstellerin blanche sich in ihrer welt verliert, genauso soll sich das publikum in der bühne verlieren. die betrachtung ist maßgebend, es sollen keine gewöhnlichen gegenstände auftreten da das auge gewöhnliches gewohnt ist. die zuschauer sollen durch gegenstände nicht beeinflusst werden oder gar abgelenkt, was zählt ist die bühne an sich und der dialog der darstellenden. die fantasie und wahrnehmung soll angeregt werden. illusionäre räume werden geschaffen. durch einige ansätze ist ein korbgeflecht entstanden. welches die gesamte sichtbare bühne einnimmt, den gesamten raum in ein netz verwandelt in dem blanche eingefangen ist. sie ist mit hoffnung nach new orleans zu ihrer schwester um vielleicht neu anzufangen, nachdem sie ihren familienbesitz verloren hatte und allein geblieben ist, wandte sie sich an ihre schwester, die nach der hochzeit mit stanley kowalski in ganz einfachen verhältnissen lebt. hier wollte sie abschalten und den verlust des großen besitzes ihrer schwester stella beichten. nun ist sie gefangen und kommt aus ihrer seelischen zerstörung nicht mehr heraus, sie wird durch den psychischen druck noch depressiver als zuvor, zusätzlich belastet sie der selbstmord ihres homosexuellen ehemannes. dazu kommt der psychoterror von stanley der mit blanche absolut nicht klarkommt. der homosexuellle Ehemann spiegelt den die lebensweise von teneesse williams wieder, der im wahren leben ebenfalls schwul war, und damit große probleme in der öffentlichkeit hatte. diese probleme und ausweglosen situationen spiegeln sich in dem geflecht wieder und stellen die ausweglosigkeit des charakters dar. blanche ist gefangen in einem netz von problemen, und in diesem netz darf sie sich auf der bühne präsentieren. dramaturgie in den einzelnen szenen wird durch verschiedene lichverhältnisse dargestellt und verstärkt, vor allem während des nervenzusammenbruchs von blanche dubois. im hintergrund soll ein bewegtes mediales bild zusätzlich für bewegung und verwirrung sorgen. dieser bereich kennzeichnet den straßenraum hinter der 2-zimmer wohnung von stella und stanley. blanche ist aus der realität verrückt! badezimmer und veranda + treppe sind zufluchtsorte für blanche, orte wo sie sich in ihrer heilen welt befindet, ihre Probleme vergisst und verdrängt und ihre strapazierten nerven beruhigt,diese orte sind dargestellt als geflechtsmauer, wie ein klettergerüst, wo sie mit mühe diese orte der illusionären beruhigung erreichen kann, sie muss sich nicht nur geistig sondern auch körperlich auf der bühne beanspruchen, um die heile welt für einen kurzen moment zu erreichen um danach die realität vor augen zu führen. 188 Burcin Eshaghi Farahmand GLEICHUNG FÜR DIE ENTWURFSIDEE: -bühne = körperliche anstrengung <-> inhaltlich seelisch anstrengend. ERSTES ENTWURFSMODELL -horizontales undvertikales element sehr dominant -das wandelement fällt aus dem system heraus, es hat eine andere struktur -> geflecht ZWEITES MODELL -wandelement wird aufgegriffen und in den kompletten bühnenraum integriert und eingebettet -horizontale und vertikale elemente werden eleminiert 189 Modul 5.2 Theorie Gestalten Prof.Dr. Franz Xaver Baier Architektur mitten im Leben 190 Multikulturelles Jugendzentrum (MKJZ) „Architektur mitten im Leben“ heißt ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Multikulturellen Jugendzentrum (MKJZ), einer städtischen Einrichtung in Trägerschaft des Kreisjugendring München-Stadt (KJR), und der Fakultät Architektur der Hochschule München. Ismail Sahin, der Leiter des Jugendzentrums, hatte den Architekturprofessor Franz Xaver Baier gebeten, Maßnahmen zur Verbesserung der architektonischen Bedingungen des Jugendzentrums zu unterstützen. Da Architekturstudenten in ihrer Ausbildung eher wenig Kontakt haben zu konkreten Menschen und ihren Bedürfnissen - denn in der Regel lernen sie ohne diesen Kontakt auszukommen und sich an abstrakte Programme auf Papier zu halten - sollte das einmal anders gemacht werden. So kam die Anfrage von Ismail Sahin gerade recht. Nach einem Workshop, welchen die Architekturstudenten mit Kindern und Jugendlichen durchführten, werden nun einige Ergebnisse im Jugendzentrum der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Ergebnis der Zusammenarbeit zeigt ein vielfältiges Spektrum an Fragen und Themen. Fragebogenaktionen zur kulturellen Herkunft und dem Bedürfnis nach entsprechendem architektonischen Ausdruck werden ebenso angesprochen wie Fragen nach den Lieblingsfarben, nach wünschenswerten Räumen und Verwirklichungsmöglichkeiten. Bauherren - Architektenspiele boten Jugendlichen die Möglichkeit selbst über Architektur zu bestimmen. Eine Exkursion an ausgewählte Orte der Münchner Architekturszene regte die Raumfantasie an. Konkrete Korrekturen und Verbesserungsvorschläge der bestehenden Einrichtung des Jugendzentrums und der Organisation werden thematisiert. Und nicht zuletzt wurden Flyer gestaltet und persönliche Kontakte weitergegeben, um Unterstützung und Sponsoren zu gewinnen. Mit den ausgestellten Ergebnissen maßen wir uns nicht an, ideale Lösungen zu präsentieren. Es ist ein vorläufiges Ergebnis, ein Anreiz, vielleicht nur für engagierte Architekten und Menschen, welche nicht so sehr an medienwirksamen Prestigeobjekten interessiert sind, sondern an gesellschaftlichen humanen Modellen des Zusammenlebens, des sich gegenseitig Respektierens, Förderns und Entfaltens. (Auszug aus dem Pressetext) 191 Architektur mitten im Leben 192 Gruppenarbeit 193 Modul 5.3 Baukonstruktion VI Modul 6.2 Okologie II Prof. Jörg Henne Prof. Clemens Richarz LB Peter Zarecky LB Medin Verem Haus des Schriftstellers 194 Im Rahmen der Studienarbeit sollte ein bestehendes Wohngebäude aus den 50er-Jahren energetisch saniert und durch einen Dachausbau erweitert werden. Dabei war der aufgrund der geringen Höhe nicht nutzbare Dachraum abzubrechen und durch einen neuen Dachaufbau zu ersetzen. Nach dieser Erweiterung sollte das bisher als Einfamilienhaus genutzte Gebäude in ein Dreifamilienhaus aufgeteilt werden. Dies hatte Auswirkungen auf die Vertikalerschließung, die Anordnung der Nassräume und den technischen Ausbau. Die Struktur des neuen Dachaufbaus war so zu entwickeln, dass die Lasten optimal d. h. möglichst auf dem direkten Wege in die vorhandene Konstruktion abgeleitet werden kann. Die Entwicklung der architektonischen Konzeption sollte unter Einbeziehung energetischer Fragestellungen erfolgen. Das Erreichen einer insgesamt gesehen architektonisch hochwertigen Lösung war übergeordnetes Ziel, wobei die Bauaufgabe mit angemessenen konstruktiven Mitteln zu lösen war. In diesem Sinne greifen in diesem Modul regelmäßig Überlegungen zur Konstruktion, zur Einbeziehung geeigneter Werkstoffe sowie die Überlegungen zu ökologisch und ökonomisch sinnvollen Lösungen ineinander. 195 das Haus des Schriftstellers Esther Marquardt, Stefanie Rott, Sarah Tebrake Gegenstand der Aufgabe ist ein großzügiges Einfamilienhaus aus den 50er Jahren am Stuttgarter Killesberg. Es soll ein zusätzliches Geschoss in Form eines Dachaufbaus erhalten und dabei gleichzeitig eine energetische Optimierung erfahren. Die von uns gewählten Zielsetzungen sind dabei zunächst der Passivhaus- und in einem weiteren Schritt der Zerohausstandard (Nullemissionsgebäude). Beides sind Zertifikate,welche hohe Anforderungen an die Qualität der Gebäudehülle und an die der Haustechnik stellen. ENTWURF Der bestehende Grundriss wurde so umgebaut, dass eine etagenweise Nutzung mit drei getrennten Wohnungen möglich wurde. Im Zuge der notwendigen Erneuerung der Haustechnik wurden die Installationen für Küchen und Bäder in einem Kern gebündelt, die sich im Grundriss jeweils als „eingestellte Box“ zeigt. Großen Wert wurde auf einen offenen Grundriss und eine flexible Nutzungsmöglichkeit der Räume gelegt. Zugleich war eine zurückhaltende, schlichte Architektursprache wichtig, die den klar strukturierten Bestand nicht in den Hintergrund drängt. Lageplan KONSTRUKTION Der Altbau sollte so wenig wie möglich verändert werden,um Aufwand und Kosten gering zu halten und zugleich die Identität des Gebäudes zu wahren. Daher entschied man sich dafür, das neue Dachgeschoss als Leichtbaukonstruktion (in Holzständerbauweise) auszuführen. Auf diese Weise ergibt sich gestalterisch und konstruktiv eine klar erkennbare Trennung zwischen neu und alt - beides harmoniert jedoch sehr gut miteinander. Die Fassade besteht aus perforierten Metallpaneelen, die sich wie eine dünne Haut über die kompette Oberfläche des Aufbaus legen. Die Südseite wurde großzügig geöffnet um den Blick über den Stuttgarter Talkessel freizugeben. ANLAGENTECHNISCHE MASSNAHMEN Grundlegende Überlegungen befassten sich mit der Kombination des Anlagensystems. Wir entschieden uns für eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe, da sie in Bezug auf die Zielsetzung Nullemissionshaus die besten Werte erbringt. In einer Alternativplanung, die auch die wirtschaftlichen Aspekte berücksichtigt, wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich für den nachträglichen Einbau in ein Bestandsgebäude oftmals eine Luft-Wasser-Wärmpumpe besser eignet, da sie keine Eingriffe ins Grundstück erfordert (keine Brunnenbohrungen nötig). Zudem ist sie wesentlich kostengünstiger - hier muss also je nach Zielsetzung individuell abgewogen werden. In Bezug auf die Abwasser-/Sanitärplanung wurde ein ökologisches Wasserkonzept mit Grauwassernutzung entwickelt. Es sieht eine Trennung von stark bzw. schwach verschnutztem Abwasser vor. Letzteres wird in der im Keller befindlichen Grauwasseranlage wiederaufbereitet und kann anschließend wieder verwendet werden. Für das Heizsystem (s. u.) wurden auf dem Dach des Gebäudes Vakuum-Röhrenkollektoren installiert. Sie werden zur Trinkwassererwärmung eingesetzt, sie können aber bei Bedarf auch zur Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Für das Nullemissionslabel werden zusätzliche Photovoltaik-Kollektorflächen im Garten eingerichtet: um den Zerohaus-Standard erfüllen zu können, muss der tatsächlich vorhandene Energieverbrauch des Gebäudes inklusive Warmwasser, Verteilverluste und Stromverbrauch vom Betreiber nachweislich vollständig regenerativ gedeckt werden. Bestand Ansicht Süd 196 A Lüftung Grauwasser C C BA DN 100 WP Pufferspeicher Kombipufferspeicher A Kellergeschoss 16,90 6,145 1,735 1,76 1,51 3,865 1,76 7,035 5,50 12 4,88 30 20 B 30 A 30 30 40 B 90 20 20 A 20 Bad 10,40 Diele Kochen 24 10,40 Bad 1,00 1,50 25 Diele 25 WC Arbeiten 3,68 2,645 1,035 WC Arbeiten 1,01 2,01 1,01 2,01 1,035 1,76 1,51 1,76 1,51 B 5,72 C 30 C C 4,705 5,695 C 6,805 Kochen Schlafen Wohnen 20 A B 20 Loggia Obergeschoss Schlafen 16,50 Wohnen 20 93 30 46 2,50 3,865 1,89 B A Terrasse 1,76 1,51 2,515 12 7,73 1,57 1,76 1,76 1,51 1,735 6,715 1,76 4,025 1,26 30 12 5,30 4,90 3,705 30 46 20 6,895 1,76 1,51 2,615 46 46 A B 16,90 Küche C C Terrasse Wohnen A B 46 Schlafen 6,465 9,075 Erdgeschoss 10,00 Bad Dachgeschoss 46 1,135 Ansicht Nord 3,62 18 2,00 1,125 3,955 3,955 6,955 18 955 69 6,18 Ansicht Ost 197 KALZIP das haus eines schriftstellers esther marquardt I stefanie rott I sarah tebrake schnitte II I_20 BAULICHE OPTIMIERUNG WANDAUFBAUTEN +10.00 WÄRMESCHUTZ WINTERLICH UND SOMMERLICH Der winterliche Wärmeschutz hat den Zweck, während der Heizperiode an den Innenoberflächen der Bauteile eine ausreichend hohe Oberflächentemperatur zu gewährleisten und damit Oberflächenkondensat bei +8.75 in Wohnräumen üblichem Raumklima auszuschließen. +8.35 Die Wandaufbauten, ausgeführt als Holzständerkonstruktion mit ResolHartschaumplatten nach neuestem Stand der Technik (Lamda = 0,021 W/mK) sind sehr leistungsfähig. Die potenziellen Problempunkte wurden in einer detaillierten Wärmebrückenuntersuchung marquardt I stefanie rott I sarah näher betrachtet (s.u.). tebrake 1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 10 chriftstellers 1 2 +6.30 +6.00 3 4 5 6 7 schnitte I I_20 +5.80 Der sommerliche Wärmeschutz dient dazu, die durch Sonneneinstrahlung verursachte Aufheizung von Räumen so weit zu begrenzen, dass ein behagliches Raumklima gewährleistet wird. In der Regel ist die Raumhitze auf eine Einstrahlung der Sonne durch die Fenster zurückzuführen. Nach Möglichkeit sollte dabei aus ökologischen Gründen auf den Einsatz von Kimaanlagen verzichtet werden. Für die Berechnung des Sonneneintragswertes muss jeweils der „kritischste Raum“ ausgewählt werden, das heißt, der Raum mit der größten Fensterfläche bezogen auf die Grundfläche, da hier die größten Sonneneintragswerte zu erwarten sind. ( Bei großen Räumen ist die anzusetzende Raumtiefe zu begrenzen.) In diesem Fall wird das Schlafzimmer des Erdgeschosses betrachtet. +10.00 +8.75 +3.25 +3.10 +2.90 +8.35 +6.30 +6.00 +5.80 +0.16 +0.00 teilansicht 3. Dampfsperre (PE- Folie) 4. Dämmung (Resol) 5. KVH Fichte (zwischengedämmt) 6. Dämmung 7. Unterdach +3.25 -2.40 DACHAUFBAU: 1. Gipskarton +3.10 +2.90 9. Rauspundschalung 11. Kalzipdeckung 12,5 mm 20 mm 200 mm 200 mm 100 mm 50mm 50/50 mm 24 mm 3 mm BODENAUFBAU: 2. Estrich 3. PE- Folie Fenster AHF 105 5. Dämmung (Mineralwolle) 6. Stahlbeton 7. Putz WANDAUFBAU Neubau: 1. Gipskarton +0.16 +0.00 Detailansicht 5. Dämmung (Resol) 6. KVH (zwischengedämmt) teilansicht 3. Dampfsperre (PE- Folie) 4. Dämmung (Resol) 5. KVH Fichte (zwischengedämmt) 6. Dämmung Resol 7. Unterdach 9. Rauspundschalung 11. Kalzipdeckung 10. Kalzipverkleidung 12,5 mm 20 mm WANDAUFBAU Bestand: 1. Innenputz 2. Mauerwerk (Ziegel) 3. Außenputz 4. Wärmedämmverbundsystem 5. Wärmedämmung Resol 6. Außenputz 200 mm 200 mm 100 mm 50mm 50/50-2.40 mm 24 mm 3 mm BODENAUFBAU: 198 25 mm 180 mm 200 mm 15 mm 14 mm 60 mm 30 mm 240 mm 240 mm 30 mm 8. PE- Folie DACHAUFBAU: 1. Gipskarton Horizontalschnitt 30 mm 45 mm 2. Estrich 3. PE- Folie 5. Dämmung (Mineralwolle) 6. Stahlbeton 7. Putz WANDAUFBAU Neubau: 1. Gipskarton 5. Dämmung (Resol) 6. KVH (zwischengedämmt) 30 mm 45 mm 25 mm 180 mm 200 mm 15 mm 14 mm 60 mm 30 mm 240 mm 200 mm Detailschnitt BODENAUFBAU Balkon: 1. Gartenrost 2. Kies 3. PE- Folie 4. Dämmung 5. Abdichtung 6. Stahlbeton 7. Dämmung 40 mm 8. Außenputz 3 mm 15 mm 240 mm 20 mm 200 mm 8 mm 40 mm 40 mm 30 mm 20 mm 200 mm 8 mm V WÄRMEBRÜCKEN Im allgemeinen Sinne ist eine Wärmebrücke der Bereich eines Außenbauteils bzw. einer Konstruktion, in dem ein erhöhter Energieabfluss vorliegt. Es wird unterschieden zwischen konstruktiven, geometrischen und materialbedingten (stofflichen) Wärmebrücken. Erstere entstehen durch Konstruktionen mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit. Beispiele hierfür sind z. B. Stahlbetondeckenverbund zu Außenwänden, Ringanker, Heizkörpernischen. Geometrische Wärmebrücken ergeben sich durch Versprünge oder Ecken in einem ansonsten homogenen Bauteil, wenn der Innenfläche eine größere Außenfläche, durch die die Wärme abfließt, gegenüber steht. Materialbedingte Wärmebrücken liegen dann vor, wenn in Wärmestromrichtung unterschiedliche Baustoffe im Querschnitt liegen. Beispiele hierfür sind z. B. eingelassene Stahl- träger; Betonsturz in Klinkerwand. Im Bereich von Wärmebrücken sinkt bei kalten Außentemperaturen die raumseitige Oberflächentemperatur von Bauteilen stärker ab als in den „Normalbereichen“. Bei Unterschreiten der Taupunkttemperatur fällt Tauwasser aus und somit besteht die Gefahr von Schimmelbildung. Diese tritt nicht erst bei Tauwasserausfall, sondern bereits bei einer (durch die Oberflächentemperatur bedingten) relativen Luftfeuchte von 80 % an der Bauteiloberfläche auf (div. Schimmelpilze bereits bei 70%). Aufgrund des inneren Wärmeübergangswiderstandes der Wand kann das bereits bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 % der Raumluft der Fall sein. Wärmebrücken führen zu höherem Transmissionswärmebedarf und damit zu höherem Heizwärmebedarf / Heizkosten. PROBLEM: Die Wärmeleitfähigkeit des Alufensters in Kombination mit dem abenfalls in Aluminium ausgeführten Winkel ist sehr gut, das bedeutet hier liegt eine Wärmebrücke vor, die es zu minimieren gilt. Die markierte Linie stellt dabei die 12,6 Grad- Isotherme dar. Bestandszustand Psi-Wert: -0,44W(mK) VERBESSERUNG/ERKENNTNISSE: - Änderung Alufenster zu Holz-Alu-Fenster - Änderung des Winkels von Aluminium zu Edelstahl Es macht nur einen kleinen Unterschied den Winkel in Edelstahl auszuführen. Da die Wärmebrücke nicht allzu schlecht ist, wird das Ergebnis über bessere Wärmebrückenergebnisse kompenisert. Psi steigt, je besser das Regelbauteil wird, denn Psi ist relativ, d. h. die Differenz zum Regelbauteil. Der nominale Psi-Wert sagt also nichts über die Güte der Konstruktion aus. Variante 1 199 =7°C; tVorl,max=35°C) Vorl,max=55°C) 3<Δ 4K M anlagenschema Δ ng eingeben) empfohlene Auslegung mit Zwischenwärmetauscher (t Wasser,ein =7°C; tVorl,max=55°C) 0,795 Δ ben) 600 W 2160 W FΔ 1,031 - FP 1,278 - < 10 K Temperaturdifferenz am Verflüssiger bei der Prüfstandsmessung 3 < ΔB < 10 K 7K B PP PWP M Temperaturdifferenz am Verflüssiger im konkreten Projekt Antriebsleistung der Wärmequellenpumpe (oder Wert F P direkt eingeben) Antriebsleistung der Wärmepumpe (oder Wert F P direkt eingeben) oder vereinfacht FΔ = 1,000 Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe; Wert für Vorplanung ; Wert für Vorplanung 1,140 Wert für Vorplanung; P WP > 20 kW 1,200 Wert für Vorplanung; 10 kW < P WP < 20 kW Wert für Vorplanung; P WP < 10 kW 1,250 βW 3,92 - Jahresarbeitszahl Brauchwassererwˇrmung Verteiler 2.OG FL Hoval Fußbodenheizung 12 Abgänge 35/28 Verteiler 1.OG 12 Abgänge 35/28 ZU ZU Wohnen/ Arbeiten/ Schlafen zu weiteren Räumen AB Hoval Fußbodenheizung 12 Abgänge 35/28 Hoval Thermalia 15 Verteiler Zuluft 5 Ventile Telefonieschalldämpfer Valloflex Hoval Fußbodenheizung Verteiler EG Wärmepumpe: AU Hoval Solamax Vakuumröhrenkollektor 15,92 m2 GEBA Brandschutz Deckenschott AVR DG Kellerdecke K90 eb an Heizung und Warmwasserbereitung WC/Bad AB Verteiler Abluft 4 Ventile K90 K90 K90 ZU en Energieträgern zu weiteren Räumen LÜFTUNG Das Lüftungssystem sieht eine zentral gesteuerte Wohnraumlüftung 1.OG vor, d. h. eine Absaugung der Abluft in Küche und Nassräumen und eine Einblasung der Zuluft in den Aufenthaltsräumen.Beide Luftmengen sind gleich, auf diese Weise bleibt der Luftdruck konstant. Außenluft wird zentral überEG Dach angesaugt, die Fortluft hier abgeführt. Die Installation befindet sich in einem Lüftungsschacht, der Brandschutz wird mit Deckenschotts gewährleistet. Im EG und im 1. OG werden die Zu-und Abluftrohre in der abgehängten Decke (Flur) verlegt, im DG im Bodenaufbau. KG HEIZSYSTEM Das geplante Heizsystem besteht aus einer Wasser-Wasser-WärmepumKombispeicher pe, einem Pufferspeicher zur Trinkwassererwärmung (solar unterstützt CombiSol 1000 mit Vakuumröhrenkollektoren) und einem zweiten Pufferspeicher, der WP Hoval das Warmwasser für die Fußbodenheizung (s.o.) bereithält. Für die WärThermalia R407C (15P) mepumpe wurden im Garten ein Entnahmeund ein Schluckbrunnen Pufferspeicher installiert. Mit diesem System lassen sich auch Spitzenlasten abdecken, Wärmequelle Grundwasser ohne dass eine elektrische Nacherhitzung nötig wird. das haus eines schriftstellers kt bei –5°C; aus Tabelle 8 VDI 4650) unkt bei –5°C; aus Tabelle 8 VDI 4650) AB K90 K90 K90 K90 ZU zu weiteren Räumen esther marquardt I stefanie rott I sarah tebrake Schluckbrunnen AB K90 Förderbrunnen Wˇrmequelle Grundwasser εN 5,70 - F 1,068 1,068 Anlagenschema Lüftung 1,011 Anlagenschema Heizsystem Hoval Solamax Vakuumröhrenkollektor 15,92 m2 M Δ B PP detaillierte berechnung der anlagenverluste AU 4K 3<Δ M < 10 K 7K 3<Δ B < 10 K 1,031 - FP 1,278 - Leistungszahl der Wärmepumpe bei W10/W35 (Herstellerangabe COP) εN 5,70 - Korrekturfaktor für verschiedene Quellen- und Vorlauftemperaturen (aus Tabelle 2 oder 3 VDI 4650) F 0,853 - in der Broschüre nachzulesen Leis Kor 0,853 emp empfohlene Auslegung mit Zwischenwärmetauscher (t Wasser,ein =7°C; tVorl,max=35°C) 0,795 emp Δ M Δ B PP Temperaturdifferenz am Verflüssiger bei der Prüfstandsmessung Temperaturdifferenz am Verflüssiger im konkreten Projekt 1,140 FL < 10 K 4K 3<Δ 7K 3 < ΔB < 10 K M Tem Tem Ant 600 W PWP 2160 W Ant FΔ 1,031 - ode FP 1,278 - Kor oder vereinfacht FΔ = 1,000 1,140 We Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe; Wert für Vorplanung 1,200 We Wert für Vorplanung; P WP > 20 kW 1,250 Wert für Vorplanung; 10 kW < P < 20 kW 1,200 - zentralHoval gesteuerte kontrollierte Wohnraum Wert für Vorplanung; P < 10 kW 1,250 lüftungVakuumröhrenkollektor 15,92 m Verteiler 1.OG β 4,91 Jahresarbeitszahl Heizbetrieb - AbsaugungHoval der Abluft in den Sanitärräumen 12 Abgänge 35/28 Fußbodenheizung und in der Küche und eine Einblasung der Verteiler 2.OG Hoval Diele Zuluft in den Wohn-und Aufenthaltsräumen 12 Abgänge 35/28 Verteiler EG Fußbodenheizung GF 8,31 m² Hoval Verteiler Zuluft Telefonieschalldämpfer 12 Abgänge V 21,41 m² 5 Ventile - 80 %35/28 der Wärmeenergie aus der Abluft rück Valloflex Fußbodenheizung Verteiler 1.OG ZU Hoval ZU Wohnen/ Kellerdecke gewinnen 12 Abgänge 35/28 Fußbodenheizung Arbeiten/ zu weiteren Schlafen Räumen - Außenluft wird zentral übers Dach angesaugt Verteiler EG AB Hoval GEBA 12 Abgänge 35/28 die Fortluft wird über dem Dach abgeführt Brandschutz Fußbodenheizung Deckenschott Verteiler Abluft Jahresarbeitszahl Heizbetrieb Jahresarbeitszahl Heizbetrieb Jahresarbeitszahl Brauchwassererwˇrmung Jahresarbeitszahl Brauchwassererwˇrmung Kellerdecke - Im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss AVR DG 4 Ventile ε F F ε F F ε F F ε F F Wˇrmequelle Grundwasser Wˇrmequelle Grundwasser Gleichung 1 Gleichung 1 Wˇrmequelle Grundwasser Wˇrmequelle Grundwasser Gleichung 3 Gleichung β = β = β = 3 β = Gesamt-Jahresarbeitszahl Essen F F F 1 werden die Zu- und Abluftrohre in der im F K90 K90 K90 K90 β = Gleichung 6 GF 22,6 m² α α ε ε ε x +y +1−α 5,70 5,70Leistungszahl der Wärmepumpe Leistungszahl bei W10/W35 der Wärmepumpe (Herstellerangabe bei W10/W35 COP) (Herstellerangabe COP) 5,70 der Wärmepumpe Leistungszahl bei W10/W35 der Wärmepumpe (Herstellerangabe bei W10/W35 COP) (Herstellerangabe COP) ZU Vε 62,2 m²5,70Leistungszahl zu weiteren Flurbereich abgehängten Decke verlegt β β Zuluft 16 m³/h F F F F Räumen 1,068 1,068Korrekturfaktor für verschiedene Korrekturfaktor Quellen- für undverschiedene Vorlauftemperaturen Quellen-(aus und Tabelle Vorlauftemperaturen 2 oder 3 VDI 4650) (aus Tabelle 2 oder 3 VDI 4650) 0,853 0,853Korrekturfaktor für verschiedene Korrekturfaktor Quellen- für undverschiedene Vorlauftemperaturen Quellen-(aus und Tabelle Vorlauftemperaturen 2 oder 3 VDI 4650) (aus Tabelle 2 oder 3 VDI 4650) Kombispeicher =10°C; t =35°C) =10°C; t =35°C) =10°C; t =55°C) =10°C; t =55°C) empfohlene Auslegung (t empfohlene Auslegung (t empfohlene Auslegung (t empfohlene Auslegung (t 1,068 1,068 0,853 - Im Dachgeschoss bietet eine Verlegung CombiSol 1000 sich0,853 =7°C; t =35°C) =7°C; t =35°C) =7°C; t =55°C) =7°C; t =55°C) empfohlene Zwischenwärmetauscher Auslegung mit(tZwischenwärmetauscher (t empfohlene Zwischenwärmetauscher Auslegung mit(tZwischenwärmetauscher (t 1,011 1,011Auslegung mitempfohlene 0,795 0,795Auslegung mitempfohlene α 1Deckungsanteil der Wärmepumpe im monoenergetischen Betrieb an Heizung und Warmwasserbereitung AB im Fußbodenaufbau an. Hier wird der Platz =10°C; t =55°C) =10°C; t =55°C) BAFA-Nachweis (t BAFA-Nachweis (t 0,853 0,853 1,00 bei monovalentem oder bivalentem Betrieb mit unterschiedlichen Energieträgern =7°C; t =55°C) =7°C; t =55°C) Kombispeicher 10 K BAFA-Nachweis mit Zwischenwärmetauscher BAFA-Nachweis mit(tZwischenwärmetauscher (t 3 < Δ <Hohlraumboden 3 < Δ < 10 Kam Verflüssiger Δ Δ Temperaturdifferenz der Prüfstandsmessung am Verflüssiger bei der Prüfstandsmessung 0,795 0,795 4K 4Temperaturdifferenz K unter dem verbauten fürbeidie 1.OG 0,98 bei bivalent parallelem Betrieb, monoenergetisch (Bivalenzpunkt bei –5°C; aus Tabelle 8 VDI 4650) WP Verteiler 2.OG Gle empfohlene Auslegung (tWasser,ein =10°C; tVorl,max=35°C) Antriebsleistung der Wärmepumpe (oder Wert F P direkt eingeben) 2.160 W FΔ Wˇrmequelle Grundwasser FP Antriebsleistung der Wärmequellenpumpe (oder Wert F P direkt eingeben) 600 W PWP Jahresarbeitszahl Brauchwassererwˇrmung εN F F Δ BAFA-Nachweis mit Zwischenwärmetauscher (tWasser,ein =7°C; tVorl,max=55°C) 0,795 Δ βh = BAFA-Nachweis (tWasser,ein =10°C; tVorl,max=55°C) 0,853 anlagenschema anlagentechnik Hoval HomeVent Gleichung 1 RS 250 Jahresarbeitszahl Heizbetrieb 10-15 m K90 K90 K90 We WP Hoval Solamax 12 Abgänge 35/28 Fußbodenheizung βW WP 3,92 - Jah 2 til AS H nachweis des cop der wärmepumpe Zuluftventil ZAW 100AS N h Δ N h P Δ N W Δ P W N - Wasser-Was wasserbereit - Kombispeich - Pufferspeich - Trink-Warmw Wärmepumpe: speicher Hoval Thermaliaunte 15 - Warmwasser ferspeicher - Solaranlage bispeicher zu kann zusätzli - Lüftung siehe WC/Bad/Küche AB Δ P P WP N N N N h Wasser,ein Vorl,max Wasser,ein Vorl,max Wasser,ein Wasser,ein Vorl,max Wasser,ein M 4K 3 <MΔ Δ M < 10 K Δ B 7K Δ 3 <B Δ B < 10 K PP PWP P 600 W PWP 2.160 W FΔ 1,031 - FP 1,278 - Vorl,max Wasser,ein Vorl,max M CombiSol 1000 Hoval 3 < Δ M < 10 Kam Verflüssiger Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung am Verflüssiger bei der Prüfstandsmessung 4Temperaturdifferenz K Thermalia 3 < Δ B < 10 Kam Verflüssiger Temperaturdifferenz im konkreten am Projekt Verflüssiger im konkreten Projekt 7Temperaturdifferenz K R407C (15P) Δ Δ Δ M 600 W Vorl,max Wasser,ein Vorl,max M PP WP WP Δ Δ P 3 < ΔB < 10 K am Verflüssiger Temperaturdifferenz im konkreten am Projekt Verflüssiger im konkreten Projekt 7Temperaturdifferenz K K90 K90 der Wärmequellenpumpe Antriebsleistung(oder der Wärmequellenpumpe Wert F P direkt eingeben) (oder Wert F P direkt eingeben) 600Antriebsleistung W P Δ 20 kW Wert für Vorplanung; P WP >Wert für Vorplanung; P WP > 20 kW 1,140 βW 3,92 - 1,140 20 kW Wert für Vorplanung; P WP >Wert für Vorplanung; P WP > 20 kW 1,140 < 20 kW Wert für Vorplanung; 10 kW Wert < Pfür 10 kW < P WP < 20 kW 1,200 WP Vorplanung; K90 Förder4,91Jahresarbeitszahl Heizbetrieb Jahresarbeitszahl Heizbetrieb brunnen βH εN 5,70 - F 1,068 - Anlagenschema Heizsystem Gesamt-Jahresarbeitszahl Gesamt-Jahresarbeitszahl 1 1 = β WPGleichung β WP = 6 α α α α x +y +1−α x +y +1−α βh βW βh βW Gleichung 6 0,82 - Wärmepumpe: Wärmepumpe: Hoval Thermalia 15 Hoval Thermalia 15 1Deckungsanteil der Wärmepumpe Deckungsanteil im monoenergetischen der Wärmepumpe Betrieb im monoenergetischen an Heizung und Warmwasserbereitung Betrieb an Heizung und Warmwasserbereitung GF 6,1 m² 2,9 parallelem m² bei bivalent 0,98 parallelem Betrieb, beiGF bivalent monoenergetisch (Bivalenzpunkt Betrieb, monoenergetisch bei –5°C; aus (Bivalenzpunkt Tabelle 8 VDI bei4650) –5°C; aus Tabelle 8 VDI 4650) 0,91 bei bivalent 0,91 alternativem Betrieb, beiAbluft bivalent monoenergetisch alternativem Betrieb, bei –5°C; aus (Bivalenzpunkt Tabelle 8 VDI bei4650) –5°C; aus Tabelle 8 VDI 4650) Abluftmonoenergetisch 43 m³/h 23 m³/h (Bivalenzpunkt V 0,82 x V 8,15 m³ 17,31 m³ 0,18 y 0,18Anteil des 0,18Warmwasser-Wärmebedarfs Anteil des Warmwasser-Wärmebedarfs (empfohlener Anteil) (empfohlener Anteil) 4,70 - βWP 4,70Gesamt-Jahresarbeitszahl Gesamt-Jahresarbeitszahl 10 AU FL AB ε N F ZU FΔ βh = 9 Abluftventil ZAW 100AS εN F F Δ Gleichung 1 βh = rmequelle Grundwasser Wˇrmequelle Grundwasser Gleichung 1 FP ÜS ÜS FP Verteiler kasten εN εN 5,70Leistungszahl der Wärmepumpe Leistungszahl bei W10/W35 der Wärmepumpe (Herstellerangabe bei W10/W35 COP) (Herstellerangabe COP) Kochen 1,068Korrekturfaktor für verschiedene Korrekturfaktor Quellen- für undverschiedene Vorlauftemperaturen Quellen-(aus und Tabelle Vorlauftemperaturen 2 oder 3 KSD VDI 4650) (aus Zuluftventil SD 1003Tabelle 2 oder 3 VDI 4650) ZAW 100AS 1,011 empfohlene Zwischenwärmetauscher Auslegung mit(tZwischenwärmetauscher (t Wasser,ein =7°C; tVorl,max=35°C) 1,011Auslegung mitempfohlene Wasser,ein =7°C; tVorl,max=35°C) ÜS F Verteiler kasten tVorl,max=55°C) BAFA-Nachweis (tWasser,ein =10°C; BAFA-Nachweis (tWasser,ein =10°C; tVorl,max=55°C) 0,853 BAFA-Nachweis mit Zwischenwärmetauscher BAFA-Nachweis mit(tZwischenwärmetauscher (tWasser,ein =7°C; tVorl,max=55°C) 0,795 Wasser,ein =7°C; tVorl,max=55°C) εN F Zuluftventil ZAW 100AS Zuluftventil ZAW 100AS 3 <MΔ Δ Δ B 7K Δ 3 <B ΔB < 10 K 3 < Δ M < 10 Kam Verflüssiger Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung am Verflüssiger bei der Prüfstandsmessung 4Temperaturdifferenz K PP 600 W Δ B 7K Δ 3 <B Δ B < 10 K Wohnen 3 < Δ B < 10 Kam Verflüssiger Temperaturdifferenz im konkreten am Projekt Verflüssiger im konkreten Projekt 7Temperaturdifferenz K PWP 2160 W GF m² direkt eingeben) Antriebsleistung der Wärmequellenpumpe Antriebsleistung(oder der Wärmequellenpumpe Wert F P direkt eingeben) (oder Wert F P 18,2 600Schlafen W V 2 50,4 m³ P direkt eingeben) Zuluft 32 m³/h 2.160 W PWP 1(oder Wert F direkt eingeben) Antriebsleistung Antriebsleistung (oder Wert der FWärmepumpe 2.160GF W 18,2 m²der Wärmepumpe 1,031 - FΔ Zuluft 21 m³/h vereinfacht FΔ = 1,000 oder vereinfacht FΔ = 1,000 1,031oder - FP 1,278Korrekturfaktor zur Berücksichtigung Korrekturfaktor der Wärmequellenpumpe; zur Berücksichtigung der WertWärmequellenpumpe; für Vorplanung Wert für Vorplanung P V 4,91 - 50,51 m³ 3 FΔ 1,031 - FP 1,278 - M Korrekturfaktor für verschiedene Quellen- und Vorlauftemperaturen (aus Tabelle 2 empfohlene Auslegung (tWasser,ein =10°C; tVorl,max=55°C) empfohlene Auslegung mit Zwischenwärmetauscher (t Wasser,ein =7°C; tVorl,max=55°C) 3<Δ M < 10 K Temperaturdifferenz am Verflüssiger bei der Prüfstandsmessung 7K 3<Δ B < 10 K Temperaturdifferenz am Verflüssiger im konkreten Projekt Δ M Δ B < 10 K 4K 3<Δ 7K 3 < ΔB < 10 K PP 600 W PWP 2160 W FΔ 1,031 - FP 1,278 - M Temperaturdifferenz am Verflüssiger bei der Prüfstandsmessung Temperaturdifferenz am Verflüssiger im konkreten Projekt Antriebsleistung der Wärmequellenpumpe (oder Wert F P direkt eingeben) Antriebsleistung der Wärmepumpe (oder Wert F P direkt eingeben) Antriebsleistung der Wärmequellenpumpe (oder Wert F P direkt eingeben) 600 W PWP 2.160 W Antriebsleistung der Wärmepumpe (oder Wert F P direkt eingeben) FΔ 1,031 - oder vereinfacht FΔ = 1,000 1,140 Wert für Vorplanung; P WP > 20 kW FP 1,278 - Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe; Wert für Vorplanung 1,200 Wert für Vorplanung; 10 kW < P WP < 20 kW 1,140 Wert für Vorplanung; P WP > 20 kW 1,250 Wert für Vorplanung; P WP < 10 kW 1,200 Wert für Vorplanung; 10 kW < P WP < 20 kW 20 kW Wert für Vorplanung; P WP >Wert für Vorplanung; P WP > 20 kW 1,140 1,200 < 20 kW Wert für Vorplanung; 10 kW Wert < Pfür 10 kW < P WP < 20 kW 1,200 WP Vorplanung; WC GF 2,9 m² V 8,15 m² Wert für Vorplanung; P WP < 10 kW Jahresarbeitszahl Heizbetrieb Abluft 23 m³/h 4,91 - Bad GF 6,1 m² V 17,31 m² Abluft 43 m³/h βW βW Terrasse 3,92 - εN F FΔ Abluftventil ZAW 100AS FP ÜS Gleichung 6 β WP = AU FL AB Abluftventil ZU ZAW 100AS oder vereinfacht FΔ = 1,000 Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Wärmequellenpumpe; Wert für Vorplanun 3,92 - Jahresarbeitszahl Brauchwassererwˇrmung Abluftventil ZAW 100AS 1 x α α +y +1−α βh βW Verteiler kasten ZU Küche Abluft 42 m³/h Wärmepumpe: Diele GF 8,31 Hoval m² Thermalia 15 V 21,41 m² SD KSD 1003 Verteiler kasten α 1- Deckungsanteil der Wärmepumpe im monoenergetischen Betrieb an Heizung und Warmwasserbereitung 1,00 bei monovalentem oder bivalentem Betrieb mit unterschiedlichen Energieträgern 3 < Δ M < 10 Kam Verflüssiger Temperaturdifferenz bei der Prüfstandsmessung am Verflüssiger bei der Prüfstandsmessung 4Temperaturdifferenz K 0,98 bei bivalent parallelem Betrieb, monoenergetisch (Bivalenzpunkt bei –5°C; aus Tabelle 8 VDIZuluftventil 4650) 3 < ΔB < 10 K am Verflüssiger Temperaturdifferenz im konkreten am Projekt Verflüssiger im konkreten Projekt 7Temperaturdifferenz K 0,91 bei bivalent alternativem Betrieb, monoenergetisch (Bivalenzpunkt bei –5°C; aus Tabelle 8 VDI 4650) 0,82 Anteil des Heizwärmebedarfs (empfohlener Anteil) FΔ vereinfacht FΔ = 1,000 oder vereinfacht FΔ = 1,000 1,031oder - FP 1,278 Korrekturfaktor zur Berücksichtigung Korrekturfaktor der Wärmequellenpumpe; zur Berücksichtigung der WertWärmequellenpumpe; für Vorplanung Wert für Vorplanung Küche/Essen Zuluftventil ZAW 100AS x y βWP GFWert 22,6 m² 20 kW für Vorplanung; P WP >Wert für Vorplanung; P WP > 20 kW 1,140 V Wert 62,2 m³ < 20 kW für Vorplanung; 10 kW Wert < Pfür 10 kW < P WP < 20 kW 1,200 WP Vorplanung; Zuluft 16 m³/h 0,82 - ZAW 100AS Zuluftventil ZAW 100AS Schlafen 0,18 0,18 GF 18,2 m² V 50,51 m² 4,70 Zuluft 21 m³/h Anteil des Warmwasser-Wärmebedarfs (empfohlener Anteil) Gesamt-Jahresarbeitszahl Wohnen GF 18,2 m² V 50,4 m² Zuluft 32 m³/h Essen GF 22,6 m² V 62,2 m² Zuluft 16 m³/h 10 kW Wert für Vorplanung; P WP <Wert für Vorplanung; P WP < 10 kW 1,250 βW 3,92Jahresarbeitszahl Brauchwassererwˇrmung Jahresarbeitszahl Brauchwassererwˇrmung 2 Schlafen FP βW = 5 1,200 10 kW Wert für Vorplanung; P WP <Wert für Vorplanung; P WP < 10 kW 1,250 FΔ Dunstabzug der Wärmequellenpumpe Antriebsleistung(oder der Wärmequellenpumpe Wert F P direkt eingeben) (oder Wert F P direkt eingeben) 600Antriebsleistung W Umlufthaube, mit PWPFett-und 2160Antriebsleistung der Wärmepumpe Antriebsleistung (oder Wert der FWärmepumpe (oder Wert F P direkt eingeben) W P direkt eingeben) Aktivkohlefilter 1,250 4,91Jahresarbeitszahl Heizbetrieb Jahresarbeitszahl Heizbetrieb εN F Gleichung βW = 3 PP 1,140 1,140 βH FΔ FP 0,853 Zuluftventil Gesamt-Jahresarbeitszahl ZAW 100AS empfohlene Zwischenwärmetauscher Auslegung mit(tZwischenwärmetauscher (t Wasser,ein =7°C; tVorl,max=55°C) 0,795Auslegung mitempfohlene Wasser,ein =7°C; tVorl,max=55°C) < 10 K 4K < 10 K βH εN F 0,795 Küche =10°C;Auslegung tVorl,max=55°C) empfohlene empfohlene (tWasser,ein =10°C; tVorl,max=55°C) 0,853Auslegung (tWasser,ein Abluft 42 m³/h M M 1,250 0,853 - βW = Leistungszahl der Wärmepumpe bei W10/W35 (Herstellerangabe COP) empfohlene Auslegung (tWasser,ein =10°C; tVorl,max=35°C) 5,70Leistungszahl der Wärmepumpe Leistungszahl bei W10/W35 der Wärmepumpe (Herstellerangabe bei W10/W35 COP) (Herstellerangabe COP) Δ 3 <MΔ Δ 8 1,278 - F Gleichung 3 empfohlene Auslegung mit Zwischenwärmetauscher (t Wasser,ein =7°C; tVorl,max=35°C) 0,853Korrekturfaktor für verschiedene Korrekturfaktor Quellen- für undverschiedene Vorlauftemperaturen Quellen-(aus und Tabelle Vorlauftemperaturen 2 oder 3 VDI 4650) (aus Tabelle 2 oder 3 VDI 4650) Zuluftventil 0,795 ZAW 100AS geschlängelte Führung vor Terrassenbereich 0,853 0,795 5,70 0,853 - Abluftventil 0,853 ZAW 100AS =10°C;Auslegung tVorl,max=35°C) empfohlene empfohlene (tWasser,ein =10°C; tVorl,max=35°C) 1,068Auslegung (tWasser,ein 4K FP Korrekturfaktor für verschiedene Quellen- und Vorlauftemperaturen (aus Tabelle 2 oder 3 VDI 4650) Arbeiten GF 17,2 m² V 47,8 m² Zuluft 16 m³/h Bad Küche Wˇrmequelle Grundwasser Wˇrmequelle Grundwasser Gleichung 3 M FΔ 5,70 - 4K 6 Jahresarbeitszahl Brauchwassererwˇrmung Jahresarbeitszahl Brauchwassererwˇrmung WC Δ PWP εN B βH 7 Abluftventil ZAW 100AS 1,068 PP Leistungszahl der Wärmepumpe bei W10/W35 (Herstellerangabe COP) Diele GF 8,31 m² V 21,41 m³ 8 Arbeiten GF 17,2 m² V 47,8 m³ hresarbeitszahl Heizbetrieb Jahresarbeitszahl Heizbetrieb Zuluft 16 m³/h 600 W Wˇrmequelle Grundwasser FP 0,82Anteil des 0,82Heizwärmebedarfs Anteil (empfohlener des Heizwärmebedarfs Anteil) (empfohlener Anteil) 0,18 - F Jahresarbeitszahl Brauchwassererwˇrmung εN F F Δ M 1,250 0,98 βh = Δ B α nachweis des cop der wärmepumpe PP K90 Δ PP A B 1- 7 AB Gesamt-Jahresarbeitszahl BAFA-Nachweis mit Zwischenwärmetauscher (tWasser,ein =7°C; tVorl,max=55°C) 0,795 in der 1,00 Broschüre nachzulesen Bad Betrieb bei monovalentem 1,00 oder bivalentem beiWC monovalentem Betrieb mitoder unterschiedlichen bivalentem Energieträgern mit unterschiedlichen Energieträgern 5,70 - zu weiteren Räumen Anteil des Warmwasser-Wärmebedarfs (empfohlener Anteil) Anlagenschema Lüftung detaillierte berechnung der anlagenverluste 1,068 - 4,70 - ZU Anteil des Heizwärmebedarfs (empfohlener Anteil) BAFA-Nachweis (tWasser,ein =10°C; tVorl,max=55°C) 0,853 Anlagenschema Heizung nachweis des lüftungskonzeptes εN βWP Hoval HomeVent Gleichung 1 RS 250 KG Wˇrmequelle Grundwasser 1,068 F 0,18 K90 Anlagenschema Lüftung 1,011 βWP 0,18 - K90 Jahresarbeitszahl Heizbetrieb y y bei bivalent alternativem Betrieb, monoenergetisch (Bivalenzpunkt bei –5°C; aus Tabelle 8 VDI 4650) 3,92Jahresarbeitszahl Brauchwassererwˇrmung Jahresarbeitszahl Brauchwassererwˇrmung 10-15 m x 0,82 10-15 m Schluck4,91 brunnen α 0,82 - EG 10 kW Wert für Vorplanung; P WP <Wert für Vorplanung; P WP < 10 kW 1,250 βW x Δ 1,200 1,250 10 kW Wert für Vorplanung; P WP <Wert für Vorplanung; P WP < 10 kW 1,250 0,91 K90 K90 P P Pufferspeicher Wärmequelle SchluckFörder< 20 kW Wert für Vorplanung; 10 kW Wert < Pfür 10 kW < P WP < 20 kW 1,200 WP Vorplanung; Grundwasser brunnen brunnen 1,250 W Vorl,max direkt eingeben) P P Antriebsleistung der Wärmepumpe Antriebsleistung (oder Wert (oder Wert F direkt eingeben) 2160 W 2160 W die Schallüber - Telefonieschalldämpfer, die -derFWärmepumpe Enerval Pufferspeicher 500 l tragungF über 1,031 die- Lüftungsleitungen verhin vereinfacht F = 1,000 oder vereinfacht F = 1,000 F 1,031oder F F 1,278 1,278Korrekturfaktor zur Berücksichtigung Korrekturfaktor der Wärmequellenpumpe; zur Berücksichtigung der WertWärmequellenpumpe; für Vorplanung Wert für Vorplanung dert 1,278Korrekturfaktor zur Berücksichtigung Korrekturfaktor der Wärmequellenpumpe; zur Berücksichtigung der WertWärmequellenpumpe; für Vorplanung Wert für Vorplanung 1,140 M 3 <B ΔB < 10 K Δ 7K B PP Grundwasser Δ Wasser,ein Wasser,ein der Wärmequellenpumpe Antriebsleistung(oder der Wärmequellenpumpe Wert F P direkt eingeben) (oder Wert F P direkt eingeben) 600Antriebsleistung W FP Vorl,max Vorl,max PWP der Wärmepumpe Antriebsleistung (oder Wert der FWärmepumpe (oder Wert F P direkt eingeben) 2.160Antriebsleistung W Hoval P direkt eingeben) Thermalia Wärmequelle R407C (15P) vereinfacht F = 1,000 oder vereinfacht F = 1,000 F 1,031oder - 1,200 βH Wasser,ein Vorl,max Wasser,ein Δ Wasser,ein Vorl,max 4 Wohnen 5 Deckenabhängung im Flurbereich ca.25cm GEBA Brandschutzschott AVR zum Einbau in die Massivdecke K90 Leitungsführung analog im 1.OG Grundriss DG M.: 1:100 Absaugung in den Nassräumen Rohre Vallo Flex Rondo 75mm Verlegung auf der Rohdecke unter dem Hohlraumboden Lüftung Dachgeschoss B Fußbodenheizung Dachgeschoss A Luftmenge 239 m³/h = Nennlüftung (entspr. 0,28fachem Luftwechsel) nachweis des lüftungskonzeptes Rohre Vallo Flex Rondo 75mm Verlegung in der = β WPGleichung Gleichung 6 6 abgehängten Decke α samt-Jahresarbeitszahl Gesamt-Jahresarbeitszahl 1- 1 α β WP = α 311 m³/h =Intensivlüftung (0,38facher Luftwechsel) (Dimensionierung nach ValloFlex Plan, siehe Broschüre) α x +y +1−α x +y +1−α β β W Deckendurchbrüche βh βW Nachströmöffnungen h schallentkoppelt Türen Querschnitt ca. 0,016 1Deckungsanteil -m² der Wärmepumpe Deckungsanteil im monoenergetischen der Wärmepumpe Betrieb im monoenergetischen an Heizung und Warmwasserbereitung Betrieb an Heizung und Warmwasserbereitung α 1,00 Bad Betrieb bei monovalentem 1,00 oder bivalentem beiWC monovalentem Betrieb mitoder unterschiedlichen bivalentem Energieträgern mit unterschiedlichen Energieträgern 0,91 bei bivalent 0,91 alternativem Betrieb, beiAbluft bivalent monoenergetisch alternativem Betrieb, bei –5°C; aus (Bivalenzpunkt Tabelle 8 VDI bei4650) –5°C; aus Tabelle 8 VDI 4650) Abluftmonoenergetisch 43 m³/h 23 m³/h (Bivalenzpunkt Wärmepumpe: Wärmepumpe: Hoval Thermalia 15 Hoval Thermalia 15 Grundriss EG und OG M.: 1:100 GF 6,1 m² 2,9 m² 0,98 bei bivalent 0,98 parallelem Betrieb, beiGF bivalent monoenergetisch parallelem (Bivalenzpunkt Betrieb, monoenergetisch bei –5°C; aus (Bivalenzpunkt Tabelle 8 VDI bei4650) –5°C; aus Tabelle 8 VDI 4650) x 0,82 - y 0,18 - βWP 4,70 - V 0,82 x V 8,15 m³ Bad Abluft 23 m³/h Abluft 43 m³/h 0,82Anteil des 0,82Heizwärmebedarfs Anteil (empfohlener des Heizwärmebedarfs Anteil) (empfohlener Anteil) 0,18 y 0,18Anteil des 0,18Warmwasser-Wärmebedarfs Anteil des Warmwasser-Wärmebedarfs (empfohlener Anteil) (empfohlener Anteil) Diele GF 8,31 m² V 21,41 m³ nachweis des heizkonzeptes 4,70Gesamt-Jahresarbeitszahl Gesamt-Jahresarbeitszahl AU FL AB ZU Abluftventil ZAW 100AS 200 ÜS Abluftventil ZAW 100AS Zuluftventil ZAW 100AS ÜS SD KSD 1003 Abluftventil ZAW 100AS Verteiler kasten Zuluftventil ZAW 100AS ÜS Zuluftventil ZAW 100AS 12 Zuluftventil ZAW 100AS 10 11 Wohnen GF 18,2 m² V 50,4 m³ Zuluft 32 m³/h 9 Abluftventil ZAW 100AS ÜS AU FL AB Abluftventil ZU ZAW 100AS Abluftventil ZAW 100AS Verteiler kasten Verteiler kasten Zuluftventil ZAW 100AS Schlafen GF 18,2 m² V 50,51 m³ Zuluft 21 m³/h Arbeiten GF 17,2 m² V 47,8 m² Zuluft 16 m³/h SD KSD 1003 B βWP Arbeiten GF 17,2 m² V 47,8 m³ Zuluft 16 m³/h B WC 6,1 m² GF 2,9 m² M.: GF Grundriss DG 1:100 V 17,31 m² V 8,15 m² 17,31 m³ Küche Abluft 42 m³/h ZU Küche Abluft 42 m³/h Diele GF 8,31 m² V 21,41 m² Verteiler kasten Zuluftventil ZAW 100AS Dunstabzug Umlufthaube, mit Fett-und Aktivkohlefilter Küche/Essen GF 22,6 m² V 62,2 m³ Zuluft 16 m³/h Zuluftventil ZAW 100AS B Zuluftventil ZAW 100AS Schlafen GF 18,2 m² V 50,51 m² Zuluft 21 m³/h 12 10 11 Wohnen GF 18,2 m² V 50,4 9 m² Zuluft 32 m³/h Essen GF 22,6 m² V 62,2 m² Zuluft 16 m³/h B α und Küche, Zuluft in den Aufenthaltsräumen mit jew. vorgeschaltetem Schalldämpfer (ca. 20dB bei 1250 Hz) A B Loggia - zentral geste lüftung - Absaugung d und in der Kü Zuluft in den - 80 % der Wä gewinnen - Außenluft wir die Fortluft w - Im Erdgesch 10 werden die Z Flurbereich a 8 - Im Dachgesc 9 im Fußboden Aushang Gültig bis: 25.05.2020 - Jahres wärme Gebäude Gebäudetyp freistehendes Einfamilienhaus Adresse Salzmann Weg 1, 70192 Stuttgart Gebäudeteil Haus eines Schriftstellers Baujahr Gebäude 2009 1952/2010 Baujahr Anlagentechnik 1) 2010 Anzahl Wohnungen 3 Gebäudenutzfläche (AN) 493,9 m unsere Erneuerbare Energien stand 5. semester - Passiv - Aktivko Lüftung Anlass der Ausstellung des Energieausweises Neubau Vermietung / Verkauf Modernisierung (Änderung / Erweiterung) Sonstiges (freiwillig) Energiebedarf ENERGIEAUSWEIS Anforderungen Endenergiebedarf dieses Gebäudes für Wohngebäude gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) 11,7 0 Aushang Gültig bis: 25.05.2020 STAND 5. SEMESTER: Anforderungen Effizienzhaus 55 - Jahres-Primärenergiebedarf Qp und Transmissionswärmeverlust HT´max. 55 % Gebäude PASSIVHAUS: Anforderungen - Jahresheizwärmebedarf QH < 15 kWh/(m²a) - Primärenergiebedarf qp < 120 kWh/(m²a) - Infiltrationsluftwechsel bei 50pa kleiner 0,6 /h Gebäudetyp freistehendes Einfamilienhaus Adresse Salzmann Weg 1, 70192 Stuttgart Gebäudeteil Haus eines Schriftstellers Baujahr Gebäude 2009 1952/2010 Baujahr Anlagentechnik 1) 2010 Anzahl Wohnungen 3 Gebäudenutzfläche (AN) 493,9 m kWh/(m a) 50 100 30,4 150 200 250 300 350 >400 kWh/(m a) - Jahres-Primärenergiebedarf Qp und Transmissio Primärenergiebedarf dieses Gebäudes ("Gesamtenergieeffizienz") ZEROHAUS: wärmeverlust HT´max. 55 % Vergleichswerte Endenergiebedarf Anforderungen - HT < EnEV - 45% - Primärenergiebedarf qP < 100 kWh/m²a unsere daraus hervorgehenden Anforderungen - Endenergiebedarf QE < 100 kWh/m²a - CO2- Bilanz = 0 kg/m²a Aussteller: Bildungsstättenversion HS/ETU das haus eines sch unsere daraus hervorgehenden Anforderungen - Passivkonzept -30% gegenüber EnEV Neubau - Aktivkonzept -50% gegebüber EnEV Neubau Erneuerbare Energien - Abwägen konstruktiver Maßnahmen, Baustoffwahl aufgrund der zu erzielenden Standards unter Berücksichtigung der Punkte Energiebedarf Kosten, baulicher Aufwand, Nutzen - Austausch der Alu- Fenster durch Holz- Alufenster der Firma Kneer - Austausch der Dämmung in Wand und Dachkonstruktion gegen Resol Hartschaumplatten Vergleichswerte Endenergiebedarf mit Lamda = 0,021 W/mK - Aufstockung der Dämmstoffdicke der Kellerdecke mit Resol Dämmstoffplatten WDVS - Wärmedämmverbundsystem des Bestandsgebäudes nach neuestem Stand der Technik (Weber Therm- Resol Hartschaum Lamda = 0,022 W/mK) - Räumliche Abtrennung des Kellers, da dieser nicht beheizt wird Lüftung Anlass der Ausstellung des Energieausweises Neubau Vermietung / Verkauf Modernisierung (Änderung / Erweiterung) Sonstiges (freiwillig) Endenergiebedarf dieses Gebäudes 11,7 0 kWh/(m a) 50 100 30,4 150 200 250 300 350 >400 kWh/(m a) Primärenergiebedarf dieses Gebäudes ("Gesamtenergieeffizienz") Aussteller: Musterstr. 13 23323 Musterstadt - Passivkonzept -30% gegenüber EnEV Neubau - Regenerative Eigenversorgung bzw. Zukauf EnEV Neubau - Aktivkonzept -50% gegebüber 26.05.2010 EFH: Einfamilienhäuser, MFH: Mehrfamilienhäuser Datum Unterschrift des Ausstellers Hottgenroth Software, Energieberater PLUS 7.0.1 regenerativer Energie in Form von Anlagen oder Beteiligungen - PV Kollektorfläche im Garten aufstellen passivhaus ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude esther m Anforde gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) - Jahres - Primär Bildungsstättenversion HS/ETU Musterstr. 13 23323 Musterstadt 26.05.2010 Datum EFH: Einfamilienhäuser, MFH: Mehrfamilienhäuser Unterschrift des Ausstellers Hottgenroth Software, Energieberater PLUS 7.0.1 stand 5. semesterpassivhaus ENERGIEAUSWEIS Anforderungen ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Gebäude Gebäudetyp freistehendes Einfamilienhaus Adresse Salzmann Weg 1, 70192 Stuttgart Gebäudeteil Haus eines Schriftstellers Baujahr Gebäude 2009 1952/2010 Baujahr Anlagentechnik 1) 2010 Anzahl Wohnungen 3 Gebäudenutzfläche (AN) 493,9 m² Erneuerbare Energien Lüftung Anlass der Ausstellung des Energieausweises Gebäude 7,9 kWh/(m² a) - Jahresheizwärmebedarf QH < 15 kWh/(m²a) Gebäudevolumen: - Primärenergiebedarf qp < 120 kWh/(m²a) - Jahres-Primärenergiebedarf Qp und TransmissionsBeheiztes Luftvolumen: wärmeverlust HT´max. 55 % 50 100 20,5 150 200 freistehendes Einfamilienhaus Gebäudetyp Adresse Salzmann Weg 1, 70192 Stuttgart Adresse Gebäudeteil Haus eines Schriftstellers Gebäudeteil Haus eines Schriftstellers Baujahr Gebäude 2009 1952/2010 Baujahr Gebäude 2009 1952/2010 Baujahr Anlagentechnik 1) 2010 Baujahr Anlagentechnik 1) 2010 Anzahl Wohnungen 3 Anzahl Wohnungen 3 Gebäudenutzfläche (AN) 493,9 m Gebäudenutzfläche (AN) 493,9 m² Vergleichswerte Endenergiebedarf Salzmann Weg 1, 70192 Stuttgart Lüftung Neubau Vermietung / Verkauf Modernisierung (Änderung / Erweiterung) Sonstiges (freiwillig) Energiebedarf EFH: Einfamilienhäuser, MFH: Mehrfamilienhäuser Neubau Vermietung / Verkauf Modernisierung (Änderung / Erweiterung) Sonstiges (freiwillig) Hottgenroth Software, Energieberater PLUS 7.0.1 Energiebedarf 0 Endenergiebedarf dieses Gebäudes kWh/(m a) 50 100 30,4 7,9 150 200 250 300 350 >400 0 50 kWh/(m a) Vergleichswerte Endenergiebedarf kWh/(m² a) 100 20,5 Primärenergiebedarf dieses Gebäudes ("Gesamtenergieeffizienz") 150 200 300 350 >400 kWh/(m² a) Vergleichswerte Endenergiebedarf Aussteller: Bildungsstättenversion HS/ETU Bildungsstättenversion HS/ETU Musterstr. 13 23323 Musterstadt Musterstr. 13 23323 Musterstadt 26.05.2010 EFH: Einfamilienhäuser, MFH: Mehrfamilienhäuser 250 Primärenergiebedarf dieses Gebäudes ("Gesamtenergieeffizienz") Aussteller: Datum Unterschrift des Ausstellers Hottgenroth Software, Energieberater PLUS 7.0.1 >400 1 11 Aussteller: A/V: CO2: Musterstr. 13 23323 Musterstadt - Passivkonzept -30% gegenüber EnEV Neubau - Aktivkonzept -50% gegebüber EnEV Neubau Anlass der Ausstellung des Energieausweises Endenergiebedarf dieses Gebäudes 11,7 350 Bildungsstättenversion HS/ETU Erneuerbare Energien Anlass der Ausstellung des Energieausweises 300 freistehendes Einfamilienhaus unsere daraus hervorgehenden Anforderungen Lüftung 250 kWh/(m² a) Primärenergiebedarf dieses Gebäudes ("Gesamtenergieeffizienz") Gebäudetyp Erneuerbare Energien Sonstiges (freiwillig) Endenergiebedarf dieses Gebäudes Aushang Gültig bis: 29.05.2020 Gebäude Modernisierung (Änderung / Erweiterung) AnforderungenGebäudedaten für Wohngebäude gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) Aushang Neubau Vermietung / Verkauf Energiebedarf 0 Gültig bis: 25.05.2020 Aushang Gültig bis: 29.05.2020 An: HT: qp: 30.05.2010 Datum 0, 30,42 Unterschrift des Ausstellers QT: QS: QV: Qi: 24.3 14.2 21.0 Anfor 13.7 QH: QE: QP: - HT < 17.3 - Prim 5.8 - Ende 15.0 - CO2- zero-haus 30.05.2010 EFH: Einfamilienhäuser, MFH: Mehrfamilienhäuser Datum Unterschrift des Ausstellers Hottgenroth Software, Energieberater PLUS 7.0.1 passivhaus CO2: 8 kg/m2 QT: 24.300 kWh/a QS: 14.200 kWh/a An: 493,9 m2 für Wohngebäude ENERGIEAUSWEIS 2 gemäß §§ 16 ff. W/m Energieeinsparverordnung (EnEV) QV: 21.000 kWh/a H : den 0,34 K T Qi: 13.700 kWh/aAushang Gültig bis: 29.05.2020 QH: 17.300 kWh/a qp: 30,42 kWh/m2K Gebäude QE: 5.800 kWh/a Gebäudetyp freistehendes Einfamilienhaus Adresse Salzmann Weg 1, 70192 Stuttgart Gebäudeteil Haus eines Schriftstellers Baujahr Gebäude 2009 1952/2010 Baujahr Anlagentechnik 1) 2010 Anzahl Wohnungen 3 Gebäudenutzfläche (AN) 493,9 m² Erneuerbare Energien Lüftung Anlass der Ausstellung des Energieausweises Neubau Vermietung / Verkauf Energiebedarf Endenergiebedarf dieses Gebäudes 7,9 kWh/(m² a) Modernisierung (Änderung / Erweiterung) Sonstiges (freiwillig) zero-haus CO2: 5 kg/m2 QT: 18.500 kWh/a QT: 18.500 kWh/a CO2: 0 kg/m2 2 Anforderungen Anforderungen QS: 11.100 kWh/a QGebäudedaten An: 493,9 m An: 493,9 m2 : 11.100 kWh/a S 2 2 QV: 16.900 kWh/a QV: 16.900 kWh/a HT: 0,25 W/m K HT: 0,25 W/m K EnEV - 45% - HT < -51% EnEV-Neubau -51% Qi: 11.900 kWh/a EnEV Neubau Qi: 11.900 kWh/a Jahresheizwärmebedarf QH < 15 kWh/(m²a) 2 qp: 20,55 qp: 20,55 QH: 12.400 QGebäudevolumen: kWh/m K kWh/m2K : 12.400qkWh/a < 100 kWh/m²a - Primärenergiebedarf < 120 kWh/(m²a) - Primärenergiebedarf qpkWh/a H P EnEV Neubau -69% QE: 3.900 kWh/a EnEV Neubau -69% QBeheiztes : 3.900 - Endenergiebedarf Q kWh/a < 100 kWh/m²a E Luftvolumen: E - CO2- Bilanz = 0 kg/m²a A/V: CO2: An: HT: 1 201 0 EnEV Ne 20,55 sommerlicher wärmes qp: Modul 5.4 FWP Prof. Siegfried H. Bucher Malstudio I Painting Studio I 202 Das Seminar bietet eine Einführung in die Ölmalerei. Thema des Seminars ist die grundlegende Frage nach dem Phänomen des Raumes und seinem Abbild in der Fläche. Neben einer praktischen Einführung in die Ölmalerei und eigenen malerischen Versuchen im offenen Atelier in der Clemensstrasse soll das Studium ausgewählter Werke der traditionellen Malerei und aktueller künstlerischer Positionen die Absichten und Möglichkeiten der räumlichen Darstellung in unterschiedlichen Stilepochen zeigen. Literatur: Alte Pinakothek München. Bestandskatalog. Erläuterungen zu den ausgestellten Werken. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage München 1999 622 S. mit Abbildungen aller ausgestellten Werke und 24 Farbtafeln 203 „Sakrales Streiflicht“ 204 Ashley Franklin 205 Modul 5.4 FWP LB Uwe Gutjahr Barrierefreies Bauen Bahnhof Pasing Pumpenwerk Kaflerstr. Seminararbeiten Entwurf-Konzeptplanung-Universal Desgin 206 Barrierefreies Bauen und Denkmalschutz wurden als zentrales Thema des Seminars an einem Projekt aus der Praxis erarbeitet. Die Studenten, die sich in Gruppenarbeiten mit einem leerstehenden Funktionsgebäude des Pasinger Bahnhofes beschäftigten, konnten sich in die Praxis einer Planung für einen Umbau im historischen Bestand einarbeiten. Das ehemalige Pumpenwerk, im Stil des Historismus errichtet, soll mit zeitgemäßer und angemessener neuer Funktion umgenutzt werden. Generationsübergreifende Baukonzepte können eine Chance darstellen für leerstehende Baudenkmäler. Das Raumprogramm lag für eine Gaststätte mit Küchenerweiterung und Biergartenflächen vor. Die Topographie, das Pumpenwerk liegt um ca. 1 Meter unter Gehwegniveau, stellte an die barrierefreie Erschliessung sehr hohe Anforderungen. Die zentrale Denkmalsaussage lag hier im wesentlichen im Erhalt des Sichtmauerwerks mit seinen Fensterordnungen und dem Erhalt der flach geneigten Zeltdachkonstruktionen. Es musste in Enklang gebracht werden mit den Anforderungen an zusätzliche Nebenräume für Küche und die Sanitärbereiche sowie nach einer funktionierenden Erschliessung mit Eingang und Windfang. Mit den Prinzipien des Universal Desgins wurden die Entwurfskonzepte erarbeitet. Das Seminar wurde begleitet vom Lehrstuhl Baugeschichte der Hochschule München, Prof. Dr. Zimmermann. Neue Gebäudeteile sollten maßvoll dem historischen Bestand beigestellt werden. Weder Dominanz noch Unterordnung führen hier zu einem angemessenem Umgang mit dem Baudenkmal. Universal Desgin wurde beispielhaft in Gestaltungen von Sanitärräumen, Rampen- oder Treppenanlagen oder Übergängen von innen nach außen erarbeitet. 207 Pumpenhaus-Pasing Isabell Hofmann, Martina Steinhoff Die Umgestaltung und Erweiterung des denkmalgeschützten Pumpenhauses in Pasing soll, das immer aktueller werdende Thema Barrierefreiheit und Design miteinander in Symbiose verbinden. Um dem Denkmal geschützten Pumpenhaus nicht seine Wichtigkeit und Wirkung zu nehmen entschieden wir uns für einen klar abgesetzten Anbau der in Stahl und Glas ausgeführt werden soll. Ein simpler und einfach strukturierter Entwurf war unser Ziel, der dem Gastwirt eine vielseitige Nutzung des neu entstehenden Restaurants bieten soll. Daher wurden abtrennbare Gasträume sowie ein Lounge- und Barbereich für das Nachtleben konzipiert. Die Fassade besteht aus einem Pfostenriegelsystem das in seiner Einteilung und Proportion auf die Bestandsfenster Bezug nimmt. Die einzelnen Elemente sind abwechselnd mit transluzenten oder opaken Glasscheiben gefüllt die entweder grau oder in verschiedenen Rottönen gehalten wurden. So bieten sie dem Gast einerseits von außen einen Sichtschutz und andererseits ein warmes und helles Raumgefühl das eine beruhigende und entspannende Wirkung auf ihn haben soll. Der Eingangsbereich dient als Schleuse zwischen „alt“ und „neu“ und soll dem Gast auf einem Blick die Übersicht über die Anlage bieten. Auf einer Glasscheibe bedruckt soll daher ein Lageplan so wie eine kurze Begrüßung und Aufführung der Leistungen zu lesen sein. Da der Bestand einen Meter unterhalb des Straßenniveaus liegt wurde eine barrierefreie Rampe notwendig die ebenfalls in Stahl und Glas gehalten ist. Das aus Glas entworfene Geländer dient neben seiner Absturzsicherung als Werbefläche des Restaurants und bietet, auch von der Straße, eine gute Aussicht auf die Anlage. Der Belag der Rampe besteht aus gefärbten Quarzsand der mit Harz behandelt wurde und so eine harte und rutschfeste Oberfläche bietet. Dieser Belag führt bis zu dem Haupteingang zu dem die bewegungseingeschränkten Nutzer der Rampe so wie auch die Nutzer der Treppenanlage gemeinsam hingeführt werden. Durch ein in die Rampe und den Boden eingelassenes Lichtband wird dieser Weg auch bei Nacht inszeniert und für Personen mit eingeschränktem Sichtfeld leichter zu begehen. Da ein Vordach dem Entwurf in seiner äußeren Erscheinungsform verunklären würde entschieden wir uns für eine Schrägstellung des Dränrostes um den Eingangsbereich vor Spritzwasser zu schützen. Da dies jedoch keine hundertprozentige Sicherheit vor Feuchtigkeit von außen bedeutet ist in dem Eingangsbereichen eine Sauberlaufzone angedacht die auf gleichem Niveau mit dem Natursteinbelag des Anbaus verlegt wird. 208 Erdgeschoss Obergeschoss Schemaschnitt Westansicht 209 Modul 5.4 FWP LB Barbara Christine Henning Das menschliche Maß 210 Grundlagen zur figurativen Zeichnung Die Handzeichnung ist ein wesentliches Element gestalterischer Ideenfindung. Jenseits von digitalem Repertoire kann nur mit der eigenen Hand wirklich Authentisches entstehen. Am Beispiel der menschlichen Figur (welche am Rande von Architektur-Darstellungen immer wieder erstaunliche Formen annimmt) wurde in diesem Seminar anhand von plastischen und zeichnerischen Übungen das Darstellen des Menschen vertieft. In unterschiedlicher Herangehensweise wurden zunächst anatomische Strukturen geübt und die Anwendung dieser Kenntnisse in Bezug auf die Darstellung von Bewegung erprobt. Im Gegensatz dazu steht die Auseinandersetzung mit dem Abbild des Menschen am Beispiel antiker Statuen, die zu zeichnen immer wieder eine Herausforderung an das Sehen und Umsetzen von Proportionen bedeutet.So entstand ein breites Spektrum an Möglichkeiten, die in einem weiterführenden Seminar vertieft werden können. 211 Das menschliche Maß 212 Marlen Salvat 213 Modul 5.4 FWP Prof. Dunja Karcher Das Detail/ Picturing Details 214 Architektur beginnt zweifellos im imaginären— doch die Ideen wollen lebendig und ergreifend zu Papier gebracht werden. Dieser maßgebliche Arbeitsschritt begleitet den Architekten von der ersten rohen Skizze über die digitale Ausarbeitung bis hin zur endgültigen Präsentation. In diesem Seminar wurde das Freihandzeichnen als eine Möglichkeit der aktiven Auseinandersetzung mit dem Detail zeitgenössischer Architektur -insbesondere von Innenräumen- wahrgenommen. Durch die Freihandzeichnung sollten verschiedene Betrachtungsebenen eines Details herausgearbeitet werden: geometrische Struktur, Proportion, Materialzusammenhang, Schichtenaufbau und Verbindungsform, Raumzusammenhang und Raumaufbau, skulpturale Prozesse, Formund Einbauprozesse. Mit der Unterweisung in grafischen Techniken und im perspektivischen Zeichnen sollte die Fähigkeit entwickelt werden, zeichnerisch Architekturdetails und Ornamente zu erfassen. Das Seminar fand in ausgewählten öffentlichen Gebäuden im Stadtraum München statt. Jeweils zwei Seminartermine wurden zusammengelegt. Den Anfang der dreistündigen Exkursionen zu den ausgewählten Objekten bildete eine kurze Gebäudeführung (u.a. das Museum Brandhorst von Sauerbruch Hutton Architekten, das jüdische Museum von Wandel Hoefer Lorch Architekten, die Herz-Jesu Kirche von Allmann Sattler Wappner). Zu jedem Projekt wurde ein eigenes Skizzenbuch als „Picturing Details Atlas“ mit Freihandzeichnungen von selbst gewählten Innenraumdetails (Grundriss, Schnitt, Ansicht, Perspektive, etc.) erstellt. 215 Das Detail 216 Semesterarbeit 217 Bachelorarbeit Prof. Jörg Weber Prof. Gilberto Botti Prof. Martin Zoll euS|muc Europäisches Studentenhaus München European Student Hall Munich (Baumeister Wettbewerb 2009) 218 prolog in den spaeten 60-er und anfang der 70-er jahre des 20. jahrhunderts wurden nicht nur in deutschland die akademischen ausbildungskapazitaeten massiv ausgebaut und erweitert. die moeglichkeit ein studium zu absolvieren war nicht mehr alleine einer gesellschaftlichen elite vorbehalten, sondern wurde in zunehmendem maße einer breiten bevoelkerungsschicht zugaenglich gemacht. der 1999 gestartete ‚bologna-prozess’ modernisiert mittlerweile die damals eingefuehrten studiengaenge und–plaene in der europaeischen ‚hochschul-landschaft’ und foerdert gezielt die internationalisierung der hochschulen. damit einher gehen zunehmend studienaufenthalte im ausland, die das persoenliche erfahrungsspektrum erweitern, die ausbildungsstandards erhoehen und zusaetzliche aspekte des studentischen und temporaeren wohnens eroeffnen sollen. geblieben ist nach wie vor - als wesentlicher faktor in der ausgestaltung der sozialen rahmenbedingungen waehrend des studiums - bei fast allen studierenden die versorgung mit preiswertem wohnraum. der aus dem britisch-amerikanischen college system stammende bautypus der ‚student hall’ hat sich zwischenzeitlich in deutschland durchgesetzt und als baustein im stadtgefuege fuer die unterschiedlichsten formen studentischen wohnens etabliert. angesichts der mieten und des angebotes auf dem freien wohnungsmarkt stellen studentenwohnheime traditionell die preiswerteste wohnform ausserhalb des elternhauses dar. ihre plaetze sind folglich entsprechend begehrt. der studentenwettbewerb „europaeisches studentenhaus“, an dem sich neun deutsche hochschulen und universitaeten beteiligen - ausgelobt von der redaktion ‚baumeister’ in kooperation mit ‚nemetschek allplan’ – wird der bachelorarbeit im ws 2009|10 thematisch und inhaltlich zu grunde gelegt. aufgabe das gebaeude eines europaeischen studentenhauses dient der temporaeren unterbringung von studenten und stipendiaten aus ganz europa. es soll zum treffpunkt und aktionszentrum der gaeste der hochschulen und der studierenden des gastlandes werden und sich gleichzeitig zum stadtraum oeffnen. fuer die bearbeitung der aufgabenstellung wurde das grundstueck der dependance der fakultaet fuer architektur in muenchen-schwabing festgelegt. auf dem grundstueck an der clemensstraße soll eine gebaeudekonfiguration fuer das euS|muc – europaeisches studentenhaus | european student hall munich entwickelt werden, die in ihrer architektonischen erscheinung, ihrer integration in die umgebung und in ihrer inneren struktur den anspruch eines besonderen bautypus erfuellt. die programmvorgaben bzw. die funktionsvorschlaege sind so angelegt, dass ein haus fuer eine spezifische wohnform und eine kulturelle einrichtung entstehen kann. ziel der aufgabenstellung ist ein bau hoechster architektonischer qualitaet und nachhaltigkeit; ein bau, der das stadtraeumliche gefuege in schoenster weise ergaenzt und ihm zu einem einpraegsamen ensemble muenchens verhilft. oberstes anliegen der aufgabe ist nicht, das baurecht auszureizen sondern eine vertraegliche, leistungsfaehige struktur zu finden, die den standort angemessen behandelt, seine qualitaeten nutzt und steigert, den besonderen ort definiert und eine eigene identitaet entwickelt. ort in muenchen - schwabing steht fuer das euS|muc – europaeisches studentenhaus | european student hall munich an der clemensstraße gegenueber der einmuendung der moltkestraße das grundstueck der ehem. schule fuer fotographie zur verfuegung. das gelaende liegt noerdlich der hauptverkehrsachse herzogstraße und einen block oestlich des puendterplatzes. die clemensstraße befindet sich stadtraeumlich im bereich der geschwungenen strassenfuehrung schwabings mit der typischen mischung geschlossener und offener bauweisen, begruenten straßenzuegen und kleinteiligen platzfolgen (theodor fischers staffelbauordnung). im schwabinger stadtkoerper und freiraum sind noch heute die alten straßen- und besitzstrukturen beruecksichtigt. besonders viele plaetze und stadtraeume sind nach dem vorbild camillo sitte in analogie zum mittelalter mit unregelmaeßigen grundrissen angelegt. die bebauung der umgebung ist durch ihre heterogenitaet gepraegt: große stadtbloecke, imposante solitaerbauwerke, klein-dimensionierte einfamilien-wohnhaeuser; unterschiedliche maßstaeblichkeiten, funktionen, nutzungen, bautypologien und architekturqualitaet. direkt angrenzend befinden sich westlich eine kinderkrippe der lh muenchen und oestlich ein kleinkinderspielplatz. wettbewerb die ergebnisse der bachelor-arbeit sollen anschließend an die bewertung bei dem studentenwettbewerb ‚europaeisches studentenhaus’ den die redaktion baumeister in kooperation mit nemetschek allplan im wintersemester 2009/2010 auslobt, eingereicht werden. im rahmen des wettbewerbs, an dem sich neun deutsche hochschulen und universitaeten beteiligen, ist eine gemeinsame entwurfsaufgabe zu bearbeiten. 219 Bachelorarbeit – European Student Hall Munich STÄDTEBAULICHER KONTEXT: Typisch für den Stadtteil sind geschlossene oder teilweise geschlossene, geometrisch klar definierte Blöcke. Eine Schließung dieses Blockes ist aus nutzungsbedingten Gründen nicht möglich, da die Grünfläche des Kinderspielplatzes erhalten werden muss. Im Entwurf wurde daher das Studentenhaus losgelöst von der restlichen Bebauung des Blockes. Es ist bewusst in die Grünzone als eine Einheit integriert. Der Bau wird als Teil der Grünzone gesehen. Somit entsteht eine nutzbare Grünfläche, die auch öffentlich von Osten nach Westen begangen und erlebt werden kann. ARCHITEKTONISCHES KONZEPT: Das Gebäude ist so konzipiert, dass alle geforderten Funktionsbereiche (Wohnen, Sport, Verwaltung) jeweils in einem eigenem Baukörper angeordnet sind. Die Richtungsänderung der jeweils angrenzenden Straßenrandbebauungen wird durch das ineinander drehen der Baukörper aufgenommen. Somit wird eine harmonische Verbindung geschaffen. Die Erdgeschosszone ist hell und Licht durchflutet gestaltet, und von Norden nach Süden durchschreitbar, vom Eingang kann man direkt in den Garten durchmarschieren. Vielfältige Nutzungen (Cafe, Lounge, Foyer, Sport) verzahnen sich durch die Transparenz und Offenheit des Baus mit der Grünfläche. Es gibt öffentliche Bereiche, orientiert zur Straße hin wie das Cafe und eher privatere Bereiche wie die Lounge die sich zum südlichen Garten öffnet. An dieser Stelle soll durch die Architektur für das Studentenhaus eine Identität geschaffen werden. 220 Anna Köppl 221 Bachelorarbeit – European Student Hall Munich Das Gebäude eines europäischen Studentenhauses dient der temporären Unterbringung von Studenten und Stipendiaten aus ganz Europa. Es soll zum Treffpunkt und Aktionszentrum der Gäste der Hochschulen und der Studierenden des Gastlandes werden und sich gleichzeitig zum Stadtraum öffnen. Für die Bearbeitung der Aufgabenstellung wurde das Grundstück der Dependance der Fakultät für Architektur in München-Schwabing festgelegt. Auf dem Grundstück an der Clemensstraße soll eine Gebäudekonfiguration für das euS|muc – Europäisches Studentenhaus | European student hall munich entwickelt werden, die in ihrer architektonischen Erscheinung, ihrer Integration in die Umgebung und in ihrer inneren Struktur den Anspruch eines besonderen Bautypus erfüllt. Die Programmvorgaben bzw. die Funktionsvorschläge sind so angelegt, dass ein Haus für eine spezifische Wohnform und eine kulturelle Einrichtung entstehen kann. Ziel der Aufgabenstellung ist ein Bau höchster architektonischer Qualität und Nachhaltigkeit; ein Bau, der das stadträumliche Gefüge in schönster Weise ergänzt und ihm zu einem einprägsamen Ensemble Münchens verhilft. Oberstes Anliegen der Aufgabe ist nicht, das Baurecht auszureizen sondern eine verträgliche, leistungsfähige Struktur zu finden, die den Standort angemessen behandelt, seine Qualitäten nutzt und steigert, den besonderen Ort definiert und eine eigene Identität entwickelt. 222 Benjamin Möckl 223 Master 01 Projektstudio I Master 02 Projektseminar I Prof. Andreas Meck LB Franz Wimmer Gastkritik: Prof. Dunja Karcher Prof. Isolde Kurz Florian Holzherr Hanns-Martin Römisch Christian Schnurrer Eine Moschee für München I 226 Christ­li­che Kir­chen wer­den ge­schlos­sen, Syn­ago­gen neu er­baut und Mo­sche­en zu Streit­ob­jek­ten in der Ge­sell­schaft. Im Früh­jahr die­ses Jah­res ver­an­stal­te­te der Werk­bund Bay­ern ein Sym­ po­si­um un­ter dem Ti­tel: Syn­ago­gen - Kir­chen - Mo­sche­en, Re­li­gio­nen und ihre Räu­me in un­se­rer Ge­sell­schaft. The­ma­ti­siert wur­de da­bei der Wan­del der Ge­sell­schaft und mit ihr der öf­fent­li­che Raum, der von den Kult­bau­ten we­sent­lich ge­prägt ist. Ge­fragt wur­de nach mög­li­chen Ver­ än­de­run­gen un­se­res Stadt­bil­des und ob der Bau von Syn­ago­gen und Mo­sche­en neue ur­ba­ne Im­pul­se be­wir­ken wird. Das Ent­wurfspro­jekt „Eine Mo­schee für Mün­chen“ be­schäf­tigte sich des­halb an­hand ei­nes kon­kre­ten in­ner­städ­ti­schen Grund­stücks mit die­ser ak­tu­el­len Pro­ble­ma­tik. Die Aus­rich­tung des Ge­be­tes nach Mek­ka stellt im Grun­de die ein­zi­ge von der Re­li­gi­on vor­ge­ge­be­ne Be­din­gung für den Versamm­lungs­raum ei­ner Mo­schee dar. Dar­aus er­wach­sen ein­ma­li­ge ar­chi­tek­to­ni­sche und ent­wer­fe­ri­sche Chan­cen und Mög­lich­kei­ten die es zu nut­zen gilt. Beim Ent­wurf ei­ner Mo­schee las­sen sich ex­em­pla­risch an Hand ei­ner spe­zi­fi­schen Funk­ti­on Licht, Raum, Ma­te­ri­al, Pro­por­tion und Stim­mung un­ter­su­chen. Auch er­lau­ben ge­ra­de auf den er­sten Blick un­ge­wöhn­lich schei­nen­de Bau­auf­ga­ben un­kon­ven­tio­nel­le Her­an­ge­hens­wei­sen und Ent­wurfs­stra­te­gi­en. Der zen­tral ge­le­ge­ne in­ner­städ­ti­sche Bau­platz er­for­derte zu­dem eine Aus­ein­an­der­set­zung mit Stadt­bild und öf­fent­li­chem Raum. 227 Eine Moschee für München ASSOZIATIVMODELL KORALLE Die Koralle kommt aus dem Wasser und ist eine gewachsene Form. Jeder Raum ist anders und doch gleich. Es bilden sich interessante Einund Ausblicke. Sie ist komplex und doch eine eigene schöne Skulptur. Eine Mehrheit in der Einheit. Und eine Einheit in der Mehrheit. STÄDTEBAU Bei dem Baukörper handelt es sich um eine Randblockbebauung. Aus dem Boden wächst ein präziser Baukörper mit drei markanten Gebäudeköpfen, die auf einem Sockel liegen und eine monolithisch abstrakte Architektursprache sprechen. In seiner Nutzung ist er klar gegliedert: Der nördliche Teil beinhaltet alle intellektuellen Räume, der westliche Riegel ein Museum, und im östlichen Riegel sind gemeinschaftliche, geistige Nutzungen untergebracht. Die zwei südlichen Gebäudeköpfe fassen den städtischen Raum und spielen eine wichtige Rolle, da sie die Nutzung des Gebäudes erkennbar machen. Den westlichen Hochpunkt bildet das Minarett, den östlichen der Gebetsraum. Der sinnlich raue, blaue Beton stellt das zu Stein gegossene Wasser dar. Das Wasser steht im Islam für Reinheit, Heilung, Schöpfung, Fruchtbarkeit, Segen, Ewigkeit und gilt als Lebensquelle und Ursprung des Lebens. Ebenso hebt die blaue Farbe die Schwere des grauen Betons auf. Der östliche Gebäudekopf hebt sich durch seine Materialität von dem restlichen Körper klar ab. Dieser ist das sinnstiftende und wichtigste Bauelement, da sich in ihm der Gebetsraum befindet. GEMEINSAME MITTE In der „Mitte“ entsteht ein Hof, der „Korallenhof“. Er ist ein Ort der Begegnung. Zwei Durchgänge verbinden den „Korallenhof“ mit dem städtischen Raum, die weltliche mit der geistlichen Welt. Verstärkt wirkt die Integration mit dem städtischen Raum mit Hilfe einer Wasserrinne, durch die das Wasser aus dem Brunnen in den Stadtgarten läuft in dem die Kinder spielen. Dadurch wird symbolisch die Natur befruchtet und die Menschen werden in den Hof hineingeleitet. Die Rinne führt den Menschen in die „gemeinsame Mitte“. 228 Bartolomej Slugocki MUSEUM Das Museum besteht aus drei Hauptgeschossen und einem begehbaren Minarett. Ein fließender, vertikaler Übergang wird mittels Rampen inszeniert. Die Materialität ist durchgehend aus extraweißem Marmorbeton. Jedes Geschoss weist verschiedene Licht- und Raumqualitäten auf. Es entstehen Räume mit spannenden Blickbeziehungen von innen nach außen. GEBETSRAUM Vom gegenüberliegenden Brunnen aus wird man durch eine Wasserrinne in den Waschraum geführt. Durch die Tür betritt man gleichsam eine andere, die geistliche Welt. In einem spannenden Kreislauf der rituellen Waschung, durch Enge und Weite, Helligkeit und Dunkelheit gelangt man in den hellen, nach innen gerichteten Gebetsraum, den man im Sommer durch den „Korallenhof“ erweitern kann. Wie das Museum bestehen der Boden und die Wände aus extraweiß pigmentiertem Marmorbeton, der den Grund für das Lichtspiel der Ornamente bildet. Der obere Teil der Wand und die Decke bestehen aus komplexen, dreidimensionalen Glaselementen, die Licht in den Raum streuen. Das Licht strahlt tagsüber in den Raum hinein und bei Dunkelheit von innen heraus in die Stadt. Das Licht an sich ist die Materie, die die geschlossenen Flächen mit Ornamenten ausleuchtet. Es ist ein Lichtraum. Licht ist das prägende Element, die Seele des Gebetsraumes. Man fühlt, dass man sich an einem anderen Ort befindet, an einem Ort, wo die Zeit eine anders Bedeutung hat. Die Strahlen verändern unsere Wahrnehmung. Nicht nur die Wahrnehmung des Raumes, sondern auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Der Weg in die eigene Mitte ist das Ziel, und „Gott ist das Licht des Himmels und der Erde“. (Koran, Sure 24/25) 229 Eine Moschee für München Gudrun Müller ORT Im nordwestlichen Teil der Münchner Altstadt befindet sich das Projektgrundstück für die Moschee. Es liegt direkt hinter dem Probengebäude der Kammerspiele und wird von der Neuturm-, der Hildegard- und der Hochbrückenstraße umschlossen. Richtung Süden befindet sich ein kleiner Platz mit einem Kinderspielplatz. IDEE/ASSOZIATION Mit dieser Moschee soll ein Raum geschaffen werden, in dem Traditionen gelebt, gelernt und auch weitab der ursprünglichen Heimat weitergegeben werden können. Als Assoziativbild und Grundgedanke für den Entwurf steht der Mantel des drehenden Derwischs. Hier steht nicht der Derwisch und dessen Bedeutung im Islam im Vordergrund, sondern ausschließlich die Bedeutung des Mantels, als etwas Bewegetes, Beschützendes, Wärmendes. EXPERIMENTE/FORMFINDUNG Auf dem Weg zur Formfindung wurden einige Experimente zum Thema Hülle, Farbe und Ornament gemacht. Hier dienten Drahtmodelle in Seifenblasenlauge zur Ermittlung der kleinsten möglichen Hüllfläche oder Ölfarbe auf Kleister zur Entwicklung spontaner Ornamente. Auch diverse Werke von Künstlern wie Naum Gabo, Zaha Hadid, Richard Serra, Olafur Eliasson, Anish Kapoor, Eero Saarinen oder Ali Akbar Safaian inspirierten die Arbeit. FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN Durch das natürliche Gefälle innerhalb des Grundstückes von Nordost nach Südwest ergab sich die Möglichkeit, den Sockel der Moschee so in das Grundstück zu integrieren, dass dieser voll genutzt werden kann. Der Zugang zum öffentlichen Untergeschoss erfolgt über Süden, indem man entweder über eine Rampe oder eine Treppe einen Meter hinab geht, um zu einem kleinen Vorplatz zu gelangen. Von dort aus betritt man eine kleine Eingangshalle mit Café und den Ausstellungsräumen, die auch in drei verschiedenen Größen als Konzert- und Vortragräume genutzt werden können. Der Hauptzugang zur Moschee erfolgt über eine kurze Treppe im Norden. Der Sockel ist hier ca. 1 Meter über dem Straßenniveau und hebt die Moschee bildlich gesehen etwas aus „dem Staub der Straße“. Das Innenleben der Gebäudehülle teilt sich über dem Sockel in zwei Bereiche. Die linke Seite, der Bereich des „eingeschlagenen Mantels“, beherbergt alle Funktionen der Moschee. Im Erdgeschoss befindet sich hier ein Sanitärkern, sowie Brunnen für die rituellen Waschungen. Die Männer gelangen über einen Treppenaufgang vor der Kiblawand in den eigentlichen Gebetsraum im 1. Obergeschoss. Die Frauen können eine Treppe genau gegenüber benutzen, die diese bis in die Empore im 2. Obergeschoss führt. Die rechte Seite, der Bereich des „schützenden Mantels“ umfasst die Funktionen der Verwaltung, Versammlung, Konferenz und Lehre bis hin zu einer kleinen modernen Bibliothek im 2. Obergeschoss. Die Hauptverbindung zwischen den Geschossen erfolgt durch eine Treppe, die sich vom Untergeschoss an der Außenwand des „eingeschlagenen Mantels“ bis ins 2. Obergeschoss führt. Durch eine große Glaskuppel über dieser Himmelsleiter entsteht ein großzügiger Luftraum, der alle Ebenen mit viel Licht versorgt und sich hervorragend zum Aufenthalt eignet. KONSTRUKTION UND AUSSENHAUT Der „Mantel“ wird auf Grund seiner außergewöhnlichen Form in Spannbeton hergestellt. Die Außenhaut besteht jedoch aus beschichteten Textilbahnen (Lotuseffekt), die über eine Wärmedämmung mit Luftschicht gespannt wird. So bekommt der „Mantel“ die optische Leichtigkeit eines Stoffes. Der Sockel besteht aus Stahlbeton. Die Fensterflächen sind PfostenRiegel-Konstruktionen. 230 Lageplan Assoziativmodell 231 Master 11 Architektur Design I Prof. Maren Paulat LB David Curdija Eine Moschee für München II 232 Künstlerische Raumkonzeption / Bauaufgabe Moschee Der Atmosphärische Raum In der Kunst gibt es viele Beispiele für atmosphärische Räume der Besinnung, des Andenkens, der Meditation und Versenkung in denen die Qualitäten des Raumes, des Ortes und die Position des Besuchers, Zuschauers bzw. Teilnehmers neu formuliert und in eine konzeptuelle Entwurfsstrategie übersetzt wird. James Turell z. B. schafft dichte atmosphärische Räume ausschließlich durch den Einsatz von Farbe und Licht. Die immersiven Bild- und Raumkompositionen der abstrakten Kunst werde ich in einem Vortrag ausführlich behandeln. Der Anspruch des Geistigen in der abstrakten Kunst von Kandinsky bis zur Gegenwartskunst berührt sich mit der spirituellen atmosphärischen Qualität der Moschee. Die Bauaufgabe Moschee wird in meinem Masterkurs inspiriert durch experimentelle, modellhafte, skulpturale Versuchsanordnungen in einem vorhandenen Raum. In einer improvisierten Laborsituation wird die Wirkung der Farbe im Raum untersucht und auf die zentrale Rolle des Ornaments in der islamischen Kultur eingegangen. Mit der digitalen Bearbeitung ornamentaler Strukturen und der Applikation auf unterschiedliche transparente Trägermaterialien erforschen wir die Wirkungsweise von Farbe, Form und Ornament im Raum. Fotografie und Video werden als dokumentarische, konzeptuelle, reflektorische Medien eingesetzt um Raumwahrnehmung, Ortsanalyse und fotografisches Bild in Beziehung zu setzen, in die auch die Kontroversen um den Bau von Moscheen in unseren Städten einfließen können. Die Dokumentation der Entwurfsmodelle soll durch eine differenzierte Fotografie dargestellt werden, die in der Lage ist, die potenzielle Entwurfsidee zu verdeutlichen. Die visuellen Studien zu Raum, Farbe, Atmosphäre, Ornament sind integraler Bestandteil des Entwurfsprozesses als auch eigenständige Raumforschung. Das Ornament Das Ornament wird klassischerweise gleichgesetzt mit dem Maskenhaften, dem Schleier, der Bekleidung, dem Nebensächlichen, dem Rahmenden und dem Dekorativem. Andererseits besitzt das Ornament eine über den Zeichencharakter hinausgehende phänomenale Präsenz. Nach Sempers Bekleidungstheorie verweisen die Ornamente unmittelbar darauf, das die Wand ihren Ursprung in textilen Wandbehängen besitze. Demnach waren über ein Gerüst gespannte Teppiche die ersten architektonischen, raumschaffenden Elemente. Das Gewebe als Urform der Wand zeichnet sich heute noch in den vielfältigen Flächenornamenten ab. In der Basis und den Kapitellen der klassischen Säulenordnung wird die Wirkungsweise der Säule sinnlich präsent. Diese Übertragung in die Struktur sinnlicher Erfahrung geschieht nicht ikonisch abbildend, sondern indexikalisch verweisend. Daraus folgt, das die Ornamente keine freien Erfindungen sind, sondern das Ornament bildet die Schnittstelle zwischen der technischen und der anthropologischen Seite des Produktionsprozesses der Architektur wieder. Die Kritik von Adolf Loos setzt an der Praxis des Ornaments im aufkommenden Maschinenzeitalter an. In „ Ornament und Verbrechen“ stellt er die emotionalen Überschüssigkeiten des Handwerkers ins architektonische Werk vor, die sozusagen als Triebsublimierung motiviert ist und stellt sie den maschinellen Herstellungsprozessen entgegen. Aus der Prozessualität der Maschinenproduktion und ihrer immanenten Logik schließt Loos allerdings nicht die Entstehung neuer, eigener Ornamente aus, in denen sich die Prozesse des maschinellen Gemachtseins abzeichnen. Das Ornament ist also kein Beiprodukt, kein Interesses an einseitigen formalen Lösungen oder geometrischen Formen. Es erwächst aus den Themen und den Herstellungsprozessen der Architektur, ohne dass es darin restlos aufgeht, es ist nach Gadamer quasi ein „Zuwachs an Sein“. Heute verschiebt sich durch die algorithmischen Methoden der digitalen Technologie die Doppelpoligkeit des Ornaments zur konstruktiven Seite, wobei viele „ neue“ Ornamente heute nichts anderes sind als ein Aufguss des analogen Maschinenornament oder des klassischen Ornaments. Was als Ornament erscheint, ist lediglich ein Muster aus sich wiederholenden Figuren, die keine Verbindung zum eigentlichen Inhalt des Entwurfes repräsentieren sondern rein äußerliche Faktoren darstellen, eben Muster, nicht Ornamente. Die neuen Ornamente müssen also sichtbar werden lassen, was die systemimmanenten digitalen Techniken transportieren und nicht quasi symbolisch bildhafte Zeichen auf die Fassade applizieren. Ornamentcharakter im Sinne des neuen Ornaments entsteht dort, wo z. B. in der Gestalt des Tragwerks in Arata Isozakis Entwurf für den neuen Bahnhof in Florenz der Verlauf der statischen Spannungen sichtbar gemacht wird und in die amorphe Struktur des Tragwerks selbst übersetzt wird. 233 234 Eine Moschee für München Bartolomej Slugocki 235 Eine Moschee für München 236 Felipe Rodriguez 237 Modul 5.2 FWP Prof. Maren Paulat Der Atmosphärische Raum 238 Raumlabor_Studien in Fläche und Raum Untersuchungen zum atmosphärischen Raum Das Masterprojekt „ Eine Moschee für München“ von Andreas Meck und mir wird in einem Wahlpflichtmodul mit der Thematik des atmosphärischen Raumes vertieft. Ich beziehe mich auf das Vokabular und die Analyse des Philosophen Gernot Böhme, um atmosphärische Charaktere zu definieren und das Thema der Immersion zu untersuchen. In Experimenten mit Farbe, Licht, Ornament und Material wird die Wirkungsweise von Atmosphären erprobt, wobei diese Umgebungsqualitäten und das Befinden des Betrachters / Teilnehmers aufeinander bezogen sind. Als Orte für diese Versuchsanordnungen stehen der Lichthof im Hauptgebäude und in der Clemensstraße ein Raum ohne Tageslicht und ein Raum mit Tageslicht zur Verfügung. In diesen Räumen kann z. B. mit farbigen Folien, Projektionen und direkt auf die Wand gearbeitet werden. Diese vertiefenden Studien in einem anderen Maßstab inspirieren das gemeinsame Entwurfsthema und sind auch eigenständige Raumforschung. 239 240 241 Masterstudiengang Projektstudio III Prof. Jörg Weber Prof. Martin Zoll Prof. Dr. Florian Zimmermann LB Günter Forster sirmioneRevista 242 vorbemerkung architektur wird als vielschichtiges berufsbild formuliert, das sich auf vielfältige art und weise und in verschiedensten maßstäben manifestieren kann. architektur wird auf dieser basis zum kulturellen, sozialen und politischen metier, das imstande ist, die gesellschaft mitzubestimmen und zu verändern. die architekturausbildung orientiert sich mithin an der vermittlung analytischer, intellektueller, gestalterischer und experimenteller positionen. das masterstudium vermittelt den experimentellen, methodenkritischen und kreativen umgang mit konzepten und materialien. grundlage dafür sind projekte und studien, die funktionen, typologien, räume, technologien und tragwerke entwickeln – vom technischen detail bis zum formen und planen urbaner gefüge. architektur tritt dabei als gebautes gebäude, als virtuelles konstrukt oder als organisationsform auf. ort und thema sirmione als ort und kontext birgt wie in einer miniatur wesentliches zur abendländischen bautradition. in der durch die einzigartige lage am wasser geprägten textur finden sich im in- und nebeneinander von bau-, natur-, wirtschafts- und sozialgeschichte alle elemente, die dem wandel gesellschaftlicher ambitionen und konflikte ausdruck verleihen. sirmione und erholung bilden seit catullus eine unzertrennliche einheit. seit der römerzeit besitzt der ort magischen reiz für touristen und genießer, was seinen niederschlag in der villen-, hotel und gartenkunst fand. das auf den ersten blick dem genius loci des perfekten oberitalienischen ferienidylls zugerechnete erscheinungsbild erweist sich als höchst differenziertes gemenge räumlicher, wirtschaftlicher und sozialer strukturen. das projektsstudio III ‚sirmione RIVISTA’ beschäftigt sich an einer topografisch wie räumlich stark ausgeprägten schnittstelle auf der halbinsel mit fortgeschrittenen fragestellungen der stadtbaukunst und der architektur anhand der themen: architektur und/oder tourismus bzw. ensemble und stadtraum. ziele und projektstudium die intensive analyse sirmiones sowie die integration neuer bebauungsstrukturen im sinne einer RIVISTA (ital. durchsicht) soll anhand dieser aufgabenstellung thematisiert und der begriff des ensembles als städtebauliche und strukturelle idee verdeutlicht werden. die wirkung der einzelnen teile zueinander und über das einzelne element hinaus sowie ihre wirkung zum bestehenden kontext genau und präzise zu entwickeln ist das ziel des projektstudios. die teilnehmer sollen die kunst, das wesen von stadtbaukunst und architektur zu erfassen und charaktervolle stadträume und schöne gebäude zu entwerfen, weiterentwickeln. in den s. g. projektstudios des masterstudiengangs architektur werden die ziele des interdisziplinären ganzheitlichen lernens, der praxis- und problemorientierung, der teamarbeit und der eigenständigen konzeptionellen planungs- und entwurfsarbeit verfolgt. ein wichtiger bestandteil innerhalb der gesamten projektarbeit ist die exkursion zum gardasee und sirmione. sie dient der beschäftigung mit dem ort, der sammlung von informationen und der praktischen erprobung von methoden im planungs- und entwurfsprozess. zudem bietet die region die möglichkeit sich mit herausragenden beispielen moderner architektur und oberitalienischer stadt- und gartenbaukunst kritisch auseinanderzusetzen. 243 Ein neues Stadtzentrum für Sirmione STÄDTEBAULICHES KONZEPT Die städtebauliche Struktur schafft ein neues Zentrum für Sirmione. Dabei knüpft die Bebauung an die südlichen Bestandsstrukturen an und schafft im Norden einen klare Trennung zur historischen Altstadt. Hier entsteht ein neuer Platz als Vorbereich, Sammelpunkt und Eingangsituation mit Blick auf das Castello Scaligero. Zugleich entsteht ein weiterer zentraler Platz, der in mitten der Neuen Bebauung gelegen, dem Besucher als Treffpunkt und Ort des Ankommens dient. Der Platz verknüpft neue, wichtige Funktionen wie Theater und Bibliothek. Als neuer Erholungs-, Sport- und Grünraum kann der Park im süd-westlichen Teil des Areals genutzt werden. Die Grünachse der Allee mit ihrem alten Baumbestand wird beibehalten und dient weiterhin als zentrale Erschließungsachse um die beiden Plätze zu verbinden. An der Spitze der östlichen Landzunge wird der dort vorhandene 270-Grad Blick genutzt und nicht vollständig bebaut, so dass ein Ort mit hoher Aussichtsqualität entsteht. Die bestehende Ufer-Promenade am westlichen Ufer Sirmiones, wird erhalten und durch die Verbreiterung gestärkt. Im unteren Teil werden Sitzstufen angelegt, die zum Wasser führen. Die Erschließungssituation wird mit Hilfe eines Boots- und Busshuttlebetriebs, vom Haupthafen im Süden bis zum neuen Zentrum, entzerrt. Von dort aus kann die Altstadt per Elektro-Caddie oder zu Fuß erschlossen werden. Es entstehen neue Parkmöglichkeiten für Anwohner und Hotelgäste unter der neuen Grünfläche. 244 Benjamin Neumeier, Sebastian Philipp 245 246 247 Teatro Sirmione AUFGABE Entwurf eines Theaters auf der Landzunge von Sirmione im Gardasee. LAGE Das Planungsgebiet ist begrenzt vom natürlichen Ufer des Gardasees im Osten, der Haupterschließungsstrasse in die Altstadt (Nord-Süd-Achse) und dem geplanten Stadtplatz im Westen. Im weiteren Umfeld befindet sich die Altstadt Sirmione mit der Scaligerburg (Castello Scaligero) und den Grotten des Catull (Grotte di Catullo). BAUKÖRPER Aus dem geplanten Vorplatz heraus steigt ein Sichtbetonbügel in einer kraftvollen Bewegung auf und senkt sich in entgegengesetzter Richtung mit einer verneigenden Geste zum Gardasee wieder ab. Der dynamische Baukörper passt sich in der Gebäudehöhe seiner Umgebung an. Neben dem Theater sind noch weitere Nutzungen wie ein Restaurant, Ausstellungsflächen, Verwaltungsräumen, Kino und ein kleines Café untergebracht. INNENRAUM Der Theaterraum ist als massiver Block in den Sichtbetonbügel eingestellt und ihn durchbricht, als Pendant dazu befindet sich an der Südostfassade ein Luftraum der von der Stahl-Glas-Konstruktion belichtet wird und sich über alle Geschosse zieht. Oberhalb des Luftraums befindet sich ein kleiner Dachgarten mit einem Café. Die öffentliche Durchwegung des Gebäudes auf Erdgeschossniveau ist gewollt und soll außerdem eine weitere Verbindung vom neugestalteten Vorplatz zur großen Freiluftterrasse dienen. 248 Sebastian Philipp Lager Technik Technik/Lüftung Bar Beh. WC Technik WC_He Seitenbühne Ausgabe WC_Da Lager_01 WC - Damen Foyer Zugang Bühne Küche Kühlung Hausmeister Zugang Tiefgarage Pause Umkleide Damen Lager Umkleide Herren A Feste Restaurant Bar Putzraum Beh. WC ang ing pte Hau n WC - Herre Lager_02 Zuga Resta ng uran t A Bühne g Technik fan d Win Seitenbühne Warten / Ausstellungsfläche Büchershop e Kass Kasse Ticket Garderobe Lager Backoffice arage rt Tiefg Zufah teatro sirmione teatro sirmione 249 Ein Rathaus und eine Bibliothek Im Vorfeld der historischen Altstadt entstand im Rahmen der städtebaulichen Aufgabenstellung eine Neubeplanung der Parkplatzstrukturen und Hotelbauten. Als neues zentrales Element entstand ein Stadtplatz, der den Besuchern als Ankommenspunkt dient. Dort entstehen neue Nutzungen zur Urbanisierung der Landzunge. Ein Rathaus und eine Bibliothek. Die Gebäude fassen den Stadtplatz nach Süden hin, der Bibliotheksturm stellt sich als Merkzeichen in die Achse der alten Allee und tritt in Beziehung mit dem Castelllo Scaligero. Das Rathaus als neue Stadtverwaltung beinhaltet die Tourismusinformation, Bürgerbüro, Sitzungssaal, Bauamt und weitere wichtige Funktionen. Als Haupterschließungselement dient eine Treppe die sich geradlinig durch alle Ebenen zieht. Der zentrale Luftraum, der durch Stege und Plattformen verbunden ist dient auf jedem Geschoss als Foyer und Kommunikationsebene und zieht sich bis ins Untergeschoss durch. Das räumliche Konzept der Bibliothek funktioniert durch eingestellte, zueinander verschobene Boxen. Es bilden sich geschosshohe Zwischenräume auf den Boxen sowie Lufträume mit unterschiedlichen Höhen. Diese Räume werden durch die äußere transparente Hülle gefasst und definiert. Erschlossen wird das Gebäude über frei angeordnete Treppen sowie einem Kern, der alle Ebenen durchdringt. Im Eingangsbereich klappt sich das Auditorium ins Untergeschoss, auf der obersten Ebene befindet sich ein Cafe mit Dachterrasse, von dort aus öffnet sich der Blick auf die Altstadt. 250 Benjamin Neumeier Foyer / Ausstellung Auditorium Technik Büro_Tourismusinfo Empfangstheke Hotelinformation Büro_01 Serverraum / Technik Tourismusinformation Foyer Bürgerbüro COMUNE I SIRMIONE 251 Sirmione Rivista Museeum mit öffentlichen Einrichtungen An dem nördlichen Rand des städtebaulichen Entwurfsgebietes soll auf einen Patchworkflecken ein Gebäude entstehen. Hierbei soll das Volumen aus dem städtebaulichen Grundgedanken dem Ort angemessen bebaut werden. Dadurch entstand ein großvolumiger Baukörper den es nun galt architektonisch zu zerlegen, zu beleben und ein Gebäude zu entwerfen. An diesem Ort ist besonders ausschlaggebend, dass im Norden der direkte Blick auf die Altstadt und vor allem auf die Burg von Sirmione frei liegt. Westlich orientiert sich das Grundstück zum Wasser hin und südlich wird der Blick frei auf die im städtebaulichen Entwurf vorgesehene Grünzone mit Baumbestand und freien Grasflächen. Aus dieser Situation heraus wurden nun die wesentlichen Blickbeziehungen über das Grundstück gelegt und anhand dieser, der Baukörper dann durchtrennt und in Einzelteile zerlegt. In der Weiterentwicklung wurde deutlich, dass die Schwerpunkte Burg und Gardasee noch verstärkt werden sollten. Um diesen Blickbeziehungen noch mehr Ausdruck zu verleihen wurden dem Baukörper im unteren Teil noch weitere Volumina ausgeschnitten und gleichzeitig im Dachbereich wieder aufgefüllt. Das hat zur Konsequenz, dass der Blick des Betrachters vom Gebäude aus noch mehr gerahmt und geformt wird. Das Gebäude bekommt dadurch eine im unteren Drittel verstärkte Orientierung zum Außenraum hin, im Obergeschoss soll sich dies aber umkehren und auch funktional bedingt eine eher introvertierte Orientierung entstehen. In den so entstandenen Baukörper wurden nun die dem Ort angemessenen und passenden Funktionen untergebracht. Dabei lag der Schwerpunkt darauf, den ursprünglichen Einrichtungen, die sich bisher dort befinden, eine neue und angemessene Unterkunft zu bieten. So bekam die dort ansässige Polizeiaußenstelle ein neues Verwaltungsgebäude, welches im südöstlichen Teil des Gebäudes über drei Geschosse angeordnet ist. Ebenso wurden der Touristeninformation neue Räumlichkeiten zugewiesen. Als neue Einrichtung entstand im Obergeschoss des Gebäudes ein Museum, welches Raum für eine permanente Ausstellung sowie Ausstellungsfläche für temporäre Ausstellungen bietet. Im Erdgeschoss befindet sich unter anderem noch ein Museumsshop und eine Bar/ Café welches die Ausrichtung zum See nach Western hin voll ausnutzt. Durch die Glasfassaden an den Räumen und auch von der Terrasse aus kann man immer das volle Panorama des Sees mit der dahinter liegenden Hügel und Berglandschaft Norditaliens genießen. Ziel des Entwurfs war es, ein Gebäude zu erschaffen, welches modern funktional und optisch ansprechend ist, sich aber gleichzeitig in das dortige Bauumfeld einpasst und einen Kontext zur dort bestehenden Altstadt aufbaut. Dies wird durch die gewählte Natursteinfassade aus Kalkstein möglich. Dadurch fügt sich das Gebäude harmonisch und authentisch in die Region ein. Optisch harmoniert so die Burg Sirmione mit dem neuen Gebäude nicht nur rein äußerlich. Auch innerlich bauen eben diese beiden Gebäude eine Beziehung auf. Während die Burg im Innern kein wirkliches Leben mehr beinhaltet und nur noch reine leere Räume zur Besichtung bietet, soll im Gegensatz das neue Museum mit öffentlichen Einrichtungen ein belebter Ort sein. Authentisches einer Region lässt sich nicht so schnell auswechseln und diese Beständigkeit und Nachhaltigkeit soll dieser Entwurf zum Ausdruck bringen. 252 Julia Kapahnke 253 Sirmione Revista STÄDTEBAULICHE SITUATION Sirmione eine kleine Halbinsel inmitten des Gardasees hat eigentlich hohes Potential. Viele Touristen besuchen diesen schönen Flecken Erde. Leider ist für Touristen bisher nur die Altstadt ein Anlaufpunkt. Um eine neue Attraktion zu schaffen, habe ich beschlossen, mich mit dem Entwurf eines Kulturzentrums mit großem Saal und Tagungsräumen zu beschäftigen. Das neue Kulturzentrum „Centro Cultura“ liegt an einer der exponiertesten Stellen, in der Mitte des zu planenden Gebietes. Die Außenkanten des Städtebaus gehen auf die umliegenden Plätze ein. Fast frei steht dieses Gebäude auf der angeschütteten Landnase. KONZEPT Das Konzept liegt dem Ablauf der für mich wichtigsten Räume eines Kulturzentrums in Einklang mit dem Standort zugrunde. Der Besucher soll in einer großzügigen Eingangshalle ankommen und sich dann über Freitreppen in die Foyers verteilen. Wichtig war mir hierbei, dass die Foyers immer an der Ostseite des Gebäudes liegen um den einzigartigen Blick auf den See zu nutzen. In den Foyers befinden sich die Lounge- und Barbereiche die jeweils mit einem Luftraum zum nächsten Geschoss verbunden sind. So entsteht nicht nur ein horizontaler Bezug nach außen sondern auch in der Vertikalen. Diese zweigeschossigen Barbereiche sind mit großen Panoramafenstern versehen. Von den Foyers verteilt man sich entweder in den großen Saal oder in die Tagungs- und Seminarräume. AUSRICHTUNG Das Gebäude liegt zwischen dem Piazza del Centro und dem Gardasee. Da nach Süden hin der Abstand zu der Nachbarbebauung geringer ist, orientiert sich das Gebäude hauptsächlich Richtung Norden und Osten, Richtung See, Berge und Burg. Dies wird wiederum auch durch die schräge Form des Grundrisses erreicht. EINGANG Der Eingang des Gebäudes liegt an dem Punkt, an dem sich alle Wege kreuzen. Also die für Fußgänger, Fahrradfahrer oder Bootsfahrer. Durch die großzügige Verglasung und die Auskragung wird diese Ecke des Gebäudes besonders betont und sofort wahrgenommen. MATERIALIEN FASSADE Die Fassade besteht aus einem Backstein in warmem Grauton. Dieser soll die Eigenständigkeit und die Monumentalität des Gebäudes unterstützen. Die Verlegung soll dünnformatig sein. WÄNDE/ DECKEN Innen sind die Wände aus Sichtbeton. Die Einteilung der Schaltafeln ist großformatig. BODEN Der Boden besteht aus robustem dunkelgrauen Epoxidharz-Estrich MÖBEL/ TÜREN Die Möbel sind aus Nussbaumholz gefertigt. 254 Karin Martin Grundriss Erdgeschoss Lageplan 255 Master 03 Projektstudio II Master 04 Projektseminar II Prof. Tomáš Valena LB Peter Haimerl Der strukturalistische Ansatz 256 Der ursprünglich in der Linguistik entwickelte strukturalistische Ansatz wurde seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts als wissenschaftliche Methode in die Anthropologie und andere Humanwissenschaften eingeführt. Die für den Strukturalismus wesentliche Doppelkategorie von Primär- und Sekundärstruktur (langue und parole), in der die Sekundärelemente durch das Regelwerk der Primärstruktur zueinander in Beziehung gesetzt werden, avancierte in den 60er und 70er Jahren auch zu einer Leitideologie in Architektur und Städtebau. Seit den frühen 90er Jahren sind wir wieder Zeugen eines Wiederauflebens strukturalistischer Tendenzen in der Architektur. Man spricht vom Neo-Strukturalismus digitaler Prägung. Die aktuellen regelbasierten Entwurfsmethoden gehören heute zu den produktivsten, umfassendsten und zukunftsfähigsten Herangehensweisen bei der Organisation und Gestaltung der gebauten Umwelt. Im Studio wurde der strukturalistische Ansatz auf drei Ebenen und in drei Schritten mit Kurzentwürfen eingeübt: zunächst wurde aus einem vorgegebenen Fundus an Möglichkeiten eine für die strukturalistische Vorgehensweise angemessene Aufgabe ausgewählt und ortlos untersucht. Im zweiten Schritt wurde für die konkrete Aufgabe ein angemessener Ort gesucht und im Kurzentwurf beplant. Für den letzten Schritt wurde aus dem mittlerweile erarbeiteten Wissen eine angemessene strukturalistische Entwurfsmethode entwickelt. 257 Der strukturalistische Ansatz SCHLACHTHOF – WIEDERBELEBUNG EINER INDUSTRIEBRACHE Das Münchner Schlachthofviertel liegt im Stadtteil Isarvorstadt-Ludwigsvorstadt im Süden Münchens. Zentral gelegen sind sowohl Theresienwiese, Isarauen und die Innenstadt schnell zu erreichen. Der Entwurf setzt sich mit dem Schlachthofgelände nördlich und südlich der Zenettistrasse auseinander. Das heterogene Gebiet liegt größtenteils brach und besticht durch großmaßstäbliche Bebauungen wie Markthallen, Kühldepots und den Betriebsgebäuden des Schlachthofes. Aufgabe des Entwurfes ist die Reaktivierung des Schlachthofareals. Unter Einbezug des Bestandes sollen neue Strukturen die Substanz ergänzen und mit öffentlichen Einrichtungen und Wohnnutzung erweitert werden. STRUKTUR, METHODE Das Gelände wird mit einem Raster von 6 x 6 Metern überspannt. Auf diesem Netz bewegen sich die Gebäudestrukturen und nehmen Rücksicht auf Verkehrsachsen und Bestand. Das Netz wird so lange angepasst, bis sich zufriedenstellende Gebäude- und Außenräume bilden. Des Weiteren werden auf dem Raster an strategisch sinnvollen Punkten Erschließungskerne verteilt, die neben der Erschließung auch die vertikale Lastabtragung gewährleisten. Auf den Kernen bilden 2-geschossige Gebäuderiegel die Primärstruktur. Ebenfalls auf dem Raster liegend nehmen diese als Sekundärstruktur modulare Strukturen auf, die in verschiedener Kombination Büro-, Gewerbe- und Wohnungsnutzung aufnehmen. NUTZUNG Die bestehenden Gebäude werden für kulturelle und öffentliche Zwecke umgenutzt. Somit wird beispielsweise das ehemalige Wannen- und Brausebad wieder aktiviert. Zudem entstehen Räumlichkeiten für Konzerte, Veranstaltungen, Ausstellungen und Einrichtungen wie Kindertagesstätten. 258 Bennet Kayser Die bestehende Markthalle beim Viehmarkt wird aufgewertet und bietet das geschäftliche Zentrum des Quartiers. Das Wirtshaus im Schlachthof bleibt weiterhin bestehen und bildet den neuen Quartiersmittelpunkt. Die alte Substanz wird durch die neue Struktur ergänzt. Die unteren Geschosse ergänzen die Nutzung durch Büro-, und Geschäftsflächen, während die oberen Geschosse dem Wohnen vorbehalten sind. KONSTRUKTION Die Erschließungskerne bilden die vertikale Tragstruktur, auf der die horizontalen 2-geschossigen Gebäuderiegel aufliegen. Fachwerkträger über 2 Geschosse bilden das Traggerüst und überbrücken bis zu 60m Spannweite. Dies ermöglicht das Aufständern der Gebäude und das Überspannen der bestehenden Gebäudestrukturen. FREIFLÄCHEN Die neue Gebäudestruktur bildet eine Einheit mit dem Bestand. Durch das Aufständern der Konstruktion entstehen im Erdgeschoss großzügige öffentliche Freiflächen und Plätze in Bezug auf die Bestandsgebäude. Auf den Dächern der Gebäude entstehen halbprivate Außenräume für Bewohner und Besucher. 259