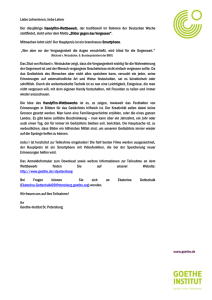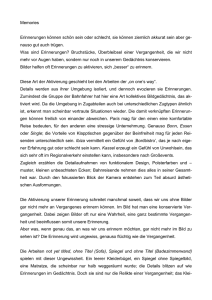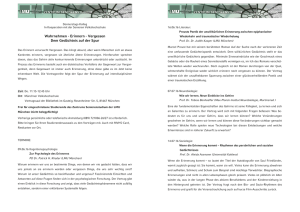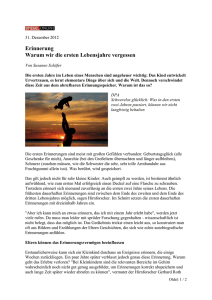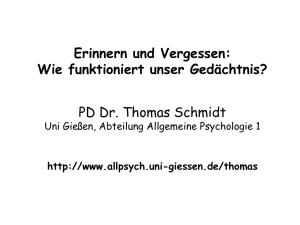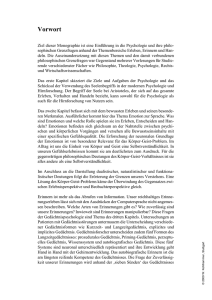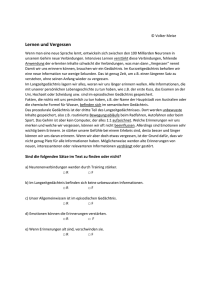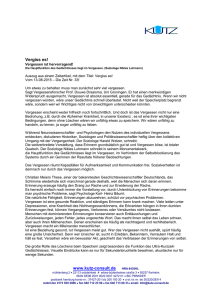Erinnern und Verdrängen
Werbung
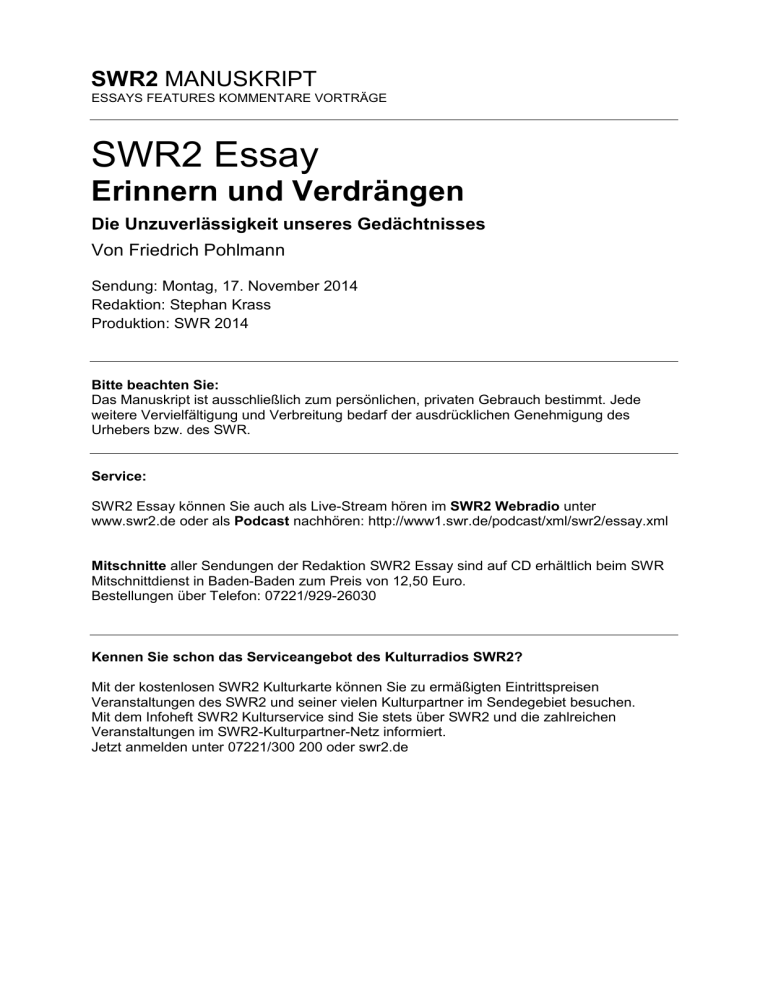
SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Essay Erinnern und Verdrängen Die Unzuverlässigkeit unseres Gedächtnisses Von Friedrich Pohlmann Sendung: Montag, 17. November 2014 Redaktion: Stephan Krass Produktion: SWR 2014 Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Service: SWR2 Essay können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter www.swr2.de oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/essay.xml Mitschnitte aller Sendungen der Redaktion SWR2 Essay sind auf CD erhältlich beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden zum Preis von 12,50 Euro. Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de Dass wir oft unangenehme Erfahrungen zu „verdrängen“ trachten, ist ein beliebter Topos und eine Jedermanns-Erfahrung. Unangenehme Erfahrungen erzeugen negative Erinnerungen, die uns manchmal auch ganz ungerufen zu belästigen vermögen, und als Schutz gegen solche unerbetenen Überraschungsgäste mobilisiert unsere Psyche dann bestimmte Strategien zur emotionalen Entschärfung des Unangenehmen. Das in der Alltagsrede heimisch gewordene Wortbild von der „Verdrängung“ soll eine solche Strategie bezeichnen, obwohl dessen Sinngehalt eigentlich gängigen Selbsterfahrungen des Erwachsenen nicht vollauf entspricht. Denn das Abdrängen bedrängender Erinnerungen an negativ getönte Erlebnisse an den Rand oder unter die Schwelle unseres Bewusstseins – der Wunsch ihrer Beförderung in den heilsamen Orkus des Vergessens – gelingt uns doch eigentlich kaum jemals vollständig, irgendwelche Erinnerungsspuren bleiben normalerweise erhalten. Eher ist es eine auch von der Forschung experimentell bestätigte Alltagsweisheit, dass ein forciert bewusstes Vergessen-Wollen unliebsamer Erinnerungen das paradoxe Ergebnis ihrer Akzentuierung im Bewusstsein zeitigt. Tatsächlich zielt das Wort „Verdrängung“ auch zumeist eher auf einen innerpsychischen Vorgang der Umdeutung von Ereignissen, der sie in der Erinnerung nicht verschwinden lässt, ihnen aber doch ihre potentiell verletzenden Stacheln nimmt. Der in der Psychologie prominent gewordene Begriff der „kognitiven Dissonanzreduktion“ bezeichnet den wohl typischsten Prozess derartiger Umdeutungen. Es gibt vielfältige Formen der Disssonanzreduktion, aber den meisten von uns sind doch Begradigungen und Beschönigungen biographischer Ereignisse nicht nur vor anderen, auch vor uns selbst - wohlvertraut: Wir pflegen Handlungen oder Widerfahrnisse, die in eklatantem Widerspruch zu unserem Selbstbild und Selbstbildideal stehen und deshalb mit Scham-, Peinlichkeits- und Versagensgefühlen assoziiert sind, so umzudeuten, dass sie ihren Charakter eines bedrohlichen Angriffs auf unser Selbstwertgefühl verlieren. Freilich: Obwohl die psychischen Mechanismen derartiger Umdeutungen gewöhnlich eher untergründig ihr Werk verrichten, sind wir uns doch meistens, wenn wir in uns gehen, sehr wohl irgendwie unserer kleineren und größeren Hochstapeleien vor anderen und uns selbst bewusst, die Umdeutung belastender Ereignissen impliziert, wenn es nicht um Kindheitserlebnisse geht, kein Vergessen ihres Kerns. Nun gab es allerdings in der jüngeren Vergangenheit die weitverbreitete, bis in Teile der fachwissenschaftlichen Öffentlichkeit hineinreichende Annahme, dass bei einer Gruppe von Erlebnissen die „Verdrängung“ sehr wohl deren vollständige Auslöschung aus dem erinnernden Bewusstsein bewirken könne: bei traumatischen Erlebnissen nämlich, insbesondere Fällen von Kindesmissbrauch. Dabei wurde allerdings die Auslöschung des traumatischen Erlebnisses aus dem Bewusstsein keineswegs als dessen komplettes Vergessen verstanden. Das Gedächtnis, so die These, bewahre eine Kopie des Ereignisses getreulich auf, allerdings nicht der dem Bewusstsein zugängliche Teil des Gedächtnisses, sondern seine unbewussten Regionen. In dessen Tiefen liege sie eingekapselt begraben, unerreichbar dem bewussten Ich, dem es gleichwohl durch beständige unterirdische Attacken schwere pathologische Schädigungen zufüge. Es gebe aber therapeutische Techniken wie beispielsweise die freie Assoziation, die die ins Unterbewusste versenkten Erinnerungslasten freizulegen und in einen Bestandteil bewussten Erinnerns umzuwandeln vermöchten: Was als vergessene Filmrolle im Kellerarchiv des Gedächtnisses gelagert habe, könne also nach gewissen Rekonstruktionsarbeiten in der Therapie wieder in den Projektor eingelegt werden, und der abgespulte Film präsentiere dann dem einzelnen einen bedeutsamen Teil seiner Vergangenheit, wie „sie wirklich war“. Tatsächlich knüpfen 2 solche metapherngesättigten Thesen über den Verlust und die Wiedererlangung von Erinnerungen - also über die „Verdrängung“ und ihre „Aufhebung“ - an Grundgedanken der Freudschen Psychoanalyse an, aber gesellschaftliche Brisanz erlangten sie in den achtziger und neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts auch deswegen, weil sie in den Händen gewisser Alternativ-Psychologen mit feministischen Zeitgeist-Mythologemen aufgeladen wurden. Im Feminismus war seinerzeit die Behauptung des massenhaften sexuellen Missbrauchs von Töchtern durch ihre Väter zu einer Anklage-Mode geworden, die vor allem in den USA medial aggressiv verbreitet wurde. So führte ein feministischer Opferkult im Zusammenhang mit den skizzierten Vorstellungen über die „Aufhebung von Verdrängungen“ dazu, dass in den USA viele junge Frauen in ihren Therapien den sexuellen Missbrauch durch ihre Väter wieder zu erinnern meinten und ein Entrüstungspotential aufhäuften, das die Massenmedien begierig aufgriffen. Es war kein Wunder, dass in dieser Zeitgeist-Atmosphäre das wiedererinnerte Opfer-Sein nicht nur zu Moralattacken genutzt wurde, sondern auch zu gerichtlichen Anklagen gegen die wiedererinnerten Täter. So gab es im Gefolge therapeutisch wiedererlangter Erinnerungen eine Vielzahl von Gerichtsverfahren von Töchtern gegen ihre Väter, von denen dasjenige gegen Paul Ingram im Jahre 1988 am bekanntesten geworden ist. Den zwei Töchtern des tiefgläubigen Christen Paul Ingram war während einer quasitherapeutisch angelegten religiösen Freizeit, in der Sünden aufgearbeitet und dunkle Flecken in der Vergangenheit ausgeleuchtet wurden, wieder ins Bewusstsein emporgestiegen, dass sie vor Jahren von ihrem Vater grausam missbraucht worden seien, und zwar im Rahmen satanischer Kulthandlungen, die er damals regelmäßig praktiziert habe. Der Angeklagte stritt anfangs alle diese Anschuldigungen vehement ab, bis auch ihm nach aufreibenden Verhören seine Untaten als innere Bilder wieder gewärtig wurden. Er gestand und musste, wie auch andere aufgrund von WiederErinnerungen ihrer Töchter verurteilte Väter, eine jahrelange Gefängnisstrafe verbüßen. Von verdrängten und wiedererinnerten traumatischen Opfererfahrungen einer anderen Art handelt der Fall des Schweizer Klarinettenlehrers Bruno Doesseker. Während in den Fällen sexuellen Missbrauchs typischerweise spezifisch weibliche Opfer-Erinnerungen verhandelt wurden, ging es bei Doesseker um Traumata, die ihrer Natur nach geschlechtsspezifische Limitierungen ausschließen, gleichwohl aber immer mit einem höchst aufnahmebereiten Medienpublikum rechnen können. Doesseker, der in einer Pflegefamilie aufgewachsen war und sehr früh begonnen hatte, mit empathischer Leidenschaftlichkeit Erinnerungsliteratur von Konzentrationslager-Insassen zu verschlingen, war nämlich während eines Polenbesuches im Jahre 1972, der ihn unter anderem nach Auschwitz geführt hatte, auf bislang tief vergrabene Erinnerungen gestoßen, die ihm mehr und mehr unzweifelhaft evident erscheinen ließen, dass er „in Wahrheit“ jüdischer Abstammung sei, Binjamin Wilkomirski heiße, in Südpolen geboren und in seiner frühen Kindheit nach Ermordung der Eltern ins Konzentrationslager deportiert. Im Jahre 1948 sei er mit einem Kindertransport in die Schweiz verbracht worden und dort bei seiner Pflegefamilie untergekommen. Die Wiedererinnerungen seiner verschütteten Kindheitserfahrungen erlebte Wilkomirski in Sequenzen ihrerseits traumatischer Flashbacks. „Meine frühesten Erinnerungen“, so Wilkomirski, „gleichen einem Trümmerfeld einzelner Bilder und Abläufe. Brocken des Erinnerns mit harten, messerscharfen Konturen, die noch heute kaum ohne Verletzung zu berühren sind“. Wilkomirskis Niederschrift seiner selbst-verletzenden Erinnerungsfetzen wurde 1995 3 unter dem Titel „Bruchstücke“ veröffentlicht, einem erschütternden Werk, dessen Sprachstil wie eine gelungene Adaption an die Inkohärenz der im Autor empordrängenden inneren Bilder erscheint, die ihm sein wahres Selbst offenbarten. Die literarische Kritik wertete diesen Stil als Authentizitätsnachweis, und euphorische Rezensionen, die das Werk in eine Reihe mit den Erinnerungen Paul Celans und Primo Levis stellten, trugen dazu bei, dass es zu einem mehrfach ausgezeichneten Bestseller wurde. Die Wiedererinnerungen der Töchter Paul Ingrams und Binjamin Wilkomirskis sind ganz offensichtlich anderer Art als diejenigen Marcel Prousts, für den eine Geruchswahrnehmung zum Auslöser sehnsuchtsvoller Assoziativketten von Kindheitsbildern wurde oder als die wehmütigen tagtraumartigen Jugendbilder, die dem alternden Goethe in seiner „Zueignung“ zu Beginn des Faust wieder in den Sinn traten. Prousts und Goethes Erinnerungen sind subtile Bilder von introvertierter Individualität, während es in den Fällen Ingram und Wilkomirski um verdrängte traumatische Opfererlebnisse geht, die trotz aller Exklusivität doch durchaus Typisches zur Sprache bringen wollen: Typische Erfahrungen großer Kollektive - der Frauen im einen, von Opfergruppen des Nationalsozialismus im anderen Fall -, wie sie in den Medien immer wieder dargestellt wurden und werden. Mit anderen Worten: Was in den individuellen Gedächtnissen der Töchter Ingrams und Wilkomirskis wieder aufgedeckt wurde, will gleichzeitig Grundmerkmale eines überindividuellen Wissens bezeichnen, für das man auch den Begriff des „kollektiven“ Gedächtnisses geprägt hat; eines Erfahrungsfundus großer Menschengruppen, aus dem sie ihr WirBild beziehen, dessen konstitutive Bestandteile in medialen Erinnerungsspeichern aufbewahrt und durch Ströme alt-neuen Meinungsmaterials beständig revitalisiert werden. Die Fälle Ingram und Wilkomirski konnten nur deswegen derart publizitätswirksam werden, weil in ihnen eine Kongruenz individueller mit typischen Kollektiverinnerungen hervorzutreten schien. Nun wurden freilich schon früh Zweifel an der Zuverlässigkeit von WiederErinnerungen wie in diesen Fällen laut. Die bekannte Sozialpsychologin Elizabeth Loftus, die schon die Gründe für typische Irritierbarkeiten unseres Gedächtnisses, wie sie immer wieder in unwillentlich falschen Zeugenaussagen zu Tage treten, erforscht hatte, war von ihrer gänzlichen Unhaltbarkeit überzeugt und entwarf deshalb Anfang der neunziger Jahre ein berühmt gewordenes Experiment, das genauer die Wege der Implantierung „falscher“ Erinnerungen - solcher, die objektiv falsch sind, aber subjektiv für wahr gehalten werden - aufdecken wollte. Im Experiment wurden den Versuchsteilnehmern vier Erlebnisse aus ihrer Kindheit präsentiert, zu denen sie ihre Erinnerungen schildern sollten. Drei dieser Erlebnisberichte, die mit Hilfe anderer Familienmitglieder entworfen worden waren, beruhten auf tatsächlichen Begebenheiten, während eine frei erfunden war. Sie handelte davon, wie der Versuchsteilnehmer als fünf- oder sechsjähriges Kind angeblich in einem Einkaufszentrum verloren gegangen war, handelten also von einer tendenziell traumatischen Kindheitserfahrung von Verlust und hilflosem Ausgeliefertsein. Das erste interessante Versuchsergebnis war, dass sich tatsächlich ca. ein Drittel der Versuchsteilnehmer an dieses Kindheitsereignis „erinnerte“, ihr Gedächtnis also eine „falsche“ Erinnerung produzierte, aber noch verblüffender war, was dann in der Folge mit dieser falschen Erinnerung geschah. Nachdem das Samenkorn der falschen Erinnerung eingepflanzt worden war, „erinnerten“ die Versuchsteilnehmer, die in gewissen Zeitabständen zu weiteren 4 Erinnerungsschilderungen gebeten wurden, von Mal zu Mal mehr Details des Ereignisses. Aus dem Samenkorn waren Assoziationsketten weiterer falscher Erinnerungen entsprossen, die sich zu „stories“ zusammenfügten, deren Einzelheiten zwar irgendwie Sinn machten, aber in dem implantierten ursprünglichen Sinnmaterial in keiner Weise enthalten waren. Offensichtlich hatte die intensive gedankliche Beschäftigung mit einer fiktiven Erfahrung die Fiktion der Vorstellungskraft so vertraut gemacht, dass an ihrer „Wahrheit“ gar nicht mehr gezweifelt wurde; und ineins mit diesem Zur-Wahrheit-Werden einer Fiktion entstand im Zuge „passender“ Assoziationen eine subjektiv sinnvolle Geschichte, die die Fiktion umschloss und ihr Halt gab - eine Form, die sich dem Gedächtnis eingravierte, leicht abrufbar war und sich mit jeder „Wiedererinnerung“ bestätigte und vertiefte. Auch die angeblich in Therapien aus ihrer „Verdrängung“ befreiten traumatischen Erinnerungen an Missbrauchserfahrungen á la Ingram waren für Loftus falsche Erinnerungen; Produkte der Suggestion durch ideologisch voreingenommene Therapeuten, mittels derer sich banale psychische Verletzungen ihrer weiblichen Klienten in dramatische, zweifelsfrei für wahr gehaltene Geschichten verwandelten, die der Person eine festumrissene Identität geben: die des Opfers. Sie waren also - um das sozialwissenschaftliche Modewort zu benutzen - „Konstrukte“ fehlgeleiteter Therapeut-Patient-Interaktionen, Konstrukte ohne jeglichen Wirklichkeitsbezug. Es gibt aber nicht nur falsche Opfer-Erinnerungen. Loftus gelang in einem QuasiExperiment sogar der Nachweis, dass auch die Implantierung falscher Erinnerungen möglich ist, in denen es um Täterschaft geht. Sie ließ den verurteilten Paul Ingram, der ja seine angeblichen Verbrechen nach erschöpfenden Polizeiverhören gestanden hatte, im Gefängnis durch einen Kollegen besuchen, der ihm eröffnete, man habe Beweise für eine weitere, bisher unentdeckte Untat. Nach deren Schilderung - einer frei erfundenen Geschichte - konnte sich Ingram zunächst zwar an nichts erinnern, bekannte sich aber am nächsten Tag zu seiner Täterschaft auch in diesem Fall mit einer ausgeschmückten Version der ihm erzählten Geschichte. Dem Gericht reichte das allerdings nicht als Unschuldsbeweis, Ingram musste noch lange Jahre hinter Gittern für die falschen Erinnerungen seiner Töchter und seine eigenen büßen. Übrigens waren auch die Selbst-Erinnerungen Binjamin Wilkomirskis falsche Erinnerungen. Wilkomirski, der die Lesungen der „Bruchstücke“ durch seinen Lektor auf seiner Klarinette mit traurig-wehmütigen Klezmer-Weisen zu umrahmen pflegte, war, wie die - im Literaturbetrieb nur ganz ungern aufgenommene - zweifelsfreie Aufdeckung seiner wahren Herkunft ergab, gar kein jüdisches KZ-Opfer, also auch nicht Wilkomirski. Aber offensichtlich war er auch kein banaler Betrüger oder Hochstapler, den unlautere Motive zur Teilnahme am beliebten Wettrennen um einen Spitzenplatz auf der Nazi-Opferliste gedrängt hatten. Er war wohl eher ein Mensch mit problematischer Persönlichkeitsstruktur, der im Zuge seiner langjährigen obsessiven Beschäftigung mit Konzentrationslager-Literatur in Prozessen der SelbstSuggestion mehr und mehr mit einer neuen Identität und den entsprechenden „Erinnerungen“ verwachsen war. Die endgültige Selbstbeglaubigung dieser neuen Identität geschah dann durch die Niederschrift der „Bruchstücke“, die seinen Erinnerungsfiktionen eine fixierte, externalisierte Form verschaffte. Elizabeth Loftus jedenfalls zog aus ihren Forschungen zu Extremfällen falscher Erinnerungen á la Ingram oder Wilkomirski nicht nur den Schluss, dass etliche der im feministischen Opfer-Diskurs als unanzweifelbare Wahrheiten gehandelten Thesen ganz unglaubwürdige Ideologeme seien - wofür sie von politisch korrekter Seite in erwartbar persönlichkeitsverletzender Weise attackiert wurde -, sondern dass man 5 auch das psychologische Konzept der „Verdrängung“ in seiner auf Freud zurückgehenden Form endgültig ad acta legen solle: Es gebe nicht den geringsten Beweis für einen psychischen oder hirnphysiologischen Verdrängungsmechanismus, der die Erinnerungen an traumatische Erfahrungen aus dem Bewusstsein vollständig zu löschen vermöchte und sie in unbewusste Regionen verbannte, aus denen sie dann nur therapeutische „freie Assoziationen“ oder „Flashbacks“ aufgrund spezifischer Auslösereize zu befreien vermöchten. Viel typischer als eine irgendwie geartete Verdrängung sei für viele Traumaopfer die geradezu obsessive Beschäftigung mit ihren traumatischen Erlebnissen. Nun ist aber unbestreitbar, dass es die kindliche Amnesie gibt, das vollständige Vergessen früher Kindheitserlebnisse. Die Freudsche Annahme allerdings, dass sie durch Verdrängung entweder traumatischer Erfahrungen oder als ungehörig zensierter Sexualwünsche zustande gekommen sei, spielt in der modernen psychologischen und neurologischen Forschung keine Rolle mehr. Diese Forschung ist in den letzten beiden Jahrzehnten zu faszinierenden neuen Einsichten in die Struktur und Entwicklung unseres Gedächtnisses gelangt, die vollkommen andere Deutungen nahelegen. Um zu einem besseren Verständnis unseres Erinnerns zu gelangen, sollen zunächst einige dieser neuen Einsichten grob skizziert werden. Zwei Grundgedanken müssen dabei an die Spitze gestellt werden: Dass erstens die Rede von „dem“ Gedächtnis eine vollkommen unzulässige Verkürzung darstellt – das entwickelte Gedächtnis ist ein System, in dem unterschiedliche Untersysteme zusammengeschlossen sind, die für höchst divergente Formen des Erinnerns zuständig sind; und dass sich, zweitens, diese multiplen Gedächtnissysteme in der Ontogenese in einer angebbaren Stufenfolge erst emporbilden - sie existieren nicht von vornherein -, bis zur Entfaltung der höchsten Form unseres Gedächtnisses, des episodischen oder autobiographischen Gedächtnisses, die ihrerseits ein langer, bis ins frühe Erwachsenenalter hineinreichender Entwicklungsprozess ist. Ein autobiographisches Erinnern vor der Entwicklung des episodischen Gedächtnisses, dessen früheste Rudimente sich erst ab dem dritten Lebensjahr auszubilden beginnen, ist unmöglich - die kindliche Amnesie ist kein Produkt der Verdrängung, sondern Folge eines noch ganz unfertigen Gedächtnissystems. Dem scheint allerdings eine autobiographische Erinnerung eines der bedeutendsten Psychologen des zwanzigsten Jahrhunderts zu widersprechen. Es handelt sich um Jean Piaget, der eine Erinnerung aus seiner Zeit als eineinhalbjähriges Kleinkind aufbewahrt hat. Piaget schreibt: „Ich sehe noch mit größter visueller Genauigkeit folgende Szene…Ich saß in meinem Kinderwagen, der von einer Amme auf den ChampsElysées geschoben wurde, als ein Kerl mich entführen wollte“. Einige Zeilen weiter freilich klärt uns Piaget auf, was es mit dieser Erinnerung auf sich hatte. Die Amme hatte, wie sich weit später herausstellte, diese Geschichte, die immer wieder im Familienkreis erzählt worden war, erfunden, auch Piagets Erinnerung war also eine falsche Erinnerung. Piaget schreibt: „Ich musste als … Kind diese Geschichte gehört haben …In der Form einer visuellen Erinnerung habe ich sie in die Vergangenheit zurückprojiziert. So ist die Geschichte also eine Erinnerung an eine Erinnerung, allerdings an eine falsche. Viele echte Erinnerungen sind zweifellos von derselben Art“. Für eine differenzierende Betrachtung unserer Gedächtnis- und Erinnerungsleistungen sind in der modernen Forschung drei kategoriale Dimensionen leitend geworden: Erstens eine zeitliche, zweitens eine funktionale und 6 drittens eine am Gegensatzpaar explizit/implizit orientierte. Die zeitliche Ebene betrifft die Unterscheidung zwischen einem Ultrakurzzeit-, Kurzzeit- und einem Langzeitgedächtnis. Während das Ultrakurzzeitgedächtnis im Bereich von Millisekunden operiert und sich vorwiegend auf die neuronalen Vorgänge des Wahrnehmungssystems bezieht, bleibt das Kurzzeitgedächtnis bis auf wenige Minuten aktiv. Es vermag sogar visuelle Wahrnehmungen zu speichern, die wegen der Schnelligkeit ihres Auftauchens und Verschwindens nicht unser Bewusstsein erreichen, auf die wir aber trotzdem emotional reagieren, - eine Kompetenz, die man experimentell getestet hat und die sich die Wirtschaftswerbung zunutze gemacht hat, indem sie beispielsweise blitzartig erscheinende Firmenlogos in Spielfilme hineingeschmuggelt hat. Für die Einspeicherung ins Langzeitgedächtnis sind Prozesse gerichteter Aufmerksamkeit notwendig, ansonsten gehen Kurzfristinformationen verloren, und dieses Vergessen ist ein höchst funktionaler Vorgang. Denn blieben alle diese Informationen für unsere gesamte Lebenszeit erinnerbar, wäre unser Gedächtnis derart mit Irrelevantem überlastet, dass wir handlungs- und entscheidungsunfähig würden. Die Einspeicherung von Erinnerungsgehalten ins Langzeitgedächtnis bewirkt neuronale Verknüpfungen, ein Engramm. Damit dieses - und damit das Erinnerte – erhalten bleibt, bedarf es bei kognitiven Erinnerungen normalerweise wiederholter Wieder-Erinnerungen, also der Erinnerung von Erinnerungen, eines Vorgangs, der kortikale Konsolidierung genannt wird. Freilich führt jede Erinnerung autobiographischer Erinnerungen auch zu Modifikationen derselben und ihrer Engramme in Abhängigkeit vom situationellen und lebensgeschichtlichen Kontext, in dem sie geschieht – keine Wieder-Erinnerung ist eine passgenaue Kopie ihrer Vorgängerin, sondern enthält immer auch Umdeutungen. Neben der zeitlichen Differenzierung unserer Gedächtnisleistungen ist, zweitens, eine funktional orientierte wichtig. Die moderne Forschung operiert nicht mehr mit der Vorstellung eines einheitlichen Gedächtnisses, sondern unterscheidet zwischen fünf Subsystemen des Langzeitgedächtnisses, denen man auch divergente Gehirnareale zuordnet. Erwähnt seien von diesen Subsystemen nur das sogenannte prozedurale, das semantische und das episodische Gedächtnis. Im prozeduralen Gedächtnis werden erlernte körperliche Verhaltensabläufe gespeichert, die dann vollständig automatisiert sind wie das Fahrradfahren und zu ihrer Abrufung keiner bewussten Bemühung bedürfen; das semantische Gedächtnis ist der Fundus für unser Sprachvermögen und alle jene symbolisch repräsentierten Wissensgehalte, die wir ohne Rekurs auf die Kontexte ihrer Entstehung erinnern wie etwa schulisch erlernte Rechenoperationen oder Geographiekenntnisse. Hingegen umschließt das episodische oder autobiographische Erinnern solche Gedächtnisgehalte, in denen auch die Zeit und der Ort ihrer Entstehung eingraviert sind - neben einem „Was“ also auch ein „Wann“ und ein „Wo“ -, und dabei der Erinnernde das Bewusstsein in besonderem Maße auf sich selbst im damaligen situationellen Kontext ausrichtet; Erinnerungen also, die von einer Person als Episoden ihrer eigenen Vergangenheit verstanden werden und ihr das Gefühl eines kohärenten und unaustauschbaren Selbst verleihen. Nur dieses Gedächtnissystem ist in vollem Sinn ein anthropologisches Privileg des Menschen - ein autobiographisches Erinnern ist keinem Tier möglich. Die Symbole und Wissensgehalte des semantischen Gedächtnisses bilden zwar eine logische und ontogenetische Voraussetzung für das episodische Gedächtnis, aber trotz der engen Beziehung beider Systeme okkupieren beide doch unterschiedliche Gehirnareale, was aus solchen ganz seltenen Krankheitsfällen erhellt, in denen der Totalausfall der lebensgeschichtlichen Erinnerung das semantische Gedächtnis unangetastet lässt. Die große Irritierbarkeit 7 unseres Gedächtnisses, von dem die spektakulären Fälle „falscher Erinnerungen“, die wir skizziert haben, künden, betrifft vor allem das episodische Gedächtnis und weniger das semantische und noch weniger das prozedurale. Denn das Typische für das semantische Gedächtnis ist nur das Verblassen und Vergessen von Gedächtnisinhalten, wenn sie nicht beständig wiedererinnert werden. Die aktive Umkonstruktion hingegen, die uns bei falschen Erinnerungen Fiktionen als subjektiv unangezweifelte Wahrheiten erscheinen lassen, geschieht vornehmlich beim autobiographischen Erinnern. Und zuletzt, drittens, noch einige Hinweise auf die dritte kategoriale Dimension, die in der modernen Forschung bei der differenzierenden Betrachtung von Gedächtnisleistungen bedeutsam geworden ist, die Unterscheidung zwischen impliziten und expliziten Erinnerungen. Explizite Erinnerungen sind immer sprachlich vermittelt und von einem Bewusstsein für die getätigte Erinnerungsleistung begleitet, während grundsätzlich alle vorprachlichen Erinnerungen des Säuglings und Kleinkindes, Erinnerungen an sensomotorische Abläufe, aber auch an emotionale Situationskomponenten also, implizite Erinnerungen sind. Implizit sind auch die Erinnerungen an frühkindliche Bindungserfahrungen. Unzureichende Bindungserfahrungen etwa samt der ihnen korrespondierenden psychischen Reaktionsmuster haben sich zwar dem Gedächtnis eingeschrieben und prägen die Charakterstruktur und typisch wiederkehrende Verhaltensmuster einer Person, sie können aber nicht über die Schwelle des expliziten Bewusstseins treten und sind gerade deswegen so resistent gegen Veränderungen. Auch das Abrufen unserer automatisierten Sprachkompetenzen im semantischen Gedächtnis oder die Orientierung an fraglos gültigen Sitten einer Gemeinschaft bezeichnet im wesentlichen ein implizites Erinnern, das erst dann bewusst wird, wenn unserem Gedächtnis beispielsweise ein Wort entglitten ist. Und schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass auch in unserem autobiographischen Gedächtnis implizite Erinnerungen gespeichert sind, die, wie wir sehen werden, keineswegs jederzeit der Person verfügbar sind und dass die verfügbaren auch von impliziten umlagert und durchzogen sein können. So wird das implizite Erinnern in allen Subsystemen des Gedächtnisses aktiviert, und es ist bestimmend in den Frühphasen der Ontogenese des Menschen. Der Begriff der impliziten Erinnerung hat die größte Nähe zum klassischen psychoanalytischen Konzept des Unbewussten, mit dem Unterschied allerdings, dass man dabei auf den Begriff der „Verdrängung“ vollständig verzichtet. Soweit einige differenzierende Hinweise zum Begriff des Gedächtnisses. Im folgenden werde ich mich ausschließlich auf das autobiographische Erinnern konzentrieren. Ich versuche zunächst eine anthropologisch orientierte Grundcharakterisierung. Unsere Vorstellung von Zeit bezeichnet ein an den Begriffen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausgerichtetes lineares Kontinuum, das unumkehrbar ist: Der Zeitpfeil zeigt nur in eine Richtung, vom Gestern ins Heute, aber nicht vom Heute ins Gestern. Einzig die menschliche Erinnerungsfähigkeit vermag den Zeitpfeil zur Umkehr zu zwingen, natürlich nicht in der materiellen Wirklichkeit, aber doch in der Wirklichkeit des Bewusstseins, als Vergegenwärtigung der Vergangenheit, WiederErleben des Gestern im Heute in der Innenwelt unserer Vorstellungskraft. Die mentale Zeitreise ins Gestern, die das autobiographische Erinnern ist, kann von starken Gefühlsaktivierungen begleitet sein, was aber nichts an der Tatsache ändert, dass ein derartiges Erinnern immer auch ein distanznehmender Vorstellungsprozess 8 ist: Die Erinnerung lässt den Sich-Erinnernden auf sich selbst wie auf einen Anderen blicken; sie produziert nach innen gerichtete Wahrnehmungsvorgänge auf ein Objekt, das niemand anders als das wahrnehmende Ich selbst ist, ein Ich, das erst in und durch diese Akte abstandnehmender Objektivierung, dieses Sich-selbstGegenübertretens, seiner selbst als einer unaustauschbaren Person gewahr wird. So ist die Abrufung von Erinnerungen des Ich an sich selbst der Inbegriff des menschlichen Selbst-Bewusstseins, das sich dabei ständig erneuert. Zwar ist die Rückbiegung des erinnernden Bewusstseins auf den Erinnernden eine mentale Rückreise in die Vergangenheit, aber dort muss nun das erinnerte Ich-Erlebnis seinerseits innerhalb einer zeitlichen Sequenz verortet werden, einem Vorher, einem Dann und einem Nachher, womit sich in der Vergangenheit die Temporalstruktur von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft noch einmal reproduziert. Diese wenigen Bemerkungen deuten schon an, ein welch anspruchsvoller anthropologischer Prozess das autobiographische Erinnern ist und welche Kompetenzen ontogenetisch entfaltet sein müssen, damit es überhaupt möglich wird. Ohne drei Schlüsselkompetenzen ist es undenkbar: entwickeltes Sprachvermögen, entwickeltes Selbst-Bewusstsein und Verfügung über einen ausgebildeten Zeitbegriff. Im Kindesalter bilden sich diese Kompetenzen erst langsam empor, was der Grund dafür ist, dass Kleinkinder zum autobiographischen Erinnern noch kaum befähigt sind. Und weil ihnen diese Erinnerungsfähigkeit abgeht, können auch Erwachsene keine Erinnerungen aus diesem Alter wiedererinnern, was der Hauptgrund für die Amnesie ist, die unsere frühe Kindheit - trotz ihrer prägenden Wirkung auf unsere Charakterstruktur - für uns unverfügbar macht. Die langsame Emporbildung der autobiographischen Erinnerungsfähigkeit geschieht in Kommunikationsprozessen zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen, in denen in der frühen Kindheit sogenannte „Erinnerungsgespräche“ eine zentrale Rolle spielen; Gespräche, in denen die Erwachsenen die Kommunikation gezielt auf zurückliegende Ereignisse hinlenken und im Dialog dem Kind immer mehr Details entlocken, unter denen seine emotionalen Bewertungen des Vergangenen eine herausgehobene Bedeutung einnehmen. Vom Differenziertheitsgrad derartiger Erinnerungsgespräche hängt ganz wesentlich die Ausbildung des Differenziertheitsgrades der kindlichen Erinnerungsfähigkeit als einer intrapsychischen Kompetenz ab, was übrigens ebenso für den Erwachsenen gilt: Je mehr und je differenzierter wir über autobiographisch bedeutsame Ereignisse reden - und sei es nur im inneren Zwiegespräch -, desto besser können sie erinnert werden. Die Entwicklung des autobiographischen Gedächtnisses ist ein langwieriger Prozess, der sich bis ins Ende der Adoleszenz hinein erstreckt. Entwicklungspsychologische Forschungen zeigen, dass die Fähigkeit zur Verknüpfung punktueller individuell bedeutsamer Erinnerungen zu einer linear ausgerichteten kohärenten Lebenserzählung mit einer plausiblen Eröffnung und Beendigung erst jungen Erwachsenen möglich ist. Wichtig ist noch der Hinweis auf kulturspezifische Besonderheiten der autobiographischen Erinnerungsfähigkeit. Obwohl das autobiographische Erinnern eine anthropologische Universalie bezeichnet – es gehört wesentlich zu unseren Vorstellungen vom Mensch-Sein -, wird ihm doch in unterschiedlichen Kulturen eine ganz unterschiedliche Bedeutung beigemessen, und entsprechend differieren auch seine Formung und Differenziertheit von Kultur zu Kultur ganz erheblich. Die positive Betonung der Einmaligkeit der persönlichen Geschichte ist ein Produkt der westlichen Kultur mit ihrem hochentwickelten Individualitätsbegriff, während in den gruppenorientierten Kulturen Asiens und Afrikas persönliche Erinnerungen viel stärker in die Kontexte eines Wir-Gruppenbewusstseins eingebettet sind. 9 Wir müssen jetzt genauer Einzelaspekte des autobiographischen Erinnerungsprozesses unter die Lupe nehmen. Zuerst richten wir das Augenmerk auf einen Modus des autobiographischen Erinnerns, den die Forschung stiefmütterlich behandelt, der aber in der künstlerischen Literatur um so häufiger beschrieben wird und jedem wohlvertraut ist: Die ganz ungerufen plötzlich aufgrund irgendeines Reizes, beispielsweise einer Geruchswahrnehmung auftauchenden Erinnerungen, die Proust „mémoire involontaire“ genannt hat; eine Erinnerung, um die sich die Person nicht willentlich bemüht hat, sondern die gewissermaßen in sie wie von außen hineingeweht ist. Oft sind das Erinnerungen sehr weit zurückliegender Ereignisse aus der Kindheit oder Jugend. Günter Grass hat in einer Rede einmal beide Modi des Sich-Erinnerns in einem Satz zusammengebunden. Er begann die Rede so: „Ich erinnere mich oder ich werde erinnert durch etwas, das mir quer steht, seinen Geruch hinterlassen hat oder in verjährten Briefen mit tückischen Stichworten darauf wartet, erinnert zu werden“. Der Satz vollzieht eine abrupte Wende von einer aktiven zu einer passiven Konstruktion, zum „ich werde erinnert“, zum Modus der mémoire involontaire. Was hat es nun mit dieser Variante der Erinnerung auf sich? Während der willentliche Erinnerungsprozess, das „ich erinnere mich“ ein aktiv steuerbarer rein intrapsychischer Vorgang ist, werden im passiven „ich werde erinnert“ der mémoire involontaire schlummernde Erinnerungen der Person erst dann wieder verfügbar, wenn sie durch äußere Reize aktiviert werden. Die Erinnerungen sind impliziter Natur und mit gewissen Sinneseindrücken visueller, akustischer oder geruchlicher Art unauflöslich verknüpft, und sie werden erst dann hervorgelockt, wenn kongruente Sinneseindrücke die Person von außen wieder berühren. Erst der passende äußere Reiz setzt die Erinnerung frei, übersetzt sie aus ihrem impliziten Latenzzustand in eine explizite Form, und weil dies ein von der Person nicht steuerbarer und weitgehend auf Zufällen beruhender Vorgang ist, kann man die mémoire involontaire zwar phänomenologisch beschreiben, aber für die empirischexperimentell ausgerichtete psychologische Forschung stellt sie ein weitgehend unzugängliches Feld dar. Neben der Unterscheidung der beiden Modi autobiographischer Erinnerung muss nun, zweitens, ein bereits oftmals angedeuteter Sachverhalt erläutert worden: Dass Erinnerungen an uns selbst kaum jemals nur Akte eines gefühlsneutralen Zur-Kenntnis-Nehmens darstellen, sondern gewöhnlich von mitschwingenden Emotionen unterschiedlicher Intensität begleitet werden. Emotionen aber sind keineswegs nur-psychische Phänomene, sondern unauflöslich mit bestimmten Reaktionsweisen des Körpers verknüpft, die ihrerseits differenzierbar sind. Drei Ebenen lassen sich unterscheiden: rein physiologische, wie sie sich beispielsweise in Veränderungen der Atem- oder Herzfrequenz und dem Erröten zeigen; zweitens Veränderungen der Mimik –Emotionen sind typischerweise mit ganz bestimmten mimischen Ausdrucksmustern verknüpft, unter denen diejenigen für die sechs Grundemotionen - Freude, Angst, Ärger, Trauer, Ekel und Überraschung anthropologische Universalien sind; und drittens Veränderungen der Körperhaltung – man denke an den in sich „eingesunkenen“ Körper des Trauernden oder Depressiven, den „gestrafften“ bei der Freude oder die Verbindung des Errötens mit dem zum Boden gewendeten Blick bei der Scham. Alle diese körperlichen Korrelate von Emotionen werden bei der Erinnerung emotional getönter Ereignisse auch wieder zum Schwingen gebracht, natürlich in unterschiedlichen Intensitätsgraden. Aber dass auch unausgesprochene Erinnerungen des Einzelnen an freudvolle Erfahrungen ein Lächeln oder sogar ein lautes Lachen entbinden können und zu einem „gehobenen“ Körpergefühl führen, ist jedem genauso vertraut wie die 10 Veränderung von Atemfrequenz, Mimik und Körperhaltung bei wiedererinnerten Angst- oder Schamerlebnissen. Wir kommen nun, drittens, zum Problem der Authentizität unserer autobiographischen Erinnerungen, ein Problem, das die eingangs behandelten Fälle „falscher Erinnerungen“ spektakulär verdeutlichten. Das Authentizitätsproblem ist aber nur angemessen behandelbar im Rahmen differenzierender Gesichtspunkte, von denen zunächst die Fragen nach dem Adressaten der Erinnerung und diejenige nach ihrer Medialität wichtig sind. Adressaten der Erinnerung können einzig die sich erinnernde Person selbst sein, aber auch ganz unterschiedliche Typen Anderer, bis hin zur anonymen Vielheit eines Lesepublikums, während als Medien der Erinnerung das innere Bild oder das gesprochene oder geschriebene Wort in Frage kommen. Berühren wir zunächst allein die in der inneren Vorstellungswelt des einzelnen verbleibenden Erinnerungen, und zwar jene der mémoire involontaire. Von äußeren Sinnesreizen in uns heraufgerufen, erreichen derartige Erinnerungen die Person typischerweise als assoziativer innerer Bilderreigen, dessen Authentizität für sie subjektiv völlig außer Frage steht: Sie wird eines lange nicht mehr verfügbaren Eindruckes in ihr Gedächtnis wieder gewahr, den gerade seine emotional-körperliche Resonanz und seine quasi-sinnliche Beschaffenheit - als visuelle, geruchliche oder akustische Erinnerung - als „echt“ vor ihr selbst beglaubigt. Derartige Erinnerungen aber sind gewöhnlich flüchtiger Natur. Sollen sie festgehalten und erweitert werden, so müssen sie ausgedrückt werden, wofür man aber gemeinhin in ein anderes Medium überwechseln muss: ins Medium des Wortes. Die Versprachlichung der erinnerten Eindrücke aber ist eine Übersetzung, die niemals vollauf ihrem emotionalen und sinnlich-somatischen Gehalt gerecht werden kann, was am meisten übrigens für Geruchswahrnehmungen und -erinnerungen gilt, für deren Unterscheidung - obwohl sinnlich eindeutig identifizierbar - die Sprache nur ganz dürftige Mittel zur Verfügung stellt. Christa Wolfs Diktum „Wie man es erzählen kann, so ist es nicht gewesen“ gilt auch für den Hiatus zwischen der Erinnerung als innerer Bilderfolge und ihrem sprachlichen Ausdruck. Man kann die Versprachlichung des Erinnerten als den Beginn einer Vielfalt von Metamorphosen seines Gehalts begreifen, jedenfalls dann, wenn die Versprachlichung nicht zu einer Verschriftlichung weitergeführt wird. Denn die Verschriftlichung zurrt das Erinnerte in einer ganz spezifischen, externalisierten Sprachform fest; einer Form, die jeder Wieder-Erinnerung Halt zu geben vermag und sie auf eine standardisierte, tendenziell „zeitlose“ Version festlegen kann. Wenn die autobiographische Erinnerung dagegen nur im Medium des gesprochenen Wortes verbleibt und wenn sie dergestalt auch Anderen verfügbar gemacht werden soll, also in einer Kommunikationssituation vergegenwärtigt wird, dann werden sich zwangsläufig unterschiedliche Versionen entfalten, und zwar in Abhängigkeit von im wesentlichen drei Variablen: von den vermuteten Erwartungen des Gegenüber jedes erzählende Abrufen einer autobiographischen Erinnerung ist zuhöhrerorientiert; zweitens in Abhängigkeit von der aktuellen lebensgeschichtlichen Selbstdeutung des Sich-Erinnernden - jedes erzählende Sich-Erinnern versucht eine Assimilation eines Vergangenen an gegenwärtige Bedürfnisse und Selbstbilder des Erzählers; und drittens in Abhängigkeit von der zeitlichen Distanz der Erinnerungen zu den Erlebnissen, und zwar im wesentlichen deswegen, weil die Ausdrucksmittel für autobiographische Erinnerungserzählungen nicht konstant bleiben, sondern sich zeitspezifisch verändern. Erinnerungen passen sich auf der Inszenierungsebene ihrer Erzählungen, ihren „Rahmungen“ und in ihren Wertungen, immer auch an den gesellschaftlichen Wandel von Ausdruckstechniken und Ausdruckssemantiken - den jeweiligen „Zeitgeist“ - an, was übrigens in wahrscheinlich noch stärkerem Maße für 11 die Wahrnehmung und die Erinnerung von Erinnerungen Anderer gilt: Die erzählte Erinnerung wird von demjenigen, der sie aufnimmt, ganz zwangsläufig durch zeittypische Wahrnehmungsmuster gefiltert. Dass autobiographische Erinnerungen in adressaten- bezogenen Versionen - orientiert an den vermuteten Erwartungen des Gegenüber - abgerufen werden, dass wir also verschiedenen Anderen andere Erinnerungen und Erinnerungen anders erzählen, nimmt deswegen kein Wunder, weil die Bestätigung durch den Anderen als eine der wesentlichen Quellen für die Selbst-Bestätigung des Erzählers als eines authentischen Autobiographen fungiert: Es ist nicht die objektive Richtigkeit der Erzählung, sondern ihre Bestätigung durch den Anderen, die die subjektive Überzeugung von der Zugehörigkeit der Erinnerung zu mir als unaustauschbarer Person festigt. Genauso evident wie die Adressatenbezogenheit der Erinnerungserzählung ist aber auch ihre Ummodelung im Hinblick auf die aktuellen Bedürfnisse und Selbstbilder des Erzählenden selbst. Jeder von uns betreibt seine eigene, höchst individuelle Erinnerungspolitik, die willentlich oder unwillentlich die Vergangenheit der Person in Deutungen aufscheinen lässt, welche das Selbstbild des gegenwärtigen Ich nicht gefährden. Der dritte Aspekt schließlich, die Variation der Erinnerungserzählung in Abhängigkeit von jeweils unterschiedlichen zeittypischen Ausdruckstechniken und Bewertungsmustern ist besonders bezüglich solcher Erinnerungen anzutreffen und untersucht worden, in denen die Lebensgeschichte des einzelnen mit dramatischen Phasen der Weltgeschichte verschlungen war, also etwa bei Erinnerungen über den Nationalsozialismus und den zweiten Weltkrieg. Vor allem Harald Welzer hat aufzeigen können, dass in bemerkenswert viele Kriegserinnerungen Erzählmuster absichtslos hineingeschmuggelt worden sind, die beispielsweise durch berühmt geworden Filme oder literarische Erzählungen für ein großes Publikum zur Nutzung bereitgestellt waren; und dass die unterschiedlichen Nachkriegsbewertungen des Nationalsozialismus - die unterschiedlichen Varianten seiner Markierung als „böse“ autobiographische Erzählungen aus dieser Zeit nicht unberührt lassen können, versteht sich von selbst. Das gilt freilich noch stärker für die Erinnerungen derartiger Erinnerungen durch die Nachgeborenen: Was sie vom Erzählten wie erinnern, ist unauflöslich durch die Macht massenmedial vermittelter Bilder und Erzählungen über diese Zeit mitgeprägt. Diese wenigen Hinweise auf Ursachen für die Variantenvielfalt von Erinnerungserzählungen legen das Resümée nahe, dass unser autobiographisches Gedächtnis nicht als eine feste Entität begriffen werden sollte, sondern, so Welzer, „als eine synthetisierende Funktionseinheit, die sich in jeder kommunikativen Situation auf jeweils neue Weise realisiert“. Bisher war ausschließlich von individuellen Erinnerungen die Rede. Gerade unsere letzten Bemerkungen aber haben zumindest angedeutet, wie sehr individuelle Erinnerungen durch zeitgeisttypische kollektive Erzählmuster gemodelt sein können, die sich auf eben jene Vergangenheit beziehen, in die die erinnerte Episode der Person eingebettet ist. Damit ist bereits das große Thema der kollektiven Erinnerungen angesprochen, das in seinen Besonderheiten noch mit einigen abschließenden Bemerkungen profiliert werden soll. In der Literatur werden gemeinhin zwei Grundformen eines Wir-Gedächtnisses unterschieden, die man „kommunikatives“ und „kulturelles“ Gedächtnis genannt hat. Das kommunikative Gedächtnis einer Gruppe ist gewissermaßen ein kollektives Kurzzeitgedächtnis, es umspannt einen Zeitraum von drei bis vier Generationen und bezieht sich auf kommunizierte Erinnerungen von Erlebnissen innerhalb dieser Gruppe. Die kommunikativ tradierte Erinnerung über die Generationenschwelle hinweg gewinnt 12 typischerweise in gewissen stereotypen Erzählungen mit fiktional ausgeschmücktem Beiwerk eine feste Form, deren oftmals quasi-ritualisierte Wiedererzählung ein wesentliches Fundament für das Wir-Gefühl eben dieser Gruppe darstellt, ihre „Identität“. Prototyp eines derartigen kollektiven kommunikativen Gedächtnisses ist das Familiengedächtnis. Das kollektive kulturelle Gedächtnis ist zwar mit dem kommunikativen durch Übergänge verbunden, unterscheidet sich von ihm aber durch seine weit größere Alltagsferne und historische Ausdehnung. Es gewinnt in jenen Geschichtserzählungen und Ritualen seine Form, in denen sich Großgruppen wie „die“ Deutschen und selbst ganze Kulturkreise wie „Europa“ als spezifisch geprägte Einheiten in Abgrenzung zu anderen deuten, als imaginierte generationenübergreifende kollektive Subjekte. Zwar sind in der Gegenwart derartige Narrative nie vollkommen eindeutig und es zirkulieren immer unterschiedliche Versionen, aber es gibt doch zeitgeisttypische Hegemonialformen, die, obwohl durch die Wissenschaft mitgeprägt, in ihren Selektionstechniken und Wertungen doch primär geschichtspolitische Produkte sind. Sie ranken sich um spezifische Schlüsselbegriffe und Mythologeme, an deren Inkrustierung im Bewusstsein der Zeitgenossen ihre fortwährende Nutzung durch die Massenmedien einen großen Anteil hat. Grundsätzlich gilt - und das wird selten in voller Klarheit gesehen -, dass allzu enge Analogisierungen zwischen dem kollektiven kulturellen Gedächtnis und dem individuellen Gedächtnis der Person schnell auf Holzwege führen können: Worte wie Erinnern, Vergessen oder Verdrängen sind im strikten Sinn nur auf das Ich-, aber nicht auf das kulturelle Wir-Gedächtnis anwendbar, denn sie haben immer das selbsterlebte Ereignis zur Voraussetzung, während das kulturelle Gedächtnis im wesentlichen aus Deutungen besteht, die in der Gegenwart über nichterlebte Vergangenheiten entworfen werden. Das kollektive kulturelle Gedächtnis hat also einen ganz anderen Konstruktcharakter als das individuelle Gedächtnis. Dem widersprechen auch nicht die eingangs besprochenen spektakulären Fälle falscher Erinnerungen, in denen die Person nichterlebtes erlebt zu haben meinte. Sie veranschaulichen zwar trefflich die Irritierbarkeit unseres Ich-Gedächtnisses, sollten aber doch als pathologische Produkte fehlgeleiteter Suggestionen gewertet werden, denn der Normalfall individuellen Erinnerns ist der Bezug auf zumindest einen Kerngehalt des Selbsterlebten. Begriffe wie Erinnern, Vergessen und Verdrängen sind im Kontext des kollektiven kulturellen Gedächtnisses wegen dieser grundlegenden Differenz eigentlich immer in Anführungszeichen zu setzen und in dieser Form hier auch nur so gemeint. Mit diesem Vorbehalt versehen lässt sich aber die These vertreten, dass das falsche Erinnern im kollektiven Gedächtnis wohl noch verbreiteter als im individuellen ist. Kollektive können identitätsstiftende Bilder über ihre Vergangenheit herbeiphantasieren, die, an wissenschaftlichen Ansprüchen gemessen, schlicht falsch sind. Gerade in der jüngeren Vergangenheit hat es hysterisierte Aufladungen kollektiver Gedächtnisse gegeben, in denen imaginierte generationenübergreifende Kollektivsubjekte wie „die“ Frauen, „die“ Deutschen, „die“ Muslime oder „die“ Juden ihre Geschichte ganz wesentlich in Begriffen des Opferoder auch des Täter-Seins auslegten, mit der Folge, dass fiktionale Bilder über die Vergangenheit sehr reale Auswirkungen auf gegenwärtige Kollektivbefindlichkeiten hatten und politisch handlungswirksam wurden. Die eingangs dargestellten pathologischen Grenzfälle falscher Erinnerungen im individuellen Gedächtnis jedenfalls sollten auch als Produkte hysterisch aufgeladener und somit höchst problematischer kollektiver Erinnerungen begriffen werden. Im kollektiven kulturellen Gedächtnis gibt es Prozesse heilsamen und schädlichen Vergessens. Was heilsames kollektives Vergessen bedeuten kann, demonstriert am eindrücklichsten 13 das Gegenbeispiel von Rachekulturen, die Erinnerungstechniken pflegen, die ein friedliches Miteinander unterschiedlicher Kollektive ausschließen. Schädlich hingegen ist ein kollektives Vergessen, das sich auf das historische Geworden-Sein der Fundamente republikanischer Ordnungen bezieht. Ein derartiges Vergessen setzt grundlegende Freiheitsrechte und das zukünftige Schicksal ganzer Völker und Kulturkreise aufs Spiel. Genau diese Variante kollektiven Vergessens scheint sich nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Gesellschaften immer stärker zu verbreiten, und zwar in Verbindung mit einer zweiten höchst schädlichen Komponente kollektiver Erinnerung: der permanenten kollektiven Selbstabwertung der eigenen Vergangenheiten. Bei uns schwindet das Bewusstsein, welche Opfer historisch mit der Erkämpfung grundlegender Freiheitsrechte verbunden waren. Wenn aber im kollektiven kulturellen Gedächtnis das Wissen um das opferreiche historische Gewordensein derartiger Freiheiten vergessen wird und die Kraft zur kollektiven Selbstaffirmation schwindet, werden in den Auseinandersetzungen mit identitätsstarken fremdkulturellen Kollektiven, die sich in Europa zukünftig intensivieren werden, grundlegende Freiheiten, die man für unverlierbar hielt, schrittweise verschwinden. Es gibt Pathologien des individuellen und des kollektiven Erinnerns. In den europäischen Gesellschaften ist ein Typus des kollektiven Erinnerns bestimmend geworden, dessen Narrative der kollektiven Selbstabwertung in die kulturelle und gesellschaftliche Selbstdestruktion führen. 14