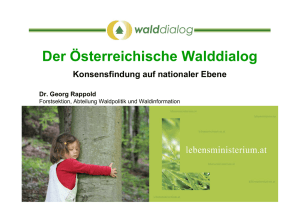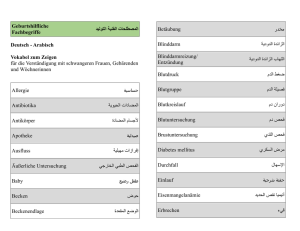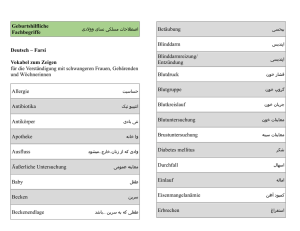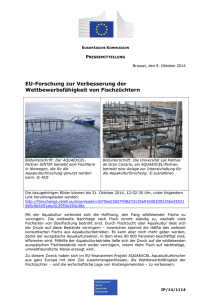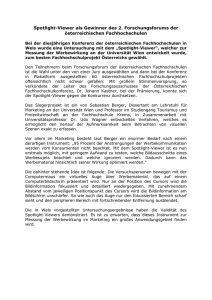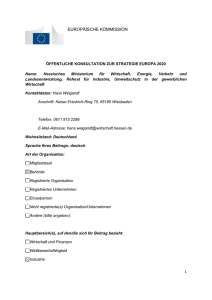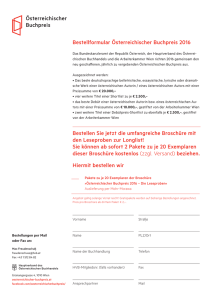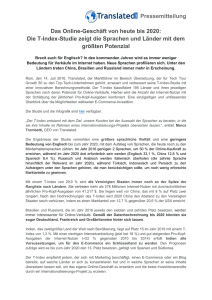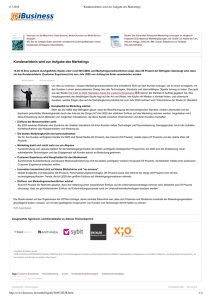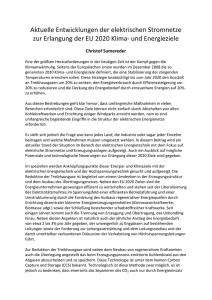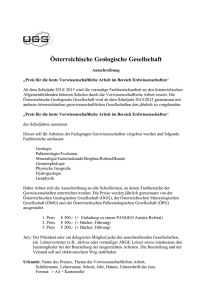Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und
Werbung

Europa 2020 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung Entwurf 2010 16. November 2010 Bundeskanzleramt, Abteilung IV/8 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 Inhaltsverzeichnis I. Einleitung ................................................................................................ 3 II. Makro-ökonomisches Szenario ........................................................... 3 III. Makro-ökonomische Überwachung ................................................... 4 III.1 Umsetzung einer raschen, wachstumsschonenden Budgetkonsolidierung ............ 5 III.2 Stärkung des Finanzsektors mit überregionaler Bedeutung.................................... 7 III.3 Mehr Wissensbasierung und Innovation der Wirtschaft im globalen Wettbewerb.............................................................................................................. 7 III.4 Weitere Erhöhung der Erwerbsbeteiligung im Lichte einer alternden Bevölkerung ............................................................................................................. 8 III.5 Stärkung der Binnennachfrage bei Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit......... 9 IV. Thematische Koordination.................................................................. 9 IV. 1 Europa 2020 Kernziele – Nationale Ziele ............................................................... 9 IV.2 Kernziel Beschäftigung: ........................................................................................... 9 IV.3 Kernziel Forschung und Entwicklung..................................................................... 11 IV.4 Kernziel Klimaschutz und Energie ......................................................................... 13 IV.5 Kernziel Bildung ..................................................................................................... 15 IV.6 Kernziel Verminderung der Armut und sozialen Ausgrenzung .............................. 17 IV.7 Wettbewerb und unternehmerisches Umfeld......................................................... 18 V. Horizontales......................................................................................... 19 2 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 I. Einleitung Die Europa 2020 Strategie sieht vor, dass jedes Mitgliedsland bis spätestens Ende April jedes Jahres ein Nationales Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung gemeinsam mit dem Stabilitäts- bzw. Konvergenzprogramm vorlegt. Beide Programme sind zentrale Bausteine des sogenannten „Europäischen Semesters“, welches erstmals mit Jahresbeginn 2011 operativ wird. Im Rahmen des Übergangs zum Europäischen Semester wurden die Mitgliedstaaten ersucht, einen Entwurf des Nationalen Reformprogramms bis Mitte November 2010 an die Europäische Kommission zu übermitteln. Die Struktur des vorliegenden Entwurfs des Nationalen Reformprogramms orientiert sich an den Vorstellungen der Europäischen Kommission zur Struktur der Programme 1 . So werden in Abschnitt III Informationen zu jenen fünf makro-strukturellen Wachstumshemmnissen bereitgestellt, welche Ende Mai gemeinsam identifiziert und im Juni vom ECOFIN-Rat bestätigt wurden. Der Abschnitt IV (Thematische Koordination) listet in Entsprechung der fünf Europa 2020 Kernziele, die fünf nationalen Ziele auf und behandelt als weiteren Bereich das Themenfeld Unternehmertum und Wettbewerb. Die fünf nationalen Ziele beschloss der Ministerrat am 5. Oktober 2010. Prioritäten, welche gesetzt werden, um die nationalen Ziele zu erreichen, werden im Detail erst im Zuge der Budgetverhandlungen festgelegt. Aus diesem Grund informiert der vorliegende Entwurf in groben Zügen über die Reformschwerpunkte. Dort, wo bereits Maßnahmen gesetzt wurden, werden diese angeführt. II. Makro-ökonomisches Szenario Mit etwas Verzögerung nahm im zweiten Quartal 2010 auch in den EU27 der Konjunkturaufschwung an Fahrt auf. Wachstumstreiber in der Eurozone war – dank der starken Nachfrage vor allem aus asiatischen Volkswirtschaften – in erster Linie die deutsche Exportindustrie. Davon konnte auch Österreich profitieren, das im dritten Quartal 2010 mit real 0,9% ein höheres Wachstum als die Eurozone und die EU 27 (jeweils 0,4% gegenüber dem Vorquartal) vorwies. Für heuer und das kommende Jahr erwartet das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) in seiner aktuellen Konjunkturprognose (September 2010) ein reales BIPWachstum des BIP in Österreich von rund 2,0%, nach -3,9% im Jahr 2009. Dieser Aufschwung wird auch in Österreich primär von der Exportwirtschaft getragen. Zusätzlich haben sich die privaten Investitionen weiter stabilisiert, ein positiver Wachstumsbeitrag dürfte auch von den privaten Konsumausgaben ausgehen. Für 2010 und 2011 prognostiziert das WIFO jeweils eine 1 Code of conduct, “Guidance for drafting, implementing and monitoring National Reform Programmes under the Europe 2020 Strategy” (Draft 22.09.2010) 3 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 durchschnittliche Inflationsrate (HVPI) im Bereich des mittelfristigen Inflationsziels der Europäischen Zentralbank. Bereits im März des heurigen Jahres begann auch eine Trendumkehr am österreichischen Arbeitsmarkt einzusetzen. Seither sind ein Rückgang der beim Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) vorgemerkten Arbeitslosen und ein Beschäftigungswachstum bei den unselbständig Beschäftigten zu beobachten (jeweils im Vorjahresvergleich). Ende Oktober 2010 waren demnach 3,4 Mio. Personen unselbständig beschäftigt (+52.405 bzw. +1,6% gegenüber dem Vorjahr) und 226.137 Personen arbeitslos (-19.386 bzw. -7,9% gegenüber dem Vorjahr). Die Arbeitslosenquote (in % der Erwerbspersonen, laut Eurostat) betrug im September 2010 in Österreich 4,5% und stellte damit den zweitniedrigsten Wert in ganz Europa dar (Eurozone: 10,1%, EU27:9,6%). Bis 2011 rechnet das WIFO mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote (nach EU-Definition) von 4,8% im Jahr 2009 auf 4,3% (nach nationaler Berechnungsmethode von 7,2% auf 6,8%). Die Abwesenheit von makroökonomischen Ungleichgewichten in Österreich bedeutet, dass der bisherige Wachstumspfad nachhaltig war und daher auch eine gewisse Orientierung für die Zukunft gibt. Die Erreichung der EU-2020 Ziele wird einen positiven Einfluss auf das Wachstumspotenzial in Österreich haben. Der Wachstumsprozess bis zum Jahr 2020 wird aber von der Demographie und auch davon abhängen, ob und in welchem Ausmaß die Wirtschafts- und Finanzkrise einen länger andauernden negativen Effekt auf das Wachstumspotenzial hat. Dies ist aus heutiger Sicht höchst unsicher. III. Makro-ökonomische Überwachung Österreich verzeichnete im letzten Jahrzehnt im Durchschnitt höhere reale Wachstumsraten als die Eurozone. Die Beschäftigungsquote der 15-64jährigen Personen lag mit 71,6% (2009) über dem „alten“ Lissabonziel der EU von 70%. Der Arbeitsmarkt hat sich gerade in der Wirtschafts- und Finanzkrise auch durch gezielte Maßnahmen vergleichsweise robust gehalten, die Arbeitslosenquote ist heute mit knapp über 4% (gemäß EU-Definition) unter den zwei geringsten in der EU. Der Konjunktureinbruch 2008-09 brachte eine drastische Verschlechterung der budgetären Situation Österreichs mit sich. Für das Jahr 2010 wird ein gesamtstaatliches Budgetdefizit von 4,5% des BIP erwartet, nach 3,5% im Jahr 2009. Die Staatsverschuldungsquote wird voraussichtlich auf rund 70% des BIP Ende des Jahres 2010 steigen. Ohne Gegenmaßnahmen würden die Budgetabgänge in den nächsten Jahren weiter zunehmen und die öffentlichen Schulden mittelfristig auf eine gesamtwirtschaftlich nicht tragfähige Größenordnung ansteigen. Dies erfordert eine konjunkturgerechte Budgetpolitik, die die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates nachhaltig sichert. Hauptaufgabe ist es dabei, am langjährig erfolgreichen Konzept einer stabilitäts- und beschäftigungsorientierten globalen Wirtschaftspolitik festzuhalten. Insbesondere gilt es, im Rahmen der Budgetkonsolidierung Augenmerk auf Wachstums- und Beschäftigungswirkungen, soziale Ausgewogenheit sowie Wettbewerbsfähigkeit zu legen. Die Bundesregierung hat daher, unter Berücksichtigung der genannten Kriterien, die schrittweise 4 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 Konsolidierung des Staatshaushaltes zu einem zentralen Anliegen der kommenden Jahre gemacht. In diesem Zusammenhang verfolgt die Bundesregierung eine dreifache Zielsetzung: ■ Budgetdefizit senken, dadurch langfristig einen ausgeglichenen Haushalt über den Konjunkturzyklus erreichen, ■ Sicherung des Wirtschaftwachstums, der Beschäftigung und des Sozialsystems als Standort- und Produktivfaktor ■ grundlegende Strukturreformen durchführen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat auch in Österreich größere strukturelle Wachstumsdellen hinterlassen, denen es nun zusammen mit bereits vor der Krise vorhandenen strukturellen Wachstumsengpässen im Kontext der großen globalen und demographischen Herausforderungen zu begegnen gilt. In Anlehnung an die Ergebnisse der makroökonomischen Überwachung vom Juni 2010 durch den ECOFIN-Rat werden folgende fünf makro-strukturelle Wachstumshemmnisse für die Wirtschaft identifiziert. III.1 Umsetzung einer raschen, wachstumsschonenden Budgetkonsolidierung Nicht zuletzt da stabile öffentliche Finanzen den wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum erweitern und elementare Bedingungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts zur Stabilität in der WWU sind, strebt Österreich eine konsequente Senkung des gesamtstaatlichen Budgetdefizits auf unter 3% des BIP bis 2013 und langfristig einen über den Konjunkturzyklus ausgeglichenen Haushalt zur Sicherstellung der finanziellen Nachhaltigkeit an. Die dazu notwendige Konsolidierungsleistung, um das übermäßige Defizit Österreichs gemäß Art. 126 AEUV bis 2013 zu korrigieren, soll zu 60% ausgaben- sowie zu 40% einnahmenseitig erfolgen. Zentrale Grundlage stellt die im Jahr 2009 in Kraft getretene erste Etappe der Haushaltsrechtsreform dar. Die Ausgabenobergrenzen für die einzelnen Kategorien wurden dabei bereits im Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG) (i.e. des mittelfristigen Ausgabenrahmens des Bundes und der konsequenten Umsetzung der Haushaltsrechtsreform) im Mai 2010 festgelegt, dadurch wurde auch die Stärkung der Qualität der öffentlichen Finanzen, im Sinne der Forcierung wichtiger Zukunftsaufgaben, gestärkt. Zudem beschloss das Österreichische Parlament einstimmig das Bundeshaushaltsgesetz 2013 und damit einen Meilenstein der zweiten Etappe der Haushaltsrechtsreform. Die Höhe des Konsolidierungsbedarfs bedingt, dass alle Ausgabenbereiche und die einzelnen Untergliederungen des Bundesfinanzrahmens einen wesentlichen Beitrag leisten müssen. Gleichzeitig werden strukturelle Reformen angegangen, um mittel- und langfristig das Budget zu entlasten und die Qualität der öffentlichen Verwaltung zu verbessern. Im Sinne einer umfassenden und ausgewogenen Budgetkonsolidierung sind alle Ausgabenpositionen auf Einsparungsmöglichkeiten zu analysieren und einer systematischen Überprüfung ihrer Zweckmäßigkeit und Angemessenheit zu unterziehen. Die Effizienz staatlicher Leistungserstel5 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 lung soll auf allen Ebenen nachhaltig erhöht werden. Die Produktivitätsfortschritte sind im Sektor zu nutzen, um eine kosteneffiziente Verwaltung und hochwertige Dienstleistungen sicherzustellen und auszubauen. Der Personalstand des Bundes wird weiter konsolidiert. Grundlage für die ressortspezifischen Personaleinsparungen ist die halbe Pensionsquote unter Berücksichtigung spezieller Erfordernisse. Neben der Budgetkonsolidierung wird die Verbesserung der Qualität der Staatsausgaben als weiteres Ziel der Budgetpolitik der Bundesregierung verfolgt. Das bedeutet, dass im Rahmen der Konsolidierungsstrategie Bildung und Forschung, Technologie und Innovation bevorzugt werden. Ebenso werden die Ausgaben für die Innere Sicherheit und für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen weniger zurückgenommen als in anderen Bereichen. Bei den einnahmenseitigen Maßnahmen wird auf die Auswirkungen auf Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung, Umwelt- und Klimaschutz, Verteilung und den Wirtschaftsstandort geachtet werden. Für die Durchführung der mittelfristigen Budgetkonsolidierung ist eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen notwendig, die im Rahmen der Erstellung des Bundesfinanzgesetz-Entwurfs für 2011 beschlossen werden. Box 1: Ergebnisse der Regierungsklausur vom 22./23. Oktober 2010 Maßnahmen auf der Ausgabenseite (auszugsweise): Öffentliches Pensionssystem: Anpassungen Öffentliche Pensionen: moderate Anhebung 2011 Pflegegeld: Anpassungen Kinderbeihilfen: Anpassungen Gesundheit: Anpassungen Personalbestandsmaßnahmen Bund Lohnentwicklung Bund: Moderate Anhebung 2011 Verschiebung Investitionen (Verkehr) Verringerung von Subventionen Senkung der Verwaltungskosten Offensivmaßnahmen: u.a. Thermische Sanierung, Bildung, Wissenschaft; Anhebung der Forschungsprämie Maßnahmen auf der Einnahmenseite (auszugsweise): Einführung einer Stabilitätsabgabe (Bankenabgabe) Einführung einer Flugabgabe (Abgabe auf Flugtickets) Einkommensteuer (Schließen von Schlupflöchern, Einkünfte aus Kapitalvermögen) Körperschaftsteuer (Anhebung der Zwischensteuer bei Privatstiftungen ua, Schließen von Schlupflöchern) Umsatzsteuer (Betrugsbekämpfung) Energieabgabenvergütung (Einschränkung) Normverbrauchsabgabe (Anpassung an strengere CO2-Werte) Tabaksteuer (Anhebung) 6 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 Mineralölsteuer (Anhebung) Anhebung der Pendlerpauschale und des Pendlerzuschlags Kraftfahrzeugsteuer (Senkung) Forcierung der Betrugsbekämpfung Auch Länder und Gemeinden werden einen Konsolidierungsbeitrag leisten müssen, der das Ziel der vereinbarten gesamtstaatlichen Konsolidierung unterstützt und die Qualität in den Budgets steigert. Zudem streben die Bundesregierung und ihre Finanzausgleichspartner die Überarbeitung des bestehenden Nationalen Stabilitätspakts zur Erreichung der gesamtstaatlichen Haushaltsziele an. III.2 Stärkung des Finanzsektors mit überregionaler Bedeutung Die Krise auf den Finanzmärkten hat auch in Österreich ihre Spuren hinterlassen. Wenngleich die unmittelbare Betroffenheit der österreichischen Banken und Versicherungen aufgrund ihres relativ schwachen Engagements in strukturierten Produkten im internationalen Vergleich gering war, so haben die Zweitrundeneffekte aufgrund des rasanten Wirtschaftsabschwungs den österreichischen Bankensektor wesentlich stärker getroffen. Massive Abschreibungen, vor allem bei Banken mit größerem „Ostexposure“, sind zu einem Gutteil bereits erfolgt. Nachdem mit dem „Bankenhilfspaket“ sukzessive die Stabilität des Finanzsektors gesichert werden konnte, wird dieses, ohne dass die freien Rahmen überhaupt zur Gänze ausgeschöpft werden mussten, nun laufend und unter Bedachtnahme auf die Wiederherstellung eines wachstumsfördernden Finanzsektors redimensioniert bzw. erfolgt ein Abbau der Garantieübernahmen. In Stresstests hat sich außerdem gezeigt, dass das österreichische Bankensystem bestehende Kapitalausstattungserfordernisse erfüllt. Dort, wo der Staat Eigentumsanteile erworben hat, wird eine Umstrukturierung und Neuausrichtung der Bank so erfolgen, dass der Staat ein Unternehmen oder dessen Einzelteile verkaufen kann und dessen Verkauf auch einen entsprechenden Ertrag bringt. Im Hinblick auf das Engagement österreichischer Kreditinstitute in CEE-Ländern wurden zur Sicherstellung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden die Einrichtung sog. „Colleges“ für alle grenzüberschreitend tätigen Banken eingerichtet. Der österreichische Finanzsektor bleibt weiterhin ein verlässlicher Partner in dieser Region, wie sich auch die österreichischen Banken im Rahmen der European Bank Coordination Initiative („Vienna Initiative“) dazu bekannt haben. Fremdwährungskredite unterliegen ferner einem verstärkten Monitoring und werden laufend zurückgeführt. III.3 Mehr Wissensbasierung und Innovation der Wirtschaft im globalen Wettbewerb Die Bedeutung des Wissensdreiecks Bildung – Forschung – Innovation für die Wettbewerbsfähigkeit und die Standortqualität einer Ökonomie sowie für die Bewältigung der kommenden großen Herausforderungen („Grand Challenges“) wie z. B. Globalisierung, Demographie und 7 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 Klimawandel ist unbestritten. Österreich hat seine Performance in Forschung, Technologie und Innovation in den vergangenen beiden Jahrzehnten beeindruckend verbessert. Der Aufholprozess war von einer markanten Steigerung der Forschungsintensität im gesamten Innovationssystem gekennzeichnet. Die Forschungsquote erhöhte sich innerhalb der vergangenen Dekade von 1,94% (2000) auf 2,76% (2010) des BIP. Im Bereich der Bildung sind in den letzten Jahren wichtige Akzente für mehr Qualität z. B. an Schulen, gesetzt worden. Derzeit findet eine intensive Diskussion auf politischer Ebene im Zusammenhang mit Reformen im Bildungsbereich statt, die mittelfristig umgesetzt werden sollen. Österreich ist sich als kleine offene Volkswirtschaft der signifikanten Aufgaben für mehr Wettbewerbsfähigkeit und der erforderlichen Ausrichtung hin zu Produkten mit höherer Qualität im globalen Wettbewerb bewusst und ist daher weiter bestrebt, nachhaltige und zielorientierte Reformen umzusetzen. Als Ansatzpunkte stehen jene Maßnahmen im Vordergrund, die im Einklang mit dem budgetären Ausgabenrahmen und der in Ausarbeitung stehenden FTI-Strategie einen im gesamtwirtschaftlichen Kontext maximalen Nutzen entfalten. In Abstimmung mit den entsprechenden Kernzielen der Europa 2020 Strategie soll daher über eine fokussierte Bildungs-, IKT- und FTI-Politik das Innovationspotenzial der österreichischen Wirtschaft verbreitert, gestärkt und das wissensbasierte Wachstum deutlich dynamischer werden. Zudem müssen die Qualitätsaspekte der Ausund Weiterbildungssysteme effizient verbessert werden, um es einer gut ausgebildeten Bevölkerung zu ermöglichen, rasch und effektiv technische, organisatorische, klima- und ressourcenschonende sowie soziale Innovationen durchzuführen. III.4 Weitere Erhöhung der Erwerbsbeteiligung im Lichte einer alternden Bevölkerung Österreich weist mit einer Beschäftigungsquote (gesamt 20-64-Jährige) von 74,7% im Jahr 2009 einen vergleichsweise hohen, bereits nahe am Europa 2020 Ziel befindlichen Wert auf. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat vorübergehend zu einem Rückgang der Arbeitskräftenachfrage geführt. Im Hinblick auf demographische Veränderungen gilt es, das Arbeitskräftepotenzial zu stärken und die Arbeitslosigkeit weiter zu verringern. Dies trägt auch wesentlich dazu bei, Armut und soziale Ausgrenzung zu senken. Insgesamt besteht bei Frauen ein beträchtliches Potenzial für eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung, sowie auch bei den Gruppen der Älteren und Niedrigqualifizierten, in dieser Gruppe vor allem auch bei MigrantInnen. Ein wesentliches Ziel der Wirtschaftspolitik muss es daher sein, insbesondere Frauen und jene Personengruppen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die bislang zum Teil nur erschwert Zugang gefunden haben bzw. zu rasch und zu früh aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Optimierte Rahmenbedingungen sollen die Teilnahme am Erwerbsprozess ermöglichen bzw. attraktiver gestalten, sowie insbesondere auch die Betroffenheit und die Dauer von Arbeitslosigkeit reduzieren. Durch bessere Rahmenbedingungen für einen längeren Verbleib im Erwerbsleben, die Verankerung des Lebenslangen Lernens über die gesamte Erwerbslaufbahn, Maßnahmen zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, der Gesundheit sowie eine aktivierende, zielorientierte, effiziente Arbeitsmarktpolitik wird eine Balance zwischen angebotenen und nachgefragten Fähigkeiten sowie ein höchstmögliches Beschäftigungsniveau anvisiert. Gleichzeitig sollen strukturelle Verbesserungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zur Erhöhung der Beschäftigung beitragen. 8 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 III.5 Stärkung der Binnennachfrage bei Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit Die externe Wettbewerbsfähigkeit ist für Österreich als eine kleine, offene Volkswirtschaft von zentraler Bedeutung. Österreich hat im letzten Jahrzehnt erfolgreich auf die Öffnung seiner Wirtschaft gesetzt und im Gegensatz zu früheren Perioden solide Leistungsbilanzüberschüsse erwirtschaftet. Die engen Verflechtungen mit der deutschen Wirtschaft haben Österreich in der Strategie einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich unterstützt. Im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich der private Konsum in Österreich nicht zuletzt aufgrund wirtschaftspolitischer Reaktionen wie der vorgezogenen Steuerreform, dem Ausbau der Familienunterstützung und höheren Lohnabschlüssen in den Jahren 2008 und 2009 als stabilisierendes Element behauptet. Insgesamt wird mehr Einkommen und damit mehr Binnennachfrage entstehen, wenn in einer wachsenden Wirtschaft mehr Menschen Beschäftigung finden, länger Beschäftigung haben können sowie, wenn die Reallöhne und -gehälter am mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt partizipieren. Um Innovation und Produktivität zu fördern sowie die Kaufkraft zu erhöhen, ist zudem die Wettbewerbsintensität in einigen Teilen der Wirtschaft zu stärken. .Zusätzlich sollen die Investitionstätigkeit sowie die Gründungsdynamik über weitere Verbesserungen des Unternehmensumfelds, geeignete Anreizmechanismen und geringere Verwaltungslasten gehoben werden. IV. Thematische Koordination IV.1 Europa 2020 Kernziele – Nationale Ziele Vor dem oben beschriebenen makroökonomischen Hintergrund bemühte sich die österreichische Bundesregierung um eine ambitionierte Umsetzung der fünf EU-2020 Kernziele in nationale Ziele. Die nationalen Ziele wurden am 5. Oktober 2010 vom Ministerrat verabschiedet. Da die Details erst im Zuge der Budgetverhandlungen fixiert werden können, die im Dezember abgeschlossen werden sollen, wird erst im endgültigen Nationalen Reformprogramm Ende April eine umfassende Information über Reformvorhaben und deren Ablauf vorgelegt werden. IV.2 Kernziel Beschäftigung: IV.2.1 Nationale Zielsetzung Unter den 20- bis 64- Jährigen Frauen und Männern wird eine Beschäftigungsquote von 77 bis 78% angestrebt, der Fokus soll dabei vor allem auf einer deutlich stärkeren Erwerbsbeteiligung älterer ArbeitnehmerInnen, insbesondere durch die Anhebung des effektiven Pensionsantrittsalters liegen. Weiteres Augenmerk soll auf die Qualität der Arbeit sowie die Beschäftigung von Frauen, und (jugendlichen) MigrantInnen gelegt werden. Zur Zielerreichung soll ein wirksames Monitoring für diese Subgruppen eingesetzt werden. Die Maßnahmen sollen dazu dienen, das langfristige Wachstumspotenzial der österreichischen Volkswirtschaft angesichts einer zuneh9 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 mend alternden Bevölkerungsstruktur abzusichern, die Beschäftigung zu erhöhen und finanzielle Nachhaltigkeit sicherzustellen. IV.2.2 Herausforderungen und (geplante) Maßnahmen a) Arbeitsmarktbeteiligung älterer ArbeitnehmerInnen Die Arbeitsmarktintegration von Älteren zählt zu den Prioritäten und Schwerpunkten der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik. In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Maßnahmen umgesetzt, die darauf abzielten, die Anreize für ältere ArbeitnehmerInnen zu erhöhen, länger in Beschäftigung zu bleiben: z. B. Entfall des AlV-Beitrages für Ältere, Kombilohn-Neu, „Active-Ageing“ Schwerpunkt im Rahmen des ESF und Reform der Altersteilzeit. Seit 2004 sind auch deutliche Erfolge nachweisbar. Die Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer konnte von 28,8% im Jahr 2004 auf 41,1% im Jahr 2009 (lt. Eurostat) kontinuierlich angehoben werden. Sie liegt aber immer noch deutlich unter dem EU-27 Durchschnitt von 46,0% (2009). Es besteht aber Einvernehmen, dass diese Maßnahmen im Zusammenhang mit der Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters in den kommenden Jahren laufend weiter entwickelt und ausgebaut werden sowie im Bereich Erwachsenenbildung ergänzt werden. Wesentliche Voraussetzung für längeres, produktives Arbeiten im Alter ist auch eine nachhaltige Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit. Ergänzend notwendig ist aber auch ein Policy-Mix aus Beschäftigungs- und Weiterbildungsanreizen sowie erfolgreichen Instrumenten der Arbeitsmarktintegration. b) Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen Die Frauenbeschäftigungsquote (20-64-Jährige) liegt mit 69,4% (2009) deutlich über dem EUDurchschnitt von 62,5% (2009). Die mit dem Nationalen Aktionsplan zur Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt (Juni 2010) skizzierten Herausforderungen liegen (i) in der Diversifizierung von Ausbildungswegen und Berufswahl; (ii) der Erhöhung der Erwerbsbeteiligung und der Vollzeitbeschäftigung von Frauen; (iii) der Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und (iv) der Verringerung der Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern. Wichtige Ansatzpunkte, um Barrieren der Erwerbsbeteiligung für Frauen abzubauen, sind: Die Bereitstellung einer quantitativ ausreichenden und qualitativ hochwertigen sowie leistbaren Kinderbetreuung, die Verbesserung der Integration von Wiedereinsteigerinnen in den Arbeitsmarkt sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Altenpflege. Es wird daher angestrebt, 50% der im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik (AMP) zur Verfügung stehenden Mittel zur Förderung der Gleichstellung am Arbeitsmarkt einzusetzen. c) Arbeitsmarktbeteiligung von Jugendlichen, Personen mit Migrationshintergrund und Niedrigqualifizierten Die Jugendarbeitslosigkeit betrug 2009 10% und war damit nur etwa halb so hoch wie der Durchschnitt der EU27. Dennoch hat sie sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Die 10 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 Beschäftigungsquote der 20-64-Jährigen Niedrigqualifizierten (ISCED 0-2) lag 2009 um 22,5 Prozentpunkte unter dem österreichischen Durchschnitt. Insgesamt liegen die Herausforderungen in einer verbesserten Integration von Jugendlichen, geringer Qualifizierten, WiedereinsteigerInnen, AlleinerzieherInnen, Menschen mit Behinderung, MigrantInnen und SozialhilfebezieherInnen in den Arbeitsmarkt. Ein weiterer wichtiger Bereich, der in den folgenden Jahren verstärkt angesprochen werden soll, ist die Ausbildung von Frauen und Männern in nichttraditionellen Berufen sowie Motivation bildungsferner Bevölkerungsteile zur Aus- und Weiterbildung. Für die Umsetzung wurde bereits ein dementsprechender Schwerpunkt im bildungspolitischen Bereich definiert. Die Erhöhung der Beschäftigung, insbesondere der qualifizierten Beschäftigung von Jugendlichen soll weiter durch den intensiven Einsatz von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen und Maßnahmen wie der Ausbildungsgarantie erzielt werden. IV.3 Kernziel Forschung und Entwicklung IV.3.1 Nationale Zielsetzung Bis zum Jahr 2020 soll die F&E Quote 3,76% des BIP betragen, die Aufwendungen sollen dabei zumindest zu 66%, möglichst zu 70%, von privater Seite getragen werden. Mit dieser Zielsetzung verfolgt die österreichische Bundesregierung einen ambitionierten Weg, mit dem Österreich als wissensbasierte, innovative und wettbewerbsfähige Volkswirtschaft ausgebaut werden soll, um nachhaltig Wohlstand und Arbeitsplätze zu schaffen. IV.3.2 Herausforderungen und (geplante) Maßnahmen a) Stärkung der Innovationskraft der Unternehmen Um die Innovationskraft und damit das Wachstumspotenzial zu erhöhen, müssen Unternehmen auch weiterhin über effektive Anreize und Rahmenbedingungen sowie mehr Wettbewerb zu Forschung und Entwicklung stimuliert werden. Die Herausforderung liegt darin, mit den eingesetzten Mitteln eine maximale Hebelwirkung auf die F&E-Ausgaben von Leitbetrieben ebenso wie von kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) zu erzeugen. Konkret werden insbesondere Gründung und Wachstum von technologiebasierten, wissensintensiven und innovativen Unternehmen sowie die Ansiedelung forschungsintensiver Unternehmen aus dem Ausland unterstützt. Die Intensivierung der Forschung in den KMU sowie in den technologiepolitisch wichtigen Großbetrieben wird zielgerichtet gefördert. Weitere wichtige Bereiche, die verstärkt angesprochen werden, sind neben der Beteiligungs- und Risikokapitalintensität bei der Finanzierung von innovativen Unternehmen (hier hat Österreich in letzter Zeit viele neue Maßnahmen gesetzt wie die Nutzung des Staates als „Cornerstone-Investor“ im Rahmen von Funds-of-Funds Konzepten oder die Einrichtung eines staatlichen Beteiligungsfonds) auch die Anzahl der systematisch F&E betreibenden Unternehmen (Breite der Innovationsbasis). Zusätzlich gilt es, die Wissens- und Innovationsintensität der österreichischen Produkt- und Dienstleistungsstruktur, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und die internationale F&E-Kooperationen zu forcieren und die Umsetzung der Ergebnisse von For11 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 schung und Entwicklung in marktfähige (und insbesondere umwelt- und klimaschonende) Innovationen zu verbessern. Im Rahmen des Einsatzes der EFRE-Mittel 2007-2013 wird die Stärkung der Innovationskraft auch auf Ebene der Regionalpolitik unterstützt. b) Stärkung der Forschung Im internationalen Vergleich liegt die österreichische Grundlagenforschung im Mittelfeld – sowohl bei Input- als auch Outputindikatoren, wobei anzumerken ist, dass die Beurteilungskriterien und Mess-Skalen von akademischer Forschung und Grundlagenforschung anders konstruiert sind als jene für Unternehmensforschung. Im Rahmen der in Ausarbeitung stehenden FTI-Strategie des Bundes wird derzeit ein Maßnahmenbündel zur Stärkung der Grundlagenforschung diskutiert. Rahmenbedingungen für exzellente Forschungsgruppen an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen müssen so ausgestaltet werden, dass sie im globalen Wettbewerb mithalten können. Global wettbewerbsfähige Forschungsinfrastrukturen zu schaffen und universitäre sowie außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zu stärken, stellen daher wichtige nationale Ziele dar. c) Informationsgesellschaft Breitbandnetze bilden eine Stütze der Informationsgesellschaft 2 . Das im Frühjahr 2010 errichtete „Kompetenzzentrum Internetgesellschaft“ wird der Bundesregierung Anfang 2011 eine erste, in Folge dann regelmäßig zu erstellende Prioritätenliste vorlegen, mit der konkrete Schritte zur Entwicklung der IKT in Österreich vorgestellt werden. Mit der Prioritätensetzung erforderlicher Maßnahmen wird eine klare, gesamthafte Koordinierung der österreichischen IKT-Politik erreicht. Ergänzend zu dieser organisatorischen Maßnahme sind bereits zwei Fördermaßnahmen operativ bzw. in Umsetzung, von denen Wachstumsimpulse und Agglomerationseffekte erwartet werden: „Breitband Austria Zwanzigdreizehn (BBA_2013)“ und „Austrian electronic network (AT:net“)“. 2 Im Vergleich mit den europäischen Spitzenreitern hat sich jedoch laut WIFO im Zeitraum 2002 bis 2010 bei der Breitbandpenetration im Vergleich zu den Spitzenreiterländern wie Schweden eine Lücke aufgetan: Die Breitbandpenetrationsrate ist in Österreich um bis zu 15% niedriger. (cf. Reinstaller, Andreas (2010), „Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Breitbandnetzwerken – Die Situation in Österreich und ein Vergleich wirtschaftspolitischer Handlungsoptionen“, WIFO 109/2010 12 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 IV.4 Kernziel Klimaschutz und Energie IV.4.1 Nationale Zielsetzung Zielwerte: ■ 16% Treibhausgasreduktion gegenüber dem Niveau des Jahres 2005 in den NichtEmissionshandelssektoren ■ 34% Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch ■ Stabilisierung des Endenergieverbrauchs auf dem Niveau des Basisjahres 2005 Das 21% Treibhausgasemissionsreduktionsziel gegenüber dem Niveau des Jahres 2005 im Emissionshandelssektor ist ein EU-weites Ziel, zu dessen Erreichung die österreichischen Emissionshandelssektoren ihren Beitrag leisten werden. Die „Energiestrategie Österreich“ ist ein wissenschaftlich evaluierter, möglicher Weg, wie der österreichische Beitrag zu den energie- und klimapolitischen Zielsetzungen der EU erreicht werden kann. Im Hinblick auf das Energieeffizienzziel macht die „Energiestrategie Österreich“ deutlich, dass die beiden erstgenannten Ziele umso leichter erreicht werden können, je effizienter die Bereitstellung und Nutzung von Energie erfolgt. Daher wurde von politischer Seite als Zielvorgabe für die „Energiestrategie Österreich“ eine Stabilisierung des Endenergieverbrauchs auf dem Niveau des Jahres 2005 i.d.H.v. 1100 PJ bis 2020 definiert. Gegenüber einer Fortschreibung des bisherigen Trends entspricht dies einer Reduktion des Endenergieverbrauchs um 200 PJ. Die Steigerung der Energieeffizienz soll auch die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Volkswirtschaft unterstützen, die Kosteneffizienz der Maßnahmen sicherstellen und so gestaltet sein, dass die Wachstumskräfte in Richtung nachhaltiger, kohlenstoffarmer Wirtschaft gestärkt werden und die soziale Verträglichkeit der Maßnahmen gewährleistet wird. Darüber hinaus wird im Sinne der EU-Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“ (Abkoppelung des Wirtschaftswachstums von der Ressourcennutzung) ein Hauptaugenmerk auf den effizienten Umgang mit Ressourcen und den absoluten Ressourcenverbrauch gelegt. Damit soll der Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft unterstützt, die Nutzung erneuerbarer Energieträger und die Energieeffizienz gefördert sowie das Verkehrswesen modernisiert werden. IV.4.2 Herausforderungen und (geplante) Maßnahmen a) Erneuerbare Energien Gemäß Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (2009/28/EG) hat Österreich seinen Anteil für erneuerbare Energie am Bruttoendenergieverbrauch bis 2020 auf 34% zu erhöhen. Im Basisjahr 2005 betrug dieser Anteil 24,4%. Im Jahr 2008 erreichte Österreich bereits 28.8%. 13 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 In Entsprechung der Richtlinie hat Österreich fristgerecht seinen Nationalen Aktionsplan 2010 für erneuerbare Energien der Europäischen Kommission vorgelegt 3 . Darin werden die vorgesehenen Zielpfade zur Erreichung des erneuerbaren Ziels, Ziele für einzelne Sektoren, die zur Zielerreichung eingesetzten Energietechnologien und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele dargestellt. b) Reduktion der Treibhausgasemissionen Österreich ist gemäß dem EU Klima- und Energiepaket verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen in Sektoren, die nicht dem Emissionshandel unterliegen, bis 2020 um mindestens 16% bezogen auf die Emissionen des Jahres 2005 zu reduzieren. Die größten sektoralen Verursacher von Treibhausgasen in Sektoren außerhalb des Emissionshandels sind in Österreich der Verkehr sowie der Bereich Raumwärme und Warmwasser in Gebäuden. Was den Verkehr anbetrifft, wird auf den Infrastrukturausbau im Hinblick auf eine nachhaltige Verkehrsverlagerung und Bewältigung des Verkehrsaufkommens sowie auf Elektromobilität und die Attraktivierung der öffentlichen Verkehrsmittel gesetzt. Flankierend sind Maßnahmen im Sinne der Kostenwahrheit und des Verursacherprinzips notwendig. Im Gebäudebereich wird auf die drei Säulen Thermische Sanierung im Bestand, Niedrigstenergie- und Passivhausbauweise sowie Erneuerbare Energieträger (u.a. Solarenergie, Biomasse) gesetzt. Um die Schaffung von „green jobs“ anzuregen und die steigende Nachfrage nach grünen Produkten, Technologien und Dienstleistungen optimal zu nutzen und weiter zu stimulieren, erarbeitet die Bundesregierung Maßnahmenvorschläge, die in der Folge umgesetzt werden sollen unter Bedachtnahme der relevanten Finanzierungs- und Verteilungsfragen. Dadurch soll der Übergang hin zu einer ressourceneffizienten und kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützt werden. c) Energieeffizienz Die konsequente Steigerung der Energieeffizienz in allen wesentlichen Sektoren ist der Schlüssel für die Energie- und Klimapolitik, dienst sie doch sowohl der Erhöhung der Versorgungssicherheit, der Kosteneffizienz des Energiesystems und der Erreichung der umweltpolitischen Zielsetzungen. In Umsetzung der Energiestrategie Österreich sollen in den kommenden Jahren Energieeffizienz- und Einsparmaßnahmen, insbesondere im Gebäude-, Verkehrs- und Haushaltsbereich, umgesetzt werden. Im Gebäudesektor wird der thermischen Sanierung ein besonderer Stellenwert einzuräumen sein. Im produzierenden Bereich werden Energiemanagementprogramme forciert. Öffentliche Forschungsprogramme sollen die Umsetzung des nationalen Aktionsplans für Erneuerbare Energien sowie des nationalen Energieeffizienzaktionsplans (inklusive der Weiterentwicklung des Monitoringsystems) unterstützen. 3 NREAP-Austria, http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm# 14 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 d) Umgang mit natürlichen Ressourcen – Ressourceneffizienz In Umsetzung des Schwerpunktes der Europa 2020 Strategie „Ein ressourceneffizientes Europa“ arbeitet Österreich an einem Aktionsplan. Ziel ist es, in Kooperation mit den relevanten Stakeholdern die Ressourceneffizienz zu verbessern. Im Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sowie mit den Ländern sollen Ziele zur Forcierung der Ressourceneffizienz in Österreich definiert und Leitmaßnahmen sowie Leitinstrumente zu ihrer Erreichung entwickelt werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Zusammenarbeit mit den Akteuren der Wirtschaft, da gerade in diesem Bereich signifikante Einsparpotenziale vorhanden sind. Die Fertigstellung des Aktionsplans ist für Anfang 2011 anvisiert. Gleichzeitig sollen Produktions- und Konsummuster in Richtung Nachhaltigkeit (Qualität, Innovation, Langfristigkeit, Klimaschutz sowie Umwelt- und Ressourcenschonung) gelenkt werden. IV.5 Kernziel Bildung IV.5.1 Nationale Zielsetzungen Es wird angestrebt, bis zum Jahr 2020 die SchulabbrecherInnenquote auf 9,5% zu senken und den Anteil der 30- bis 34-Jährigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben oder über einen gleichwertigen postsekundären Abschluss (ISCED 4a) verfügen, auf 38% zu erhöhen. IV.5.2 Herausforderungen und (geplante) Maßnahmen a) Steigerung der Bildungsbeteiligung, Vorbereitung auf das Studium und Mobilität im tertiären Sektor Ziel ist es, nicht nur die Steigerung der Bildungsbeteiligung (Sekundar- und Tertiärbereich), sondern vor allem auch die Mobilität im tertiären Sektor zu erhöhen. Wesentlich im Bereich der Hochschulbildung ist die vorgelagerte Studienwahl. Um die Effektivität zu steigern, wird das Angebot zur Vorbereitung auf das Studium (Information, Orientierung) verbessert. Aus diesem Grund wurde bereits mit der Initiative „Studienwahlberatung NEU“ ein umfassendes Maßnahmenpaket geschnürt, das weiter ausgebaut werden soll 4 . Zur besseren Abstimmung des tertiären Bildungsangebots ist zudem die Entwicklung eines österreichischen Hochschulplanes vorgesehen. Für Österreich ist die Förderung der internationalen Studierendenmobilität ebenso ein besonderes Anliegen. Die bereits gesetzten Maßnahmen führten zur kontinuierlichen Steigerung diesbezüglicher Kennzahlen. 4 Nähere Informationen zu diesem Projekt unter: http://www.studienchecker.at/ 15 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 b) Anzahl der AbsolventInnen naturwissenschaftlich-technischer Studienrichtungen Österreich weist eine niedrige Zahl an AbsolventInnen naturwissenschaftlich-technischer Studienrichtungen auf. Als Reaktion darauf wurde die Informationsoffensive „MINT“ gestartet. Diese Initiative hat zum Ziel, die StudieninteressentInnen und StudienanfängerInnen besser über die diversen Studienmöglichkeiten in den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sowie über die diversen Studienmöglichkeiten an Universitäten und Fachhochschulen zu informieren, Berührungsängste abzubauen und über Jobchancen aufzuklären 5 . Weiters werden die Programme zur Frühförderung des wissenschaftlichen Nachwuchses erweitert, um SchülerInnen aktiv in den Forschungsprozess einzubeziehen, das Interesse an Naturwissenschaft und Technik zu wecken und die Berufs- und Studienwahl zu erleichtern. Es wird gezielt die Vernetzung von Schulen mit universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen aufgebaut. c) Verbesserung des Bildungsniveaus und Senkung der SchulabbrecherInnenquote Das frühzeitige Beenden der Bildungskarriere ohne Abschluss senkt die Beschäftigungschancen, erhöht das Risiko der Arbeitslosigkeit und kann zu sozialer Ausgrenzung führen. Personen aus schwierigen sozio-ökonomischen Verhältnissen und/oder Migrationshintergrund sind in überdurchschnittlichem Ausmaß betroffen. Zentrales Ziel der strukturellen bildungspolitischen Reformen sind daher die Steigerung der Chancengerechtigkeit und die Anhebung des Qualifikationsniveaus. Die entsprechenden Maßnahmen werden bereits sehr früh gesetzt: Alle Kinder sollen bei Eintritt in die Volksschule ausreichend Deutsch sprechen, um dem Unterricht folgen zu können. Deshalb findet vor Beginn des letzten Kindergartenjahres eine „Sprachstandsfeststellung“ statt, bei der die Sprachkompetenz der Kinder im Mittelpunkt steht. Es wird festgestellt, ob sich ein Kind dem Alter entsprechend ausdrücken kann. Ein Bildungsplan sowie „Standards“ ermöglichen – abhängig vom Ergebnis der Sprachstandsfeststellung – die Entwicklung eines individuellen Förderkonzepts. Im Jahr vor dem Schuleintritt werden Kinder bei Bedarf im Kindergarten (kindgerecht und in vertrauter Umgebung) gefördert. KindergartenpädagogInnen werden speziell dafür aus- und fortgebildet. Eine Vielzahl von Maßnahmen, die frühzeitigem Schulabbruch entgegenwirken, wurde bereits eingeleitet 6 . Prävention steht dabei im Mittelpunkt, hochwertige Bildungs- bzw. Berufsberatung sowie niederschwellige Angebote zum Nachholen von Bildungsabschlüssen sind weitere Schwerpunkte. Um Jugendliche bei der Bildungs- und Berufswahl zu unterstützen, wird seit dem Schuljahr 2009/2010 die Berufsorientierung und Bildungsberatung verbessert. Die Neue Mittelschule ist eine zentrale Strukturmaßnahme, die der frühen Trennung im Alter von 10 entgegenwirkt und individuelle Förderung der persönlichen Begabungen ermöglicht. 5 6 Nähere Informationen zu beiden Maßnahmen unter: http://mint.bmwf.gv.at/content/about.php Beispiele für aktuelle präventive Maßnahmen im Bildungsbereich: http://www.bmukk.gv.at/schulen/sb/schulabbruch.xml 16 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 Die im Schuljahr 2007/2008 begonnene Initiative „25plus“ setzt die Individualisierung des Lernens und Lehrens fort. Die Senkung der Klassenschülerzahl schafft günstigere Voraussetzungen für den/die einzelnen SchülerIn in Hinblick auf Leistungsfähigkeit, Lernstil, Lerntempo, Motivlage, Muttersprache und Geschlecht. Gleichzeitig tragen all diese Maßnahmen zu einer Erhöhung der Qualitätsstandards bei. Im Rahmen der Offensivmaßnahmen wird in enger Kooperation mit Städte- und Gemeindebund das ganztätige Schulangebot im Pflichtschulbereich von derzeit 120.000 Plätzen auf 200.000 Plätze ausgeweitet werden. Im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) werden ebenfalls Mittel eingesetzt, um SchülerInnen mit starken (sprachlichen) Defiziten im Ausbildungssystem zu halten. Der Besuch der Übergangsstufe dient zur Erfüllung der Schulpflicht auf der neunten Schulstufe, der positive Abschluss berechtigt zum Eintritt in weiterführende Schulen. Durch die Einführung von Kleingruppenunterricht – vorzugsweise im Fremdsprachenbereich – und die zusätzliche Teilung in den Fächern Deutsch, Mathematik und einem weiteren schulspezifischen Schwerpunktfach steht eine Maßnahme zur verbesserten Förderung von Kindern und Jugendlichen mit anderer Erstsprache als Deutsch zur Verfügung. Schulsozialarbeit, Einsetzung von mehr Beratungs- und Lehrpersonal – auch für muttersprachlichen Unterricht – sind weitere Maßnahmen, die zur Lösung schulische Problemsituationen und einer besseren Betreuungsqualität der einzelnen SchülerInnen beitragen. d) Attraktivität, Qualität und Durchlässigkeit der beruflichen Bildung Die berufliche Bildung trägt maßgeblich zu intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum und zum Erreichen des Kernziels Bildung bei. Bei der Formulierung des Kernziels wurde der hochqualitativen postsekundären Berufsbildung in Österreich Rechnung getragen. Ziel ist daher die weitere Steigerung der Attraktivität, Durchlässigkeit und Qualität der beruflichen Bildung auf allen Ebenen. Die Qualitätsinitiative Berufsbildung (QIBB) hat die Implementierung und Weiterentwicklung eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems zum Ziel und wird weiterhin umgesetzt. IV.6 Kernziel Verminderung der Armut und sozialen Ausgrenzung IV.6.1 Nationale Zielsetzung In der nationalen Umsetzung bis zum Jahr 2020 wird ein Beitrag zum EU-Ziel, erfasst durch die drei Indikatoren Armutsgefährdung, materielle Deprivation und Erwerbslosenhaushalt, in der Höhe von 235.000 Personen angestrebt. Die Erreichung des Ziels zur Verminderung des Risikos für Armut und soziale Ausgrenzung sowie des Beschäftigungsziels stehen in enger Verbindung. Der Fokus liegt daher auf Beschäftigungssteigerung und auf der Eingliederung in den Arbeitsmarkt, insbesondere auch von erwerbsfähigen, arbeitsmarktfernen Personen, sowie auf der Verbesserung der Qualität der Jobs. Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Kontext auch darauf zu legen sein, dass die finanziellen Anreize für eine Beschäftigungsaufnahme und einen Verbleib in Beschäftigung richtig gesetzt werden. Die Politiken zur Zielerreichung sollen zudem fokussiert erfolgen und dabei vor allem auf WiedereinsteigerInnen, Langzeitarbeitslose, Jugendliche, Kinder und verschuldete Haushalte sowie mittelfristig auf besonders 17 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 von Armut betroffene Gruppen von nicht-erwerbsfähigen bzw. älteren Personen ausgerichtet sein. IV.6.2 Herausforderungen und (geplante) Maßnahmen a) Vereinbarkeit von Familie und Beruf Für Frauen, insbesondere für AlleinerzieherInnen, bedingen bestehende Betreuungspflichten oftmals eine ungünstige Ausgangsposition am Arbeitsmarkt. Der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen sowie – im schulischen Bereich – die Ausweitung der ganztägigen Betreuung, zählen daher zu den Bereichen, die es verstärkt zu beachten gilt. Mit der Einführung eines verpflichtenden, kostenlosen letzten Kindergartenjahres, per 1. September 2010, wurde bereits ein wesentlicher Schritt zur leichteren Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesetzt. Damit wird gleichzeitig insbesondere auch bei Kindern aus bildungsfernen Schichten und solchen mit Migrationshintergrund der Spracherwerb verbessert und damit der Übergang bzw. der Eintritt in die Volksschule erleichtert. b) Geringe Erwerbsbeteiligung armutsgefährdeter Gruppen im erwerbsfähigen Alter Zentrale Ursachen für Armutsgefährdung liegen in einer Nicht- bzw. geringfügigen Erwerbsbeteiligung, beispielsweise aufgrund geringer Qualifikation oder Behinderung. Der Fokus liegt daher auf besonders gefährdeten Gruppen. Im Rahmen des Integrationsschwerpunktes für Behinderte wurde gemäß der Vereinbarung des Bundes und der Länder ein erhöhter Interventionsbedarf vorgesehen. Zudem werden eine Verbesserung der Qualität der Jobs sowie eine Politik angestrebt, die die Beschäftigungsaufnahme und den Verbleib in der Beschäftigung attraktiv macht. Mit der Umsetzung der bundesweiten bedarfsorientierten Mindestsicherung per 1. September 2010 werden zwei Ziele verfolgt: Erstens Vermeidung und Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung und zweitens Unterstützung beim Einstieg oder Wiedereinstieg in das Erwerbsleben. IV.7 Wettbewerb und unternehmerisches Umfeld Die Schwerpunkte liegen auf der Verbesserung des Finanzierungszugangs heimischer KMU, auf der Stärkung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage sowie der Wettbewerbsfähigkeit und der Standortattraktivität, der Reduzierung der Verwaltungslasten und der Stärkung der Exportwirtschaft. Wettbewerb unterstützt in einer Marktwirtschaft eine effiziente Allokation der Ressourcen. Dem weiteren Ausbau der Wettbewerbsintensität und der Innovationsanstrengungen sowohl im Dienstleistungs- als auch dem Sachgüterbereich wird auch in Zukunft große Bedeutung beigemessen. 18 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 IV.7.1 Herausforderungen und (geplante) Maßnahmen a) Wettbewerbsrecht Die erfolgreiche Vollziehung des Wettbewerbsrechts und damit die Aufdeckung von Wettbewerbsverstößen hängen von schlagkräftigen Institutionen ab. Das Regierungsprogramm sieht daher die Stärkung der Bundeswettbewerbsbehörde sowie eine Reform der Behördenorganisation vor, um optimale Synergien der Wettbewerbsbehörden – unter Beachtung rechtsstaatlicher Prinzipien – und im Hinblick auf das europäische Umfeld zu erzielen. b) Gründungsdynamik Hinsichtlich der Gründungsdynamik gehen die Bemühungen dahin, Gründungen durch adaptierte Förderprogramme zu unterstützen und Gründungen zu vereinfachen (GmbH neu). Das aktuelle Regierungsprogramm sieht die Steigerung der Attraktivität der österreichischen GmbH im nationalen und internationalen Wettbewerb der Rechtsformen vor. Darüber hinaus sollen die Kosten bestimmter einfacher Gründungen von Einpersonengesellschaften durch natürliche Personen erheblich reduziert werden. Die Umsetzung dieser GmbH-Reform ist bis Ende 2010 geplant. c) Weitere Internationalisierung Die Situation der österreichischen Exportwirtschaft ist weiterhin angespannt. Die Außenwirtschaft adäquat zu unterstützen, bleibt daher eine notwendige Investition in die Zukunft. Die grundsätzliche Konzeption der Internationalisierungsoffensive und die bisher gesetzten Maßnahmen haben sich bewährt. Die Besonderheit der Internationalisierungsoffensive liegt darin, dass sie auf eine umfassende Strukturveränderung abzielt. Sie beschränkt sich nicht darauf, bestehende Märkte zu sichern und neue zu öffnen, sondern bemüht sich, aufbauend auf einer Stärken-/Schwächenanalyse des österreichischen externen Sektors, nachhaltig Fundamente einer dynamischen, global orientierten und wissensbasierten Außenwirtschaftsstruktur zu schaffen. Im Zuge der Fortsetzung wird auf einen systematischen, fokussierten und strukturierten Ansatz zu achten sein. Ein Schwerpunkt wird sein, der mangelnden Exportausrichtung in die aufstrebenden Schwellenländer gegenzusteuern. Neben den BRICS (Brasilien, Russische Föderation, Indien, China und Südafrika) werden die Schwarzmeerregion sowie Zentralasien und die Türkei Schlüsselrollen spielen, weil sie zu den schnell wachsenden Märkten gehören und das österreichische Exportpotenzial in diese Region groß ist. Der Erhöhung des Technologiegehalts an österreichischen Exporten kommt dabei zunehmend zentrale strategische Bedeutung zu. V. Horizontales Im Rahmen der Arbeiten zum Entwurf des Nationalen Reformprogramms hat das Bundeskanzleramt im Frühjahr das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO mit einer Studie zu den Wachstumshemmnissen beauftragt. Auf Basis dieser Studie fand im Mai 2010 eine erste 19 Österreichisches Reformprogramm für Wachstum und Beschäftigung – Entwurf 2010 Diskussion zu Wachstumshindernissen mit allen betroffenen Ressorts und den Sozialpartnervertretern statt. Die einzelnen Ressorts setzten die diesbezügliche Arbeit fort und identifizierten in der Folge die jeweiligen in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Hemmnisse. Nach Abschluss der Budgetverhandlungen werden die Ressorts diese Arbeiten fortsetzen und Detailmaßnahmen zur Erreichung der nationalen Ziele festlegen. Der BESO-Rat wird im Dezember 2010 eine Beispielliste potenzieller Arbeitsmarktengpässe annehmen, die bei der Erstellung des endgültigen Reformprogramms berücksichtigt werden. Für Österreich ist es wichtig, dass die Fachministerräte umfassend in die Umsetzung und das thematische Monitoring beider Säulen der Europa 2020 Strategie (makroökonomische und thematische Koordinierung) eingebunden werden. Die Europa 2020 Strategie soll eng mit dem EU-Haushalt verknüpft werden und wird durch alle gemeinsamen Politiken, darunter die Gemeinsame Agrarpolitik und die Kohäsionspolitik, unterstützt. Zu den Zielen der Strategie wird die Gemeinsame Agrarpolitik einen bedeutenden Beitrag leisten, vor allem im Hinblick auf Beschäftigung (im ländlichen Raum) und erneuerbare Energie und damit auch auf die nationalen Kernziele Beschäftigung sowie Klimaschutz und Energie. Entsprechend dem Bericht der Stiglitz-Kommission und der Initiative der Europäischen Kommission „GDP and beyond“ gibt es in Österreich Aktivitäten, wie Messgrößen für Wohlstand und Lebensqualität in Ergänzung zum BIP und Merkmale eines qualitativ ausgerichteten Wirtschaftssystems stärker sichtbar gemacht werden können. Im gesamten Umsetzungsprozess wird darauf zu achten sein, dass eine umfassende Einbindung der Länder, Gemeinden und Interessensvertreter erfolgt. 20