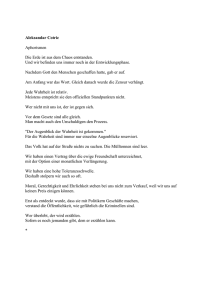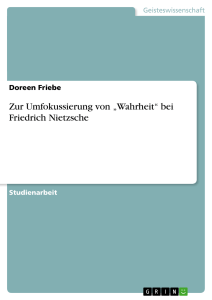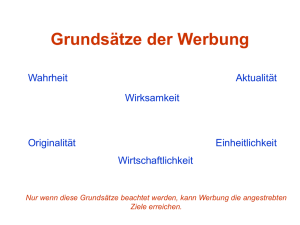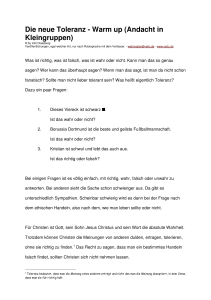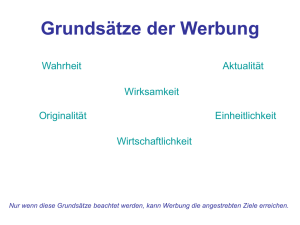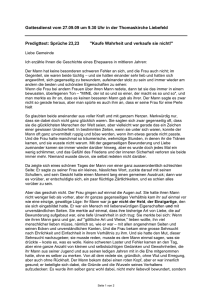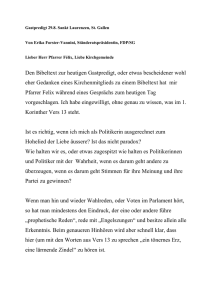Ringvorlesung Angewandte Ethik
Werbung

Ringvorlesung Angewandte Ethik Sommer-Semester 2015 Otto Neumaier Wissenschaft und Ethik: die offene Frage 20. Mai 2015 Im März und April 2015 erschienen in Nature und Science mehrere Artikel, in denen aufgerufen wurde, auf bestimmte Versuche zu verzichten und darüber ethisch zu reflektieren. Was sind die (Hinter-) Gründe für diesen Vorschlag? 2 In den 1980er Jahren war entdeckt worden, dass sich Bakterien vor Viren schützen, indem sie ihrem eigenen Genom einen Teil des fremden Erbgutes einfügen, und zwar in Form von palindromisch wiederholten Sequenzen samt den dazwischen liegenden Abschnitten (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats; CRISPR). Dazu bedienen sie sich eines bestimmten Enzyms, des Crispr associated Protein mit der Nummer 9 (Cas9). Im Jahr 2012 kam es zu einer entscheidenden Entdeckung: 3 Wie aus dieser Studie folgt, lässt sich die CRISPR-Cas9Technik der Bakterien gezielt als »programmierbare Schere« bzw. als »gentechnisches Schweizermesser« einsetzen, um im Genom beliebiger Organismen eine Gensequenz »punktgenau« durch eine andere zu ersetzen. Die Technik wurde in den vergangenen drei Jahren so weit verfeinert, dass wir nun vor folgender Situation stehen: • Die CRISPR-Technik kann leicht, rasch und kostengünstig für genetische Eingriffe verwendet werden. • Beispielsweise lassen sich damit Nutzpflanzen genetisch so exakt verändern, dass sie von natürlich mutierten Pflanzen nicht mehr zu unterscheiden sind. • Die Technik erlaubt auch Eingriffe ins menschliche Genom; die Änderungen können also vererbt werden. 4 Es ist diese neue Möglichkeit, gezielte Eingriffe in die menschliche Keimbahn vorzunehmen, die nicht zuletzt die Leute, welche die Technik selbst entwickelt haben, veranlasst hat, eine ethische Reflexion vorzuschlagen, d.h. zu überlegen, ob eine solche Nutzung der Technik wirklich wünschenswert ist. Eine solche »ethische Reflexionsphase« wird in der Biotechnologie nicht zum ersten Mal vorgeschlagen. Schon im Juli 1974 forderte Paul Berg, der jetzt den Aufruf in Science mit unterzeichnet hat, dort zusammen mit zehn anderen Wissenschaftlern (darunter James D. Watson), »that until the potential hazards of […] recombinant DNA molecules have been better evaluated or until adequate methods are developed for preventing their spread, scientists throughout the world join with the members of this committee in voluntarily deferring […] experiments.« 5 Neben anderen Maßnahmen forderten die Wissenschaftler auch die Abhaltung einer internationalen Tagung zur Diskussion des Forschungsstands und zur Erarbeitung von Richtlinien für die Vermeidung »biologischer Unfälle«. Die bei dieser Tagung im Februar 1975 in Asilomar (Calif.) erarbeiteten Richtlinien werden unterschiedlich bewertet: • Manchen (auch Kritikern) gelten sie als Beweis dafür, dass sich Wissenschaftstreibende ihrer Verantwortung bewusst sind und bei Forschungen in einem neuen Bereich das Vorsichtsprinzip anwenden. • Andere (darunter James Watson) hielten sie für »an exercise in the theater of the absurd«, weil die möglichen Gefahren zu hoch eingeschätzt worden waren und die Forschungen danach gleich weitergingen wie zuvor. 6 Tatsächlich stellte sich das Gefahrenpotenzial der damaligen Forschungen mit der rekombinierten DNA von Tumorviren später als geringer heraus, als befürchtet worden war. Deshalb wurden die Vorsichtsmaßnahmen in der Folge zum Teil wieder zurückgenommen. Folgt daraus jedoch, dass die ethische Reflexion darüber, ob wir in einem Bereich der Wissenschaften alles tun sollen, was wir tun können, absurd ist, wie Watson meinte? Watson hatte zwar das »Asilomar-Moratorium« mit unterschrieben, sich dann aber »besonnen« und gegen die Beschränkung wissenschaftlicher Forschung ausgesprochen. Auch 2015 bedeutet der Aufruf zu »offenen Gesprächen über die Nutzung der CRISPR-Technologie« nicht, dass a'e Beteiligten diese Forschungen genere' beschränken möchten. 7 Die Befürworter des Einsatzes der CRISPR-Technologie für Eingriffe in die menschliche Keimbahn können dabei Argumente ins Treffen führen, die auch aus ethischer Sicht nicht von vornherein von der Hand zu weisen sind: • Damit können Krankheiten geheilt werden, für die uns nur sehr begrenzt andere Mittel zur Verfügung stehen. • Der Einsatz der Technik verursacht zudem viel geringere Kosten als andere medizinische Heilmethoden. • Der praktische Erfolg von CRISPR verhilft uns auch zu grundlegenden theoretischen Einsichten in wesentliche biologische Zusammenhänge. • Die dadurch bewirkten genetischen Veränderungen von Menschen sind von natürlichen Mutationen nicht zu unterscheiden, anders als diese aber in jedem Fa' positiv. 8 So erfreulich diese Aussichten klingen, so lässt sich natürlich auch manches gegen so viel Optimismus einwenden: ➡ Es ist zweifelhaft, ob gezielte Eingriffe ins Genom nur die erwünschten positiven Auswirkungen haben; vielmehr ist (wie bei jedem Handeln) auch mit nicht-intendierten »Nebenwirkungen« zu rechnen. ➡ Insbesondere wissen wir nichts darüber, wie sich vererbte Eigenschaften insgesamt auf das Leben von Individuen der folgenden Generationen auswirken. ➡ Wenn eine Technik relativ frei verfügbar und einfach zu beherrschen ist, dann ist die Gefahr umso größer, dass sie auch für zweifelhafte Zwecke missbraucht wird. Mithin haben wir Grund und Anlass, das Verhältnis von Wissenschaft und Ethik etwas genauer zu betrachten. 9 Auf den ersten Blick scheint es, als ob die Wissenschaften von vornherein moralisch ausgerichtet sind, denn • sie verfolgen das theoretische Ziel des Gewinns von Wahrheit bzw. Erkenntnis, dabei zugleich aber auch • das praktische Ziel der »Erleichterung und Verbesserung der Lage der Menschen« (Francis Bacon). Unter diesen Zielen wird wohl in der einen oder anderen Wissenschaft jeweils etwas anderes verstanden. Andererseits finden wir derartige Verbindungen theoretischer und praktischer Ziele sehr oft. So bestimmt etwa auch Bernard Bolzano (1849) die Philosophie als »Wissenschaft von dem objectiven Zusammenhange aller derjenigen Wahrheiten, in deren letzte Gründe nach Möglichkeit einzudringen wir uns zu einer Aufgabe machen, um dadurch weiser und besser zu werden.« 10 Ist Bolzanos Rede davon, dass wir es uns als Philosophierende (wie überhaupt in den Wissenschaften) zur Aufgabe machen, grundlegende Wahrheiten zu finden, »um dadurch weiser und besser zu werden«, als Beschreibung dessen zu verstehen, was wir a'e tun? Damit würde er behaupten, dass dies de facto alle Leute in Philosophie und Wissenschaft tun. Aber ist das so? Wahrscheinlicher ist, dass Bolzano normativ erklärt, es sei Aufgabe derer, die sich mit Philosophie bzw. Wissenschaft beschäftigen, grundlegende Wahrheiten zu finden, um dadurch ein moralisches Ziel zu erreichen. 11 Der normative Aspekt kommt genau genommen bereits dadurch ins Spiel, dass Bolzano die Philosophie auf die erwähnte Weise bestimmt bzw. definiert. Jede Definition ist insofern normativ, als sie bestimmte Verwendungsweisen eines Ausdrucks von anderen abgrenzt und festlegt, wie der Ausdruck verstanden werden so'. Eine »Nebenwirkung« davon ist, dass jene, die nicht nach grundlegenden Wahrheiten suchen, um dadurch ein moralisches Ziel zu erreichen, entweder überhaupt nicht als philosophisch oder wissenschaftlich Tätige gelten oder aber als solche, die das Ziel dieser Tätigkeit verfehlen bzw. die vorausgesetzte Aufgabe nicht erfü'en. Auf diese normative Voraussetzung wissenschaftlichen Tuns weist nicht zuletzt auch Friedrich Nietzsche hin. 12 Nach Ansicht von Nietzsche (Die )öhliche Wissenschaft, 21887) liegt dem wissenschaftlichen Tun »der unbedingte Wille zur Wahrheit« zugrunde. Dieser kann nicht auf einem »NützlichkeitsCalcul« beruhen; vielmehr halten Wissenschaftstreibende am »Willen zur Wahrheit« fest, obwohl ihnen dessen »Unnützlichkeit und Gefährlichkeit […] fortwährend bewiesen wird.« Wir halten am »Willen zur Wahrheit« auch nicht deshalb fest, weil wir nicht getäuscht werden wollen, sondern weil Wissenschaft bedeutet: »›ich will nicht täuschen, auch mich selbst nicht‹: – und hiermit sind wir auf dem Boden der Moral.« 13 Wenn Nietzsche Recht hat, so gehört zum wissenschaftlichen Ethos nicht nur der Verzicht auf das bewusste Täuschen anderer, sondern auch und erst recht das Bemühen, sich selbst nicht zu täuschen. Dazu gehört etwa, • nicht subjektive Vorlieben als Maßstab für das Vertreten von Ansichten zu nehmen, sondern die Frage, ob sie aufgrund der untersubjektiv verfügbaren Informationen als richtig und gerechtfertigt anzusehen sind, und • eine Annahme aufzugeben, wenn sie sich als Irrtum bzw. als falsch oder nicht hinreichend gerechtfertigt erweist. Wissenschaft schließt demnach das Streben ein, einen Gegenstandsbereich so gut wie möglich zu erklären, und zwar unabhängig von der subjektiven Einstellung, die wir dazu pflegen und die es gegebenenfalls zu verändern gilt. 14 Ein so verstandener »Wille zur Wahrheit« ist zwar tatsächlich unabdingbar für wissenschaftliche Tätigkeit, doch ist laut Nietzsche zweifelhaft, ob er auch unbedingt gelten soll: »Denn man frage sich nur gründlich: ›warum willst du nicht täuschen?‹ […] Es könnte ein solcher Vorsatz vielleicht, mild ausgelegt, eine Don-Quixoterie, ein kleiner schwärmerischer Aberwitz sein; er könnte aber auch noch etwas Schlimmeres sein, nämlich ein lebensfeindliches zerstörerisches Prinzip…« Diese Kritik am »unbedingten Willen zur Wahrheit« ist wohl auch durch Nietzsches Ansicht begründet, dass sich die Wissenschaft diesbezüglich vom Leben abhebt. Laut Nietzsche (»Über Wahrheit und Lüge im außenmoralischen Sinne«, 1873) dient der menschliche Verstand primär dem Überleben, hat er also nicht unbedingt die Funktion, eine objektive Wirklichkeit realistisch zu erfassen. 15 Im Allgemeinen ist das Streben nach Wahrheit laut Nietzsche praktisch begründet, und zwar durch die »Notwendigkeit, mit anderen zu koexistieren«. Mit Blick darauf wird »das fixirt, was von nun an Wahrheit heißen soll.« Auch für die Wissenschaften gilt, dass Wahrheit im Sinne eines Erfassens der Dinge »an sich« unmöglich ist. Nietzsche stellt dabei nicht allgemein den Anspruch auf Wahrheit in Frage, sondern – laut Wolfgang Röd (Geschichte der Philosophie XIII, 2002) – den »Anspruch definitiver Wahrheit von Urteilen über die Wirklichkeit an sich«. Wenn wir in den Wissenschaften an »Wahrheiten« in einem absoluten, unbedingten Sinne glauben, so handelt es sich in Nietzsches (1873) Augen bloß um I'usionen, »von denen wir vergessen haben, dass sie welche sind«. 16 Das unbedingte Streben nach einer Wahrheit »an sich« wird aber nicht nur dann zu einem »lebensfeindlichen, zerstörerischen Prinzip«, wenn dabei die Möglichkeit des Irrtums und von anderen Perspektiven verdrängt wird. Problematisch ist vielmehr auch, wenn dieses Streben dem praktischen Ziel des Überlebens zuwiderläuft. Diese Überlegung gleicht jener von Bolzano, der dabei noch weiter geht und 1810 in einer Erbauungsrede »Von der weisen Selbsttäuschung in gewissen Fällen« spricht: »Wo der Irrthümer einmal schon mehrere vorhanden sind: da kann ein neu hinzugekommener, statt ihre Anzahl zu vermehren, selbe im Gegenteil vermindern; die neue Täuschung kann oft die schädliche Wirksamkeit anderer […] heben; der neue Irrthum dient oft nur dazu, dass wir aus einem falschen Vorhersatze […] eine wahre und richtige Folgerung herleiten.« 17 Zwar hält es Bolzano für eine »Pflicht des Menschen«, nach Wahrheit zu streben, doch sieht er dafür Grenzen: • Das Zugeständnis, dass wir uns (auch selbst) täuschen können, zeugt von der Einsicht in die Endlichkeit des Menschen, insbesondere darin, »dass sein Verstand beschränkt und sein Herz nicht durchaus fehlerlos ist.« • Die Pflicht, nach Wahrheit zu streben, gilt nicht unbedingt und ausnahmslos, denn sie ist »von jener ersten und obersten« Pflicht abgeleitet, »das Wohl des Ganzen zu befördern«, die Bolzano das oberste Sittengesetz nennt. Wenn ich Bolzano richtig verstehe, so ist das theoretische Ziel der Wissenschaften instrumente' wertvo' für das Erreichen des praktischen Ziels. Wenn es mit diesem in Konflikt gerät, verliert es also seinen (bzw. an) Wert. 18 Bolzano spricht von einer »Pflicht des Menschen«, nach Wahrheit zu streben, während Aristoteles (Met., 980a21) meint, »alle Menschen streben von Natur nach Wissen«. Dies wirft nicht nur die Frage auf, wie etwas, das wir von Natur aus tun, zudem eine Pflicht sein soll, sondern auch, was es heißt, von Natur aus nach Wissen zu streben. Eine Antwort auf die Frage nach der Verankerung des Strebens nach Wahrheit in der menschlichen Natur verdanken wir Bertolt Brecht, der in seinen »Anmerkungen zu Leben des Galilei« (1947) bemerkt, der Forschungstrieb sei »nicht weniger lustvoll oder diktatorisch wie [sic!] der Zeugungstrieb«. 19 Demnach ist wissenschaftliche Forschung bei aller Rationalität so wie andere Einstellungen und Handlungen auch durch Triebe bestimmt. Wenn dem so ist, kommt es darauf an, mit diesem Trieb ähnlich umzugehen wie mit anderen Trieben. Wie Felix Hammer (Selbstzensur für Forscher? 1983) betont, hat dieser Umgang mit dem Forschungstrieb zwei Seiten: • Zum einen geht es darum, diesen Trieb nicht zu verdrängen, denn »Triebverdrängung macht krank.« • Zum anderen ist wichtig, den Trieb nicht blind walten zu lassen: »Bewußte Triebbeherrschung ist unerläßlich«, damit der Trieb nicht zur Sucht wird. Um mit dem Forschungstrieb umgehen zu können, ist indes zunächst notwendig, dass wir uns seiner bewusst sind. 20 Ein Zeichen für mangelnde Triebkontrolle und mithin für »Forschungssucht« könnte z.B. sein, wenn die ethische Reflexion darüber, ob wissenschaftliche Ziele, die wir erreichen können, auch angestrebt werden so'en, prinzipiell als »Beschränkung der Forschung« abgelehnt wird. Ein Ausdruck dieser Einstellung ist der vom Physiker Edward Teller formulierte und von Hans Lenk und Günther Ropohl (»Technik zwischen Können und Sollen«, 1987) so genannte technische Imperativ, der besagt: »Der technische Mensch soll das, was er verstanden hat, anwenden […] und sich dabei keine Grenze setzen. […] Was man verstehen kann, das soll man auch anwenden.« Demnach gilt für Wissenschaft und Technik ein »KönnenSo'en-Prinzip«: Was wir tun können, sollen wir auch tun. 21 Dies wirft u.a. die Frage auf, was es heißt, etwas zu können bzw. (im umfassenden Sinne) zu verstehen. Was heißt es z.B., (im umfassenden Sinne) zu verstehen, welche Konsequenzen die Nutzung der Kernenergie oder der Gentechnologie insgesamt mit sich bringt? Angenommen, wir hätten ein solches Verständnis gewonnen. Folgt daraus, dass wir uns bei der wissenschaftlichen Forschung und ihrer technischen Anwendung in jedem Fa' »keine Grenze setzen« sollen? Kann nicht eben das umfassende Verständnis eines Problems oder einer Theorie und ihrer Folgen zumindest in manchen Fällen bedeuten, dass wir wegen der Konsequenzen davon absehen so'en, nach weiteren Erkenntnissen zu streben bzw. diese technisch umzusetzen? 22 Wer ethische Reflexion für sinnvoll hält, kann mithin das »Können-Sollen-Prinzip« nicht unbedingt akzeptieren. In der Ethik gilt vielmehr in gewissem Sinne die Umkehrung des »technischen Imperativs«, d.h. die So'en-Können-Bedingung, wonach es nur dann gerechtfertigt ist, von jemandem zu fordern, dass er etwas tun so', wenn er es auch tun kann. Diese Bedingung setzt zunächst einmal dem ethischen Diskurs selbst Grenzen, da es eben nur dann gerechtfertigt bzw. sinnvoll ist, moralische Überlegungen anzustellen, wenn begründeterweise anzunehmen ist, dass die fraglichen Anforderungen für die Adressaten auch erfüllbar sind. So ist es z.B. nicht sinnvoll bzw. gerechtfertigt, von mir zu fordern, dass ich mit meinen bloßen Händen ein Gewicht von 2 Tonnen hebe oder dass ich sofort aufhöre zu atmen… 23 Die Annahme, dass es nur dann gerechtfertigt ist zu fordern, jemand so'e etwas tun bzw. er oder sie sei verpflichtet, sich für eine Handlung zu verantworten, wenn er oder sie das, worum es geht, auch tun kann, ist zweideutig. Damit können nämlich folgende Voraussetzungen gemeint sein: • Jemand ist subjektiv fähig, das zu tun, wovon es heißt, dass er oder sie es tun soll. • Es ist jemandem objektiv möglich, das zu tun, wovon es heißt, dass er oder sie es tun soll. Im ersten Fall wird für Ansprüche der präskriptiven Ethik vorausgesetzt, dass sich diese an ein zurechnungsfähiges Wesen richten, im zweiten, dass dieses Wesen auch über Handlungsmacht verfügt. Wer subjektiv fähig ist, etwas zu tun, dem mag es dennoch objektiv unmöglich sein, es zu tun. 24 Die Frage, über welche Vermögen ein Wesen verfügen muss, damit es als zurechnungsfähig gelten kann, ist mit Bezug auf das jeweils anzuwendende Normensystem (Recht, Berufskodex, Moral,…) anders zu beantworten. Aus Sicht der präskriptiven Ethik liegt es nahe anzunehmen, dass Zurechnungsfähigkeit nur bei einer Person vorliegen kann, d.h. bei einem Wesen, das laut Locke (Über den menschlichen Verstand, 21694) »Vernunft und Überlegung besitzt und sich selbst als sich selbst betrachten kann.« Andererseits sind wohl nicht a'e Personen im moralischen Sinne zurechnungsfähig, denn dafür ist es insbesondere notwendig, dass jemand prinzipiell auch in der Lage ist, die für moralische Prinzipien notwendigen Bedingungen der Präskriptivität und Universalisierbarkeit zu verstehen: 25 • Eine Norm n ist präskriptiv genau dann, wenn ein Subjekt x dadurch, dass x die Norm n anerkennt, auf bestimmte Handlungen festgelegt wird, die n vorschreibt. • Eine Norm n ist universalisierbar genau dann, wenn gilt: Hat ein Gegenstand x mit Bezug auf eine Norm n einen moralischen Status s, so kommt s gemäß n a'en Gegenständen zu, die x in relevanter Hinsicht gleich sind. Diese beiden Bedingungen für Moral im präskriptiven Sinne vorauszusetzen, bedeutet laut Richard Hare, dass wir nur solche moralischen Normen rational vertreten können, denen zufolge Gleiches gleich behandelt wird. Diese beiden Bedingungen sind laut Hare wesentlich für die »Logik« der Moral. Wer sie ablehnt, hat (in gewissem Sinne) nicht verstanden, was Moral ist. 26 Während Kinder bereits mit etwa 2–3 Jahren fähig sind, »sich als sich selbst [zu] betrachten«, entwickeln sie anscheinend erst später, bis zum Alter von etwa 10–12 Jahren, ein Verständnis davon, dass Gleiches gleich zu behandeln ist. Da Wissenschaft von Erwachsenen betrieben wird, ist anzunehmen, dass diese moralisch zurechnungsfähig sind. Diese Fähigkeit schließt ein, dass sie in der Lage sind, eine reflexive Distanz zu ihren Trieben, Wünschen und Empfindungen einzunehmen, und dass sie mithin die Auswirkungen ihres Handelns auf alle davon Betroffenen gleicherweise berücksichtigen können. Sie sind demnach auch fähig zu beurteilen, ob eine Handlung wegen ihrer Konsequenzen für die davon Betroffenen unproblematisch ist oder nicht. 27 Wer unbedingt bzw. ohne jegliche Beschränkung wissenschaftlich forschen möchte, könnte sich jedoch z.B. darauf berufen, dass er oder sie wegen seiner bzw. ihrer Berufung nicht anders könne, als das zu tun. Dies wäre zwar kein Fall von Zurechnungsunfähigkeit im eigentlichen Sinne, doch wäre trotzdem die subjektive Sollen-Können-Bedingung nicht erfüllt, da es jemandem aufgrund eines »inneren Drucks« nicht möglich ist, die Alternative zu wählen, also auf Forschung zu verzichten. Zwar könnte von dieser Person nicht gefordert werden, dass sie anders handelt, jedoch mit der »Nebenwirkung«, dass ihr die Handlungsfähigkeit abzusprechen und sie unter Vormundschaft zu stellen wäre. Es ist fraglich, ob jemand diese Konsequenz in Kauf nehmen möchte… 28 Im objektiven Sinne ist die Sollen-Können-Bedingung insbesondere dann nicht erfüllt, wenn keine Handlungsalternativen zur Verfügung stehen, zwischen denen jemand wählen kann, um eine Situation zu beeinflussen. Wenn solche Handlungsalternativen geschaffen werden, ergibt sich jedoch auch die Möglichkeit (und Notwendigkeit), über deren Wahl mit Bezug auf die jeweiligen Konsequenzen moralisch zu reflektieren und zu urteilen. Solange z.B. keine Therapien zur Verfügung stehen, um bestimmte Krankheiten zu behandeln bzw. zu heilen, müssen wir dies als gegeben hinnehmen. Durch die Entwicklung von Therapien eröffnen sich indes Handlungsalternativen, durch die es gerechtfertigt ist, den medizinisch Tätigen Verantwortung dafür zuzurechnen. 29 Freilich kommen diese Therapien nicht aus dem Nichts, d.h., die Frage der Verantwortung stellt sich bereits dann, wenn sich die Möglichkeit eröffnet, therapeutische (und überhaupt wissenschaftliche) Möglichkeiten zu entwickeln. Die in den Wissenschaften alltägliche Frage, ob über einen Gegenstand geforscht werden soll oder nicht, ist Ausdruck des Verfügens über zumindest zwei Alternativen, zwischen denen wir wählen können. Die ethische Reflexion darüber, welche dieser Alternativen gewählt werden so', bringt abhängig davon, ob ein deontologischer, teleologischer oder anderer Ansatz zugrunde gelegt wird, jeweils eine andere Begründung ins Spiel. In jedem Fall spielt aber wohl die erwähnte Frage nach den Zielen der wissenschaftlichen Forschung eine Rolle. 30 Als jenes praktische Ziel, welches das wissenschaftliche Streben nach Wahrheit als theoretisches Ziel rechtfertigt, bestimmte bereits Francis Bacon (Novum Organum, 1620) die »Erleichterung und Verbesserung der Lage der Menschen«. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es laut Bacon notwendig, »die Macht und die Herrschaft des Menschengeschlechtes […] über die Gesamtheit der Natur zu […] erweitern.« Bacon denkt dabei jedoch nicht an eine »Unterwerfung« oder Ausbeutung der Natur. Vielmehr meint er, die Natur lasse sich »nur durch Gehorsam besiegen.« Es geht also darum, durch die Erklärung der Naturvorgänge das Leben und Überleben der Menschen zu verbessern. 31 Bacons Überlegungen werfen eine Reihe von Fragen auf, u.a. die folgenden: • Was heißt es, die Lebenssituation der Menschen durch Wissenschaft und Technik zu verbessern? • Was sind die Kriterien dafür, dass sich das Leben der Menschen durch Wissenschaft verbessert? • Werden diese Kriterien (bzw. die eigenen Ansprüche) durch die Wissenschaften tatsächlich erfüllt? Zwar sind diese Fragen keineswegs geklärt, doch spielt das von Bacon genannte Ziel bis heute für die Rechtfertigung wissenschaftlicher Forschung eine zentrale Rolle. Tatsächlich wird kaum jemand etwas dagegen haben, dass durch wissenschaftliche Forschung Krankheiten geheilt, Menschen ernährt oder soziale Probleme gelöst werden können. 32 Unseren früheren Überlegungen zufolge lässt sich daraus nicht auf die Gültigkeit des technischen Imperativs schließen, gilt also nicht: Was wir tun können, sollen wir auch tun. Nehmen wir z.B. an, dass wir Aussicht haben, eine seltene Erkrankung von Menschen dadurch (und zwar nur dadurch) in den Griff zu bekommen, dass wir an Tieren bestimmte, für diese qualvo'e Experimente durchführen. Den Tierschutzgesetzen vieler Länder gemäß ist es verboten, einem Tier »ohne vernünftigen Grund« bzw. »ungerechtfertigt« Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen. Als Rechtfertigung bzw. vernünftiger Grund gilt jedoch, dass »die Bewahrung und der Schutz des menschlichen Lebens« (wie auch desjenigen von Tieren selbst sowie sogar von Pflanzen) Tierversuche notwendig macht. 33 In neuerer Zeit hat sich die Einstellung vieler Menschen zur Verwendung von Tieren für die »Erleichterung und Verbesserung der Lage der Menschen« gewandelt. Eine andere Frage ist aber, ob diese Menschen bereit sind, sich für eine der folgenden Alternativen zu entscheiden: • Wer es ablehnt, dass für Forschungen, deren Ziel die »Erleichterung und Verbesserung der Lage der Menschen« ist, bestimmte Mittel eingesetzt werden, muss konsequenterweise auch für den Verzicht auf all jene Handlungsmöglichkeiten eintreten, die sich dadurch eröffnen. • Wer es für wichtig hält, ein Ziel zu erreichen, muss auch bereit sein, zumindest manche Mittel als dafür notwendig zu akzeptieren und Risiken in Kauf zu nehmen – zumal solche, die der ethischen Reflexion standhalten. 34 Wie früher erwähnt, ist es nur dann gerechtfertigt zu fordern, dass jemand etwas tun soll, wenn er oder sie das, worum es geht, auch tun kann. Diese Bedingung wurde von Aristoteles (Nikomach.Ethik 1109b32ff.) eingeführt, der betont, jemand sei für eine Handlung nur dann moralisch zu tadeln, wenn diese )eiwi'ig (hekousios) ist. Aristoteles meinte damit allerdings nicht nur, dass jemand über Handlungsalternativen verfügt, sondern auch, dass er oder sie (viele von) deren Folgen vorhersehen kann. Tatsächlich sind wir moralisch im Sinne einer Schuldigkeit oder Schuld nur für solche Konsequenzen unseres Handelns verantwortlich zu machen, von denen begründeterweise anzunehmen ist, dass sie objektiv vorhersehbar sind. 35 Dieser Überlegung zufolge gilt jemandes Handeln als moralisch richtig, solange nicht gute Gründe für die Annahme sprechen, dass bestimmte Folgen des Handelns für davon betroffene Wesen gravierend sind und dass dieser Umstand objektiv vorhersehbar ist. Indes ist diese Unschuldsvermutung nur dann problemlos anwendbar, wenn wir hinreichend gut wissen, welche Folgen verschiedene Handlungsalternativen voraussichtlich jeweils haben und dass diese ein »übliches Maß« an Schwere nicht überschreiten. Dies ist indes nicht immer der Fa': ➡ Wie neue Entwicklungen in Wissenschaft und Technik zeigen, müssen wir oft mit der Möglichkeit rechnen, dass bestimmte Handlungen gravierende, irreversible Folgen haben, ohne dass wir wissen, welche Folgen dies sind. 36 Wenn wir strikt an der Unschuldsvermutung festhalten, so sind viele Handlungen als moralisch richtig zu beurteilen, obwohl die Wahrscheinlichkeit gravierender, irreversibler Folgen relativ hoch ist. Zudem ist es nicht gerechtfertigt, jemandem eine moralische Pflicht zur Unterlassung einer Handlung zuzurechnen, von der nicht mit Gewissheit zu sagen ist, welche Folgen sie hat. Indes erscheint es theoretisch und praktisch ratsam, jemandes Handeln eher nicht von vornherein als richtig zu beurteilen, wenn (etwa aufgrund der Komplexität und Vernetztheit von Ereignissen sowie von Wechselwirkungen zwischen diesen) nur wenig über die vorhersehbaren Folgen einer Handlung bekannt, sondern »bloß« wahrscheinlich ist, dass diese gravierende oder irreversible Folgen hat. 37 Um Schaden zu vermeiden, liegt es nahe, in Anschluss an Dagfinn Føllesdal (»Einige ethische Aspekte der DNS-Rekombination«, 1981) in solchen Fällen (und nur in diesen) dem Unschuldsprinzip ein Vorsichtsprinzip überzuordnen: ‣ Eine Handlung gilt nur dann als moralisch richtig, wenn gute Gründe für die Annahme sprechen, dass die Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist, dass diese Handlung besonders gravierende Folgen für Betroffene hat. Besondere Vorsicht ist nicht nur dann geboten, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine Handlung sehr gravierende oder irreversible Folgen hat, sondern auch dann, wenn wir aufgrund mangelnder Erfahrung so gut wie nichts darüber wissen, welche Folgen eine Handlung haben könnte (wie bei neuen Technologien). 38 Eine solche neue Technologie ist z.B. der Einsatz von CRISPR-Cas9 für Änderungen des Genoms. Deshalb ist es gerechtfertigt zu fordern, dass bei den Forschungen über die Einsatzmöglichkeiten dieser Technik mit größtmöglicher Vorsicht vorgegangen wird. Der Aufruf zu »offenen Gesprächen über die Nutzung der CRISPR-Technologie« und zur Zurückhaltung vor Eingriffen in die menschliche Keimbahn zeigt mithin, dass die beteiligten Personen das Vorsichtsprinzip anwenden (welche Gründe auch immer sie sonst noch haben mögen). Indes ist es keineswegs bloß die Neuheit des wissenschaftlichen Ansatzes, die Vorsicht geboten erscheinen lässt. Vielmehr ist auch an die bislang unbekannten Konsequenzen der bereits durchgeführten Forschungen zu denken. 39 Giacomo Balla: »Velocità d’automobile« (1913) Laut Hans-Bernd Strack hat die wissenschaftlich-technische Innovation ein Tempo erreicht, dass selbst dann, wenn wir sofort und vo'ständig au-örten, weiter zu forschen und die Ergebnisse anzuwenden, mit einer überaus hohen, unbekannten Zahl unbekannter Konsequenzen zu rechnen ist. 40 Laut Strack ist dies so, als ob wir mit einem Auto schne'er als »auf Sicht« unterwegs wären, d.h. so, dass der Bremsweg länger ist als die Strecke, die wir sehen können. Wenn ein Autofahrer schneller als »auf Sicht« fährt, so gilt er mit Recht als verantwortungslos. Dies wirft jedoch die Frage auf, warum wir in Bezug auf Wissenschaft und Technik, deren Konsequenzen im Ernstfall für eine unvergleichlich größere Zahl von Menschen gravierender sind, nicht eine ähnliche Einstellung bzw. eine angemessene ethische Reflexion pflegen. Selbst wenn die ethische Reflexion zum Ergebnis führt, dass die Risiken geringer sind, als zunächst befürchtet worden war, ist eben die Reflexion notwendig, um dies zu erkennen – und dann zu handeln. 41 Aber kehren wir zu unserer Ausgangssituation zurück und wenden wir darauf etwas an, was manchmal als ethische Minimalforderung an wissenschaftliches Tun genannt wird: der redliche Umgang mit den relevanten Informationen. Demnach sind Wissenschaftstreibende verpflichtet, mit Bezug auf den Gewinn, die Verarbeitung und Veröffentlichung der für ihre Forschungen relevanten Informationen bestimmte Standards einzuhalten, die in der »community of scientists« vorausgesetzt werden. Die Forderung der Redlichkeit hat nicht nur mit dem erwähnten »Willen zur Wahrheit« zu tun, sondern auch damit, dass für die durch die Wissenschaften angestrebten theoretischen und praktischen Fortschritte notwendig ist, dass Ergebnisse intersubjektiv reproduzierbar sind. 42 Wie Manfred Eigen (»Wir müssen wissen, wir werden wissen«, 1988) betont, hat etwa Otto Hahn dadurch, dass er diese Standards einhielt und »seine Resultate in der Zeitschrift Die Naturwissenschaften veröffentlicht […hat, diese] damit der gesamten Welt zugänglich gemacht – wohlgemerkt in einem Land, das sich anschickte, über seine Nachbarn herzufallen.« Dadurch wurde den PhysikerInnen klar, dass Deutschland über die Möglichkeit verfügte, die Nuklearenergie auch militärisch zu nutzen, weshalb sie sich – in der Kriegssituation – für deren Entwicklung einsetzten. Zwar trug Hahn so indirekt zur Entwicklung der Atombombe bei, doch trägt er laut Eigen daran keine (Mit-) Schuld, denn »er hat sich an keinen Arbeiten beteiligt, die die Entwicklung einer Bombe zum Ziel hatte.« 43 Drei Wochen nach Veröffentlichung des Aufrufs zu »offenen Gesprächen über die Nutzung der CRISPR-Technologie« ist nun der erste Aufsatz erschienen, in dem über Versuche zu deren Einsatz für Eingriffe in die menschliche Keimbahn berichtet wird. 44 Zwar lässt sich die Praxis einer »Open-Access«-Zeitschrift kritisch diskutieren, die den Aufsatz nach einer Begutachtungsfrist von 2 Tagen akzeptierte, doch hielten sich die Autoren zumindest an die Regeln der wissenschaftlichen Redlichkeit, wodurch wir nun u.a. Folgendes wissen: • Es werden bereits Versuche durchgeführt, die therapeutischen Eingriffen in die menschliche Keimbahn dienen. • Obwohl die CRISPR-Technik als höchst effizient und punktgenau gilt, sind die Versuchsergebnisse schlecht. • Solange die Ergebnisse sich nicht als reproduzierbar erweisen, sind sie dennoch mit Vorsicht zu genießen. • Höchstwahrscheinlich wird weltweit weiter an Versuchen und an Verfeinerungen der Technik gearbeitet, um das Ziel zu erreichen, über das zu reflektieren wäre… 45