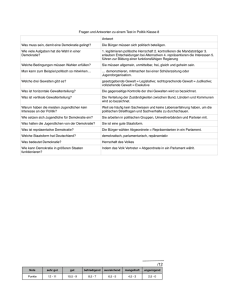Ist die direkte Demokratie mitschuldig an der
Werbung

150 DEBATTE Schmidt, Manfred G. (2002). ”The Impact of Political Parties, Constitutional Structures and Veto Players on Public Policy”, in Hans Keman (ed.). Comparative Democratic Politics. A Guide to Contemporary Theory and Research. London: Sage, pp. 166-184. Schmidt, Manfred G. (2005). ”Politische Reformen und Demokratie. Befunde der vergleichenden Demokratie- und Staatstätigskeitsforschung”, in Hans Vorländer (Hrsg.). Politische Reform in der Demokratie. Baden-Baden: Nomos, S. 45-62. Sciarini, Pascal, Sarah Nicolet et Alex Fischer (2002). ”L‘impact de l‘internationalisation sur le processus du décision en Suisse”, Revue Suisse de Science Politique 8(3/4): 1-34. Ist die direkte Demokratie mitschuldig an der wirtschaftlichen Stagnation der Schweiz? Frank Bodmer, Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum, Universität Basel; E-Mail: [email protected] Silvio Borner, Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum, Universität Basel; E-Mail: [email protected] 1 Einleitung Die Schweiz stagniert. Seit Beginn der 90er Jahre konnte praktisch kein Wachstum erzielt werden. Die Schweiz liegt damit im Vergleich zu den anderen OECD-Ländern weit abgeschlagen auf dem letzten Platz, noch deutlich hinter Deutschland und Japan, über deren Krisen schon viel geschrieben wurde.1 Gleichzeitig stiegen die Staats- und die Fiskalquote markant an. Während für die 90er Jahre die Krise allgemein sicht- und spürbar ist, so liegen ihre Wurzeln bereits in der Phase nach der ersten Erdölkrise von 1974. Worauf ist diese Wachstumsschwäche nun zurückzuführen? Grundsätzlich gibt es nur drei Erklärungsmöglichkeiten: erstens könnte es sich um Pech in Gestalt von exogenen Angebots- oder Nachfrageschocks gehandelt haben, zweitens um wachstumsfeindliche Verhaltensänderungen von Unternehmen und Arbeitnehmern oder schliesslich drittens um falsche Weichenstellungen in der Wirtschaftspolitik. Die erste Möglichkeit können wir ausschliessen, scheint die Schweiz Seit der kürzlichen Revision der Zahlen für das Bruttoinlandprodukt ist auch klar geworden, dass die Wachstumsschwäche nicht nur scheinbar ist und auf mögliche Datenprobleme zurückgeht. Für eine Übersicht zur Entwicklung der schweizerischen Volkswirtschaft, siehe Borner und Bodmer (2004). 1 WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 151 über verbesserte Terms-of-Trade doch eher vom Globalisierungs-Glück profitiert zu haben. Die fehlende Dynamik als zweiter möglicher Grund kann nicht ganz ausgeschlossen werden. Dem steht aber die eindrückliche Konkurrenzfähigkeit der schweizerischen Exportwirtschaft gegenüber, welche solche kulturellen Erklärungsfaktoren allein als ungenügend erscheinen lässt. Es verbleibt damit die Wirtschaftspolitik als Hauptverdächtiger. Mit der Wirtschaftspolitik geraten auch direkte Demokratie und Volksentscheide in die Kritik, hat das Volk als Souverän doch praktisch immer das letzte Wort und ist damit (mit-)verantwortlich. In Bezug auf die Wirtschaftspolitik stehen wir eigentlich vor einem Rätsel. Die empirische Forschung hat nämlich in einer inzwischen sehr langen Reihe von Arbeiten gezeigt, dass die direkte Demokratie auf kantonalem Niveau zu mehr Wachstum, weniger Staatsausgaben, tieferen Steuern, weniger Verschuldung, besserer Steuermoral und ganz allgemein zu grösserem Glück führt.2 Diese Resultate und die Tatsache, dass die Schweiz auf nationalem Niveau über soviel direkte Demokratie verfügt wie kein anderes Land, passen natürlich schlecht zur wirtschaftlichen Stagnation und zur steigenden Steuer- und Abgabenlast. Erstens stellt sich deshalb die Frage, ob die Kantonsvergleiche überhaupt auf die nationale Politik und die nationalen Probleme übertragen werden können. Aus unserer Sicht gibt es viele und gute Gründe, weshalb dies nicht der Fall ist.3 Zweitens muss untersucht werden, ob und wie die direkte Demokratie auf nationalem Niveau einen negativen Einfluss auf die Wirtschaftspolitik haben könnte. Wir werden uns im folgenden auf grundsätzliche Überlegungen und nicht auf statistische Resultate stützen. Einerseits ist die Schweiz international ein Sonderfall, womit internationale Vergleiche entfallen. Andere statistische Methoden, wie das Auszählen von Volksentscheiden, scheinen uns ebenfalls wenig geeignet, die Auswirkungen der direkten Demokratie auf die wirtschaftliche Entwicklung festzustellen.4 Dagegen gibt es Fallbeispiele, welche auf einen negativen Einfluss der direkten Demokratie hinweisen. Zu nennen sind vor allem die negativen Volks2 Diese Literatur arbeitet mit der interkantonalen oder intermunizipalen Variation an direkter Demokratie. Zu Einkommensniveau und Wachstum, siehe Feld und Savioz (1997) und Vatter und Freitag (2001). Zu öffentlichen Finanzen, siehe z.B. Feld und Kirchgässner (2001); zu Steuermoral, siehe z.B. Feld und Frey (2001); zu Glück, siehe z.B. und Stutzer und Frey (2000). 3 Dabei ist einerseits zu beachten, dass die Probleme auf nationalem Niveau anders sind als auf kantonalem Niveau. Andererseits ist es möglich, dass die Resultate bezüglich kantonaler Entwicklung nicht so robust sind, wie es den Anschein hat. Zu öffentlichen Finanzen, siehe Fischer (2004) und Bodmer (2004); zu Wachstum, siehe Bodmer (2005). 4 Lutz und Votruba (2005) haben kürzlich vorgeschlagen, die Anzahl der Übereinstimmungen zwischen Abstimmungsresultaten und FDP-Parolen als Indikator für die Wirtschaftsverträglichkeit der direkten Demokratie zu verwenden. Grundproblem dieses Ansatzes ist das fehlende Gewicht, das einzelnen Abstimmungen beigemessen wird. Die Religionsartikel sind für das Wachstum ja nicht von derselben Bedeutung wie ein EWR-Beitritt oder die Liberalisierung des Strommarktes. 152 DEBATTE entscheide zu EWR-Beitritt und zur Strommarktliberalisierung. Der Einfluss der direkten Demokratie beschränkt sich aber nicht auf einzelne Volksentscheide, sondern wirkt sich auch über die Ausbildung und Funktionsweise der übrigen politischen Institutionen (wie Parlament und Regierung) aus. Dazu kommen noch die Vorauswirkungen von potenziellen Referenden, welche den politischen Prozess wesentlich mitbestimmen. 2 Zur Qualität der Entscheidungen in der direkten Demokratie Es wird oft davon ausgegangen, dass die direkte Demokratie zu Entscheidungen führt, die den Präferenzen der Wähler besser entsprechen als Entscheide von Parlamenten. Dies scheint auf der Hand zu liegen, haben die Stimmbürger dank ihrer Volksrechte doch mehr Einflussmöglichkeiten auf das Verhalten der gewählten Politiker. Formal lässt sich dies in einem Modell eines Politikers zeigen, der seine eigenen Interessen verfolgt, soweit dies seine Wiederwahlchancen nicht zu sehr beeinträchtigt.5 Wahlen finden nur alle vier Jahre statt, und während dieser Zeit kann ein Politiker auch Ziele verfolgen, die nicht im eigentlichen Interesse seiner Wähler liegen. Gründe dafür sind - abgesehen von einem kurzen Gedächtnis der Wähler - Schwierigkeiten, das Verhalten von Politikern genau zu verfolgen und die Auswirkungen des Verhaltens der Politiker richtig einzuschätzen. Auch wenn dieses Principal-Agent-Argument akzeptiert wird, folgt daraus allerdings noch nicht, dass die Gesamtheit der Entscheidungen in der direkten Demokratie näher an den Präferenzen der Stimmbürger liegt.6 Was nämlich oft übersehen wird, ist die Unmöglichkeit, individuelle Präferenzen in fairer und konsistenter Weise zu sozialen Präferenzen zu aggregieren. Dieses Problem ist unter dem Namen Condorcet-Paradox bekannt und wurde von Arrow (1963) und einer Reihe von weiteren Ökonomen formal bewiesen. Die Konsequenzen dieser Unmöglichkeit sind tiefgreifend, können doch Volksentscheide nicht mehr einfach mit dem ”Volkswillen” gleichgesetzt werden.7 In der Praxis heisst dies unter anderem, dass die Reihenfolge von Abstimmungen oder andere taktische Anordnungen einen Einfluss auf das Resultat haben können. Ein weiteres Problem ist die Grundrichtung der Entscheide. Es wurde schon oft moniert, dass die Abstimmenden den Status-Quo befürworten.8 Es sei hier 5 Zu entsprechenden Modellen des Politikerverhaltens siehe Dixit (1996) oder Persson und Tabellini (2002). Ein Modell unter Einbezug der direkten Demokratie wird von Besley und Coate (2001) präsentiert. 6 So setzt das Principal-Agent-Argument z.B. informierte Wähler voraus. 7 Riker (1982) hat als erster auf die Bedeutung dieses Resultates für die Einschätzung der direkten Demokratie hingewiesen, siehe auch Haskell (2002). 8 So z.B. Borner et al. (1990). WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 153 an die vielen Anläufe zur Einführung des Frauenstimmrechts, der AHV oder der Sommerzeit erinnert. Es gibt eine grosse Anzahl von Gründen, warum der Status-Quo bevorzugt wird. Erstens sind im schweizerischen politischen System viele Sicherungen eingebaut.9 Dazu gehören doppeltes Mehr, Zwei-Kammersystem und die Volksrechte selber. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Beschluss an einer dieser Hürden scheitert. Zweitens dürfte der Medianwähler in der Schweiz konservativ eingestellt sein, eine Tendenz, welche durch das steigende Durchschnittsalter noch verstärkt werden wird. Das Festhalten am Bisherigen muss nicht automatisch negativ sein. Es dürfte beispielsweise für den langsamen Ausbau des Wohlfahrtsstaates und die lange Zeit tiefe schweizerische Staatsquote mitverantwortlich sein. Der Status-QuoBias hat aber dann negative Auswirkungen, wenn komplexe Probleme einer dringenden Lösung harren. In diesem Fall kann das Festhalten am Bisherigen fatale Auswirkungen haben. Wir sind der Meinung, dass sich die Schweiz im Moment in seiner solchen Situation befindet. Probleme bei der Überregulierung des internen Marktes, bei den Sozialversicherungen und im Gesundheitssystem harren einer Lösung. Solche tief greifende Reformen werden weiter durch die Unmöglichkeit erschwert, in der direkten Demokratie Reformpakete zusammenzustellen. Da in der Regel über einzelne Gesetze und Verfassungsvorlagen getrennt abgestimmt wird, können solche Pakete nämlich im letzten Moment wieder aufgelöst werden. 3 Institutionen und Governance Beurteilt man die Staatsformen nach den gegensätzlichen Kriterien ”Regierbarkeit” und ”Partizipation”, so weist das schweizerische System sehr viel Partizipation, aber eine begrenzte Regierbarkeit auf.10 Dies ist sicherlich gewollt und dürfte den Präferenzen einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger entsprechen. Die Konsequenz davon ist aber eine begrenzte Regierbarkeit. Es sollte dies eigentlich niemanden wundern, stellt es doch den Preis der hohen Partizipation dar. Drei Aspekte der tiefen Regierbarkeit, nämlich die Möglichkeit inkonsistenter Entscheide, den Status-Quo-Bias und die Schwierigkeit Reformpakete zusammenzustellen, haben wir bereits besprochen. Es bestehen im schweizerischen politischen System aber noch andere Governance-Probleme. Zu nennen ist hier vor allem die sehr eigentümliche Organisation der Regierung. Der Bundesrat besteht ja bekanntlich aus sieben gleichberechtigten Mitgliedern aus vier verschiedenen Parteien, welche sich Siehe dazu Moser (1996). Zu diesem gegensätzlichen Paar, siehe z.B. Sartori (1987), March und Olson (1995) oder Papadopoulos (1997). Für die Schweiz haben Neidhart (1970b), Germann (1994) und Wittmann (1979) früh auf die Mängel bei der Regierbarkeit hingewiesen. 9 10 154 DEBATTE nie auf ein Regierungsprogramm einigen. Die Konkordanz garantiert zwar eine breite Partizipation der wichtigsten Parteien und verschiedener Bevölkerungsgruppen. Dies geht aber wieder auf Kosten der Kohärenz und der Regierbarkeit.11 Ähnliches ist zum Milizsystem des Parlamentes zu sagen. Dieses hat kaum eigene Ressourcen, und die Teilzeitpolitiker sind von Informationen aus der Verwaltung oder aus den Verbänden abhängig. Gleiches gilt im übrigen für die Parteien. Die schwache Stellung der Regierung und des Parlaments sind wiederum unmittelbare Konsequenzen der direkten Demokratie.12 Die Lücke, welche durch die schwache Stellung von Regierung und Parlament entsteht, wird durch die starke Stellung des Volkes nur teilweise gefüllt. Ein zentraler Gewinner ist die Verwaltung, bei der alle Fäden zusammenlaufen und die auch gegenüber den eigenen Bundesräten eine sehr starke Stellung hat. Ein weiterer Gewinner sind die organisierten Interessen, welche über das Vernehmlassungsverfahren einen institutionalisierten Einfluss auf die Entscheidfindung haben. Angesichts der komplizierten Entscheidungswege und eines insgesamt wenig transparenten Entscheidungssystems überrascht es deshalb trotz sehr viel direkter Demokratie nicht, wenn viele Bürgerinnen und Bürger der Ansicht sind, Entscheide würden in Berner Hinterzimmern ausgehandelt oder von der Verwaltung bestimmt. 4 Einige abschliessende Bemerkungen zu den nötigen politische Reformen Angesichts der bereits sehr grossen Bedeutung des Kriteriums Partizipation überrascht es dann doch, wenn viele Reformvorschläge darauf hinauslaufen, einseitig nur die Partizipation weiter auszubauen.13 Aus unserer Sicht sollte es vielmehr darum gehen, die Regierbarkeit wieder zu verbessern.14 Angesichts des Misstrauens, welche die ”Classe Politique” beim Volk hervorruft, haben Reformen, welche auf einen Abbau der direkten Demokratie zielen, aber wohl keine Chance. Eine reine Regierungsreform, wie die Einführung von Staatssekretären, 11 Es besteht zwar internationale Evidenz, dass konsensorientierte Systeme besser oder zumindest nicht schlechter als konkurrrenzorientierte Systeme abschneiden (z.B. Lijphart 1999). Da die Schweiz bei der Konsensorientierung wiederum einen Extremfall darstellt, halten wir diese Evidenz im konkreten Fall für nicht ausreichend. Es ist mit anderen Worten ohne weiteres möglich, dass die Schweiz weit jenseits des diesbezüglichen Optimums liegt. 12 Die klassische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Referendum und Konkordanz stammt von Neidhart (1970a), siehe auch Vatter (1997). Das Volk hat zudem wiederholt eine Reform des Milizsystems wie auch Regierungsreformen abgelehnt, welche die Arbeitslast der Bundesräte etwas mindern würden. Siehe dazu die Übersicht in Klöti (2004). 13 So der Vorschlag für eine Verfassungsreform von Müller und Kölz (1990). 14 In diese Richtung gehen auch Neidhart (1970b) und Germann (1994). WIRTSCHAFT UND POLITIK IN DER SCHWEIZ 155 ist nicht nur unpopulär, sondern dürfte auch kaum ausreichend sein. Wir halten deshalb die Abkehr von der Konkordanz für die vielversprechendste Möglichkeit, wieder mehr Kohärenz ins schweizerische politische System zu bringen. Dies könnte über eine Abkehr der Parteien resp. des Parlamentes von der Konkordanz erfolgen.15 Oder es könnte die Volkswahl des Bundesrates eingeführt werden, allerdings über die Wahl eines Präsidenten und allenfalls Vizepräsidenten oder über die Wahl einer Liste. Wahlen für einzelne Sitze, wie sie in den Kantonen üblich sind, würden das Problem der fehlenden Kohärenz und Regierbarkeit dagegen nicht lösen. Bibliographie Arrow, Kenneth (1963). Social Choice and Individual Values. 2nd edition. New York: Wiley. Besley, Timothy and Stephen Coate (2001). ”Issue Unbundling via Citizen’s Initiatives”. CEPR Discussion Paper No. 2857. London: CEPR. Bodmer, Frank (2005). Bestimmungsgründe des kantonalen Wirtschaftswachstums. Manuskript. Universität Basel. Bodmer, Frank (2004). ”Warum die direkte Demokratie den Anstieg der Staatsquote in der Schweiz nicht verhindern konnte”, in Frank Bodmer und Silvio Borner (Hsg.). Wohlstand ohne Wachstum - Die Hintergrundberichte. WWZ Forschungsberichte 04/06. Universität Basel. Borner, Silvio und Frank Bodmer (2004). Wohlstand ohne Wachstum – Eine Schweizerische Illusion. Zürich: Orell Füssli. Borner, Silvio, Aymo Brunetti und Thomas Straubhaar (1990). Schweiz AG: Vom Sonderfall zum Sanierungsfall? Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung. Dixit, Avinash (1996). The Making of Economic Policy. CESifo Lecture Series. Cambridge Mass: MIT Press. Feld, Lars P. and Bruno S. Frey (2001). ”Trust breeds Trust: How Taxpayers are Treated”, Economics of Governance 2: 87-99. Feld, Lars P. and Gebhard Kirchgässner (2001). ”The political economy of direct legislation: direct democracy and local decision-making”, Economic Policy 16(33): 331-367. Feld, Lars P. and Marcel R. Savioz (1997). ”Direct Democracy Matters for Economic Performance”, Kyklos 50(4): 507-538. Fischer, Roland (2004). Die Unterschiede in der Steuerbelastung der Kantone. mimeo. Bern: Eidg. Finanzverwaltung. Eine solche Änderung wird von Politologen nicht durchwegs negativ beurteilt, wie der kürzliche Beitrag von Sciarini (2004) zeigt. Damit ist natürlich nicht die gegenwärtige Infragestellung des Kollegialitätsprinzips durch die SVP und ihren Bundesrat Blocher gemeint, welche die Kohärenz der Regierung noch weiter reduziert. 15 156 DEBATTE Freitag, Markus und Adrian Vatter (2000). ”Direkte Demokratie, Konkordanz und Wirtschaftsleistung. Ein empirischer Vergleich der Schweizer Kantone”, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 136(4): 578-605. Germann, Raimund (1994). Staatsreform: Der Übergang zur Konkurrenzdemokratie. Bern: Verlag Paul Haupt. Haskell, John (2002). Direct Democracy or Representative Government? Dispelling the Populist Myth. Boulder: Westview Press. Kirchgässner, Gebhard, Lars P. Feld und Marcel R. Savioz (1999). Die Direkte Demokratie. Modern, Erfolgreich, Entwicklungs- und Exportfähig. Basel: Helbing & Lichtenhahn. Klöti, Ulrich (2004). ”The Government”, in Ulrich Klöti, Peter Knoepfel, Hanspeter Kriesi, Wolf Linder and Yannis Papadopoulos (eds.). Handbook of Swiss Politics. Zürich: NZZ Publishing. Lijphart, Arend (1999). Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press. Lutz, Georg und Thomas Votruba (2005). ”Ist der Souverän wirtschaftsfeindlich? Direkte Demokratie taugt nicht als Sündenbock”, Neue Zürcher Zeitung 226 (2): 25. March, James G. and Johan P. Olson (1995). Democratic Governance. New York: The Free Press. Moser, Peter (1996). ”Why is Swiss Politics so Stable?”, Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik 132(1): 31-61. Müller, Jörg Paul und Alfred Kölz (1990). Entwurf für eine neue Bundesverfassung vom 16.Mai 1984. Basel: Helbing und Lichtenhahn. Neidhart, Leonhard (1970a). Plebiszit und Pluralitäre Demokratie. Eine Analyse der Funktion des schweizerischen Gesetzesreferendums. Bern: Francke Verlag. Neidhart, Leonhard (1970b). Die Reform des Bundesstaates. Bern: Francke Verlag. Papadopoulos, Yannis (1998). Démocratie Directe. Paris: Economica. Persson, Torsten and Guido Tabellini (2002). Political Economics. Explaining Economic Policy. Cambridge Mass: MIT Press. Riker, William (1982). Liberalism against Populism. San Francisco: W.H. Freeman. Sartori, Giovanni (1987). The Theory of Democracy Revisited. Chatham: Chatham House Publishers. Sciarini, Pascal (2004). ”Für eine reduzierte Drei-Parteien-Konkordanz”, Neue Zürcher Zeitung (225)293. Stutzer, Alois and Bruno S. Frey (2000). ”Stärkere Volksrechte - Zufriedenere Bürger: eine mikroökonometrische Untersuchung für die Schweiz”, Swiss Political Science Review 6(3): 1-30. Vatter, Adrian (1997). Die Wechselbeziehungen zwischen Konkordanz- und Direktdemokratie, Politische Vierteljahresschrift 38(4): 743-770. Wittmann, Walter (1979). Wohin treibt die Schweiz? Bern: Schwerz Verlag.