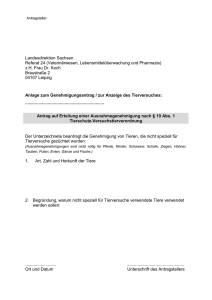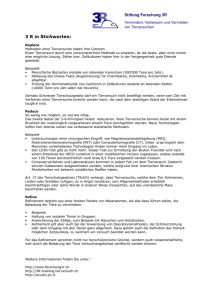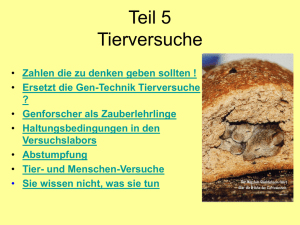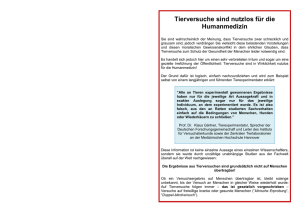Hier warten Mäuse und Ratten aufs Experiment
Werbung

Tierversuche Ein notwendiges Übel? Klar ist: Ohne sie geht heute in der Forschung wenig «Man macht es sich zu einfach» In Alternativen zu Tierversuchen wird heute noch zu wenig investiert, kritisiert Tierschützerin Claudia Mertens. VON SOPHIE RÜESCH Hier warten Mäuse und Ratten aufs Experiment Frau Mertens, braucht es Tierversuche? Claudia Mertens*: Mit Ja oder Nein lässt sich diese Frage nicht beantworten. Klar ist aber: Von den vielen Tierversuchen, die heute stattfinden, ist ein ganz grosser Teil infrage zu stellen. Auf der biomedizinischen Front wird geforscht wie wild, mit höchst fragwürdigen Versuchen. Es gibt aber auch Bereiche, in denen man Tierversuche, zumindest basierend auf der heutigen gesetzlichen Grundlage, nicht ablehnen kann. In Schlieren werden vor allem Nagertiere gehalten. Damit keine eingeschleppten Erreger die Tiere verunreinigen, gelten strenge Hygienevorschriften. Da schwingt Skepsis mit. Meinen Sie: Aus ethischen Gründen schon? Aus ethischen wie auch wissenschaftlichen Gründen, ja. Schauen wir nur mal die Labortierhaltung an und lassen Versuche an sich noch vorneweg: Die ist oft alles andere als tierschutzkonform. Jedoch nicht aus gesetzlicher, sondern aus Sicht des Tiers. Ist es für Sie vertretbar, Menschenüber Tierwohl zu stellen? Der gesellschaftliche Konsens, dass man die Würde des Tieres im Namen höherer Interessen verletzen darf, ist sicher infrage zu stellen. Ich respektie- In Schlieren leben fast so viele Labortiere wie Menschen, seit die Universität Zürich auf dem Wagi-Areal forscht. VON SOPHIE RÜESCH (TEXT UND FOTOS) G regor Fischer hebt eine Maus aus ihrem Käfig und setzt sie auf seine Handfläche. Das Tierchen kraxelt auf dem Plastikhandschuh hinauf und hinunter, hält inne, schnuppert in der Luft herum. Die Maus weckt den Beschützerinstinkt, ob man nun will oder nicht. «Auch ich finde die Tiere herzig», sagt Gregor Fischer. Die Äusserung wäre weniger erstaunlich, wenn sie nicht aus dem Mund des Leiters des Laboratory Animal Services Center (LASC) der Universität Zürich käme — zu Deutsch: dem Chef des universitären Labortier-Dienstzentrums. Als solcher ist Fischer Herr über ein ganzes Heer von Labortieren, die seit vergangenem Jahr im Bio-Technopark in Schlieren gezüchtet und gehalten werden, um später in der biomedizinischen Forschung eingesetzt zu werden. 17 000 der rund 66 000 universitären Versuchstiere warten hier darauf, für die Forschung zu sterben. Platz hat es für weitere 20 000. Die Tiere, hauptsächlich Mäuse, sterben, vereinfacht gesagt, damit die Menschen länger und auch mit Erkrankungen besser leben können. Doch nicht nur Menschen, sondern auch andere Tiere, wie Fischer betont: Das Zentrum beliefert nicht nur Forschungsgruppen der Medizinischen und der Mathematischnaturwissenschaftlichen Fakultät mit Versuchstieren. Auch die Vetsuisse-Fakultät (also die tiermedizinische) ist auf der Verteilerliste. Das ganze Leben einer Labormaus Im «Maushaus» in Schlieren kann man fast den ganzen Lebenskreislauf einer Labormaus nachverfolgen. Während im Parterre alle zwei bis drei Tage neue Nager von externen Importeuren angeliefert werden, werden in den oberen Stockwerken auch neue Tiere gezüchtet. Diese werden nach 21 Tagen von der Mutter getrennt; «abgesetzt» heisst das im Fachjargon. Dann wird entschieden, ob die Jungtiere für die Forschung geeignet sind oder nur für die Fortpflanzung — oder ob sie eingeschläfert werden. Die meisten der Tiere verlassen den Neubau auf dem Wagi-Areal jedoch le- 21 LIMMATTAL LIMMATTALER ZEITUNG SAMSTAG, 11. APRIL 2015 bend: Erst wenn sie in den Uni-Labors im Gebäude vis-à-vis landen, oder in einem weiteren der rund um Zürich verstreuten Forschungsräume, wird an ihnen experimentiert. Experimentierräume gibt es zwar auch im LASC-Gebäude; es sind aber nur ein paar wenige. Dort können die LASC-Mitarbeiter für die Forscher zum Beispiel das Applizieren von Tumoren übernehmen, wenn das gewünscht ist. Dabei werden der Maus oder der Ratte Krebszellen unter die Haut gespritzt. Die Krebsforschung ist denn auch einer der Schwerpunkte, welche die Universität Zürich in der angewandten Forschung setzt. Andere sind in der Alzheimer- oder in der Multiple-Sklerose-Forschung zu finden. Rund zwei Drittel der Tierversuche gehen aber auf das Konto der Grundlagenforschung. Dort ist die ethische Güterabwägung besonders schwierig: Die Forscher müssen dafür belegen können, dass die Belastung der Tiere durch den zu erwartenden Erkenntnisgewinn legitimiert wird. Vor dem Versuch, gibt Fischer zu bedenken, sei es aber gerade dort sehr schwierig abzuschätzen, welche Resultate daraus hervorgehen würden. So ist es vor allem der Anstieg der Gesuche für die Grundlagenforschung, der Tierschützern ein Dorn im Auge ist. «Klar», sagt Fischer, «die Grundlagenforschung liefert keine schnellen und direkten Resultate. Sie führt aber zu Erkenntnissen, welche die angewandte Forschung überhaupt erst ermöglichen.» Leise Musik soll Tiere beruhigen Der Tag einer Labormaus im WagiAreal beginnt um 6 Uhr; bis dann wird das Licht in den fensterlosen Räumen langsam hochgedimmt. Zwölf Stunden später geht die künstliche Sonne wieder unter. Im Hintergrund spielt Musik. Für das menschliche Ohr ist sie kaum hörbar, doch auf die Tiere soll sie beruhigend wirken. Die Nager leben unter Artgenossen – genug vielen, damit sie ihr Sozialverhalten ausleben können, genug wenigen, damit es nicht zu eng wird im schuhschachtelgrossen Käfig. Bei Mäusen heisst das in der Regel: 3 bis 5, bei Ratten: je nach Gewicht 2 bis 3 Tiere pro Käfig. Einzelhaltung ist nur unter speziellen Bedingungen erlaubt, etwa wenn ein Tier aggressiv ist und die Mitbewohner verletzen könnte. «Natürlich ist das nicht der natürliche Lebensraum einer Maus», räumt Fischer ein, nachdem er diese Haltungsgrundsätze erklärt hat. Und: Natürlich gebe es Zuchten, zum Beispiel solche, denen ein aggressiver Tumor eingesetzt wurde, die stark leiden. «Obwohl wir jede Massnahme treffen, um es zu lindern: Das Leiden müssen wir mangels Alternativen in Kauf nehmen», sagt er. Wie fest dieses Leiden bei den einzelnen Tieren ausgeprägt ist, wird in regelmässigen Abständen kontrolliert und protokolliert. Das schreibt das Gesetz vor; die erhobenen Daten fliessen danach, eingeteilt in BelastungsSchweregrade von 0 bis 3, in die Tierversuchsstatistik des Bundes ein. Leidet ein Tier stark, wird abgeklärt, ob es eingeschläfert werden soll. Dann kommt die Maus in einen luftdichten Behälter, in den langsam Kohlendioxid strömt – «damit sie nicht erstickt, sondern langsam einschläft». Andere Tiere sterben erst auf dem Operationstisch, «natürlich unter Narkose». Gewisse Wildtypen – niemals transgene, also genetisch veränderte Tiere – gibt das LASC auch an Zoos oder die Vogelwarte zur Verfütterung weiter. Wie die Mäuse da so in ihrem Streu herumwuseln, sich unter einer Eierschachtel verstecken und sich an der Plexiglaswand recken, scheint dieses Schicksal noch weit weg. re die derzeit gültigen Normen. Diese verlangen aber in jedem einzelnen Fall eine sorgfältige Güterabwägung. Das heisst: Das Versuchsziel muss relevant und erreichbar sein, Alternativen müssen nachweislich fehlen. Nur dann sind Tierversuche vertretbar. Das steht aber ja heute schon im Gesetz. Ja, aber es wird nicht sauber umgesetzt. Das Problem ist: Die Forscher müssen diese Güterabwägung im Rahmen des Bewilligungsverfahrens selbst vornehmen. Sie sind dabei natürlich stark befangen. Das Forschungsziel steht für sie über allem. Und die Bewilligungsorgane teilen diese Sicht meistens. Ich gebe zu: Die Prüfung dieser Gesuche ist alles andere als einfach. Aber man macht es sich heute auch viel zu einfach. Um das Tierleid tief zu halten, hat sich die Forschung aber doch dem sogenannten 3-R-Grundsatz («replace, reduce, refine») verschrieben. Greift diese Strategie nicht? Doch, bis zu einem gewissen Punkt schon. Vor allem in der akademischen Forschung wird das Prinzip aber, obwohl es ständig beschworen wird, noch viel zu wenig angewendet. Zudem wird es viel zu oft zum Vorteil des Forschenden und nicht des Tiers ausgelegt: Beim Gebot «Refine» etwa wird häufig die wissenschaftliche Verbesserung des Versuchs und nicht die Schonung des Tiers geltend gemacht. Gemeint wäre aber Letzteres. Gregor Fischer ist Herr über 17 000 Labortiere. ZVG 3R Irritierende Doppelmoral UZH-STANDORT SCHLIEREN ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Eine Zwischenlösung Die Universität Zürich bezog im Herbst 2013 ihren neuen Standort für Life Sciences im Bio-Technopark in Schlieren, um die zunehmende Platznot an den universitären Forschungsstandorten zu entschärfen. Auf drei angemieteten Stockwerken werden hier seit Juli 2014 auch Labortiere gezüchtet und gehalten. Schlieren ist für die UZH aber keine langfristige Lösung. Auch für das Laboratory Animal Services Center ist es nur Zwischenstation: Letztes Jahr erst gebaut, soll das Gebäude in 10 bis 15 Jahren bereits wieder verlassen werden. Danach soll die Labortierhaltung in einem eigenen Bau am Irchel zentral angesiedelt werden. Spruchreif ist dieses Projekt noch nicht. Seit drei Jahren ist es in Planung, Gespräche mit dem Kanton laufen. Für nichts soll das Gebäude in Schlieren aber dennoch nicht errichtet worden sein: Im obersten Stock ist ein Pharmakonzern eingemietet; so könnte sich die Möglichkeit einer Nachmiete ergeben, sind die Räume doch spezifisch für die Forschung mittels Tierversuchen ausgebaut worden. Als Verantwortlicher für den Labortierbereich ist es sich Fischer gewohnt, stets aus der Defensive heraus zu argumentieren. Ganz im Sinne der 2010 — unter anderem vom heutigen Uni-Rektor Michael Hengartner — ins Leben gerufenen «Basler Deklaration» erachtet er es aber als wichtig, eben das zu tun: zu argumentieren. «Wir müssen proaktiver werden», sagt Fischer. Mehr Transparenz: Das könne für mehr Verständnis in der Öffentlichkeit sorgen, hofft er. Auf deren Gunst sind die Hochschulforscher auch angewiesen, immerhin fliessen jährlich Millionen an Bundesgeldern in die Finanzierung von Tierversuchsprojekten. 118 Millionen Franken waren es gemäss dem Schweizerischen Nationalfonds im Jahr 2013. Dabei sei aber zu bedenken, dass auch Millionen in die Forschung mit bereits entwickelten Alternativmethoden fliesse; dies würden die steht für: ■ ■ ■ «Reduce» (Reduzieren): Die Zahl der verwendeten Tiere soll möglichst tief gehalten werden; «Refine» (Verbessern): Forschungsmethoden sollen stetig weiterentwickelt werden mit dem Ziel, dass Tiere beim Versuch möglichst wenig belastet werden; «Replace» (Ersetzen): Tierversuche sollen wenn möglich durch eine Alternativmethode ersetzt werden. Also finden Sie, dass es beim Lippenbekenntnis bleibt? Ein Stück weit, ja. Man muss auch sehen: Nur eines der drei R-Prinzipien – das «Replace» – betrifft den kompletten Ersatz des Versuchstiers, was unser eigentliches Ziel ist. In den letzten 20 Jahren wurde in der Forschung nach Alternativen zwar viel erreicht. Wir glauben aber, dass noch viel mehr möglich ist. Dafür braucht es Dreierlei: wissenschaftlichen Fortschritt, Geld für die Forschung nach Alternativen und vor allem ein Umdenken. Gäbe es denn heute schon gleichwertige Alternativen zu Tierversuchen? Ja, und zwar nicht wenige. Doch das Tiermodell ist noch derart in den Köpfen zementiert, dass Alternativen gar nicht in Betracht gezogen werden. Auch alternative Methoden müssen erst mal entwickelt werden. Wird dafür genug Geld investiert? Nein, definitiv nicht. 100 bis 200 Millionen Franken — nur schon an staatlichen Geldern — fliessen jährlich in die akademische biomedizinische Forschung. Vergleicht man das mit den 500 000 Franken für die Stiftung «Forschung 3R», sieht man, wo die Prioritäten gesetzt werden. Tierschützer bemängeln auch, dass Erkenntnisse aus Tierversuchen – selbst die vielversprechendsten – gar nicht auf Menschen übertragbar sind. Tierschützer gerne mal unterschlagen, wenn sie Forschungsbeiträge gegeneinander ausspielen, so Fischer. Was ihn «wirklich irritiert», ist die Doppelmoral, die in Diskussionen über Tierversuche häufig im Spiel ist: Man wolle zwar sich selbst und seine Liebsten stets auf dem höchsten medizinischen Niveau versorgt wissen, empöre sich dann aber über die Forschung, die dafür nötig sei. «Ich kenne niemanden, der dann auf ein Medikament verzichten würde, wenn er selbst betroffen ist», sagt er. «Und das ist einfach nicht konsequent.» Auch missverstanden fühlen sich Fischer und die Forscher. Ihr Ziel seien ja nicht die Versuche, sondern die Resultate – welche die Gesellschaft auch von ihnen verlange. Überhaupt: Tierversuche seien nicht nur aus tierschützerischen Überlegungen, sondern auch aus finanziellen nie die erste Wahl. «Kein vernünftiger Mensch würde die Versuche, die unglaublich teuer sind, durchführen, wenn es echte Alternativen gäbe.» Doch genau da liege das Problem: «Falsch» nennt er die Position der Tierschützer, dass Tierversuche für die meisten Forschungszwecke heute nicht mehr nötig seien. Wo es Alternativen gebe, werde auf die Versuche verzichtet, sagt Fischer, das sei auch im Bewilligungsprozess so vorgesehen. Für einzelne Fragestellungen seien Experimente an isolierten Zellen – sprich: toten Organismen – auch durchaus sinnvoll. «Doch sobald man komplexere Zusammenhänge testen will, ist die Arbeit an Reagenzglas und Computer eben keine echte Alternative.» Fischer verweist auf das sogenannte 3R-Prinzip (siehe Einschub), welches das LASC aktiv lebe. «Wir fragen uns ständig, was wir besser machen können», sagt er. Zu diesem Zweck entwickelte die Universität bereits die Software «iRats». Das umfangreiche Tierverwaltungssystem erlaubt ihnen einerseits, den Überblick über sämtliche Versuchstiere zu behalten. Andererseits könnten damit «Synergien zwischen verschiedenen Forschungsteams genutzt werden», was einen möglichst sparsamen Umgang mit den Tieren gewährleisten soll. Zudem diene das ganze neue Gebäude in Schlieren dem Zweck, die Uni in Sachen Tierversuche nicht nur fachlich, sondern Eine gewisse Übertragbarkeit ist natürlich schon gegeben. Doch sie ist limitiert und wird in der heutigen Forschung massiv überschätzt. In vielen Forschungsbereichen wäre Tier wie auch Mensch sehr damit geholfen, wenn man auf humanes Zellmaterial zurückgreifen würde. In Bern lancierten Tierschützer gerade ein Referendum gegen einen Laborneubau. Auch am Irchel soll langfristig mehr Platz für die Tierhaltung geschaffen werden. Wird der Zürcher Tierschutz hier aktiv? Das ist offen. Klar ist: Solche Pläne zeigen, dass die Tierversuchsbranche nicht daran ist, sich zu verkleinern, im Gegenteil. Das behagt uns natürlich nicht. Bei solch hochpolitischen Entscheiden wie der Erweiterung am Irchel hat ein Tierschutzverein aber nur beschränkte Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Im Moment nutzen wir die Möglichkeit, über den Einsitz in der kantonalen Tierversuchskommission möglichst viel Tierschutz in den Vollzug einzubringen. *Claudia Mertens ist diplomierte Biologin, Tierversuchsexpertin beim Verein Zürcher Tierschutz und Präsidentin der Stiftung Animalfree Research. Zudem hatte sie 13 Jahre lang Einsitz in der kantonalen Tierversuchskommission. möglichst auch in Bezug auf den Tierschutz an die Spitze zu bringen, so Fischer. So hält und züchtet das LASC nicht nur, sondern bildet auch Forscher und Pfleger im Umgang mit den Labortieren aus. Zudem überwacht es die Umsetzung der gesetzlichen Auflagen und internen Regeln. Hygienevorschriften sind streng Fischer sagt zwar, er wünschte sich, dass der Gesetzgeber weniger pauschale Auflagen für die Haltung erlassen würde. Denn in der Praxis diene längst nicht jede dieser Vorschriften, wie zum Beispiel die erhöhte Kontrollfrequenz, auch tatsächlich dem Tierwohl. Andere Auflagen hingegen setzt sich die Universität gemäss internem Leitfaden selbst — und zwar strengere als diejenige, die ihr der Gesetzgeber vorschreibt. So wäre es heute etwa legal, «deutlich mehr Tiere» in einem Käfig unterzubringen. Auch hat die Universität Zürich, schon lange bevor der Gesetzgeber dies vorschrieb, den Tieren Nest- und Spielmaterial in den Käfigen bereitgestellt. «Forschung auf hohem Niveau impliziert auch Tierschutz auf hohem Niveau», sagt Fischer. «Wir wollen im Sinne des Tierschutzes deshalb bewusst eine Vorreiterrolle einnehmen.» Dieser Anspruch äussert sich im neuen Gebäude auch in den allgegenwärtigen und strengen Hygienevorschriften. In den sterilen Teil der Anlage kommt niemand, der nicht Ganzkörperanzug, Gummihandschuhe und Mundschutz trägt. Gegenstände müssen desinfiziert werden und am Schluss, da muss alles zusammen noch durch die Luftdusche, die einem den Atem verschlägt, dafür aber auch verbleibende Keime wegfegt. «Hygiene hat sehr viel mit Tierschutz zu tun», sagt Fischer. Denn wird eine Maus, die in aufwendigen Verfahren auf einen bestimmten Forschungszweck hingezüchtet wurde, von einem Erreger infiziert, ist sie für die Forscher in der Regel nicht mehr einsetzbar. «Und in diesem Fall – wenn keine verwertbaren Resultate zu erwarten sind – wäre der Gebrauch der Tiere aus meiner Sicht ethisch nicht mehr vertretbar.» Weitere Bilder finden Sie auf www.limmattalerzeitung.ch