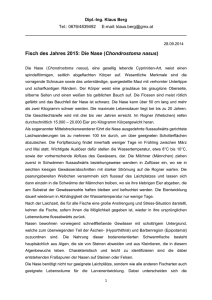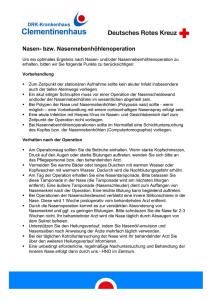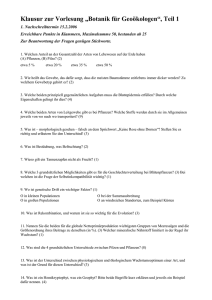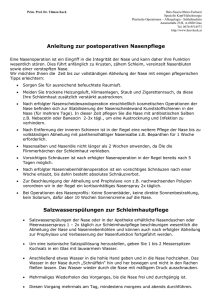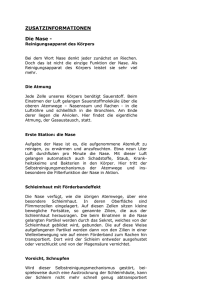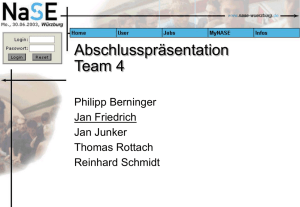Der genetischen Vielfalt der Nase auf der Spur
Werbung
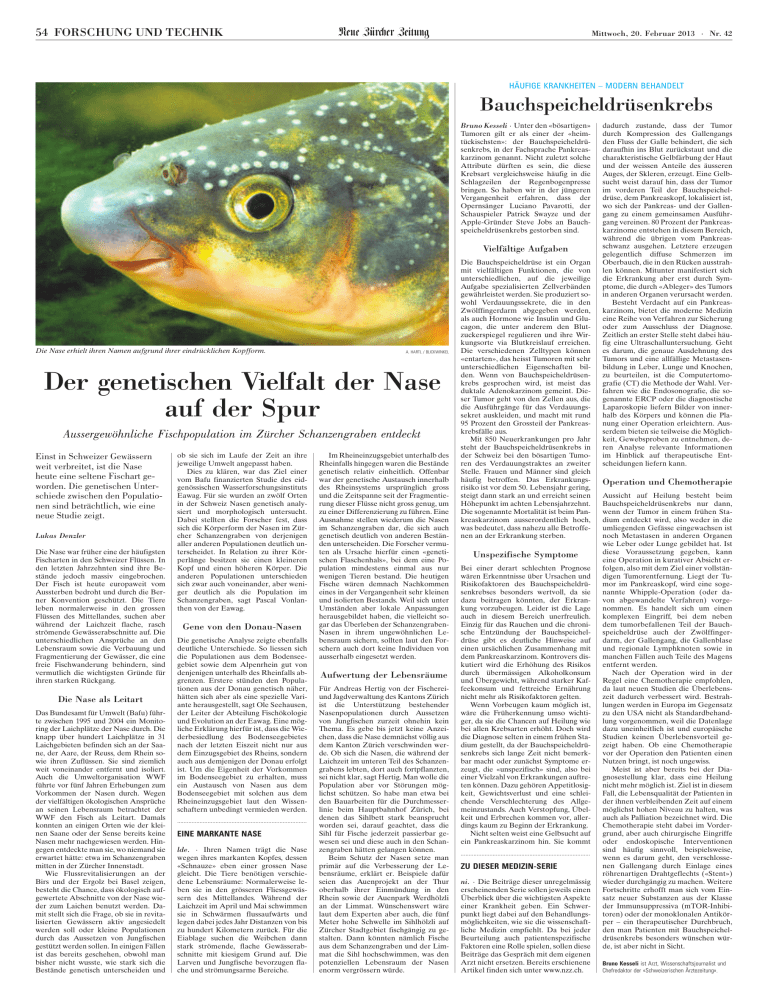
54 FORSCHUNG UND TECHNIK Neuö Zürcör Zäitung Mittwoch, 20. Februar 2013 ^ Nr. 42 HÄUFIGE KRANKHEITEN – MODERN BEHANDELT Bauchspeicheldrüsenkrebs Bruno Kesseli ^ Unter den «bösartigen» Tumoren gilt er als einer der «heimtückischsten»: der Bauchspeicheldrüsenkrebs, in der Fachsprache Pankreaskarzinom genannt. Nicht zuletzt solche Attribute dürften es sein, die diese Krebsart vergleichsweise häufig in die Schlagzeilen der Regenbogenpresse bringen. So haben wir in der jüngeren Vergangenheit erfahren, dass der Opernsänger Luciano Pavarotti, der Schauspieler Patrick Swayze und der Apple-Gründer Steve Jobs an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben sind. Vielfältige Aufgaben Die Nase erhielt ihren Namen aufgrund ihrer eindrücklichen Kopfform. A. HARTL / BLICKWINKEL Der genetischen Vielfalt der Nase auf der Spur Aussergewöhnliche Fischpopulation im Zürcher Schanzengraben entdeckt Einst in Schweizer Gewässern weit verbreitet, ist die Nase heute eine seltene Fischart geworden. Die genetischen Unterschiede zwischen den Populationen sind beträchtlich, wie eine neue Studie zeigt. Lukas Denzler Die Nase war früher eine der häufigsten Fischarten in den Schweizer Flüssen. In den letzten Jahrzehnten sind ihre Bestände jedoch massiv eingebrochen. Der Fisch ist heute europaweit vom Aussterben bedroht und durch die Berner Konvention geschützt. Die Tiere leben normalerweise in den grossen Flüssen des Mittellandes, suchen aber während der Laichzeit flache, rasch strömende Gewässerabschnitte auf. Die unterschiedlichen Ansprüche an den Lebensraum sowie die Verbauung und Fragmentierung der Gewässer, die eine freie Fischwanderung behindern, sind vermutlich die wichtigsten Gründe für ihren starken Rückgang. Die Nase als Leitart Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) führte zwischen 1995 und 2004 ein Monitoring der Laichplätze der Nase durch. Die knapp über hundert Laichplätze in 31 Laichgebieten befinden sich an der Saane, der Aare, der Reuss, dem Rhein sowie ihren Zuflüssen. Sie sind ziemlich weit voneinander entfernt und isoliert. Auch die Umweltorganisation WWF führte vor fünf Jahren Erhebungen zum Vorkommen der Nasen durch. Wegen der vielfältigen ökologischen Ansprüche an seinen Lebensraum betrachtet der WWF den Fisch als Leitart. Damals konnten an einigen Orten wie der kleinen Saane oder der Sense bereits keine Nasen mehr nachgewiesen werden. Hingegen entdeckte man sie, wo niemand sie erwartet hätte: etwa im Schanzengraben mitten in der Zürcher Innenstadt. Wie Flussrevitalisierungen an der Birs und der Ergolz bei Basel zeigen, besteht die Chance, dass ökologisch aufgewertete Abschnitte von der Nase wieder zum Laichen benutzt werden. Damit stellt sich die Frage, ob sie in revitalisierten Gewässern aktiv angesiedelt werden soll oder kleine Populationen durch das Aussetzen von Jungfischen gestützt werden sollen. In einigen Fällen ist das bereits geschehen, obwohl man bisher nicht wusste, wie stark sich die Bestände genetisch unterscheiden und ob sie sich im Laufe der Zeit an ihre jeweilige Umwelt angepasst haben. Dies zu klären, war das Ziel einer vom Bafu finanzierten Studie des eidgenössischen Wasserforschungsinstituts Eawag. Für sie wurden an zwölf Orten in der Schweiz Nasen genetisch analysiert und morphologisch untersucht. Dabei stellten die Forscher fest, dass sich die Körperform der Nasen im Zürcher Schanzengraben von derjenigen aller anderen Populationen deutlich unterscheidet. In Relation zu ihrer Körperlänge besitzen sie einen kleineren Kopf und einen höheren Körper. Die anderen Populationen unterschieden sich zwar auch voneinander, aber weniger deutlich als die Population im Schanzengraben, sagt Pascal Vonlanthen von der Eawag. Gene von den Donau-Nasen Die genetische Analyse zeigte ebenfalls deutliche Unterschiede. So liessen sich die Populationen aus dem Bodenseegebiet sowie dem Alpenrhein gut von denjenigen unterhalb des Rheinfalls abgrenzen. Erstere stünden den Populationen aus der Donau genetisch näher, hätten sich aber als eine spezielle Variante herausgestellt, sagt Ole Seehausen, der Leiter der Abteilung Fischökologie und Evolution an der Eawag. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass die Wiederbesiedlung des Bodenseegebietes nach der letzten Eiszeit nicht nur aus dem Einzugsgebiet des Rheins, sondern auch aus demjenigen der Donau erfolgt ist. Um die Eigenheit der Vorkommen im Bodenseegebiet zu erhalten, muss ein Austausch von Nasen aus dem Bodenseegebiet mit solchen aus dem Rheineinzugsgebiet laut den Wissenschaftern unbedingt vermieden werden. ................................................................................. EINE MARKANTE NASE lde. ^ Ihren Namen trägt die Nase wegen ihres markanten Kopfes, dessen «Schnauze» eben einer grossen Nase gleicht. Die Tiere benötigen verschiedene Lebensräume: Normalerweise leben sie in den grösseren Fliessgewässern des Mittellandes. Während der Laichzeit im April und Mai schwimmen sie in Schwärmen flussaufwärts und legen dabei jedes Jahr Distanzen von bis zu hundert Kilometern zurück. Für die Eiablage suchen die Weibchen dann stark strömende, flache Gewässerabschnitte mit kiesigem Grund auf. Die Larven und Jungfische bevorzugen flache und strömungsarme Bereiche. Im Rheineinzugsgebiet unterhalb des Rheinfalls hingegen waren die Bestände genetisch relativ einheitlich. Offenbar war der genetische Austausch innerhalb des Rheinsystems ursprünglich gross und die Zeitspanne seit der Fragmentierung dieser Flüsse nicht gross genug, um zu einer Differenzierung zu führen. Eine Ausnahme stellen wiederum die Nasen im Schanzengraben dar, die sich auch genetisch deutlich von anderen Beständen unterscheiden. Die Forscher vermuten als Ursache hierfür einen «genetischen Flaschenhals», bei dem eine Population mindestens einmal aus nur wenigen Tieren bestand. Die heutigen Fische wären demnach Nachkommen eines in der Vergangenheit sehr kleinen und isolierten Bestands. Weil sich unter Umständen aber lokale Anpassungen herausgebildet haben, die vielleicht sogar das Überleben der SchanzengrabenNasen in ihrem ungewöhnlichen Lebensraum sichern, sollten laut den Forschern auch dort keine Individuen von ausserhalb eingesetzt werden. Aufwertung der Lebensräume Für Andreas Hertig von der Fischereiund Jagdverwaltung des Kantons Zürich ist die Unterstützung bestehender Nasenpopulationen durch Aussetzen von Jungfischen zurzeit ohnehin kein Thema. Es gebe bis jetzt keine Anzeichen, dass die Nase demnächst völlig aus dem Kanton Zürich verschwinden werde. Ob sich die Nasen, die während der Laichzeit im unteren Teil des Schanzengrabens lebten, dort auch fortpflanzten, sei nicht klar, sagt Hertig. Man wolle die Population aber vor Störungen möglichst schützen. So habe man etwa bei den Bauarbeiten für die Durchmesserlinie beim Hauptbahnhof Zürich, bei denen das Sihlbett stark beansprucht worden sei, darauf geachtet, dass die Sihl für Fische jederzeit passierbar gewesen sei und diese auch in den Schanzengraben hätten gelangen können. Beim Schutz der Nasen setze man primär auf die Verbesserung der Lebensräume, erklärt er. Beispiele dafür seien das Auenprojekt an der Thur oberhalb ihrer Einmündung in den Rhein sowie der Auenpark Werdhölzli an der Limmat. Wünschenswert wäre laut dem Experten aber auch, die fünf Meter hohe Schwelle im Sihlhölzli auf Zürcher Stadtgebiet fischgängig zu gestalten. Dann könnten nämlich Fische aus dem Schanzengraben und der Limmat die Sihl hochschwimmen, was den potenziellen Lebensraum der Nasen enorm vergrössern würde. Die Bauchspeicheldrüse ist ein Organ mit vielfältigen Funktionen, die von unterschiedlichen, auf die jeweilige Aufgabe spezialisierten Zellverbänden gewährleistet werden. Sie produziert sowohl Verdauungssekrete, die in den Zwölffingerdarm abgegeben werden, als auch Hormone wie Insulin und Glucagon, die unter anderem den Blutzuckerspiegel regulieren und ihre Wirkungsorte via Blutkreislauf erreichen. Die verschiedenen Zelltypen können «entarten», das heisst Tumoren mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften bilden. Wenn von Bauchspeicheldrüsenkrebs gesprochen wird, ist meist das duktale Adenokarzinom gemeint. Dieser Tumor geht von den Zellen aus, die die Ausführgänge für das Verdauungssekret auskleiden, und macht mit rund 95 Prozent den Grossteil der Pankreaskrebsfälle aus. Mit 850 Neuerkrankungen pro Jahr steht der Bauchspeicheldrüsenkrebs in der Schweiz bei den bösartigen Tumoren des Verdauungstraktes an zweiter Stelle. Frauen und Männer sind gleich häufig betroffen. Das Erkrankungsrisiko ist vor dem 50. Lebensjahr gering, steigt dann stark an und erreicht seinen Höhepunkt im achten Lebensjahrzehnt. Die sogenannte Mortalität ist beim Pankreaskarzinom ausserordentlich hoch, was bedeutet, dass nahezu alle Betroffenen an der Erkrankung sterben. Unspezifische Symptome Bei einer derart schlechten Prognose wären Erkenntnisse über Ursachen und Risikofaktoren des Bauchspeicheldrüsenkrebses besonders wertvoll, da sie dazu beitragen könnten, der Erkrankung vorzubeugen. Leider ist die Lage auch in diesem Bereich unerfreulich. Einzig für das Rauchen und die chronische Entzündung der Bauchspeicheldrüse gibt es deutliche Hinweise auf einen ursächlichen Zusammenhang mit dem Pankreaskarzinom. Kontrovers diskutiert wird die Erhöhung des Risikos durch übermässigen Alkoholkonsum und Übergewicht, während starker Kaffeekonsum und fettreiche Ernährung nicht mehr als Risikofaktoren gelten. Wenn Vorbeugen kaum möglich ist, wäre die Früherkennung umso wichtiger, da sie die Chancen auf Heilung wie bei allen Krebsarten erhöht. Doch wird die Diagnose selten in einem frühen Stadium gestellt, da der Bauchspeicheldrüsenkrebs sich lange Zeit nicht bemerkbar macht oder zunächst Symptome erzeugt, die «unspezifisch» sind, also bei einer Vielzahl von Erkrankungen auftreten können. Dazu gehören Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und eine schleichende Verschlechterung des Allgemeinzustands. Auch Verstopfung, Übelkeit und Erbrechen kommen vor, allerdings kaum zu Beginn der Erkrankung. Nicht selten weist eine Gelbsucht auf ein Pankreaskarzinom hin. Sie kommt ................................................................................. ZU DIESER MEDIZIN-SERIE ni. ^ Die Beiträge dieser unregelmässig erscheinenden Serie sollen jeweils einen Überblick über die wichtigsten Aspekte einer Krankheit geben. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Behandlungsmöglichkeiten, wie sie die wissenschaftliche Medizin empfiehlt. Da bei jeder Beurteilung auch patientenspezifische Faktoren eine Rolle spielen, sollen diese Beiträge das Gespräch mit dem eigenen Arzt nicht ersetzen. Bereits erschienene Artikel finden sich unter www.nzz.ch. dadurch zustande, dass der Tumor durch Kompression des Gallengangs den Fluss der Galle behindert, die sich daraufhin ins Blut zurückstaut und die charakteristische Gelbfärbung der Haut und der weissen Anteile des äusseren Auges, der Skleren, erzeugt. Eine Gelbsucht weist darauf hin, dass der Tumor im vorderen Teil der Bauchspeicheldrüse, dem Pankreaskopf, lokalisiert ist, wo sich der Pankreas- und der Gallengang zu einem gemeinsamen Ausführgang vereinen. 80 Prozent der Pankreaskarzinome entstehen in diesem Bereich, während die übrigen vom Pankreasschwanz ausgehen. Letztere erzeugen gelegentlich diffuse Schmerzen im Oberbauch, die in den Rücken ausstrahlen können. Mitunter manifestiert sich die Erkrankung aber erst durch Symptome, die durch «Ableger» des Tumors in anderen Organen verursacht werden. Besteht Verdacht auf ein Pankreaskarzinom, bietet die moderne Medizin eine Reihe von Verfahren zur Sicherung oder zum Ausschluss der Diagnose. Zeitlich an erster Stelle steht dabei häufig eine Ultraschalluntersuchung. Geht es darum, die genaue Ausdehnung des Tumors und eine allfällige Metastasenbildung in Leber, Lunge und Knochen, zu beurteilen, ist die Computertomografie (CT) die Methode der Wahl. Verfahren wie die Endosonografie, die sogenannte ERCP oder die diagnostische Laparoskopie liefern Bilder von innerhalb des Körpers und können die Planung einer Operation erleichtern. Ausserdem bieten sie teilweise die Möglichkeit, Gewebsproben zu entnehmen, deren Analyse relevante Informationen im Hinblick auf therapeutische Entscheidungen liefern kann. Operation und Chemotherapie Aussicht auf Heilung besteht beim Bauchspeicheldrüsenkrebs nur dann, wenn der Tumor in einem frühen Stadium entdeckt wird, also weder in die umliegenden Gefässe eingewachsen ist noch Metastasen in anderen Organen wie Leber oder Lunge gebildet hat. Ist diese Voraussetzung gegeben, kann eine Operation in kurativer Absicht erfolgen, also mit dem Ziel einer vollständigen Tumorentfernung. Liegt der Tumor im Pankreaskopf, wird eine sogenannte Whipple-Operation (oder davon abgewandelte Verfahren) vorgenommen. Es handelt sich um einen komplexen Eingriff, bei dem neben dem tumorbefallenen Teil der Bauchspeicheldrüse auch der Zwölffingerdarm, der Gallengang, die Gallenblase und regionale Lymphknoten sowie in manchen Fällen auch Teile des Magens entfernt werden. Nach der Operation wird in der Regel eine Chemotherapie empfohlen, da laut neuen Studien die Überlebenszeit dadurch verbessert wird. Bestrahlungen werden in Europa im Gegensatz zu den USA nicht als Standardbehandlung vorgenommen, weil die Datenlage dazu uneinheitlich ist und europäische Studien keinen Überlebensvorteil gezeigt haben. Ob eine Chemotherapie vor der Operation den Patienten einen Nutzen bringt, ist noch ungewiss. Meist ist aber bereits bei der Diagnosestellung klar, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist. Ziel ist in diesem Fall, die Lebensqualität der Patienten in der ihnen verbleibenden Zeit auf einem möglichst hohen Niveau zu halten, was auch als Palliation bezeichnet wird. Die Chemotherapie steht dabei im Vordergrund, aber auch chirurgische Eingriffe oder endoskopische Interventionen sind häufig sinnvoll, beispielsweise, wenn es darum geht, den verschlossenen Gallengang durch Einlage eines röhrenartigen Drahtgeflechts («Stent») wieder durchgängig zu machen. Weitere Fortschritte erhofft man sich vom Einsatz neuer Substanzen aus der Klasse der Immunsuppressiva (mTOR-Inhibitoren) oder der monoklonalen Antikörper – ein therapeutischer Durchbruch, den man Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs besonders wünschen würde, ist aber nicht in Sicht. Bruno Kesseli ist Arzt, Wissenschaftsjournalist und Chefredaktor der «Schweizerischen Ärztezeitung».