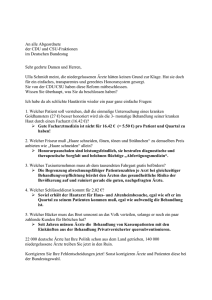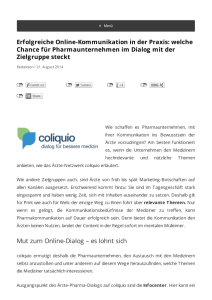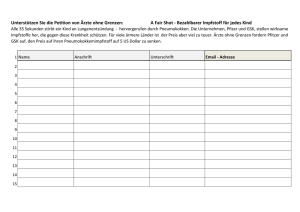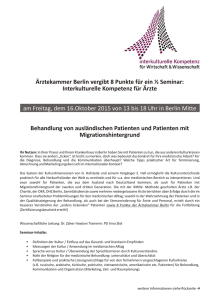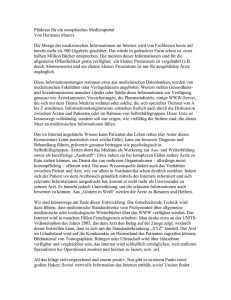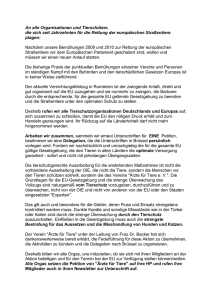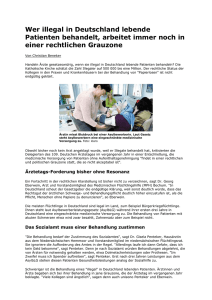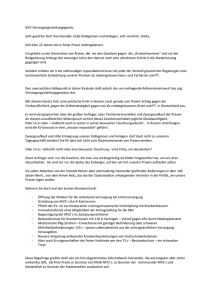Schlaraffenland mit dunklen Seiten
Werbung
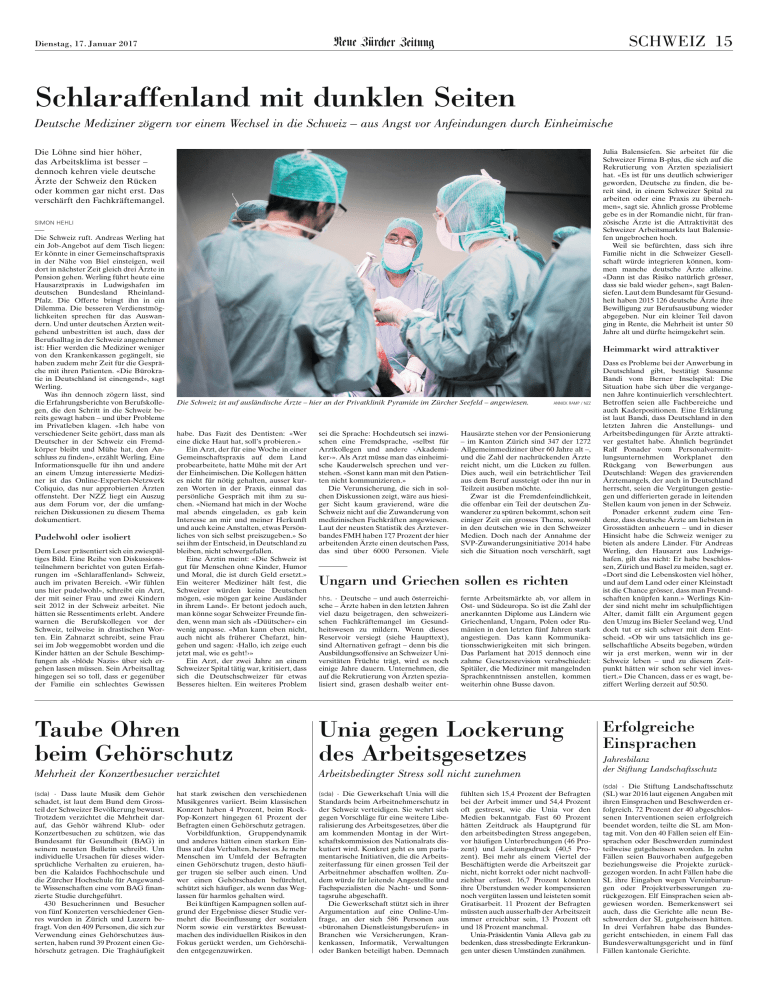
SCHWEIZ 15 Neuö Zürcör Zäitung Dienstag, 17. Januar 2017 Schlaraffenland mit dunklen Seiten Deutsche Mediziner zögern vor einem Wechsel in die Schweiz – aus Angst vor Anfeindungen durch Einheimische Die Löhne sind hier höher, das Arbeitsklima ist besser – dennoch kehren viele deutsche Ärzte der Schweiz den Rücken oder kommen gar nicht erst. Das verschärft den Fachkräftemangel. Julia Balensiefen. Sie arbeitet für die Schweizer Firma B-plus, die sich auf die Rekrutierung von Ärzten spezialisiert hat. «Es ist für uns deutlich schwieriger geworden, Deutsche zu finden, die bereit sind, in einem Schweizer Spital zu arbeiten oder eine Praxis zu übernehmen», sagt sie. Ähnlich grosse Probleme gebe es in der Romandie nicht, für französische Ärzte ist die Attraktivität des Schweizer Arbeitsmarkts laut Balensiefen ungebrochen hoch. Weil sie befürchten, dass sich ihre Familie nicht in die Schweizer Gesellschaft würde integrieren können, kommen manche deutsche Ärzte alleine. «Dann ist das Risiko natürlich grösser, dass sie bald wieder gehen», sagt Balensiefen. Laut dem Bundesamt für Gesundheit haben 2015 126 deutsche Ärzte ihre Bewilligung zur Berufsausübung wieder abgegeben. Nur ein kleiner Teil davon ging in Rente, die Mehrheit ist unter 50 Jahre alt und dürfte heimgekehrt sein. SIMON HEHLI Die Schweiz ruft. Andreas Werling hat ein Job-Angebot auf dem Tisch liegen: Er könnte in einer Gemeinschaftspraxis in der Nähe von Biel einsteigen, weil dort in nächster Zeit gleich drei Ärzte in Pension gehen. Werling führt heute eine Hausarztpraxis in Ludwigshafen im deutschen Bundesland RheinlandPfalz. Die Offerte bringt ihn in ein Dilemma. Die besseren Verdienstmöglichkeiten sprechen für das Auswandern. Und unter deutschen Ärzten weitgehend unbestritten ist auch, dass der Berufsalltag in der Schweiz angenehmer ist: Hier werden die Mediziner weniger von den Krankenkassen gegängelt, sie haben zudem mehr Zeit für die Gespräche mit ihren Patienten. «Die Bürokratie in Deutschland ist einengend», sagt Werling. Was ihn dennoch zögern lässt, sind die Erfahrungsberichte von Berufskollegen, die den Schritt in die Schweiz bereits gewagt haben – und über Probleme im Privatleben klagen. «Ich habe von verschiedener Seite gehört, dass man als Deutscher in der Schweiz ein Fremdkörper bleibt und Mühe hat, den Anschluss zu finden», erzählt Werling. Eine Informationsquelle für ihn und andere an einem Umzug interessierte Mediziner ist das Online-Experten-Netzwerk Coliquio, das nur approbierten Ärzten offensteht. Der NZZ liegt ein Auszug aus dem Forum vor, der die umfangreichen Diskussionen zu diesem Thema dokumentiert. Pudelwohl oder isoliert Dem Leser präsentiert sich ein zwiespältiges Bild. Eine Reihe von Diskussionsteilnehmern berichtet von guten Erfahrungen im «Schlaraffenland» Schweiz, auch im privaten Bereich. «Wir fühlen uns hier pudelwohl», schreibt ein Arzt, der mit seiner Frau und zwei Kindern seit 2012 in der Schweiz arbeitet. Nie hätten sie Ressentiments erlebt. Andere warnen die Berufskollegen vor der Schweiz, teilweise in drastischen Worten. Ein Zahnarzt schreibt, seine Frau sei im Job weggemobbt worden und die Kinder hätten an der Schule Beschimpfungen als «blöde Nazis» über sich ergehen lassen müssen. Sein Arbeitsalltag hingegen sei so toll, dass er gegenüber der Familie ein schlechtes Gewissen Heimmarkt wird attraktiver Die Schweiz ist auf ausländische Ärzte – hier an der Privatklinik Pyramide im Zürcher Seefeld – angewiesen. habe. Das Fazit des Dentisten: «Wer eine dicke Haut hat, soll’s probieren.» Ein Arzt, der für eine Woche in einer Gemeinschaftspraxis auf dem Land probearbeitete, hatte Mühe mit der Art der Einheimischen. Die Kollegen hätten es nicht für nötig gehalten, ausser kurzen Worten in der Praxis, einmal das persönliche Gespräch mit ihm zu suchen. «Niemand hat mich in der Woche mal abends eingeladen, es gab kein Interesse an mir und meiner Herkunft und auch keine Anstalten, etwas Persönliches von sich selbst preiszugeben.» So sei ihm der Entscheid, in Deutschland zu bleiben, nicht schwergefallen. Eine Ärztin meint: «Die Schweiz ist gut für Menschen ohne Kinder, Humor und Moral, die ist durch Geld ersetzt.» Ein weiterer Mediziner hält fest, die Schweizer würden keine Deutschen mögen, «sie mögen gar keine Ausländer in ihrem Land». Er betont jedoch auch, man könne sogar Schweizer Freunde finden, wenn man sich als «Düütscher» ein wenig anpasse. «Man kann eben nicht, auch nicht als früherer Chefarzt, hingehen und sagen: ‹Hallo, ich zeige euch jetzt mal, wie es geht!›» Ein Arzt, der zwei Jahre an einem Schweizer Spital tätig war, kritisiert, dass sich die Deutschschweizer für etwas Besseres hielten. Ein weiteres Problem sei die Sprache: Hochdeutsch sei inzwischen eine Fremdsprache, «selbst für Arztkollegen und andere ‹Akademiker›». Als Arzt müsse man das einheimische Kauderwelsch sprechen und verstehen. «Sonst kann man mit den Patienten nicht kommunizieren.» Die Verunsicherung, die sich in solchen Diskussionen zeigt, wäre aus hiesiger Sicht kaum gravierend, wäre die Schweiz nicht auf die Zuwanderung von medizinischen Fachkräften angewiesen. Laut der neusten Statistik des Ärzteverbandes FMH haben 17,7 Prozent der hier arbeitenden Ärzte einen deutschen Pass, das sind über 6000 Personen. Viele ANNICK RAMP / NZZ Hausärzte stehen vor der Pensionierung – im Kanton Zürich sind 347 der 1272 Allgemeinmediziner über 60 Jahre alt –, und die Zahl der nachrückenden Ärzte reicht nicht, um die Lücken zu füllen. Dies auch, weil ein beträchtlicher Teil aus dem Beruf aussteigt oder ihn nur in Teilzeit ausüben möchte. Zwar ist die Fremdenfeindlichkeit, die offenbar ein Teil der deutschen Zuwanderer zu spüren bekommt, schon seit einiger Zeit ein grosses Thema, sowohl in den deutschen wie in den Schweizer Medien. Doch nach der Annahme der SVP-Zuwanderungsinitiative 2014 habe sich die Situation noch verschärft, sagt Ungarn und Griechen sollen es richten hhs. V Deutsche – und auch österreichi- sche – Ärzte haben in den letzten Jahren viel dazu beigetragen, den schweizerischen Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zu mildern. Wenn dieses Reservoir versiegt (siehe Haupttext), sind Alternativen gefragt – denn bis die Ausbildungsoffensive an Schweizer Universitäten Früchte trägt, wird es noch einige Jahre dauern. Unternehmen, die auf die Rekrutierung von Ärzten spezialisiert sind, grasen deshalb weiter ent- fernte Arbeitsmärkte ab, vor allem in Ost- und Südeuropa. So ist die Zahl der anerkannten Diplome aus Ländern wie Griechenland, Ungarn, Polen oder Rumänien in den letzten fünf Jahren stark angestiegen. Das kann Kommunikationsschwierigkeiten mit sich bringen. Das Parlament hat 2015 dennoch eine zahme Gesetzesrevision verabschiedet: Spitäler, die Mediziner mit mangelnden Sprachkenntnissen anstellen, kommen weiterhin ohne Busse davon. Taube Ohren beim Gehörschutz Unia gegen Lockerung des Arbeitsgesetzes (sda) V Dass laute Musik dem Gehör (sda) V Die Gewerkschaft Unia will die Mehrheit der Konzertbesucher verzichtet schadet, ist laut dem Bund dem Grossteil der Schweizer Bevölkerung bewusst. Trotzdem verzichtet die Mehrheit darauf, das Gehör während Klub- oder Konzertbesuchen zu schützen, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in seinem neusten Bulletin schreibt. Um individuelle Ursachen für dieses widersprüchliche Verhalten zu eruieren, haben die Kalaidos Fachhochschule und die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften eine vom BAG finanzierte Studie durchgeführt. 430 Besucherinnen und Besucher von fünf Konzerten verschiedener Genres wurden in Zürich und Luzern befragt. Von den 409 Personen, die sich zur Verwendung eines Gehörschutzes äusserten, haben rund 39 Prozent einen Gehörschutz getragen. Die Traghäufigkeit hat stark zwischen den verschiedenen Musikgenres variiert. Beim klassischen Konzert haben 4 Prozent, beim RockPop-Konzert hingegen 61 Prozent der Befragten einen Gehörschutz getragen. Vorbildfunktion, Gruppendynamik und anderes hätten einen starken Einfluss auf das Verhalten, heisst es. Je mehr Menschen im Umfeld der Befragten einen Gehörschutz trugen, desto häufiger trugen sie selber auch einen. Und wer einen Gehörschaden befürchtet, schützt sich häufiger, als wenn das Weglassen für harmlos gehalten wird. Bei künftigen Kampagnen sollen aufgrund der Ergebnisse dieser Studie vermehrt die Beeinflussung der sozialen Norm sowie ein verstärktes Bewusstmachen des individuellen Risikos in den Fokus gerückt werden, um Gehörschäden entgegenzuwirken. Arbeitsbedingter Stress soll nicht zunehmen Standards beim Arbeitnehmerschutz in der Schweiz verteidigen. Sie wehrt sich gegen Vorschläge für eine weitere Liberalisierung des Arbeitsgesetzes, über die am kommenden Montag in der Wirtschaftskommission des Nationalrats diskutiert wird. Konkret geht es um parlamentarische Initiativen, die die Arbeitszeiterfassung für einen grossen Teil der Arbeitnehmer abschaffen wollten. Zudem würde für leitende Angestellte und Fachspezialisten die Nacht- und Sonntagsruhe abgeschafft. Die Gewerkschaft stützt sich in ihrer Argumentation auf eine Online-Umfrage, an der sich 586 Personen aus «büronahen Dienstleistungsberufen» in Branchen wie Versicherungen, Krankenkassen, Informatik, Verwaltungen oder Banken beteiligt haben. Demnach fühlten sich 15,4 Prozent der Befragten bei der Arbeit immer und 54,4 Prozent oft gestresst, wie die Unia vor den Medien bekanntgab. Fast 60 Prozent hätten Zeitdruck als Hauptgrund für den arbeitsbedingten Stress angegeben, vor häufigen Unterbrechungen (46 Prozent) und Leistungsdruck (40,5 Prozent). Bei mehr als einem Viertel der Beschäftigten werde die Arbeitszeit gar nicht, nicht korrekt oder nicht nachvollziehbar erfasst. 16,7 Prozent könnten ihre Überstunden weder kompensieren noch vergüten lassen und leisteten somit Gratisarbeit. 11 Prozent der Befragten müssten auch ausserhalb der Arbeitszeit immer erreichbar sein, 13 Prozent oft und 18 Prozent manchmal. Unia-Präsidentin Vania Alleva gab zu bedenken, dass stressbedingte Erkrankungen unter diesen Umständen zunähmen. Dass es Probleme bei der Anwerbung in Deutschland gibt, bestätigt Susanne Bandi vom Berner Inselspital: Die Situation habe sich über die vergangenen Jahre kontinuierlich verschlechtert. Betroffen seien alle Fachbereiche und auch Kaderpositionen. Eine Erklärung ist laut Bandi, dass Deutschland in den letzten Jahren die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen für Ärzte attraktiver gestaltet habe. Ähnlich begründet Ralf Ponader vom Personalvermittlungsunternehmen Workplanet den Rückgang von Bewerbungen aus Deutschland: Wegen des gravierenden Ärztemangels, der auch in Deutschland herrscht, seien die Vergütungen gestiegen und differierten gerade in leitenden Stellen kaum von jenen in der Schweiz. Ponader erkennt zudem eine Tendenz, dass deutsche Ärzte am liebsten in Grossstädten anheuern – und in dieser Hinsicht habe die Schweiz weniger zu bieten als andere Länder. Für Andreas Werling, den Hausarzt aus Ludwigshafen, gilt das nicht: Er habe beschlossen, Zürich und Basel zu meiden, sagt er. «Dort sind die Lebenskosten viel höher, und auf dem Land oder einer Kleinstadt ist die Chance grösser, dass man Freundschaften knüpfen kann.» Werlings Kinder sind nicht mehr im schulpflichtigen Alter, damit fällt ein Argument gegen den Umzug ins Bieler Seeland weg. Und doch tut er sich schwer mit dem Entscheid. «Ob wir uns tatsächlich ins gesellschaftliche Abseits begeben, würden wir ja erst merken, wenn wir in der Schweiz leben – und zu diesem Zeitpunkt hätten wir schon sehr viel investiert.» Die Chancen, dass er es wagt, beziffert Werling derzeit auf 50:50. Erfolgreiche Einsprachen Jahresbilanz der Stiftung Landschaftsschutz (sda) V Die Stiftung Landschaftsschutz (SL) war 2016 laut eigenen Angaben mit ihren Einsprachen und Beschwerden erfolgreich. 72 Prozent der 40 abgeschlossenen Interventionen seien erfolgreich beendet worden, teilte die SL am Montag mit. Von den 40 Fällen seien elf Einsprachen oder Beschwerden zumindest teilweise gutgeheissen worden. In zehn Fällen seien Bauvorhaben aufgegeben beziehungsweise die Projekte zurückgezogen worden. In acht Fällen habe die SL ihre Eingaben wegen Vereinbarungen oder Projektverbesserungen zurückgezogen. Elf Einsprachen seien abgewiesen worden. Bemerkenswert sei auch, dass die Gerichte alle neun Beschwerden der SL gutgeheissen hätten. In drei Verfahren habe das Bundesgericht entschieden, in einem Fall das Bundesverwaltungsgericht und in fünf Fällen kantonale Gerichte.