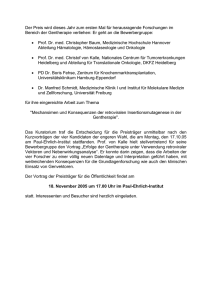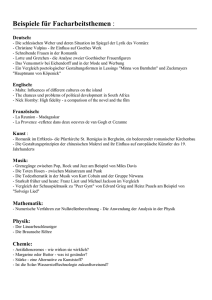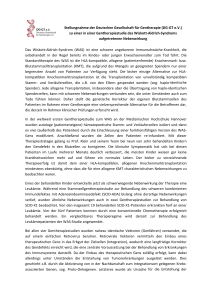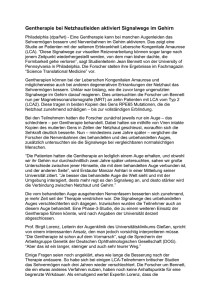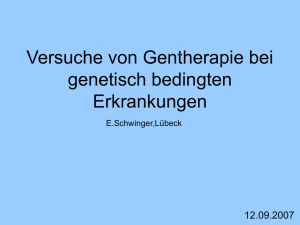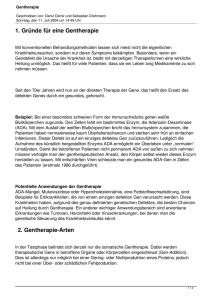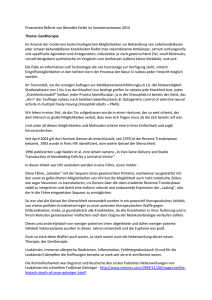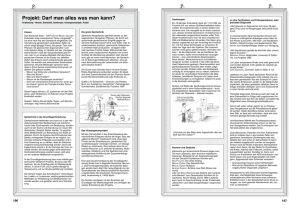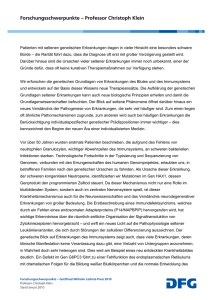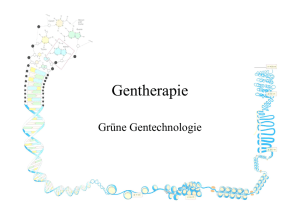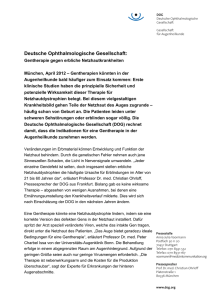Somatische Gentherapie. Chancen und Grenzen von Christoph Klein
Werbung
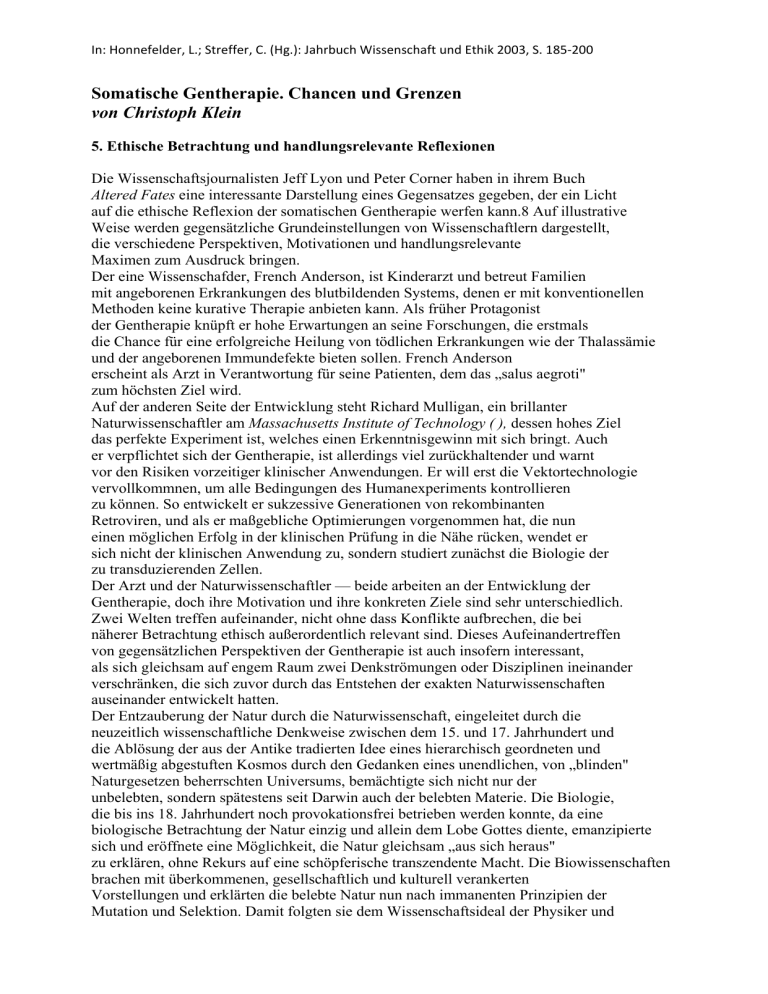
In: Honnefelder, L.; Streffer, C. (Hg.): Jahrbuch Wissenschaft und Ethik 2003, S. 185‐200 Somatische Gentherapie. Chancen und Grenzen von Christoph Klein 5. Ethische Betrachtung und handlungsrelevante Reflexionen Die Wissenschaftsjournalisten Jeff Lyon und Peter Corner haben in ihrem Buch Altered Fates eine interessante Darstellung eines Gegensatzes gegeben, der ein Licht auf die ethische Reflexion der somatischen Gentherapie werfen kann.8 Auf illustrative Weise werden gegensätzliche Grundeinstellungen von Wissenschaftlern dargestellt, die verschiedene Perspektiven, Motivationen und handlungsrelevante Maximen zum Ausdruck bringen. Der eine Wissenschafder, French Anderson, ist Kinderarzt und betreut Familien mit angeborenen Erkrankungen des blutbildenden Systems, denen er mit konventionellen Methoden keine kurative Therapie anbieten kann. Als früher Protagonist der Gentherapie knüpft er hohe Erwartungen an seine Forschungen, die erstmals die Chance für eine erfolgreiche Heilung von tödlichen Erkrankungen wie der Thalassämie und der angeborenen Immundefekte bieten sollen. French Anderson erscheint als Arzt in Verantwortung für seine Patienten, dem das „salus aegroti" zum höchsten Ziel wird. Auf der anderen Seite der Entwicklung steht Richard Mulligan, ein brillanter Naturwissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology ( ), dessen hohes Ziel das perfekte Experiment ist, welches einen Erkenntnisgewinn mit sich bringt. Auch er verpflichtet sich der Gentherapie, ist allerdings viel zurückhaltender und warnt vor den Risiken vorzeitiger klinischer Anwendungen. Er will erst die Vektortechnologie vervollkommnen, um alle Bedingungen des Humanexperiments kontrollieren zu können. So entwickelt er sukzessive Generationen von rekombinanten Retroviren, und als er maßgebliche Optimierungen vorgenommen hat, die nun einen möglichen Erfolg in der klinischen Prüfung in die Nähe rücken, wendet er sich nicht der klinischen Anwendung zu, sondern studiert zunächst die Biologie der zu transduzierenden Zellen. Der Arzt und der Naturwissenschaftler — beide arbeiten an der Entwicklung der Gentherapie, doch ihre Motivation und ihre konkreten Ziele sind sehr unterschiedlich. Zwei Welten treffen aufeinander, nicht ohne dass Konflikte aufbrechen, die bei näherer Betrachtung ethisch außerordentlich relevant sind. Dieses Aufeinandertreffen von gegensätzlichen Perspektiven der Gentherapie ist auch insofern interessant, als sich gleichsam auf engem Raum zwei Denkströmungen oder Disziplinen ineinander verschränken, die sich zuvor durch das Entstehen der exakten Naturwissenschaften auseinander entwickelt hatten. Der Entzauberung der Natur durch die Naturwissenschaft, eingeleitet durch die neuzeitlich wissenschaftliche Denkweise zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert und die Ablösung der aus der Antike tradierten Idee eines hierarchisch geordneten und wertmäßig abgestuften Kosmos durch den Gedanken eines unendlichen, von „blinden" Naturgesetzen beherrschten Universums, bemächtigte sich nicht nur der unbelebten, sondern spätestens seit Darwin auch der belebten Materie. Die Biologie, die bis ins 18. Jahrhundert noch provokationsfrei betrieben werden konnte, da eine biologische Betrachtung der Natur einzig und allein dem Lobe Gottes diente, emanzipierte sich und eröffnete eine Möglichkeit, die Natur gleichsam „aus sich heraus" zu erklären, ohne Rekurs auf eine schöpferische transzendente Macht. Die Biowissenschaften brachen mit überkommenen, gesellschaftlich und kulturell verankerten Vorstellungen und erklärten die belebte Natur nun nach immanenten Prinzipien der Mutation und Selektion. Damit folgten sie dem Wissenschaftsideal der Physiker und In: Honnefelder, L.; Streffer, C. (Hg.): Jahrbuch Wissenschaft und Ethik 2003, S. 185‐200 Astronomen, die den Gegenstand ihrer Forschung als „moralisch neutral" betrachteten. Diese „Wertneutralität" der Naturwissenschaften ist ein immer noch sehr weit verbreitetes Paradigma in der Scientific Community mit entsprechenden Verhaltensmustern. Im Gegensatz zu der naturwissenschaftlich geprägten Sichtweise steht die klinische Sichtweise. Die Verschiedenheit der klinischen Perspektive liegt darin begründet, dass sie bei aller notwendigen und fruchtbaren Integration naturwissenschaftlicher Methodik sich nie auf eine rein theoretische Betrachtungs- bzw. Erklärungsweise reduzieren lassen kann. Die klinische Medizin ist eine praktische Wissenschaft, die sich dadurch kennzeichnen lässt, dass sie es ermöglicht, Fragen danach, was zu tun sei, innerhalb ihrer zu erörtern und auf begründbare Weise zu beantworten. Ist das Ziel der theoretischen Wissenschaften, Aussagen über Gesetzmäßigkeiten und ihre Bedingungen zu treffen, so liegt das Ziel der praktischen Wissenschaften darin, Handlungen selbst zu begründen und zu rechtfertigen.9 Der Arzt ist in sehr direkter Weise durch seinen Patienten zum Handeln aufgerufen, er kann sich dieser Pflicht nicht entziehen. Dadurch, dass er qua Arzt-Sein sein theoretischnaturwissenschaftliches Wissen praktisch zur Anwendung bringen muss, steht er in einem direkten Handlungszusammenhang. Gefordert ist eine praktische Rationalität Doch diese ist keineswegs trivial in dem Sinne, dass der Arzt immer schon weiß, auf welche Weise er dem Anspruch seines Patienten auf Linderung seiner Symptome bzw. auf Heilung gerecht wird. Eine Festlegung der Pflicht des Arztes, Leben zu wahren und Krankheit zu heilen, ist zwar von fundamentaler Bedeutung, allerdings unter den jeweiligen Umstanden nicht immer klar in Handlungsdirektiven übersetzbar. Gerade die Unkenntnis aller theoretisch möglichen Bedingungen macht die Begründung des Handelns mitunter schwierig. Die Kenntnis der Randbedingungen bleibt fragmentarisch, und der beabsichtigte Erfolg kann nicht garantiert werden. Der Am muss immer weder unter Bedingungen handeln, die er nur schemenhaft erahnen kann und auf deren Klärung er nicht warten kann, insbesondere dann, wenn diese dem hohen Standard einer naturwissenschaftlich-theoretischen Wissenschaft genügen soll. Die Gentherapie als Disziplin verschränkt beide Sichtweisen, eine theoretische, dem naturwissenschaftlichen Ideal verbundene, und eine klinisch-praktische, die sich spätestens bei ihrer Durchführung am Patienten offenbart. In dieser Verflechtung stellt sich eine Reihe von praxisrelevanten und ethischen Fragen, die hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit kurz skizziert werden sollen. - Welche Krankheitsmodelle werden für die Untersuchungen gewählt? Die Entwicklung gentherapeutischer Strategien kann nicht wie ein konkretes naturwissenschaftliches Experiment von einem einzelnen Wissenschaftler durchgeführt werden, sondern erfordert eine langfristige konzertierte Anstrengung von vielen Akteuren. Dies gebietet vor Beginn eines solchen Projektes eine sorgfältige Sondierung der möglichen Handlungsräume. In der Perspektive der Naturwissenschaft, die auf Klarheit der Bedingungen Wert legt, wäre eine erste Entwicklung anhand derjenigen Krankheitsmodelle vorrangig, die sich monokausal erklären lassen. Monogene Erkrankungen zeigen eine definierte Pathophysiologie; im Gegensatz dazu ist die Pathophysiologie komplexer Erkrankungen wie die Entstehung von Krebs oder die Manifestationen der Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehr viel schwieriger zu verstehen und kausal zu behandeln. Es ist nicht verwunderlich, dass die erste erfolgreiche klinische Gentherapiestudie gerade deswegen erfolgreich war, da eine geeignete Modellerkrankung sorgfältig ausgewählt wurde. Es ist offensichtlich, dass bereits die Frage nach der Wahl der klinischen Modelle In: Honnefelder, L.; Streffer, C. (Hg.): Jahrbuch Wissenschaft und Ethik 2003, S. 185‐200 geprägt ist von der Dichotomie der wissenschaftlichen Sichtweisen. Das naturwissenschaftliche Interesse, anhand definierter Bedingungen klare Aussagen über die Durchführbarkeit genetischer Therapien zu machen, steht dem klinischen Interesse gegenüber, welches motiviert ist durch den Appell der Patienten, bislang nicht oder nicht zureichend heilbare Erkrankungen mit Hilfe neuer Methoden zu therapieren. 10 Insbesondere sieht der Kliniker die schweren, unheilbaren Erkrankungen, u.U. auch die sehr häufig auftretenden Erkrankungen als vordringliche Gegenstände seines Handelns an. — Wann und unter welchen Bedingungen sollte eine experimentelle Therapie klinisch getestet werden? Diese Frage wurde bereits in einem vorausschauenden Artikel von Theodore Friedmann und Richard Roblin aus dem Jahre 1972 kritisch diskutiert11 Die Autoren nennen eine Serie von fünf „ethisch-wissenschaftlichen" Kriterien, die vor einer klinischen Anwendung erfüllt sein sollten. So fordern sie, dass der genetische Defekt der Erkrankung biochemisch charakterisiert sein sollte. Dies bezieht sich z.B. auf die Frage, welche Restmengen an Protein der betroffene Patient noch bildet, bzw. auf die Frage der Restaktivität eines Proteins bei Vorliegen einer Mutation. Als weiteres Kriterium wird angeführt, dass eine ausreichende klinische Erfahrung mit den jeweiligen Krankheiten bestehen soll. Diese Expertise ist wichtig zur Einschätzung von Aussagen über den natürlichen Verlauf der Erkrankung und zur Evaluierung alternativer Therapieverfahren. Dieses Kriterium resultiert aus der Erfahrung, dass Defekte in ein und demselben Gen zu leichteren und schwereren Verläufen prädisponieren können, und soll sicherstellen, dass nicht äußerst milde Varianten eines Gendefektes einer experimentellen risikobehafteten Therapie zugeführt werden. Friedman und Roblin fordern weiter, dass ein zu verwendendes Vektorsystem adäquat charakterisiert sein muss. In diesem Zusammenhang verweisen die Autoren explizit auf die Notwendigkeit einer zentralen Aufsichtsbehörde. Weiterhin werden vor einer klinischen Prüfung ausreichende tierexperimentelle Vorarbeiten vorausgesetzt, so dass eine adäquate Risikobewertung erfolgen kann. Ausdrücklich wird die Generierung von Tiermodellen menschlicher Erkrankungen (wie sie erst durch die Entwicklung transgener Tiere möglich werden sollte) gefordert. Schließlich wird ein Kriterium dargestellt, welches eine ausreichende in w/to-Analyse von genetisch veränderten Zellen der Patienten fordert Die Autoren argumentieren, dass man in vielen Fällen Primärzellen aus dem Patienten gewinnen, diese in vitro manipulieren und den Erfolg der genetischen Manipulation analysieren könne. Auf diese Weise ist nicht nur ein Wirksamkeitsnachweis, sondern auch eine Untersuchung auf toxische Nebenwirkungen (z.B. chromosomale Stabilität, maligne Entartung) möglich. Dieser Katalog von Kriterien beansprucht auch heute noch Gültigkeit, wenn auch das eine oder andere Kriterium im Detail auf unseren aktuellen Kenntnisstand angepasst werden kann. - Nach welchen Kriterien sollte eine Risiko- und FoIgenabschätzung durchgeführt werden? Wie jedes neue Therapieverfahren muss auch die somatische Gentherapie vor einer Anwendung am Patienten einer kritischen Abwägung von Nutzen und Risiko unterzogen werden. In diesem Sinne unterscheidet sie sich nicht prinzipiell von konventionellen Therapien. Kontrovers diskutiert wird allerdings die Frage, welche Risiken und welche Folgen verantwortbar sind. Im Gegensatz zu vielen (durchaus nicht allen) konventionellen Therapieverfahren ist ein gentherapeutischer Eingriff in der Regel irreversibel, insbesondere dann, wenn genetisch manipulierte Stammzellen verabreicht werden. So erscheint eine experimentelle Gentherapie bei primären Immundefekten, die ohne adäquate Therapie in den ersten Lebensjahren zum Tode In: Honnefelder, L.; Streffer, C. (Hg.): Jahrbuch Wissenschaft und Ethik 2003, S. 185‐200 führen, eher gerechtfertigt als bei manchen Stoffwechselerkrankungen, die diätetisch gut zu kontrollieren sind. Konkrete Kataloge mit Kriterien, anhand derer Nutzen und Risiko definiert werden können, fehlen .bisher allerdings. Die Diskussion um die schwer wiegenden Nebenwirkungen, die in den vergangenen Jahren beschrieben wurden, wird neue Forschungsinitiativen begünstigen, die sich insbesondere mit dem Toxizitätsprofil gentherapeutischer Interventionen befassen. Es ist zu hoffen, dass aus diesen Initiativen nicht nur experimentelle Daten resultieren, die eine adäquate Folgenabschätzung erlauben werden, sondern auch eine Vergewisserung der ethischen Grundlagen durch praktizierte Formen eines interdisziplinären Dialoges. - In welchem therapeutischen Kontext befindet sich der Patient? Viele Analysen haben gezeigt, dass sich die tradierte Arzt-Patient-Beziehung, in welcher der Arzt jeder institutionellen Beeinflussung enthoben nur dem Patienten gegenüber verpflichtet war, nicht mehr der Realität entspricht. Die Dyade von Arzt und Patient wurde längst durch die rasant zunehmende medizinische Subspezialisierung und durch die Einflussnahme der Krankenhausverwaltungen und Versicherungen aufgebrochen, ein Faktum, welches interessante und äußerst wichtige ethische Implikationen hat. Dies trifft in besonderem Maße für die Gentherapie zu. Die institutionellen Bedingungen ärztlichen gentherapeutischen Handelns werden durch die notwendige Einbeziehung weiterer Akteure zusätzlich kompliziert. Oftmals werden wissenschaftliche Vorbereitungen zur Durchführung gentherapeutischer Studienprotokolle vor Ort von Pharmaunternehmen unterstützt, manchmal auch verantwortlich dirigiert. Die Gewinnung, Züchtung und genetische Veränderung primärer Zellen von Patienten erfolgt heute unter strengen behördlichen Auflagen. Die dazu notwendigen Laboratorien arbeiten unter so genannten GMP-Bedingungen („good manufacturing practice'*), labortechnische Voraussetzungen, die sich auch ein hoch spezialisiertes Universitätsklinikum kaum mehr leisten kann. Folge ist, dass diese Tätigkeit an Unternehmen delegiert wird. Ähnliches trifft auch für die Produktion von qualitätsgeprüften viralen Vektoren zu. Der Patient findet sich also in einem äußerst komplexen Interaktionsfeld, dessen Akteure Vertreter von klinischer Medizin, Naturwissenschaft, Krankenhausverwaltung und Privatwirtschaft sind. Diese Entwicklung erfordert eine kritische Analyse und Offenlegung der jeweiligen Interessen der Beteiligten, so dass sichergestellt ist, dass der Patient im Zentrum des Geschehens bleibt. Die Begutachtung durch unabhängige Expertenkommissionen spielt hierbei eine zentrale Rolle. In Deutschland werden alle klinischen Gentherapiestudien nicht nur von den lokalen Ethikkommissionen der medizinischen Fakultäten bzw. Landesärztekammern begutachtet, sondern auch von einem Expertengremium, welches bei der Bundesärztekammer angesiedelt ist. Die Kernaufgabe der Kommission Somatische Gentherapie der Bundesärztekammer ist die Somadsche Gentherapie - Chancen und Grenzen 199 fachlich-inhaltliche Begutachtung der geplanten Gentransferstudien.12 Sie spricht empfehlende Voten aus, welche den lokalen Ethikkommissionen als Leitlinie für ihre Entscheidungen dienen. Neben den wissenschaftlichen und ethischen Aspekten sind dabei mit Blick auf die Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes und des Gentechnikgesetzes behördliche Auflagen zu berücksichtigen; als Bundesaufsichtsbehörde dient das Paul-Ehrlich-lnstitut. Die Entwicklung und klinische Umsetzung der Gentherapie stellt also eine äußerst komplexe Aufgabe dar. Naturwissenschaftliche, klinische und ethische Aspekte spielen eine fundamentale Rolle. In diesem Sinne kann die Gentherapie als moderne Konkretion der Medizin auf vielschichtige Wurzeln blicken. Ihre erfolgreiche Umsetzung und Realisierung im klinischen Kontext kann nur in kompetenten In: Honnefelder, L.; Streffer, C. (Hg.): Jahrbuch Wissenschaft und Ethik 2003, S. 185‐200 Netzwerken mit interdisziplinärer Expertise gemeistert werden. 6. Zusammenfassung Die somatische Gentherapie ist eine junge Disziplin der Medizin, die sich auf der Grundlage einer genetischen Sicht der Medizin unter methodischer Hilfe der Molekularbiologie und Biotechnologie entwickelt hat. Angesichts des hohen Ranges von individualspezifischer Gesundheit hat die Gentherapie einen hohen gesellschaftlichen Zuspruch erfahren. Grundlage für die Umsetzung des Konzeptes der Gentherapie war die Entwicklung von Genfahren durch die genetische Manipulation von Viren. Die klinische Umsetzung des Konzeptes erfolgt heute bereits erfolgreich bei ausgewählten monogenen Erkrankungen. Es ist zu erwarten, dass die Gentherapie auch das therapeutische Armamentarium in der Behandlung komplexer Krankheitsentitäten maßgeblich bereichern wird. Die Grenzen der Gentherapie sind einerseits kontingenter Natur, sofern sie die Erkenntnisse der Pathophysiologie vererbter Erkrankungen oder die Limitationen der Vektortechnologie betreffen. Darüber hinaus sieht sich die somatische Gentherapic aber auch ethischen Grenzen gegenüber, die jenseits der technologischen Machbarkeitsgrenzen liegen. Die notwendigen ethischen Analysen der somatischen Gentherapie erscheinen allerdings nicht kategorial verschieden von den Analysen konventioneller experimenteller Therapieverfahren. Die Disziplin der Gentherapie verschränkt die Handlungsraume von Naturwissenschaft und klinischer Medizin. Diese Dichotomie der Sichtweisen kann zu Konflikten fuhren. Eine philosophische Reflexion sollte dazu beitragen, die Verschiedenheit der jeweiligen Begründungskontcxtc und der jeweiligen normativen Kräfte zu identifizieren und transparent werden zu lassen. Im Antlitz des Patienten ist diese Klarheit ein Desiderat, um die klinische Medizin vor der Gefahr zu bewahren, zum Erfüllungsgehilfen einer blinden Technokratie zu degenerieren-