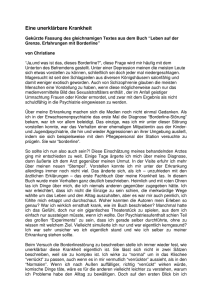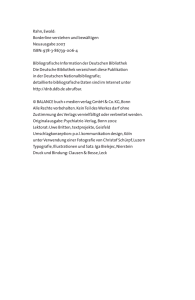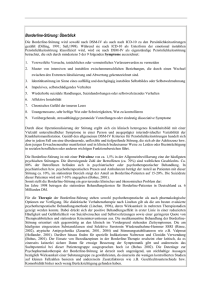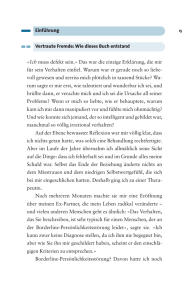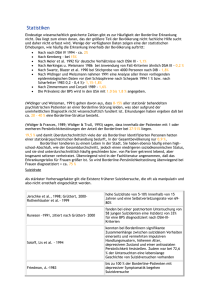Leben auf der Grenze. Erfahrungen mit Borderline
Werbung

Leben auf der Grenze Erfahrungen mit Borderline BA L A N C E buch + medien verlag ISBN 978-3-86739-003-3 003 Grenze NA1 09_03 RZ 2.indd 1 Andreas Knuf (Hg.) Leben auf der Grenze Dieses Buch ist eine Chance: Zwanzig Menschen mit BorderlineErfahrung, Betroffene und Angehörige, schreiben über ihr Leben, über ihre Gefühle, über ihren Umgang mit sich und anderen. Die Texte schaffen Verständnis und zeigen, dass Veränderungen möglich sind und es gelingen kann, eine neue Haltung sich selbst gegenüber zu gewinnen und liebevoller mit sich, seiner Familie und seinen Freunden umzugehen. Andreas Knuf (Hg.) BAL A N C E erfahrungen www.balance-verlag.de 20.03.2009 14:48:17 Uhr kannten die Autoren mein Erleben so genau? War ich wirklich ernsthaft krank, wie im Buch beschrieben? Manchmal hatte ich das Gefühl, doch nur ein gigantisches Theaterstück zu spielen, aus dem ich einfach nur aussteigen müsse, wenn ich wollte. Der Psychiatrieaufenthalt schien Teil des großen »Experiments« zu sein, das ich gerade selbst durchführte, ohne das Ziel zu kennen. Vielleicht simulierte ich nur und war eigentlich kerngesund? Ich war sehr unsicher, wo ich eigentlich stand und wie ich selbst zu meiner Erkrankung stehen sollte. Bis heute gerate ich also immer wieder in die Verlegenheit, erklären zu müssen, was meine Krankheit ausmacht. Üblicherweise 14 möchten meine Gesprächspartner eine kurze Schilderung der Symptome, die sie über alles ins Bild setzt. Beim Versuch, die Borderline-Störung zu beschreiben, stelle ich immer wieder fest, wie unerklärbar diese Krankheit eigentlich ist. Sie lässt sich nicht in zwei Sätzen beschreiben, weil sie zu komplex ist. Ich wirke zu »normal«, um in das Klischee »verrückt« zu passen, auch wenn es in mir vermutlich »verrückter« aussieht als in den »Normalen«. Wenn ich nach außen auffälliger, richtig »verrückt« wirken würde, komische Dinge täte, wäre es für die anderen vielleicht leichter zu verstehen, warum ich Probleme habe, den Alltag zu bewältigen. Doch auf den ersten Blick bin ich einfach nur unauffällig, eben »normal«. Von Freunden etwa, die mich nach einer Erklärung für die Borderline-Störung fragen, unterscheide ich mich kaum. Das kann die Sache dann noch deutlich verkomplizieren, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Ähnlichkeit Angst macht und Abstand erzeugt. Deshalb muss ich nach »ungefährlichen« Parallelen im Erleben suchen, um meine Gesprächspartner »abholen« zu können, um einen Ausgangspunkt bei der Beschreibung zu haben, mit dem mein Gegenüber etwas anfangen kann. Davon ausgehend, kann ich dann vorsichtig versuchen zu erklären, was mein Erleben von dem Erleben der »Normalen« unterscheidet. Wenn ich nicht missverstanden werden will, muss ich mich in den anderen hineinversetzen und Entgegenkommen zeigen, über meinen Schatten springen und auch ungeschickte oder verletzende Fragen beantworten. Das erfordert eine Menge Toleranz, aber auch Fantasie, weil ich nur Vermutungen über das, was »normales« Erleben bedeutet, anstellen kann. Oft gelingt es mir nicht, anderen zu erklären, wie verletzlich ich bin und wie sehr ich meinen Stimmungsschwankungen unterworfen bin. Wenn ich keine Lust habe, große Erklärungen über meine Krankheit abzugeben, »oute« ich mich nur als psychisch Kranke. Da ich sehr dünn bin, ist die nächste Frage meines Gegenübers meist, ob ich magersüchtig gewesen sei. Nur die Andeutung eines Nickens erspart mir eine Menge Erklärungen, denn mein Gegenüber meint alles über mich zu wissen. Manchmal ist das ganz praktisch. Reaktionen meiner Umwelt haben mich vorsichtig gemacht, zu meiner Diagnose zu stehen. Bei professionell Tätigen ist mir das gesamte Spektrum der Einstellungen zu dieser Erkrankung begegnet: Interesse an den Symptomen und meinem Erleben wurde ebenso gezeigt wie offene Aggression und Abwertung meiner Person als Personifizierung dieser Störung. Im Rahmen meiner therapeutischen Ausbildung habe ich gesehen, wie viel Angst das wenig Greifbare der Störung bei Schülern, aber auch bei vermittelnden Lehrern auslöst. Es blieb der Eindruck, dass »Borderliner« mit Vorsicht zu genießen seien. Schlimm genug, denn meine Mitschüler von gestern sind die Therapeuten 15 von heute. Viel hilfreicher hätte ich es gefunden, den Umgang mit der eigenen Angst und Unsicherheit bei der Arbeit mit dieser Patientengruppe zu thematisieren, um zu zeigen, dass eben diese Gefühle auftauchen können, wenn man mit Borderline-Patienten arbeitet. In meinem Kurs wusste zu dem Zeitpunkt keiner, dass ich als »Borderlinerin« gelte, und ich hatte nicht den Mut, mich zu »outen«, weil eigene Erfahrungen grundsätzlich unerwünscht waren. Im Unterricht fühlte ich mich irgendwie wie eine Spionin, die das »feindliche Lager« der »Profis« belauschte, um herauszukriegen, mit welcher Taktik sie die »Borderliner« überlisten wollten. 16 »Borderliner« zu enttarnen, sie zu überführen, ihnen ihre »Schlechtigkeit« vor Augen zu halten ist eine Einstellung, mit der mir einige Profis begegnet sind. Ich fand das ziemlich unpassend und wenig hilfreich, weil ich selbst immer am meisten unter meinem eigenen Verhalten gelitten habe. Mir ging es jedenfalls nicht darum, die Profis persönlich zu ärgern, sondern sie waren diejenigen, die als Projektionsfläche dienten. Einige waren damit vielleicht überfordert. »Borderline« scheint in Fachkreisen auf jeden Fall oft negativ besetzt zu sein (was mich nach meiner Ausbildung nicht mehr in Staunen versetzt). In einer Ärztezeitschrift habe ich eine Empfehlung gelesen, »Borderliner« sofort weiterzuüberweisen, da sie sehr zeitaufwendig und kostenintensiv seien. Ob das dann die Kosten reduziert, wage ich zu bezweifeln. Neulich hat mir meine Freundin mal wieder jemanden, den sie extrem schwierig und anstrengend fand, als »borderlinig« beschrieben. Das Wort dient als Abkürzung und soll alles ausdrücken, was zu beschreiben wäre. Ich weiß, was gemeint ist, aber trotzdem bleibt mir das Lachen im Hals stecken. Ich finde es verletzend, wenn jemand behauptet, dass die Symp­ tome meiner Erkrankung auf jeden zuträfen und die Diagnose immer dann gestellt werde, wenn die Psychiater nicht wissen, wo sie die Patienten einordnen sollen. Ich weiß, dass das nicht stimmt, trotzdem bleibt mir das Gefühl, nicht zur Gruppe der wirklich psychisch Kranken zugerechnet zu werden, sondern nur eine »Verlegenheitsdiagnose« zu haben. Wieder einmal gehöre ich nicht dazu, diesmal bin ich, wie es scheint, nicht psychisch krank genug. Was ist schon meine »Verlegenheitsdiagnose« gegen eine Schizophrenie? Ich fühle mich persönlich angegriffen und abgewertet, vielleicht weil die Borderline-Störung zwangsläufig Teil meiner Identität ist. Ich glaube, dass es sich bei meiner Diagnose um mehr als nur eine »Krankenkassendiagnose« handelt, die die Abrechnung sicherstellt, aber nichts aussagt. Vielleicht fängt das Erklärungsproblem meiner Krankheit schon damit an, dass die Störung selten sofort klar diagnostiziert wird. In der Fachliteratur als Grenzstörung zwischen Psychose und Neurose beschrieben, erlebe ich bis heute immer wieder, dass Ärzte oder Therapeuten mir neue Diagnosen zuordnen, obwohl ich die Borderline-Störung selbst als sehr zutreffend für die Beschreibung meiner Problematik halte. Wenn ich mir meine diversen Diagnosen in den Arztberichten ansehe, denke ich, dass sehr gut die verschiedenen Facetten der Krankheit deutlich werden: Anorexia nervosa, latente Suizidalität, Medikamentenabusus, Identitätsstörung, Bulimie, Essstörungen, Panikattacken, akute Suizidalität bei depressiver Entwicklung, Laxantienabusus, Verhaltensstörung, psychogenes Erbrechen, Depression, multiple Suizidversuche, komplexe frühe Störung mit multiplen Symptomen und 17 Beschwerden, multiple Schnittwunden, akute Belastungsreaktion, Psychose, Borderline-Störung, Posttraumatisches Belastungssyndrom, dissoziative Störung und schließlich Borderline-Persönlichkeit mit ausgeprägt autoaggressiver Tendenz bei Drogen- und Tablettenabusus, latenter Suizidalität und Bulimie. So lauten die medizinischen Umschreibungen für mein Erleben. Ich selbst halte die Borderline-Störung für eine lebensgefährliche Erkrankung. Es hat für mich Zeiten gegeben, in denen ich nicht in der Lage war, meinen Alltag zu bewältigen, ohne eine Überdosis Tabletten oder Rasierklingen bei mir zu haben. Ich habe viele Stunden an Bahngleisen gestanden mit der Überlegung, meinem 18 Leben ein Ende zu setzen. Ich habe versucht, mir die Pulsadern aufzuschneiden und mich zu strangulieren. Der Gedanke, mein Leben beenden zu können, wenn ich das »Spiel des Lebens« nicht mehr aushalte, lässt mich letztlich überleben. Der Einsatz meines Lebens als Fluchtversuch aus der Verzweiflung oder um unbewusst Beziehungen auf ihre Tragfähigkeit zu testen hätte mit einem gelungenen Suizid enden können. Ich weiß, dass ich ohne die Psychiatrie heute nicht mehr leben würde. Das »Verrückte« an der Beschreibung meines Erlebens der Borderline-Störung ist vielleicht, dass ich mich selbst nie als krank empfunden habe. Daher kann ich auch schwer sagen, ob ich jetzt gesund bin. Ich denke, dass mein Empfinden irgendwie anders war und ist als das der »Normalen«. Was den Unterschied macht, kann ich schwer erklären. Empfinden ist immer subjektiv. Vielleicht bin ich empfindlicher. Nicht »normal« ist wahrscheinlich, dass ich mir ein Leben ohne Angst nicht vorstellen kann. Ich habe wahnsinnige Angst vor Menschen und vor Situationen, in denen ich auf mich gestellt bin. Paradoxerweise bin ich gut an