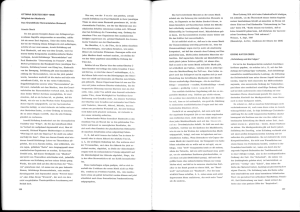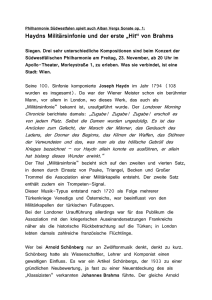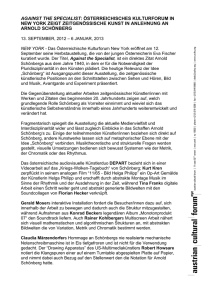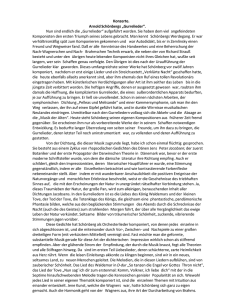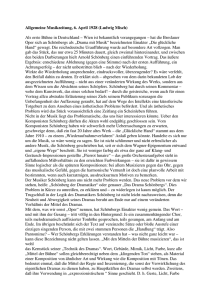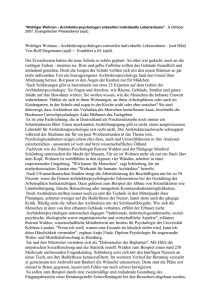Die »Harmonielehre« (1911/22) – Ansichten eines atonalen
Werbung

Die »Harmonielehre« (1911/22) – Ansichten eines atonalen Wagnerianers Die Entwicklung der harmonischen Kunstmittel erklärt sich vor allem dadurch, daß ein Vorbild bewußt oder unbewußt nachgeahmt wird und daß jede so entstehende Nachahmung wieder Vorbild werden und wieder nachgeahmt werden kann.1 Es ist wohl keine Übertreibung, wenn die Harmonielehre gelegentlich als musiktheoretisches Hauptwerk Schönbergs bezeichnet wird2; tritt sie doch aus der Fülle der musiktheoretisch orientierten Arbeiten des Komponisten allein schon ob ihres nicht nur für eine Harmonielehre gewaltigen Umfangs hervor. Ungleich geeigneter zur Rechtfertigung eines solchen Diktums erscheinen allerdings die inhaltlichen Charakteristika des Buches. Hier sticht insbesondere ein zwischen Bekenntnishaftigkeit und Apodiktik schwankender Tonfall ins Auge, der seinen Grund in der eigentümlichen Positionierung der Schrift hat: Nicht nur auf das enge Metier der Akkordverbindung und ihrer Prinzipien sich beschränkend, sondern auch grundsätzliche Fragen der Kunst grundsätzlich behandelnd, erweist sich die Schrift als künstlerisches Credo par excellence3. Dieses mündet bisweilen in eine Abrechnung mit den Prinzipien und Ansprüchen einer (im mehrfachen Wortsinn) konservatorischen Musiktheorie, bisweilen in eine Rechtfertigungs-Propaganda zugunsten Neuer Musik, die immer aber getragen werden von einem umfassenden Bekenntnis zur großen abendländischen Musiktradition. 1 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 462, Zeile 18–22 2 Vgl. diesbezüglich etwa VOJTĔCH, Ivan: Vorwort, S. IX, in: Schönberg, Arnold: Stil und Gedanke, S. IX–XVIII. 3 Das fiel offensichtlich schon den Zeitgenossen auf. Jedenfalls sah sich der Chefredakteur einer Musikzeitschrift zu der emphatischen Feststellung veranlaßt: »Hier hat Schönberg mit strengster Sachlichkeit, mit der Frische, Unmittelbarkeit und Wahrhaftigkeit eines aus der Erfahrung Schöpfenden Gedanken niedergelegt, die durch ihren [...] Gehalt und durch die seltene sprachliche Vollendung ihres Ausdrucks dem Buche die Prägung eines Kunstwerks verleihen...« (FLEISCHMANN, H.R.: Biographische Skizzen moderner Musiker, Nr. 6 in: Modernes Musikleben, Oktober (1912), zitiert nach: Reich, Willi: Arnold Schönberg oder der konservative Revolutionär, S. 90) 707 Die »Harmonielehre« (1911/22) Als bezeichnend für den Anspruch des Werks darf nicht zuletzt auch der Zeitpunkt seiner Entstehung gelten: Zwischen Frühling 1910 und Juli 19114, das heißt also unmittelbar nachdem die Musik – zumindest diejenige Schönbergs – die Gefilde der (erweiterten) Tonalität verlassen hatte, die Zeit der Harmonielehre im klassischen Sinn mit ihrer engen Verbindung zur zeitgenössischen Komposition also vorbei war, gelang es dem Komponisten, seine Schrift druckreif zu entwerfen. Die zeitlichen Voraussetzungen waren somit wie geschaffen für eine letzte, umfassende Abhandlung des gesamten – nun gleichsam historisch und damit übersichtlich gewordenen – Stoffgebiets; die Situation forderte geradezu, so scheint es, einen Abgesang auf die lange abendländische Tradition tonaler Musik. Den lieferte Schönberg in gewissem Sinne auch5, ohne allerdings – wie etwa seine Zeitgenossen Oswald Spengler6 und Heinrich Schenker7, auf dessen Theorie Schönberg ausführlicher eingeht – in einen Zukunfts-Pessimismus zu verfallen, dem sich die Vergangenheit zu einer abgeschlossenen Epoche kultureller Blüte verklärt. Vielmehr beschwört Schönberg die Kontinuität und Notwendigkeit8, mit der die Entwicklung von der noch-tonalen zur atonalen (Schönberg: »pantonalen«) Musik führe9. Eine Sonderstellung gebührt der Harmonielehre allerdings nicht nur innerhalb des literarischen Œuvres ihres Verfassers, sondern auch innerhalb des musiktheoretischen Schrifttums überhaupt: Hier sind es gleichwohl nicht die dem Werk ureigenen Qualitäten, auf die wir zunächst das Augenmerk gerichtet hatten, sondern vielmehr die Wechselwirkungen mit der (praktischen) musikalischen Entwicklung, wie sie sich vornehmlich in der Rezeptionsgeschichte des Opus manifestieren, welche begründend zu nennen wären. So soll an dieser Stelle jedoch der Verweis auf die Tatsache genügen, daß die Harmonielehre zweifelsohne zu den wirkungsmächtigsten musiktheoretischen Schriften, und somit erst recht zu den wirkungsmächtigsten Harmonie4 So O.W. NEIGHBOUR in: The New Grove Dictionary of Music ..., Band 22, S. 599, rechte Spalte. Werner Breig spricht demgegenüber davon, daß die »Konzeption der Harmonielehre als Ganzes [...] aus Schönbergs Lehrtätigkeit seit 1903 erwuchs« (BREIG, Werner: Schönbergs Begriff des vagierenden Akkordes, S. 106). 5 Ivan Vojtĕch etwa spricht nicht zuletzt wohl auch in diesem Sinne treffend von »dem mächtigen, universalistisch angelegten Impuls der ›Harmonielehre‹« (VOJTĔCH, Ivan: Vorwort, S. X, in: Schönberg, Arnold: Stil und Gedanke, S. IX–XVIII) 6 Vgl. SPENGLER, Oswald: Der Untergang des Abendlandes (1918–22) 7 Vgl. SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 384, Zeile 415 ff 8 Vgl. das diesem Kapitel vorangestellte Schönberg-Zitat! 9 Theo Hirsbrunner stellt in diesem Sinne fest: »Schönberg zog in seiner Harmonielehre (1911) die Bilanz der spätromantischen Tonalität und öffnete zugleich deren Grenzen hin zur theoretisch noch nicht klar definierten Atonalität.« (HIRSBRUNNER, Theo: Deutsches und französisches Musikdenken am Beispiel von Schönberg und Messiaen, S. 72) 708 Die »Harmonielehre« (1911/22) Lehrbüchern des 20. Jahrhunderts gerechnet werden muß. Dieser Status spiegelt sich nicht so sehr in der bis auf den heutigen Tag sich fortsetzenden Zahl der Wiederauflagen, als er sich daran erweist, daß die Harmonielehre sogar auf Komponisten von einigem Einfluß war, deren Schaffen vorderhand als nicht oder nur wenig beeinflußt von den Kompositionen Schönbergs gilt10. Wesentlich, insbesondere aus der Perspektive der hier zu bearbeitenden Themenstellung, erscheint das bereits erwähnte Bekenntnis zu abendländischen Musiktradition, das die Harmonielehre, gleichsam als einer ihrer »Grundpfeiler«, teils explizit, teils implizit von Anfang bis Ende durchzieht. Zum Bereich dieser »Traditionsbezogenheit«, wenngleich denselben in gewisser Hinsicht sprengend, gehören auch die außerordentlich zahlreichen Bezugnahmen auf Richard Wagner: Dem »Namenregister« am Ende der Harmonielehre zufolge wird offenbar nur der Name Bachs häufiger erwähnt, was dieser wohl einzig dem Umstand zu verdanken hat, daß in dem Kapitel »Choral-Harmonisierung« einem seiner Choräle der Monopol-Status zugebilligt wird, das einzige Literatur-Beispiel zu sein, sowie der Tatsache, daß diejenigen, nicht seltenen Fälle, in denen Schönberg Wagner zitiert, ohne einen Zitat-Nachweis zu bringen (wie wohl meistens beim Zitieren wörtlicher Rede), mithin also ohne den Namen »Wagner« überhaupt zu erwähnen11(!), im Register nicht aufgelistet sind. Die Bezugnahmen auf Wagner sind naturgemäß unterschiedlichen Charakters; es lassen sich hier zumindest drei Arten von Bezügen unterscheiden: 1. Direkte Referenzen, die sich vornehmlich in Namensnennungen, Erwähnungen der Werke des Meisters, Zitaten, sowie im Verweis auf Sachen bestehen, die unmittelbar mit dem Namen Wagners in Zusammenhang stehen. 2. Einflüsse Wagners auf Ideen, Vorstellungen, Prinzipien, Ästhetik usw., kurz: auf das Denken Schönbergs. 3. Kongruenzen zu Wagner bzw. seinem Werk, wie sie sich in der Haltung, der Vorgehensweise, der Intention o.ä. Schönbergs zeigen. Die »Harmonielehre« (1911/22) 10 So etwa auf Carl Orff (vgl. THOMAS, Werner: Carl Orff und sein Werk, Band 1, S. 44). 11 Wenngleich sich Schönberg offenbar prinzipiell von der Pflicht entbunden sieht, genaue Quellennachweise zu liefern, so verzichtet er doch gleichwohl in der Regel nicht auf eine einfache namentliche Referenz! Allerdings kennzeichnend er seine Haltung wohl recht deutlich, wenn er ausführt: »Als Musiker, der es nicht zusammengelesen hat, sondern, was er vorträgt, als Denkresultat seiner Lehr- und Komponiererfahrungen bezeichnen darf, bin ich wohl berechtigt, mich der in wissenschaftlichen Werken üblichen Quellenangaben zu entbinden. Einer so zeitraubenden und unfruchtbaren Arbeit mag sich der unterziehen, dessen Verhältnis zum Lebendigen der Kunst schwächer ist als zum Theoretischen.« (SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 11, Zeile 168–174) 709 Die »Harmonielehre« (1911/22) Diese Aufzählung spiegelt durchaus eine Art Rangfolge wider, eine Hierarchie der Plausibilität: So darf im Falle dessen, was ich als »direkte Referenz« (1) definiert habe, wohl von einer eindeutigen, unbestreitbaren Bezugnahme auf Wagner gesprochen werden, wogegen ein solcher Bezug in dem Fall, daß irgendwo ein »Einfluß« Wagners erkennbar scheint, naturgemäß eher im Bereich des Wahrscheinlichen liegt. Von mir entdeckte »Kongruenzen« zu Wagner können demgegenüber rein zufällig bedingt sein, zeugen also womöglich nur vermeintlich von einem Einfluß Wagners; hierbei handelt es sich vorwiegend um Hypothesen, die im Bereich des Plausiblen, vielleicht nur des Möglichen liegen. Auf eine Darstellung und Erläuterung der letzteren kann darum hier verzichtet werden. Wenn wir im Folgenden auch versuchen, unsere Untersuchung anhand der soeben erläuterten Einteilung vorzunehmen, so soll das nicht darüber hinwegtäuschen, daß diese einer gewissen Willkür nicht entbehrt, ja nicht entbehren kann, insofern nämlich die Übergänge zwischen den einzelnen Beispielen fließend sind, was (überdies) eine definitive Zuordnung zu der einen oder anderen Kategorie erschwert. Einer durch solche Einteilung der zahlreichen Beispiele erreichten größeren Übersichtlichkeit der Gliederung wurde der Vorzug gegeben gegenüber einer sozusagen demokratischen, unverbundenen Gegenüberstellung von Einzelfällen (die aufgrund der hohen Zahl der Fälle dennoch nicht ganz ausbleiben konnte). Direkte Referenzen Direkte Referenzen Zu den »Meistersingern« (I) Die ersten deutlichen Bezüge zu Wagner finden sich bereits im ersten, einleitenden Kapitel (»Theorie oder Darstellungssystem«), das über Prinzipien und Voraussetzungen, mithin über die Möglichkeit eines HarmonieLehrbuchs überhaupt spekuliert. Schönberg nutzt die Gelegenheit zu einer ersten Abrechnung mit den ihm verhaßten Musiktheoretikern und -ästheten, die in mehrfacher Hinsicht Bezug auf Wagner, insbesondere seine Oper Die Meistersinger nimmt: »Warum nennt sich [...] ein Tischlermeister nicht auch Theoretiker, oder ein Musiktheoretiker sich nicht Musikmeister? Weil da ein kleiner Unterschied ist: der Tischler dürfte nie sein Handwerk bloß theoretisch verstehen, während der Musiktheoretiker vor allem gewöhnlich praktisch nichts kann; kein Meister ist. Und noch einer: der wahre Musiktheoretiker schämt sich des Handwerks, weil es nicht das s e i n e , sondern das a n d e r e r ist. Das zu verbergen, ohne aus der Not einer Tugend zu machen, genügt ihm nicht. Der Titel: Meister ist entwertet; man könnte verwechselt werden – ein dritter Unterschied – dem vornehmeren Beruf muß ein vornehmerer Titel entsprechen und darum hat die Musik, obwohl der große Künstler auch heute noch ›Meister‹ angesprochen wird, nicht, wie sogar die Malerei, einfach eine Handwerkslehre, sondern ei- 710 Direkte Referenzen nen Theorie-Unterricht. [...] Aber sie [die Theorie] will mehr sein. Sie will nicht sein: der Versuch, Gesetze zu finden; sie behauptet: d i e e w i g e n Gesetze gefunden zu haben. Sie betrachtet eine Anzahl von Erscheinungen, ordnet sie nach einigen gemeinsamen Merkmalen und leitet daraus Gesetze ab. [...] Aber nun beginnt der Fehler. Denn hier wird der falsche Schluß gezogen, daß die Gesetze, weil sie für die bisher beobachteten Erscheinungen scheinbar zutreffen, nunmehr auch für alle zukünftigen Erscheinungen gelten müßten. Und das Verhängnisvollste: man glaubt einen M a ß s t a b zur Ermittlung des Kunstwerts auch künftiger Kunstwerke gefunden zu haben. So oft auch die Theoretiker von der Wirklichkeit desavouiert wurden, wenn sie für unkunstmäßig erklärten, ›was nicht nach ihrer Regeln Lauf‹, können sie doch ›vom Wahn nicht lassen‹. Denn was wären sie, wenn sie nicht wenigstens die Schönheit gepachtet hätten, da doch die Kunst nicht ihnen gehört? [...] Was wären sie, da die Kunst sich in Wirklichkeit doch durch die Kunstwerke fortpflanzt und nicht durch die Schönheitsgesetze? Wäre da wirklich noch ein Unterschied zwischen ihnen und einem Tischlermeister zu ihren Gunsten?«12 Diese mit einem ordentlichen Schuß Polemik und Ironie gewürzte Attacke gegen die Vertreter einer – wie Schönberg meint – falsch verstandenen Kunsthandwerkslehre verweist, wie schon angedeutet, in zweierlei Hinsicht auf Wagners Meistersinger. Und zwar zum einen durch die ausführliche Reflexion über Sinn und Berechtigung des Meistertitels, zum anderen durch die beiden mehr oder weniger wörtlichen Zitate der Figur des Meistersingers Hans Sachs13. Die eigentliche Stoßrichtung der Schönberg’schen Argumentation, für welche die Diskussion um den Meistertitel eigentlich zunächst nur den »Aufhänger« bildet, besteht in der Proklamation und Begründung einer Abkehr von der »klassischen« Musiktheorie. Der Komponist respektive Künstler, der sich herabläßt, eine Harmonielehre, ein Übungsbuch also, zu verfassen, will nicht »in einen Topf geworfen« werden mit der für solche Dinge generell zuständigen Berufsgruppe und dem von dieser selbst geprägten Berufsbild des Musiktheoretikers; vielmehr versucht er, sich in die Tradition eines Kunstverständnisses, ja eines Kunst-Credos zu stellen, wie es sich in Wagners Meistersingern manifestiert. Das eigentlich ist es, so scheint mir, was Schönberg deutlich machen will, indem er mit der Diskussion um den Meistertitel einen auch in den Meistersingern ausführlich behandelten Problem-Komplex aufgreift und diesen auf die für ihn selbst aktuelle Frage nach Aufgabe, Berechtigung und Anspruch einer zeitgenössischen Musiktheorie transferiert. Die bereits gekennzeichnete Haltung, welche Schönberg hierbei einnimmt, gewinnt somit eine gewisse Analogie zu derjenigen, die Walther 12 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 1 (Zeile 25)–S. 3 (Zeile 90); Hervorhebungen im Fettdruck von mir, C.G. 13 Genauere Angaben folgen später! 711 Die »Harmonielehre« (1911/22) von Stolzing gegen Ende der Meistersinger erkennen läßt, als man ihm, ob des von ihm gewonnenen Sänger-Wettstreits, den Meistertitel anträgt: »Nicht Meister! Nein! Will ohne Meister selig sein!«14 Wagners Gegenbewegung: »Verachtet mir die Meister nicht, und ehrt mir ihre Kunst!«15, der Figur des Hans Sachs als Reaktion auf die despektierliche Äußerung Stolzings in den Mund gelegt, vollzieht Schönberg dagegen nur bedingt mit. Er unterscheidet zwischen berechtigtem Suchen nach Gesetzen der Kunst und dem unberechtigten Anspruch, »d ie ewig e n Gesetze gefunden zu haben«16 sowie der damit verbundenen Konsequenz, daß die Musiktheorie (auch) die lebendige, im Entstehen begriffene Kunst in das Prokrustes-Bett dieser vermeintlich ewig gültigen Richtlinien zwingen will. Schönberg wehrt sich gegen die Tendenzen der Musiktheorie, ein empirisch – d.h. durch Betrachtung bzw. Analyse von Kunstwerken – gewonnenes Regelsystem zum normativen Maßstab auch für alle künftigen Kunstwerke zu erheben. Er verteidigt, kurz gesagt, das Primat des Kunstwerks gegenüber der Kunsttheorie, des Musikers gegenüber dem Musiktheoretiker und erhebt somit das Postulat einer autonomen Kunst17, die nicht den Gesetzen irgendeiner (früheren) Ästhetik unterliegt. Die der Proklamation einer solchen Haltung zugrundeliegende Intention besteht allerdings wohl nicht – wie es oft scheinen mag und wie Schönberg seine Leser gelegentlich glauben zu machen sucht – allein darin, einer idealistischen Überzeugung um ihrer selbst willen Gehör zu verschaffen, sondern dürfte in nicht geringem Maße auch in der Absicht zu sehen sein, auf diese Weise eine Rechtfertigung der eigenen Kunst, die ja zum Zeitpunkt der Entstehung der Harmonielehre bekanntlich bereits die Pfade einer von der Musiktheorie bis dahin verfochtenen regulären Tonalität verlassen hatte, vorzubringen. Schließlich mag hier nicht zuletzt auch Schönbergs Haß auf die Kritiker seiner Werke – meist in Personalunion 14 WAGNER, Richard: Die Meistersinger, Sämtliche Werke, Band 9, III, 3. Aufzug, 5. Szene, Takt 2763–2766 15 WAGNER, Richard: Die Meistersinger, Sämtliche Werke, Band 9, III, 3. Aufzug, 5. Szene, Takt 2771–2776 16 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 3 (Zeile 73) 17 Die damit aufs engste verknüpfte Vorstellung einer selbstzweckhaften Kunst taucht bei Schönberg auch später öfter auf; vgl. diesbezüglich etwa SCHÖNBERG, Arnold: Stil und Gedanke (Neue Musik...), S. 34 oder: SCHÖNBERG, Arnold: Stil und Gedanke (Zum Rundgespräch in San Francisco...), S. 394/395, wo er seine Haltung offenbar zugunsten politisch engagierter Musik relativiert. Bereits Hermann Danuser hat – in Rekurrenz auf Wagners Text Deutsche Kunst und deutsche Politik (WAGNER, Richard: Gesammelte Dichtungen Band 8, S. 96) – erkannt, daß Schönberg mit dieser Haltung, die er mit dem Begriff einer deutschen Musik in Verbindung bringt, auf Richard Wagner fußt; vgl. DANUSER, Hermann: Arnold Schönberg und die Idee einer deutschen Musik, S. 29 712 Direkte Referenzen auch Musiktheoretiker – eine Rolle spielen, die er offenbar – wie seinerzeit Wagner18 – mit dem Klischee eines »Meister Beckmesser« zu identifizieren pflegt. Einen deutlichen Hinweis auf Wagner, das soll an dieser Stelle noch vermerkt sein, verbirgt der ebenfalls im Kontext der Meistertitel-Diskussion stehende Neben-Satz: »obwohl der große Künstler auch heute noch ›Meister‹ angesprochen wird«. Und zwar verweist diese Stelle insofern auf Wagner, als dieser im späten 19. Jahrhundert wohl der einzige Komponist war, der öffentlich als »Meister« angesprochen wurde, mithin der gesamten Musikwelt als solcher im Bewußtsein stand. Auf ein Verständnis seiner Anspielung durfte Schönberg also beim zeitgenössischen Leser durchaus rechnen, sofern denn dieser – wie Schönberg selbst – ein gutes Dezennium des 19. Jahrhunderts bewußt miterlebt hatte. Was nun die beiden von Schönberg verwendeten direkten Zitate aus den Meistersingern anbelangt, so wurden diese signifikanterweise in einem einzelnen Satz zusammengefaßt, der hier – zur Erinnerung – noch einmal angeführt sei: »So oft auch die Theoretiker von der Wirklichkeit desavouiert wurden, wenn sie für unkunstmäßig erklärten, ›was nicht nach ihrer Regeln Lauf‹, können sie doch ›vom Wahn nicht lassen‹.«19 Schönberg verzichtet hier – wie meistens, wenn er aus Wagner-Opern zitiert! – auf einen Nachweis der Textstelle20. Er überläßt es somit dem Leser, die Provenienz der Zitate zu erraten. Jedoch erscheint es natürlich – jedenfalls dem Wagner-Kenner – im Kontext der bereits näher beleuchteten Meistertitel-Diskussion naheliegend, daß sie den die nämlichen Fragestellungen berührenden Meistersingern entstammen. Wer dies genauer nachprüft, wird allerdings überrascht sein: Das erste der beiden Zitate nämlich ist offenbar ein wörtliches, das zweite jedoch nicht! Möglicherweise zitierte Schönberg also aus dem Gedächtnis, was sowohl die Fehlerhaftigkeit respektive Ungenauigkeit des letztern begründen, als auch den (dann Arbeit ersparenden) Verzicht auf einen genauen Nachweis der entsprechenden Textstellen erklären könnte. 18 Bekanntlich hatte Wagner ja anfangs geplant, die Figur des »Sixtus Beckmesser« – mit Referenz auf den wirkungsmächtigsten Kritiker seiner Zeit, Eduard Hanslick, der insbesondere auch ein eifriger Gegner des Wagner’schen Œuvres war – »Hans Lick« zu nennen, wovon ihn bedauerlicherweise offenbar einige seiner Freunde abbringen konnten. 19 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 3 (Zeile 81–84); Hervorhebungen von mir, C.G. 20 Vgl. diesbezüglich meine Ausführungen im Rahmen der Einleitung des vorliegenden (Groß-)Kapitels Die »Harmonielehre«! 713 Die »Harmonielehre« (1911/22) Zunächst zum ersten, wörtlichen Zitat. Es entstammt der dritten Szene des ersten Akts der Oper: Nachdem Walther von Stolzing in der »Singschul« vorgesungen hat, um in die Meistergilde aufgenommen zu werden, und die Meister in der Folge scharfe Kritik an seinem Vortrag üben, der in keiner Weise den üblichen Regularien – der »Tabulatur« – entsprach, ergreift Meister Sachs das Wort: »Halt Meister, nicht so geeilt! Nicht jeder eure Meinung teilt. Des Ritters Lied und Weise, sie fand ich neu, doch nicht verwirrt; verließ er unsre Gleise, schritt er doch fest und unbeirrt. Wollt ihr nach Regeln messen, was nicht nach eurer Regeln Lauf, der eignen Spur vergessen, sucht davon erst die Regeln auf!«21 Indem nun Schönberg also einen Teil dieser Rede zitiert, stellt er sich bewußt in die Tradition Wagners. Er identifiziert sich gewissermaßen mit der Figur des Hans Sachs und mit dessen Plädoyer für eine neue, von äußeren Regeln befreite, d.h. autonome Kunst, welcher zudem insofern Priorität gegenüber jeglicher Theorie zukomme, als diese von ihr »erst die Regeln auf [-zusuchen]« habe. Ganz analog zur Argumentationsstrategie der Sachs’schen Rede verläuft auch Schönbergs Konzept einer Theorie-Kritik: Musiktheorie wolle eben mehr sein als bloß »der Versuch, Gesetze zu finden«22, wie Wagner ihn ihr zur Aufgabe macht, sie nehme vielmehr für sich in Anspruch, »d ie ewig en Gesetze [...] [als] Maß stab zur Ermittlung des Kunstwerts auch künftiger Kunstwerke gefunden zu haben.«23 Hier wird also – so sieht es Schönberg im Anschluß an Wagner – von der Musiktheorie die richtige Reihenfolge auf den Kopf gestellt: Die Theorie spricht sich selbst die Priorität zu, indem sie beansprucht, Gesetze und Regularien aufzustellen, nach denen die Kunst sich dann zu richten habe, versteigt sich gleichsam in die Gefilde der Ästhetik, während »die Kunst sich in Wirklichkeit doch durch die Kunstwerke fortpflanzt und nicht durch die Schönheitsgesetze«24! Nun zum zweiten Zitat. Obwohl es, wie oben angemerkt wurde, in der von Schönberg gebrauchten Form offenbar nicht wörtlich den Meistersingern entstammt, verweist es doch mit ziemlicher Deutlichkeit auf einen weiteren für die Oper konstitutiven Themenkomplex, den des »Wahns«. Als entschiedenste Artikulation desselben muß der bezeichnenderweise sogenannte »Wahn-Monolog«25 des Hans Sachs angesprochen werden, erscheinen hier doch der Kontext, in dem der »Wahn«-Begriff bei Wagner steht und somit 21 WAGNER, Richard: Die Meistersinger, Sämtliche Werke, Band, 1. Aufzug, 3. Szene, Takt 1878–1898; Hervorhebungen von mir, C.G. 22 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 3 (Zeile 72/73) 23 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 3 (Zeile 73–81) 24 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 3 (Zeile 87–89) 25 WAGNER, Richard: Die Meistersinger, Sämtliche Werke, Band 9, 3. Aufzug, 1. Szene, Takt 301ff 714 Direkte Referenzen auch die mit diesem verbundenen respektive zu verbindenden Konnotationen am stärksten herausgearbeitet. Die äußere Situation der Szene besteht hier bekanntlich darin, daß Sachs, mit sich selbst und seinem Schicksal hadernd, und dementsprechend in einer als melancholisch bis sentimental zu charakterisierenden Stimmung verfangen, seinen Blick auf den Lauf der (Welt-) Geschichte lenkt und – aus seiner pessimistisch gefärbten Perspektive heraus – nach der dieser letztlich zugrundeliegenden Kraft und der diese bedingenden Ursache Ausschau hält. Er glaubt sie schließlich im »Wahn« gefunden zu haben: »Wahn! Wahn! Überall Wahn! Wohin ich forschend blick’ in Stadt- und Weltchronik, den Grund mir aufzufinden, warum gar bis aufs Blut die Leut’ sich quälen und schinden in unnütz toller Wut? Hat keiner Lohn noch Dank davon: in Flucht geschlagen wähnt er zu jagen; hört nicht sein eigen Schmerzgekreisch, wenn er sich wühlt ins eigne Fleisch, wähnt Lust sich zu erzeigen! Wer gibt den Namen an? ’s ist halt der alte Wahn, ohn’ den nichts mag geschehen, ’s mag gehen oder stehen! Steht’s wo im Lauf, er schläft nur neue Kraft sich an; gleich wacht er auf, dann schaut, wer ihn bemeistern kann!«26 Vor allem der letzte Satz kann wohl als sinngemäße Entsprechung dem von Schönberg in seinem Zitat verwendeten Wortlaut gegenübergestellt werden, zeichnet er doch eine retardierende Bewegung nach, die dem von Schönberg zitierten Gestus des »Vom-Wahn-nicht-Lassens« gleichkommt: ein Abschlaffen des Wahns, das sich dann aber letztlich doch nur als »Schlaf« entpuppt, aus dem der Wahn dann mit »neuer Kraft« hervorgeht. Indem nun Schönberg den überzogenen Anspruch der (herkömmlichen) Musiktheorie mit solchem gleichsam »immerwährenden« Wahn identifiziert, verleiht er einerseits seinem Pessimismus Ausdruck, daß dieser Theorie-Wahn nicht gestoppt werden kann, andererseits versieht er letzteren auf diese Weise auch zugleich mit dem Stigma des genuin Indiskutablen, Nicht-Ernst-zuNehmenden. Von der gleichen Intention zeugen auch die dem Zitat unmittelbar folgenden Sätze Schönberg: »Denn was wären sie [die Theoretiker], wenn sie nicht wenigstens die Schönheit gepachtet hätten, da doch die Kunst nicht ihnen gehört? Was wären sie, wenn es für alle Zeiten jedem klar würde, was hier wieder einmal einer zeigt?«27 Ob Schönberg mit diesem »einer« nun den unmittelbar vorher mehrfach zitierten Wagner meint oder sich selbst – was ihm auch zuzutrauen wäre! – erscheint zweitrangig. Die beiden Wagner-Zitate – seien sie wörtlich oder sinngemäß – weisen allein schon in größtmöglicher Deutlichkeit daraufhin, 26 WAGNER, Richard: Die Meistersinger, Sämtliche Werke, Band 9, III, 3. Aufzug, 1. Szene, Takt 305–534 27 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 3 (Zeile 84–87) 715 Die »Harmonielehre« (1911/22) daß sich Schönberg mit seinem Kunst-Begriff und seinen sich um diesen »rankenden« Anschauungen in der Tradition Wagners versteht, verstanden wissen will. Die in den Text eingegliederten und zumal ob ihrer Kürze äußerlich unscheinbaren Zitate bilden somit nur die Oberfläche eines tiefergehenden Bekenntnisses: Im Anschluß an Wagner tritt Schönberg ein für eine freie, autonome Kunst und damit gegen eine Musiktheorie, deren Ansprüche ihre faktischen Möglichkeiten übersteigen, d.h. gegen eine Musiktheorie, die neben Empirie und Historizität auch Normativität beansprucht. Die Unscheinbarkeit der Wagner-Zitate, zu der auch der Verzicht auf einen Nachweis ihrer Provenienz beiträgt, zeigt schließlich, daß Wagner von Schönberg als selbst-verständliche Autorität in Fragen der Kunst wahrgenommen wird, die eigene Thesen wirkungsvoll zu untermauern, eigene (atonale) Schöpfungen zu rechtfertigen vermag. Zu den »Meistersingern« (II) Die nächsten deutlichen Bezüge zu Wagner – wiederum Verweise auf die Meistersinger – finden sich nur wenige Seiten später zu Beginn des Kapitels »Die Durtonart und die leitereigenen Akkorde«28, mit welchem Schönberg versucht, die historischen Entwicklung »unserer« Dur-Skala nachzuzeichnen respektive zu motivieren. Wichtig erscheint es ihm hierbei offenbar, auch den Stellenwert einer solchen (Dur-)Tonleiter – zumal im Horizont einer künftigen musikalischen Entwicklung – einige Gedanken zu widmen: »Die Auffindung unserer Skala war für die Entwicklung unserer Musik ein Glücksfall. [...] [Aber] diese Tonreihe allein ist es nicht, der wir die Entwicklung zu danken haben. Und vor allem: diese Tonreihe ist nicht das Letzte, das Ziel der Musik, sondern eine vorläufige Station. Die Obertonreihe, die das Ohr zu ihr geführt hat, enthält noch viele Probleme, die eine Auseinandersetzung nötig machen werden. Und wenn wir diesen Problemen augenblicklich noch entrinnen, so verdanken wir das fast ausschließlich einem Kompromiß zwischen den natürlichen [= reinen] Intervallen und unserer Unfähigkeit, sie zu verwenden. Jenem Kompromiß, der sich temperiertes System nennt, das einen auf eine unbestimmte Frist geschlossenen Waffenstillstand darstellt. Diese Reduktion der natürlichen Verhältnisse auf handliche wird aber die Entwicklung auf die Dauer nicht aufhalten können; und das Ohr wird sich mit den Problemen befassen müssen, w e i l e s w i l l . Dann wird unsere Skala ebenso aufgehen in eine höhere Ordnung, wie die Kirchentonarten in der Dur- und Molltonart aufgegangen sind. Ob dann Viertel-, Achtel-, Drittel- oder (wie Busoni meint) Sechsteltöne kommen [...], läßt sich nicht voraussagen. Vielleicht wird diese neue Teilung der Oktave sogar untemperiert sein und mit unserer Skala nur noch wenig gemeinsam haben. Jedenfalls erscheinen Versuche, in Viertel- oder Dritteltönen zu 28 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 19 ff 716 Direkte Referenzen komponieren, wie sie hie und da unternommen werden, mindestens solange zwecklos, als es zu wenig Instrumente gibt, die sie spielen könnten. Wahrscheinlich, wenn Ohr und Phantasie dafür reif sein werden, wird die Reihe und werden die Instrumente mit einem Schlag da sein. Sicher ist, daß diese Bewegung heute vorhanden ist, sicher, daß sie zu einem Ziel führen wird. Mag sein, daß auch hier viele Umwege und Irrtümer zu überwinden sein werden, daß auch diese zu Übertreibungen oder zu dem Wahn führen werden, es sei nun das Endgültige, Unveränderliche gefunden. Vielleicht wird man auch hier zur Aufstellung von Gesetzen und Tonleitern gelangen und denen eine ästhetische Ewigkeitsbedeutung zumessen. Für den Weitblickenden bedeutet auch das nicht das Ende. Er erkennt: jedes Material kann kunstfähig sein, wenn es soweit klar ist, daß man es seinem mutmaßlichen Wesen entsprechend bearbeiten kann; aber doch nicht so klar, daß der Phantasie nicht noch in den unerforschten Bezirken Raum bliebe [...]. Und da uns noch die Hoffnung bleibt, daß unserem Verstande die Welt noch lange ein Rätsel sein wird, ist wohl allen Beckmessern zum Trotz noch nicht das Ende der Kunst da.«29 Zwei Stellen sind es, die hier (wiederum) auf die Meistersinger verweisen. Die erste muß im Kontext eines der oben behandelten Zitate30 verstanden werden: Schönberg, der im Zuge der musikalischen Entwicklung eine Überwindung des etablierten temperierten Tonsystems sowie der bewährten Durund Mollskalen für wahrscheinlich, ja sogar notwendig hält, warnt hier davor, daß solche zunächst modern erscheinenden Entwicklungen wie etwa der Rekurs auf Drittel- bzw. Vierteltonskalen, den er als Beispiel anführt, möglicherweise »zu Übertreibungen oder zu dem Wahn führen werden, es sei nun das Endgültige, Unveränderliche gefunden.«31 Indem er hier erneut den aus den Meistersingern entlehnten Begriff des »Wahns« bemüht32, verweist Schönberg auf seine eigene, einige Seiten zuvor entworfene Kritik an einer »ewige Gesetze« postulierenden, konservativen Musiktheorie. Er transponiert somit seine sich inhaltlich gleichbleibende Kritik auf einen anderen Fall: War es zunächst eine eher konservative, in ihren Ansprüchen hybride Musiktheorie, die den Gegenstand derselben bildete, so sind es nun eher fortschrittliche, dafür aber wohl ähnlich apodiktische Musikdenker33, die Schönberg im Vi29 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 22 (Zeile 84)–25 (Zeile 128); Hervorhebungen in Fettdruck von mir, C.G. 30 Vgl. in der vorliegenden Arbeit das Kapitel »Die ›Harmonielehre‹ – Direkte Referenzen – Zu den ›Meistersingern‹ (1)«. 31 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 25 (Zeile 117/118); Hervorhebungen in Fettdruck von mir, C.G. 32 Vgl. in der vorliegenden Arbeit das Kapitel »Die Harmonielehre – Direkte Referenzen – zu den ›Meistersingern‹ (1)«. 33 Besondere Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang der explizite Verweis auf (Ferruccio) Busoni! 717 Die »Harmonielehre« (1911/22) sier hat. Bemerkenswerterweise läßt der Autor hier also eine Art Skeptizismus auch gegen eine in ihren Inhalten progressive Musiktheorie erkennen, insofern sie denn dogmatische Tendenzen gewärtigen läßt. Nicht so sehr die Unterscheidung in progressiv und konservativ bildet demnach für Schönberg das entscheidende Kriterium, nach dem es den Wert eines musiktheoretischen Konzepts zu bemessen gilt, als vielmehr die Frage nach dem Anspruch: Jede dogmatische Fixierung auf ein bestimmtes System ist abzulehnen, denn – in dieser positiven These versucht Schönberg seine Kritik aufgehen zu lassen – »jedes Material kann kunstfähig sein, wenn es soweit klar ist, daß man es seinem mutmaßlichen Wesen entsprechend bearbeiten kann; aber doch nicht so klar, daß der Phantasie nicht noch in den unerforschten Bezirken Raum bliebe [...]34. Der Komponist bezieht hiermit selbst (theoretische) Position; eine Position, an der insbesondere zwei Aspekte auffallen. Während er zunächst mit dem Postulat »jedes Material kann kunstfähig sein« unmißverständlich gegen jede Form von Dogmatismus zu Felde zieht, erscheint demgegenüber das Folgende als Einschränkung: Voraussetzung der Kunstfähigkeit eines Materials sei »Erschlossenheit« sowie »Unerforschtheit«, zwei einander widersprechende Momente also, denen beiden bis zu einem gewissen Grad Rechnung getragen werden soll. Was zunächst paradox wirkt, läßt sich als ein Rigorismus verstehen, der faktisch einer Art Mittelweg gleichkommt. Die Forderung nach einem Moment der »Erschlossenheit« – das Material muß »soweit klar [...] [sein], daß man es seinem mutmaßlichen Wesen entsprechend bearbeiten kann«35 – richtet sich nämlich gegen eine totale Progressivität, die zu musikalischem Material erklärt, was noch gar nicht erschlossen wurde, somit im Rahmen eines Kompositionsprozesses auch nicht beherrscht, nicht verarbeitet werden kann36. Andersherum fungiert das von Schönberg postulierte Moment des »Unerforschten« – das Material darf »aber doch nicht so klar [sein], daß der Phantasie nicht noch in den unerforschten Bezirken Raum bliebe«37 – wohl als Negation eines totalen Konservatismus, der an dem bis zum Überdruß Bekannten, Abgegriffenen als dem einzig gültigen Material der Musik festhalten möchte. Was zunächst als vorsichtig angeschlossene Relativierung oder gar Einschränkung des Diktums gegen allen Dogmatismus erschien, entpuppt sich somit als konsequente Fortführung im Sinne einer Ausdifferenzierung desselben. Aus der also deutlich gewordenen Grundhaltung Schönbergs heraus erklärt sich auch die zweite, auf die Meistersinger Bezug nehmende Textstelle: 34 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 25 (Zeile 122–125) 35 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 25 (Zeile 123/124) 36 In ähnlichem Sinne wurde Ferruccio Busoni – als Reaktion auf seinen Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst – von Hans Pfitzner »Futurismus« vorgeworfen (vgl. PFITZNER, Hans: Futuristengefahr (Gesammelte Schriften Band 11) sowie MEYER, Michael: Die Musik im kulturpolitischen Streit, S. 173–178)! 37 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 25 (Zeile 124/125) 718 Direkte Referenzen »Und da uns die Hoffnung bleibt, daß unserem Verstande die Welt noch lange ein Rätsel sein wird, ist wohl allen Beckmessern zum Trotz noch nicht das Ende der Kunst da.«38 Hier sind es wohl wieder die ultra-konservativen Musiktheoretiker, vor denen Schönberg warnt, indem er sie mit Meister Beckmesser identifiziert. Eisernes, dogmatisches Festhalten an alten, angelernten, vermeintlich ewig gültigen Regeln, gepaart mit einer neidisch auf den moderneren Komponistenkollegen schielenden Mißgunst – diese Eigenschaften charakterisieren die von Wagner zum Teil karikierend überzeichnete Figur des Beckmesser in den Meistersingern, und diese Eigenschaften sind es demnach wohl auch, die Schönberg an den verhaßten Musiktheoretikern am wenigsten akzeptiert. Seine explizit vorgetragene Kritik allerdings – so legt es jedenfalls die eben zitierte Textstelle nahe – setzt offenbar den Hauptakzent eher auf die den genannten Eigenschaften zugrundeliegende Hybridität der inneren Haltung, wie sie sich – auch das legt die Stelle nahe – in der Überzeugung der Musiktheoretiker manifestiert, die (musikalische) Welt endgültig »enträtselt« zu haben, bzw. sich in der von diesen mehr oder weniger apodiktisch vertretenen Behauptung äußert, das »Ende der Kunst« sei da. Speziell der Verweis auf ein solches »Ende der Kunst« läßt vermuten, daß Schönberg bei der Formulierung der entsprechenden Passage an einen Theoretiker wie etwa Heinrich Schenker39 gedacht hat, der die Vorstellung von einer ihren Zenit überschreitenden und somit zu einem »Ende« tendierenden Kunst-Entwicklung verfolgte und der auch – wenngleich an anderem Orte – von Schönberg kritisch zitiert wird40. In jedem Falle aber stellt sich die zweite Bezugnahme auf die Meistersinger zumindest äußerlich formal als ein genaues Analogon zur vorhergehenden dar. Wurde nämlich mit dieser kritisch auf die Gefahren eines (total) progressiven Konzepts hingewiesen, so steht bei jener wiederum die Kritik an einer (total) konservativen Musiktheorie im Vordergrund. Dogmatismus – ganz gleich ob progressiv oder konservativ geprägt – hat, so die auf den Punkt gebrachte Position der Schönbergs, keine Existenzberechtigung. Gleichwohl könnten auch noch andere, womöglich weniger idealistisch strukturierte Motivationen die Schönberg’sche Kritik in ihrer ambivalenten, scheinbar sich selbst entgegengerichteten Stoßrichtung mitgeprägt haben: Während die Angriffe gegen eine konservative Musiktheorie vielleicht eine ihrer Ursachen in den negativen Erfahrungen Schönbergs mit der auf nämlichem geistigen Boden gewachsenen Musikkritik um 1900 finden41, lassen 38 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 25 (Zeile 126–128); Hervorhebungen in Fettdruck von mir, C.G. 39 Vgl. SCHENKER, Heinrich: Neue musikalische Phantasien und Theorien 40 SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 384/385 41 Julius Korngold etwa, der Vater des Komponisten Erich Wolfgang Korngold und einer der maßgeblichen Musikkritiker der Zeit, wurde auf dem Wiener Konserva- 719 Die »Harmonielehre« (1911/22) sich seine Attacken gegen übermäßig progressive Konzepte möglicherweise aus einer Art Erfinder-Neid gegenüber den ihm selbst vorauseilenden Komponisten-Kollegen wie etwa Ferruccio Busoni42 erklären!? Welche Rolle aber kommt nun den Verweisen auf die Meistersinger zu? – Indem Schönberg seine Kritik an konservativer wie auch an progressiv orientierter Musiktheorie mit Begriffen aus den Meistersingern anreichert, die – zumindest zur Entstehungs-Zeit der Harmonielehre – Schlagwort-Charakter hatten, versucht er, Wagner als eine diese Kritik untermauernde bzw. rechtfertigende Autorität in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus gelingt ihm auf diese Weise auch die Stützung seiner – wie es scheint – aus solch ambivalenter Kritik erwachsenen Forderung eines undogmatischen Kunst-Verständnisses (»jedes Material kann kunstfähig sein«): Während nämlich die Beckmesser-Figur unmittelbar als Beispiel eines totalitären Dogmatismus taugt und Schönberg somit ex negativo den Meistersingern ein dem seinen kongruentes Plädoyer zu entnehmen vermag, funktioniert die Bezugnahme auf den »Wahn«-Begriff vielmehr mittelbar, nämlich als Verweis auf die schon früher vor dem Hintergrund der Meistersinger geführte Diskussion um den Theoretiker-»Wahn«. Daß Schönberg mit der Nutzbarmachung des »Wahn«Begriffs für die Kritik auch einer progressiv orientierten Musiktheorie diesen einer Umdeutung oder, wie ich es nannte, einer Transposition in einen neuen Kontext unterzieht, wie er in den Meistersingern als auch in Schönbergs eigener, früherer »Wahn-Kritik« so nicht zu erkennen war, dürfte ihm durchaus bewußt gewesen sein43. torium ausgebildet und vertrat dementsprechend(?) auch ein eher konservatives Musik-Ideal! Die Begründung der Ablehnung seines Streichsextetts Verklärte Nacht durch eine Konzertgesellschaft mit der Verwendung einer von der zeitgenössischen Musiktheorie nicht gebilligten Umkehrung eines 7-9-Akkords beispielsweise hat Schönberg anscheinend so wenig verwunden, daß er diesem Vorfall noch in seiner Harmonielehre kritisch gedenken zu müssen vermeint (vgl. SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 416/417)! 42 Zwar erwähnt Schönberg Busonis Vorschlag, Sechsteltöne zu verwenden, jedoch nur im Zusammenhang mit zahlreichen anderen Vorschlägen, so daß der Verdacht, Schönberg versuche auf diese Weise die neuen ästhetischen Ideen Busonis zu relativieren nicht unberechtigt erscheint. Erwähnung verdient in diesem Kontext auch die innerhalb der »Zweiten Wiener Schule« besonders deutlich zu beobachtende Tendenz, daß der einzelne Komponist es als wichtig erachtet, die Genese musikalisch-technischer Neuerungen/Erfindungen für sich beanspruchen zu können. Einige Fußnoten der Harmonielehre zeugen geradezu paradigmatisch von einer solchen Denkweise (vgl. SCHÖNBERG, Arnold: Harmonielehre, S. 211 und S. 138/ 139)! 43 Jedenfalls legt das die Formulierung der entsprechenden Textstelle nahe. 720