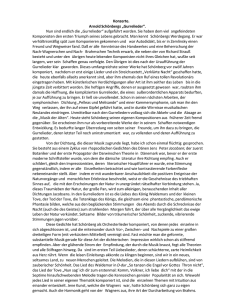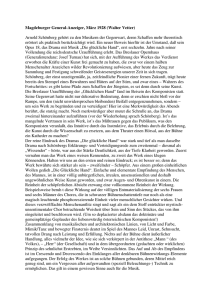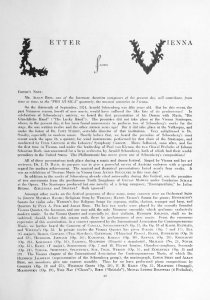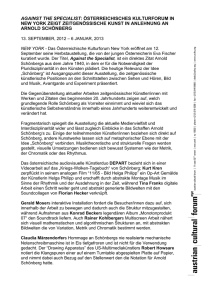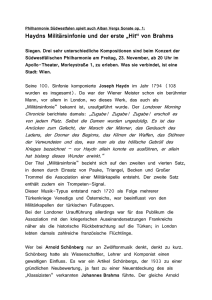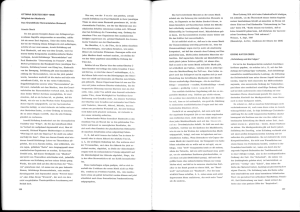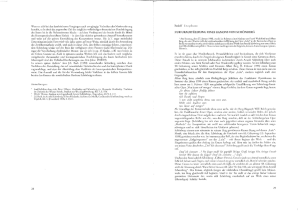Allgemeine Musikzeitung, 6. April 1928 (Ludwig Misch) Als erste
Werbung

Allgemeine Musikzeitung, 6. April 1928 (Ludwig Misch) Als erste Bühne in Deutschland – Wien ist bekanntlich vorangegangen – hat die Breslauer Oper sich an Schönbergs als „Drama mit Musik“ bezeichneten Einakter „Die glückliche Hand“ gewagt. Die reichsdeutsche Uraufführung wurde auf besondere Art vollzogen. Man gab das Stück, das nur etwa 25 Minuten dauert, gleich zweimal hintereinander, und zwischen den beiden Darbietungen hielt Arnold Schönberg einen einführenden Vortrag. Das äußere Ergebnis: entschiedene Ablehnung (gegen eine Stimme) nach der ersten Aufführung, ein Achtungserfolg – der nicht unbestritten blieb – nach der Wiederholung. Wirkte die Wiederholung ansprechender, eindrucksvoller, überzeugender? Es wäre verfehlt, den Beifall dahin zu deuten. Er erklärt sich – abgesehen von dem darin bekundeten Lob der ausgezeichneten Aufführung – nicht aus einer veränderten Wirkung des Werks, sondern aus dem Wissen um die Absichten seines Schöpfers. Schönberg hat durch seinen Kommentar – wehe dem Kunstwerk, das eines solchen bedarf! – durch die geistreiche, wenn auch für einen Vortrag allzu abstrakte Erläuterung seines Ziels seinem Publikum sozusagen die Unbefangenheit der Auffassung geraubt, hat auf dem Wege des Intellekts eine künstlerische Totgeburt zu dem Ansehen eines ästhetischen Problems befördert. Und als ästhetisches Problem wird das Stück voraussichtlich eine Zeitlang ein Scheinleben führen. Nicht in der Musik liegt das Problematische, das uns hier interessieren könnte. Ueber den Komponisten Schönberg dürften die Akten wohl endgültig geschlossen sein. Vom Komponisten Schönberg haben wir schwerlich mehr Ueberraschungen zu erwarten, geschweige denn, daß ein fast 20 Jahre altes Werk – die „Glückliche Hand“ stammt aus dem Jahre 1910 – zu einem „Wiederaufnahmeverfahren“ Anlaß geben könnte. Handelte es sich nur um die Musik, so wäre wenig zu sagen. Sie ist nicht schlimmer und nicht erfreulicher als andere Musik, die Schönberg geschrieben hat, seit er sich dem Wagner-Epigonentum entwand und „eigene Wege“ beschritt. Sie ist weniger farbig als etwa der ganz auf Klang- und Geräusch-Impressionen gestellte „Pierrot lunaire“ – das große Orchesteraufgebot steht in auffallendem Mißverhältnis zu den erreichten Farbwirkungen – sie ist dafür in gewissem Sinne logischer als die späteren Kompositionen: bei allem Musizieren gegen das Ohr, gegen das musikalische Gefühl, gegen die harmonische Vernunft ist doch eine planvolle Arbeit mit bestimmten, wenn auch kurzatmigen, ausdrucksarmen Motiven zu bemerken. Der Musiker Schönberg kann uns nicht mehr Problem werden. Das neue Problem vor dem wir stehen, heißt: „Schönberg der Dramatiker“ oder genauer „Das Drama Schönbergs“. Dies Problem in Kürze zu umreißen, zu erklären und – zu widerlegen ist kaum möglich. Der Trugschluß in der Logik des Dramatikers Schönberg ist nicht leicht nachzuweisen, denn die Neuheit und Abwegigkeit seines Dramas beruht am Ende nur auf einem veränderten Verhältnis der Mittel des Dramas. Mit dem, was wir sonst „Oper“ nennen, hat Schönbergs Einakter wenig gemein. Das Wort – und mit ihm der Gesang – tritt völlig in den Hintergrund: Je ein zusammenhängender Chor, teils melodramatisch auffixierter Tonhöhe gesprochen, teils gesungen, am Anfang und am Ende. Im übrigen beschränkt sich der Text auf vereinzelte Sätze oder bloße Ausrufe einer einzigen singenden Person, die mit zwei stummen Personen die „Handlung“ trägt. Also Pantomime? – Wer Schönbergs Erklärungen verstanden hat – was nicht ganz leicht war – kann diese Bezeichnung nicht gelten lassen. „Mit den Mitteln der Bühne musizieren“, das ist wohl das Kernstück seiner „Technik des Dramas“. Wort, Gebärde, Mimik, Licht, Farbe, kurz alle „Mittel der Bühne“ sollen gleichberechtigt neben dem „klingenden Ton“ stehen, als Material einer Komposition von ähnlicher Art und Wirkung wie die Komposition mit Tönen. Das bedeutet einmal, daß die Mittel der Regie und Inszenierung, die sonst der Verwirklichung des eigentlichen Dramas zu dienen haben, zu Hauptkräften des Dramas selbst werden. Zweitens, daß ihre Verwendung in „expressionistischem “ Sinne geschieht. D. h. Geste, Licht, Farbe usw. ist nicht Verdeutlichung, real verständliche Unterstützung eines dichterischen oder musikalischen Inhalts, sondern für sich selbst Inhalt, Ausdruck. Selbstverständlich soll der Ausdruck der zusammenwirkenden Mittel analog, parallel wirken. Doch wer verstände so ohne weiteres die absolute Gebärde, die absolute Skala des Lichts! Wer kann darauf kommen ein Ostinato im Orchester in Einklang zu sehen mit gleichmäßig starrenden Blicken, ein „Crescendo des Lichts“ mit einer gleichzeitig symbolischen und realistischen Gebärde! Aus diesen Andeutungen mag mancher schon ahnen, wie es um die „Handlung“ steht. Eine wirkliche Handlung ist gar nicht vorhanden, sondern nur eine geistige Idee, ein Stück Weltanschauung, ausgedrückt durch ein allegorisches Geschehen. Nicht eine real faßliche Begebenheit, hinter der eine Idee läge, sondern eine Idee in nahezu abstrakter Symbolik dargestellt. Die Idee dieser im einzelnen reichlich unklaren Allegorie heißt etwa: Tragödie des schöpferischen, zu „unendlichen“ Aufgaben bestimmten Menschen, der in Sehnsucht nach „endlichem“ Glück, nach Frauenliebe, immer wieder Enttäuschungen erlebt. Ein Bekenntnis dem Inhalt, ein Experiment der Form nach. Ein zweifellos mit ehrlichem Kunstwillen geschaffenes, aber nur vom Intellekt gezeugtes Werk. Künstlerisch eine Totgeburt. Die Aufführung, unter musikalischer Leitung von Fritz Cortolezis, Regie von Herbert Graf und mit Bühnenbildern von Prof. Wild ermann war, wie gesagt, ausgezeichnet, tat alles, um die Absichten des Autors voll zu erfüllen und machte der Breslauer Bühne hohe Ehre. Die etwas rauhe Stimme von Geerd Herm. Andra war für den „Mann“, der ja kaum zu singen hat, wohl durchaus passend.