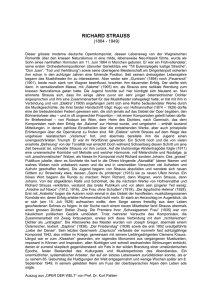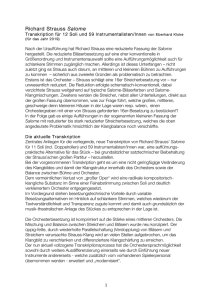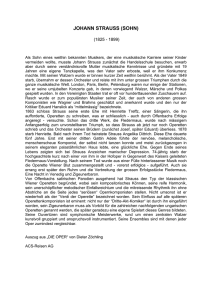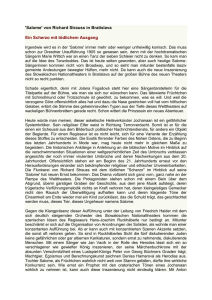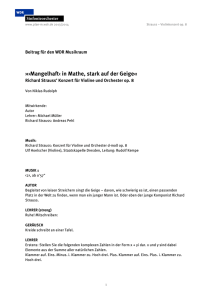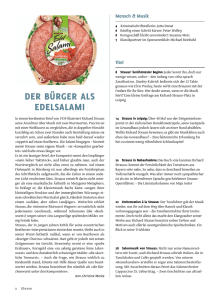SWR2 Musikstunde Richard Strauss 150
Werbung
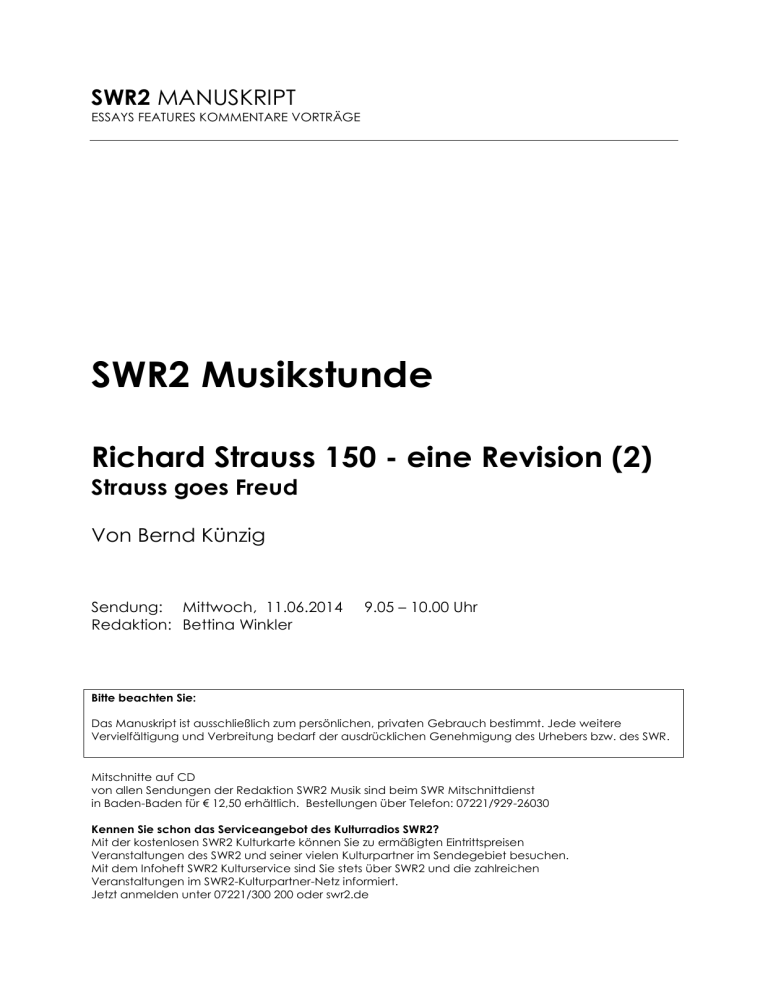
SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Musikstunde Richard Strauss 150 - eine Revision (2) Strauss goes Freud Von Bernd Künzig Sendung: Mittwoch, 11.06.2014 Redaktion: Bettina Winkler 9.05 – 10.00 Uhr Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Mitschnitte auf CD von allen Sendungen der Redaktion SWR2 Musik sind beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden für € 12,50 erhältlich. Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de Musikstunde 11. Juni 2014 Signet Musikstunde zu der Sie Bernd Künzig begrüßt. Heute der zweite Teil von Richard Strauss 150 - eine Revision: Strauss goes Freud. Um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert vollzog der Komponist Richard Strauss einen nahezu fundamentalen Gattungswechsel. Nach dem ersten Misserfolg der Oper „Guntram“ im Jahr 1894 und der schließlich triumphalen Serie von Tondichtungen, die den Komponisten zu einem führenden Vertreter der Moderne gemacht hatten, folgte um die Jahrhundertwende der nun erfolgreiche Sprung in das Genre des Musiktheaters, das fortan das kompositorische Schaffen bis in die späten Jahre prägen sollte. Die Uraufführung von „Salome“ nach dem gleichnamigen Drama von Oscar Wilde im Jahr 1905 wird zum Sensationserfolg. Gleichzeitig aber ist das Werk in konservativen Kreisen umstritten. Strauss‘ Zeitgenosse Gustav Mahler bemüht sich als Direktor der Wiener Hofoper vergeblich um eine Aufführung, die von der Zensur der k. und k.-Monarchie unterbunden wird. Offensichtlich ging den Zensoren sowohl der Stoff Wildes als auch die Vertonung von Strauss entschieden zu weit. Mit dieser Art von Skandalon festigte Strauss noch einmal seinen Ruf als ein wesentlicher Neuerer der musikalischen Sprache – und das noch einige Zeit vor den berühmt-berüchtigten Skandalkonzerten Arnold Schönbergs und seiner Schüler. Für viele Rezipienten war Strauss damit in Bereiche vorgedrungen, die die Grenzen des sittlichen Anstandes hinter sich ließen. Inzest, offen ausgesprochenes sexuelles Begehren und perverse Fetischisierungen prägten bereits den Text Oscar Wildes, der selbst zur Zeit der Uraufführung der Opernversion in England noch immer verboten war. Der Text aus dem Jahr 1892 war bereits ein Griff in das Unterbewusste der Sprache und des Sprechens – bei einem brillanten Rhetoriker, der Wilde auch war, kaum zu verwundern. Etwa zur gleichen Zeit begann Sigmund Freund mit seinen Studien über die weibliche Hysterie. 1899 erschien schließlich Freuds Hauptwerk der „Traumdeutung“, deren Publikationsdatum er symbolisch geschickt auf 1900 vordatierte. In diesem Kontext stehen auch die frühen Opernerfolge der „Salome“ und der 1909 folgenden „Elektra“. Aber Strauss selbst ist ein durchaus interessantes Untersuchungsobjekt psychoanalytischer Deutung. Ganz im Sinne des Freudschen Mottos über das Unterbewusstsein „Wo Es war soll Ich werden“ zählt der Komponist mit zahlreichen seiner Werke zu den großen Ich-Sagern seiner Zeit. Das gilt bereits für die 1899 uraufgeführte Tondichtung „Ein Heldenleben“, deren fast anonymisierter Titel etwas darüber hinwegtäuscht, dass es sich eigentlich um „Mein Heldenleben“ handelt. Die autobiografischen Bezüge lassen sich nicht zuletzt anhand einer musikalischen Collage vor dem letzten Teil ablesen, in der alle zuvor entstandenen Tondichtungen mit kurzen Zitaten wiedergegeben werden. Musik: Richard Strauss „Ein Heldenleben“ – Zitatcollage SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg; Francois-Xavier Roth, Dirigent M0330318.W00 (5:49) Noch unverhohlener spricht Richard Strauss über sich in der kurz vor Kompositionsbeginn der Salome abgeschlossenen „Sinfonia domestica“, die 1904 in New York uraufgeführt wurde. Die großformatige Komposition folgt zwar programmatischen poetischen Ideen als Ausgangspunkt, setzt diese dann aber als klassische sinfonische, viersätzige Anlage in einer ununterbrochenen Folge um – ganz anders als die jeweils eigene Formen erfindenden Tondichtungen. Im Unterschied zum „Heldenleben“ ist an dieser häuslichen Sinfonie nichts heroisch. Schon der Titel „Sinfonia domestica“ ist ein eigentümliches Kompositum aus Latein und Griechisch. Der Inhalt eines Tagesablaufs im Hause der Familie Strauss wiederum ist kaum geeignet zu klassischer Größe. Wie in einer klassischen Sinfonie stellt Strauss zu Beginn drei musikalische Themen vor, die er im Laufe des dreiviertelstündigen orchestralen Geschehens bis hin zur kontrapunktischen Großform eines Fugen-Finales durchführt. Das erste dieser Themen ist robust-markant, gefolgt von einer „träumerisch“ bezeichneten Oboenkantilene. Das zweite Thema ist glänzender, brillanter instrumentiert, sprunghaft in den Gesten. Nach einer kurzen Tremolopause der zweiten Geigen folgt ein lyrisch-zärtliches Thema, das Strauss bemerkenswerterweise einer Oboe d’amore zugeordnet hat. Abgelöst wird es von krähend-blasenden Tremoli. Danach beginnt der eigentliche Durchführungsteil mit einem als Scherzo bezeichneten Abschnitt, der in einer klassischen Sinfonie eigentlich erst an dritter Stelle folgt. Musik: Richard Strauss „Sinfonia domestica“ – Beginn M0015409.W02 (5:07) Das war der Beginn der „Sinfonia domestica“ mit der Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Rudolf Kempe. Strauss hat das musikalische Material der “Sinfonia domestica” keineswegs als abstraktes an den Anfang gestellt, sondern um es freudianisch zu formulieren, seine eigene Familie auf die kompositorische Material-Couch gelegt. Das robust-markante des Anfangs entspricht seinem Selbstbild, das kapriziössprunghafte zweite Thema seiner Frau, der Generalstocher und ehemaligen Sängerin Pauline de Ahna. Und der Sohn Franz, Bubi genannt, wird ganz zärtlich dem liebenden Instrument einer Oboe d’amore anvertraut. Dieses familiale Dreieck ist kein ödipales im Sinne Freuds, Kastrationsängste werden hier nicht auskomponiert, sondern es ist ein vollkommen gelingendes Familienbild, wie es Tradition in der englischen Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts hat. Zu diesem bildhaft Gelingenden gehört auch am Ende des Bubi-Themas eine Partiturbezeichnung, wonach die Trompeten die Tanten repräsentieren, die sagen „Ganz der Papa“, während die Posaune den Onkels zugeordnet wird mit der Anmerkung „Ganz die Mama“. Dem gelingenden Familienporträt mit der engen kontrapunktischen Verknüpfung der Themen von Vater, Mutter und Kind im großen Fugenfinale entspricht schließlich auch die Wiedergewinnung der sinfonischen Durchführungsform, die Strauss mit seinen Tondichtungen bislang überwunden hatte. Doch parallel zur Vollendung der „Sinfonia domestica“ im Jahr 1903 hebt der Kompositionsbeginn der „Salome“ an. Musik: Richard Strauss „Salome“ – Anfang (1:00) Wieslaw Ochmann, Narraboth; Heljä Angervo, Page; Wiener Philharmoniker; Herbert von Karajan; EMI 7 49358 2 LC0542 Es ist viel Aufhebens gemacht worden um die formalen Parallelitäten der beiden aufeinanderfolgenden Einakter „Salome“ und „Elektra“. Anfänglich hatte auch Strauss Bedenken, der „Salome“ einen vergleichbaren Einakter folgen zu lassen. Dennoch hielt die Irritation in der Tat nicht allzu lang an. Wir gehen mit Strauss nun zu Sigmund Freud. Nach einer psychoanalytischen Sitzung können wir feststellen, dass eigentlich weniger ein Zusammenhang zwischen der „Salome“ und der ihr folgenden „Elektra“ besteht, als zwischen der „Sinfonia domestica“ und der biblischen Parodie. Im Unterschied zu seinem Zeitgenossen Gustav Mahler hatte Strauss jedoch Freud nie aufgesucht. Dennoch hatte er einen Korrespondenzpartner gefunden, der ihn in seinen Tagebuchnotizen nahezu tiefenpsychologisch unter die Lupe genommen hat. Dieser genaue Beobachter war der große Europäer, Musikwissenschaftler und französische Schriftsteller Romain Rolland. Der Briefwechsel zwischen Rolland und Strauss ist vielleicht weniger bekannt als der berühmte briefliche Austausch zwischen dem Komponisten und seinem langjährigen späteren Librettisten Hugo von Hofmannsthal. Wo der Austausch mit dem Textdichter in erster Linie werkbezogen aufschlussreich, von wechselseitigen Missverständnissen zweier diametral entgegengesetzter Persönlichkeiten durchzogen ist, gerinnt der Briefwechsel mit Rolland und den ergänzenden Tagebuchaufzeichnungen zu einer präzisen, nüchternen Charakteristik des Menschen Strauss. Bereits nach der ersten Begegnung im Jahr 1898 in Paris schreibt Rolland: „Im Lamoureux-Konzert. - Ein junger Mann, groß, schlank, krause Haare, eine am Scheitel beginnende Tonsur, blonder Schnurrbart, helle Augen, helles Gesicht. Weniger der Kopf eines Musikers als eines Landjunkers. Vitale Energie, nervöses Temperament, eine krankhafte Übererregtheit, gestörtes Gleichgewicht, das vom Willen gebändigt wird, aber Musik und Musiker antreibt. (…) Er ist ein Moderner, sehr stolz darauf, ein Moderner zu sein und steht allem, was das Ewige und allumfassende des menschlichen Geistes ausmacht, gleichgültig gegenüber. Bei Tisch hält er sich sehr schlecht, setzt sich mit übereinadergeschlagenen Beinen neben seinen Teller, führt diesen zum Kinn um zu essen, stopft sich mit Bonbons voll wie ein kleines Kind usw. Sein Ton verändert sich ebenso wie seine Manieren, je nachdem, ob er sich an uns wendet oder an Henry Expert und Robert Brussel, die nach dem Essen erschienen sind. Herzlich und gutmütig mit uns, ist er den anderen gegenüber kurz angebunden; er hört kaum zu, wendet sich an Clotilde: ‚Was‘, sagt er und ‚ach! So, so‘, das ist alles.“ Nach der Aufführung der „Sinfonia domestica“ im Jahr 1905 gibt sich Rolland dialektisch irritiert: „Während der Probe zur Sinfonia domestica von Strauss empfinde ich plötzlich eine Art Abscheu. Ein Missverhältnis zwischen der Grundidee und ihren Ausdrucksmitteln. Keine Intimität. Dieser lärmende Haushalt entfaltet sich im Freien, ungehemmt, ohne Schamgefühl. Und mich sucht die Erinnerung an das Heldenleben heim und an den früheren Strauss. Mein allgemeiner Eindruck ist: Wenn ich eine solche Frau hätte, würde ich mich sofort scheiden lassen. – Abends jedoch im Konzert bin ich überrascht von der Schönheit dieser Orchesterkomposition, leicht, elegant und ausdrucksvoll, im Vergleich zu den kompakten Klangflächen Mahlers.“ Ein Jahr später kommt Rolland ein geradezu provozierend, sexuell aufreizendes Bild zur „Domestica“-Musik in den Sinn: „Bloss, es gibt – wie immer – zu viele ‚Haare‘ in dieser Musik. Man denkt an Algen oder Schlingpflanzen, die sich um den Torso des Helden winden.“ Wer denkt bei diesem Bild nicht an die vor Jochanaan knieende Salome, die den begehrten Propheten mit ihren langen Haaren umschlingt. Oder noch deutlicher: die in die Körperlichkeit des spirituellen Redners verliebte Prinzessin, die auch dessen Haar anbetet, bevor sie sich entschließt ihn küssen zu wollen. Und in der Tat lässt sich „Salome“ als Pendant der „Sinfonia domestica“ lesen. Wo in der orchestralen Musik ein gelingendes Familiengemälde entsteht, wird in der Oper mit grellen Farben die perverse Zerrüttung der heiligen Dreifaltigkeit entworfen: der Stiefvater will der angeheirateten Nichte zu Leibe rücken, die Mutter will den von der Tochter Begehrten nicht weniger tot sehen als die in ihrer Sexualität Erwachende. Schließlich löst Strauss alle harmonischen und formalen, kontrapunktischen Verbindlichkeiten der vorangehenden Sinfonie bis an die Grenze zur atonalen Sprache auf. Die Dur-moll-Predigt des Propheten Jochannaan begreift Strauss nur noch parodistisch als Persiflage des erhabenen Hörner-Tonfalls in Wilhelm Kienzls damals erfolgreicher, heute vergessener Oper „Der Evangelimann“. Für den Modernisten, Antimetaphysiker und Nietzsche-Anhänger Strauss gilt dieser Prediger lediglich als Hanswurst-Figur in einem absurden Puppentheater, das in die Abgründe unterbewusster Perversionen vordringen will. Was in der „Sinfonia domestica“ am Ende im hoch ambitionierten Kontrapunkt des Finales als thematische Familienzusammenführung stattfindet, wird in der „Salome“ zur alles erschütternden „Nervenkontrapunktik“, wie Strauss das selbst nannte. Wir folgen dieser Nervenkontrapunktik zunächst in der Dialogszene zwischen Salome und dem Propheten Jochanaan. Es singen: Hildegard Behrens, Salome und José van Dam, Jochanaan. Die Wiener Philharmoniker werden von Herbert von Karajan in einer legendären Referenzaufnahme aus dem Jahr 1977 geleitet. Musik: Richard Strauss „Salome“ – Szene Salome-Jochanaan (6:58) Jose van Dam- Jochanaaan; Hildegard Behrens – Salome; Wiener Philharmoniker; Herbert von Karajan EMI 7 49358 2 LC0542 Der Höhepunkt einer tiefenpsychologischen Nervenkontrapunktik wird mit dem Schlussmonolog der Salome erreicht. In perverser Erregung wartet die Prinzessin am Rande der Gefängnis-Zisterne auf die Enthauptung des Propheten, um endlich den begehrten Mund küssen zu können. Für diese Erwartungs-Passage komponierte Strauss eine bis dahin nie dagewesene pure Klangatmosphäre. Die E-Bässe sind auf ein lastendes Es-Tremolo um einen halben Ton herabzustimmen. Ein Solokontrabass spielt ein B-Flageolett im Violinschlüssel zu dessen Erzeugung es in der Partitur heißt: „Dieser Ton, statt auf das Griffbrett aufgedrückt zu werden, ist zwischen Daumen und Zeigefinger fest zusammenzuklemmen; mit dem Bogen ein ganz kurzer, scharfer Strich, so dass ein Ton erzeugt wird, der dem unterdrückten Stöhnen und Ächzen eines Weibes ähnelt.“ In einer Notiz aus späteren Jahren ergänzte Strauss: „Hier sei bemerkt, dass das hohe B des Kontrabasses bei der Ermordung des Täufers nicht Schmerzensschreie des Delinquenten sind, sondern stöhnende Seufzer aus der Brust der ungeduldig wartenden Salome.“ Im Laufe dieses Monologs zieht auf der Szene eine Wolke vor den zuvor höchst symbolträchtig besungenen Mond und hüllt die Bühne in völliges Dunkel. Der Schlussgesang wird zum reinen Hörstück eines verinnerlichten Geschehens. Eine Studie über Hysterie à la Strauss. Musik: Richard Strauss „Salome“ – Schlussmonolog Anfang (1:23) Karl-Walter Böhm – Herodes; Hildegard Behrens – Salome; Wiener Philharmoniker; Herbert von Karajan EMI 7 49358 2 LC0542 Soweit der Ausschnitt aus dem Schlussmonolog der „Salome“ mit Hildegard Behrens und den Wiener Philharmonikern unter der Leitung Herbert von Karajans. Nach dieser radikalen Klangstudie in das weiblich Unterbewusste nimmt beim Berliner Hofkapellmeister Strauss das öffentlich Bewusste wieder Oberhand an. Vom üppigen Honorar der „Salome“ baut er sich ein großzügiges Familienheim im bayerischen Garmisch. Die „Sinfonia domestica“ nimmt häusliche Gestalt an und wandert aus dem Konzertsaal in die süddeutsche Gebirgswelt, die den Komponisten zu seinem zweiten großformatigen, zwischen 1911 und 1915 entstandenen Sinfoniegebilde der „Alpensinfonie“ inspirieren wird. Während Gustav Mahler an der Wiener Zensur scheitert, geht Strauss für eine Aufführung der „Salome“ an der Berliner Hofoper strategischer vor. Er leitete eine Aufführung von Carl Maria von Webers „Freischütz“, der Lieblingsoper Kaiser Wilhelms. Und ganz zeitgemäß und staatstreu komponiert der Berliner Operndirektor zwischen 1905 und 1907 vier Marschmusiken, von denen wir den 1906 entstandenen Militärmarsch in Es-Dur hören. Ein Bayer in Preussen. Musik: Richard Strauss „Militärmarsch Es-Dur“ op. 57, Nr. 1 (2:52) Radio-Symphonieorchester Berlin; Caspar Richter, Dirigent Archiv-Nr. 3301693 Doch das öffentliche Bewusstsein von Strauss ist eine Nebensache nur. Bereits während der Komposition der „Salome“ sucht er nach einem neuen Opernstoff. Mit dem österreichischen Dichter Hugo von Hofmannsthal sprach Strauss bereits nach ihrer ersten Begegnung am 23. März 1899 über Opernstoffe. Es bleibt unklar, wann er erstmals die Uraufführungsproduktion der Hofmannsthalschen „Elektra“ in der Berliner Inszenierung von Max Reinhardt mit Gertrud Eysoldt in der Titelrolle gesehen hat, die bereits auch die Salome in Wildes Drama gespielt hatte. Reinhardts äußerst erfolgreiche Produktion lief zwischen 1903 und 1909, dem Jahr der Dresdner Uraufführung von Strauss Vertonung, in mehreren Serien. Möglicherweise besuchte der Komponist eine Aufführung am 17. November 1906. Zu diesem Zeitpunkt hatte er allerdings bereits mit der Komposition der ersten Szene begonnen. Damit nahm die enge Zusammenarbeit mit Hugo von Hofmannsthal ihren Anfang, dem bis zum frühen Tod des Dichters im Jahr 1929 fünf gemeinsame Werke für das Musiktheater folgen sollten. Hofmannsthals Interesse am Musiktheater war einer tief verwurzelten Sprachkrise des Dichters entsprungen, die er literarisch im 1902 entstandenen Brief des Lord Chandos manifest werden ließ. Von da an sucht er der Unzulänglichkeit der Sprache eine andere Ausdrucksebene zuzugesellen. Und diese Ausdrucksebene sollte die Musik sein, die er nicht in der Lage war zu schreiben, die er aber dem Komponisten mit seinem Text vorzuschreiben gedachte. Von Anfang an war diese Art literarischer Vorschrift für den Komponisten Strauss nicht ohne Konflikte zu bewältigen. Dem Modernisten Strauss war der sich in oft eisige Höhen versteigende Symbolismus des Dichters fremd. Der wiederum hatte für die banalen Alltäglichkeiten, die den Komponisten etwa zu seiner häuslichen Sinfonie inspirierten, wenig übrig, bis hin zur schroffen Ablehnung. Dennoch erfüllte sich mit „Elektra“ die Kooperation der beiden so gegensätzlichen Charaktere am idealsten. Doch dies ist eine paradoxe Situation. Denn anders als die folgenden Libretti war die „Elektra“ nicht für eine Vertonung geschrieben worden, sondern für die reine Sprechbühne Max Reinhardts. Verwandt war sie mit Strauss vorangehendem Einakter, weil sie ein ideales Vorbild für einen musikalischen Seelenkontrapunkt abgab. Hofmannsthals Überschreibung der „Elektra“ des Sophokles ist weit entfernt von der stillen Einfalt und schlichten Größe eines Klassizismus im Geiste von Johann Joachim Winkelmann und der „Iphigenie“ Goethes. In ihr schlägt sich vielmehr die Erfahrung mit Sigmund Freuds Hysterie-Studien nieder. Musik: Richard Strauss „Elektra“ – „Es geht ein Lärm los“ und Zwischenmusik (2:35) Marjana Lipovsek, Klytämnestra; Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks; Wolfgang Sawallisch, Dirigent EMI 6 40779 2 LC 0542 Wenn „Salome“ im Sinne eines perversen Scherzos als Nach- und Gegensatz des gelingenden Familienporträts der „Sinfonia domestica“ verstanden werden kann, dann ist die „Elektra“ die Abschaffung der Familie. Durch die Ermordung Agammemnons und die rachebesessene Elektra ist die Familie längst zu Grunde gegangen. Wo „Salome“ sich auf den Schlussmonolog hinbewegt, ist die „Elektra“ von Anfang an ein einziger Monolog. In der Figur der Elektra spiegeln sich letztlich alle anderen Figuren des Stückes, sei es die degenerierte, von Schuld zerfressene Mutter Klytämnestra, die auf Mutterschaft hoffende Schwester Chrysothemis oder der letztlich die Rache vollziehende Bruder Orest. Sie und alle anderen auftretenden Personen, wie die Mägde, der Diener, der Stallknecht, der Pfleger des Orest und der feige Mörder Ägisth sind nichts anderes als Seelenbilder dieser einen Elektra. So ist die Oper nicht nur nach dem kurzen Prolog der Mägde-Szene zwischen die beiden großen Monologe der Elektra aufgespannt, sondern jeder Dialog gerinnt zu einem Monolog, der von zwei Stimmlagen und Klangfarben bestimmt wird. Dieser Einakter ist nicht grundlos eine von Frauenstimmen dominierte Musik. Nirgends wird dieser Sachverhalt eines monologisch gemeinten, dialogisch angelegten Nervenkontrapunkts deutlicher als in jenem zentralen Musikkrimi zwischen Elektra und ihrer Mutter Klytämnestra: zwei Seelen wohnen keineswegs ach in ihrer Brust. Ein drastischeres Porträt einer tragisch endenden Schizophrenie ist wohl nie mit solcher Wucht bis an die Grenzen des psychologischen und tonalen Zerfalls auskomponiert worden. Strauss bemerkte in diesem Zusammenhang zu seinen beiden Einaktern „Salome“ und „Elektra“: „Beide Opern stehen in meinem Lebenswerk vereinzelt da: ich bin in ihnen bis an die äußersten Grenzen der Harmonik, psychischer Polyphonie (Klytämnestras Traum) und Aufnahmefähigkeit heutiger Ohren gegangen.“ Was ihm die Komponisten einer erweiterten, sich lösenden und schließlich aufgelösten Tonalität vorgeworfen haben, nämlich den späteren Verrat am Fortschritt der Moderne mit der Komposition der Erfolgsoper „Der Rosenkavalier“, gestaltet sich aus Strauss Perspektive ganz anders. Der Ausgangspunkt eines derartigen Fortschritts war für ihn ein exaktes Krankheitsprotokoll. In Wahrheit war er aber der liebende Familienvater, der dem Sohn Bubi Franz nichts weniger zuordnete als eine Oboe d’amore. So produktiv es auch sein mochte: dem Weg eines Krankheitsprotokolls wollte Strauss damit am Vorabend des ersten Weltkriegs und eines heraufdräuenden gesellschaftlichen Zerfalls nicht mehr folgen. Strauss Moderne war mit der „Elektra“ keineswegs abgeschlossen, sondern hatte nur den Nervenkontrapunkt im Zustand der sprachlichen Zerrüttung erreicht. Darin war er sich zweifellos kongenial einig mit seinem Librettisten Hofmannsthal. Daher ist die „Elektra“ bis auf den heutigen Tag der Meilenstein der modernen Oper geblieben, als die sie auch von Strauss Gegnern gewürdigt wurde. Wir hören zum Schluss unserer Freudianischen Musikstunde über Richard Strauss den Schluss der Elektra-Klytämnestra-Szene. Musik: Richard Strauss „Elektra“ – Szene Elektra-Klytämnestra (5:52) Marjanan Lipovsek, Klytämnestra; Eva Marton, Elektra; Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks; Wolfgang Sawallisch, Dirigent EMI 6 40779 2 LC 0542 Unsere heutige Musikstunde über Richard Strauss ging zu Ende mit dem Schluss der Elektra-Klytämnestra-Szene aus der Oper „Elektra“. Es sangen Eva Marton als Elektra und Marjana Lipovsek als Klytämnestra. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielte unter der Leitung von Wolfgang Sawallisch. In unserer morgigen Musikstunde nähern wir uns dem „sogenannten Hauptwerk“ des Komponisten an. Am Mikrophon verabschiedet sich Bernd Künzig.