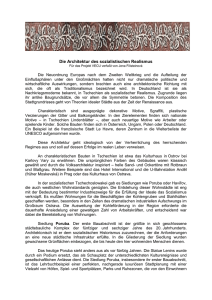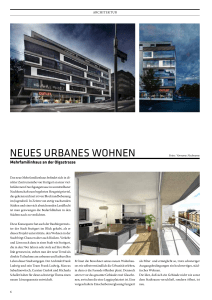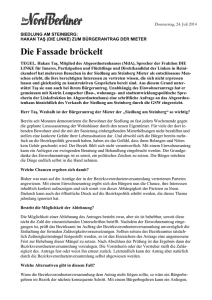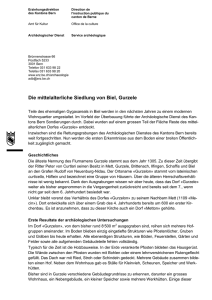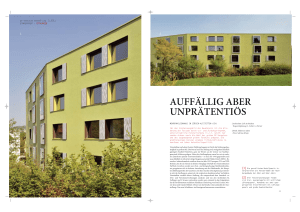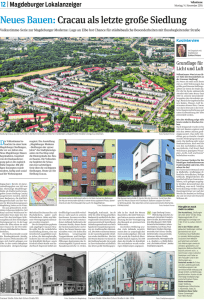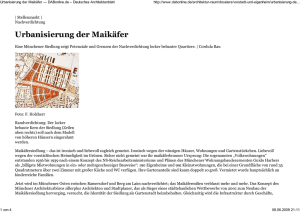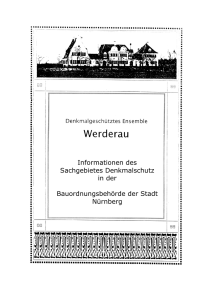zukunft wohnen - Stadt Viersen
Werbung

1 zukunft wohnen PraxisProjekt „Zukunft Wohnen“ Siedlung Viersen „Im Rahser“. Strategische Bestandsentwicklung, Architekturconsulting, Modernisierung. Kooperation Lehrstuhl und Institut für Wohnbau und Grundlagen des Entwerfens, Lehrstuhl und Institut für Städtebau und Landesplanung, Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung, Stadt Viersen, VAB - Viersener Aktien-Baugesellschaft AG, GWG - Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG. Praxisnahe Ausbildung im Fachbereich Architektur an der RWTH Aachen im Sommersemester 2009. Dokumentation studentischer Lösungsansätze zu aktuellen Problemstellungen von Unternehmen der Wohnungswirtschaft. Impressum Lehrstuhl und Institut für Wohnbau und Grundlagen des Entwerfens Univ.-Prof. ir. Wim van den Bergh Dipl.-Ing. Ben Beckers Dipl.-Ing. Alexander Bartscher Schinkelstraße 1, 52062 Aachen http://wohnbau.arch.rwth-aachen.de Lehrstuhl und Institut für Städtebau und Landesplanung Dipl.-Ing. Michael Kloos Wüllnerstraße 5-7, 52062 Aachen www.isl.rwth-aachen.de Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung Dipl.-Ing. Gisela Schmitt Wüllnerstraße 5-7, 52062 Aachen www.pt.rwth-aachen.de Redaktion und Gestaltung Ben Beckers Alexander Bartscher Lynn Cosyn Renate Morawietz Die Texte der studentischen Beiträge wurden im Original übernommen und nicht redaktionell überarbeitet. © Lehrstuhl für Wohnbau, Aachen, September 2009 2 inhalt 3 einführung 4 vorwort 8 stadt viersen, kooperationspartner im praxisprojekt 2009 12 portrait wohnsiedlung „im rahser“ 18 aufgabe ergebnisse 24 rahser ring 36 rahser evolution 48 notburga update 60 einer für alles - alles für einen 72 barrieren abbauen 84 offene räume - geschlossene gemeinschaft 96 denkmalbereichssatzung und modernisierung anhang 108 quellen 4 einführung Vorwort Dieses Jahr wurde das „Praxisprojekt Zukunft Wohnen“ bereits zum fünften Mal an der RWTH Aachen durchgeführt. Das Praxisprojekt entsteht aus der Erfahrung heraus, dass es für die Wohnungswirtschaft trotz eines „Überangebots“ von Hochschulabsolventen oftmals schwierig ist, für die spezifischen Planungsaufgaben der Bestandsentwicklung geeigneten Nachwuchs an Planern und Architekten zu finden. Seit dem Jahr 2004 wird daher an der RWTH Aachen ein Entwurfsprozess „unter Praxisbedingungen“ organisiert. Basis dieses Projekts ist die enge Kooperation der drei Lehrstühle Wohnungsbau, Planungstheorie und Stadtentwicklung, sowie Städtebau und Landesplanung mit dem Verband für Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen (VdW). Daneben ist auch das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen (ILS) in das Projekt mit eingebunden. Ziel dieses kooperativen Ansatzes ist es, Fragestellungen der strategischen Entwicklung von Wohnungsbeständen als zentrale Planungsaufgabe der Zukunft in der Ausbildung von Architekten und Stadtplanern an der RWTH Aachen zu verankern. Damit wird in der Lehre der Fakultät für Architektur an der RWTH Aachen ein Thema aufgegriffen, dass sowohl in Bezug auf die Stadtplanung als auch der Architektur höchste Aktualität hat. Denn aufgrund des demographischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandels ist in vielen Teilen Deutschlands die Nachfrage nach Wohnraum deutlich zurückgegangen und die Qualitätsansprüche an das Wohnen haben sich stark verändert. Hierdurch hat sich der Schwerpunkt des Wohnungsbaus deutlich vom Neubau zur Bestandsentwicklung verschoben. Vor diesem Hintergrund nimmt die Bestandsentwicklung auch eine immer wichtigere Rolle innerhalb des Berufsfeldes von Architekten und Stadtplanern ein. Viele Planungsaufgaben erfordern mittlerweile eine intensive Auseinandersetzung mit Siedlungs- und Gebäudebeständen auf verschiedenen Ebenen, aber auch fundierte Kenntnisse über Zusammenhänge der Wohnungswirtschaft und der Stadtentwicklung. Mittlerweile stehen die Wohnungsunternehmen vor der Aufgabe, den vorhandenen Wohnungsbestand, insbesondere denjenigen der Ära des „Massenwohnungsbaus“ der Nachkriegsjahre, vermietungssicher und rentabel zu halten. Dabei reicht die Spanne möglicher Entscheidungen von der zukunftsgerechten Modernisierung bis hin zum Totalabriss bestehenden Wohnraums. Dies verdeutlicht, dass derzeit vor allem aufgrund des wirtschaftlichen und demographischen Strukturwandels sowie den steigenden Anforderungen an den Energiehaushalt von Gebäudebeständen immer komplexere Aufgaben an die Wohnungswirtschaft herangetragen werden. Daneben spielt das Thema der zukunftsgerichteten Entwicklung von Wohnungsbeständen derzeit auch 5 für Städte und Kommunen eine außerordentlich wichtige Rolle. Denn die Sicherung bestehender und zukünftiger Qualitäten in einzelnen Stadtquartieren und gesamtstädtischen Zusammenhängen ist eine zentrale Aufgabe der aktuellen Stadtentwicklung. Dies verdeutlicht, dass sich derzeit die Zielstellungen von Kommunen und der Wohnungswirtschaft auf vielfältige Art und Weise überlagern. Praxisprojekt Zukunft Wohnen 2009 Vor diesem Hintergrund wird das Praxisprojekt 2009 in enger Kooperation mit zwei Wohnungsunternehmen und einer Kommune durchgeführt. Diesjährige Partner im Rahmen des Projekts ist die Stadt Viersen, vertreten von Frau Becker und Herrn Jenniches, die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft zu Viersen eG (GWG), vertreten durch Herrn Fels, sowie die Viersener Aktien-Baugesellschaft AG (VAB), vertreten von Herrn Becker und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hiermit wird die Grundlage dafür geschaffen, dass Studentinnen und Studenten anhand konkreter Wohnungsbestände Ideen zur strategischen Bestandsentwicklung erarbeiten können, auf die sie von den Projektpartnern ein direktes Feedback erhalten. Durch diesen unmittelbaren Kontakt wird zwischen den Studentinnen und Studenten, deren Projekte innerhalb dieser Publikation dokumentiert sind, sowie den „professionellen Vertretern“ der Wohnungswirtschaft und der Stadt Viersen ein gegenseitiger Austausch über die Ideen und Konzepte zur strategischen Bestandsentwicklung ermöglicht. Dieses gegenseitige Geben und Nehmen ist ein zentraler Bestandteil des Praxisprojektes Zukunft Wohnen ohne den das Projekt nicht das wäre, was es ist – eine „Win-WinSituation“ für alle Beteiligten. Für das Projekt wird uns die Siedlung „Rahser“ in Viersen zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt, deren Gebäudebestand in mehreren Bauphasen hauptsächlich zwischen den 20iger und den 80iger Jahren errichtet wurde. Dieser Siedlungsbestand weist in mehrerer Hinsicht spezifische Charakteristika auf, die es im laufenden Bearbeitungsprozess zu beachten gilt: t Der Gebäudebestand ist relativ heterogen und unterliegt teilweise einer Denkmalbereichssatzung. Dennoch gilt es, das Wohnungsangebot vor dem Hintergrund der derzeitigen demographischen und energetischen Anforderungen für zukünftige neue Bewohnergruppen attraktiv zu halten ohne den besonderen Wert der Siedlung zu beeinträchtigen. 6 1 2 1 2 3 Starttermin in Viersen Ortsbegehung Wohnungsbesichtigung 3 7 t Ebenfalls gilt es, diejenigen Gebäudebestände in die Überlegungen mit einzubeziehen, die nicht der Denkmalbereichssatzung unterliegen, um auch hier eine zukunftsgerechte Entwicklung zu ermöglichen. t Die Außen- und Frei- und Grünräume, insbesondere die charakteristischen Schrebergartenanlagen der Siedlung bedürfen einer besonderen Aufmerksamkeit, weil sie die Charakteristik des Quartiers maßgeblich bestimmen, einen wesentlichen Bestandteil der Denkmalbereichssatzung ausmachen und daneben eine wichtige Rolle für die Wohnqualität spielen. t Die Bearbeiterinnen und Bearbeiter haben sich ebenfalls mit der Bevölkerungsstruktur und die spezifische Lebenssituation der Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb der Siedlung intensiv auseinander zu setzen. Denn die beste technische oder städtebauliche Analyse des Bestandes ist sinnlos, wenn sie nicht in den Bezug gesetzt wird mit den Bewohnern vor Ort, die „ihr“ Lebensumfeld, seine Qualitäten, Defizite und Potenziale am allerbesten kennen. t Strategische Bestandsentwicklung bedeutet jedoch auch, all diese verschiedenen Faktoren mit in ein konzeptionelles Gedankengerüst mit einzubeziehen und dennoch nicht die Kosten, die die getroffenen Entscheidungen nach sich ziehen, aus dem Auge zu verlieren. Diesen und noch viel mehr Fragen widmen sich unsere Studentinnen und Studenten, deren Projekte innerhalb dieser Publikation in Auszügen – unabhängig von der hochschulinternen Bewertung – in zufälliger Reihenfolge vorgestellt werden. Entsprechend vielfältig wie die unterschiedlichen Frage- und Aufgabenstellungen in der Siedlung „Rahser“ sind auch die Projekte und ihre konzeptionellen Ansätze, die sich mit den bestehenden Rahmenbedingungen und der zukünftigen Entwicklung dieses charakteristischen Stadtteil Viersens auseinandersetzen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Stadt Viersen, insbesondere bei Frau Becker und Herrn Jenniches, die große organisatorische Teile des Projektes geschultert und viele Fäden zusammengeführt haben. Ebenfalls bedanken wir uns bei der GWG und der VAB, vor allem bei Herrn Fels und Herrn Becker sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Insbesondere bedanken wir uns darüber hinaus für das Engagement und die Gastfreundschaft, die den Studentinnen und Studenten der RWTH Aachen vor Ort im Rahmen eines mehrtägigen Workshops und eines persönlichen Empfangs von Herrn Bürgermeister Thönnessen entgegengebracht wurde. Ohne die intensive Beratung und Unterstützung aller Beteiligten hätte weder das Praxisprojekts 2009 noch die hier vorgelegte Publikation realisiert werden können. Aachen, im September 2009, Alexander Bartscher, Ben Beckers, Michael Kloos, Gisela Schmitt 8 Stadt Viersen Grußwort 1 1 Das Rahser ist ein liebenswerter Stadtteil Viersens, der über viele Jahre gewachsen ist. Trotz oder gerade wegen der verschiedenen Baustufen hat sich hier eine gemeinsame Identität entwickelt, die die Bewohner spüren und erleben. Im Rahser fallen verschiedene Themen der Stadtgestaltung und Wohnungswirtschaft zusammen. Es gilt nun, an einem Strang zu ziehen und die Aktivitäten der Stadt – z.B. im Bereich des öffentlichen Raums – mit den zahlreichen Maßnahmen der Wohnungsgesellschaften in ihrem Wohnungsbestand zu bündeln. Für die Entwicklung der Siedlung sind in den kommenden Jahren gemeinsam Entscheidungen zu treffen, die das Rahser als beliebten Wohnstandort stärken. Das„Praxisprojekt Zukunft Wohnen“ hat den Stadtteil Rahser aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert. Dabei ist das Spannungsverhältnis zwischen Denkmalschutz und energetischer Modernisierung, aber auch Barrierefreiheit und kindgerechtes Wohnen als Themen von großem Interesse, damit den Bürgerinnen und Bürgern in jeder Lebenslage ein angepasster und qualitativ hochwertiger Wohnraum mit einer optimalen Infrastruktur geboten werden kann. Mein Dank gilt den Studentinnen und Studenten der RWTH Aachen, die mit ihrem vielfältigen und umfassenden Studienprojekt wichtige Ideen erarbeiteten, die Impulse für eine zukünftige Gesamtstrategie geben. Sehr herzlich bedanke ich mich auch bei der Viersener Aktien-Baugesellschaft AG (VAB) und der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) für die gute Zusammenarbeit. Die intensive Auseinandersetzung mit unserem Stadtteil Rahser eröffnet zahlreiche positive Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft. Günter Thönnessen Bürgermeister 1 Der Bürgermeister Günter Thönnessen 9 2 2 Remigiusplatz 10 Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG Viersen gegründet 1900 – GWG Stadt Viersen Kooperationspartner im Praxisprojekt In diesem Jahr besteht unsere Genossenschaft 109 Jahre, 109 Jahre zum Wohl unserer Mitglieder. Grundlagen Unsere Wohnungsgenossenschaft hat einen eigenen Wohnungsbestand von 133 Häusern mit 531 Wohnungen, 3 Gewerbeeinheiten und 145 Garagen/ Carports/ Stellplätzen. Der Wohnungsbestand liegt überwiegend innerhalb der Stadt Viersen. Ein Großteil unseres Wohnungsbestandes liegt im Ortsteil Rahser, der von unserer Geschäftsstelle fußläufig erreichbar ist. 46 % unseres Wohnungsbestandes wurde zwischen 1900 und 1940 errichtet, der Rest wurde nach 1950 erbaut. Bei einer Untersuchung der Altersstruktur der bei uns wohnenden Mitglieder wurde festgestellt, dass 51,5 % der Bewohner jünger als 50 Jahre alt sind. Der Anteil der Bewohner, der älter als 60 ist, liegt bei 35 %. Die Verwaltung ist transparent, flexibel und mieternah. Diese Aussage wird auch durch unsere Bewohnerbefragung aus dem Jahre 2005 bestätigt. Als Ergebnis können wir festhalten, dass die Bewohner der Genossenschaft mit uns zufrieden sind. Die Mitarbeiter wurden als sehr freundlich und hilfsbereit beschrieben. Obgleich es auch Punkte zur Kritik gab, äußerten mehr als 90 % der an der Befragung teilnehmenden Bewohner, dass sie noch einmal eine Wohnung bei der Wohnungsgenossenschaft anmieten würden. Die genossenschaftliche Unternehmensform ist ein weiterer Pluspunkt, unsere Wohnungsgenossenschaft schließt überwiegend Dauernutzungsverträge ab. Die Eigenkapitalquote unserer Wohnungsgenossenschaft liegt bei 47 %. Unsere Ziele Die Wohnungsversorgung der Mitglieder durch gute, zeitgemäße und bezahlbare Wohnungen ist unsere oberste Verpflichtung. Wir pflegen mit unseren Vertragspartnern faire Geschäftsbeziehungen und verfolgen eine korrekte Immobilienverwaltung, die frei von Immobilienhandel ist. Die Wohnungsbestände unserer Wohnungsgenossenschaft werden ständig modernisiert und auf einen aktuellen Stand gehalten. In den letzten Jahren wird verstärkt auf die energetische Optimierung geachtet, um den Bewohnern angenehme klimatische Verhältnisse innerhalb der Wohnungen zu schaffen. Wärmedämmung und Energieeinsparung führt auch zu tragfähigen Mieten. Erdgeschosswohnungen in unseren Wohnungsbeständen werden barrierearm modernisiert, so dass auch ältere Menschen in der Wohnungsgenossenschaft ein Zuhause finden. Neubauprojekte sehen grundsätzlich Barrierefreiheit in allen Erdgeschosswohnungen vor. 11 Schon heute beschäftigt sich die Genossenschaft mit der Entwicklung neuer Wohnformen. In den nächsten Jahren werden hierzu Projekte angestoßen, die ökologisch optimiert sind, gleichzeitig durch Wohnumfeldgestaltung und Bauweise Kommunikation und Begegnung der Nachbarschaften fördern. Schon heute bieten wir barrierefreie Wohnungen für ältere Menschen, Kleinwohnungen für junge Haushalte, 4-Zimmerwohnungen für Familien, aber auch attraktiven Wohnraum in aufwändig sanierten Altbauwohnungen. Mit außerordentlicher Neugier erwarten wir die Beiträge der Studenten, um aus deren Ausarbeitungen zukünftige Projektansätze zu gestalten. Wir danken den Projektbeteiligten und verbinden dies mit dem Wunsch, für weitere zukunftsweisende Ideen sowie berufliche und persönliche Erfolge. Busch, Fels, Neumann Vorstand der Wohnungsgenossenschaft 12 Portrait Wohnsiedlung „Im Rahser“ Viersen Die Wohnsiedlung „Im Rahser“, unser diesjähriges Planungsgebiet, ist ein nördlich gelegener Stadtteil Viersens. Viersen, mit ca. 77 000 Einwohnern, ist eine zwischen den Großstädten Düsseldorf, Mönchengladbach und Krefeld, zentral gelegene, mittelgroße Kreisstadt. Als niederrheinisches Mittelzentrum bietet die Stadt vielfältige Freizeitmöglichkeiten, zentrale Dienstleistungseinrichtungen und Einzelhandel. Ein weiteres besonderes Merkmal ist die gut ausgebaute Grünvernetzung von zahlreichen Parks und Gärten. Ehemals ein Standort der Textilindustrie hat sich die Stadt durch ihre Zentralität zum Sitz renommierter Firmen entwickelt. Ein Blick auf den demographischen Wandel zeigt uns, dass die Einwohnerzahl Viersens zurückgeht, der Altersdurchschnitt jedoch zunimmt. Mit einer Arbeitslosenquote von 17,3% liegt diese deutlich höher als ihr Umkreis. Geschätzt wird, dass 15% aller Viersener Bürger einen Migrationshintergrund haben oder keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Durch diese Fakten wird darauf aufmerksam gemacht, dass dies gravierende Auswirkungen auf das erforderliche Wohnraumangebot mit sich bringt. Es ist von großer Notwendigkeit, dass man diesen Problemen, die durch die Veränderungen herangeführt wurden, entgegenwirkt. Rahser Die nah gelegenen Landschaftsschutzgebiete bzw. Naturschutzgebiete, und die unmittelbare Stadtnähe heben die besondere Lage Rahsers hervor. Bemerkenswert ist die Bahntrasse, die einerseits eine Trennung zwischen der Wohnsiedlung und der Innenstadt darstellt, andererseits jedoch zur Identitätsbildung der Wohnsiedlung beiträgt. Nicht zuletzt sind auch die Kleingartenanlagen, mit ihrer atypischen Lage, mit ein Grund für die Identifizierung der Bewohner mit ihrem Wohnviertel. Die auf den ersten Blick kaum zu erkennenden Mietgärten, innerhalb der jeweiligen Wohnblöcke, bieten den Fußgängern eine angenehme und autofreie Wegeführung durch die Siedlung. Beim Durchqueren des Stadtteils Rahsers fallen einem die unterschiedlichen Bautypologien auf. Die Wohnsiedlung ist hauptsächlich von zwei verschiedenen Leitbildern geprägt. Die auf das Leitbild der 20er Jahre zurückzuführenden Gebäude, sind durch stringente Achsen, geschlossene Straßenräume, strenge Reihungen und Symmetrien gekennzeichnet. An den Gebäuden der 50er Jahre, die sich vor allem im östlichen Bereich der Siedlung befinden, erkennt man die Idee der aufgelockerten und durchgrünten Stadt. Das Hauptmerkmal dieser Epoche bestand darin, möglichst viel Wohnraum auf wenig Grundfläche unterzubringen. Das sogenannte Herz der Siedlung ist ein festgelegter Bereich innerhalb Rahsers, der unter die Denkmalbereichssatzung fällt. Dieser gilt als ein besonders schützenswertes Ensemble, welches erhalten bleiben soll. 13 Süchteln Dülken Viersen Mönchengladbach 1 2 1 2 3 3 Lage der Siedlung Denkmalbereichssatzung Notburgakirche 14 4 5 4 5 6 Siedlung „Im Rahser“ 1963 Katasterplan von Rahser Luftbild der Siedlung 6 15 Grundsätzlich kann man noch erwähnen, dass die Siedlung an sich, eine gut durchmischte Bevölkerung hat, in welcher alle möglichen sozialen Gruppen vertreten sind. Siedlung + Baustruktur Wie vorhin schon erläutert, zeigt sich die Stadtgeschichte und die städtebauliche Entwicklung in diesem Wohnviertel. Die Großvermieter dieses Stadtteils sind die VAB und die GWG. Rund 200 Wohnungen werden von der Viersener Aktienbaugesellschaft vermietet. Nordwestlich der St.-Notburga-Kirche sind einige Mehrfamilienhäuser, die der VAB gehören. Der andere Großvermieter, die Gemeinnützige Wohngenossenschaft vermietet im Rahser ca. 130 Wohneinheiten an. Ein großer Teil dieser Wohnungen liegt im Bereich der Denkmalsatzung. Das Wohnangebot der GWG besteht tendenziell eher aus kleineren Gebäuden, im Gegenteil zu den grösseren Objekten der VAB. Viele Gebäude sind allerdings sanierungsbedürftig. Hier sind die Nebenkosten oft sehr hoch, wodurch die Zufriedenstellung der Bewohner abnimmt. Vor allem die Objekte der Denkmalbereichssatzung stehen der Problematik der Sanierungsmaßnahmen gegenüber. Durch das diesjährige Praxisprojekt werden Vorschläge von uns Studenten herausgearbeitet, um zum einen die Wohnqualität der Bewohner zu verbesseren und zum anderen, um das Wohnangebot der Immobiliengesellschaften attraktiver zu gestalten. 7 7 Mietgärten 16 Übersicht der Siedlung „ Rahser“ Wohngebäude der 50er Jahre, Dechant-Stroux Straße 17 Wohnhaus der Denkmalbereichssatzung. Nauenstraße Laubenganghaus der 50er Jahre, Oberrahserstraße 18 Aufgabe Im Rahmen dieses Praxisprojektes bestand die Aufgabe darin, ein zukunftsorientiertes Konzept für die Siedlung „Im Rahser“ in Viersen zu entwickeln. Das Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz der vorhandenen baulichen und städtebaulichen Qualitäten und einer zeitgemäßen Entwicklung war ebenso Thema wie die mögliche Nachverdichtung in Abwägung mit der qualitativen Aufwertung der Freiräume. Zur Aufgabe gehörte eine kompakte Analyse des örtlichen Wohnungsmarktes, der städtebaulichen Situation und der Gebäudetypologien. Die Analyse diente den Projektteilnehmerinnen als Basis für die individuelle Ideen- und Konzeptfindung. Modernisierung, Umbau, Rückbau und Neubau waren mögliche Strategien, die jeweils das Zusammenspiel von nachfrageorientierter Qualität und kostengünstiger Realisierung berücksichtigen sollten. Bei der Konzeptentwicklung orientierten sich die BearbeiterInnen an den folgenden Kernfragen: t Gibt es ein einheitliches, gestalterisches Leitbild für die Siedlung oder lassen sich charakteristische Teilbereiche herausarbeiten? Wo liegen die gestalterischen und funktionalen Qualitäten der Siedlung? Lässt sich eine eigene „Siedlungsidentität“ herauslesen? t Welche unterschiedlichen Freiräume prägen die Siedlung? Welche Entwicklungspotentiale stecken in den unterschiedlichen Freiraumtypen? Wie prägend sind die Straßenräume und die öffentlichen Plätze für die Identität der Siedlung? t Was sind erhaltenswerte, räumliche, funktionale und gestalterische Qualitäten des Gebäudebestandes? Welche Spielräume lassen die Vorgaben der Satzung für den Denkmalbereich zu? Was sind denkbare Szenarien für eine energetische Ertüchtigung der Bestände unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte und den bautechnischen Eigenheiten der jeweiligen Gebäudetypologie? t Wie ist die vorhandene Bausubstanz der Gebäudestände im Hinblick auf zeitgemäße bautechnische Anforderungen – über die energetische Ertüchtigung hinaus – zu beurteilen? Wie ist die Qualität der Wohnungszuschnitte vor dem Hintergrund der aktuellen Tendenzen auf dem Wohnungsmarkt zu sehen? Welchen zeitgemäßen Wohnqualitäten müssten für welche Zielgruppen (neu) geschaffen werden (Wohnungsmix)? Wie sind die Modernisierungskosten mit Blick auf die Qualitätsverbesserungen zu beurteilen? t Welche Siedlungsbereiche bieten sich in Abwägung mit der jeweiligen Freiraumqualität für eine Nachverdichtung an? Welche baulichen Erweiterungsmöglichkeiten bieten die einzelnen Gebäudetypologien in der Siedlung? t Ist die Versorgung des Quartiers durch die vorhandene Infrastruktur gewährleistet? Entspricht das Versorgungsangebot der augenblicklichen und zukünftigen Nachfragesituation? Sind alle Zielgruppen gleichermaßen gut bedacht? Bildet die „Geschäftzeile“ das/ein Zentrum der Siedlung? Welche Nutzungsalternativen bietet der Standort der Evangelischen Kirche bei Umnutzung, Abriss oder Teilrückbau der vorhandenen Gebäude? 19 t Identifizieren sich die Bewohner mit dem Gesamtquartier oder bilden sich eher „sozialhomogene“ Teilquartiere heraus? Gibt es innerhalb der Siedlung ein aktives Nachbarschafts- und/oder Vereinsleben? Können zusätzliche (baulich/ räumliche) Angebote die Siedlungsidentität und den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Siedlung stärken? Die Bearbeitung dieser Fragenstellungen ließ verschiedene inhaltliche und räumliche Perspektiven zu. Im Rahmen des diesjährigen Praxisprojektes standen drei Handlungsfelder im Vordergrund: Nachfrageorientierte Wohnqualität Bei der Konzepterarbeitung sollte ausgehend von gesellschaftlichen Trends und allgemeinen Tendenzen auf dem Wohnungsmarkt auf die örtliche Nachfragesituation in Viersen und speziell auf die derzeitige Bewohnerstruktur in der Siedlung „im Rahser“ eingegangen werden. Es sollte der Frage nachgegangen werden, wie die Wohnbedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen oder Lebensstile in Zukunft aussehen. Aus den Erkenntnissen der Recherche waren konkrete Schlüsse für die Qualitäten des Wohnungsangebotes in der Siedlung „Im Rahser“ zu ziehen. Im Ergebnis wurden Vorschläge für zeitgemäße und zukunftsorientierte Wohnformen abgestimmt auf verschiedene Gebäudetypologien, Wohnungszuschnitte und Freiraumkategorien innerhalb der Siedlung erwartet. Städtebauliche Situation Unter städtebaulichen Fragestellungen sollte vor allem die großräumliche städtebauliche und landschaftliche Einbindung der Siedlung, die Siedlungsstruktur und die vorhandenen Freiraumqualitäten untersucht werden. Auf dieser Basis galt es, städtebauliche Leitideen für die zukünftige Gebietsidentität der Siedlung zu entwickeln. Bei der Konzeptentwicklung sollte auf die Anforderungen der Denkmalbereichssatzung eingegangen und die Position der Siedlung innerhalb des gesamtstädtischen Gefüges in Viersen berücksichtigt werden. Insbesondere war eine Aussage darüber zu treffen, inwieweit auf Basis des vorhandenen Bestandes städtebauliche Qualitäten definiert, gesichert und ggf. verbessert werden können. Dabei sollte für „Impulsprojekte“ und „Schlüsselgrundstücke“ eine detaillierte Betrachtung erfolgen. Gebäudebestand Anhand einer architektonischen und bautechnischen Analyse des Gebäudebestandes sollten verschiedene hochbauliche Aspekte untersucht werden (Wohnungsgrundrisse, Erschließung, private Freibereiche, Bausubstanz, Konstruktion, Materialität etc.). Die auf die analytischen Erkenntnisse aufbauenden Konzepte sollten die Spielräume und Grenzen der Entwicklung für die vorhandenen Gebäudetypologien aufzeigen. Gestalterische und funktionale Qualitäten sollten in den Konzepten mit belastbaren Kostenberechnungen und Wirtschaftlichkeits-Abschätzungen verknüpft und so im Hinblick auf ihre Realisierbarkeit überprüft werden. Ziel war es, derzeitige und zukünftige Möglichkeiten im Umgang mit der vorhandenen Gebäudesubstanz auszuloten. Die Planungen sollten neben den architektonischen Qualitäten auch ökologische, ökonomische und soziale Anforderungen einbeziehen. 20 1 2 1-3 Impressionen aus dem Workshop 3 21 Die inhaltlichen Eingrenzungen und Fragen der Aufgabenstellung dienten allen TeilnehmerInnen des Projektes als Leitlinien für die individuelle Ideenfindung und eigenständige Schwerpunktsetzung. Es konnte entweder das gesamte Planungsgebiet oder auch nur ein ausgewählter Teilraum behandelt werden. Die unterschiedlichen Bearbeiterteams oder Einzelbearbeiter verfolgten in diesem Rahmen jeweils eine eigene inhaltliche Ausrichtung, so dass nicht immer alle Aspekte der Aufgabenstellungen behandelt wurden. In der Zusammenschau aller Arbeiten wird jedoch die Komplexität der Gesamtaufgabe wieder deutlich. 22 ergebnisse 23 24 marina frentzen Rahser Ring marina frentzen Vorwort „Im Rahser“ ist ein Stadtteil im Norden von Viersen und zählt zu dessen ältesten Bezirken. Er grenzt direkt an die Innenstadt an und erstreckt sich in Richtung des Stadtteils Süchteln weiter nördlich. Kommt man als Außenstehender in den Rahser, wird schnell klar, dass der Rahser anders ist als übliche vergleichbare Stadtteile. Viersen „Im Rahser“ ist eine eigene kleine Einheit. Abgeschottet durch Bahngleise im Süden und Felder und Wiesen im Norden bekommt der Rahser den Charakter einer Stadt in der Stadt. Die Abgetrenntheit zur Stadt und der fehlende räumliche Bezug kann vom Außenstehenden durchaus als Nachteil aufgefasst werden. Die Rahser Bewohner allerdings nehmen dies hauptsächlich als Vorteil wahr. Nicht zuletzt ist die durch die abgeschottete Lage geschaffene Intimität mit ein Grund für die starke Identifizierung der Bewohner mit ihrem Wohnort, für die gut funktionierende Nachbarschaft und für das starke Vereinsleben. Fragt man genauer nach, stellt man jedoch fest, dass die vorhandene Identifikation der Bewohner mit dem Rahser fast ausschließlich auf einer sozialen, nachbarschaftlichen Ebene stattfindet. Nur wenige Bewohner können räumliche oder architektonische Gegebenheiten nennen, die für sie den Rahser ausmachen. Außer der St. Notburga Kirche, die zwar bekannt ist, aber nicht immer positiv bewertet wird, und den für den Rahser typischen Kleingartenanlagen gibt es keine für die Anwohner nennenswerten Punkte. Der Rahser lebt derzeit von seiner sozialen Stärke, nicht von einer städtebaulichen oder architektonischen. rahser ring 25 Analyse Erschließung Bei der Analyse der Erschließung im Viersener Stadtteil Rahser fällt erst einmal auf, dass es sich um einen durchgängig wenig befahrenen Stadtteil handelt. „Im Rahser“ befindet sich zwischen zwei stark frequentierten Ausfallstraßen Viersens, der Süchtelner Straße im Südwesten und der Sittarder Straße im Nordosten. Diese funktionieren als Haupterschließungswege stadtauswärts. Im Rahser selbst gibt es keine wirklich viel befahrenen Straßen. Im Allgemeinen kann man die vorhandenen Straßenstrukturen in 2 Gruppen unterteilen, die Nebenstraßen und die Feinwege, worunter Anwohnerstraßen und Fußwege zu verstehen sind. 1 Infrastruktur 2 1 2 Analyse _ Erschließung Analyse _ Infrastruktur Bezüglich der Versorgungs-Infrastruktur im Rahser ist anzumerken, dass im gesamten Stadtteil nur wenig Einzelhandel vorhanden ist. Die Hauptversorgung findet durch einen ALDI-Markt an der Süchtelner Str. statt, bzw. durch weitere Discounter die sich außerhalb des Rahsers befinden. Im Stadtteil selber gibt es bis auf 2 Kioske keine weiteren Lebensmittelmärkte. Der spärlich vorhandene Einzelhandel scheint zudem nur schlecht zu funktionieren, was zum Teil an den verstreuten Standorten liegt. Was Bildungseinrichtungen betrifft ist Rahser ausreichend ausgestattet. Es sind Kindergärten, eine Grundschule und eine Gesamtschule vorhanden, die auch von Kindern aus anderen Stadtteilen besucht werden. Ebenfalls gibt es zwei Kirchen im Rahser, von denen jedoch nur noch die Katholische für Messen genutzt wird. Die evangelische Kirche an der Oberrahser Straße wurde bereits profaniert und in das „Dietrich-Bonhoeffer-Dienstleistungszentrum“ umgewandelt. 26 marina frentzen Leitbilder Der Stadtteil Rahser wird stark durch die zu unterschiedlichen Zeiten entstandenen Gebäude geprägt. Im südlichen Bereich - geschützt durch eine Denkmalbereichssatzung - befinden sich typische Siedlungshäuser von vor 1920 bis hin zu den 1930er Jahren. An der Abbildung ist zu erkennen, wie sich der Ortsteil Rahser von hier aus entwickelt hat. Das städtebauliche Leitbild hier ist das der Gartenstadt. Weiter nördlich befinden sich in den 1940er und 50er Jahren entstandene Geschosswohnungsbau-Riegel. Deren Hauptmerkmal ist die Unterbringung von viel Wohnraum auf wenig Grundfläche und dadurch entstehende großzügige Zwischenräume, in denen sich weiträumige Wiesen befinden. Zwischendrin gibt es verteilt immer wieder Neubaugebiete in denen Reihenhaussiedlungen bzw. freistehende Einfamilienhäuser angelegt sind. 3 Fazit Analyse _ Es ist keine räumliche Identifikation der Bewohner mit städtebaulichen oder architektonischen Gegebenheiten vorhanden. _ Durch die vielen verschiedenen Teilbereiche mit unterschiedlichen Gebäudetypologien gibt es nur wenig räumlichen Zusammenhalt. _ Anders als in vergleichbaren Stadtvierteln gibt es im Rahser keinen öffentlichen Raum wie z.B. einen Dorfplatz oder Ähnliches. _ Die Versorgungs-Infrastruktur ist nur mangelhaft vorhanden und die Vorhandene ist gefährdet. 4 Konzept Rahser Ring Ziel meines Entwurfs ist es, die bei der Analyse festgestellten momen- 3 4 Analyse _ Entstehungsjahre Konzept Piktogramm rahser ring 27 tan vorhandenen Defizite im Rahser auszugleichen. Dies geschieht, indem der vorhandene Straßenring (Nauenstraße, Dechant-Stroux-Straße, Oberrahser Straße) von einem bloßen Erschließungsring zu einer identitätsprägenden Hauptstraße aufgewertet wird. An diesem Straßenring soll vor allem öffentlicher Raum geschaffen, und an verschiedenen Punkten der Einzelhandel zentriert und dadurch gestärkt werden. Dies geschieht in Form von kleineren Plätzen beziehungsweise öffentlichen Grünanlagen zur Naherholung. Der Rahser Ring soll ein Rückgrat für das Viertel sein und es vernetzen und räumlich zusammenhalten. 5 Rahser Bubbles 6 5 6 Rahser Bubbles Schwarzplan mit neuer Bebauung Wie schon in der Analyse beschrieben, wird der Rahser vor allem durch seine vielen unterschiedlichen städtebaulichen bzw. architektonischen Typologien geprägt. Fährt man die in meinem Entwurf thematisierte Ringstraße entlang, werden die verschiedenen typologischen Teilbereiche besonders deutlich (siehe Bilderreihe auf den nächsten Seiten). Am südlichen Ende wird das Straßenbild durch die Siedlungshäuser der 20er und 30er Jahre geprägt, hier wirkt die Straße fast wie ein „Nadelöhr“. Dem Straßenverlauf folgend gelangt man in einen eher infrastrukturell geprägten Bereich mit der Notburgakirche. Dem schließt sich die nächste „Zelle“ mit dem für die 50er Jahre typischem Geschosswohnungsbau an. Am nördlichen Ende der Oberrahser Straße befindet sich ein sehr heterogener Teilbereich, in dem der Straßenraum nur wenig gefasst ist. Von hier aus entwickelt sich die Straße zu einer dörflichen, und endet schließlich an einem ehemaligen Bauernhof an der Ecke Süchtelner Straße. Auf den nächsten Seiten findet sich eine ausführlichere Beschreibung der einzelnen Teilbereiche. 28 marina frentzen Teilbereiche des Rahser Rings Um geeignete Maßnahmen zur Gestaltung des Rahser Rings und damit zur Verbesserung der Situation im Rahser zu finden, musste ich mich erst einmal mit den verschiedenen Teilbereichen der Ringstraße befassen und diese genauer in Augenschein nehmen. Teilbereich 1.1 _ Anfang Nauenstraße Thema: 20er Jahre Kleinstadtstraße Charakter: Urban Qualitäten: Denkmalbereichssatzung, Charme der 20er Jahre Bebauung, gefasst, hart, städtisch,„Nadelöhr“ Teilbereich 1.2 _ Quartiersplatz Nauenstraße Thema: 20er Jahre Kleinstadtstraße Charakter: Urban Qualitäten: Denkmalbereichssatzung, Charme der 20er Jahre Bebauung, Straße öffnet sich in Platzsituation mit Potential, Übergang zwischen harten und aufgelockerten Strukturen Teilbereich 1.3 _ Kreuzung Regentenstraße Thema: 20er Jahre Kleinstadtstraße Charakter: Urban Qualitäten: Denkmalbereichssatzung, Charme der 20er Jahre Bebauung, Schulgebäude,„dörflicher“ Einzelhandel, Kreuzungssituation, aufgelockerte Bebauung Teilbereich 2.1 _ Kirchenplatz Dechant-Stroux-Straße Thema: Urbanes Zentrum Charakter: Urban Qualitäten: Räumlichkeiten für Einzelhandel, Grün durch große Baumreihe, Potential des unbebauten Grundstücks, Notburgakirche als identitätsstiftendes Element Teilbereich 2.2 _ Notburgaviertel Thema: Kirchengarten Charakter: Privat, Garten Qualitäten: Grün, gepflegt,„historisch“, abgeschlossen, Notburgakirche als identitätsstiftendes Element, Kindergarten, grün durch Baumreihe Teilbereich 3 _ Wohnen am Nordkanal Thema: 50er Jahre Geschosswohnungsbau Charakter: Suburban Qualitäten: offen, großzügige Grünbereiche, große Abstände zur Nachbarbebauung, viel Wohnen auf wenig Grundfläche Fahrradweg am Nordkanal -> Besucher Teilbereich 4.1 _ Ortseingang Oberrahser Straße Thema: heterogene Mischung Charakter: Suburban Qualitäten: lockere Gebäudestrukturen, Mischung zwischen Geschosswohnungsbau und Reihenhäusern Mischung aus alt und neu, Eingangssituation in den Rahser rahser ring Teilbereich 4.2 _ Oberrahser Straße Mitte Thema: Charakter: Qualitäten: heterogene Mischung Suburban heterogene Gebäudemischung, Grün, offene Gebäudestrukturen Teilbereich 4.3 _ Oberrahser Straße - Dietr. Bonhoeffer Zentrum Thema: Charakter: Qualitäten: heterogene Mischung Suburban heterogene Gebäudemischung, sehr Grün, offene Gebäudestrukturen, Freistehende Einfamilienhäuser Dietrich Bonhoeffer Zentrum / Kindergarten Teilbereich 5 _ Oberrahser Dorf Thema: Charakter: Qualitäten: Dorfstraße Dörflich enge, kurvige Straße, lockere Gebäudestrukturen, ungebunden an Straßenraum,„chaotisch“, Bauernhof Potenzielle Eingangssituation Unbebautes Grundstück -> Neubau Tagesklinik 8 7 8 Fotos vom Straßenverlauf der Ringstraße, Ausgangspunkt Anfang Nauenstraße bis hin zur Kreuzung Oberrahser Straße / Süchtelner Straße Nummerierung Teilbereiche 7 29 30 marina frentzen Maßnahmen Gestaltung der Ringstraße - übergreifendes Leitbild Um den Rahser Ring als solchen zu verdeutlichen, muss es ein übergreifendes Erscheinungsbild geben, welches in allen Teilbereichen gleich bleibt. Dies ist sozusagen die „Kette“, auf der die „Perlen“ aufgezogen werden. Das wichtigste Element dieser „Kette“ ist der Bodenbelag der Fußgängerbereiche. Die Bürgersteige sollen mit einem einheitlichen, hellen Pflaster gepflastert werden, das sich an den Aufweitungen der Straße in die Plätze ziehen soll. Hierdurch grenzt sich der neu gestaltete öffentliche Raum von den übrigen Straßen des Rahsers ab. Die Fahrbahnen bleiben u.a. aus Kostengründen wie gehabt mit Asphalt bezogen. Zur zusätzlichen Stärkung der Ringstraße werden die konkurrierenden Querstraßen (z.B. die Regentenstraße) an den Kreuzungen verkehrsberuhigt. 9 Straßenquerschnitt Anfang Nauenstraße 10 Straßenquerschnitt Quartiersplatz Nauenstraße 11 Straßenquerschnitt Kirchenplatz Dechant-Stroux-Straße 12 Straßenquerschnitt 50er Jahre Bebauung Dechant-Stroux-Straße Baum- und Lichtkonzept Ein weiteres Mittel zur Gestaltung der Ringstraße ist das Baum- und das Lichtkonzept. Bäume und eine einheitliche Straßenbeleuchtung funktionieren sowohl als Mittel um die Ringstraße hervorzuheben, als auch zur Fassung des Straßenraums in jenen Bereichen, die diese benötigen (z.B. an der Oberrahser Straße). Die Abstände der Bäume bzw. der Straßenlaternen reagieren somit auf den jeweiligen spezifischen Teilbereich. In der Nauenstraße z.B. gibt es keine Bäume, da sie nicht ins Straßenbild passen würden. Anderswo hingegen sind sie wichtig für das Straßenbild. Die Laternen reagieren auf die Urbanität der Gegend, d.h. je Urbaner, desto mehr Laternen gibt es. Die Beleuchtung wird an der äußeren Seite des Bürgersteigs montiert, d.h. zwischen Gebäude und Fußgängerbereich, um diesen mit einzufassen. rahser ring 31 Bäume Bestand Bäume Neu Gebäude Neu 13 Maßnahmenplan Rahser gesamt 14 Straßenquerschnitt Ortseingang Oberrahser Straße 15 Straßenquerschnitt Oberrahser Straße Mitte 16 Straßenquerschnitt Dietr. Bonhoeffer Zentrum 17 Straßenquerschnitt Oberrahser Dorf 32 marina frentzen Maßnahme 01 Kirchenplatz St. Notburga Oberste Priorität hat meiner Meinung nach die Umgestaltung der Kreuzungssituation Dechant-StrouxStraße / Notburgastraße, da sie einen typischen Ort darstellt, an dem sich öffentlicher Raum befinden sollte, bis jetzt aber keiner vorhanden ist. Es sind an diesem Standort beste Voraussetzungen für ein „öffentliches“ Zentrum des Rahsers geschaffen, die ausgenutzt werden sollten. Es gibt keinen Kirchenplatz oder ähnliches und die Platzsituation vor der bestehenden Ladenzeile wird ausschließlich als Parkfläche genutzt. Für das bis jetzt unbebaute Grundstück existieren bereits Planungen für einen Neubau mit seniorengerechten Wohnungen. Dies ist an dieser Stelle meiner Meinung nach ein sehr geeigneter Standort, weswegen ich daran festhalten will. Anders als geplant will ich allerdings in dem Gebäude nicht ausschließlich Senioren-Wohnungen unterbringen, sondern im Erdgeschoss soll eine öffentliche Funktion in Form eines Cafés unterkommen. Dieses soll sowohl von den Senioren als auch von anderen Bewohnern des Rahsers genutzt werden und als soziale Schnittstelle dienen. Zudem soll es über einen Außenbereich auf der neu gestalteten Platzsituation verfügen. Der neue Kirchenplatz soll - wie der Name schon sagt die Notburgakirche mit einbeziehen. Aus diesem Grund entferne ich Teile der Mauer, die den Kircheneingang bis jetzt umgibt und füge an dieser Stelle eine (Sitz-)Treppe ein. Über das Podest am Kircheneingang gelangt man jetzt auch in den vorhandenen Kirchengarten. 18 19 Maßnahme 02 Wohnprojekt St. Notburga Der in der Dechant-Stroux-Straße vorhandene Spiel- und Bolzplatz wird in einen neuen Park am Nordkanal verlegt (siehe nächste Seite). Auf 18 Maßnahmen Kirchenplatz St. Notburga (Teilbereich 2.1) 19 Perspektive Kirchenplatz 20 Modellfoto Kirchenplatz 20 rahser ring Bäume Bestand Bäume Neu 21 22 21 Maßnahmen Wohnprojekt St. Notburga (Teilbereich 2.2) 22 Perspektive Wohnprojekt 23 Modellfoto Wohnprojekt 23 33 dem durch die Spielplatzverlegung frei gewordenen Grundstück besteht die Möglichkeit einer Neubebauung. In meinem Entwurf vorgesehen ist an dieser Stelle ein Wohnprojekt mit Mehrgenerationenwohnen, sowie Betreutem Wohnen. Zusammen mit dem Kirchengelände und dem Kindergarten sollen die neuen Wohngebäude eine Einheit bilden. Die Idee ist die der 3 Höfe. Der erste Hof ist der vorhandenen Kirchengarten, der für die Öffentlichkeit geöffnet wird und als Grünfläche genutzt werden kann. Seinen abgeschlossenen Charakter behält er jedoch, da der Zugang nur über das Kircheneingangspodest erfolgen kann. Die den Garten umgebende Mauer bleibt bestehen. Die vorhandene Treppe stellt einerseits den Zugang, andererseits aber auch die „Schwelle“ zum zweiten Hof dar. Sie bestimmt den Übergang zu einer deutlich privateren Atmosphäre. An diesem mittleren Hof soll die Möglichkeit zu betreutem Wohnen bestehen. Dieses kann sowohl in einem Neubau als auch im bestehenden Gebäude des ehemaligen Jugendzentrums realisiert werden. Über eine informelle Wegeführung gelangt man in den nördlichen dritten Hof. Hier soll ein Neubau Wohnmöglichkeiten für Mehrgenerationenwohnen bieten. Zudem gibt es ein Gebäude mit gemeinschaftlichen Funktionen an der Dechant-StrouxStraße. Die Wohngebäude werden über den Hof erschlossen, weswegen sich eine Laubengang-Erschließung anbieten würde. Um auf den auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelegenen Eingang zum Nordkanal-Park zu reagieren, befindet sich vor dem Gemeinschaftsgebäude mit dem Eingang zum Hof wieder um eine kleine Platzsituation. Der Eingang zum Hof erfolgt über eine Öffnung im Gebäude. Straßenseitig werden die vorhanden Bäume mit drei Neupflanzungen ergänzt um die Straße deutlicher um die Kurve zu leiten. 34 marina frentzen Maßnahme 03 Wohnen am Nordkanal Eine weitere Stelle an der dringender Handlungsbedarf besteht, sind die Grünflächen hinter der nördlichen Bebauung der Dechant-StrouxStraße. Diese liegen hinter den Geschosswohnungsbauten versteckt und bieten keinerlei Aufenthaltsqualität. Zur Südseite werden sie von der Bebauung eingegrenzt, nach Norden hin besteht eine dichte Baumreihe die regelrecht wie eine „grüne Wand“ wirkt. Diese hat zur Folge, dass die Doppelhäuser „Am Nordkanal“ regelrecht vom Rahser abgetrennt stehen. Mein Ziel ist es die Bebauung „Am Nordkanal wieder näher an den Rahser „zu rücken“ und die bis jetzt nicht genutzten Wiesen nutzbar zu machen. An dieser Stelle soll eine Art Park entstehen, der sowohl den Fahrradtouristen des Nordkanal-Radwegs eine Rastmöglichkeit bietet, als auch für die Rahser Bewohner eine öffentliche Grünfläche darstellt. Es sollen ausreichend Sitzmöglichkeiten geschaffen werden, die zum Verweilen einladen. Mit parallel zum Nordkanal laufenden Wasserbecken greife ich die KanalThematik auf und schaffe Spielmöglichkeiten für Kinder. Damit die Bewohner der Geschosswohnungsbauten auch private Bereiche erhalten, werden hinter den Gebäuden Mietergärten geschaffen. Im neu gestalteten Park findet sich genügend Platz um den bis jetzt an der Kurve der Dechant-Stroux-Straße bestehenden Spiel- und Bolzplatz hierhin zu verlegen. Für die Kinder bietet der Park einen ruhigeren und sichereren Ort zum spielen, als direkt an der Straße. Um die Fußwegeverbindungen zu optimieren schaffe ich an einigen Stellen neue Vernetzungen, z.B. einen Fußweg zur Sittarder Straße. Ebenfalls ergänze ich einige Wege, die bis jetzt Sackgassen sind, zu durchgehenden Fußwegevernetzungen (im Plan gelb gekennzeichnet). 24 rahser ring 35 Maßnahme 04 Quartiersplatz Nauenstraße Eine weitere Maßnahme zur Gestaltung öffentlichen Raums ist die Umgestaltung der Platzsituation in der Nauenstraße. Die Straße öffnet sich an dieser Stelle und bildet eine Platzsituation, die allerdings im Moment ebenfalls nur als Parkplatz genutzt wird. Aufenthaltsqualität wird nicht geboten. In meinem Konzept soll der Platz vom Parkplatz zu einem Quartiersplatz umgestaltet werden. Er soll als Übergang zwischen den harten, kantigen Strukturen der Nauenstraße und den aufgelockerten grüneren Strukturen in der Dechant-Stroux-Straße dienen. Aus diesem Grund verändere ich die Anordnung der Bäume und schaffe somit zwei Zonen des Platzes. In den Gebäuden um den Platz herum könnte sich neuer und bestehender Einzelhandel zentrieren, bzw. sind auch andere Nutzungen, zum Beispiel Arztpraxen oder ähnliches denkbar. In seiner Funktion als Quartiersplatz benötigt er nur wenig Bespielung. Es könnte zum Beispiel einen Außenbereich für den bestehenden Kiosk geben und Sitzmöglichkeiten wie Bänke oder ähnliches. Integriert werden sollte auch das vorhandene Kriegsdenkmal. 25 26 Resümee 27 24 Maßnahmen Park am Nordkanal 25 Modellfoto Park am Nordkanal 26 Maßnahmen Quartiersplatz Nauenstraße (Teilbereich 1.2) 27 Perspektive Quartiersplatz 28 Modellfoto Quartiersplatz 28 Durch die Umgestaltung des Straßenrings Nauenstraße/Dechant-StrouxStraße/Oberrahser Straße wird ein öffentlicher Bereich geschaffen, der sich durch den ganzen Rahser zieht. An der Straße bilden sich Plätze die viel Aufenthaltsqualität bieten und als Treffpunkte der Bewohner genutzt werden können. Der Besucher wird entlang der Straße durch den Rahser geleitet und lernt auf diesem Wege alle Facetten des Stadtteils kennen. Durch den Rahser Ring wird er aufgewertet und es findet eine räumliche Identifikation der Bewohner mit dem Rahser statt. 36 renate morawietz, lynn cosyn Rahser Evolution Lynn Cosyn, Renate Morawietz Vorwort Gegenstand des Praxisprojekts 09 „Zukunft Wohnen“ war die Siedlung „Im Rahser“, ein Ortsteil von Alt-Viersen. Die Aufgabe bestand darin die Siedlung zu analysieren und ein Konzept zu entwickeln um die Wohnqualität auch in der Zukunft zu erhalten beziehungsweise zu verbessern. An erster Stelle mussten hierfür die städtebaulichen Fragestellungen für die Siedlung „ Im Rahser“ näher betrachtet werden. Dabei wurde die großräumliche, städtebauliche und landschaftliche Einbindung der Siedlung untersucht. Hinzu kamen die vorhandenen Siedlungsstrukturen und Freiraumqualitäten. Angelehnt an die Viersener Leitideen, wurde ein ergänzendes städtebauliches Leitbild für die Siedlung entwickelt. Ziel war es die zukünftige Gebietsidentität der Siedlung zu entwickeln, aber auch zu erhalten und zu sichern. Rahmenbedingungen Räumliche Analyse Die Siedlung Rahser liegt in unmittelbarer Nähe von mehreren Natur- und Landschaftsschutzgebieten. So befinden sich westlich von Rahser zum einen die Süchtelner Höhen, welche rahser evolution sich besonders für Waldspaziergänge eignen. Unter anderem ist dort auch eine Minigolfanlage oder ein Wildgehege mit unterschiedlichen Tierarten (Damwild, Hirsche, Wildschweine) aufzufinden. Nicht nur für Spaziergänger bietet dieses Gebiet eine gute Erholungsmöglichkeit, sondern Radfahrer finden hier interessante Fahrradstrecken. Im südlichen Bereich dieses Landschaftsschutzgebietes schließt sich das Naherholungsgebiet Hoher Busch an. Dieses Gebiet ist durch ein großes Erholungsund Sportangebot geprägt. So findet man hier mehrere Sportplätze mit einer großzügigen Sportwiese vor. Zusätzlich werden den Besuchern ein Fitnessparcours und verschiedene Wander- und Radfahrwege geboten. Sehenswürdigkeiten wie der Bismarckturm und das Viersener Labyrinth bieten eine lohende Anlaufstelle für Besucher. Das Gebiet zeichnet sich besonders durch den dichten Waldwuchs aus. Östlich von Rahser befindet sich das Landschaft-und Naturschutzgebiet, welches geprägt ist durch seine niedrigere Vegetation, den Feuchtwiesen. Diese bieten unterschiedlichen Vogelarten einen Lebensraum. Eine weitere Punkt, welcher das Erscheinungsbild Rahsers ausmacht sind die großzügigen Ackerflächen. Diese heben den Ländlichen Charakter hervor. Die nördliche Straße bildet eine direkte Verbindung zu nächstgelegenen Stadt Süchteln und im Süden schließt die Siedlung an die Stadt Viersen an. Durch die kurzen Wege und die zentrale Lage der Siedlung sind die umliegenden Gebiete bequem erreichbar, was die Qualität von Rahser steigert. 1 Historische Analyse/ Bestandsanalyse Schaut man sich die zeitliche Entwicklung (Abb. 2) von Rahser genauer an so ist zu erkennen, dass die ersten Gebäude an der Süchtelner Straße und an der Sittarder Straße erbaut worden sind. Hier waren es vor allem Bauernfamilien die sich niedergelassen haben. Diese dörfliche Charaktere, die kleinteilige Architektur an diesen Stellen ist auch heute noch erkennbar. Im Jahre 1940 entwickelte sich Rahser immer mehr von den Hauptverkehrswegen zum Inneren von Rahser. Mit dem Bau der Notburga-Kirche wollte man eine gewisse Zentralität innerhalb der Siedlung erhalten. In den 60 Jahren war dann schlussendlich ein ausgebautes Verkehrs- und Wegenetz mit den verschiedenen Gebäudetypen zu erkennen. In den letzten Jahren bis zur heutigen Zeit haben sich neue Wohngebiete entwickelt, die von „außen“ an Rahser anknüpfen, wie zum Beispiel das Wohngebiet „Römerfeld“ und „Buschfeld“. Diese Entwicklung zeigt, dass Rahser immer weniger eine klare Grenze zum Außenraum bildet. Dies kann langfristig zu einem Identitätsverlust führen. Ein Blick auf den Bestand zeigt die typischen Merkmale der Siedlung Rahser. Die vorhandene Denkmalbereichsatzung ist ein Zeugnis des Kleinwohnungswesens in Siedlungsform. Bereichsprägende Elemente sind der Grundriss, aufgehende Bausubstanz und die zugehörigen Freiflächen, hier insbesondere die Gartenflächen. Diese sind von den anliegenden Wohngebäuden umschlossen, wodurch sie vor äußeren Einblicken geschützt werden. Diese Elemente fügen sich zusammen zu einer strukturellen städtebaulichen Einheit, die flächenhaft, räumlich und im Erscheinungsbild erfahrbar ist. Die Versorgung erfolgt bis auf einen Lebensmittellieferanten und einen sehr kleinen Gastronomiebereich durch die Innenstadt Viersens und durch das im südöstlichen Bereich angrenzende Gewebegebiet. 2 37 38 renate morawietz, lynn cosyn Leitidee/ Siedlungsrand Wie aus der Analyse hervorgeht sind die Grenzen zum Außenraum nicht klar erkennbar. Um jedoch die Zukunft, die Identität und die Sicherheit von Rahser zu gewährleisten und zu sichern, muss der Siedlungsrand thematisiert und definiert werden. Ein erster Schritt besteht darin, dass Äußere von Rahser zu erkennen und Ansatzpunkte für einen Siedlungsrand ausfindig zu machen. Um dies zu erreichen werden zuvor die Siedlungsrandbereiche thematisiert und charakterisiert. Wie bereits aus der historischen Analyse ersichtlich ist, haben sich in den Jahren nach 1960 zwei Wohngebiete im Osten und im Westen Rahsers gebildet. Hier sind erste Ansätze eines Siedlungsrandbereiches wahrnehmbar. Das im Westen gelegene Römerfeld hat als Identifikationsmerkmal die anliegenden Maisfelder, welche die Siedlung einschließen. Zusätzlich knüpft das in unmittelbarer Nähe gelegene Naturschutzgebiet an, zu welchem sich das Wohngebiet orientiert. Der Siedlungsrandbereich Buschfeld, welcher sich östlich befindet, umrahmt die dort vorhandenen Lauch- und Kamillenfelder. Wie auch bereits das zuvor genannte Wohngebiet orientiert sich auch dieses zu den Natur- und Landschaftsschutzgebieten (Feuchtwiesen). 3 Nun stellt sich die Frage nach einem Siedlungsrandbereich im Norden und im Süden Rahsers, wo es an einer klaren Definition mangelt. Ein möglicher Ausgangspunkt hierfür ist die Bebauungsstruktur an diesen Standorten. So ist fest zu stellen, dass der nördliche Teil einen ländlichen bzw. dörflichen Charakter besitzt, welcher sich durch die kleinteilige Bebauung und die unterschiedlichen Parzellenformen und –größen auszeichnet. Dieser Charakter wird zusätzlich durch die landwirtschaftlich genutzten Flächen unterstrichen. Im Gegensatz dazu steht der städtische Charakter, durch welchen der südliche Teil Rahsers (Rahserstraße) geprägt ist. Dieser zeichnet sich durch identische Parzellengrößen, enge und äußerlich stimmige Bebauung aus. 4 Ein markantes Merkmal ist die vorhandene Bahntrasse zwischen der Siedlung Rahser und der Innenstadt von Viersen. Diese lässt eine klare Grenze erkennen ohne dass eine räumlich thematische Trennung vorhanden ist. Dadurch bleibt die Zugehörigkeit zu Viersen erhalten. Entwicklungsziele 1 2 3 4 großräumliche Analyse Denkmalbereichschatzung, Grünflächenplan, Nutzungsplan, Erschließungsplan Piktogramm, Darstellung der zwei Siedlungsbereiche Siedlungsrandbereiche Im nächsten Schritt war es das Ziel den Siedlungsrand zu bestimmen. Die Visualisierung erfolgt dabei, indem das Verhältnis zum Außenraum festgelegt wird. Die Motivation zur Charakterisierung eines Siedlungsrandes ist psychologischer Art, denn dieser bietet zum einen Sicherheit und zum anderen trägt es zur Gemeinschaftsbildung bei. Außerdem wird die Identität der Siedlung gestärkt und für die Zukunft gesichert. Der nördliche und südliche Außenraum Rahsers stellen das Büssenfeld und das Rahserfeld dar. Durch Bildung von Schwellenräumen ist ein Eintreten als ein räumlich-zeitlicher Prozess wahrnehmbar. Diese Räume bilden Zwischenzonen mit verschiedenen Aufenthaltsräumen und somit auch unterschiedlichen Funktionen. Außerdem bringen sie interessante Verbindungselemente zwischen den Außenräumen hervor. rahser evolution SWOT-Plan Nachdem die einzelnen wichtigen Punkte sowohl im Inneren als auch im äußeren Bereich von Rahser näher betrachtet wurden, ist das nächste Vorgehen bedeutungsvolle Stellen und Orte nach ihren Stärken, Schwächen, Potenzialen und Bedrohungen auszuwerten. Zu den Stärken von Rahser gehören die Schrebergärten und der historische Nordkanal. Sie spiegeln die Geschichte dieser Siedlung wieder und fördern nicht nur die Gemeinschaft sondern festigen auch den Wiedererkennungswert. Weiterhin kann als positiv der weiträumige Schulcampus und die abwechslungsreichen Erholungsflächen gewertet werden. Ferner sind die angrenzenden Naturund Landschaftsschutzgebiete und die Viersener Innenstadt über kurze Strecken angenehm zu erreichen. Somit ist ein breit gefächertes Angebot für Freizeit und Erholung gegeben. Siedlungsbereiche definieren > Zwischenzonen (Verbindung) > Eintreten als räumlich-zeitlicher Prozess 5 6 Nicht nur viele Stärken prägen das Siedlungsbilds Rahsers. So können zum Beispiel die stark befahrene Süchtelnerstraße und die Bahntrasse als Schwächen aufgelistet werden, da diese eine Lärmbelästigung für das Umfeld darstellen und die Luftqualität in diesen Bereich senken. Der Mangel an Rad und Fußgängerwegen im Bereich der Rahserstraße (beim Schulcampus) und in Richtung der Naturschutzgebiete ist offensichtlich und sollte deshalb behoben werden. Zusätzlich ist der Spielplatz an der Oberrahserstraße stark durch Bewuchs verdeckt, weshalb er schlecht einsehbar ist und somit keine Sicherheit für die dort spielenden Kinder gewährleistet. Neben den zuvor genannten Schwächen weist die Bahntrasse jedoch auch ein Potenzial auf. So bildet sie wie bereits zuvor erwähnt einen klaren Rand der Siedlung gegenüber der Stadt. Weiterhin bergen die im Norden angrenzenden Ackerflächen Schwellenräume > Psychologische Motivation (Sicherheit) > Verhältnis zum Außenraum visualisieren 7 39 40 renate morawietz, lynn cosyn eine Grundlage für das Anlegen eines Fahrrad- und Fußgängerstrecke, welche zum einen die Verbindung der beiden Natur- und Landschaftsgebieten und zum anderen einen Siedlungsrand hervorhebt. Vorhandene Freiflächen innerhalb Rahser bilden die Möglichkeit für vielfältige Nutzungsarten. Der angestrebte Bau einer Tagesklinik an der Süchtelnerstraße kann dazu genutzt werden den Rad und Fußweg in dieser Gegend auszubauen, um zum einen die Tagesklinik zu integrieren und zum anderen einen sichereren Übergang für Passanten zu schaffen. Die Gastronomie und das denkmalgeschützte Gebäude im Rahserfeld fallen unter die Kategorie bedrohte Objekte. Durch eine ungünstige Lage der Gastronomie besteht für diese die Gefahr in Zukunft unter zu gehen. Das denkmalgeschützte Gebäude im Rahserfeld erfüllt die beiden Absätze des §1 des DSchG nicht im vollen Umfang. §1 Absatz 1: „Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich gemacht werden.“ §1 Absatz 3: „Ihrerseits wirken Denkmalschutz und Denkmalpflege darauf hin, dass die Denkmäler in die Raumordnung und Landesplanung, die städtebauliche Entwicklung und die Landespflege einbezogen und einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden.“ Durch die schlechte Anbindung an das Wegenetzt Rahsers ist zum einen der Zugang der Öffentlichkeit nicht gewährleistet und der städtebauliche Bezug zur Siedlung nicht vorhanden. 5 6 8 7 8 Piktogramm, Darstellung aller Siedlungsbereiche Piktogramm, Darstellung der Schwellenräume SWOT-Plan Funktionale Entwicklungsziele rahser evolution 41 Funktionale Entwicklungsziele Nachdem zuvor die Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Bedrohungen festgestellt wurden, war es jetzt die Aufgabe Entwicklungsziele mit der Funktion das Optimum aus der vorherigen Analyse heraus zu arbeiten. 9 10 11 12 13 So soll im oberen (nördlichen) Teil von Rahser das landwirtschaftliche Leitbild gestärkt werden, indem die Naturverbundenheit gefördert wird. Dies soll durch Anlegen einer Obstallee erfolgen, welcher eine direkte Verbindung zwischen den Natur- und Landschaftsschutzgebiet ermöglicht. Im südlichen Teil Rahsers ist das Leitbild eine Bewegungszone, wo die Aktivität im Vordergrund steht. So kann durch eine artifiziell angelegte Freifläche Bewegung gefördert werden, was besonders durch die Nähe zum Schulcampus angemessen ist. Durch eine Joggingstrecke die ähnlich der Obstallee (Verbindung zwischen Osten und Westen) verläuft wird der Bewegungsraum in das Wegenetz aufgenommen. Die in ihrer Thematik gegensätzlichen Routen werden durch eine historische Strecke, die Fietsallee, miteinander verbunden und somit ein Glied einer überregionalen Verbindung. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Schwellenräume, die auch eine funktionale Rolle im Bezug auf die Entwicklungsziele einnehmen. Sie stellen die Zwischenzonen und somit die Verbindung zwischen Innen- und Außenraum dar. So werden bei dem landwirtschaftlichen Leitbild die Schwellenräume zum einen mit der Funktion Obsterlebnis und zum anderen mit der Funktion Waldgebiet bekräftigt. Die Funktion des Schwellenraumes „Waldgebiet„ besteht darin, die Thematik des hier anknüpfenden Waldgebietes aufzugreifen und den Bewohnern dies an dieser Stelle deutlich zu machen. Beim Schwellenraum mit der Thematik „Obsterlebnis“ ist es naheliegend, dass das hierzu gehörige Ziel die Obstallee ist. Die Bewohner sollen auf diese neue „Allee“ durch den Spielplatz an der Oberrahserstraße aufmerksam gemacht werden, aber auch durch eine kleine Erholungswiese mit Sitzgelegenheiten an der nordöstlichen Seite der Siedlung. Ein dritter Schwellenraum greift die Thematik „Aktivität/ Bewegung“auf. Diese Zwischenzone knüpft an die denkmalgeschützte Fabrikhalle in Rahserfeld an, welches so wieder ins Bewusstsein der Bewohner gerufen werden soll. Durch die zuletzt genannte Funktion wird das Leitbild der Bewegungszone bestärkt. Beim Realisieren der geplanten Räume muss unterschieden werden, ob dabei ein Eingriff in privaten oder öffentlichen Besitz stattfindet. Dies spielt deshalb eine Rolle, da so die Chancen für das Zustandekommen eines Projekts besser abgeschätzt werden können. Das heißt ein Vorhaben, welches auf einem Grundstück, welches sich im Besitz der Stadt befindet, hat reellere Aussichten durchgeführt zu werden, als die auf einem Grundstück einer Privatperson. 42 renate morawietz, lynn cosyn Die Leitthemen Einleitung Nachdem wir die funktionalen und gestalterischen Maßnahmen festgelegt haben, wollen wir nun die Umsetzung der Leitideen präziser herausfiltern. Da wir von vier verschiedenen Anhängseln ausgehen, legen für jeden dieser Siedlungsbereiche ein passendes Leitthema fest. Die Tatsache, dass die Wohnsiedlung Rahser von zwei Naturschutzgebieten, östlich und westlich, umgeben ist, zeigt die Notwendigkeit diese besondere Lage zu stärken. Eine deutliche Verbesserung der außenräumlichen Qualität soll geschaffen werden und ein funktionierendes Verknüpfungssystem soll den Bewohnern die Möglichkeit bieten, die nahegelegenen Ziele besser erreichbar zu machen. Ziel ist es also, die Nutzungsqualität vor allem am Siedlungsrand hervorzuheben und zu steigern. Beim Begründen der Auswahl unseres Titel, ist zum einen die historische Entwicklung zu erwähnen, aus der wir zahlreiche Informationen herleiten konnten, die für die Identität Rahsers von Wichtigkeit sind. Zum anderen wird auf die Entwicklung von der Wohnsiedlung hingedeutet. Das „Gute“ von damals soll erneut zum Vorschein kommen, um so dem Ziele die Rahseridentität zu stärken und zu schützen, näher kommen. Zuerst zur Umsetzung der Leitthemen... „Natur kennenlernen im frühen Alter“ Westlich der Süchtelner Straße sehen wir die Freifläche als Potenzial, die Schnittstelle zwischen Rahser und Röhmerfeld zu bilden. An dieser Stelle sehen wir durch das Errichten eines Waldkindergarten die Möglichkeit, Rahser funktional mit dem Naherholungsgebiet, den Süchtelner Höhen und dem Hohen Busch zu verknüpfen. Nicht nur die Verbindung ist hier von großer Bedeutung, sondern auch, dass bei Kindern das Bewusstsein entwickelt wird, die Natur im späten Alter zu schützen. 14 „Alte Traditionen wieder aufgreifen“ Nördlich der Wohnsiedlung verschwimmt die Grenze in die Ackerlandschaft. Um auch hier den Außenraum zu visualisieren, muss eine ablesbare Grenze her. Ein kohärenter Übergang soll durch eine geplante Obstallee geschaffen werden. Eine Obstallee, aus dem einfachen Grund, die landschaftlich geprägte Siedlung an dieser Stelle zu stärken. Die Landschaftsästhetik- und der Charakter werden somit bewahrt und aufgewertet. Außerdem wird eine Verbindung der beiden Naherholungsgebiete gewährleistet. Als Rad-und Fußweg wird die Allee an das überregionale Fahrradnetz, die Fietsallee gebunden. Folgende Obstbäume und deren Gründe sind hier aufgelistet: - Da zum Teil schon Kirschbäume auf dem Spielplatz an der Oberrahser vorhanden sind, wollen wir diesen Bestand weiterführen. - Als zweite Sorte haben wir uns für die pflegeleichten und beliebten Apfelbäume entschieden - Und zu guter Letzt die Mispelbäume. Zum einen, weil der Anbau gefördert wird und Mispeln als traditionelle Frucht in Viersen bekannt sind, und zum andern, weil auf dem Viersener Wappen drei Mispeln abgebildet sind. Dies würde 15 9 10 11 12 13 14 15 Thematische Siedlungsrandsequenzen Schwellenräume Vernetzung Siedlungsränder mit Rahser verbinden Städtisches und privates Eingreifen Waldkindergarten Auswahl der Obstsorten rahser evolution 43 auch wiederum zur Stärkung der Identität Rahsers führen. Eventuelle Akteure wären Bauern, Vizereien, Brennereien, Obstbaumbesitzer oder sonstige Vereine. Auch für die Bewohner bietet die Obstallee so Einiges an. So könnten zum Beispiel schulische Projekte am Anbau teilnehmen. Ein eigener Saft könnte hergestellt werden und auf „Rahserfesten“ verkauft werden. „Neue Ackerflächen für die Bewohner“ 16 Kommen wir jetzt zum östlichen Teil der Siedlung, zum Buschfeld. Auch hier wird durch eine funktionale Verbindung zwischen Rahser und Buschfeld, den Bewohnern ein neues Erlebnis angeboten. Eine Selbstpflückanlage, genauer gesagt, ein Erdbeerfeld soll für jede Zielgruppe in Rahser aber auch im näheren Umfeld (Entfernung 5-10 km) als jährlich, sommerliches Erlebnis zur Verfügung gestellt werden. Somit wird nicht nur Rahser selbst, funktional mit dem Siedlungsrand an dieser Stelle verbunden, sondern auch die Obstallee findet hier einen Anschlusspunkt. Der Fußgänger oder Radfahrer wird gleich weiter zu dem Naherholungsgebiet geleitet. Interessente wären auch hier wieder die Bauern oder Obstfeldbesitzer. „Ein Highlight für Rahser“ 17 16 Selbstpflückanlage 17 Outdoor-Amphitheater Das Rahserfeld, anfangs noch unser Problemkind, wird jetzt in ein ganz neues Licht gerückt. An diesem bewegungsreichen und innenstadtnahen Ort sehen wir das Potenzial hier einen vielseitig nutzbaren Platz zu schaffen. Durch ein kleines Outdoor-Amphitheater wird dieser Platz zu einem identitätsstiftenden Ort für Rahser. Da sich im südlichen Teil vom Rahserfeld ein denkmalgeschütztes Gebäude befindet, das nicht städtebaulich integriert ist und den Anschein einer vergessenen Fabrikhalle hat, bietet sich die zu Rahser hin, gerichtete Fassade, vor allem nachts als interessante Hintergundkulisse an. Durch Sichtbezüge und Wegeführungen die daran vorbei laufen, wird das Gebäude wieder in das Bewusstsein der Rahserbewohner geholt und könnte somit zu einem neuen attraktiven Ziel werden. Das Outdoor-Amphitheater, als Platz für interkulturelle Märkte (Flohmarkt, Weihnachtsmarkt), für Schulaufführungen, außerschulische Aktivitäten, als Ort zum Verweilen und im Winter als Eislaufpiste umnutzbar, wäre sicherlich ein städtebaulicher Höhepunkt für die Bewohner in Rahser. Als Interessent sehen wir die Stadt Viersen. Wir sehen nicht nur am äußeren Siedlungsrand die Potenziale die zu nutzen sind und die unterschiedliche Maßnahmen die wir treffen um das Innere Rahsers zu schützen. Von gleicher Notwendigkeit, muss das „Verlassen“ des Siedlungsrandbereiches und das „Eintreten“ des Wohngebietes selbst, auch berücksichtigt werden. Die sogenannten Schnittstellen oder auch noch Schwellenräume sollen sichtbar gemacht werden. 44 renate morawietz, lynn cosyn Zum Entwurf Die Obstallee Angefangen mit den wichtigsten Entwurfvorschlägen, gehen wir über zu den etwas kleineren Maßnahmen und kommen dann zum Fazit. Die Obstallee, als Pufferzone zwischen der Wohnsiedlung und den Ackerflächen, nimmt durch geschwungene, ungerichtete Linienführung die ländliche Ästhetik auf. Die Anbindung an das überregionale Fahrradnetz führt zur Notwendigkeit die Obstallee auch dementsprechend als Fahrradweg auszubilden. Eine Breite von 2 m, gewährleistet sowohl den Fußgängern, als auch den Radfahrern ein ungestörtes „Aneinandervorbeilaufen“. Kleinere Obstbaumeinbuchtungen laden die Bewohner dazu ein, hier zu verweilen und in Ruhe Obst zu pflücken. Außerdem wird so der Fuß- und Radweg nicht durch störendes Laub bedeckt. Als Bodenfläche ist hier eine gebundene Sanddecke vorgesehen und die Radfahrstrecke wird mit Betonplatten ausgelegt. Ein Gehölz entlang der Gärten dient als Abstand, um die Privatsphäre der Bewohner zu sichern. Da die Äpfelbäume und Mispelbäume windgeschützt sein müssen, werden Ahornbäume angebaut. Durch ihre Höhe von ca. 6-8 m schützen sie die kleineren Obstbäume (ca. 3-4m Höhe) von Windkräften und bieten den Fußgängern einen angenehmen Schatten im Sommer. Rundförmige Holzbänke rund um den Baumstamm angelegt, sorgen dafür, dass auch Kinder oder etwas kleinere Menschen ihren Spaß beim Pflücken haben. 18 19 20 Die Selbstpflückanlage Die Obstallee endet mit einer Freifläche, die ebenfalls zum Ausruhen einlädt. Hat man noch nicht genug vom Obstpflücken läuft man weiter zur Erdbeerfläche. 21 18 19 20 21 Gestalterische Maßnahmen Obstalle, Grundriss Obstalle, Ansicht Gestaltungselemte rahser evolution 45 Die einen Hektar große Fläche die man dazu benötigt, fügt sich unter die anderen zahlreichen Ackerflächen (Kamille und Lauch) ein.Einige Parkplätze sind vorgesehen, für diejenigen die aus weiterer Entfernung kommen. Ein Stellplatz für den Verkaufsplatz von 10 qm ist ebenfalls geplant. Der Rahserpark 22 23 24 25 22 23 24 25 26 26 Erdbeerfeld Edrbeerstand Outdoor-Amphitheater, Grundriss Outdoor-Amphitheater, Schnitt Gestaltungselemte Das Outdoor-Amphitheater fügt sich in die hier vorhandene Topographie ein. Allerdings steht hier nicht nur dieses Element im Vordergrund. Da es sich um einen sehr bewegungsreichen Ort handelt und der Fußweg zur Innenstadt hier entlang führt, wird vor allem auf eine neue Wegeführung fokussiert. Im Gegensatz zur Obstallee, an der nördlichen Seite der Wohnsiedlung, sollen die Wege gerichtet und eher künstlich, parkähnlich angelegt werden. Hier soll die Verbindung zwischen den Naherholungsgebieten im südlichen Teil Rahsers geschaffen werden. Da die immer wieder auftretende Frage zu einer weiteren Errichtung einer Bahntrasse auftritt, wollen wir der Schule ihre ruhige Lage sichern. Der sogenannte Siedlungsrand bildet sich dann sozusagen aus einem Fußwegenetz in parkähnlicher Situation zusammen. Das Gewerbegebiet liegt außerhalb der Siedlung, nur die Fabrikhalle wird als neuer Zielort zunehmend an Bedeutung gewinnen. Noch zu den Details des OutdoorAmphitheaters: 6 Stufen von jeweils 40 cm Höhe, sind als Betonblöcke in die Rahsenfläche eingearbeitet. 46 renate morawietz, lynn cosyn Die Oberrahserstraße Die Oberrahserstraße soll mit kleineren Kugelbäumchen beschmückt werden. Läuft man entlang dieser Straße müssen einige Bäume weggenommen werden, um den vorhanden Spielplatz sichtbar zu machen. Dies ist für die Sicherheit der Kinder wichtig; der Spielplatz öffnet sich so der Oberrahserstraße, er ist nicht abgeschottet und unbemerkt und vorbeilaufende Fußgänger nehmen den Anfang der Obstallee zum Teil hier schon wahr. Die Joggingstrecke 27 An der Süchtelner Straße führt ein mehr oder weniger direkter Weg zum Naherholungsgebiet. Sinnvoll ist es, diese Zugänglichkeit für die Bewohner erkennbar zu machen. Hier bietet sich die Möglichkeit an, eine Joggingallee hier anfangen zu lassen, die bis zum Sportplatz hinführt. Somit rücken auch die Schrebergärten zum Vorschein, deren Zugang wird qualitativ aufgewertet und verliert somit den Charakter der „vergessenen Hintergärten“. Straßenlaternen sorgen nachts für die nötige Sicherheit. Die Tagesklinik 28 & 29 Da an der Süchtelner Straße eine Tagesklinik geplant ist, ist es von Bedeutung die kleinteilige Architektur die dort vorzufinden ist, den dörflichen Charakter nicht zu zerstören. Das Gebäude der Tagesklinik soll städtebaulich gesehen diese kleinteilige Architektur aufnehmen. Ein in mehrere Teile gegliedertes Gebäude würde diesen Dorfcharakter stärken. 27 Oberrahserstraße 28 Spielplatz 29 Tagesklinik rahser evolution 47 Die Bahntrasse An verschiedenen Stellen, läuft man an der Bahntrasse entlang. Nimmt man die Böschung weg oder entkrautet diese, so entsteht ein hellerer Gehweg. Die Ziegelwand der Bahntrasse, die ca. 4 m hoch ist, gesäubert und mit Straßenlaternen und kleineren Begleitbäumchen umgestaltet wird, bietet dem Fußgänger angenehmere Laufwege. Die Rahserstraße 30 Als letzte Maßnahme wäre die qualitative Umänderung der Rahserstraße. Die relativ gut befahrene Straße, wird sehr stark von Schulkindern überquert. Um die Sicherheit an dieser Straße zu erhöhen, sollen der Fahrradweg, die Fahrbahn und der Fußweg klar von einander differenziert und dementsprechend markiert werden, durch ein Begleitgrün, und/ oder einen Abstandsstreifen. 31 Jogginstrecke 32 Bahntrasse 33 Rahserstraße 31 Fazit Bei der Aufgabe des Praxisprojektes, ein zukunftorientiertes Konzept für die Wohnsiedlung Rahser zu entwickeln, haben wir uns städtebauliche orientiert. Durch eine gründliche Analyse sind wir auf Defizite gestoßen, die wir allerdings als Potenziale nutzen. Die Identität Rahsers soll für die Zukunft gesichert werden. Somit zeigt unser Konzept, dass durch die Schaffung einer Grenze und einer Definition der verschiedenen Siedlungrandbereiche, die Identität Rahsers geschützt, bzw. gestärkt wird. 48 bikash palikhey Notburga Update Bikash Palikhey Vorwort In den ersten drei Jahrzenten der Nachkriegszeit lag die Nachfrage weit über dem Wohnangebot. Das wohnungsbaupolitische Ziel war es, dem entgegen zu wirken durch die Errichtung standardisierter „Massenwohnungsbauten“, die möglichst kostengünstig eine ausreichende Grundversorgung an Wohnraum sicher zu stellen hatten. Die Normierung der Wohngebäude und ihre Vervielfältigung begründen sich durch Wirtschaftlichkeit und den dringenden Bedarf an einfachem Wohnraum nach dem 2. Weltkrieg. Mittlerweile stehen die Wohnungsunternehmen vor der Aufgabe, den vorhandenen Wohnungsbestand, insbesondere diejenigen der Nachkriegsjahre, vermietungssicher und rentabel zu halten. Denn aufgrund des demographischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandels ist in vielen Teilen Deutschlands die Nachfrage nach Wohnraum deutlich zurückgegangen und die Qualitätsansprüche an das Wohnen haben sich stark verändert. Hierdurch hat sich der Schwerpunkt des Wohnungsbaus deutlich vom Neubau zur Bestandsentwicklung verschoben. notburga update Bestand Der Stadtteil „im Rahser“ grenzt direkt an den nördlichen Teil der Innenstadt Viersens und hat somit eine relativ zentrale Lage. Zu Fuß beträgt die Entfernung zum Zentrum (Rathaus) ca. 1.5km. Trotz der stadtnahen Lage wird Rahser durch die im Süden und Osten verlaufenden Bahnlinien deutlich von der Innenstadt abgegrenzt. Im Norden des Gebietes gibt es hauptsächlich Landwirtschaft und die ersten größeren Siedlungen befinden sich erst wieder in Süchteln. Westlich des Gebietes befindet sich ein Landschaftsschutzgebiet, der Naturpark Schwalm-Nette. Rahser ist ein natürlich gewachsenes Viertel. In den verschiedenen Straßenzügen findet man unterschiedliche städtebauliche Leitbilder, wie z.B. Siedlungshäuser der 20er Jahre, 50er Jahre Geschosswohnungsbau. Durch diesen durchgemischten Gebäudetypen hat Rahser einen eher kleinstädtischen Charakter. Wie auch in den meisten anderen Stadtteilen ist Rahser auch von einer starken Tendenz an Suburbanisierung getroffen bzw. größtenteils der Neubauten in Rahser sind Einfamilienhäuser. Die Gebäude im Notburga Viertel sind in der 50’er Jahre entstanden. Nach den städtebaulichen Leitbilder der 50’er-60’er Jahren sind die vier Zeilenbebauung auf großzügigen Grünflächen positioniert. Private Gärten gibt es nicht. Bei der Anordnung der Gebäude ist hier kein eindeutiges Konzept zu erkennen. Die Bausubstanz ist entsprechend dem Bauzustand dieser Bauzeit. In 1992 wurden die Wohnungen saniert (Wärmedämmung auf der Fassade, Einbau von Kunststoff-Fenstern). Zusammenfassend kann man sagen, dass Notburga eine typische 50’er Jahre Wohnsiedlung ist, in der bis heute nicht viel geändert hat. Die Haupterschließung ist entlang der Nord, Ost und West Seite mit Nebenstraßen(Feinwegen) auf der Südseite und zwischen die Zeilenbauten. Es gibt insgesamt vier Zeilenbauten die Nord-West/ Sud-Ost gerichtet ist. Jede Zeile hat zwei Geschosswohnungen, die Obere ist eine Drei- und die Untere eine Zwei-Geschosswohnung. Um es besser verständlich zu machen habe ich die obere Geschosswohnung als Gebäudetyp-1 und die unteren als Gebäudetyp-2 bezeichnet. 1 2 Gebäudetyp-1 Dies ist ein 2-Spanner mit vier Wohnungen auf jeder Etage mit jeweils zwei Treppenhäusern. Die EG Wohnungen liegen 1,2m über dem Gelände. Die zwei Wohnungen sind 66m²(A) und 94m²(B) groß. Gebäudetyp-2 Dies ist eine 1-Spanner-Wohnung mit jeweils einer Wohnung in jeder Etage. Die Wohnung im EG hat auch einen eigenen Eingang. Die Wohnungen sind alle gleich groß, 63m², und mit einem privaten Garten(45m ²) in den EG Wohnungen ausgestattet. 1 2 3 4 5 Rahser Luftbild Schwarzplan Erschließung Gebäudetyp-1 Gebäudetyp- 4 3 5 49 50 bikash palikhey Defizite/Konflikte Der 50‘er Jahre Zeilenbau steht im starken Kontrast zu den anderen Einzelhäusern. Notburga leidet momentan unter einem schlechten Image. Wenn man von der Spielhofstr. auf der Westseite, aus der Richtung Notburga kommt, ist man sofort mit dem Problem des Viertels konfrontiert. Es fehlt eine Raumkante, die Gebäudefront entlang der Spielhofstr wirkt leer. Es gibt zu viel Freifläche, aber keine privaten Gärten. Der grösste Teil der Grünfläche bleibt unbenutzt. Die Wohnungen sehen auch kahl und banal aus, die Eingänge sind unauffällig. Die Grundrisse weisen auch einige Probleme auf. Diese sind zu kleinteilig und entsprechen nicht den heutigen Bedürfnissen. Es fehlt an Außenräumen. Ein kleiner Balkon ist vorhanden, aber der liegt an der Nord-Ost Seite und kriegt wenig Sonneneinstrahlung. 6 Potenzial Den großen unbenutzten Freiraum kann man nicht nur als Defizit sondern auch als Potenzial sehen. Davon kann man sowohl ganz leicht Privatgärten für die EG-Wohnungen schaffen, als auch gemeinsame Mietergärten. Die Gebäude haben eine akzeptable Bausubstanz und die Erschließung ist auch größtenteils in Ordnung. Die Wohnhäuser bieten eine Alternative zu den Einzelfamilienhäusern, die sich nicht jeder leisten kann oder welche auch nicht immer gewollt sind. Die Nähe zur Innenstadt macht Rahser zu einem optimalen Wohnort. Die Freiflächen, Kindespielplätzte und zahlreichen Kindergärten machen Rahser für Familien sehr attraktiv. 7 8 notburga update 51 Ziele Quartier bilden, Durchgemischte Mieterstruktur 9 Das erste städtebauliche Ziel war ein Quartier zu bilden. Der Grundstück soll eine klare Kante kriegen. Dazu kommen auch die Freiräume, welche besser organisiert und gestaltet werden sollen. Die Eingänge der Gebäude sollen stärker betont werden und die Erschließungsfläche sollte nicht nur für den Verkehr zu nutzen sein, sondern ebenfalls Aufenthaltsplätze anbieten. Die Wohnungsgrundrisse sollen aufgelockert werden mit Wohnräumen auf der Südseite und Schlafräumen auf der Nordseite. Das allgemeine Ziel besteht darin, das Quartier und die Wohnungen auszuwerten, damit eine langfristige Vermietbarkeit garantiert ist. Konzept 10 6 Spielhofstrasse 7 Blick auf Notburga von der Spielhofstrasse 8 Abstandsgrün vor Gebäudetyp-2 9 Nelkenweg 10 Konzept pictos Das Notburga Viertel macht allgemein einen schlechten Eindruck. Der Bestand weist einige Gegebenheiten auf, die nicht mehr den aktuellen Wohnbedürfnissen entsprechen. Meine Vorgehensweise war eine Aufwertung zu schaffen, jedoch ohne in das Gefüge einzudringen. Der Bestand und die Struktur bleiben erhalten und nur die Organisation wird umgeändert. Ich würde das mit einem Software Update vergleichen. Notburga kriegt ein Update. Dieses Update bezieht sich auf das heutige Wohnbedürfnis. Da es sich auch um das Bauen im Bestand handelt, ist es wichtig zu fragen ob die Maßnahmen einen Mehrwert schaffen, und nur dann ist es sinnvoll diese durchzusetzen. Die Wohnungen haben keine einheitliche Orientierung, deswegen werden die Maßnahmen auch auf die individuellen Grundrisse angepasst Dies bezieht sich sowohl auf die Freiraumplanung als auch auf die Grundrissänderungen. 52 bikash palikhey Wohnsituationen der 50er Jahre Anfang der 1950 fehlten in der Bundesrepublik ca. 4,5 bis 5 Millionen Wohnungen. Das wohnungspolitische Ziel bestand darin, diesem riesigen Mangel an Wohnungen zu verringern, durch die Errichtung standardisierter „Massenwohnungsbauten“, die möglichst kostengünstig eine ausreichende Grundversorgung an Wohnraum sicher zu stellen hatten. Der politische Druck trägt maßgeblich dazu bei, dass sich innerhalb der Bundesrepublik, vor allem im allgemeinen Wohnungsbau, eine Architektur durchsetzt, die sich stark an Normierung, Typisierung und Rationalisierung orientiert. Dies äußert sich in der Addition gleicher Hauszeilen, Wohnungstypen und Fensterelemente. Als städtebauliches Leitbild entwickelt sich die Idee der gegliederten, durchgrünten und aufgelockerten Stadt; es wurde jedoch stringente Achsen, geschlossene Straßenräume, strenge Reihungen und Symmetrien vermieden. Der Standard dieser Neubauwohnungen war allerdings relativ niedrig. Die durchschnittliche Wohnungsgröße liegt bei ca. 60m². Viele Wohnungen besitzen darüber hinaus keine eigenen Balkone oder vergleichbare Außenräume. Auch der bautechnische Standard war niedrig, was sich in bauphysikalischen Mängeln wie Kältebrücken äußert. 11 .....und heute 12 Der Bevölkerungsrückgang, wirtschaftliche Umstrukturierung von der Industrie- zur Informations- und Dienstleistungsgesellschaft und technische Entwicklungen wie die Entstehung des Internets beeinflussen unsere Gesellschaft derzeit stark. Viele Städte werden in den kommenden Jahren zehn bis zwanzig Prozent ihrer jetzigen Einwohnerzahlen verlieren. Aber es gibt auch gleichzeitig einen deutlichen Zuwachs an Bevölkerungszahlen in vielen deutschen Innenstädten. Die Verringerung der Pendlerpauschale und Eigenheimpauschale, immer weiter steigenden Energiepreise und neue Lebensformen wie Alleinerziehende, Singles, Ältere und „Patchworkfamilien“ tragen dazu bei, dass immer mehr Menschen in die Innenstädte einziehen. Das soziale Umfeld hat sich seit den 50‘er Jahren stark verändert. Durch den durchschnittliche Gehalt von heute, kann man sich viel mehr leisten als in den 50‘er Jahren. Mit dem steigenden Konsum und Image-Bewusstseins haben sich auch die Ansprüche an Wohnungen geändert. Jetzt wird mehr Wert an die Wohnqualität gelegt. Fragen wie – Größe(m² und m³), Außenfläche(Balkon/Terrasse), Privatgärten, Nähe zur Innenstadt und Einkaufszentren sind heute wichtiger denn je. Die rückgängige Nachfrage an neuen Wohnungen hat die Konkurrenz zwischen den Anbietern sehr verschärft. Die Herausforderung heute für die Wohnungsanbieter ist nicht mehr die, um neue Kunden gewinnen zu können, sondern die, die Kunden die man schon hat beibehalten zu können. 13 14 11 Verteilung der Haushalte 1961 12 Verteilung der Haushalte 2010 13-14 Constructa Hannover,Ausstellungsteil Hildesheimer Straße, Karl Gutschow, 1951-53, Situation 1939 und Lageplan1953, Gebäudetypologien 15 Hansaviertel, Lageplan 1957, Modell und Luftbilder 16 Geplante Bebauung des Luisenhofs an der Frankfurter Straße, Offenbach 15 16 notburga update 53 Maßnahmen Freiraum 17 Die Freiraumplanung spielt hier eine Schlüsselrolle. Ein besonderer Charakter der 50‘er Jahre Bauten sind die offenen Grünflächen. Dieses Grün bleibt größtenteils beibehalten. In die Mitte der offenen Freifläche werden ein paar Bäume gepflanzt, damit es nicht leer wirkt und damit auch das Sonnenlicht auf der Nordfassade reflektiert wird. Die Bäume sind bilden ausserdem eine „durchsichtige Wand“ die die unterschiedlichen Räume trennt - Privat-Gemeinschaftlich und Erschließung-Freifläche-. Der erste Schritt bestand darin, den Freiraum zu zonieren. Um das zu realisieren habe ich drei Elemente ausgesucht- Bäume, Hecken und Wände. Die Baumallee entlang der Spielhofstr. schirmt Notburga ab und bildet eine klare ablesbare Kante. Es werden weitere Bäume gepflanzt um dem „leeren Grün“ entgegen zu wirken. Die vorhandene Erschließung bleibt größtenteils erhalten. Die zwei rechts gelegenen Zeilenbauten haben eine gemeinsame Erschließungden Rosenpfad. Die alte zerfallene Asphaltstraße wird mit Betonsteinpflaster ersetzt. Die niedrigen Wände und die Hecken dahinter bilden gemeinsam eine Vorkulisse die, die Gebäude dahinter in den Hintergrund drängt. Die dadurch resultierenden privaten Räume werden für die EG-Wohnungen als Privatgärten benutzt. Die niedrige Mauer (50 cm hoch) kann auch als Sitzgelegenheit benutzt werden. Die zweite Zeile (v. Links) hat eine Erschließung die ungünstig nah an den Gebäuden liegt. Dies wurde ein bisschen nach links verschoben um mehr Platz für die Südgärten auf der Südseite des Gebäudes zu gewinnen Die Freiräume rund um den EG Wohnungen bieten ein großes Potenzial an. Die Maßnahmen die dort getroffen werden, sind genau so individuell wie die Orientierung des Grundrisses. 54 bikash palikhey Parken Das Parken findet ausschließlich entlang der Erschließung statt. Die Stellplätze werden in regelmäßigen Abständen mit Bäume durchpunktiert. Die Oberfläche der Stellplätze ist aus Rasengitterstein die das Wasser versickern lässt. Dort wo Rasengitterplatten eingesetzt werden, entstehen Flächen mit einem hohen Grünanteil was die Stellplätze von der Straße klar unterscheidet. 18 Außenräume Die oberen Etagen werden mit großzügigen Balkonen ausgestattet. In dien meisten Fällen handelt es sich nur um einen Umbau des Balkons der schon vorhanden ist. Die neuen Balkone sind alle auf der Südseite. Die Balkone sind alle mit dem Wohnzimmer verknüpft. Die Trennwände zwischen dem Wohnzimmer und dem Balkon ist größtenteils verglast, damit ein fließender Übergang zwischen den Innen- und Außenräume gewährleistet ist. 19 20 Maßnahmen Gebäudetyp-1 Wohnungen im EG Das Abstandsgrün vor den EG Wohnungen wird zu Privatgärten umgewandelt. Die einzige Ausnahme zu dieser Regel sind die EG Wohnungen der zweiten Zeile von rechts. Die Gärten hier sind als Gemeinschaftsgarten vorgesehen. Die Eingänge werden durch Hecken und ein Tor besser gegliedert. Es gibt vor jedem Eingang einen Müllplatz und einem Fahrradstellplatz. Die Türklingel und die Briefkästen befinden sich neben der überdachten Haustür. Es gibt zwei Hauseingänge, einen Eingang im Treppenhaus (Haupteingang) und den anderen durch den Garten (Hintereingang). Die neuen aufgelockerten Grundrisse verbessern den Wohnkomfort. Die Küche-Wohn-Ess- 21 Küche A - 66 m² 22 Bad Schlafzimer Wohnzimmer Küche-Wohn-Block Esszimmer Nebenräume B - 94 m² notburga update 23 76 m² 24 106 m² 55 Bereiche sind jetzt alle zur Südseite gerichtet, mit einem direkten Zugang zu den Gärten. Da das EG 1,2m über dem Gelände liegt, gibt es eine Treppe zum Garten von der Außenterrasse aus. Diese Außenterrasse ist eine Erweiterung des Wohnraumes. Große Öffnungen zwischen den Wohnbereichen und dem Garten sorgen für mehr Licht in die Wohnung und verbinden die Außen- und Innenräume. Die Eltern können auch dadurch ihre Kinder besser beaufsichtigen während der Hausarbeit. Der größte Umbau findet in der Wohnung B statt.Dies war auch notwendig um die Zimmer besser anzuordnen. Die Schlafräume lagen auf der Südwest-Seite und das Küche-Wohnzimmer ungünstig auf der Nord-Ostseite. Nach dem Umbau liegen der Küche-Ess-Wohnblock auf der Südseite mit direktem Zugang zu der Gartenterrasse und dem Privatgarten.Die Schlafräume liegen jetzt auf der Nordseite. Die 3-ZimmerWohnungen werden zu 2-ZimmerWohnungen umgewandelt. Die frei gewonnene Fläche kommt dem Wohnräumen zugunste. Wohnungen in OG Die Wohnungen im OG sind ähnlich denen vom EG. Als Kompensation für die Gärten ist die großzügige Außenfläche. Die Balkone sind alle nach Süden gerichtet, 2m tief und die Länge variiert jeweils. Die Balkone sind mit dem Wohnzimmer verknüpft. 25 26 17 Lageplan 18 Schnitt Gebäudetyp-1 19 Ansicht Gebäudetyp-1 Bestand 20 Ansicht Gebäudetyp-1 nach Umbau 21 Plan Gebäudetyp-1 Bestand 22 Plan Gebäudetyp-1 Bestand picto 23 Plan Gebäudetyp-1 nach Umbau(a) 24 Plan Gebäudetyp-1 nach Umbau(a) picto 25 Plan Gebäudetyp-1 nach Umbau(b) 26 Plan Gebäudetyp-1 nach Umbau(b) picto 56 bikash palikhey Maßnahmen Gebäudetyp-2 Die zweigeschossige Wohnungen am Südende der Zeile ist vom Erscheinungsbild her eher ein Reihenhaus als ein Geschosswohnungsbau. Weil die Nachfrage für Einfamilienwohnungen immer noch wächst und damit auch das Wohnangebotsspektrum verbreitet wird, habe ich entschieden die zwei Geschosse zu einer Wohneinheit zu machen. Damit entstehen für jede Zeile zwei Maisonetten-Wohnungen die für kleine Familien gedacht sind. Die Sanierung von 1992 beschränkte sich auf die Fassade und das Dach blieb unsaniert. Das Dach ist nicht gedämmt. Das Dachgeschoss kann man sanieren und als Wohnraum nutzten, wenn Bedarf da ist. Ein anderer Mehrwert ist der Privatgarten. Die Aufteilung der Zimmer ist wie folgend- Wohnen im Erdgeschoss und Schlafen im Obergeschoss. Die Trennwände von dem Erdgeschoss werden abgerissen um einen große n hellen Raum zu schaffen mit Küche, Wohnzimmer und Esszimmer drin. Die alte Küche wird zum Bad umgewandelt. Die Schlafzimmer sind alle in dem 1 OG. Dir Loggia im 1OG wird zugemauert um ein Arbeitszimmer zu schaffen. 27 28 29 30 Küche 31 Bad Schlafzimer Wohnzimmer Küche-Wohn-Block Esszimmer Nebenräume notburga update 57 32 33 34 35 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Schnitt Gebäudetyp-2 Ansicht Gebäudetyp-2 Bestand Ansicht Gebäudetyp-2 nach Umbau Plan Gebäudetyp-2 Bestand(EG/OG) Plan Gebäudetyp-2 Bestand picto Plan Gebäudetyp-2 EG Umbau Plan Gebäudetyp-2 EG Umbau picto Plan Gebäudetyp-2 Umbau 1OG Plan Gebäudetyp-2 Umbau 1OG picto 58 bikash palikhey Fazit Das besondere Merkmal in dieser Entwicklung des Wohnungstrends der 1950‘er bis heute, ist die Individualisierung der Gesellschaft und dementsprechend auch des Wohnens. Die Wohnungsnot nach dem Kriegsende ist längst vorbei. Der größte Teil der Wohnungen ist auch in dieser Zeit entstanden. Die rückgängige Bevölkerungszahl, die demografische Entwicklung und der Wunsch nach maßgefertigten Konsumartikel beeinflussen auch das Wohnen. Die meisten 50’er Jahre Wohnungen sind heute nicht mehr auf dem aktuellen, bautechnischen Stand und auch dieWohnqualität lässt zu wünschen übrig. Die Verantwortung der Architekten und Stadtplaner liegt jetzt darin, so weit wie möglich die vorhandenen Wohnungen zu „reparieren“ anstatt sie abzureißen und neuzubauen. Derzeit sind 40% des Gesamtmülls Bauschutt. Das Bauwesen verbraucht weltweit die meiste Energie. Dies sind genügend Gründe, um alle zu überzeugen, dass Sanierung der richtige Weg ist. Die Herausforderung liegt jetzt darin die zukünftige Mieter in dieser sanierte Wohnungen zu locken. 36 37 notburga update 38 39 40 36 37 38 39 40 Modellfoto Modellfoto Modellfoto Perspektiv Rosenpfad Vogelperspektiv Rosenpfad 59