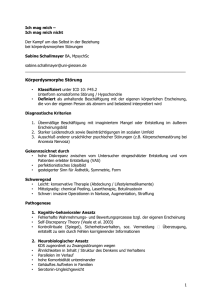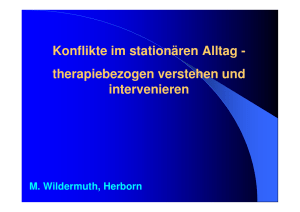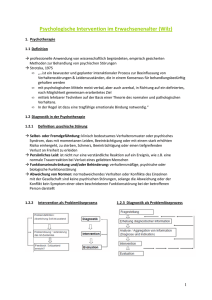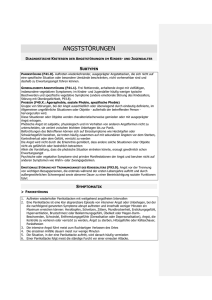klinische psychologie – ätiologie
Werbung

Rheinische Friedrich- Wilhelms- Universität Bonn Institut für Psychologie Klinische Psychologie - Ätiologie Schriftliche Arbeit für die wissenschaftliche Übung Z4- Anwendungen der Psychologie (Arbeitsgruppe Klinische Psychologie) Leitung: PD Dr. Ina Grau Wintersemester 2009/10 vorgelegt von : Daniela Sandfort Nussbaumer Winkel 6 51467 Bergisch Gladbach [email protected] KLINISCHE PSYCHOLOGIE – ÄTIOLOGIE 1. ALLGEMEINE EINFÜHRUNG Ätiologie ist die Lehre von der Erforschung und Bestimmung von den Ursachen psychischer Störungen im Allgemeinen und einzelner Störungssyndrome im Besonderen. Für die Klinische Psychologie ist die Frage nach den Ursachen psychischer Störungen nicht nur ein theoretisches, sondern im Hinblick auf die Diagnostik und Intervention auch ein praktisches Anliegen. Bei den meisten psychischen Störungen kann man nicht von einer einzigen Ursache ausgehen; man nimmt eine Ursachenkette bzw. Ursachenbündel an und spricht von Multikausalität bzw. multifaktorieller Entstehung. Erst das Zusammenwirken mehrerer Faktoren führt zur Ausformung einer psychischen Störung. Man spricht demnach nicht von der Ursache bzw. Ätiologie einer Störung, sondern von den Bedingungen einer Störung, denn um der Komplexität der Störung gerecht zu werden, ist ein differenzierter Ursachenbegriff nötig. In der Klinischen Psychologie werden zwei Arten von Bedingungen unterschieden, die beide für das Auftreten einer psychischen Störung von Bedeutung sind: dies sind zum einen pathogene (krankheitsfördernde) Faktoren bzw. Stressoren und zum anderen protektive (schützende) Faktoren bzw. Ressourcen. Erstere sind solche Bedingungen („Ursachen“), die zum Auftreten einer psychische Störung beitragen, zweitere sind solche, die das Auftreten einer Störung eher behindern, indem sie den Störungsbedingungen entgegenwirken. Demnach führen pathogene Faktoren bzw. Risikofaktoren zu einer Zunahme, protektive Faktoren hingegen zu einer Abnahme der Auftrittswahrscheinlichkeit. Eine Erklärung des Auftretens einer psychischen Störung muss deshalb auf beide Faktorengruppen eingehen. Die verschiedenen Faktoren, die psychische Störungen bedingen, können biologischer, psychischer, sozialer und ökologischer Art sein; daher spricht man auch von einem sogenannten Biopsychosozialen Ansatz, da die Betonung auf interaktiven Prozessen liegt. Die sogenannte integrative Perspektive greift dabei auf neurobiologische, psychodynamische und kognitivbehaviorale Perspektiven zurück. Dies ist ein Konzept, bei dem die Ursachen und Bedingungen nicht allein auf eine Ebene reduziert werden, sondern wo einzelne Ebenen sich gegenseitig beeinflussen, so dass Faktoren aller unterschiedlicher Ebenen von Bedeutung und für die Entstehung einer Störung verantwortlich sind; dabei variiert die relative Bedeutung eines jeden einzelnen dieser Faktoren über die Lebensspanne. Ein Beispiel für ein derartiges Interaktionsmodell, wo das Zusammenwirken von unterschiedlichen Bedingungen für eine Störung verantwortlich gemacht wird, ist das sogenannte VulnerabilitätsStress-Modell (auch Diathese- Stress-Modell genannt); dieser Ansatz erklärt das menschliche Verhalten und das Auftreten von Störungen als Interaktion biologischer, kognitiv-affektiver, sozialer und Umweltbezogener Variablenbündel, unter Einschluss von Entwicklungsbezogenen Aspekten. Vulnerabilitäts-Stress-Modelle besagen also, dass für den Ausbruch einer psychischen Störung eine (angeborene oder früh erworbene) Anlage vorhanden sein muss, die dann zusammen mit entsprechenden Belastungen zur Störung führt. Je stärker die Anlage (Vulnerabilität) ist, umso geringere Auslöser (Stressoren) sind notwendig für die Entstehung einer Störung, und umgekehrt; d.h. eine erhöhte Anfälligkeit führt beim Eintreten entsprechender weiterer (belastender) Faktoren (Stress) zum Krankheitsausbruch. Die zwei Einflussgrößen, die den Umgang mit herausfordernden Belastungssituationen bestimmen und beeinflussen, sind die schon genannten Risiko- und protektiven Faktoren; dabei werden Risikofaktoren in Verbindung mit der Entwicklung von Vulnerabilität und ihrer Bedeutung bei der Störungsauslösung gesehen, protektive Faktoren hingegen werden zumeist im Zusammenhang mit der Resilienz und sog. Ressourcen diskutiert. Die Vulnerabilität bzw. Resilienz stellen bisher keine für ein Individuum messbaren Größen dar und sind rein hypothetische Konstrukte, die das Ergebnis des Einwirkens von schädigenden bzw. schützenden Einflüssen im Verlauf der Entwicklung sind. Da es wichtig ist, nicht nur einen Faktor verantwortlich zu machen, werden also verschiedene Bedingungskomplexe unterschieden. Die prädisponierenden Bedingungen begünstigen die Ausformung einer psychischen Störung; einerseits können dies Erbanlagen und biologische Faktoren sein, die zu einer psychischen Störung führen können, andererseits fallen auch ungünstige Umweltbedingungen in der Kindheit und Jugend darunter. Von auslösenden Bedingungen spricht man, wenn bestimmte Ereignisse dem Auftreten einer Störung vorausgehen, beispielsweise traumatische oder belastende Ereignisse, Frustrationen etc. Eine dritte Differenzierung in der Ätiologie sind die Aufrechterhaltenden Bedingungen, auf die hier aber nicht näher Bezug genommen wird. Im Folgenden wird zunächst auf die letztgenannten, dann auf erstere Bedingungen eingegangen; es werden erst die Risikofaktoren Stress und Vulnerabilität, und schließlich die die schützenden Faktoren und die Resilienz behandelt. 2. GRUNDLEGENDE KOMPONENTEN: STRESS, VULNERABILITÄT UND RESILIENZ Stressbewältigung steht in enger Beziehung zu psychischen Störungen; Belastungen können (Mit-) Ursachen oder (Mit-) Auslöser sein. Unter sogenannten Stressoren versteht man ganz allgemein Ereignisse, Situationen und Bedingungen, die für die Person subjektiv und/oder objektiv belastend sind. Die Stressforschung spricht dabei von verschiedenen Kategorien von belastenden Ereignissen; zu nennen sind kritische Lebensereignisse (zeitlich genau bestimmbar), traumatische Belastungen (Ereignisse hoher Intensität), Alltagsstressoren (allgemein störende Ereignisse im Alltagsleben, die das Wohlbefinden beeinträchtigen) und chronischen Stressoren (die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken). Dabei können nicht nur äußere Faktoren als Stressoren wirken, sondern auch innere, wie Ziele und Werte, deren Ignorieren oder Nichtrealisierung für die Personen negative Folgen zu haben drohen. Stress ist ein Prozess der Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt, und verschiedene psychologische Faktoren wirken zusammen, die das Stresserleben beeinflussen. Wenn belastende Ereignisse eintreten, erfolgen auf Seiten des Individuums Bewertungsprozesse, die das Ereignis einschätzen; diese bestimmen Art und Intensität des Stresserlebens bzw. der Stressreaktion. Die Art der Bewältigung einer Belastung, d.h. wie die Person mit der Situation umgeht, wird demnach durch Persönlichkeitsmerkmale und durch Aspekte der sozialen Umwelt beeinflusst. Stress beschreibt also allgemein eine Anforderungssituation einer Person auf der biologischen, sozialen oder psychologischen Ebene, bei der diese eine Anpassungsreaktion zeigen muss, um die Herausforderung zu bewältigen. In diesem Zusammenhang steht auch der Begriff des Coping, der sich auf die Handlungskompetenz einer Person bezieht und das Ausmaß meint, in dem sie mit Schwierigkeiten und stressreichen Lebensereignissen fertig wird und sie bewältigt. Es wurde schon weiter oben ausgeführt, dass belastende Ereignisse alleine selten psychische Störungen verursachen, denn die Vulnerabilitäts-Stress-Hypothese nimmt ja an, dass Stressoren nur eine Teilursache sind und daneben noch eine besondere Vulnerabilität für die Entstehung einer Störung gegeben sein muss; und dabei gibt es Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Störung erhöhen, während protektive Faktoren die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Bewältigens charakterisieren. Diese schützenden bzw. schädigenden Einflüsse können sowohl außerhalb (materiell, sozial) als auch innerhalb des Individuums (personal) lokalisiert sein, können also den verschiedenen (biologisch, psychologisch, sozial, ökologisch) Ebenen zugeordnet werden; sie beziehen sich demnach auf Personenmerkmale und Umweltbedingungen. Da die schädigenden Einflussgrößen im Zusammenhang mit der Entwicklung stehen, wird der Verlauf einer Störung in mehrere aufeinanderfolgende Phasen unterteilt, die für die Erklärung bestimmter Störungen allerdings unterschiedlich gewichtet werden. Die Prä- und perinatale Phase bezieht sich auf die Zeit vor der Geburt und der Geburt; Einflussgrößen, die hier von Bedeutung sind, sind genetische und vererbte Faktoren und solche, die während der Schwangerschaft wirksam werden. Es handelt sich also um Zustände, die angeboren sind, und die Summe dieser Einflussgrößen setzen in unterschiedlichem Ausmaß Randbedingungen für die weitere Entwicklung. Das Ergebnis dieser Einflussgrößen bzgl. einer psychischen Störung wird auch primäre Vulnerabilität genannt, das bei der Geburt vorhandene Risiko. Ein Beispiel für unterschiedliche negativ beeinflussende Faktoren auf der biologischen Ebene sind also genetische Faktoren, eines auf der ökologischen Ebene wäre radioaktive Belastung. Vulnerabilität kann also einerseits biologisch/genetisch beeinflusst und bestimmt sein, andererseits kann sie auch erworben oder gelernt werden, also von der Umwelt bedingt sein; dies wird auch sekundäre Vulnerabilität genannt und beschreibt das nach der Geburt erworbene Risiko. Sie steht dabei in Zusammenhang mit der Sozialisations- bzw. Entwicklungsphase, die die frühe Kindheit, über die Kindheit bis ins Erwachsenenalter beschreibt; die folgenden Ausführungen beziehen sich auf diese Phase. Kategorisch gibt es auch noch die Phase vor dem Ausbruch der Störung, wo im Vorfeld des Störungsausbruchs die Frage nach den Auslösern gestellt wird (wobei die Stressforschung wie bereits angedeutet betont, dass wie auch immer geartete belastende Ereignisse Störungen auslösen können), sowie die Phase nach dem Störungsausbruch, die hier nicht näher thematisiert werden. Im Zusammenhang mit der sekundären Vulnerabilität ist die Perspektive der Entwicklung als lebenslanger Prozess von Bedeutung, die besagt, dass der Mensch sich in seinem gesamten Leben aufgrund unterschiedlicher Einflussgrößen verändert. Die Psychoanalytische Perspektive, dass die frühe Kindheit die Hauptdeterminante und nahezu allein verantwortlich für die Entstehung psychischer Störungen sei, ist somit nicht mehr haltbar; dabei ist aber unbestritten, dass die Kindheit eine zentrale Sozialisationsphase darstellt, denn psychische Störungen sind zumeist eng mit der Individualentwicklung eines Menschen verbunden. Im Entwicklungsverlauf eines Menschen gibt es altersbezogene biologisch, kulturell-soziale oder persönlich bedingte Aufgaben, von deren erfolgreichen Lösung eine störungsfreie Entwicklung abhängt. Entwicklung als lebenslanger Prozess meint also eine Sequenz von Entwicklungsaufgaben; eine erhöhte Vulnerabilität kann entstehen, wenn schädigende Einflüsse die Bewältigung dieser Entwicklung stören. Soziale Einflüsse können generell Störungselemente von Entwicklungsaufgaben sein, wenn beispielsweise die sozialen Lebens- und Entwicklungsbedingungen einer Person nachteilig sind. Zur Verdeutlichung seien hier kurz Beispiele für Entwicklungsaufgaben und aufgabentypische Störungen angeführt: Eine Entwicklungsaufgabe in der frühen Kindheit ist der Bindungsaufbau, und aufgabentypische soziale Störungsquellen können eine gestörte Mutter/Kind- Interaktion, die Erfahrung von Gewalt oder Missbrauch sein; eine Entwicklungsaufgabe in der Adoleszenz ist die Identitätsfindung, und hier könnten beispielsweise autonomiehemmende familiäre Bedingungen eine soziale Störungsquelle darstellen. Typische soziale Störfaktoren sind also Bindungsstörungen durch eine negative Interaktion mit der Bindungsperson, welche solche Einflüsse sind, die durch andere Personen charakterisiert sind (allgemeine Konflikte); es können aber auch Einflüsse durch Institutionen sein, als auch solche materieller Art, wie Armut und schlechte Wohnverhältnisse, sowie medialer Art, durch TV (allgemeine unvorteilhafte Lebensverhältnisse). Daneben gibt es noch die Personeninternen Vulnerabilitäten, wie z.B. Kognitive Defizite, negative Selbstkonzepte und Attributionsstile. Insgesamt bedeutet Vulnerabilität eine (angeborene oder erlernte) Anfälligkeit bzw. Erkrankungswahrscheinlichkeit und führt an sich nicht zur Störung; hinzutreten muss eine Auslösersituation, wo das Eintreten eines bestimmten Ereignisses zum Ausbruch einer Störung beitragen kann. Bei der Entwicklung und dem Verlauf von psychischen Störungen handelt es sich allerdings um ein dynamisches Geschehen; die Wahrscheinlichkeit zu erkranken stellt meist keine stabile Größe dar, sondern kann sich aufgrund von internen und externen Einflussgrößen wandeln. Die Stabilität der Vulnerabilität ist insofern negativ, als diese durch entsprechende Lebensbedingungen und Lebensphasen gestärkt oder gemildert werden kann. Sie ist als Ergebnis des Prozesses vom Einwirken verschiedener Einflußgrössen weder intraindividuell, noch interindividuell eine Konstante, sondern eine dynamische Größe. Doch für die Entwicklung von Störungen sind nicht nur innere und äußere pathogene Faktoren von Bedeutung, sondern auch protektive; während Vulnerabilität die Entwicklung einer Störung begünstigt, wird angenommen, dass Störungen umso unwahrscheinlicher werden, je mehr auf Resilienz- und Unterstützungsfaktoren zurückgegriffen werden kann. Im Zusammenhang mit den protektiven Faktoren steht das Konzept der Resilienz/ der Ressourcen, die für die Entwicklung von Störungen somit ebenfalls von Bedeutung sind. Als Resilienz wird das Ausmaß an Widerstandskraft gegenüber Belastungen bezeichnet ; auch dies ist ein Personencharakteristikum, das ein Ergebnis von transaktionalen Prozessen darstellt und wie die Vulnerabilität eine dynamische Größe, die in unterschiedlichen Phasen zu- oder abnehmen kann. Es ist die Fähigkeit einer Person, auch in Gegenwart von extremen Belastungsfaktoren und ungünstigen Einflüssen proaktiv zu handeln; resiliente Menschen können auch bei negativen Lebensereignissen oft eine erfolgreiche Anpassung an veränderte Bedingungen erreichen. Auch hier können personeninterne und externe Quellen unterschieden werden; Beispiele für den Belastungswiderstand fördernde Persönlichkeitseigenschaften, also für protektive Faktoren im Umgang mit Stressoren, sind ein hohes Selbstwertgefühl, emotionale Stabilität und seelische Gesundheit, die als Fähigkeit zur Bewältigung innerer und äußerer Anforderungen definiert wird. Ein weiteres Beispiel ist die Widerstandsfähigkeit, die ein komplexes System von selbst- und umweltbezogenen Überzeugungen einschließt, die die Person in ihrer Auseinandersetzung mit belastenden Ereignissen unterstützen, z.B. die Überzeugung, dass Herausforderungen und Veränderungen zum Leben gehören und die Möglichkeit zu Wachstum enthalten; die Bewertung von Stressoren erfolgt dann eher selbstwertfördernd, da Belastungen eher als herausfordernd und nicht bedrohlich wahrgenommen werden. Risikofaktoren können auch an Verhaltensweisen festgemacht werden, die zu positiven Mensch-Umwelt-Interaktionen führen, wie von Geselligkeit, Ausgeglichenheit und Selbstständigkeit bekannt ist, sowie gut entwickelte Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten. Der Begriff der Ressourcen zielt in die gleiche Richtung wie das Konstrukt der Resilienz. Ressourcen sind ganz allgemein Potentiale, die die Person in der Auseinandersetzung mit Belastungen aktivieren können. Psychische Ressourcen beschreiben individuelle Handlungskompetenzen; daneben gibt es aber auch materielle Ressourcen wie ökonomische Mittel, sowie soziale Ressourcen, also zwischenmenschliche Beziehungen, aus denen das Individuum emotionale Unterstützung für die Bewältigung von Belastungen zieht. Die soziale Umwelt, sowohl die soziale Schicht als auch Soziale Netzwerke, spielen eine wichtige Rolle, da sie als protektive Faktoren die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Bewältigens belastender Situationen charakterisieren. Soziale Netzwerke sind Unterstützungsfaktoren, die pathogene Einflüsse mildern können und sich direkt auf das Umfeld beziehen; sie bestehen u.a. auch in stabilen Beziehungsangeboten in der Kindheit (und im Erwachsenenalter), denn positive Beziehungen zu primären Bezugspersonen stellen einen wesentlichen Schutzfaktor dar. Durch das Soziale Netzwerk erfährt das Individuum u.a. emotionale Unterstützung und Anerkennung. Das Konstrukt des Sozialen Netzwerkes meint dabei das System der zwischenmenschlichen Beziehungen eines einzelnen Individuums, d.h. das persönliche Beziehungsnetzwerk, bei dem es verschiedene Kriterien gibt (subjektive Bedeutung eines Menschen, Rollenzugehörigkeit, Unterstützungsfunktionen und Kontaktfrequenz); der Begriff der sozialen Unterstützung bezieht sich auf die Befriedigung spezifischer sozialer Bedürfnisse nach Nähe, Geborgenheit, Information, praktischer Hilfe, Entspannung und Beruhigung innerhalb wie außerhalb von Belastungen. Soziale Unterstützung und soziale Beziehungen können also durch ihre stresspuffernden und Selbstwert-fördernden Funktionen eine besondere Bedeutung als protektive Faktoren einnehmen. 3. SCHLUSS UND AUSBLICK Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass Vulnerabilitäts-Stress-Modelle zu beantworten suchen, wie die große Variabilität der Reaktionen auf Belastungen zu erklären ist, warum gewisse Personen schnell mit Beeinträchtigungen gewisser psychischer Funktionen reagieren und andere sich als resistent erweisen, und welche Bedeutung schweren, mittleren oder kleineren chronischen Belastungen dabei zukommt. Die Entstehung von Störungen ist ein komplexes multifaktorielles Geschehen, an dem in verschiedenen Phasen unterschiedliche Faktoren unterschiedlicher Ebenen beteiligt sind, und das Zusammenspiel der pathogenen und protektiven inneren und äußeren Bedingungen entscheidet über die Anpassungserfolge im lebenslangen Entwicklungsprozess. Die krankheitsfördernde Wirkung von Belastungen, d.h. die Bedeutung bestimmter Stressereignisse und das Ausmaß von Stressbelastungen und ihre Auswirkungen, ist abhängig von der Vulnerabilität und Resilienz einer Person und ihres Entwicklungsstadiums, welche die Art und Weise beeinflußen, wie Personen mit Belastungen umgehen, d.h. ihre Bewältigungskompetenz bestimmen. Gestörtem Verhalten geht nicht zwingend, aber oft eine Störung in der Entwicklung voraus; angeborene und durch die Lerngeschichte erworbene Unterschiede in der primären und sekundären Vulnerabilität machen Menschen interindividuell unterschiedlich anfällig und empfänglich für krankheitsfördernde Einflüsse, und das zweite pathogene Faktorenbündel sind belastende negative Lebensereignisse, die auf die Entwicklung einwirken. Persönlichkeits- und Merkmale der sozialen Umwelt können zwar die Entwicklung von psychischen Störungen fördern und zu einer Intensivierung des Stresserlebens beitragen, können jedoch auch als schützende Größen wirken, indem sie zur Reduktion der Stressreaktion beitragen. Es wurde deutlich, dass der heutige Forschungsstand für die Entwicklung einer Störung das Zusammenspiel mehrerer Faktorenbündel verantwortlich macht. Eine ätiologische Erklärung psychischer Störungen kann jedoch niemals vollständig sein, weil sich nie alle für eine Störung relevanten Faktoren anführen lassen. Doch mit interaktionalen Vulnerabilitäts-Stress-Modellen ist eine breitere und widerspruchsfreiere Integration verschiedener Erkenntnisbeiträge zum Verständnis psychischer Störungen möglich, da sie sowohl Anlage-Umwelt-Interaktionen als auch Entwicklungsaspekte integrieren. Wichtig ist jedoch, dass die Zusammenhänge zwischen den als Ursachen unterstellten Bedingungen und dem Auftreten einer psychischen Störung probabilistischer Natur sind: Die betreffenden Ereignisse treffen nicht mit Sicherheit, sondern nur mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit ein. Weitere interdisziplinäre Forschungen können zu Ergänzungen der als Ursachen einer Störung konstituierten Bedingungen führen, denn die gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisbasis ist noch außerordentlich schmal und selbst die Fragen nach den wichtigsten Risikofaktoren kann zumeist nicht mit hinreichender Präzision beantwortet werden; es gibt bisher für keine einzige Störung hinreichend gesicherte ätiologische Modelle, die es erlauben, alle relevanten Befunde widerspruchsfrei einzuordnen. Die Suche nach adäquateren Modellen und die bessere Aufklärung von spezifischen Schlüsselprozessen für die Entstehung und den Verlauf gestörter Funktionen ist und bleibt damit die Schlüsselaufgabe der Klinischen Psychologie; Biopsychosoziale Modelle stellen die Zielvorstellung für die Ätiologie dar. Die Konzepte Stress und Vulnerabilität sind dabei wesentliche Kategorien für die Ätiologie von Störungen, und auch die Resilienzforschung, die sich mit den Faktoren befasst, die die Wirkungen pathogener Bedingungen zu vermindern mögen, wird in Zukunft relativ gute Kenntnisse über Risikofaktoren zu ergänzen haben und bessere Modelle des Zusammenwirkens von Schutz- und Risikobedingungen ermöglichen. Ein interessanter Aspekt dabei ist, dass der Fokus der Forschung sich somit vom Defizitären einer Krankheit auf gesundheitserhaltende Faktoren verschiebt. Quellen: - U. Baumann, M. Perrez: Lehrbuch Klinische Psychologie- Psychotherapie. 2005. Bern: Huber. H. Wittchen, J. Hoyer: Klinische Psychologie und Psychotherapie. 2006. Berlin: Springer.