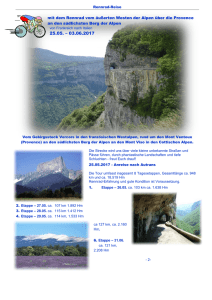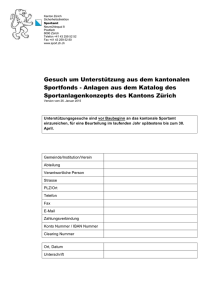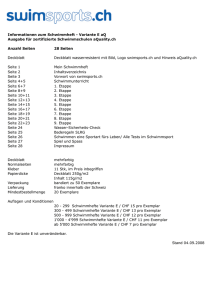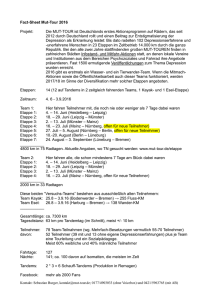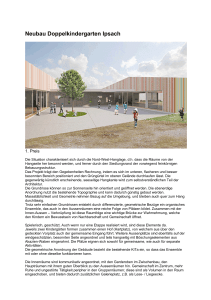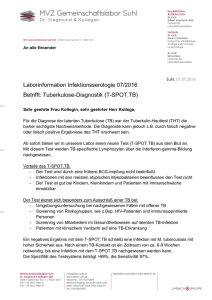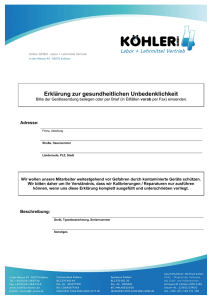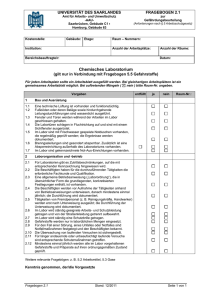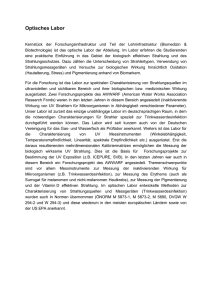PAOLOPAOLO
Werbung

PaoloPaolo P AOLO P AOLO 1. Wettbewerbsstufe Projektbeteiligte Gesamtleistungsanbieter: Federführende Firma: Architekt: Bauingenieur: Elektroingenieur: HRS Real Estate AG, Bern Bollhalder & Eberle AG Henauer Gugler AG Hefti. Hess. Martignoni GmbH HLK-Ingenieur: Sanitär Ingenieur: Koordination Haustechnik: Laborplaner: Energiespezialist: Hochstrasser Glaus und Partner AG Der Ingeniör Kurt Weiss GmbH Aro Plan AG Lemon Consult GmbH Städtebau und Architektur Auf städtebaulicher Ebene schafft der Entwurf den Spagat zwischen dem engen Korsett der Überbauungsordnung und der grossen Fülle des Raumprogramms. Die Gesamtkubatur sucht den Bezug zur Umgebung mittels gross- und kleinmassstäblichen plastischen Anpassungen. Höhenstaffelungen mit zwei unterschiedlichen Kopfbereichen erzeugen eine bewegte städtische Silhouette, die sich harmonisch in den Strassenraum einfügt und zusätzlich gegen das Lobhaus einen schönen Platz erzeugt. Die Komposition der Fassade spielt mit leichten volumetrischen Profilie1 PaoloPaolo rungen des Gesamtvolumens und geometrisch abwechslungsreichen Zeichnungen der Flächen. Der städtebaulichen Gesamtfigur müssen grosse Qualitäten attestiert werden. Als erste Etappe wirkt das Gebäude jedoch allzu fragmentarisch in seiner Mächtigkeit. Der Entwurf bietet einiges zum Thema Publikumsnutzung. Die Anbindung an den Strassenraum geschieht im Erdgeschoss über eine zweigeschossige Laube mit Vorplatz, wobei die Niveauregulierung nicht ganz ersichtlich ist. Besonders interessant für das Publikum ist die Arkade im Kopfbereich mit dem baumbestandenen Platz beim Lobhaus. Speziell zu erwähnen sind die grosszügigen Eingangshallen mit Galeriegeschossen für Seminarräume und Sitzungszimmer, die auch für Aussenstehende bestimmt sind. Die Idee ist nicht uninteressant, die Auslagerung führt aber eigentlich zu einem Kompromiss, der für die Rechtsmedizin respektive Forschung nicht ideal erscheint. Zusätzlich verdrängen die mehrgeschossigen Lufträume deutlich Raum, der die Geschossflexibilität mindert respektive nur noch Büros ermöglicht. In den Regelgeschossen wird ein Dreibünder vorgeschlagen, der funktional nicht ganz ausgereift ist. Beurteilung der Fassade Die Fassade ist gestaffelt horizontal gegliedert. Die vorfabrizierten Elemente haben eine hinterlüftete vorgehängte Glaskonstruktion, die teilweise mit PV-Elementen bestückt sind. Die Brüstung und die vertikalen „lamellenartigen“ Elemente“ bestehen aus Glasfaserzement. Die Befensterung ist als Holzmetallkonstruktion mit lichtgesteuerten Lamellen als Sonnenschutz angedacht. Die Konstruktion scheint eher aufwändig zu sein. Nutzung und Betrieb Die Laborgeschosss funktionieren mit einigen Einschränkungen: Die Laborräume sind gut dimensioniert, allerdings geht dies auch auf Kosten des Umstandes, dass sie keinen direkten Medienanschluss an Vertikalschächte aufweisen. Betrieblich günstig sind die von den Erschliessungskernen unabhängigen Verbindungen zwischen dem Labor- und dem Bürobund. Allerdings werden dadurch, sowie durch die Integration der Vertikalschächte in die Kerne die Flächen im Mittelbund knapp, so dass auch Labornebenräume an den Fassadenbereich ausgelagert werden müssen. Die Social-Hubs sind gut, konzeptionell aber etwas zu uneinheitlich gelöst. Charakteristisch für das Projekt sind die mehrgeschossigen Hallen auf der Erdgeschossebene: Eine dient als Eingangshalle für das DKF, als Zugang zu den Seminarräumen im Galeriegeschoss und gleichzeitig als Cafeteria (das DKF kann aber auch unabhängig von dieser Halle erreicht werden). Der Zugang zum IRM erfolgt separat und diskret im Randbereich des Gebäudes. Der Ansatz, möglichst alle Sitzungszimmer im Galeriegeschoss zu konzentrieren, belebt die Halle und das Erdgeschoss, allerdings sollten kleinere Sitzungszimmer auf den Etagen verfügbar sein und der grosse Seminarraum anstatt im Dachgeschoss im Hallenbereich platziert werden. Die zweite Halle steht einer beliebigen Publikumsnutzung zur Verfügung. Diese mehrgeschossige Anlage mit Zwischengeschossen ist räumlich attraktiv, aber für die im Hause untergebrachten, von vergleichsweise wenigen Personen frequentierten Nutzungen (es ist kein Lehrgebäude mit vielen Studierenden) eher überdimensioniert. Gesamtwürdigung Die städtebauliche Auseinandersetzung mit dem Ort ist für die Gesamtfigur gelungen. Der Baukörper in der ersten Etappe wirkt indes noch unfertig. Die Interpretation des Sockelgeschosses verschlingt zuviel Raum und dem Laborkonzept fehlt es an der geforderten Stringenz. 2 PaoloPaolo GLA | Bern | Murtenstrasse 20-32 | Baufeld B | Wettbewerbsstufe 1 | Mai 2012 Städtebau Kopfsituation „Cityparking“ Kopfsituation „Lobhaus“ Bahnseitige Profilierung Skyline Das „Korsett“ der Überbauungsordnung ist eng - das Raumprogramm der ersten Bauetappe auf dem gegebenen Baufeld ist eine Herausforderung. Gegenüber dem Cityparking wird in Richtung Bahnhof ein Kopf mit grossräumlicher Wirkung ausgebildet. Das Gebäude entwickelt sich in der Höhe bis an die maximale Ge- Das denkmalgeschützte Lobhaus wird freigespielt. Zwischen unserem Neubau und dem Lobhaus entsteht eine gut zugeschnittene und grosszügige Freifläche. Bahnseitig wird die Volumetrie durch einen horizontalen Gebäuderücksprung strukturiert. Das Gebäude erhält durch diese Profilierung eine horizontale Gliederung und nimmt die Das Gebäudeprofil zeigt die städtebauliche Grundidee der zwei Gebäudeköpfe sowie die horizontale Profilierung. Durch die gestaffelte Höhenentwicklung des Bauvolumens wird Ausgehend von der Überbauungsordnung und deren Rahmenbedingungen wie maximale Gebäudehöhe, anbaupflichtige Baulinien, durchlaufende Laube, maximale BGF von bäudehöhe hin. Über eine Auskragung der obersten drei Geschosse wird der Bezug zum Gebäude des Cityparkings hergestellt und ein einprägsamer Gebäudekopf ausformuliert, Dieser ostseitige Gebäudekopf nimmt in seiner Höhenentwicklung Bezug auf das Lobhaus und die flacheren westlichen Gebäude des Strassenzugs. Die „über Eck“ laufende Höhe der Umgebungsgebäude auf. In Kombination mit der strassenseitigen Laube und den Kopfausbildungen entsteht ein die Gebäudelänge gebrochen und klare Bezüge zu den Gebäuden entlang der Murtenstrasse hergestellt. 27‘500 m2 über Baufeld B, ergibt sich eine maximale „baurechtlich mögliche Kubatur“. Anhand von gezielten Volumenkorrekturen wird diese Rohkubatur zurechtgeschnitten und in die städtebauliche Situation eingepasst. Durch diese Korrekturen bindet sich das Ge- der über das Cityparking hinweg städtebauliche Präsenz herstellt. Durch den Rücksprung der unteren Geschosse wird die Verbreiterung der Zufahrt zum Cityparking gewährleistet. Laube schafft erdgeschossige Bezüge zur neu geschaffenen Freifläche. heterogenes Volumen, das mit Sockelthemen spielt und differenzierte Gliederungen ausbildet. bäude in die Massstäblichkeit der Umgebung ein. Das rund 150 m lange, sich über das ganze Baufeld B erstreckende Gebäude erhält zwei unterschiedliche Kopfbereiche. GLA | Bern | Murtenstrasse 20-32 | Baufeld B | Wettbewerbsstufe 1 | Mai 2012 Etappe 3 Etappe 1 Etappe 2 Technik Technik Labor Labor Labor Labor Büro Lobplatz +549.00 Öffentlich Halle Schnitt Längs 2 5.OG +572.10 4.OG +568.10 3.OG +564.10 2.OG +556.10 1.OG Büro +549.20 +546.30 +542.30 Technik +576.10 +560.10 +553.20 Anlieferung Lager +580.10 6.OG Labor Labor Labor Labor 6.OG +576.10 5.OG +572.10 4.OG +568.10 3.OG +564.10 2.OG Labor Halle Halle +556.10 Sitzung Büro EG 1.UG +539.00 2.UG +535.80 3.UG +531.30 4.UG +538.10 5.UG Labor Schnitt Quer Technik Technik +553.20 2.ZG +549.20 1.ZG +546.30 EG 1.UG +542.30 2.UG +539.00 3.UG +535.80 +532.90 Parking Parking System Büronutzung +560.10 1.OG Büro 2.ZG 1.ZG Büro +580.10 Labor Parking System Labornutzung +530.00 4.UG +527.10 5.UG System Seminarnutzung Statisches System | Baudynamik Baugrund | Baugrubensicherung | Fundation Wegen des setzungsempfindlichen Baugrunds und in Folge von hohen Lasteinwirkungen wird das gesamte Bauwerk des Hochhauses mit Bohrpfählen fundiert. Eine kombinierte Pfahlplattengründung erlaubt eine Berücksichtigung des Setzungsverhaltens bei Lastabtragung. Die Baugrubensicherung in Form von Schlitzwänden erfolgt in Zusammenhang mit einer sogenannten Deckelbauweise. Die Bodenplatte wird 60 cm stark aus Stahlbeton ausgeführt. Unter Lastkonzentrationen bei tragenden Wänden respektive Stützen werden 30m lange Bohrpfähle unterschiedlichen Durchmessers angeordnet. Konstruktion | Nachhaltigkeit des Gebäudes Das Gebäude wird in den unteren Geschossen in Stahlbeton als weisse Wanne erstellt. Sämtliche Aussenwände, welche unter Wasserdruck stehen, werden mit mind. 30 cm starken, bewehrten, wasserdichten Betonkonstruktionen ausgeführt. Bei der Dimensionierung der Decken wurde besonders auf das vorgegebene Stützenraster geachtet. Durch die Verwendung von Hohlraumdecken können die Deckenstärken auf 40 cm limitiert werden und die Schwingungsanforderungen werden eingehalten. Etappe 3 Etappe 2 Etappe 1 Luftraum über Technik Luftraum über Technik Erschliessung HT Erschliessung HT Galerie über Technik Erschliessung HT Etappe 3 18 PP Erschliessung HT Etappe 2 Bahnerschütterungen Zur Dämmung der Erschütterungs- und Körperschallimmissionen ist hier als Hauptmassnahme eine vertikale elastische Trennlage der vorgesehen: Die Schlitzwand wird mit einem 60cm breiten Luftraum zu Gebäudewand erstellt, die horizontale Abstützungen der Schlitzwand auf die Deckenebenen erfolgen über elastischen Lager entsprechend den Etappe 1 abzufangenden Erddrücken. Die Reduktion der Bahnerschütterungen tritt somit in erster Linie durch eine Erhöhung des Übertragungsweges ein. Eine weitere deutliche Erschütterungsreduktion erfolgt beim Übergang vom Boden auf das Fundament. Die relativ grosse totale Gebäudemasse auf den Pfählen bewirkt eine zusätzliche Dämmwirkung. Ziel aller Parkierung 3 | 24 PP + 4 KW (Parkierung 1 | 24 PP + 4 KW) 28 PP Lüftungszentrale Dach Massnahmen ist das Erreichen eines Erschütterungslevels vergleichbar mit gebäudeintern verursachten Erschütterungen. Erschütterungsempfindliche Geräte Die Böden sind mit einer ausreichend grossen Steifigkeit vorzusehen. Als erstes Beurtei- Parkierung 2 | 22 PP 7.OG | +580.10 2.UG | +539.00 lungskriterium werden die Deckeneigenschwingungsformen beigezogen; die geforderten Deckenbiegeschwingungen sind auf folgende Werte zu dimensionieren: fLabore > 15 Hz, fMRT > 20 Hz; zudem sind die Decken in Stahlbeton auszuführen. Studien zeigten, dass Hohlkörperdecken bessere Eigenschwingungsverhalten ausweisen als konventionell 4.UG | +531.30 | +530.00 erstellte und darauf basierend konnten die Deckenstärken unter Berücksichtigung der effektiven Spannweiten und Steifigkeitsverteilungen definiert werden: Laborbereiche d = 40 cm und MRT d = 50 cm. Etappe 3 Etappe 2 Etappe 1 Etappe 3 Etappe 2 Etappe 1 Technikzentrale Technikzentrale Parkierung 5 | 24 PP + 4 KW Erschliessung HT Vorraum Parkierung 4 | 22 PP 6.OG | +576.10 1.UG | +542.30 3.UG | +535.80 5.UG | +528.1 | +527.10 3 PaoloPaolo GLA | Bern | Murtenstrasse 20-32 | Baufeld B | Wettbewerbsstufe 1 | Mai 2012 Etappe 1 Etappe 2 Labor Labor Labor Büro Sitzung Büro Labor +568.10 Technik 5.OG Labor 4.OG +564.10 3.OG +560.10 2.OG +556.10 1.OG +553.20 2.ZG +549.20 1.ZG +546.30 EG +542.30 1.UG Labor Labor Labor Büro Öffentlich Technik Parking Parking Parking Lager Stützen Das Stützenraster beruht mit einem Abstand von 7.20 m auf angemessenen Spannweiten, auch dieses Mass ist auf die baudynamischen Anforderungen abgestimmt. Schächte Hochinstallierte Gebäude für Labornutzungen erfordern eine hohe Dichte an vertikalen Haustechnik-Verbindungen. Zusätzlich sind Reserveflächen sinnvoll, um während der Nutzungsdauer nachrüsten zu können. Die Zugänglichkeit der Schächte erleichtert wesentlich Modifikationen ohne Störung des Laborbetriebs. Lüftungsschächte mit hohen Luftmengen generieren einen grossen Flächenbedarf. Wir bieten optimale Schachtproportionen, breite Ausfahrkante und eine gute Lage nahe an System Kerne Etappe 2 Etappe 1 Etappe 3 Etappe 2 +535.80 Technik 3.UG Parking +532.90 +530.00 4.UG +527.10 5.UG den Hauptnutzungen. Sanitär-, Heizungs- und Klimaschächte weisen ebenfalls optimale Schachtproportionen und breite Ausfahrkante auf. Zusätzlich sind Transferschächte für Lüftungsbereiche in den Untergeschosse wie Einstellhalle oder Tierstallungen notwendig genauso wie RWA-Schächte für die Treppenhäuser und den Feuerwehrlift. Sicherheitstreppenhaus REI 90 (nbb) überdruckbelüftet WC H Personenlift Schleuse EI90 (nbb) WC D Personenlift Sekundärsystem | Nutzungsflexibilität Dank den durchlaufenden Gang- und Raumstrukturen können Nutzungen über die Etappierungsgrenzen hinweg flexibel angeordnet werden. Die Struktur erlaubt viele Varianten an Sekundärsystemen. Neben der Labornutzung ist auch eine reine Büronutzung oder Seminar- und Schulungsnutzung ohne weiteres möglich. Nebenräume können variabel in Grösse und Lage situiert werden. Einbau Vereinzelungsanlage (Optional) Lüftung inkl. 30% Reserve Bündeln und Gruppieren Die frei bespielbaren Grundriss-Ebenen werden unweigerlich von Vertikalelementen (Stützen, Kerne und Steigzonen) durchstossen. Je weniger einzelne, unveränderbare Vertikalelemente eine Ebene aufweist, desto grösser ist grundsätzlich die Möglichkeit, die Etappe 3 Lüftung inkl. 30% Reserve Einbau Vereinzelungsanlage (Optional) Nebenräume Allgemeine WC-Räume, Putzräume sowie Räume für Schwach- und Starkstrom sind ebenfalls Teil der Primärstruktur und unabhängig von Funktionsänderungen der Hauptnutzungen. Etappe 1 Ebene flexibel zu nutzen und unterschiedliche Nutzungen unterzubringen. Die Lage der Stützen ist statisch bedingt – die Lage der Kerne und Haustechnik-Steigzonen kann aber frei gewählt werden. Das Bündeln der Schächte um die Vertikalerschliessungen zu „Superkernen“ bietet die grösstmögliche Gebäudeflexibilität. Hauptnutzung Lüftung inkl. 30% Reserve Nebennutzung Kerne Basierend auf einer maximalen Fluchtwegdistanz bei einer Kombizone von 20 m, finden die Flucht- und Sicherheitstreppenhäuser ihren Platz im Grundriss. Zusätzlich haben die Wände der Kerne aussteifende Wirkung als Scheiben gegen Erdbeben- und Windlasten. Neben den Treppenhäusern sind auch Lifte für Personen und Waren integriert. Ein Feuerwehrlift ist ebenfalls integriert. Der Vorbereich des Treppenhauses in einem Hochhaus besitzt einerseits Schleusenfunktion, dient andererseits aber auch als Platz um eine Vereinzelungsanlage aufzunehmen. Decken Die Geschosshöhen der Regelgeschosse betragen 4.00 m abgestimmt auf die Vorgaben der Ausschreibung bezüglich Labornutzung. Die Deckenstärken wurden mit Hilfe des Einsatzes von COBIAX-Elementen auf 40 cm optimiert. Dies ist mit der Baudynamik abgestimmt und auf 16 Hz-Decken bezogen. Die Flachdecken sind unterzugsfrei und ohne Absätze ausgeführt, was eine Grundvoraussetzung für eine flexible Nutzung und Systemtrennung darstellt. Schnitt Längs 1 Labor 2.UG Fortluft Einstellhalle Transfer WRG RK inkl. 30% Reserve Primärsystem Das System des Gebäudes besteht aus verschiedenen Elementen, diese haben je nach Anforderung spezielle Beziehungen untereinander. Das System läuft über das gesamte Baufeld, unabhängig von der Etappierung. Lobplatz +549.00 Anlieferung Technik Ansicht West | Ansicht Ost Etappe 3 +572.10 Etappe 3 Sanitär Heizung Klima inkl. 30% Reserve Labor 7.OG 6.OG Nebennutzung Labor +580.10 +576.10 RDA Sicherheitstreppenhaus Technik Labor Lüftung inkl. 30% Reserve Hauptnutzung Kern Etappe 2 Etappe 1 Etappe 3 Etappe 2 Etappe 1 Etappe 3 Etappe 2 Etappe 1 Lüftungszentrale Dach +549.20 Halle Publikum +549.20 +549.20 Luftraum Halle 1.ZG | +549.20 Luftraum Halle Etappe 3 Etappe 2 Etappe 1 Halle +546.30 EG | +546.30 3.OG | +564.10 1.OG | +556.10 Zentrale Anlieferung Etappe 3 Halle +546.30 Etappe 2 Luftraum Halle Etappe 1 Luftraum Halle 5.OG | +572.10 Etappe 3 Etappe 2 Etappe 1 Luftraum Halle +546.30 2.ZG | +553.20 2.OG | +560.10 4.OG | +568.10 GLA | Bern | Murtenstrasse 20-32 | Baufeld B | Wettbewerbsstufe 1 | Mai 2012 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A A 10 514 Büro Anlieferung 43.0 057 Radiologie 18.5 054 ext. Forschung 18.5 049 Ass-Ärzte 18.5 050 Ass-Ärzte 18.5 051 Ass-Ärzte 18.5 052 Ass-Ärzte 18.5 037 Oberarzt 18.5 035 Leitung 18.5 038 Oberarzt 18.5 117 Ärzte 18.5 039 Oberarzt 18.5 118 Ärzte 18.5 119 Ärzte 18.5 120 Ärzte 18.5 121 Ärzte 18.3 B B 058 Leitung 18.5 IRM Virtopsy IRM Forensische Medizin IRM Verkehrsmedizin 112 Blutuntersuchung 31.8 901 WC H 10.3 905 WC D 10.3 059 Sitzung 32.4 114 Untersuchung 15.8 115 Untersuchung 21.4 116 Psychologie 16.8 113 Material 27.5 602 Social Hub 18.8 122 Sekretariat 17.5 D C C 546 Gaslager 43.4 547 + 277 Anlieferung 77.1 500 Cafeteria 129.6 512 Publikumsnutzung 1 134.3 E E 511 Warten 26.4 545 WC FPD H 6.2 576 E Stark 6.2 544 WC FPD D 8.6 541 Putz 8.6 548 Abfallraum 13.2 577 E Stark 15.2 597 E Schw 7.1 +546.30 271 Empfang 18.9 +546.30 013 + 510 Empfang 22.7 +546.30 Cafeteria / Halle G +546.30 F F Rampe 18% mit Ausrundung D Anlieferung allgemein 513 Publikumsnutzung 2 49.6 Publikumsnutzung G 930 Foyer Publikum 19.8 012 + 509 Foyer IRM 62.5 508 Foyer DKF 20.4 IRM 10 Wasserbecken mit Stahleinfassung +547.40 9 DKF Publikumsnutzung 8 +547.40 +547.30 +547.20 +547.10 +547.00 +546.90 Wasserbecken mit Stahleinfassung +546.40 +546.80 +546.70 Virtopsy + Forensische Medizin lungen direkt von den Treppenkernen aus erreichbar. Selbst Abteilungen auf demselben Geschoss können so strikt voneinander getrennt werden. Nutzungsverteilung über Raumtypen Grundsätzlich kann das ganze Haus als reines Bürogebäude oder auch als reines Laborgebäude genutzt werden. (siehe Nutzungsschemen Primärsystem). Aufgrund der schmalen Bauparzelle sind nur bahnseitig vollwertige Grossraumlabors möglich. Die vorgesehenen Haustechnikschächte erlauben aber bei Bedarf auch den strassenseitigen Einbau von Speziallabors mit variabler Raumtiefe. interne Treppe ins UG +546.60 +546.50 Publikumsnutzung +546.40 +546.30 +546.20 +546.10 +546.00 +545.90 +545.80 Verkehrsmedizin IRM Eingangshalle Die Eingangshalle liegt im Randbereich des Gebäudes. Der zugehörige östliche Gebäudekern wird exklusiv vom Institut genutzt. Der Empfang übernimmt Steuerfunktionen und fungiert als Drehscheibe und ist die Anlaufstelle für alle Klienten. Vom Empfang aus ist die Eingangshalle einsehbar, ebenso wie die diskret angeordnete Wartezone für Besucher Blutuntersuchung Anlieferung Cafeteria interne Treppe ins 1.ZG Nutzungsverteilung Institute Die Institute (DKF oder IRM) werden geschossweise voneinander getrennt: auf einem Geschoss sind entweder Abteilungen des DKF oder Abteilungen des IRM untergebracht. Dank den drei Vertikalerschliessungen und einem doppelt geführten Gangsystem im Erdgeschoss, welches als Verteiler zwischen den Treppenkernen dient, sind sämtliche Abtei- 1 2 3 4 5 6 7 EG | +546.30 Warten sowie der Zugang zum Erschliessungskern. Ein zweiter diskreter Klientenzugang (in Begleitung) zum Institut wird im 1.UG sichergestellt. Empfang Publikumsnutzung Publikum DKF IRM IRM Virtopsy | IRM Forensische Medizin Die beiden zusammen gehörenden Abteilungen sind zweigeschossig organisiert. Ein Teil der Büros und Besprechungszimmer sind im Erdgeschoss untergebracht. Über eine abteilungsinterne Treppe wird die Verbindung zu den Räumlichkeiten im 1.Untergeschoss hergestellt. IRM Verkehrsmedizin Der Publikumsbereich der Verkehrsmedizin ist über den Haupteingang IRM erreichbar und ist zusammen mit den zugehörigen Räumen als eine in sich geschlossene Einheit organisiert. DKF Eingangshalle | Cafeteria Über das Foyer betritt man die mehrgeschossige Eingangshalle des DKF. Die allgemein zugängliche Cafeteria mit Aussenbereich betont den öffentlichen Charakter der Erdgeschossnutzung. Über die Eingangshalle und eine grosszügige Treppe erreicht man das multidisziplinär genutzte Seminar und Konferenzgeschoss im 1.OG. Zusätzliche Publikumsnutzung Neben der Cafeteria des DKF, welche öffentlich zugänglich gemacht wird, werden attraktive und bei extern nutzbare Flächen „unter den Lauben“ angeboten. Anlieferung Allgemein Die Zentrale Anlieferung ist vom seitlich gelegenen Anlieferungshof her der zugänglich. Dem Warenlift ist eine grosszügige Stellfläche vorgelagert. Hier werden alle Waren angeliefert und ebenso die Entsorgung untergebracht. 4 PaoloPaolo GLA | Bern | Murtenstrasse 20-32 | Baufeld B | Wettbewerbsstufe 1 | Mai 2012 1 5 199 Einfachlabor 17.9 566 E Stark 6.2 536 Putz 8.6 9 8 090 Doktoranden 28.3 077 Probeneingang 28.8 2 1 209 Geräte 19.3 182 Grossraumlabor 125.2 D 564 E Stark 6.2 195 Einfachlabor 17.9 701 Social Hub 9.8 567 E Stark 15.2 592 E Schw 7.1 535 Putz 8.6 196 Einfachlabor 18.1 230 Lagerraum gross 41.3 705 Social Hub 9.7 518 WC H 6.2 227 Lager klein 17.8 224 Lager klein 21.4 216 Kühlgeräte 21.9 197 Einfachlabor 17.7 217 Kühlgeräte 21.9 198 Einfachlabor 17.9 565 E Stark 15.2 591 E Schw 7.1 225 Lager klein 27.2 257 Büro 17.0 256 Büro 17.0 210 Geräte 28.5 258 Büro 16.8 267 Social Hub 34.1 259 Büro 16.6 260 Büro 15.5 261 Büro 14.9 262 Büro 14.3 263 Büro 13.5 4 5 3 2 G G 712 Social Hub 22.8 613 Social Hub 7.1 1 9 8 7 6 5 3. OG | +564.10 231 Lager gross 36.0 297 Büroleitung 16.3 248 Büro 16.7 249 Büro 17.0 208 Geräte 34.6 250 Büro 16.8 251 Büro 16.0 704 Social Hub 34.7 252 Büro 15.5 253 Büro 14.9 254 Büro 14.3 255 Büro 13.5 266 Social Hub 44.9 4 3 2 1 9 8 7 6 5 3 4 2 1 4.OG | +568.10 Proben TOXIKOLOGIE IRM Forensische Chemie | Toxikologie Die Labors mit ihren Nebenräumen sind analog zu den Labor-Regelgeschossen auf der Nordfassade bzw. im Mittelbund untergebracht. Proben gelangen vom Eingang IRM aus über separate Probeneingangsräume in die sowohl räumlich als auch lüftungstechnisch strikt voneinander getrennten Laborbereiche „Proben Chemie“ und „Proben Toxikologie“. Die gemeinsamen Büros beider Bereiche werden von den Laborbereichen getrennt. Module DKF Die vier Module werden direkt übereinander angeordnet um Synergien und kurze Wegstrecken zu ermöglichen. Der Grundriss wird als „Dreibünder“ organisiert. Die Grosslabore liegen bahnseitig, die Mittelzone nimmt die Zellkulturlabors und Labornebenräume auf. Die Bürobereiche sind strassenseitig angeordnet. Das Konzept des „Wissenschaftsboulevards“ wird konsequent weiterverfolgt. Die Bereiche zwischen Labor und Büro werden als Begegnungsbereiche ausgestaltet. Die Grundrisse der vier DKF Module zeigen unterschiedliche Möglichkeiten auf wie die Kommunikationsbereiche und Social Hubs anzuordnet werden können. Sämtliche Labors verfügen über Dokumentationsarbeitsplätze. Eingang IRM Medizinrecht Dieser Bürobereich ist im Randbereich des Gebäudes gelegen und von den Laborbereichen getrennt. Eine Anbindung an die Bereiche Administration und Informatik wird über eine Vertikalverbindung sichergestellt. Eingang Medizinrecht 3 G 612 Social Hub 15.4 2.OG | +560.10 Proben CHEMIE 4 181 Grossraumlabor 125.2 DKF Tiere 089 Stv. Leitung 15.5 088 Leitung 16.0 611 Social Hub 16.9 6 7 5 703 Social Hub 9.8 G 10 6 180 Grossraumlabor 125.2 527 WC D 8.6 202 Einfachlabor 17.9 F 062 Labor Aufb. 22.5 F 087 Büro 16.6 086 Gutachter 16.8 7 528 WC D 8.6 G 085 Gutachter 17.0 609 Social Hub 35.7 8 179 Grossraumlabor 124.8 IRM Büros Forensische Chemie + Toxikologie 061 Leitung 16.7 G 060 Mitarbeitende 16.3 9 211 Geräte 27.0 702 Social Hub 9.7 201 Einfachlabor 17.7 E E Proben Toxikologie > Proben Chemie > 569 E Stark 15.2 593 E Schw 7.1 1 Departement für Klinische Forschung 2 219 Kühlgeräte 21.9 218 Kühlgeräte 21.9 200 Einfachlabor 18.1 F 125 Fall 2.6 076 Probeneingang 17.9 2 186 Grossraumlabor 124.8 519 WC H 6.2 529 WC D 8.6 IRM Medizinrecht 3 Departement für Klinische Forschung 1 226 Lager klein 21.4 083 Tiefkühllager 22.5 079 Lager Archiv 27.1 520 WC H 6.2 078 Lager Archiv 27.3 4 185 Grossraumlabor 125.2 B 6 184 Grossraumlabor 125.2 C 7 E 081 Stoffla. Gasla. 21.9 084 Tiefkühllager 26.9 E 568 E Stark 6.2 537 Putz 5.5 8 183 Grossraumlabor 124.8 IRM ForensischeToxikologie D IRM Forensische Chemie 610 Social Hub 14.7 080 Lager Archiv 21.4 9 F 075 Labor 61.6 B 074 Labor 62.0 065 Labor 30.3 E 066 Labor 30.3 082 Waschraum Lager 30.3 068 Labor Aufb. 30.3 F 073 Labor 30.3 B 072 Labor 30.3 C 071 Labor 30.3 D 070 Labor 30.3 B 069 Labor 30.3 C 067 Alklabor 30.3 D 064 Labor 30.3 C B 063 Labor 29.9 C 2 D 3 B 4 C 5 D 6 E 7 F 8 A 9 A 10 Bürobereich Chemie / Toxikologie Ansicht Süd GLA | Bern | Murtenstrasse 20-32 | Baufeld B | Wettbewerbsstufe 1 | Mai 2012 Energiestandard in der gleichen Grössenordnung wie die graue Energie für den Rohbau. sierung sowie effizientes Recycling. Der Einsatz von effizienten Heiz-, Kühl- und Lüftungssystemen und konsequente Abwärmenutzung vermindert den Aufwand an Primärenergie. me aus der Kälteproduktion deckt die Grundlast des Wärmebedarfs. Die Spitzenlasten werden mit der Fernwärme der ewb gedeckt, die eine tiefe CO2-Belastung ausweist. Fassade und Dach erhalten eine PV-Anlage, die grünen Strom ins Netz speist. 2 | Tragwerk | konsequent und geradlinig Ein Tragwerk mit geradliniger Lastableitung und angemessenen Spannweiten (rund 7.2 m) benötigt wenig Material und graue Energie. 6 | Baustoffe | umweltschonend und schadstoffarm | MINERGIE ECO Der Einsatz von schadstoffarmen oder wiederverwerteten Baustoffen erfordert in der Regel wenig Herstellungsenergie und einen geringeren Ressourceneinsatz. Das schont die Umwelt und schafft zusätzlich ein gesundes Raumklima für die Nutzer. 3 | Gebäudehülle | beständig und gut gedämmt Eine funktionstüchtige und gut gedämmte Hülle im MINERGIE P Standard garantiert 7 | Ressourcenaufwand einen niedrigen Betriebsenergiebedarf an Wärme. Der aussenliegende Sonnenschutz vermeidet sommerliche Überhitzung im Sommer. Die Einhaltung der MINERGIE ECO Anforderungen ermöglicht einen tiefen Bedarf an grau- Die „Graue Energie“ ist direkt abhängig von Bauweise (Massivbau), Materialwahl und Geschossfläche. Die kompakte Gebäudeform, sowie der Einsatz von Holz-Metallfenstern und COBIAX-Elementen in den Decken reduzieren den Bedarf an grauer Energie. er Energie, denn rund ein Drittel der grauen Energie steckt in der Gebäudehülle. Gebäudes, dies spart Umbauzeiten und Ressourcen. Die Gebäudehülle bietet optimalen Witterungsschutz. Witterungsbeständige Materialien und eine „konventionelle“ Fassadenkonstruktion sichern eine beständige Gebäudehülle mit geringem Sanierungsbedarf. Ein guter sommerlicher Wärmeschutz gewährleistet eine hohe Behaglichkeit und gleichzeitig die Nutzung von Tageslicht. 10 | Planungs- und Bauprozess Variantenvergleiche und die Anwendung moderner Simulationswerkzeuge erlauben das Finden von nachhaltig und wirtschaftlich optimierten Lösungen. Im Bauprozess wird darauf geachtet, dass Lärm-, Staub- und weitere Umweltbelastungen vermieden werden und die Arbeitssicherheit gewährleistet ist. 8 | Betrieb Der Verbrauch von Primärenergie zur Deckung des Wärmebedarfs eines Gebäudes gehört 11 | Lebenszykluskosten Die Berücksichtigung der Lebenszykluskosten ist ein integraler Bestandteil in der Entscheidungsfindung von Lösungen und garantiert über die gesamte Lebensdauer des bei einer Lebenszyklusbetrachtung zu den wichtigsten Umweltfaktoren. Er liegt je nach Gebäudes eine wirtschaftliche Lösung. 3.60 3.60 1.80 1.18 40 3.60 40 4 | Sekundärstruktur | zugänglich und auswechselbar Bauteile mit begrenzter Lebensdauer, wie Fenster, Sonnenschutz- und Haustechnikanlagen sind zugänglich und auswechselbar eingebaut. Das hilft Unterhaltskosten zu sparen 9 | Funktionstüchtigkeit Das Tragwerk hat eine hohe Flexibilität und ermöglicht damit einfach die Umnutzung des 40 5 | Energieversorgung | effizient und wirtschaftlich Das Gesamtsystem ist einfach, effizient und wirtschaftlich. Eine hocheffiziente Kälteversorgung mit Freecooling-Betrieb stellt den vielfältigen Bedarf an Kälte bereit. Die Abwär- 1 | Grundriss | strukturiert und nutzerfreundlich Einfache und gut strukturierte Grundrisse reduzieren die Verkehrsflächen, vereinfachen die Gebäudetechnik und erleichtern spätere Umnutzungen. Das ist ressourcenschonend, verhilft zu mehr Flexibilität und einer längeren Nutzungsdauer. 4.00 und ist Voraussetzung für eine einfache und wirtschaftliche Instandsetzung und Moderni- Elf Themenbereiche zum nachhaltigen Bauen 3.60 Energie | Ökologie | Nachhaltigkeit Wärmedämmung Mineralwolle 0.038 (wie Flumroc Prima) Dampfsperre Bitumenbahn (wie V60) Stahlbetondecke 40 cm (mit Cobiax-Elementen, 20% Gewichtsreduktion) 40 Der verbesserte Wärmeschutz von Flachdach kompensiert die Wärmedämmung an 214 Kühlgeräteraum 21.8 Aufbau Aussenwand U-Wert <0.20 W/m2K Brüstung Beton-Fertigteil 15 cm sind tragend auszubilden (Baudynamik / Brandüberschlag) 3.60 Wärmedämmung Mineralwolle 0.034 (wie Flumroc Typ 3) Hinterlüftung / Unterkonstruktion Metall VSG-Glas bedruckt oder PV-Element Dünnschicht-Technologie (amorphes Silizium) mit Standard-Elementgrössen Glasfaserzement-Lamelle 2.90 Variante Hygiene Waschbecken 40 Fenster Holz-Metall-Konstruktion Glas 3-fach IV, U-Wert Glas 0.7, 48% Glasanteil Sonnenschutz Lamellenstoren mit Lichtlenkfunktion 284 | 231 Social Hub | DKF Modul 9.9 (56) 40 Dachflächen mit ökologisch schlechteren Aufbauten. Die Wahl von Mineralwolle wird aus ökologischen Gründen bevorzugt. Gegenüber üblichen Dämmungen wie Polyurethan PUR weist Mineralwolle weniger Umweltbelastungspunkte auf. Auf dem Dach des Attika-Aufbaus wird ebenfalls PV installiert. Raumakustik Die geforderten Nachhallzeiten werden durch kombinierte Absorberflächen mit der geforderten Kühldecke eingehalten. Zusätzliche Verbesserungen der Raumakustik werden mit ausgewählten Flächen an den Raumwänden und der Möblierung erreicht. 191 | 355 Einfachlabor | DKF Modul 17.9 (18) 3.60 U-Wert <0.15 W/m2K PV-Element aufgeständert mit Standard-Elementgrössen extensive Begrünung Substrat Vlies Abdichtung Feuchteschutz zweilagig Bitumenbahnen (wie Bikutop) 1.02 Aufbau Flachdach Aufbau Decke Bodenbelag Kunststoff Schacht 2.7 Ausgleichsschicht Hartbeton 2 cm Stahlbetondecke 40 cm (mit Cobiax-Elementen, 20% Gewichtsreduktion Schacht 3.6 Schallschutz Deckenuntersicht Bodenbelag Kunststoff Ausgleichsschicht Hartbeton 2 cm Stahlbetondecke 40 cm (mit Cobiax-Elementen, 20% Gewichtsreduktion) Installationen 5.3 6.50 Es wird eine min. Luftschalldämmung R‘w = 60 dB erreicht, die Mindest-Anforderungen der SIA 181 an die Luftschalldämmung werden eingehalten. Mit einem Bodenbelag Kunststoff wird eine min. Trittschallverbesserung dLw,P = 10 dB erreicht, die Mindest-Anforderungen der SIA 181 an die Trittschalldämmung werden eingehalten. Wärmedämmung 18 cm Mineralwolle 0.034 (wie FLUMROC DUO) Hinterlüftung / Unterkonstruktion Metall Glasfaserzement-Platte 176 | 355 Grossraumlabor | DKF Modul 125.2 (104 - 7-8P) Erschliessung 20.9 Variante Hygiene Waschbecken Die Anwendung von Mineralwolle weist im Vergleich zu harten Polystyrolprodukten eine verbesserte Luftschalldämmung auf. Verglasung EG Pfosten-Riegel-Konstruktion Glas 3-fach IV, U-Wert Glas 0.7 5