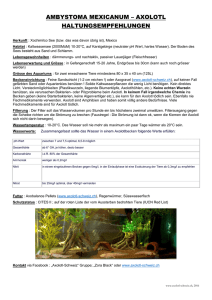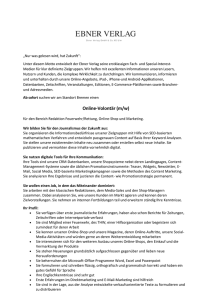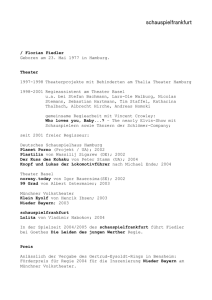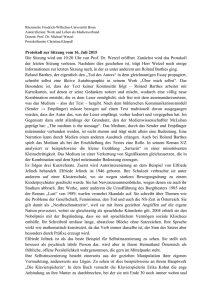Die ganze Kritik als pdf - Kinowerkstatt St. Ingbert
Werbung

Name: kai_hp07_kult.01 Ausgabe rhp-kai Erstellt von: dittgea Ressort kult () PDF erstellt 19.07.2017 17:09:06 Erscheint am Mittwoch, 28. Juni 2017 DLayName: kai_hp07_kult.01 KULTUR DIE RHEINPFALZ — NR. 147 MITTWOCH, 28. JUNI 2017 Total von der Rolle Sammlung Gurlitt: Erste Werke in Bonn präsentiert KINO AKTUELL: „Axolotl Overkill“ von Helene Hegemann hat nur bedingt mit ihrem Roman zu tun VON ANDREA DITTGEN „Steh auf, Fotze, und verbeug’ dich!“, sagt Mifti, die 16-jährige Schülerin, zu der jungen blonden Frau, die ihr in der Schulkantine keine zweiten Nachtisch geben will. Wenig später wird sie ihre beste Freundin. Wer solche Widersprüche mag, wird in „Axolotl Overkill“ von Helene Hegemann bestens bedient. Der Film hat mit ihren Skandalroman „Axolotl Roadkill“ (2010) nur bedingt zu tun, deshalb heißt er auch ein wenig anders. Wie im Roman ist Mifti (Jasna Fritzi Bauer) 16 Jahre alt und wohnt nach dem Tod der Mutter mit ihren zwei erwachsenen Halbgeschwistern in Berlin in einer Wohngemeinschaft. Damit Mifti morgens aus dem Bett kommt und danach in die Schule, schüttet ihr die Halbschwester (Laura Tonke, zweifacher deutscher Filmpreis 2016) schon mal einen Eimer Wasser ins Bett. Aber das hilft nicht wirklich. Wenn sie es in die Schule packt, eckt sie an, nennt ihren Lehrer beim KZ-Ausflug „Führer“, verhaut schon mal einen Mitschüler und wird vor die Rektorin zitiert. „Was ist das Problem?“, fragt Mifti. „Dass du dich permanent unangemessen verhältst“, sagt diese und kippt ihrer Schülerin absichtlich Kaffee übers T-Shirt, als die ihr wilde Geschichten über einen Opa erzählt, der Russe sei und sich selbst angezündet habe. „Axolotl Overkill“ kommt mehr als spontane Szenenfolge denn als klassischer, durchkomponierter Film daher. Die Hauptfigur durchlebt keine Entwicklung, sie ist mit 16 schon fertig, so abgebrüht wie eine Endzwanzigerin – oder wie ein Junge. Mifti tut viele Dinge, die bürgerliche Mädchen – ihr Vater lebt in einem kalten Designerhaus, hat nur Kunst im Kopf und hält Terrorismus für eine gute Berufswahl – nicht tun. Als Rebellin würde man Mifti deshalb nicht gleich ansehen. Sie hat Langewei- le, sie weiß nicht so recht, was das Leben lebenswert macht. Sie nimmt Drogen. Sie wird von einem Psychiater als „Borderline“ mit Tabletten therapiert („Wenn denen nichts einfällt, sagen sie sie immer Borderline“). Sie ist verliebt in eine über 40-jährige Frau, nach der sie sich sehnt. Als sie sich bei einer langweiligen Party die Männer anschaut und sagt, „vielleicht sollte ich jetzt mal richtig vergewaltigt werden“, hilft das auch nicht weiter. Es ist nicht einfach, es im Kino zwei Stunden mit dieser verzogenen, zu früh erwachsenen gewordenen SchickeriaFrau auszuhalten. Mifti nervt – und trifft einen Nerv. Sie ist das Ventil für alle, denen in einem Deutschland, in dem die Sprache der politischen Überkorrektheit schon in der Schule eingeimpft wird, oft der Kragen platzt, es aber nicht (so deutlich) zu sagen wagen. Doch vor allem ist Mifti das Bild einer jungen Frau, die durchs Leben treibt, alles ausprobiert und nichts findet außer Enttäuschungen. In der Liebe wird sie von einer Frau verraten, Männer helfen in puncto Sex nicht wirklich weiter, der Vater ist ihr fremd, die Halbgeschwister denken nur an sich selbst wie die Mitglieder in jeder zerrütteten Familie, Drogen und Pillen helfen nur auf Zeit, Partys sind besser als Schule, und was danach kommt, entscheidet sich spontan. Im Prinzip ist diese Mifti die Vorstufe von Hanna (der Schriftstellerin Gisela Elsner) aus Oskar Roehlers Spielfilm „Die Unberührbare“ (2000) – und genauso faszinierend. Im Gegensatz zum Roman, der mehr Miftis Gedankenwelt ausspuckt, sieht man Mifti (was ist das überhaupt für ein Name?) hier in einem Leben, das voller Action ist. Es gibt kaum ein Umfeld, in dem man Mifti zweimal trifft, kaum eine ruhige Minute. Das erinnert an ein anderes deutsches experimentelles Meisterwerk der jüngsten Zeit, an „Victoria“ (2015) Anstrengend, mutig, unangepasst: Mifti (Jasna Fritzi Bauer) in „Axolotl Overkill“. Helene Hegemann, die 2009 ihre Karriere auch als Regisseurin begann, hat ihren eigenen Roman eher frei fürs Kino adaptiert. FOTO: CONSTANTIN FILM/L. GRÜN von Sebastian Schipper. Hegemann selbst orientierte sich eher an Jim Jarmuschs „Permanent Vacation“ (1980), wo ein (männlicher) Teenager ähnlich ziellos durch eine Stadt läuft, wie sie sagt. Schon ihr 42-Minuten-Film „Torpedo“, der 2009 den Max-Ophüls-Preis für den besten mittellangen Film gewann, war verstörend und gut gemacht, wenngleich nicht so radikal. Vor allem geht es Hegemann darum, Grenzen zu sprengen. Dabei hilft ihr vor allem ihre geniale Hauptdarstellerin Jasna Fritzi Bauer, die dafür – ebenso wie Hegemann – einen Deutschen Filmpreis bekommen müsste. Die heute 28-Jährige Bauer war beim Dreh vor zwei Jahren (an dem Film wurde viel und lange geschnitten) 26, geht aber problemlos als 16-Jährige durch und hat die passende intellektuelle Reife und Abgeklärtheit einer Mifti. Bauers erste große Kinorolle war die einer frechen Außenseiterin in „Ein Tick anders“ (2010), dem Regiedebüt des Pirmasenser Autorenfilmers Andi Rogenhagen. Das passt. Hegemanns zweite große Hilfe war ihr belgischer Kameramann Manuel Dacosse, der dafür im Januar bei US-Independent-Festival Sundance, wo „Axolotl Overkill“ uraufgeführt wurde, für seine krassen Bilder – sie sind mal hell und hart, mal einfarbig weich und rauschartig, mal im 50er-Jahre-Hochglanz-Look – den Kamerapreis erhielt. Man kann Helene Hegemann weiterhin für ein Wunderkind halten – ihren Roman schrieb sie mit 17, diesen Film, quasi eine Fortsetzung des Romans auf einer anderen Ebene, drehte sie mit 23, jetzt ist sie 25 – oder auch für übergeschnappt. Aber wenn sie redet, ist sie absolut cool, selbstbewusst und weiß genau, was sie will. Sie ist der erste Regisseur (als Feministin sieht sie sich nicht) seit Rainer Werner Fassbinder, der ähnlich mutig, fantasievoll und unangepasst zeigt, was sonst gerne unter den Tisch gekehrt wird. Die Bundeskunsthalle hat gestern erstmals einige Werke aus dem Gurlitt-Kunstfund präsentiert, die ab 3. November in Bonn gezeigt werden sollen. Darunter sind das Gemälde „Waterloo Bridge“ von Claude Monet, die Skulptur „Kauernde“ von Auguste Rodin und eine Grafik von Albrecht Dürer, deren Herkunft jeweils unklar ist wie bei rund 200 der für die Schau vorgesehenen 250 Arbeiten. Man erhoffe sich durch die Ausstellung Hinweise, so Kuratorin Agnieszka Lulinska. Bisher ist bei rund einem Drittel der über 1500 Werke des 2014 verstorbenen Sammlers und NS-Kunsthändlersohns die sogenannte Provenienz ermittelt. Derzeit werden die Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Skulpturen in der Bundeskunsthalle für die Ausstellung „Bestandsaufnahme Gurlitt“ restauriert. |dpa/epd Film: Fleischmanns „Das Unheil“ gefeiert Am Montagabend wurde der Film „Das Unheil“ des in Zweibrücken geborenen und in Neustadt aufgewachsenen Regisseurs Peter Fleischmann (79) beim Münchner Filmfest in restaurierter Fassung gezeigt – und gefeiert. Das Ungewöhnliche daran: Der Film ist von 1972, er lief beim Festival von Cannes, bekam dort den Luis-Buñuel-Preis, wurde bei den ersten Vorführungen in Deutschland gnadenlos verrissen und war seitdem nie mehr zu sehen. Der optisch und akustisch etwas surreale Spielfilm erzählt episodenhaft ohne stringente Handlung, wie die bürgerliche Fassade einer Kleinstadt bröckelt, ausgelöst durch rebellische junge Leute. Plötzlich ist die ganze Stadt vergiftet: Das Wasser ist braun, Alt-Nazis wachen auf, man vermutet eine Bombe. Der Film wird am Samstag noch einmal beim Münchner Filmfest gezeigt. |adi Am Rande des Nirgendwo Werke von Johanna Jakowlev und Uli Gsell treten in der Galerie Ruppert in Birkweiler in einen spannenden Dialog VON BRIGITTE SCHMALENBERG Das passt! Sitzt, wackelt nicht, hat viel Luft. Die kargen und doch vielsagenden Gemälde von Johanna Jakowlev und die archaisch unaufgeregten Steinskulpturen von Uli Gsell haben in der Galerie Ruppert in Birkweiler zusammengefunden zu einer Werkschau wie aus einem Guss. Sie verbinden Geschichte und Moderne, Architektur und Natur, Kühnheit und Sinnlichkeit. Diese Ausstellung ist ein Erlebnis. Weil sie so einfach, so unaufgeregt, so geerdet daherkommt und doch eine so irritierende und lang anhaltend frappierende Wirkung entfaltet. Der erste Blick eröffnet Klarheit und eine in sich selbst ruhende Ordnung und Kraft. Man spürt die Aura der Einsamkeit, die jedes einzelne Objekt umkreist und hört zugleich den Dialog, den Johanna Jakowlevs großformatige Gemälde und Uli Gsells steinerne Skulpturen miteinander führen. Beide Künstler sind in Stuttgart geboren, die Malerin 1980, der Steinwerker 1967, beide haben an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste ihrer Heimatstadt studiert, beide haben künstlerische Formsprachen gefunden, die schwäbische Enge und Gemütlichkeit sehr weit hinter sich lassen. Johanna Jakowlevs linear strukturierte, fast surreal inszenierte Bildwelten führen an menschenleere Orte am Rande des Nirgendwo. Doch weisen die verlassenen Betonrelikte vor kargen klaren Meeresküsten selbstredend darauf hin, dass sie vor nicht allzu langer Zeit von Menschenhand gebaut wurden, vielleicht bewohnt wurden. Mit rahmenähnlichen Öffnungen gewähren die kantigen Kuben erstaunlich reizvolle Blicke in eine leblose Landschaftsszenerie, in der über einem scharf konturierten Horizont der Himmel dominiert. Die schmutzigen Verwitterungen und rostigen Brauntöne, die auch an Industrierelikte denken lassen, können ihrer kühnen Ästhetik nichts anhaben. Doch verströmt die textile Anmutung der vielfach geschichteten Acrylfarbe auf grober Leinwand zugleich einen stimmungsvollen, melancholisch-poetischen Grundton. Und jeder Betrachter wird sich zu den Szenerien, die durch knappe Titel wie „Tragwerk“ oder „Schwindspannung“ eine zweite Ebene erhalten, seine eigene Geschichte reimen. Auch Uli Gsell schickt seine Werke nicht namenlos unters Volk – wobei man nicht wissen muss, was Namen wie „Flog“ für eine Stele aus Jurakalkstein, oder „kleines hoola“, für einen bearbeiteten Quader aus Basaltlava bedeuten. Man will diese Skulpturen, die so raffiniert den menschlichen Eingriff in die Natur dokumentieren, ohnehin selbst ergründen. Manche Arbeiten wirken mit ihren Einkerbungen und rhythmisierten Spalten wie Hierogly- phen, die man enträtseln kann. Andere – etwa die „Schilder“ – gleichen verrosteten Gebrauchsgegenständen aus vorchristlichen Zeiten. Wieder andere Findlinge sind mit akkurat ausgearbeiteten Nischen, geometrisch gesetzten Einschnitten oder glatt verschliffenen fensterähnlichen Fassaden so bearbeitet, als wären sie Zeitzeugen einstiger Felswohnungen. So gelingt Uli Gsell, der auch bei Kiyoto Ota an der Escuela Nacional de Artes Plasticas in Mexiko studierte, eine spannende Symbiose von Kultur und Natur, die sich aus ferner Vergangenheit speist, während die Bilder von Johanna Jakowlev auf moderne Ruinen der Gegenwart verweisen. In der Galerie Ruppert berühren sich beide Positionen. DIE AUSSTELLUNG „Schwindspannung 1“ heißt diese Arbeit von Johanna Jakowlev aus dem Jahr 2016. FOTO: JAKOWLEV/GALERIE Raffinierte Eingriffe: Uli Gsells OnyxWerk „Lichtstein“ aus dem Jahr 2004. FOTO: WOLFRAM JANZER/GALERIE „Johanna Jakowlev und Uli Gsell“, bis 23. Juli, Galerie Ruppert, Birkweiler; samstags 14 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr ; www.galerieruppert.com Die Schönheit und das Grauen Ersan Mondtag inszeniert an den Münchner Kammerspielen „Das Erbe“ und beschäftigt sich mit der mutmaßlichen NSU-Terroristin Beate Zschäpe VON JÜRGEN BERGER Er ist der große Aufsteiger unter den Regisseuren. Jetzt hat Ersan Mondtag an den Münchner Kammerspielen die wohl rechtsradikale Beate Zschäpe zum Gegenstand eines Theaterabends gemacht. Der Text zur Uraufführung von „Das Erbe“ stammt von der Autorin Olga Bach. Wäre die Hölle ein kosmisches Labor, würden dort Lemuren geistern, wie sie jetzt an den Münchner Kammerspielen zu sehen sind. Aufgeschossene Rotgesichte mit langem Strähnenhaar auf dem Hinterkopf einer Tonsur, als wandelten verhärmte Novizinnen in knielangen Kleidern und mit Kniestrümpfen durch ein teuflisches Kloster. Heilig ist dieser Ort nicht. Im Gegenteil: Was Rainer Casper da als Bühne gebaut hat, könnte eine riesige Weltbibliothek sein, in der alles zu finden ist, was die Menschheit in Jahrtausenden gesammelt hat. Die Schönheit der Kunst und Kultur, aber auch all das Grauen der Weltgeschichte. „Das Erbe“ nennt Regisseur Ersan Mondtag seinen jüngsten, zusammen mit der Autorin Olga Bach und dem Videokünstler Florian Seufert entwickelten Theaterabend. Mondtag – bürgerlich Ersan Aygün und 1987 in Berlin geboren – wurde innerhalb kurzer Zeit zwei Mal zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Inzwischen kann es sich aussuchen, an wel- chem Theater er eines seiner szenischen Gesamtkunstwerke inszenieren möchte. Im Untertitel der Uraufführung steht „Eine Assoziation zum NSU“. Gemeint ist das Trio des „nationalsozialistischen Untergrunds“, das im Wohnmobil durch Deutschland reiste und neun Männer türkischer und griechischer Herkunft ermordete. Die Schützen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos richteten sich selbst. Beate Zschäpe, von der man bis heute nicht genau weiß, welche Rolle sie im rechtsradikalen Hinrichtungskommando spielte, sitzt immer noch auf der Anklagebank des Münchner Landgerichts und schweigt sich wund. Was sich im Hirn dieser Frau wohl abspielt, fragte sich vor drei Jahren schon Elfriede Jelinek im ebenfalls an den Münchner Kammerspielen uraufgeführten „Das schweigende Mädchen“. Olga Bach, die jetzt für den Text verantwortlich ist, widmet sich ebenfalls dieser Frage. Ihr Text ist aber nicht zu vergleichen mit dem der Nobelpreisträgerin, und Ersan Mondtag hat völlig anders inszeniert als Johan Simon, der ehemalige KammerspielIntendant und Regisseur der JelinekUraufführung. Olga Bach schreibt so dicht wie knapp. „Das Erbe“ umfasst gerade mal 20 Seiten, holt aber trotzdem zu einem kulturgeschichtlichen Rundumschlag aus. In einer kurzen Bildbeschreibung geht es um das „Bildnis ei- nes bartlosen Mannes und Bildnis einer Frau“ von Lucas Cranach dem Älteren. Es folgen Textpartikel von Sophokles, Schiller, Kafka, Heinrich Böll, Heiner Müller. Mitten im assoziativen Kunterbunt sprechen dann aber plötzlich zwei nicht näher definierte Menschen über Beate Zschäpe. Eigentlich sehe sie „fast wie ein zartes Mädchen aus“, meint der eine. Darauf der andere: „Sie sieht völlig verblödet aus.“ „Eine Assoziation zum NSU“ heißt der von Ersan Mondtag entwickelte Theaterabend, in dem Tina Keserovic als Beate Zschäpe zu sehen ist (Mitte). Lena Lauzemis (links) und Thomas Hauser sind ihre Beobachter. FOTO: ARMIN SMAILOVIC In der Uraufführung geht an dieser Stelle mitten in der Fake-Bibliothek eine große Schiebetür auf und öffnet den Blick auf einen dahinter liegenden Raum, in dessen Mitte eine Schauspielerin in einem jener Ganzkörperanzüge liegt, die Nacktheit vortäuschen: Tina Keserovic sieht wie Beate Zschäpe aus und erweckt in ihrem Bodysuit den Eindruck, sie sei schwanger. Später wird sie mit einem Unschuldslächeln umher wandeln, sich wie ein trotziges Kind schreiend winden und schließlich ihr eigenes Hirn gebären. Zunächst aber liegt sie reglos, und wir verstehen: Hier wurde eines der wohl interessanteren Studienobjekte der Menschheitsgeschichte konserviert. Mit ihm werden sich die maskenhaften Lemuren (Jonas Grundner-Culemann, Thomas Hauser, Jelena Kuljic, Lena Lauzemis, Wiebke Puls, Damian Rebgetz) näher beschäftigen. Ersan Mondtag inszeniert, als seien Nachkommen der heutigen Menschheit mit einem Raumschiff unterwegs. Robo-Wissenschaftler, die durch ein großes Fenster ins Nichts des All blicken und kühl gezirkelt das Erbe der Menschheit analysieren. Nirgendwo ist da Empathie oder Grauen, auch nicht, wenn sie unvermittelt einen Vers aus Gustav Mahlers „Kindertotenlieder“ singen. Das „Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen!“ wirkt, als wollten sie die Angehörigen der NSU-Opfer darauf aufmerksam ma- chen, dass der Tod nichts Endgültiges sei. Der Eindruck, man sei in einem gefühllosen Labor gelandet, stellt sich auch ein, wenn es um den Schwaben Ernst August Wagner geht, der im September 1913 nahe Stuttgart seine gesamte Familie ermordete und auf der Straße mit zwei Mauser-Pistolen wahllos um sich schoss. Der erste amtlich registrierte Amokläufer schrieb ganz nebenbei Theaterstücke und wälzte herrenmenschliches Gedankengut. Nachdem er gestorben war, wurde sein Gehirn seziert, und da habe man, schreibt Olga Bach, einen Schaden im limbischen System festgestellt, also in jener Hirnregion, die für unsere Emotionalität zuständig ist. Und weiter: „Wagner war wahnsinnig. Keine politische Motivation. Schwere dependente Persönlichkeitsstörung, schwere seelische Abartigkeit.“ Man könnte sich nun die Frage stellen, ob Beate Zschäpe am Ende des Münchner Prozesses unter Umständen in eine psychiatrischen Klinik eingeliefert wird, beschäftigte sich aber lieber damit, ob Ersan Mondtags ästhetisches Überwältigungstheater nicht ein etwas schlaffer Zugriff ist angesichts eines Themas wie den Morden des NSU. TERMINE — Nächste Aufführungen am 2. und 4. Juli — Karten im Internet: www.muenchner-kammerspiele.de; Telefon 089/233 966 00 kai_hp07_kult.01