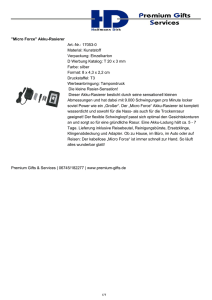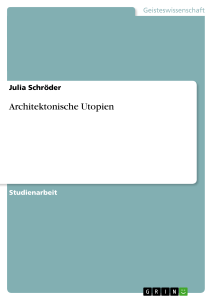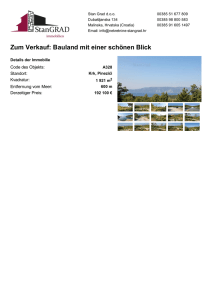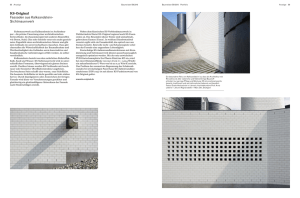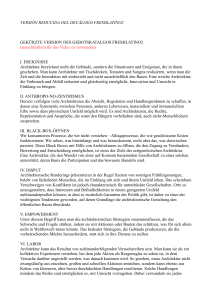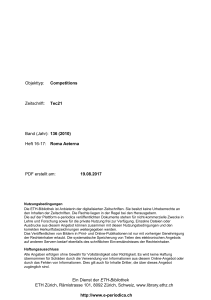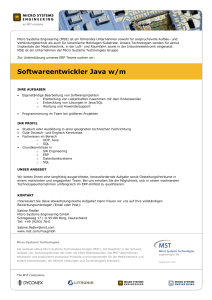Orte der Begegnung - Publikationsdatenbank der TU Wien
Werbung
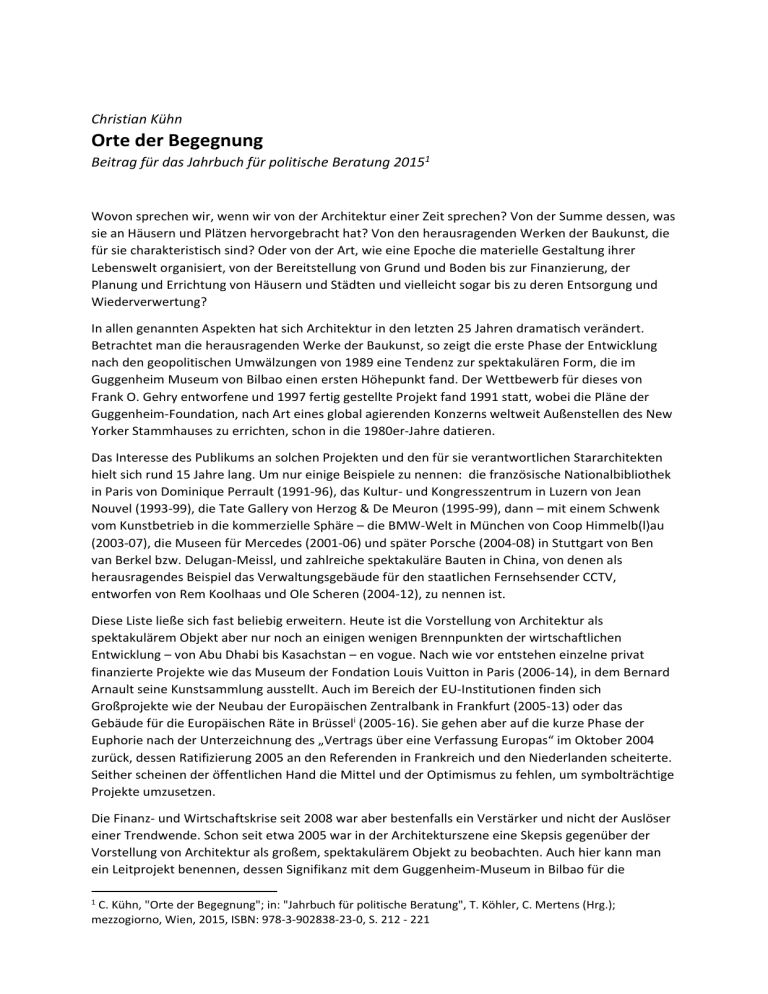
Christian Kühn Orte der Begegnung Beitrag für das Jahrbuch für politische Beratung 20151 Wovon sprechen wir, wenn wir von der Architektur einer Zeit sprechen? Von der Summe dessen, was sie an Häusern und Plätzen hervorgebracht hat? Von den herausragenden Werken der Baukunst, die für sie charakteristisch sind? Oder von der Art, wie eine Epoche die materielle Gestaltung ihrer Lebenswelt organisiert, von der Bereitstellung von Grund und Boden bis zur Finanzierung, der Planung und Errichtung von Häusern und Städten und vielleicht sogar bis zu deren Entsorgung und Wiederverwertung? In allen genannten Aspekten hat sich Architektur in den letzten 25 Jahren dramatisch verändert. Betrachtet man die herausragenden Werke der Baukunst, so zeigt die erste Phase der Entwicklung nach den geopolitischen Umwälzungen von 1989 eine Tendenz zur spektakulären Form, die im Guggenheim Museum von Bilbao einen ersten Höhepunkt fand. Der Wettbewerb für dieses von Frank O. Gehry entworfene und 1997 fertig gestellte Projekt fand 1991 statt, wobei die Pläne der Guggenheim‐Foundation, nach Art eines global agierenden Konzerns weltweit Außenstellen des New Yorker Stammhauses zu errichten, schon in die 1980er‐Jahre datieren. Das Interesse des Publikums an solchen Projekten und den für sie verantwortlichen Stararchitekten hielt sich rund 15 Jahre lang. Um nur einige Beispiele zu nennen: die französische Nationalbibliothek in Paris von Dominique Perrault (1991‐96), das Kultur‐ und Kongresszentrum in Luzern von Jean Nouvel (1993‐99), die Tate Gallery von Herzog & De Meuron (1995‐99), dann – mit einem Schwenk vom Kunstbetrieb in die kommerzielle Sphäre – die BMW‐Welt in München von Coop Himmelb(l)au (2003‐07), die Museen für Mercedes (2001‐06) und später Porsche (2004‐08) in Stuttgart von Ben van Berkel bzw. Delugan‐Meissl, und zahlreiche spektakuläre Bauten in China, von denen als herausragendes Beispiel das Verwaltungsgebäude für den staatlichen Fernsehsender CCTV, entworfen von Rem Koolhaas und Ole Scheren (2004‐12), zu nennen ist. Diese Liste ließe sich fast beliebig erweitern. Heute ist die Vorstellung von Architektur als spektakulärem Objekt aber nur noch an einigen wenigen Brennpunkten der wirtschaftlichen Entwicklung – von Abu Dhabi bis Kasachstan – en vogue. Nach wie vor entstehen einzelne privat finanzierte Projekte wie das Museum der Fondation Louis Vuitton in Paris (2006‐14), in dem Bernard Arnault seine Kunstsammlung ausstellt. Auch im Bereich der EU‐Institutionen finden sich Großprojekte wie der Neubau der Europäischen Zentralbank in Frankfurt (2005‐13) oder das Gebäude für die Europäischen Räte in Brüsseli (2005‐16). Sie gehen aber auf die kurze Phase der Euphorie nach der Unterzeichnung des „Vertrags über eine Verfassung Europas“ im Oktober 2004 zurück, dessen Ratifizierung 2005 an den Referenden in Frankreich und den Niederlanden scheiterte. Seither scheinen der öffentlichen Hand die Mittel und der Optimismus zu fehlen, um symbolträchtige Projekte umzusetzen. Die Finanz‐ und Wirtschaftskrise seit 2008 war aber bestenfalls ein Verstärker und nicht der Auslöser einer Trendwende. Schon seit etwa 2005 war in der Architekturszene eine Skepsis gegenüber der Vorstellung von Architektur als großem, spektakulärem Objekt zu beobachten. Auch hier kann man ein Leitprojekt benennen, dessen Signifikanz mit dem Guggenheim‐Museum in Bilbao für die 1 C. Kühn, "Orte der Begegnung"; in: "Jahrbuch für politische Beratung", T. Köhler, C. Mertens (Hrg.); mezzogiorno, Wien, 2015, ISBN: 978‐3‐902838‐23‐0, S. 212 ‐ 221 vorangegangene Phase zu vergleichen ist: Das Rolex‐Learning‐Center der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (2004‐2009), entworfen von der japanischen Architektin Kazuo Sejima und ihrem Büro SANAA, ein flächig ausgelegtes, eingeschoßiges Gebäude, leicht gewellt wie ein fliegender Teppich, der gerade vom Boden abheben möchte. Auch dieses Haus ist technisch aufwendig und auf seine Weise spektakulär, aber sicher kein monumentales Objekt. Architektur wie das Rolex‐Learning‐Center versteht sich nicht als Gegenstand, der im Weg steht, sondern als Medium, das Menschen verbindet. „People meet in Architecture“, lautete folgerichtig auch der Titel, unter den Kazuo Sejima die von ihr 2010 geleitete Architekturbiennale in Venedig stellte. Man muss diesen scheinbar banalen Satz umkehren, um seine Sprengkraft zu verstehen: Architektur ist, wo Menschen sich treffen, also einen gemeinsamen Raum zwischen sich aufspannen können. Architektur als Objekt oder gar als Monument spielt für diese Herleitung der Kernaufgabe der Architektur keine besondere Rolle, wenn sie nicht überhaupt als etwas zu Überwindendes gesehen wird: „Anti‐Object: The Dissolution and Desintegration of Architecture“ nannte der japanische Architekt Kengo Kuma sein 2007 erschienenes Buch, in dem er nichts weniger als eine neue Kunstform einforderte, die Architektur, Medien‐ und Landschaftskunst vereinen und die traditionelle, ans Objekthafte gebundene Baukunst ersetzen sollte. Die Krise des Objekts und die Sehnsucht nach dem Öffentlichen Raum Für die Öffentlichkeit hatte die Krise des monumentalen Objekts jedoch bisher eine andere Konsequenz. Konnte man in den 1990er‐Jahren noch glauben, durch spektakuläre Architektur Stadtplanung betreiben zu können, so verlagert sich das Interesse von Planern und Öffentlichkeit heute zunehmend auf die Qualität des öffentlichen, insbesondere des städtischen Raums. Was Architekten wie Kengo Kuma und Kazuo Sejima von der Architektur forderten, scheint sich im öffentlichen Raum aus mehreren Gründen leichter realisieren zu lassen. Erstens sind öffentliche Räume definitionsgemäß Orte der Begegnung. Zweitens sind sie eher durch soziale Beziehungen definiert und als durch ihre Geometrie: Während der Begriff „Raum“ – auf ein Gebäude bezogen – in der Regel mit dem Zimmer gleichgesetzt wird, ist der „öffentliche Raum“ schon immer mehr soziale Metapher als geometrisch klar umrissene Figur. Dass öffentliche Räume umkämpft sind, dass ihre Bedeutung und ihr Stellenwert in der Stadt Veränderungen ausgesetzt sind, ist Teil der Erfahrung von Generationen. Wenn soziale Bewegungen ernst genommen werden wollen, müssen sie bis heute – das zeigen die Ereignisse vom Gezi‐Park in Istanbul über den Tahrir‐Platz in Kairo bis zum Majdan in Kiew und zur Occupy‐Bewegung – ihre Fähigkeit beweisen, öffentlichen Raum zu besetzen. Die domestizierte Form dieser Besetzungen sind die Ansätze für einen „Urbanismus von unten“, der sich in gestalterischen Aktivitäten wie etwa dem „Urban Gardening“ im öffentlichen Raum manifestiert.ii Die Symbolik dieser Aktionen ist politisch subtil: Hier werden Freiräume erobert und Ad‐Hoc‐ Institutionen geschaffen, die der selbständigen Produktion von Nahrungsmitteln dienen. An Architektur reicht ihnen eine Gartenlaube, die sich als Hütte gegenüber den Headquarter‐Palästen der Nahrungsmittelindustrie positioniert. Die Finanz‐ und Wirtschaftskrise seit 2008 hat die Krise des architektonischen Objekts aus mehreren Gründen verschärft. Einerseits war einer der auslösenden Faktoren dieser Krise das scheinbar harmloseste architektonische Objekt, nämlich das US‐amerikanische suburbane Häuschen im Grünen. Dass dieses Produkt bei den Banken nur als vielfach transformiertes Abstraktum auftauchte, ändert nichts am Ursprung der Krise: Zu viel Geld wurde an Wohnungssuchende mit zu geringer Bonität verliehen, die in der Hoffnung auf ewig steigende Immobilienpreise in zu große und für sie zu teure Objekte investierten. Andererseits sind große Gebäude für ihre Realisierung zwangsläufig auf großes Kapital angewiesen und damit in der öffentlichen Wahrnehmung mit allen negativen Aspekten des Neoliberalismus kontaminiert. Der Imageverlust des architektonischen Objekts, vom Häuschen im Grünen bis zum milliardenschweren Investorenprojekt, blieb nicht ohne Folgen. Allem Anschein nach hat die öffentliche Hand unter den Bedingungen einer investorengetriebene Stadtentwicklung den Einfluss auf die architektonische Qualität von Gebäuden weitgehend aufgegeben. Sie beschränkt sich auf den Versuch, zumindest einen Teil des privaten Gewinns zurückzuholen und in den öffentlichen Raum zu investieren. Hier kann die öffentliche Hand den Bürgern auch etwas versprechen, das sie ihnen in der investorengetriebene Stadtentwicklung ansonsten kaum mehr zu bieten wagt, nämlich Partizipation. Von einer Volksbefragung über ein Investorenprojekt wie etwa das Hochhaus auf dem Areal des Wiener Eislaufvereins wird in aller Regel Abstand genommen, um das angeblich scheue Kapital nicht zu verschrecken. Ob auf der Mariahilferstraße eine Fußgänger‐ und Begegnungszone entstehen soll, war dagegen monatelang ein Streitfall der Lokalpolitik, der schließlich über eine Volksbefragung entschieden wurde. Zugespitzt könnte man behaupten: Je schlechter es der Demokratie geht, desto mehr Partizipation muss sie in Bereichen inszenieren, in denen sie mit den Kräften des Kapitals so wenig wie möglich anecktiii. In diesem Kontext entfalten sich Professionen, die kooperative Verfahren und künstlerischen Interventionen im öffentlichen Raum organisieren, um ‚die Menschen‘ an Gestaltungsprozessen zu beteiligen. An die Stelle der spektakulären Stararchitektur tritt dabei oft das temporäre Spektakel als kostengünstigeres Vehikel zur Konstruktion von sozialem Raum. Die Krise des architektonischen Objekts, in dessen Innenräumen Stadtbewohner dennoch gut 80% ihrer Lebenszeit verbringen, ist dadurch aber noch in keiner Weise bewältigt. Im Gegenteil: Die einseitige Fokussierung auf den öffentlichen Raum überlässt das architektonische Objekt den freien Kräften des Marktes auf der einen und einer zunehmenden Bürokratisierung und Verrechtlichung aller Bauprozesse auf der anderen Seite. Zwar ist auch die Gestaltung des öffentlichen Raums von diesen Tendenzen betroffen, aber bei weitem nicht im selben Ausmaß wie die Gestaltung von Hochbauprojekten. Deren Komplexität macht sie zu immer riskanteren Unternehmungen, bei denen jede Abweichung von der Norm für die Planer in einem Fiasko enden kann. Unter diesen Rahmenbedingungen kündigt sich ein neue Einteilung in der Gestaltung von Städten an: Auf der einen Seite die Gestaltung des öffentlichen Raums mit seinen Verkehrs‐ und Erholungsaufgaben, die als kulturelle und künstlerische Aufgabe gesehen wird, auf der anderen Seite die Gestaltung von Gebäuden als primär technische Aufgabe, die eher von Ingenieuren als von Architekten bearbeitet werden sollte. Das käme einer Umkehrung der bisherigen Verhältnisse gleich. Die Straße wird zur kulturellen Aufgabe und das Gebäude zur Infrastruktur. Architektur als Medium gesellschaftlicher Veränderung Man kann der Reduktion von Architektur auf eine Form von technischer Infrastruktur durchaus positive Aspekte abgewinnen, die mit dem Ziel einer Überwindung des Objekthaften vereinbar sind. Infrastrukturen sind Systeme und keine Objekte. Auch wenn das Kanal‐ oder Verkehrsnetz einer Stadt aus zahlreichen Bauwerken und Elementen besteht, wird es immer als dynamisches System geplant, in dem Kreisläufe und Stoffflüsse die wesentlichen Parameter sind. Auch Gebäude lassen sich als Teil eines Gesamtsystems von Infrastrukturen betrachten, das in ein größeres Ökosystem eingebettet ist und dieses mitbeeinflusst. Eine solche Neu‐Konzeptionalisierung des Gebäudes ist wahrscheinlich die wichtigste Voraussetzung für eine ökologisch nachhaltige Architektur. Sie impliziert gebäudetechnische Aspekte wie die Integration von Gebäuden als Energieversorger in Smart‐Grids ebenso wie die Suche nach nachhaltigen Konstruktionsweisen, aber auch Fragen der Nutzungstypologien jenseits der heutigen Trennung von Wohnen, Arbeiten und Konsum. Zur Infrastruktur gezählt zu werden, hätte für die Architektur auch den Vorteil, ähnlich wie das Kanalsystem oder das U‐Bahnnetz als unverzichtbar angesehen zu werden. Auch wenn es um technische Infrastruktur immer wieder öffentliche Auseinandersetzungen gibt – wie etwa um den Bahnhof in Stuttgart –, geht es bei diesen Auseinandersetzungen in der Regel um Standortfragen und nicht um Technologie. Sobald eine Grundentscheidung gefallen ist, wird die konkrete Gestaltung von Infrastrukturen weitgehend unhinterfragt der Expertise von Ingenieuren überlassen, von denen man erwartet, dass sie auf dem aktuellsten Stand der Technik und mit entsprechend ausgestatteten Budgets arbeiten. Ein Wechsel des Innovationsschemas vom künstlerischen in den technologischen Modus könnte der Architektur also durchaus neue Spielräume bieten. Eine wichtige Funktion kann Architektur, auf Infrastruktur reduziert, aber nur noch schlecht übernehmen: Medium für gesellschaftliche Veränderung zu sein. Als solches wird Architektur von den Sozialwissenschaften seit den 1980er‐Jahren im Rahmen einer Neubewertung des Raums verstanden, die als „Spatial Turn“ oder „topologische Wende“ bezeichnet wird. Raum wird im Kontext dieser Wende nicht einfach als Behälter verstanden, in dem sich soziales Leben abspielt, sondern als Ergebnis sozialer Beziehungeniv. Der ‚reale‘, in der sozialen Praxis des Alltags erlebte Raum reicht zur Erklärung dessen, was Raum für eine Gesellschaft bedeutet, nicht aus. Produktion von Raum findet auch in den Konzepten und Plänen statt, durch die Räume entwickelt werden, sowie durch die Bilder und Symbole, mit denen Räume in der Gesellschaft wirksam werden.v Diese Überlegungen haben Konsequenzen für die häufigste Form der Raumschaffung, nämlich jene durch Architektur, Städtebau und Landschaftsarchitektur. Sie eröffnen gewissermaßen eine zweite Front gegen die Architektur als Objekt, indem sie ihr die Vorstellung von Architektur als Prozess gegenüberstellenvi. Architektur als Objekt ist charakterisiert durch Eigenschaften wie Form und Funktion sowie durch die Leistungen, die sie für bestimmte Nutzungen erbringt („Performance“). Diese Leistungen reichen von so objektiv messbaren Aspekten wie dem Schutz vor der Witterung bis zu so subtilen wie der Artikulation von Machtstrukturen über einen Grundriss. Architektur als Prozess lässt sich dagegen als Abfolge von Handlungen und Entscheidungen definieren, vom Projektanstoß über die Planung, Umsetzung, Nutzung und Umnutzung bis hin zum Abbruch eines Objekts. Bei der Betrachtung von Architektur als Objekt stehen die Anforderungen der Gesellschaft und des Einzelnen am Schluss und sind über den Begriff der ‚Performance‘ nur lose mit dem Objekt verknüpft. Bei der Betrachtung von Architektur als Prozess ist es genau umgekehrt: Sie interessiert sich für die gesellschaftlichen Kräfte, die zu bestimmten, oft widersprüchlichen Anforderungen an die gebaute Umwelt führen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die verschiedenen Akteure und ihre Ideen, deren Wirkungsgeschichte und Seiteneffekte. Das gebaute Objekt wird nur als eine Wirkung unter anderen betrachtet. Diese beiden Vorstellungen von Architektur ergänzen einander, wobei sie ihre Inhalte im einen Fall über eine räumliche und im anderen über eine zeitliche Achse organisieren. Offensichtlich kann es keine Architektur als Objekt ohne einen entsprechenden Prozess geben. Umgekehrt ist es aber sehr wohl möglich, einen architektonischen Prozess in die Wege zu leiten, der nie zu einem Objekt führt, trotzdem aber Auswirkungen hat. Darunter zählen nicht nur die einflussreichen, aber nie realisierten Projekte, die wir aus der Architekturgeschichte kennen. Jedes Projekt hinterlässt Spuren und Erfahrungen bei Akteuren und Beobachtern, die auch dann fortwirken, wenn es unrealisiert bleibt. Der Verzicht auf die Realisierung muss nicht immer ein Misserfolg sein. Oft genug stellen sich im Prozess neue Prioritäten und Alternativen heraus, die das Nicht‐Bauen für alle Beteiligten als die bessere Lösung erscheinen lassen. Aus der Perspektive des Prozesses markiert ein fertiggestelltes und feierlich eröffnetes Objekt nur einen Punkt auf der Zeitachse, einen Zwischenzustand zwischen wertvollen Erfahrungen der Vergangenheit und der Zukunft. Was bedeutet die tendenzielle Reduktion von Architektur auf technische Infrastruktur für ihre Rolle als Medium gesellschaftlicher Veränderung? Sie geht zwar nicht völlig verloren, da auch Infrastrukturen öffentlich diskutiert werden und bis zu einem gewissen Grad auch eine symbolische Bedeutung besitzen, wie sich zum Beispiel bei massiven Infrastrukturprojekten wie großen Staudämmen oder den Transeuropäischen Netzen beobachten lässt. Dennoch ist die Beziehung zum sozialen Raum bei Infrastrukturprojekten schon deshalb geringer, weil Infrastrukturen nicht direkt an den menschlichen Maßstab gebunden sind. Die Öffentlichkeit interessiert an Kanalsystemen und Autobahnen in erster Linie ihre Funktion, die meist auch erst dann aktiv wahrgenommen wird, wenn Störungen auftreten. Der menschliche Maßstab kommt bei der Autobahn nur vermittelt über das Fahrzeug ins Spiel, das dann als ‚Micro‐Environment‘ den eigentlichen auf den Menschen bezogenen Raum bietet. Auf die Architektur übertragen bedeutet das eine ähnliche Gliederung des Gebäudes in die primäre Infrastruktur von Tragsystem, Hülle und Ver‐ bzw. Entsorgung auf der einen und das ‚Micro‐ Environment' der bewohn‐ oder benutzbaren Einheiten auf der anderen Seite, wobei diese beiden Ebenen ästhetisch völlig entkoppelt werden können. Auf lange Sicht würde der Architektur als Disziplin die Gestaltung der ‚Micro‐Environments‘ als Aufgabe übrig bleiben, während das Ingenieurwesen alle anderen Aspekte abdecken kann. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist genau jener Aspekt, der einleitend als zunehmende gesellschaftliche Sehnsucht identifiziert wurde: die Verbindung zwischen dem auf individuellen Nutzen ausgerichteten ‚Micro‐Environment‘ und dem öffentlichen Raum. Aus diesem Blickwinkel lohnt es sich, Kengo Kumas Forderung nach einer Architektur des „Anti‐ Objects“ noch einmal genauer zu betrachten. Wenn er von der „Dissolution and Desintegration of Architecture“ spricht, ist damit keineswegs gemeint, die Rolle von Architektur als Medium gesellschaftlicher Veränderung aufzugeben, sondern im Gegenteil, sie zu verstärken und an neue Bedingungen anzupassen. Dass dabei der klassische Gebäudebegriff aufgegeben wird, meint alles andere als die oben skizzierte Aufspaltung der Architektur in Infrastruktur und „Micro‐Environment“. Die von Kuma geforderte Einbeziehung von Medienkunst und Landschaftsarchitektur in die neue architektonische Praxis bedeutet eine Ausweitung der Aufgabenstellung und keine Reduktion. Bemerkenswert an Kumas Arbeit ist in diesem Zusammenhang, dass sowohl der städtebaulichen Lösung als auch dem architektonischen Detail größte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Auflösung des Gebäudes wird bei manchen Projekten Kumas von innen her unternommen, indem ein bestimmtes Material oder Detail an den Anfang des Gestaltungsprozesses gestellt wird, lange bevor die Funktion im Grundriss thematisiert wird. Das Paradoxon, dass auch eine Architektur des „Anti‐Objects“ in der Regel auf eine materielle Realisierung abzielt, bleibt natürlich bestehen. Ihre Rolle als Medium, in dessen imaginierten wie realen Räumen gesellschaftliche Interessen und Bedürfnisse artikuliert und ausgehandelt werden, wird Architektur aber eher jenseits der Grenzen des konventionellen Gebäudebegriffs erfüllen können. Bahnhöfe als Orte der Begegnung: Super‐Markets oder potenzielle Agorà? Ein Bereich, in dem sich exemplarisch die Rolle von Architektur als Medium gesellschaftlicher Veränderung zeigen lässt, ist das Eisenbahnwesen. In ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts ist die Eisenbahn nur mit dem Internet für das 21. Jahrhundert vergleichbar. Die aus technischen Gründen monumentale Dimension der großen Kopfbahnhöfe gab der Architektur des 19. Jahrhunderts die Gelegenheit, diesen Stellenwert mit den Mitteln der monumentalen Palastarchitektur auszudrücken. Die sprunghafte Entwicklung der Eisen‐ und Stahlkonstruktionen, mit denen immer größere Bahnhofshallen überspannt werden konnten, hatte auf die der Stadt zugewandten Palastfassaden kaum einen Einfluss. An die Schnittstelle zwischen dem Netzwerk der Schieneninfrastruktur und der Stadt wurden monumentale Objekte gesetzt, die in ihren Innenräumen versuchten, die römischen Thermen zu übertreffen, und bei dieser formalen Ansage auch blieben, als die eingesetzte Bautechnik schon längst andere Optionen geboten hätte. Obwohl sich aus der Zeit der frühen Moderne konzeptionelle Entwürfe für Bahnhöfe im konstruktivistischen oder internationalen Stil finden lassen, blieb der Klassizismus international die bevorzugte Architektursprache für das Thema. Erst ab der Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine radikal andere Ästhetik des Bahnhofsbaus, die der technischen Infrastruktur den Durchbruch ins Stadtbild erlaubte, immer noch in einem monumentalen Maßstab, wie etwa die Stazione Termini in Rom (1948‐51) bezeugt. Funktionell änderte sich an der Typologie der Bahnhofsarchitektur nichts Grundsätzliches: Die große Bahnhofshalle als beeindruckender Raum, ergänzt um Gastronomieflächen und Einkaufsmöglichkeiten für den Bedarf der Reisenden. Erst ab den 1990er‐Jahren begannen die Bahnunternehmen das wirtschaftliche Potential ihrer inzwischen nicht mehr peripheren, sondern durch das Wachstum der Städte innerstädtischen Lagen zu erkennen und auszunutzen. Dabei wurden einerseits Gleisflächen frei gemacht, um sie gewinnbringend als hochwertige Standorte auf dem Immobilienmarkt anbieten zu können. Andererseits wurden Bahnhöfe funktionell neu interpretiert, nämlich als potenzielle Standorte für großflächige Shopping‐Malls mit hoher Frequenz. Die großen Bahnhofshallen, die immer eine, wenn auch beschränkte Agorà‐Funktion boten, wurden in diesem Kontext als unproduktiver Raumüberschuss denunziert. Bahnhofshallen waren immer ein unfreiwilliger Ort der Begegnung, der in der Frühzeit der Bahn noch wesentlich deutlicher in Zonen für unterschiedliche Klassen geteilt war, und sich im Lauf des 20. Jahrhunderts langsam demokratisiert hatte. Dass sich diese Tendenz sich seit Mitte der 1990er‐Jahre umkehrt, ist eine bemerkenswerte Entwicklung, die gesellschaftliche Trends im Raum umsetzt. Die deutliche Reduktion der Bahnhofshallen an sich und der in ihnen nicht kommerziell genutzten Flächen ist ein Komfortverlust für die Masse jener Reisenden, deren Tickets keinen Zugang zu den „Lounges“ ermöglichen. Auch die Verwandlung von früher öffentlichen Toiletten in kostenpflichtige Einrichtungen passt in dieses Schema subtiler Ausgrenzung, hier in Bezug auf ein spezielles Segment der Bahnhofsbesucher. Betrachtet man im Vergleich die zwei Bahnhöfe für Wien und Salzburg, die in den letzten Jahren neu errichtet beziehungsweise erneuert wurden, zeigen sich Unterschiede sowohl im Prozess als auch im architektonischen Resultat. Der Wiener Hauptbahnhof ist nicht viel mehr als ein Beiwerk zu einem Infrastrukturprojekt, das die Umstellung der bisherigen beiden Kopfbahnhöfe nach Süden und Osten auf einen zentralen Durchgangsbahnhof umfasste. Die insgesamt nötigen Aufwendungen für die neue Streckenführung durch Wien überstiegen bei weitem die Kosten des eigentlichen Bahnhofs. Im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs, der die Verwertbarkeit der freiwerdenden Gleisflächen betraf, wurden zwei Sieger ermittelt, die in ihren Projekten auch erste Konzepte für das Bahnhofsgebäude einreichten. Statt für den Bahnhof einen eigenen Wettbewerb auszuloben, wurde der Gesamtauftrag für Gleiskörper und Bahnhof an ein Konsortium von Ingenieurbüros vergeben, bei dem die Sieger des städtebaulichen Wettbewerbs als Subunternehmer mitwirkten. Die Gestaltung des Bahnhofs erfolgte daher ohne einen eigenen, internationalen Wettbewerb, in dem die Wahl eines geeigneten Projekts einer unabhängige Jury übertragen gewesen wäre. Der realisierte Bahnhof stellt eine Verbindung zwischen dem vierten und dem zehnten Bezirk her, die als Shopping‐Mall mit über hundert Geschäften auf zwei Ebenen umgesetzt wurde, von der auch der Aufgang zu den einzelnen Bahnsteigen erfolgt. Während diese Bereiche architektonische Massenware sind, die sich nicht von anderen Shoppingmalls unterscheidet, versuchten die Architekten bei der Überdachung der Bahnsteige mit spektakulären Formen zu punkten. Das Ergebnis zeigt aus der Vogelperspektive eine einprägsame Figur, für die Nutzer des Bahnhofs entstand jedoch ein unruhiger Raum, in dem die skulpturalen Einzelteile dominieren und kein Ganzes ergeben. Mit großem Aufwand – der Stahlmenge entspricht jener des Eiffelturm – wurde hier an der eigentlichen Aufgabe vorbeigeplant, nämlich einen großen Raum so leicht wie möglich zu überdachen. Völlig anders sieht das Ergebnis in Salzburg aus. Auch hier dauerte es viele Jahre vom Wettbewerb bis zur Realisierung, vor allem, weil sich eine Bürgerinitiative für die Erhaltung eines Marmorsaals stark machte, der zwar spätsezessionistische Züge trug, aber aus der Zeit nach 1945 stammte. In der öffentlichen Debatte konnte schließlich ein Kompromiss erreicht werden, der allerdings ein deutliches Bekenntnis zur Erneuerung implizierte: Die Marmorverkleidung wurde abgetragen und eingelagert und wartet bis heute auf eine Nachnutzung. Die denkmalgeschützte Stahlkonstruktion der alten Bahnüberdachung wurde dagegen komplett saniert und durch ein neues Dach ergänzt, das mit seinen luftgefüllten Kissen aus Kunststofffolie zu den leichtesten Bahnhofsdächern überhaupt gehört. Obwohl auch im Salzburger Bahnhof Geschäftsflächen zu finden sind, dominiert in der Bahnhofshalle und der Unterführung unter den Gleisen, die so wie in Wien auch hier zwei Stadtteile verbindet, der nicht‐kommerzielle öffentliche Raum. Während der Wiener Hauptbahnhof ein Nicht‐ Ort ist und den Eindruck erweckt, er sei er selbst nur auf der Durchreise, ist der Salzburger Bahnhof ein Ort, an dem es sich auch zu verweilen lohnt. Am deutlichsten würde der Unterschied zwischen den beiden Bahnhöfen wohl im Ausnahmezustand werden, wenn der Bahnverkehr plötzlich zusammenbricht und aus den Transiträumen Aufenthaltsorte für gestrandete Reisende werden. Wie würden die beiden Räume in dieser Situation wirksam werden? Was leistet dann die Kombination aus roher Infrastruktur und spektakulärer Form? Und was der Raum, der aus einer architektonischen Überlegung resultiert, die diese Unterschiede mit formvollendeter Leichtigkeit und Präzision im Detail überwindet? vgl. Christian KÜHN, Europa baut sich ein Palais um. In: Merkur - Deutsche Zeitschrift für Europäisches Denken, 66 (2012), 8; S. 717 - 723. i ii vgl. Elke KRASNY (Hsg.), Hands‐On Urbanism 1850 ‐ 2012: Vom Recht auf Grün. (Wien 2012) vgl. Jens KASTNER, Postdemokratische Räume. In: UmBau 27 (2014) Plenum. Orte der Macht. S 90 ‐ 99 iv vgl. Martina LÖW: Raumsoziologie (= Suhrkamp‐Taschenbuch Wissenschaft. Bd. 1506). (Frankfurt am Main, 2001) v vgl. Henri LEFÈBVRE: The Production of Space. (Oxford 1993 (1974). vi vgl. Christian KÜHN, Towards an Architecture of Change: From Open Plan to Open Planning. In: Michael SHAMIYEH (Hsg.), Organizing for Change: Integrating Architectural Thinking in Other Fields. (Basel 2007) iii