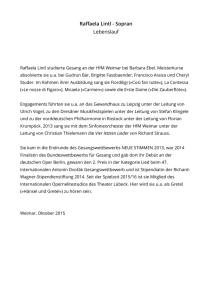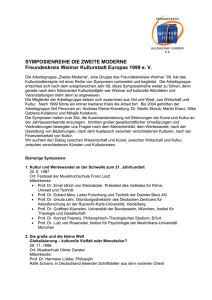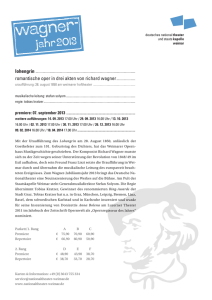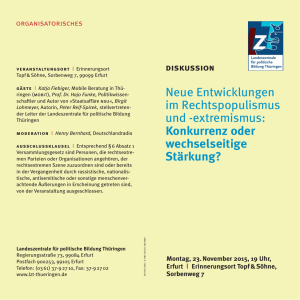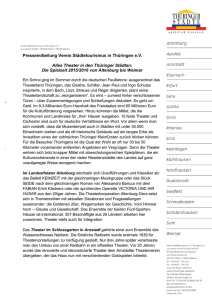Ohne Theater wird der Mensch zum Tier
Werbung

TLZ THEMA DES TAGES ZCTT1 Sonnabend, 17. Mai 2014 Drei Theater – drei Herausforderungen: Interview mit den Intendanten von Erfurt, Weimar und Rudolstadt Seit dieser Spielzeit in Weimar: Generalintendant Hasko Weber. Der Strukturerhalt der Thüringer Theaterlandschaft wird einiges kosten, sagt er. Früher Clown: Steffen Mensching, Intendant in Rudolstadt und Unterhaltungsfachmnann. Kleine Häuser, sagt er, brauchen höhere Landeszuwendungen. Langjähriger Chef der Erfurter Oper: Guy Montavon. Bis 2016, betont er, sind die Landesmittel sicher. Dann muss verhandelt werden. Fotos (4): Peter Michaelis „Ohne Theater wird der Mensch zum Tier“ Montavon: Bühnen schützen Städte vor Verödung – Weber: Wir können nicht alle erreichen – Mensching: Der Bund muss Thüringen mehr unterstützen n Von Bernd Hilder und Gerlinde Sommer Erfurt/Weimar/Rudolstadt. Neues Opernhaus in der Landeshauptstadt, Staatstheater mit der Verpflichtung zum Klassikerprogramm, Theater an der Saale, das mit Nordhausen kooperiert – die Häuser sind sehr unterschiedlich, die Erwartungen des Publikums hoch. Die Chefs dieser drei wichtigen Institutionen trafen sich jetzt zum TLZ-Theatergipfel: Guy Montavon (Erfurt), Hasko Weber (Weimar) und Steffen Mensching (Rudolstadt). Es geht um Bildungsaufträge, veränderte Zuschauergewohnheiten, Geld und Werktreue. Außer Ihrem eigenen: Haben Sie ein Thüringer Lieblingstheater? Hasko Weber: Nein. Ich bin noch nicht lange da und war beispielsweise noch nicht in Nordhausen. Guy Montavon: Ich bin ja von uns Dreien am längsten im Amt und habe natürlich alle Theater besichtigt und besucht – und in meiner Funktion als Landesverbandsvorsitzender des Deutschen Bühnenvereins wird das auch von mir erwartet. Am liebsten bin ich beim Kollegen Mensching in Rudolstadt. Da könnte ich direkt neidisch werden. Ich habe bei ihm zuletzt „Dinner for Spinner“ gesehen. Auch sein Projekt mit den Älteren auf der Bühne hat mich sehr interessiert. Steffen Mensching: Mein Lieblingstheater ist natürlich Nordhausen, weil wir damit in Kooperation stehen: Die machen bei uns Musiktheater, wir bei denen Schauspiel. Und das Funktionieren dieser Kooperation ist für uns eine Lebensversicherung, ansonsten wären wohl beide Häuser schon der letzten Finanzierungsdebatte zum Opfer gefallen. Sprechen Sie sich bei der Planung der Stücke ab? Montavon: Ja. Speziell mit Weimar, unserer benachbarten Bühne, haben wir jetzt die Pläne für das Musiktheater bis 2017 erörtert. Das hat es so in den vergangenen zehn Jahren nicht gegeben. Weber: Ich finde den Schritt vorher wichtiger: zu schauen, wohin die Reise inhaltlich geht... Mensching: Hasko hat in dieser Saison „Faust“ gemacht, wir machen es in der nächsten Spielzeit. Das passiert aus dem Willen heraus, sich mit so einem Stoff auseinanderzusetzen. Wir verstehen uns als Partner, aber in kreativer Konkurrenz. Beim Kampf ums liebe Geld wird immer wieder gesagt: Es müsste mehr Zusammenarbeit im Bereich Verwaltung oder auch bei den Werkstätten möglich sein. Wie sehen Sie das denn? Montavon: Unsere jetzige Zusammenarbeit mit Weimar ist nicht von Geld getrieben, sondern es handelt sich um einen künstlerisch-kreativen Prozess. Wir haben mit dem Land Verträge bis 2016 und die werden eingehalten. Die Frage ist: Was kommt danach? Um mehr über die Bevölkerungsentwicklung in den einzelnen Regionen zu erfahren, will ich zur nächsten Intendantenversammlung den Thüringer Chefstatistiker, Herrn Krombholz, einladen. n Mensching: Wegkürzen geht da nicht Und was ist jetzt mit Einsparmöglichkeiten etwa in Verwaltung und Werkstätten? Mensching: Das ist Illusion. Wir haben ganz kleine technische Gewerke – und in der Buchhaltung drei Leute: Wegkürzen geht da nicht. Aber natürlich sind wir drei in unterschiedlichen Positionen: Wir in Rudolstadt arbeiten seit 15 Jahren mit Haustarifverträgen... Blicken Sie neidisch auf die Kollegen? Mensching: Neidisch? Nein. Das ist ein Erbe, das ich 2008 übernommen habe. Wenn Sie in Weimar und Erfurt auch Haustarife hätten, könnten Sie dann mehr machen? Weber: Was verlangen Sie denn? Es sind prekäre Verhältnisse, die 15 Jahre lang in einem Haus wie Rudolstadt ausgehalten werden – von ausgebildeten Fachkräften, die ihr Leben in ihr Theater einbringen. Die Bezahlung dafür ist unterm Strich nicht zu rechtfertigen. Die große Erosion für die Theater und Orchester gab es in den 1990er Jahren – und von dem damit verbundenen Abbau waren alle betroffen. Montavon: Wichtig ist, egal wie die künftigen Strukturen aussehen: Die Theater lassen sich nicht mehr gegeneinander ausspielen. Wenn wir vom Geld sprechen: Ich war in Weimar in „Was Ihr wollt“. Mir hat es gut gefallen. Das Bühnenbild ist schön gemacht, aber sehr schlicht – und eine ganze Reihe von Figuren sind weggestrichen oder zusammengelegt worden. Und das Stück, das eigentlich drei Stunden oder länger dauert, ist jetzt nach 110 Minuten zu Ende. Ist das alles nur Kunst – oder ist das auch Kaufmann? Weber: Die Frage beantworte ich Ihnen nicht! Sie ist unseriös gestellt. Wie wollen Sie in Zeiten des Wandels in der Medien- und Kulturnutzung die Relevanz des Theaters erhalten? Weber: Wir gehen in Kindergärten, in Schulen – zum Teil zwei Fahrstunden von Weimar weg. Wir haben auf der Studiobühne und im Kesselsaal speziell für Schulklassen ein richtiges Aufbauprogramm auf den Weg gebracht – das reicht bis in große Aufführungen wie „Faust“ oder andere für die Schule relevante Stoffe. Das macht Mut... Mensching: Weimar und Rudolstadt versuchen auf diesem Gebiet tastend in Kooperation zu treten. Wir spielen „Der Junge im Bus“ – dieses Stück geht für einige Vorstellungen nach Weimar. Gegenseitig kommt in der nächsten Spielzeit „Tschick“ aus Weimar zu uns. Die Frage ist doch: Kriegt man die Kids von den Handys und Bildschirmen weg ins Theater... Und ich bin da eher optimistisch. Die Erfahrung, in einem Saal zu sein mit 100, 200, 300 Leuten, die in der gleichen Stimmung sind, wenn etwas auf der Bühne live passiert, ersetzt kein digitales Medium. Das ist wie im Fußballstadion oder bei Rockkonzerten. Montavon: Wir gehen gern in Schulen oder empfangen Schulklassen hier im Haus. Aber ich sage ganz klar: Wir sind kein Ersatz für den ausgefallenen Musikunterricht. Und ich finde, die beste Werbung für die Jugend ist die Jugend selbst – und deshalb habe ich das Bild des Generalmusikdirektors hier in Erfurt ein wenig verändert, indem ich eine ganz junge Generalmusikdirektorin engagiert habe. Bei den Domstufen gehen wir in diesem Jahr mehr Richtung Rockoper – und das wird ein anderes Publikum als bisher ansprechen. Haben Sie beim Theater immer die Quote im Kopf – oder geht es einzig um Qualität? Montavon: Wir sind immer getrieben vom Prinzip der Exzellenz und versuchen das Maximale zu erreichen an künstlerischer Qualität. Das beantwortet auch die Frage, die Sie vorher an den Kollegen Weber zu „Was Ihr wollt“ gestellt haben. Wir sind ein Unternehmen, das Kunst produziert und vermittelt. Wir haben eine gewisse geistige Weltordnung weiterzugeben – und natürlich hat Theater eine ganz große soziale Funktion: Wo Theater sind, sind bekanntermaßen weniger soziale Probleme oder Jugendkriminalität. Wenn Städte keine Theater mehr haben, verödet unsere Gesellschaft und der Mensch wird langsam wieder zum Tier. Das legitimiert uns – und dafür soll Geld ausgegeben werden. Weber: Theater sollte für alle da sein, aber es wird niemals alle erreichen. Und wir hängen voneinander ab. Es stellt sich die Frage: Was bedeutet eine Zeitung in einer kleinen Stadt? Was bedeutet ein Theater in einer kleinen Stadt? Dieses Thema wird relevant werden, weil es existenziell ist – und zwar für alle Beteiligten. Herr Montavon hat das drastisch formuliert, als er vom Veröden sprach. Mensching: Unsere Besucher sind die Leute aus der Region, kaum Touristen, nur wenige Studenten. Was aus Jena kommt, das ist die alte Intelligenzia, die mit Bussen anreist. Da verändert sich wenig... So ein treues Publikum kann man höchstens vergraulen, oder? Mensching: Vergraulen kann man es ganz schnell. Die dritte Klassiker-Inszenierung, die völlig gegen den Strich gebürstet ist, hat zur Folge, dass Abonnenten kündigen. Das ist Fakt. Man muss an die Ansprüche und ästhetischen Erfahrungen der Zuschauer anknüpfen – und gleichzeitig muss man sie formen, mobilisieren und weitertreiben. Das funktioniert, wenn man die Menschen ernst nimmt als Partner und nicht etwa, wenn man ihnen nach dem Munde redet. Deshalb ist die Frage, ob wir Aufklärung oder Unterhaltung machen wollen, gar nicht relevant. Für uns ist beides wichtig. Und Unterhaltung bedeutet für mich, der ich viele Jahre als Clown gearbeitet habe, eben nicht, dass man den Kopf an der Garderobe abgeben soll. Unterhaltung hat zu tun mit sinnli- Im Büro des Erfurter Opernhauschefs: Guy Montavon (v.l.), Bernd Hilder, Hasko Weber, Gerlinde Sommer und Steffen Mensching. chem Genuss, Vergnügen – und Nachdenken über die Welt. Viele rufen nach Werktreue – und auf der Bühne gibt es stattdessen oft sehr freie Interpretationen der Stücke bis hin zur ewigen Provokation. Muss das sein? Montavon: Es ist besser, von einer Werkberechtigung als von einer Werktreue zu sprechen. Feststellen kann ich: Deutschland ist das einzige Land in der ganzen Welt, das die Theatergeschichte nach vorne gebracht hat, indem es geforscht und gewagt hat. Theater soll manchmal stören. Das macht unvergesslich – und wichtig. n Weber: Wo Hamlet draufsteht, muss Hamlet drin sein Muss sich Theater manchmal entscheiden zwischen regionalem Abo-Publikum und überregionalem Feuilleton? Weber: Ach, wenn man sich dazu entscheiden könnte... (lacht) Nein! Man darf aus der Verankerung nicht heraus. In Weimar haben wir geradezu eine Verpflichtung, uns mit dem klassischen Erbe zu beschäftigen. Goethe und Schiller sind eine stabile Erwartung an das Theater dieser Stadt. Das finde ich auch gut. Daneben gilt es aber, Neues auszuprobieren. Ich verstehe jeden Theaterbesucher, der sagt: Da steht Hamlet drauf – und dann möchte ich auch, dass da Hamlet drin ist. Eine Uraufführung aber heißt, etwas noch nicht Dagewesenes zu machen. Doch liegt das überhaupt noch im Interesse der Zeit? Zur Kunst gehört insgesamt nicht nur Erfolg, sondern auch das Scheitern, auch das scheint gesellschaftlich schon fast nicht mehr erlaubt zu sein. Wie reagieren Sie denn auf dieses Dilemma? Weber: Ich habe da ein ganz einfaches Prinzip. Wir selber müssen vor der Premiere – und wenn es fünf Minuten vorher ist – uns in die Augen sehen können, um zu sagen: Hier sind wir ganz vorn. Oder: Hier haben wir gut in der Mitte gelegen. Oder: Hier haben wir es vielleicht gerade so hingekriegt. Und wenn es gar nicht reicht, darf der Vorhang gar nicht erst hochgehen. Dann können die Zuschauer und die Zeitung urteilen – und alles meinetwegen auch ganz anders sehen... Wo geht es hin in der Thüringer Theaterlandschaft – von den Finanzen über Kooperationen bis zu den künstlerischen Leistungen? Mensching: Wir stehen vor Wahlen – aber von CDU über SPD bis hin zu Grünen und Linken haben sich, wenn auch unterschiedlich stark akzentuiert, alle wesentlichen Parteien für den Erhalt der Kulturlandschaft in Thüringen ausgesprochen. Ich bin also optimistisch. Klar ist: Wir brauchen mehr Geld für die Theater in Thüringen – und dabei geht es um ein paar Millionen Euro. Nicht so viel, dass alle in die Flächentarife geraten, aber doch verbunden mit einer größeren Fördergerechtigkeit. Ich spreche hier ganz klar für die kleinen Häuser – und sage: Es wird nach wie vor einen Unterschied geben zwischen der Staatskapelle und unserem Orchester, sowohl auf das Niveau und die Ensemblegröße als auch auf die Tarife bezogen. Aber es muss größere Gerechtigkeit geben – und das Ziel muss sein, dass der Landesanteil auch bei den kleinen Häusern in Richtung 50 Prozent tendiert. Bisher sind es bei uns um die 30 Prozent, und das ist nicht zu rechtfertigen. Wenn man die Theater in der jetzigen Struktur und an diesen Standorten erhalten will, müssen die jetzigen Beträge aufgestockt werden. Die Höhe ist eine Verhandlungsfrage. Herr Montavon und Herr Weber, schließen Sie sich dem an? Weber: Ja. (Montavon nickt) Das Theater wird, wie alle anderen Bereiche auch, nicht von sich aus billiger. Aber wenn es um die Frage nach mehr Geld geht, man muss auch mal gesagt werden: Was die Theater in den vergangenen zehn Jahren eingespart haben – und zwar ohne politische Ansage – ist gigantisch. Wir sprechen auf Bundesebene davon, dass 350 Millionen Euro weniger für Theater aufgewendet werden müssen als ohne diese eigenen Sparmaßnahmen. Wir schauen alle ständig darauf, wie wir effektiv mit dem umgehen können, was wir haben. Und wenn man davon ausgeht, dass die aktuellen Strukturen in Thüringen erhalten bleiben und sich auch entwickeln sollen, dann werden dazu weiter Mittel nötig sein, die auf dem aufbauen, was es jetzt gibt. Wie das verteilt, wie es strukturiert wird, hängt davon ab, wer die Landespolitik bestimmt und wie die Kommunen mit der Landespolitik zu einem Agreement kommen. Aber das geht weit über Thüringen hinaus. In dem Handelsabkommen, das Europa mit den USA plant, steht Kultur unter Dienstleistungen. Wenn das in einigen Jahren greifen sollte, dann wird sich die gesamte Bildungs- und Kulturlandschaft in Deutschland verändern – und zwar lawinenartig. Und in Deutschland diskutiert niemand darüber... Deshalb muss man sich landespolitisch auf solche Entwicklungen einstellen. Thüringen ist kulturreich, das ist ein Segen und auch eine Last. Kann denn das Land das alles stemmen – oder muss der Bund mehr einspringen? Mensching: Thüringen hat viel nationales Kulturerbe, also nicht nur Theater, sondern auch Burgen und Schlösser sowie Museen, dabei aber mit zwei Millionen ein Bruttosozialprodukt, das weit hinter anderen Bundesländern zurückfällt. Und dieser Erhalt geht nicht nur das Land etwas an. Es stellt sich also die Frage, wie viel Prozent dafür vom Bund übernommen werden können... Montavon: Sollte ein politisch Verantwortlicher auf die Idee kommen, die Kulturlandschaft stark zu beschädigen, werden wir mit ganzer Kraft erklären, warum wir wichtig sind. Dazu gehört nicht nur der Verweis auf die Geschichte und unser Publikum, sondern auch, dass man mit Kultur Investoren lockt, dass wir zur Städtebelebung beitragen... Ich glaube, dass man das in der Thüringer Politik verstanden hat. n Montavon: Zum Biotop gehört die Rezension Lesen Sie Theaterkritiken – und was machen Sie, wenn Sie den Inhalt gar nicht teilen? Montavon: Eine gute Kritik sorgt nicht dafür, dass wir einen vollen Saal haben – und eine schlechte Kritik sorgt nicht dafür, dass wir einen leeren Saal haben. Zum Biotop Theater gehört Produktion und Rezension – und das Brot des Künstlers ist der Applaus. Ich ärgere mich natürlich manchmal, wenn ich eine Kritik ungerecht finde, aber es gehört zum demokratischen Prozess, dass wir wahrgenommen und bewertet werden. Mensching: Kritiken sind ganz wichtig. Nicht nur, um den Künstlern zu zeigen, wie weit sie gekommen sind – ob sie vollkommen gescheitert sind oder nur partiell, sondern auch, um eine gesellschaftliche Aussprache vorzuführen, die auf der Bühne begonnen wurde. Und das sollte Gegenstand der Kritiken sein – und wenn sie so ansetzt, kann ich auch mit jeder scharfen Polemik gut leben. Aber wenn es nur geschmäcklerisch ist, ärgere ich mich drüber. Und dann schreibe ich auch mal einem Kritiker. Das ändert nichts, verschärft vielleicht sogar manchmal die Situation, aber für mich ist so ein Austausch wichtig. Weber: Ich finde, Kritik bemisst sich daran, ob sie den Respekt behält – oder ob sie den verliert. Eine Kritik, die auf der persönlichen Ebene landet – und das passiert ja gelegentlich, würde ich meinerseits scharf befragen.