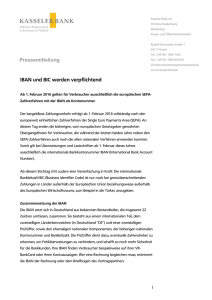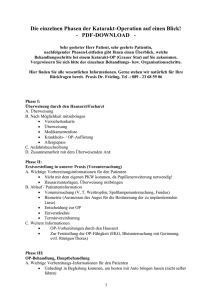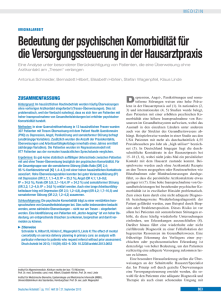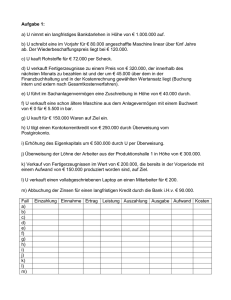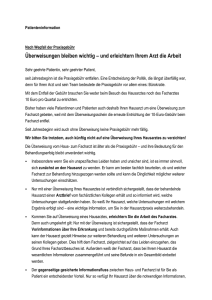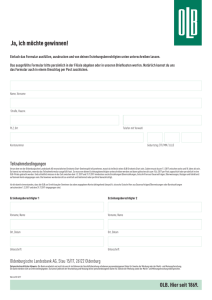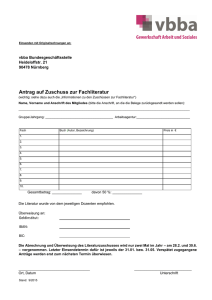Psychosomatische Aspekte an der Schnittstelle Hausarzt
Werbung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN Institut für Allgemeinmedizin Klinikum rechts der Isar (Direktor: Univ.-Prof. Dr. Antonius Schneider) Psychosomatische Aspekte an der Schnittstelle Hausarzt – Spezialist: eine Überweisungsstudie Bernadett Maria Hilbert Vollständiger Abdruck der von der Fakultät für Medizin der Technischen Universität München zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Medizin genehmigten Dissertation. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Ernst J. Rummeny Prüfer der Dissertation: 1. Univ.-Prof. Dr. Antonius Schneider 2. apl. Prof. Dr. Claas Lahmann Die Dissertation wurde am 06.05.2015 bei der Technischen Universität München eingereicht und durch die Fakultät für Medizin am 14.10.2015 angenommen. Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis ......................................................................... V Abbildungsverzeichnis ......................................................................... VI Tabellenverzeichnis ............................................................................. VII 1 EINLEITUNG ...................................................................... 1 1.1 Versorgungssteuerung im deutschen Gesundheitswesen .......... 1 1.1.1 Die Position des Hausarztes in Deutschland ........................ 1 1.1.2 Das deutsche Überweisungssystem ..................................... 3 1.2 Psychische Erkrankungen in der Hausarztpraxis......................... 8 1.2.1 Epidemiologie ....................................................................... 8 1.2.2 Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen ..................... 9 1.3 Entwicklung des Studienkonzepts ............................................... 11 1.3.1 Beschreibung des Vorläuferprojekts – die Erststudie .......... 11 1.3.2 Theoretische Herleitung der Hypothesen ............................ 13 1.4 Zielsetzungen und Hypothesen .................................................... 17 2 MATERIAL UND METHODIK ........................................... 19 2.1 Beschreibung des Studiendesigns .............................................. 19 2.1.1 Das Vorläuferprojekt – die Erststudie .................................. 19 2.1.2 Die Überweisungsstudie ..................................................... 20 2.2 Aufbau des Fragebogens .............................................................. 23 2.2.1 Soziodemographische Fragen ............................................ 23 2.2.2 Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D).................. 23 2.2.3 Autonomie-Präferenz-Index (API) ....................................... 25 2.2.4 Fragebogen zu Körper und Gesundheit (FKG) ................... 26 2.2.5 Fragebogen zur Erhebung von Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit (KKG) ................................... 28 2.3 Angewandte statistische Methoden ............................................. 29 2.3.1 Fallzahlschätzung ............................................................... 29 2.3.2 Statistische Analyse ............................................................ 30 2.3.3 Umgang mit fehlenden Werten ........................................... 31 II 3 ERGEBNISSE ................................................................... 32 3.1 Vergleich von Patienten aus der regulären Sprechstunde mit Patienten, die Überweisungen am Tresen erhalten .................... 32 3.1.1 Beschreibung der Stichprobe .............................................. 32 3.1.2 Psychische Komorbidität ..................................................... 33 3.1.3 Dauerdiagnosen .................................................................. 36 3.1.4 Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen ................... 39 3.1.5 Partizipations- und Informationspräferenz........................... 41 3.1.6 Analyse der Non-Responder ............................................... 42 3.2 Patienten mit sinnvollen Überweisungen im Vergleich zu Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung 44 3.2.1 Beschreibung der Stichprobe .............................................. 44 3.2.2 Psychische Komorbidität ..................................................... 45 3.2.3 Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen ................... 47 3.2.4 Dysfunktionale Kognitionen................................................. 47 3.2.5 Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit ........ 48 3.3 Analyse der Überweisungsvorgänge ........................................... 49 3.3.1 Dokumentation der Überweisungen .................................... 49 3.3.2 Fachgebiete und Anteil nicht sinnvoller Überweisungen ..... 49 3.3.3 Angaben zum Grund der Überweisung ............................... 51 4 DISKUSSION .................................................................... 53 4.1 Diskussion der Methoden ............................................................. 53 4.1.1 Datenerhebung und Auswertung ........................................ 53 4.1.2 Verwendete Fragebögen..................................................... 59 4.2 Diskussion der Ergebnisse ........................................................... 62 4.2.1 Vergleich von Patienten aus der regulären Sprechstunde mit Patienten, die Überweisungen am Tresen erhalten....... 62 4.2.2 Patienten mit sinnvollen Überweisungen im Vergleich zu Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung ....................................................................... 69 4.2.3 Dokumentierte Überweisungsvorgänge .............................. 71 4.3 Schlussfolgerungen und Ausblick ............................................... 75 5 ZUSAMMENFASSUNG .................................................... 77 III 6 ANHANG .......................................................................... 79 6.1 Einverständniserklärung ............................................................... 79 6.2 Patientenfragebogen ..................................................................... 82 6.3 Auszahlung von Probandenentgelt.............................................. 92 7 LITERATURVERZEICHNIS .............................................. 93 8 DANKSAGUNG .............................................................. 105 9 LEBENSLAUF ................................................................ 106 IV Abkürzungsverzeichnis API Autonomie-Präferenz-Index FKG Fragebogen zu Körper und Gesundheit GAD-7 Generalized Anxiety Disorder-7-Fragebogen ICD-10-GM International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Release 10, German modification KKG Fragebogen zur Erhebung von Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit OR Odds Ratio PHQ-D Gesundheitsfragebogen für Patienten TU München Technische Universität München V Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Ablauf von Erststudie und Überweisungsstudie ..................................... 13 Abbildung 2: Rekrutierung von Patienten für die Erststudie und Überweisungsstudie .................................................................................................... 32 Abbildung 3: Prävalenz der nach PHQ-D diagnostizierten psychischen Komorbidität .............................................................................................................. 35 Abbildung 4: Rekrutierung von Patienten mit sinnvollen Überweisungen und von Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung .................................... 44 Abbildung 5: Am Tresen und in der Sprechstunde ausgestellte Überweisungen ........ 49 VI Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Umgang mit fehlenden Werten ................................................................... 31 Tabelle 2: Soziodemographischer Hintergrund ........................................................... 33 Tabelle 3: Summenwerte der PHQ-D-Module Depression, Panik, Andere Angststörungen und Somatoforme Syndrome ............................................................ 34 Tabelle 4: Nach PHQ-D diagnostizierte psychische Störungen (Module Depression, Panik, Andere Angststörungen und Somatoforme Syndrome) ................ 34 Tabelle 5: Anzahl der vom Hausarzt dokumentierten Dauerdiagnosen pro Patient ..... 36 Tabelle 6: Diagnosen................................................................................................... 37 Tabelle 7: Erkrankungsklassen ................................................................................... 38 Tabelle 8: Inanspruchnahmeverhalten während der letzten zwölf Monate .................. 39 Tabelle 9: Prädiktoren für die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen ............. 40 Tabelle 10: Beurteilung der Partizipationspräferenz der Patienten durch den Hausarzt...................................................................................................................... 42 Tabelle 11: Mittelwerte des Autonomie-Präferenz-Index (API) .................................... 42 Tabelle 12: Non-Responder-Analyse der Erststudie und der Überweisungsstudie ..... 43 Tabelle 13: Non-Responder-Analyse der Überweisungsstudie ................................... 43 Tabelle 14: Soziodemographischer Hintergrund und Anzahl der vom Hausarzt dokumentierten Dauerdiagnosen pro Patient .............................................................. 45 Tabelle 15: Summenwerte der PHQ-D-Module Depression, Panik, Andere Angststörungen und Somatoforme Syndrome ............................................................ 46 Tabelle 16: Ängstlichkeits-Schweregrade gemäß dem Generalized Anxiety Disorder-7-Fragebogen (GAD-7) ................................................................................ 46 VII Tabelle 17: Inanspruchnahmeverhalten während der letzten zwölf Monate ................ 47 Tabelle 18: Summenwerte des Fragebogens zu Körper und Gesundheit (FKG) ....... 48 Tabelle 19: Summenwerte des Fragebogens zur Erhebung von Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit (KKG) ..................................... 48 Tabelle 20: Häufigkeit und Sinnhaftigkeit von Tresen-Überweisungen (beurteilt durch die an der Studie mitwirkenden Hausärzte) ...................................................... 50 Tabelle 21: Fachgebiet und Anteil nicht sinnvoller Überweisungen ............................. 51 Tabelle 22: Angaben zum Grund der Überweisung ..................................................... 52 VIII Vorbemerkung: Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter. IX 1 EINLEITUNG 1.1 Versorgungssteuerung im deutschen Gesundheitswesen 1.1.1 Die Position des Hausarztes in Deutschland Die Position des Hausarztes im Gesundheitswesen ist in den verschiedenen Ländern dieser Welt ganz unterschiedlich definiert. Während dem Hausarzt im Primärarztsystem eine bedeutende Funktion bei der Koordination seiner Patienten zukommt, ist er in anderen Staaten nur eine von vielen alternativen Anlaufstellen für Patienten im medizinischen System. In der bis heute grundlegenden Alma-Ata-Deklaration der World Health Organization wurde die Primärversorgung im Jahr 1978 wie folgt definiert: „Primary health care […] is the first level of contact of individuals, the family and community with the national health system bringing health care as close as possible to where people live and work, and constitutes the first element of a continuing health care process.” (World Health Organization 1978, S. 3-4). Ein Primärarztkonzept ist unter anderem in Großbritannien, Finnland oder den Niederlanden umgesetzt worden. In diesem Versorgungsmodell muss der Hausarzt grundsätzlich zuerst konsultiert werden. Dieser prüft dann, ob er selbst für die Behandlung zuständig ist oder ob er den Patienten zu einem anderen Facharzt weiterleitet. In diesem System können Spezialisten nur mit einer Überweisung aufgesucht werden. Folglich sind Hausärzte hier die „Gatekeeper des Medizinwesens“, denn sie steuern den Zugang der Patienten zu den Leistungen im Gesundheitssystem. In Deutschland haben die Patienten hingegen zum aktuellen Zeitpunkt freien Zugang zum Arzt ihrer Wahl. Nur bei gesetzlich Versicherten gilt die Einschränkung, dass ein an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmender Arzt aufgesucht werden muss. Die Einführung des Rechts auf freie Arztwahl war in Deutschland im Jahr 1931 Resultat ärztlicher Proteste gegen deren Abhängigkeit von den Krankenkassen (Kunstmann 2002). Unter Bismarck war 1883 die Krankenversicherung, als erste Leistung aus dem Bereich der Sozialversicherungen, eingeführt worden. Nun waren erstmals Teile der Arbeiterschaft pflichtversichert. Im Erkrankungsfall konnten die Versicherten von der Krankenkasse zugewiesene Ärzte aufsuchen. Diese Kassenärzte waren weitestgehend den Krankenkassen unterstellt, mit denen sie Einzelverträge abschlossen und die ihr Honorar und ihre Arbeitsbedingungen diktierten. 1 Ende des 19. Jahrhunderts stieg die Zahl der praktizierenden Ärzte rasch an. Forderungen nach Kollektivverträgen, freier Arztwahl und dem Einzelleistungsprinzip wurden laut. Um diese besser vertreten zu können, wurde im Jahr 1900 der Leipziger Verband (der spätere Hartmannbund) gegründet. Es folgten 30 Jahre voller Unruhen und Streiks durch die Ärzteschaft. Schließlich übertrug die Regierung im Jahr 1931 die Interessenvertretung der Kassenärzte gegenüber den Krankenkassen einer Körperschaft des öffentliches Rechts: der Kassenärztlichen Vereinigung. Nur zwei Jahre später wurden die regionalen Vereinigungen jedoch im Zuge der Gleichschaltungsgesetze von den Nationalsozialisten aufgelöst und durch die autoritär-zentralistische Organisation Kassenärztliche Vereinigung Deutschlands ersetzt. Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949 wurde auch die Krankenversicherung neu geordnet und die ärztliche Selbstverwaltung wieder aufgebaut (Vogt 1998; Jütte 1997). Der „Kostenexplosion“ und „Ärzteschwemme“ in den 60er und 70er Jahren wurde in der nachfolgenden Zeit eine Vielzahl von Gesundheitsreformen entgegengesetzt. Diese dienten zumeist der Sicherstellung der Finanzierung des Gesundheitssystems. Das 2004 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung befasste sich unter anderem mit der Rolle des Hausarztes in Deutschland. Dieses Gesetz verpflichtete die Krankenkassen, bis spätestens Ende Juni 2009 eine flächendeckende hausarztzentrierte Versorgung anzubieten. Gesetzlich Versicherte können freiwillig an dieser Versorgungsform teilnehmen, indem sie einen Hausarzt wählen, bei dem sie sich für ein Jahr einschreiben. In diesem Hausarztmodell haben die Patienten verschiedene Vorteile. Beispiele sind eine reduzierte Zuzahlung in der Apotheke oder die Möglichkeit bestimmte Sondersprechstunden in der Hausarztpraxis zu besuchen. Im Gegenzug willigen die Teilnehmer ein, bei gesundheitlichen Problemen immer zuerst ihren Hausarzt aufzusuchen. Dieser prüft dann, ob er selbst den Beratungsanlass abklären kann oder ob er den Patienten zu einem anderen Arzt überweisen muss. Ein direktes Aufsuchen von Spezialisten ist in Notfallsituationen und bei der Konsultation von Frauen-, Augen-, Kinder- oder Zahnärzten möglich. Dem Hausarzt kommt in diesem Versorgungsmodell eine zentrale Position in der Behandlung seiner Patienten zu. Er wahrt den Gesamtüberblick über die Krankengeschichte und koordiniert sämtliche Untersuchungs- und Therapieschritte. Die derzeitige Situation der hausarztzentrierten Versorgung gestaltet sich noch unübersichtlich. Während das Modell von einigen Krankenkassen erfolgreich angeboten wird, bereiten andere 2 Kassen die Umsetzung noch vor oder haben laufende Verträge schon wieder gekündigt (Lehr 2010; Korzilius 2012). Die hausarztzentrierte Versorgung engt das Recht auf eine freie Arztwahl ein (Linden 2004). Ob diese Einschränkung auch zu einer effizienteren Verteilung der begrenzten Gesundheitsressourcen führt, wird derzeit kontrovers in Politik, Ärzteschaft und Medien diskutiert. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) tritt für eine Stärkung der Position des Hausarztes im Gesundheitswesen ein. In den 2012 verabschiedeten DEGAM-Zukunftspositionen wird die gewünschte Funktion des Hausarztes wie folgt beschrieben: „Hausärztinnen und Hausärzte stellen eine qualifizierte Grundversorgung sicher und organisieren darüber hinaus die Zusammenarbeit mit Fachspezialisten […]. Sie nehmen eine zentrale Position als verantwortliche Koordinatorinnen und Koordinatoren ein und behalten den Überblick über die Gesamtversorgung des Patienten.“ (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. 2012, S. 9). Andere Parteien sprechen sich jedoch resolut gegen eine Veränderung der Stellung des Hausarztes in Deutschland aus. Der NAV-Virchow-Bund (Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands e.V.) vertrat im Deutschen Ärzteblatt zum Beispiel folgende Meinung: „Ein Primärarztsystem sei durch neue Kooperations- und Versorgungsstrukturen überholt. Es würde den qualifizierten Hausarzt zum Patientenverteiler degradieren, die spezialärztliche Versorgung gefährden und die freie Arztwahl beschneiden.“ (Kloppenborg 1998, S. 36). Es bleibt abzuwarten, welches Lager sich in der Debatte um die Bedeutung des Hausarztes in Deutschland durchsetzt und ob ein Primärarztsystem bei der Planung künftiger Gesundheitsreformen eine Rolle spielen wird. 1.1.2 Das deutsche Überweisungssystem In Deutschland kann ein behandelnder Arzt seine Patienten zu anderen Fachrichtungen überweisen, wenn eine Auftragsleistung, Konsiliaruntersuchung oder Mit- bzw. Weiterbehandlung indiziert ist. Im Sinne der freien Arztwahl darf der überweisende Arzt auf dem Vordruck keinen bestimmten Kollegen vermerken, sondern muss sich auf die Fachrichtung beschränken, an die sich die Überweisung richtet. Im Jahr 2011 wurde der Überweisungsschein überarbeitet. Auf dem neuen Formular können in separaten Feldern Informationen zur gestellten Diagnose bzw. Verdachtsdiagnose, zum 3 erhobenen Befund, zur Medikation und zur geforderten Auftragsleistung vermerkt werden (Kochen 2012). Grundsätzlich sollte ein Hausarzt genau prüfen, ob die Ausstellung einer Überweisung zu einem Kollegen notwendig ist. Im alltäglichen Praxisablauf wird der Arzt aber nicht immer in diese Entscheidungsfindung eingebunden. In einem Teil der Praxen können die Patienten per Email oder Telefon gewünschte Überweisungen anfordern und diese dann in den nächsten Tagen abholen. In anderen Praxen erscheinen die Patienten ohne Termin und warten bis der Hausarzt zwischen seinen Konsultationen Zeit findet, die Überweisungen zu unterschreiben. Insbesondere am Quartalsanfang, wenn Patienten besonders viele Überweisungen anfordern, werden deshalb in einigen Praxen für ein effektiveres Zeitmanagement vom Arzt vorunterschriebene Überweisungen am Tresen der Praxis platziert. Wenn der Patient in der Praxis vorstellig wird, müssen die Mitarbeiter auf dem Überweisungsschein nur noch die Patientendaten und geforderte Fachrichtung eintragen. Bis heute widmeten sich nur wenige Studien der Frage, wie viele Überweisungen von den medizinischen Fachangestellten außerhalb der regulären Sprechstunde ohne direkten Arztkontakt ausgegeben werden (Tresen-Überweisung). Eine Erhebung aus den USA zeigte, dass der Hausarzt insgesamt 86 Prozent der Überweisungsvorgänge veranlasste. Die übrigen Überweisungen wurden von den Praxismitarbeitern erstellt: davon 11 Prozent mit und 3 Prozent ohne ärztliche Beratung (Forrest 2002). Aufgrund der Unterschiede zwischen dem amerikanischen und deutschen Gesundheitssystem lassen sich diese Ergebnisse aber nur mit Einschränkung auf die hiesige Versorgungslandschaft übertragen. Hausärzte unterzeichnen Tresen-Überweisungen mit gewisser Ambivalenz. Einerseits muss der Hausarzt nicht immer für Routine-Überweisungen konsultiert werden, wie zum Beispiel bei der jährlichen Vorstellung des Diabetikers beim Augenarzt. Andererseits erfolgen aber zu viele Überweisungsvorgänge als Routine. Bei genauer Prüfung zeigt sich dann, dass ein Teil der Überweisungen gar nicht indiziert ist, zum Beispiel wenn der Hausarzt selbst die geschilderten Beschwerden abklären oder die geforderte Untersuchung durchführen könnte. Einer effizienten hausärztlichen Lotsenfunktion stehen jedoch zeitliche Gründe entgegen. So ist es für den Hausarzt in der kurzen Kontaktzeit nur schwer möglich, die Notwendigkeit aller angegebenen Überweisungsanlässe zu überprüfen. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn Patienten mehr als eine 4 Überweisung verlangen. Darüber hinaus behalten sich Patienten im Sinne der freien Arztwahl das Recht vor, den gewünschten Spezialisten in Anspruch zu nehmen. Bei Restriktionen, wie sie im Sinne eines funktionierenden "Gatekeeper-Systems" zu erwarten wären, wird jedoch mit einem Arztwechsel gedroht. Ohnehin können Patienten wegen der fehlenden Zugangsbeschränkung bei den meisten Spezialisten auch ohne Überweisung vorstellig werden. Es liegt also letztendlich in der Entscheidung des Patienten, ob Hausärzte als Lotsen wirksam werden können. Die Einführung der Praxisgebühr im Jahr 2004 diente nicht nur der finanziellen Entlastung der Krankenkassen, sondern auch der Stärkung dieser hausärztlichen Lotsenfunktion. Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung mussten gesetzlich Versicherte beim ersten Arzt-, Zahnarztoder Psychotherapeutenbesuch im Quartal eine Gebühr in Höhe von zehn Euro entrichten. Das Aufsuchen weiterer Ärzte stand den Patienten frei, wobei aber nochmals zehn Euro fällig wurden, wenn keine Überweisung durch den zuerst konsultierten Arzt vorgelegt werden konnte. Dieser finanzielle Anreiz sollte Patienten motivieren, zunächst den Hausarzt aufzusuchen, der dann bei begründeter Notwendigkeit Überweisungen zu Spezialisten ausstellte. Konstruktionsfehler der Praxisgebühr bewirkten jedoch, dass der Hausarzt dieser Lotsenfunktion nicht immer nachgehen konnte. Ein Teil der Patienten konsultierte, unter Umgehung des Hausarztes, direkt einen Spezialisten. Dieser stellte dann Überweisungen zu weiteren Fachärzten aus. Da dem Spezialist aber nur im Ausnahmefall die gesamte Krankenakte vorliegt, kann er, im Vergleich zum Hausarzt, die Plausibilität von Überweisungen nur unzureichend beurteilen. Andere Patienten suchten die gewünschten Ärzte weiterhin in der ihnen beliebigen Reihenfolge auf, da für sie entweder das wiederholte Entrichten von zehn Euro keine Barriere darstellte oder sie von der Zahlung der Praxisgebühr befreit waren. Eine Befreiung war für all jene Patienten möglich, die pro Jahr mehr als zwei Prozent ihres Bruttoeinkommens für Zuzahlungen aufwenden mussten. Bei chronisch Kranken galt eine reduzierte Einkommensschwelle von nur einem Prozent, sodass diese Patienten häufig eine Befreiung von der Gebühr erzielten. Insbesondere in diesen Fällen kommt aber der hausärztlichen Steuerung eine große Bedeutung zu. So suchen chronisch kranke Patienten aufgrund der Schwere der Erkrankung, der Notwendigkeit von Kontrolluntersuchungen und der oft bestehenden Multimorbidität viele Spezialisten auf. Wiederholt führen diese Ärzte diagnostische Maßnahmen durch, stellen neue Diagnosen und verändern die Medikati5 on des Patienten. Bei diesen komplexen Krankheitsgeschichten ist ein zentraler Ansprechpartner, bei dem alle Befunde zusammenfließen, von großer Wichtigkeit. Die Praxisgebühr wurde seit der Einführung im Jahr 2004 von den verschiedensten Seiten kritisiert. Die unzureichende Erfüllung der erhofften Steuerungsfunktion stellte dabei nur einen der vielen bemängelten Punkte dar. Der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, brachte in einem Interview seine ablehnende Haltung gegenüber der Praxisgebühr zum Ausdruck: „Die funktioniert nicht, weil gerade diejenigen, die sehr oft zum Arzt gehen, davon befreit sind, und für die anderen hat die Gebühr den Gegenwert von zwei Schachteln Zigaretten.“ (Borstel 2011, ¶ 20). Schlussendlich reagierte die Regierungskoalition im November 2012 auf die anhaltenden Proteste, indem die Abschaffung der Praxisgebühr beschlossen wurde. Während nach der Einführung der Praxisgebühr im Jahr 2004 ein dramatischer Anstieg der Überweisungszahlen beobachtet wurde (Brenner 2005), zeigte sich nach deren Abschaffung ein gegenläufiger Trend. Zum aktuellen Zeitpunkt existieren noch keine belastbaren Zahlen. Schätzungen zufolge wurden aber im hausärztlichen Bereich im ersten Quartal des Jahres 2013 nur etwa halb so viele Überweisungen ausgestellt (Ollenschläger 2013). Erst in den nächsten Jahren werden alle Folgen der Abschaffung der Gebühr ersichtlich werden. Eine schon jetzt spürbare Konsequenz ist der reduzierte Informationsfluss zwischen Hausarzt und Spezialist. Während Spezialisten nun zum Teil ohne die erklärenden Informationen des Überweisungsscheins agieren müssen, erhalten Hausärzte weniger Berichte zu den Facharztbesuchen ihrer Patienten (Medical Tribune 2013). Auswirkungen dessen sind auch für die Forschung zu erwarten. So wird es in Zukunft weitaus schwieriger werden, Studien zu den Patientenströmen zwischen Hausarzt und Spezialist durchzuführen. Ohnehin gestaltet sich die Datenlage zum deutschen Überweisungssystem zum jetzigen Zeitpunkt unzureichend. So war die Thematik bis heute nur selten Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Ein Beispiel ist eine im Jahr 2012 in Deutschland durchgeführte Untersuchung von fast 4000 Überweisungsvorgängen. Ziel der Studie war die Identifikation von verschiedenen Überweisungstypen. Die Clusteranalyse ermittelte folgende drei Gruppen: die Weiterleitung des Patienten aufgrund einer klinischen Fragestellung, wegen einer gemeinsamen Dauerbehandlung oder auf Patientenwunsch. Gemäß dem Urteil der Autoren könnte die Stärkung der hausärztlichen Kompetenzen, wie zum Beispiel im Umgang mit chronisch Kranken, zu einer Redukti6 on der Überweisungsströme führen (Hirsch 2012). In einer anderen deutschen Studie wurde die Zufriedenheit von Patienten nach deren Überweisung zu einem Facharzt untersucht. Das für die Autoren überraschende Ergebnis zeigte eine größere Zufriedenheit, wenn der Hausarzt und nicht der Patient die Überweisung initiiert hatte. Darüber hinaus beurteilten die Spezialisten 91 Prozent der an sie gerichteten Überweisungen als gerechtfertigt (Rosemann 2006). Dieser komplexen Frage der Sinnhaftigkeit von Überweisungen widmeten sich bisher nur äußerst wenige Untersuchungen (Mehrotra 2011). Ein Beispiel ist eine Anfang der 1990er Jahre in Großbritannien durchgeführte Überprüfung des Überweisungsverhaltens der Hausärzte. Hier entsprachen 15,9 Prozent der 308 analysierten Überweisungsvorgänge nicht den Leitlinien und wurden somit als „possibly inappropriate“ eingestuft (Fertig 1993). Die Gesundheitssysteme der einzelnen Länder sind unterschiedlich strukturiert. Ergebnisse der Versorgungsforschung aus anderen Staaten können aus diesem Grund auch nicht ohne Weiteres auf das deutsche Gesundheitswesen übertragen werden. In einer internationalen Vergleichsstudie unterschieden sich zum Beispiel die Überweisungsraten verschiedener europäischer Staaten stark voneinander, obgleich hier nur ähnliche Gesundheitssysteme und ein einziges Erkrankungsbild betrachtet wurden. Unter anderem zeigte der Vergleich der Primärarztsysteme Spaniens und Großbritanniens, dass 45,6 Prozent der spanischen, aber nur 26,6 Prozent der britischen Patienten innerhalb eines Jahres aufgrund ihres Diabetes mellitus vom Hausarzt zum Augenarzt überwiesen wurden (Donker 2004). Auch Anfang der 1990er Jahre wurde die starke Variation der Überweisungszahlen von Hausärzten aus verschiedenen Ländern bestätigt. In Deutschland stellten die Hausärzte durchschnittlich 55,6 Überweisungen in 1000 Konsultationen aus, im Vergleich zu 81,7 bzw. 44,8 Überweisungen in den Primärarztsystemen Norwegens bzw. der Niederlande (Fleming 1993). Die genannten Studienergebnisse verdeutlichen, dass ein Informationsgewinn zum hiesigen Überweisungsgeschehen nur möglich ist, indem Untersuchungen vor Ort in Deutschland durchgeführt werden. Als Beispiel kann die Auswertung aller Überweisungen genannt werden, die im Jahr 2008 mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg abgerechnet wurden. Demnach wurden 56,1 Prozent aller Überweisungen von Spezialisten ausgestellt, während die Hausärzte lediglich 43,9 Prozent der Überweisungsvorgänge veranlassten. Am häufigsten überwiesen die Hausärzte an die internistischen Fachgebiete Kardiologie, Hämato-/Onkologie und Pneumologie, die Spezialisten zur Anästhesie und Radiologie. Pädiater, Kinderpsychiater, Internisten 7 ohne Schwerpunkt und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen behandelten den größten Anteil derjenigen Patienten, die sich ohne Überweisung direkt beim Facharzt vorstellten. Die Autoren des Artikels empfehlen die Durchführung weiterer Studien, um eine detaillierte Aufschlüsselung der Überweisungsströme vornehmen zu können (Gröber-Grätz 2011). Die Überweisungsströme zwischen Hausarzt und Spezialist wurden in Deutschland bisher nur selten in wissenschaftlicher Forschung thematisiert. Die vorliegende Untersuchung möchte einen Beitrag zur besseren Charakterisierung des deutschen Überweisungswesens leisten. Schwerpunkte der Arbeit sind die Analyse der Sinnhaftigkeit von Überweisungen und die Beschreibung der Gründe für das Überweisen eines Patienten zum Facharzt. Die vorliegende Studie bearbeitet darüber hinaus aber noch ein zweites bedeutendes hausärztliches Themengebiet. Dieses soll im Folgenden vorgestellt werden. 1.2 Psychische Erkrankungen in der Hausarztpraxis 1.2.1 Epidemiologie Rund ein Drittel der europäischen Bevölkerung leidet im Laufe eines Jahres an einer psychischen Störung. Angststörungen, Depressionen und somatoforme Störungen stellen dabei, neben Suchterkrankungen und Schlafstörungen, die am weitverbreitetsten Erkrankungen dar (Wittchen 2011). Im Rahmen der „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ wurde in den Jahren 2008 bis 2011 der psychische Zustand einer gesamtdeutschen, repräsentativen und zufällig ausgewählten Stichprobe evaluiert. Das Modul „Psychische Gesundheit“ untersuchte insgesamt 5318 Erwachsene mittels Screening-Fragen (Composite International Diagnostic-Screener) und gegebenenfalls vertieftem psychiatrischem Interview (Composite International Diagnostic Interview). Auf diese Weise wurde bei 15,3 Prozent der Befragten eine Angststörung, bei 7,7 Prozent eine Depression und bei 3,5 Prozent eine somatoforme Störung festgestellt (Jacobi 2014). Der erste Ansprechpartner für Patienten mit psychischen Störungen ist im Allgemeinen der Hausarzt, dem eine zentrale Position bei der Detektion, Prävention und Behandlungsplanung dieser Erkrankungsbilder zukommt. Es ist demnach anzunehmen, dass sich im Patientengut der Hausarztpraxis noch mehr psychisch Kranke finden als 8 in der Gesamtbevölkerung. Verschiedene Studien bestätigen diese Vermutung. Ein Beispiel ist eine im Jahr 2009 veröffentlichte Untersuchung einer weitgehend unselektierten Stichprobe von 1751 Patienten aus 32 Hausarztpraxen in Baden-Württemberg. Das Screening mittels Whiteley-7-Index und zwei Modulen des Gesundheitsfragebogens für Patienten (PHQ-D) ergab, dass 9,8 Prozent der Studienteilnehmer die Kriterien für eine Angststörung, 10,7 Prozent für eine Depression und 27,0 Prozent für eine somatoforme Störung erfüllten. Ein Anteil von 9,7 Prozent der Patienten litt an einer Kombination der genannten Erkrankungen (Hanel 2009). Zahlen ähnlicher Größenordnung ergab auch die Untersuchung von 394 Patienten aus 18 allgemeinärztlichen Praxen im Raum Nürnberg. Psychische Störungen wurden hier mittels der ScreeningInstrumente WBI-5 (World Health Organization-Five Well-Being Index) sowie GHQ-12 (General Health Questionnaire-12) erfasst. Darüber hinaus erfolgte bei jedem Studienteilnehmer ein CIDI (Composite International Diagnostic Interview). Von den Befragten litten 15,8 Prozent an Angststörungen, 22,9 Prozent an Depressionen und 26,6 Prozent an somatoformen Störungen. Eine Kombination dieser Erkrankungen war hier bei insgesamt 17,3 Prozent der Studienteilnehmer vorhanden (Mergl 2007). Ärzte und Medien gehen sogar soweit, psychische Erkrankungen als neue „Volkskrankheit“ (Hibbeler 2011, S. 442) oder „Epidemie des 21. Jahrhunderts“ (Weber 2006, S. 169) zu bezeichnen. Unbestreitbar können psychisch kranke Patienten den Hausarzt vor eine Herausforderung stellen. Erkrankte werden häufiger als „schwierig“ erlebt und können sogar Abneigung beim behandelnden Arzt provozieren (Hahn 1994). Darüber hinaus nehmen Konsultationen, bei denen psychische Probleme als Hauptbefund oder im Hintergrund eine Rolle spielen, einen unverhältnismäßig großen Anteil der Arbeitszeit eines Hausarztes ein (Zantinge 2005). Verstärkend wirkt sich aus, dass Erkrankte die hausärztliche Praxis überproportional häufig aufsuchen. Auch andere Gesundheitsleistungen werden von diesem Patientenkollektiv vermehrt in Anspruch genommen (Jacobi 2004) – eine Thematik, die im Folgenden näher beleuchtet wird. 1.2.2 Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen Psychische Erkrankungen sind mit der verstärkten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen assoziiert. Patienten mit aktueller psychischer Störung sind über eine längere Zeit im Jahr krankgeschrieben. Sie suchen häufiger Hausärzte und Spezialis- 9 ten auf, werden öfter hospitalisiert und nehmen mehr Notdienstleistungen in Anspruch. Folglich verursachen sie höhere Kosten im medizinischen System als psychisch gesunde Patienten (Jacobi 2004; Barsky 2006; Schneider 2011). Die Fehlallokation der begrenzten Ressourcen des Gesundheitssystems ist aber nur eine Folge der übermäßigen Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Da wiederholte diagnostische und therapeutische Maßnahmen mit Risiken behaftet sind, stellt dieses Verhalten auch eine Gefahr für den Patienten selbst dar. Jede weitere Röntgenaufnahme verursacht eine Strahlenbelastung, jedes zusätzliche Medikament birgt ein Risiko für Nebenwirkungen und jede einzelne Biopsie kann zu Blutungen oder Verletzungen von Organstrukturen führen. Zu ihrem Schutz sollten Patienten mit einem unverhältnismäßigen Inanspruchnahmeverhalten folglich frühzeitig identifiziert werden (Fink 1992; Kouyanou 1997). Diese „high utilizer“ leiden im Umkehrschluss auch häufiger an psychischen Erkrankungen als das Vergleichskollektiv der „mid-range utilizer“ (Ford 2004; den Boer-Wolters 2010; Schmitz 2002). Patienten, die in dieser Hinsicht auffällig werden, müssen die Aufmerksamkeit des Hausarztes wecken. Während der folgenden Konsultationen sollte der Arzt überprüfen, ob beim Patienten weitere Hinweise für eine psychische Störung bestehen. Damit die Einordnung des Inanspruchnahmeverhaltens der einzelnen Patienten gelingt, müssen die betreffenden Durchschnittswerte in Studien ermittelt werden. Untersuchungsergebnisse aus anderen Ländern können dabei nicht ohne Weiteres auf die deutsche Versorgungslandschaft übertragen werden. Bereits Kapitel 1.1.1 verdeutlichte, wie stark zum Beispiel die Funktion des Hausarztes in den verschiedenen medizinischen Systemen variiert. In diesem Zusammenhang ergibt auch der Vergleich hausärztlicher Praxiskontaktraten große Unterschiede. Während die primärärztliche Praxis in den USA durchschnittlich 3,7 Mal pro Jahr aufgesucht wird (Barsky 2005), zeigten Studien aus Deutschland deutlich höhere Kontaktzahlen auf. Gemäß der Publikationsreihe „Gesundheitswesen aktuell“ der Barmer GEK aus dem Jahr 2010 wurden gesetzlich Versicherte innerhalb eines Jahres durchschnittlich zehn Mal beim Hausarzt vorstellig (Maydell 2010). Die Schlussfolgerung, dass deutsche Patienten mehr Zeit beim Hausarzt verbringen, kann aber nicht ohne Weiteres gezogen werden. Während ein Hausarzt-Patienten-Kontakt in den USA im Mittel 22,5 Minuten dauert, wurde für Deutschland ein Durchschnittswert von lediglich 9,1 Minuten ermittelt (Koch 2011). Die aufgezeigten Beispiele verdeutlichen, aus welchem Grund Untersuchungsergebnisse 10 zum Inanspruchnahmeverhalten möglichst durch deutsche Studien bestätigt werden sollten. Ein Beispiel ist eine im Raum München durchgeführte Erhebung des Inanspruchnahmeverhaltens eines hausärztlichen Patientenkollektivs. Psychische Dauerdiagnosen waren hier mit einer größeren Zahl von Überweisungen (Odds Ratio – OR 3,6), Arbeitsunfähigkeitstagen (OR 5,0) und Kontakten zur Hausarztpraxis (OR 20,0) assoziiert (Schneider 2011). Die dieser Publikation zugrunde liegende Erhebung (Erststudie) stellt die Vorläuferuntersuchung der vorliegenden Arbeit (Überweisungsstudie) dar. Im Folgenden werden die Überlegungen aufgezeigt, die nach dem Abschluss dieser Erststudie dazu führten, dass die Durchführung einer weiteren projektbezogenen Untersuchung für notwendig erachtet wurde. 1.3 Entwicklung des Studienkonzepts 1.3.1 Beschreibung des Vorläuferprojekts – die Erststudie Im Jahr 2010 führte das Institut für Allgemeinmedizin der Technischen Universität München (TU München) eine Querschnittbefragung eines weitgehend unselektierten Patientenkollektivs der Hausarztpraxis durch. Diese Erststudie verfolgte drei Hauptanliegen. Zum einen sollte die Prävalenz von somatoformen Störungen, Depressionen und Angststörungen im allgemeinärztlichen Patientengut festgestellt werden. Des Weiteren erfasste die Untersuchung die Partizipationspräferenz und das Informationsbedürfnis von Patienten mit den genannten Erkrankungen, im Vergleich zu anderen in dieser Hinsicht gesunden Patienten. Und drittens sollte der Einfluss psychischer Komorbidität auf die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen analysiert werden. Diese Erhebung wurde unter Anleitung von Prof. Antonius Schneider von den Doktorandinnen Elisabeth Angela Hörlein und Eva Maria Wartner durchgeführt. Diese Erststudie untersuchte insgesamt 1011 Patienten. 985 dieser Patienten besuchten die reguläre Sprechstunde, während lediglich 26 Patienten mit Tresen-Überweisungen rekrutiert werden konnten. Bisher war die Frage, wie viele Überweisungen in Deutschland außerhalb der Sprechstunde ausgegeben werden, nur selten Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Gemäß der Einschätzung von vor Studienbeginn befragten Hausärzten ist die Ausstellung von Tresen-Überweisungen jedoch ein häufiges Ereignis im Praxisalltag. Demnach liegt die Vermutung nahe, dass Patienten mit 11 Tresen-Überweisungen weitaus seltener zur Teilnahme an der Erststudie bereit waren als Patienten der regulären Sprechstunde. Die Erklärung für diese fehlende Bereitschaft findet sich bei Betrachtung des Rekrutierungsprozesses. Alle Patienten mussten für die Teilnahme an der Studie einen Fragebogen ausfüllen. Dies nahm etwa 15 Minuten Zeit in Anspruch. Für die Patienten mit einem Sprechstundentermin stellte dies kein großes Hindernis dar. Sie konnten den Fragebogen meist schon während der Wartezeit auf den Arzttermin beantworten. Patienten mit Tresen-Überweisungen suchen die Praxis hingegen mit der Erwartung auf, dort nur wenige Minuten zu verbringen. So gehört das Ausstellen von Überweisungen zu den Routineaufgaben der Praxismitarbeiter: das Formular wird bedruckt, der Arzt unterschreibt und nach kurzer Zeit kann der Patient die Praxis wieder verlassen. Zudem besteht in einem Teil der Praxen die Möglichkeit der Vorbestellung von Überweisungen per Email oder Telefon oder vom Arzt vorunterschriebene Überweisungen werden am Tresen der Praxis platziert. In diesen Fällen verkürzt sich das Prozedere für den Patienten noch weiter. Somit wird verständlich, warum die Stichprobe nur eine geringe Zahl von Patienten mit Tresen-Überweisungen enthielt. Diese konnten nur selten überzeugt werden, länger als geplant in der Praxis zu bleiben, um für eine Studie einen Fragebogen auszufüllen. Trotz dieser beschriebenen Rekrutierungshindernisse sollte die Erststudie eigentlich auch Patienten mit Tresen-Überweisungen untersuchen. Befragte Hausärzte hatten vor Erhebungsbeginn den Verdacht geäußert, dass vor allem Patienten mit erhöhter psychischer Komorbidität besonders viele Überweisungen außerhalb der Sprechstunde einfordern. Weil in Deutschland bisher keine systematischen Untersuchungen zu dieser Thematik existieren, konnte dieser Verdacht weder untermauert noch widerlegt werden. Die Stichprobe der Erststudie enthielt jedoch nur eine sehr geringe Zahl von Patienten mit Tresen-Überweisungen, deren psychische Komorbidität dennoch ausgewertet wurde. Der Vergleich mit dem Kollektiv aus der regulären Sprechstunde zeigte eine im Durchschnitt höhere Somatisierungsneigung dieser Patientengruppe. Dieses Ergebnis gab den Ausschlag zur Durchführung eines Folgeprojekts, in das ausschließlich Patienten mit Tresen-Überweisungen eingeschlossen werden sollten. In der Auswertung dieser Überweisungsstudie diente das in der Erststudie rekrutierte Kollektiv der regulären Sprechstunde als hausärztliches Vergleichskollektiv. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in der vorliegenden Arbeit vorgestellt. Abbildung 1 12 verschafft einen Überblick über die Durchführung der Erststudie und der nachfolgenden Überweisungsstudie. Im Jahr 2010 Im Jahr 2011 Erststudie Überweisungsstudie Befragung eines weitgehend unselektierten Patientenkollektivs Befragung von Patienten mit Tresen-Überweisungen 1011 Patienten rekrutiert Vergleich der zwei Kollektive: 26 Patienten mit TresenÜberweisungen 985 Patienten aus der Sprechstunde Patienten aus der Sprechstunde Rekrutiert in Inanspruchnahmestudie Verdacht: Patienten mit TresenÜberweisungen haben im Vergleich höhere psychische Komorbidität Patienten mit TresenÜberweisungen Rekrutiert in Überweisungsstudie Vorstellung der Ergebnisse in der vorliegenden Arbeit Abbildung 1: Ablauf von Erststudie und Überweisungsstudie 1.3.2 Theoretische Herleitung der Hypothesen Verschiedene Studien konnten den Zusammenhang zwischen psychischen Störungen und einer erhöhten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen herstellen. Patienten, die Tresen-Überweisungen einfordern, könnten demnach eine höhere psychische Komorbidität aufweisen als Patienten der regulären Sprechstunde. Mithilfe der entsprechenden Module des Gesundheitsfragebogens für Patienten wurde in der vorliegenden Erhebung überprüft, ob beim Studienteilnehmer eine somatoforme Störung, Depression, Angst- oder Panikstörung besteht (Details siehe Kapitel 2.2.2). Zur Quantifizierung des Inanspruchnahmeverhaltens dienten die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage, Überweisungen und Praxiskontakte der vergangenen zwölf Monate. Darüber hinaus beeinflusst aber auch die somatische Morbidität das Inanspruchnahmeverhalten der Patienten. In der Erststudie übten körperliche Erkrankungen auf die jährliche Überweisungszahl sogar einen noch größeren Einfluss aus als bestehende psychische Störungen (Schneider 2011). Womöglich ist die somatische Morbidität von 13 Patienten mit Tresen-Überweisungen demnach stärker ausgeprägt als von Patienten aus der regulären Sprechstunde. Zur Erfassung dieses Zusammenhangs wurden die Dauerdiagnosen der Patienten dokumentiert. Dauerdiagnosen sind mindestens schon ein Quartal lang diagnostizierte Erkrankungen, für die der Arzt auch im aktuellen Quartal diagnostische oder therapeutische Maßnahmen zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse erbringt. Sie dienen dem Arzt als Gedächtnisstütze, müssen von ihm aber auch aus abrechnungstechnischen Gründen vermerkt und nach der ICD-10-GM (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Release 10, German modification) verschlüsselt werden. Das Kürzel I10.00 übersetzt sich beispielsweise als benigne essentielle Hypertonie ohne Angabe einer hypertensiven Krise (Graubner 2012). Patienten fordern Überweisungen außerhalb der Sprechstunde an, wenn sie zu der Auffassung gelangt sind, dass ihre Vorstellung bei einem anderen Facharzt vonnöten ist. Vermutlich hat das Patientenkollektiv mit Tresen-Überweisungen demnach ein hohes Bedürfnis, an medizinischen Entscheidungen beteiligt zu werden. Um diese Hypothese zu überprüfen, wurde das Partizipations- und Informationsbedürfnis der Patienten mithilfe des Autonomie-Präferenz-Index bestimmt (Details siehe Kapitel 2.2.3). Darüber hinaus wurden auch die an der vorliegenden Studie beteiligten Hausärzte um Beurteilung der Partizipationspräferenz ihrer Patienten gebeten. Mit Partizipationspräferenz wird der vom Patienten bevorzugte Interaktionsstil in der Patient-ArztBeziehung bezeichnet. Im paternalistischen Modell wird dem Patienten eine passive, abhängige Rolle zugewiesen, während der Arzt die Anordnungen trifft, von denen der Patient seiner Meinung nach am besten profitiert. Im Gegensatz dazu ist der ärztliche Aufgabenbereich im autonomen Interaktionsstil (informed decision-making model) auf die genaue Aufklärung des Patienten beschränkt. Nachdem der Patient alle benötigten Informationen erhalten hat, entscheidet er eigenständig über anstehende medizinische Maßnahmen. Das partnerschaftliche Modell (shared decision-making, partizipative Entscheidungsfindung) bietet einen Mittelweg zwischen paternalistischer und autonomer Vorgehensweise. Arzt und Patient partizipieren gleichermaßen im Entscheidungsprozess, nachdem ein wechselseitiger Informationsaustausch stattgefunden hat (Charles 1997). Laut dem Meinungsbild vor Studienbeginn befragter Hausärzte bestehe bei Patienten mit Tresen-Überweisungen überwiegend eine partnerschaftliche oder sogar autonome Partizipationspräferenz. Eine paternalistische Vorgehensweise sei bei diesen Patienten hingegen nur selten geeignet. 14 Ein weiteres zentrales Thema der Studie ist die Sinnhaftigkeit von Überweisungen. In der vorliegenden Erhebung wurden die beteiligten Hausärzte um Einschätzung jedes dokumentierten Überweisungsvorgangs gebeten. Dies ermöglichte die Zuteilung der Patienten zu zwei Gruppen, je nachdem ob diese am Erhebungstag sinnvolle oder mindestens eine nicht sinnvolle Überweisung erhalten hatten. Der Vergleich dieser beiden Kollektive soll offen legen, ob bestimmte Patientencharakteristika mit der Einforderung von nicht unbedingt erforderlichen Überweisungen einhergehen. Des Weiteren konnte auf diese Weise überprüft werden, ob sich nicht sinnvolle Überweisungen tendenziell an andere Fachdisziplinen richten als sinnvolle Überweisungen und ob Tresen-Überweisungen öfter nicht sinnvoll sind als in der Sprechstunde ausgestellte Überweisungen. Viele Patienten mit somatoformen Störungen sind der Überzeugung, ihre Symptomatik werde durch eine körperliche Erkrankung verursacht (Barsky 1999). Im Krankheitsverlauf werden die von den Patienten geschilderten Beschwerden immer wieder diagnostisch abgeklärt (Barsky 2006). Einerseits fordern die Patienten selbst diese Maßnahmen ein. Andererseits fühlen sich aber auch die Ärzte zur wiederholten Abklärung gezwungen, da sie sich durch die wortreich vorgetragene, schwer erklärbare Symptomatik unter Druck gesetzt fühlen (Ring 2004). Es liegt demnach die Vermutung nahe, dass das Kollektiv mit nicht sinnvollen Überweisungen mehr Patienten mit psychischen Erkrankungen enthält und Gesundheitsleistungen stärker in Anspruch nimmt als die Vergleichsgruppe mit sinnvollen Überweisungen. Zur Überprüfung dieser Hypothesen wurde die psychische Komorbidität durch den PHQ-D und das Inanspruchnahmeverhalten mithilfe der Parameter Überweisungszahl, Arbeitsunfähigkeitsdauer und Praxiskontaktrate erfasst. Zur Beantwortung der Frage, aus welchem Grund Patienten somatoforme Körperbeschwerden entwickeln, wurden verschiedene ätiopathogenetische Modelle entwickelt. Demnach sollen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von somatoformen Störungen mehrere Faktoren in komplexer Weise zusammenwirken. Eine bedeutende Rolle scheinen dabei dysfunktionale Kognitionen zu spielen. Dazu gehört die Neigung körperliche Empfindungen in unangenehmer Weise wahrzunehmen und diese anschließend katastrophisierend zu bewerten. Zur Erfassung dieser spezifischen Gedankenmuster entwickelten Rief et al. Ende der 1990er Jahre den Fragebogen zu Körper und Gesundheit (Details siehe Kapitel 2.2.4) (Rief 1998). Dieser diente in der vorliegenden 15 Erhebung der Überprüfung der Hypothese, dass Patienten mit nicht sinnvollen Überweisungen vermehrt dysfunktionale Kognitionsmuster aufweisen. Entgegen der Einschätzung des Hausarztes sind Patienten mit nicht sinnvollen Überweisungen überzeugt, dass ihre Vorstellung bei einem anderen Facharzt vonnöten ist. Vermutlich verfolgt dieses Kollektiv zum Erhalt der eigenen Gesundheit andere Strategien als die Patientengruppe mit sinnvollen Überweisungen. Die gesundheitspsychologische Forschung beschäftigt sich schon lange mit der Frage, warum sich einige Menschen gesundheitsbewusst verhalten, während sich andere durch Rauchen, Inaktivität, hyperkalorische Ernährung oder dem exzessiven Konsum von Alkohol selbst Schaden zufügen. Im Laufe der Zeit konnten verschiedene Faktoren identifiziert werden, die eine Rolle bei der Entwicklung des individuellen Gesundheitsverhaltens spielen. Besonders bedeutsam scheint hierbei zu sein, ob die jeweilige Person das Gefühl hat selbst Einfluss auf den eigenen Gesundheitszustand nehmen zu können. Basierend auf dieser Erkenntnis wurden mehrere Erklärungsmodelle konstruiert. Ein Beispiel ist das in den 1960er Jahren von Julian Rotter entwickelte Konzept. Er teilte die Menschen in zwei Gruppen ein, je nachdem ob diese glaubten, das Auftreten von Lebensereignissen kontrollieren zu können. Personen mit internaler Kontrollüberzeugung (internal locus of control) erleben Veränderungen als Konsequenz ihres eigenen Verhaltens. Besteht dagegen externale Kontrollüberzeugung (external locus of control) scheint die Person, keinen Einfluss auf die Geschehnisse im eigenen Leben nehmen zu können (Rotter 1966). Mit dem Ziel das Ausmaß dieser Vorstellungen zu quantifizieren, entwickelte Rotter einen Fragebogen, der unter anderem durch Hanna Levenson weiterentwickelt wurde. Sie ersetzte das zwei- durch ein dreidimensionales Konzept, indem sie die externale Kontrollüberzeugung weiter unterteilte. Demnach besteht fatalistische Externalität (chance locus of control), wenn dem Zufall oder dem Schicksal die Kontrolle zugeschrieben wird, und soziale Externalität (powerful others locus of control), wenn es so scheint, als würden andere Menschen das eigene Leben lenken (Levenson 1974). Diese drei Dimensionen waren wiederum Ausgangspunkt für weiterführende Forschung und finden sich auch in dem von Lohaus et al. entwickelten Fragebogen zur Erhebung von Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit wieder (Lohaus 1989). Dieser Fragebogen wurde in der vorliegenden Erhebung verwendet, um die Hypothese zu überprüfen, dass Patienten mit nicht sinnvollen Überweisungen hohe externale Kontrollüberzeugungen besitzen. So erhoffen sich diese 16 Patienten, entgegen der Beurteilung des behandelnden Hausarztes, medizinische Hilfe von anderen Fachärzten und somit von einer externen Wissensquelle. Auf dem Überweisungsschein können Angaben zur gestellten Diagnose bzw. Verdachtsdiagnose, zum erhobenen Befund, zur Medikation und zur geforderten Auftragsleistung vermerkt werden. Auf diese Weise sollte der Hausarzt dem fachärztlichen Kollegen wichtige Informationen übermitteln, sodass eine effektive und sichere Behandlung des Patienten gewährleistet wird. Dennoch weisen nicht alle Überweisungen einen ausreichenden Informationsgehalt auf. Die Autoren einer Studie aus den Vereinigten Staaten gehen sogar so weit, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die Kommunikation zwischen Hausärzten und Spezialisten mittlerweile zusammengebrochen sei (Gandhi 2000). Auch in einer in Deutschland durchgeführten Untersuchung erhielten die Ärzte auf lediglich 61 Prozent der Überweisungen angemessene Angaben zur Krankengeschichte des Patienten (Rosemann 2006). Tresen-Überweisungen werden von Praxismitarbeitern erstellt, ohne dass der Arzt immer in diesen Entscheidungsprozess eingebunden wird. Vermutlich weist demnach ein großer Teil diese Überweisungen einen nur unzureichenden Informationsgehalt auf. Um diese Hypothese zu überprüfen, wurden die auf der Überweisung vermerkten Angaben zum Grund der Überweisung dokumentiert. 1.4 Zielsetzungen und Hypothesen Die Ziele der vorliegenden Studie wurden ausführlich im vorangegangenen Kapitel 1.3.2 diskutiert. An dieser Stelle folgt eine übersichtliche Zusammenstellung aller untersuchten Hypothesen. Fragenkomplex 1) Bei Patienten mit Tresen-Überweisungen besteht im Vergleich zu Patienten aus der regulären Sprechstunde: höhere psychische und somatische Komorbidität verstärkte Inanspruchnahme der Leistungen des Gesundheitssystems (höhere Zahl an Arbeitsunfähigkeitstagen, Überweisungen und Praxiskontakten) höhere Informations- und Partizipationspräferenz 17 Fragenkomplex 2) Bei Patienten mit mindestens einer nicht-sinnvollen Überweisung besteht im Vergleich zu Patienten mit sinnvollen Überweisungen: höhere psychische Komorbidität verstärkte Inanspruchnahme der Leistungen des Gesundheitssystems (höhere Zahl an Arbeitsunfähigkeitstagen, Überweisungen und Praxiskontakten) dysfunktionale Kognitionen zu Körper und Gesundheit niedrigere internale und höhere externale Kontrollüberzeugung zu Krankheit und Gesundheit Fragenkomplex 3) Die in der Studie dokumentierten Überweisungsvorgänge: sind bei Patienten mit Tresen-Überweisungen häufiger nicht sinnvoll als bei Patienten aus der regulären Sprechstunde richten sich bei Patienten mit Tresen-Überweisungen an andere Fachdisziplinen als bei Patienten aus der regulären Sprechstunde enthalten regelmäßig nur unzureichende Angaben zum Grund der Überweisung, wenn sie durch Patienten am Tresen in Anspruch genommen werden 18 2 MATERIAL UND METHODIK 2.1 Beschreibung des Studiendesigns 2.1.1 Das Vorläuferprojekt – die Erststudie Die Erststudie wurde von der Ethikkommission der Fakultät für Medizin der TU München genehmigt und im Zeitraum von April bis August 2010 realisiert. Die Untersuchung war als Querschnittserhebung angelegt, mit dem Ziel über 1000 Patienten zu befragen. Die Doktorandinnen Elisabeth Angela Hörlein und Eva Maria Wartner rekrutierten die Patienten in München, Augsburg und dem bayerischem Umland in 13 allgemeinärztlichen Lehrpraxen der TU München. Die Erststudie lieferte die Idee zur Durchführung der hier vorgestellten Überweisungsstudie. Darüber hinaus diente die dort rekrutierte Stichprobe in der vorliegenden Arbeit als hausärztliches Vergleichskollektiv. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle das Studiendesign der Erststudie vorgestellt. Weitere Details zum Entwicklungsprozess der zwei Erhebungen können dem Kapitel 1.3 entnommen werden. Die Doktoranden rekrutierten die Patienten vor Ort in den Hausarztpraxen. Sie sprachen geeignete Patienten an, informierten diese über die Durchführung der Studie und überprüften die folgenden Einschlusskriterien: Alter: mindestens 18 Jahre Ausreichende Deutschkenntnisse für die Beantwortung des Fragebogens Aufsuchen der Praxis am Erhebungstag, um die Sprechstunde des Hausarztes zu besuchen oder um eine Überweisung abzuholen Patienten, die diese Kriterien erfüllten, wurden gebeten eine Einverständniserklärung zu unterschreiben und den Fragebogen zu beantworten. Diejenigen, die daraufhin die Studienteilnahme verweigerten, wurden um Angabe von Alter und Geschlecht gebeten und der Gruppe der Non-Responder zugeordnet. Patienten, die hingegen die Einverständniserklärung und den Fragebogen ausfüllten, wurden in die Untersuchung aufgenommen. Von diesen Patienten wurden dann folgende Daten aus den elektronischen Behandlungsunterlagen erhoben: 19 Alter und Geschlecht Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage, Überweisungen und Kontakte zur Hausarztpraxis während der vorausgegangenen zwölf Monate Dokumentation, ob eine Überweisung ausgestellt wurde und Fachgebiet, an welches sich diese richtete Anzahl und Art der vom Hausarzt dokumentierten Dauerdiagnosen (Definition siehe Kapitel 1.3.2, Seite 14) Um die Auswertung der großen Zahl an einzelnen Dauerdiagnosen zu ermöglichen, wurden diese zu 27 Diagnosen, wie zum Beispiel maligner Erkrankung oder schwerer Herzerkrankung, zugeordnet. Des Weiteren wurde der Hausarzt des jeweiligen Studienteilnehmers gebeten, zwei Fragestellungen zu beantworten. Hierbei war es dem Arzt erlaubt die elektronischen Patientenakten zu Rate zu ziehen, in denen unter anderem die Dauerdiagnosen und das Überweisungsverhalten des Patienten in der Vergangenheit aufgezeichnet sind. Einstufung der Überweisungen: sinnvoll oder nicht sinnvoll Einschätzung der Partizipationspräferenz des Patienten: autonom, partnerschaftlich oder paternalistisch (Definitionen siehe Kapitel 1.3.2, Seite 14) 2.1.2 Die Überweisungsstudie Die Genehmigung zur Durchführung der vorliegenden Überweisungsstudie wurde am 11.01.2011 von der Ethikkommission der Fakultät für Medizin der TU München erteilt. Die Rekrutierung der Patienten mit Tresen-Überweisungen erfolgte im Zeitraum von März bis Dezember 2011 in München, Augsburg und bayerischen Umland in zwölf hausärztlichen Lehrpraxen der TU München. Bevor Patienten für die vorliegende Untersuchung rekrutiert wurden, sollten die beteiligten Hausärzte folgende zwei allgemeine Fragestellungen beurteilen (Antworten jeweils in Prozent): „Was schätzen Sie, wie viele der Überweisungen im Quartal werden außerhalb der regulären Sprechstunde am Tresen der Praxis ausgestellt (sogenannte Tresen-Überweisung)?“ 20 „Was denken Sie, wie viel Prozent dieser Tresen-Überweisungen sind als nicht sinnvoll einzustufen?“ Anschließend folgte die Rekrutierungsphase in den Hausarztpraxen. Da sich die Rekrutierung von Patienten mit Tresen-Überweisungen in der vorausgegangenen Erststudie problematisch gestaltete, musste für die vorliegende Erhebung ein abweichendes Konzept entwickelt werden. Um die Vergleichbarkeit der beiden Untersuchungen zu gewährleisten, mussten aber gleichzeitig Unterschiede im Studienablauf möglichst gering gehalten werden. In beiden Erhebungen erfolgte die Rekrutierung vor Ort in den Hausarztpraxen, indem geeignete Patienten durch die Doktoranden angesprochen wurden. Die Rekrutierungsorte waren dabei nahezu identisch. Nur eine der 13 hausärztlichen Praxen der Erststudie konnte nicht an der nachfolgenden Überweisungsstudie teilnehmen. In dieser einen Praxis war keine vollständige Datenerhebung möglich, da noch per Karteikarte und nicht in der heute üblichen elektronischen Form dokumentiert wurde. Die Fragebögen der Erststudie und der Überweisungsstudie enthielten jeweils den API und die PHQ-D-Module Depression, Panik, Andere Angststörungen und Somatoforme Syndrome. Des Weiteren wurden in beiden Untersuchungen soziodemographische Daten abgefragt. GAD-7, FKG und KKG wurden nur in der vorliegenden Überweisungsstudie eingesetzt (gesamter Fragebogen siehe Anhang). Angaben zu den Parametern, die hingegen nur in der Erststudie erhoben wurden, können den Dissertationen von Elisabeth Angela Hörlein und Eva Maria Wartner und den zugehörigen Publikationen entnommen werden (Hörlein 2013; Wartner 2013; Schneider 2011; Hamann 2012; Schneider 2013). Während die Patienten der Erststudie den Fragebogen direkt vor Ort in der Hausarztpraxis beantworteten, wurde in der nachfolgenden Überweisungsstudie ein anderes Konzept verfolgt. Hier erhielten Patienten, die Tresen-Überweisungen erhielten, ein vorfrankiertes Kuvert mit dem Fragebogen und der Einverständniserklärung, sodass diese nicht länger als geplant in der Praxis bleiben mussten. Stattdessen konnten sie die Studienmaterialien zu Hause ausfüllen und dann dem Institut per Post zukommen lassen. Um die Rücklaufquote zu erhöhen, wurde bei Eintreffen der Dokumente eine Aufwandsentschädigung in Höhe von zehn Euro gezahlt. Im Vergleich dazu konnte bei der Erststudie auf die Zahlung eines Probandenentgelts verzichtet werden, da auch 21 ohne finanziellen Anreiz eine ausreichende Zahl von Patienten rekrutiert werden konnte. Wie auch bei der Erststudie war die Patientenrekrutierung Aufgabe eines Doktoranden. Für die Überweisungsstudie wurden folgende Einschlusskriterien festgelegt: Alter: mindestens 18 Jahre Ausreichende Deutschkenntnisse für die Beantwortung des Fragebogens Abholung mindestens einer Tresen-Überweisung am Erhebungstag Kein Besuch der hausärztlichen Sprechstunde am Erhebungstag Patienten, die diese Kriterien erfüllten, wurden umfassend über die Erhebung informiert. Diejenigen, die bereit waren an der Studie teilzunehmen, erhielten die Studienmaterialien im vorfrankierten Kuvert. Ein Teil der Patienten lehnte von Vorherein ab, an der Studie teilzunehmen, und weitere Patienten sendeten den ausgehändigten Fragebogen nicht an das Institut zurück. Diese Patienten bildeten das Kollektiv der Non-Responder, von denen jeweils die Parameter Alter, Geschlecht und Überweisungszahl der letzten zwölf Monate dokumentiert wurden. Weitere Daten wurden nur von den Patienten erfasst, deren unterschriebene Einverständniserklärung und ausgefüllter Fragebogen im Institut eingingen. Für die Datenerhebung entnahm die Doktorandin den elektronischen Behandlungsunterlagen des Hausarztes folgende Informationen: Alter und Geschlecht Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage, Überweisungen und Kontakte zur Hausarztpraxis während der vorausgegangenen zwölf Monate Fachgebiet, an welches sich die Überweisung richtete Angaben zum Grund der Überweisung: die Diagnose bzw. Verdachtsdiagnose, der erhobene Befund, die Medikation des Patienten oder der Auftrag des Hausarztes an den fachärztlichen Kollegen Anzahl und Art der vom Hausarzt dokumentierten Dauerdiagnosen (Definition siehe Kapitel 1.3.2, Seite 14) Analog zur Erststudie wurde der Hausarzt um Einschätzung der Partizipationspräferenz des Patienten gebeten und am Erhebungstag ausgestellte Überweisungen sollten als sinnvoll oder nicht sinnvoll bewertet werden. 22 In der Überweisungsstudie wurde auch der Informationsgehalt der Überweisungen analysiert. In gemeinsamer Arbeit beurteilten die Doktorandin und der Dissertationsbetreuer die auf dem Überweisungsschein angegebenen Informationen zum Grund der Überweisung. Der genaue Wortlaut wurde hierbei als vage oder exakt formuliert eingestuft. 2.2 Aufbau des Fragebogens 2.2.1 Soziodemographische Fragen Um den soziodemographischen Hintergrund der Patienten zu erfassen, widmete sich ein Teil der Fragen dem Familienstand, dem höchstem Schulabschluss, der Berufsausbildung und dem Erwerbstätigkeitsstatus. Darüber hinaus wurden Alter und Geschlecht der Befragten erfasst. 2.2.2 Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D) Der Patient Health Questionnaire ist ein in Amerika entwickeltes Selbstbeurteilungsinstrument zum Erkennen der häufigsten psychischen Erkrankungen im primärärztlichen Bereich (Spitzer 1999). Eine deutsche Version wurde von der Arbeitsgruppe um Bernd Löwe in Kooperation mit den Originalautoren entwickelt und „Gesundheitsfragebogen für Patienten“ (PHQ-D, Patient Health Questionnaire-deutsche Version) genannt (Löwe 2001). Dieser Original-PHQ-D wurde inzwischen überarbeitet. Die zweite Fassung besteht aus 16 Modulen, die je der Erfassung einer psychischen Störung dienen (Löwe 2002). Für die vorliegende Überweisungsstudie wurden insgesamt vier Module ausgewählt: Depression, Panik, Somatoforme Syndrome und der Generalized Anxiety Disorder-7-Fragebogen (GAD-7). Da die vorher durchgeführte Erststudie (Einzelheiten siehe Kapitel 1.3.1 und 2.1.1) noch die Originalversion des PHQ-D verwendete, musste noch zusätzlich das Modul zu den Anderen Angststörungen in den Fragekatalog der Überweisungsstudie aufgenommen werden. Das Modul Andere Angststörungen wurde in der zweiten Fassung des PHQ-D durch den GAD-7 mit verbesserten psychometrischen Testeigenschaften ersetzt. Die in der vorliegenden Untersuchung verwendeten Module werden im Folgenden vorgestellt. 23 Panikmodul: 15 Items: erstes Item fragt nach dem Auftreten einer Angstattacke in den letzten vier Wochen; bei Antwort „Nein“ muss der Patient die weiteren Fragen des Panikmoduls nicht beantworten, bei Antwort „Ja“ folgen weitere Fragen zu stattgefundenen Angstattacken mit dichotomer Antwortmöglichkeit von „Ja“ oder „Nein“ Auswertung ist dimensional (Summenwert von 0 bis 15, d.h. keine bis maximale Panik) und kategorial (Diagnose Panikstörung) möglich Depressionsmodul (PHQ-9): 9 Items: Überprüfung der Beeinträchtigung durch Beschwerden, wie zum Beispiel „wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten“, innerhalb der letzten zwei Wochen vierstufige Antwortskala von „überhaupt nicht“ bis „beinahe jeden Tag“ Auswertung ist dimensional (Summenwert von 0 bis 27, d.h. keine bis maximale Depressivität) und kategorial (Diagnose Major Depression oder Andere Depressive Störung) möglich Modul zu Anderen Angststörungen (aus der Originalversion des PHQ-D): 7 Items: Überprüfung der Beeinträchtigung durch Beschwerden, wie zum Beispiel „Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung“, innerhalb der letzten zwei Wochen dreistufige Antwortskala von „überhaupt nicht“ bis „an mehr als der Hälfte der Tage“ Auswertung ist dimensional (Summenwert von 0 bis 14, d.h. keine bis maximale Ängstlichkeit) und kategorial (Diagnose Andere Angststörung) möglich GAD-7 (aus der zweiten Version des PHQ-D): 7 Items: Überprüfung der Beeinträchtigung durch Beschwerden, wie zum Beispiel „übermäßige Sorgen bezüglich verschiedener Angelegenheiten“, innerhalb der letzten zwei Wochen vierstufige Antwortskala von „überhaupt nicht“ bis „beinahe jeden Tag“ Auswertung ist dimensional (Summenwert von 0 bis 21, d.h. keine bis maximale Ängstlichkeit) und kategorial (minimale, geringe, mittelgradige und schwere Ängstlichkeit) möglich 24 Modul zu Somatoformen Syndromen (PHQ-15): 13 Items: Überprüfung der Beeinträchtigung durch Beschwerden, wie zum Beispiel „Verstopfung, nervöser Darm oder Durchfall“, innerhalb der letzten vier Wochen dreistufige Antwortskala von „nicht beeinträchtigt“ bis „stark beeinträchtigt“ Auswertung ist dimensional (unter Einbeziehung von zwei Fragen aus dem Depressionsmodul ergibt sich Summenwert von 0 bis 30, d.h. keine bis maximale Somatisierung) und kategorial (Diagnose Somatoforme Störung) möglich Die verschiedenen Module des PHQ-D wurden in mehreren Studien in Amerika, Deutschland und vielen anderen Ländern der Welt validiert. In einer in Deutschland durchgeführten Untersuchung mit 501 Patienten zeigte das Depressionsmodul, im Vergleich zu etablierten Depressionsfragebögen und der Detektion durch einen Arzt, die besten Testeigenschaften. Je nach Cut-Off-Wert lag die Sensitivität bei bis zu 98 Prozent und die Spezifität bei bis zu 80 Prozent. Auch die interne Konsistenz erwies sich als sehr gut mit einem Wert von Cronbachs α bei 0,88 (Löwe 2004a). Weitere Validierungsstudien bestätigten auch für das Modul Panik (Löwe 2003), Somatoforme Syndrome (van Ravesteijn 2009) und den GAD-7 (Löwe 2008) eine gute diagnostische Leistung. Der PHQ-D ist aufgrund dieser diagnostischen Eigenschaften, der Praktikabilität und internationalen Verfügbarkeit zu einem weltweit führenden Instrument bei der Diagnosestellung psychischer Störungen geworden. 2.2.3 Autonomie-Präferenz-Index (API) Seit den 1980er Jahren vollzog sich in der Patient-Arzt-Interaktion ein stetiger Wandel vom bis dahin dominierenden paternalistischen Modell hin zur partizipativen Entscheidungsfindung (Definitionen siehe Kapitel 1.3.2, Seite 14). Im Laufe dieser Entwicklung wurden verschiedene Messinstrumente für diesen neuen und bis dahin noch wenig erforschten Ansatz ausgearbeitet (Charles 1997). Ein Beispiel ist der von Ende et al. erstellte Autonomie-Präferenz-Index (Ende 1989). Dieser Fragebogen misst das Informationsbedürfnis der Patienten und Ihren Wunsch an medizinischen Entscheidungen beteiligt zu werden. Zur Einschätzung dieser beiden Charakteristika ist der API in zwei Subskalen gegliedert, die im Folgenden vorgestellt werden. 25 Informationspräferenz-Skala: 8 Aussagen: zum Beispiel „Sie sollten vollständig verstehen, was infolge der Krankheit in Ihrem Körper vor sich geht.“ Beurteilung mit „sehr dafür“ bis „sehr dagegen“ Partizipationspräferenz-Skala: 6 Aussagen: zum Beispiel „Wichtige medizinische Entscheidungen sollten von Ihrem Arzt getroffen werden und nicht von Ihnen.“ Beurteilung mit „sehr dafür“ bis „sehr dagegen“ Komplettfassung der Partizipationspräferenz-Skala beinhaltet darüber hinaus Fallvignetten zu drei Krankheitsschweregraden, die aber nicht in den Fragekatalog der vorliegenden Arbeit aufgenommen wurden Die Auswertung beider Subskalen ergibt je Werte zwischen 0 und 100, wobei 0 für kein und 100 für ein sehr hohes Informations- bzw. Partizipationsbedürfnis des Patienten steht. Die Reliabilitätsprüfung, die von der Arbeitsgruppe um Jack Ende in Amerika durchgeführt wurde, ergab eine gute interne Konsistenz mit einem Wert von Cronbachs α bei 0,82 und eine Retest-Reliabilität von 0,83 bzw. 0,84 für die Informationsbzw. Partizipationspräferenz-Skala (Ende 1989). Die Originalfassung wurde mit Unterstützung vom Bundesministerium für Gesundheit ins Deutsche übersetzt und indikationsübergreifend an einer Gruppe von fast 1592 Patienten validiert. Laufende Forschungsprojekte widmen sich dem Versuch, die Testeigenschaften durch Elimination oder Umpolung einzelner Items noch weiter zu verbessern (Simon 2010). 2.2.4 Fragebogen zu Körper und Gesundheit (FKG) Dysfunktionale Kognitionen sollen bei der Entwicklung einer somatoformen Störung eine bedeutende Rolle spielen. Zur Erfassung dieser spezifischen Kognitionsmuster entwickelten Rief et al. Ende der 1990er Jahre den Fragebogen zu Körper und Gesundheit. Die zunächst erstellte Vorversion bestand aus insgesamt 68 Items. Der Großteil dieser Items wurde von den Autoren selbst formuliert, weitere neun wurden aus Barskys Somatosensory Amplification Scale übernommen. Die Vorversion wurde an einer Stichprobe von 493 Patienten einer psychosomatischen Klinik validiert, was die Auswahl der 31 aussagekräftigsten Items für die endgültige Fassung ermöglichte. Die einzelnen Aussagen des FKG sind mittels vierstufiger Antwortskala von „stimmt 26 nicht“ bis „stimmt voll und ganz“ zu bewerten und lassen sich einer von fünf Kategorien zuordnen, die im Folgenden mit je einem Beispielitem vorgestellt werden. Skala Katastrophisierende Bewertung: 14 Aussagen, wie zum Beispiel: „Bei Verstopfung sollte man umgehend einen Facharzt aufsuchen, um sicherzugehen, dass man keinen Darmkrebs hat.“ Auswertung ergibt Werte zwischen 0 und 42, d.h. niedrige bzw. hohe Neigung zu katastrophisierender Bewertung von körperlichen Empfindungen Skala Vegetative Missempfindungen: 4 Aussagen, wie zum Beispiel: „Ich kann meinen Herzschlag oft im Ohr pulsieren hören.“ Auswertung ergibt Werte zwischen 0 und 12, d.h. niedrige bzw. hohe Tendenz körperliche Empfindungen in unangenehmer Weise wahrzunehmen Skala Körperliche Schwäche: 6 Aussagen, wie zum Beispiel: „Nach körperlicher Anstrengung habe ich sehr oft ein Schwächegefühl.“ Auswertung ergibt Werte zwischen 0 und 18, d.h. niedrige bzw. hohe Neigung sich schwach und erschöpft zu fühlen und nicht mit Stress umgehen zu können Skala Intoleranz: 4 Aussagen, wie zum Beispiel: „Bei körperlichen Beschwerden hole ich möglichst sofort einen ärztlichen Rat ein.“ Auswertung ergibt Werte zwischen 0 und 12, d.h. niedrige bzw. hohe Tendenz körperliche Empfindungen nur schlecht ertragen zu können Skala Gesundheitsverhalten: 3 Aussagen, wie zum Beispiel: „Ich bin immer darum bemüht, richtig gesund zu leben.“ Auswertung ergibt Werte zwischen 0 und 9, d.h. niedrige bzw. hohe Motivation sich so zu verhalten, dass es der eigenen Gesundheit zugutekommt Die Validierung der endgültigen FKG-Version erfolgte an einer Stichprobe, die aus zwei verschiedenen Gruppen gebildet wurde: einerseits 124 Personen mit diagnosti27 zierter somatoformer Störung oder einer anderen psychischen Erkrankung und andererseits 101 in dieser Hinsicht gesunde Kontrollpersonen. Die Reliabilitätsprüfung ergab eine interne Konsistenz mit Werten von Cronbachs α zwischen 0,49 und 0,89, wobei die niedrigsten Werte bei Testung der Skala Intoleranz und bei Befragung der Kontrollgruppe registriert wurden. In der Auswertung erzielten Patienten mit somatoformen Störungen in vier der fünf Kategorien signifikant höhere Punktwerte als das Vergleichskollektiv. Nur bezüglich der Skala „Gesundheitsverhalten“ ließ sich kein Unterschied zwischen den Gruppen feststellen. Der FKG ist demzufolge ein geeignetes diagnostisches Hilfsmittel, um dysfunktionale Kognitionen aufzudecken, wie sie bei einer somatoformen Störung beobachtbar sind (Rief 1998). Ebenso kann der FKG zur Verlaufskontrolle eingesetzt werden. Eine zweite Studie zeigte, dass eine stationäre Verhaltenstherapie zur signifikanten Verbesserung der Werte der Skalen Katastrophisierende Bewertung, Körperliche Schwäche und Intoleranz führte (Hiller 1997). 2.2.5 Fragebogen zur Erhebung von Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit (KKG) Für die Entwicklung des individuellen Gesundheitsverhaltens scheint von Bedeutung zu sein, ob die jeweilige Person das Gefühl hat, selbst Einfluss auf den eigenen Gesundheitszustand nehmen zu können. Zur Quantifizierung dieser Vorstellungen wurden verschiedene Fragebögen entwickelt. Ein Beispiel ist der von Lohaus et al. entwickelte Fragebogen zur Erhebung von Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit. Der KKG überprüft drei Dimensionen mit jeweils sieben Aussagen. Diese werden im Folgenden mit je einem Beispielitem vorgestellt (Definitionen siehe Kapitel 1.3.2, Seite 16). Internalität: „Wenn ich mich körperlich nicht wohl fühle, dann habe ich mir das selbst zuzuschreiben.“ fatalistische Externalität: „Ich bin der Meinung, dass Glück und Zufall eine große Rolle für mein körperliches Befinden spielen.“ soziale Externalität: „Wenn ich mich unwohl fühle, wissen andere am besten, was mir fehlt.“ 28 Die einzelnen Fragen werden je mittels sechsstufiger Antwortskala von „trifft sehr zu“ bis „trifft gar nicht zu“ beurteilt. So ergibt sich für die drei Dimensionen jeweils ein Wert zwischen 7 und 42, was für eine niedrige bzw. hohe Kontrollüberzeugung steht. Laut der Forschungsgruppe um Lohaus erreicht der KKG mittlere Reliabilitätskoeffizienten. Bei der Überprüfung der Testgütekriterien lag die Retest-Reliabilität bei Werten zwischen 0,66 und 0,78 und die interne Konsistenz mit einem Wert von Cronbachs α zwischen 0,64 und 0,77, jeweils abhängig davon, welche Altersklasse befragt bzw. welche der drei Dimensionen überprüft wurde. Konstruktvalidität des Fragebogens wurde durch zwei Methoden bestätigt. So zeigte die Faktorenanalyse eine dreifaktorielle Lösung und die Interkorrelation der drei Skalen eine adäquate Unabhängigkeit dieser voneinander. Auch kriterienbezogene Validität konnte durch Korrelationen mit Außenkriterien und Gruppenvergleichen bewiesen werden (Lohaus 1989). Der KKG und verwandte Fragebögen finden bis heute in zahlreichen Themengebieten Anwendung. Beispiele sind die Erforschung der interindividuellen Unterschiede bezüglich der Compliance bei der Medikamenteneinnahme oder dem Ausführen krankheitspräventiver Maßnahmen. Die Untersuchung der Auswirkung einer chronischen Erkrankung auf die psychische und physische Gesundheit und die verschiedenartige Interaktionsweise von Patienten mit dem medizinischen Versorgungssystem stellen weitere Einsatzmöglichkeiten dar (Lohaus 1989; Otto 2011). 2.3 Angewandte statistische Methoden 2.3.1 Fallzahlschätzung Die Fallzahlschätzung der vorliegenden Untersuchung basiert auf den Erkenntnissen der vorausgegangenen Erststudie. Hier ergab die Auswertung des PHQ-D-Moduls zu Somatoformen Syndromen für die 23 Patienten mit vom Hausarzt als nicht sinnvoll eingestuften Überweisungen einen Summenwert von 6,3. Die 182 Patienten mit sinnvollen Überweisungen wiesen im Vergleich dazu eine niedrigere Somatisierungstendenz von 5,8 auf. Bei einer mittleren Standardabweichung von 2,0 müssten insgesamt 446 Patienten eingeschlossen werden, um einen Unterschied auf einem Signifikanzniveau von 5 Prozent mit 80 prozentiger Power nachweisen zu können (einseitige Testung, Berechnung mit G-Power). Die bereits in der Erststudie dokumentierten 182 Patienten mit sinnvolle Überweisungsvorgängen konnten mit dem Kollektiv verrechnet werden, sodass insgesamt 270 weitere Patienten in die vorliegende Studie einge- 29 schlossen werden mussten. Bei einer geschätzten drop-out-Rate von 10 Prozent ergab sich eine geforderte Stichgrößenzahl von 300 Patienten. 2.3.2 Statistische Analyse Die Analyse der Studienergebnisse wurde mithilfe der Statistiksoftware SPSS Statistics (Version 20) realisiert. Zunächst wurde das Datenmaterial einer deskriptiven Analyse unterzogen. Hier wurden die Häufigkeitsverteilungen der einzelnen Variablen dargestellt und je nach Datentyp Mittelwerte und Standardabweichungen, Mediane und Quartile bzw. Prozentangaben ermittelt. Als nächstes wurden die zu vergleichenden Subgruppen definiert und dann auf Gruppenunterschiede hin analysiert. Für den Vergleich kontinuierlicher Variablen wurden der Wilcoxon-Mann-Whitney-Test bzw. bei Normalverteilung der Daten der t-Test für unabhängige Stichproben verwendet. Bei kategorialen Variablen kamen der Chi-Quadrat-Test zum Einsatz bzw. der exakte Test nach Fisher, wenn nur zwei Variablen mit je zwei Kategorien betrachtet wurden. Als Signifikanzniveau α wurde ein Wert von 5 Prozent festgelegt. Den Tabellen des Ergebnisteils kann je entnommen werden, welcher statistische Test für die Berechnung des jeweiligen p-Werts herangezogen wurde. Zur Ermittlung von Prädiktoren für das Inanspruchnahmeverhalten wurde eine binär logistische Regression durchgeführt. Praxiskontakte, Überweisungszahl und Arbeitsunfähigkeitstage dienten als abhängige Variablen und wurden anhand des jeweiligen Medians dichotomisiert. Es wurde festgelegt, dass eine erhöhte Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen vorliegt (sogenannte „high utilizer“), wenn der jeweilige Median der abhängigen Variable überschritten wird. Als erklärende Variable wurde die nach PHQ-D diagnostizierte psychische Komorbidität in das Regressionsmodell aufgenommen. Des Weiteren wurde untersucht, ob die Zugehörigkeit zur Patientengruppe mit Tresen-Überweisungen und das Vorliegen von definierten Erkrankungsklassen einen Einfluss auf das Inanspruchnahmeverhalten ausübt. Die erklärenden Variablen wurden nach Alter, Geschlecht, Schulbildung und – zur Kontrolle von Zentrumseffekten – auch nach der Praxiszugehörigkeit adjustiert. Für alle PHQ-D-Diagnosen wurden Interaktionseffekte mit der somatischen Morbidität durch Bildung von Interaktionstermen („Vorliegen der jeweiligen PHQ-D-Diagnose x Vorliegen von somatischer Morbidität“) berücksichtigt, da bei bestehender hoher somatischer Morbidität auch von einer erhöhten psychischen Komorbidität ausgegangen werden muss. 30 2.3.3 Umgang mit fehlenden Werten Bei nur unvollständig ausgefüllten Fragebögen erfolgte die Auswertung so, wie von den Autoren angegeben. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Anzahl der Items, die der Patient ankreuzen musste, damit eine Auswertung möglich war. In den Tabellen des Ergebnisteils zeigt jeweils die Spalte „N (%)“, bei welchem Anteil der Fragebögen eine Auswertung vorgenommen werden konnte. Tabelle 1: Umgang mit fehlenden Werten Fragebogen Gesamtzahl Items Auswertung ab Itemzahl PHQ-D Depression 9 7 Panik 15 12 Andere Angststörungen 7 6 GAD-7 7 5 Somatoforme Syndrome 12 9 Informationspräferenz 6 4 Partizipationspräferenz 6 4 API FKG KKG Katastrophisierende Bewertung 14 11 Vegetative Missempfindungen 4 4 Körperliche Schwäche 6 6 Intoleranz 4 4 Gesundheitsverhalten 3 3 Internalität 7 7 Fatalistische Externalität 7 7 Soziale Externalität 7 7 Abkürzungen: API – Autonomie-Präferenz-Index, FKG – Fragebogen für Körper und Gesundheit, GAD-7 – Generalized Anxiety Disorder-7-Fragebogen, KKG – Fragebogen zur Erhebung von Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit, PHQ-D – Gesundheitsfragebogen für Patienten Eine Auswertung des Depressionsmoduls des PHQ-D ist zum Beispiel möglich, insofern mindestens sieben der neun Fragen beantwortet sind. Im Falle von ein oder zwei fehlenden Angaben wird der Durchschnittswert der restlichen Werte ermittelt und dieser anstelle der fehlenden Werte in der Berechnung eingesetzt. Im Falle von mehr als zwei fehlenden Werten kann dieses Modul nicht mehr ausgewertet werden. 31 3 ERGEBNISSE 3.1 Vergleich von Patienten aus der regulären Sprechstunde mit Patienten, die Überweisungen am Tresen erhalten 3.1.1 Beschreibung der Stichprobe In der vorliegenden Überweisungsstudie wurden 281 Patienten rekrutiert, die Überweisungen am Tresen der Praxis ohne direkten Arztkontakt erhielten. Darüber hinaus konnten die Daten von 1011 Patienten der zuvor durchgeführten Erststudie für die Auswertung herangezogen werden. 985 dieser Patienten besuchten die reguläre Sprechstunde, die übrigen 26 hatten Tresen-Überweisungen erhalten. Abbildung 2 gibt wieder, wie sich die rekrutierten Patientengruppen zusammensetzten. Überweisungsstudie Erststudie 602 Patienten wurde Fragebogen überreicht 1185 Patienten erfüllten Einschlusskriterien 11 ausgeschlossen: - 3 besuchten Sprechstunde - 2 ohne Überweisung - 6 Fragebögen ausgefüllt von der falschen Person 174 Non-Responder: - 174 hatten von Vornherein kein Interesse 591 Patienten erfüllten Einschlusskriterien 1011 Responder in die Studie eingeschlossen 310 Non-Responder: - 38 hatten von Vornherein kein Interesse - 272 sendeten Fragebogen nicht zurück 281 Responder in die Studie eingeschlossen Davon 26 Patienten mit Tresen-Überweisungen Insgesamt 307 Patienten mit Tresen-Überweisungen Davon 985 Patienten aus der Sprechstunde Abbildung 2: Rekrutierung von Patienten für die Erststudie und Überweisungsstudie In der Tabelle 2 ist der Vergleich des soziodemographischen Hintergrunds der zwei Kollektive dargestellt. Die Patientengruppe mit Tresen-Überweisungen enthielt mehr Frauen (66 % vs. 58 %) und verheiratete oder in fester Partnerschaft lebende Personen als das Kollektiv der regulären Sprechstunde (76 % vs. 67 %). In den Bereichen 32 Alter, Schulbildung, Studium und Erwerbstätigkeitsstatus fanden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Gruppen. Tabelle 2: Soziodemographischer Hintergrund Patienten aus der Sprechstunde (N=985) N (%) n (%) Alter in Jahren; mw (sd) 985 (100) Weiblich + Patienten mit TresenÜberweisung (N=307) p-Wert + N (%) n (%) 49,3 (17,8) 307 (100) 51,4 (17,5) 0,066 985 (100) 575 (58) 307 (100) 201 (66) 0,028 Verheiratet oder fester Partner 956 (97) 637 (67) 303 (99) 230 (76) 0,002 Fachabitur oder Abitur 949 (96) 296 (31) 303 (99) 93 (31) 0,887 Fach- oder Hochschulstudium 941 (96) 224 (24) 302 (98) 64 (21) 0,389 In Erwerbstätigkeit 953 (97) 544 (57) 303 (99) 159 (53) 0,164 Fragen zur Person: Testverfahren: t-Test (Alter), Exakter Test nach Fisher (Geschlecht), Chi-Quadrat-Test (Fragen zur Person) p-Wert bezogen auf n (%) bzw. mw (sd) + wenn nicht anders angegeben Abkürzungen: mw (sd) – Mittelwert (Standardabweichung), n (%) – Anzahl von Patienten mit soziodemographischem Kriterium (Anteil an Gesamtzahl), N (%) – Anzahl auswertbarer Fragebögen (Anteil an Gesamtzahl) 3.1.2 Psychische Komorbidität Tabelle 3 zeigt den Vergleich der beiden Kollektive hinsichtlich der Summenwerte der in der Studie verwendeten PHQ-D-Module. Patienten mit Tresen-Überweisungen wiesen eine leicht geringere Depressivität auf als Patienten der regulären Sprechstunde (Mittelwert 5,1 vs. 5,6). Hinsichtlich Panik, Ängstlichkeit und Somatisierung ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den zwei Gruppen. 33 Tabelle 3: Summenwerte der PHQ-D-Module Depression, Panik, Andere Angststörungen und Somatoforme Syndrome Patienten aus der Sprechstunde (N=985) Patienten mit TresenÜberweisung (N=307) N (%) mw (sd) N (%) mw (sd) Depressivität 949 (96) 5,6 (4,8) 296 (96) 5,1 (4,9) 0,015 Panik 967 (98) 1,2 (3,2) 299 (97) 1,3 (3,5) 0,917 Ängstlichkeit 938 (95) 4,5 (3,2) 300 (98) 4,6 (3,6) 0,902 Somatisierung 896 (91) 7,6 (4,8) 293 (95) 7,1 (4,7) 0,074 p-Wert Testverfahren: Wilcoxon-Mann-Whitney-Test p-Wert bezogen auf mw (sd) Abkürzungen: mw (sd) – Mittelwert (Standardabweichung), N (%) – Anzahl auswertbarer Fragebögen (Anteil an Gesamtzahl), PHQ-D – Gesundheitsfragebogen für Patienten Neben dieser dimensionalen Analyse ist auch eine kategoriale Auswertung der PHQD-Module möglich. Tabelle 4 zeigt die Prävalenz der auf diese Weise diagnostizierten psychischen Störungen. Es konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den zwei Gruppen ermittelt werden. Tabelle 4: Nach PHQ-D diagnostizierte psychische Störungen (Module Depression, Panik, Andere Angststörungen und Somatoforme Syndrome) Patienten aus der Sprechstunde (N=985) Patienten mit TresenÜberweisung (N=307) N (%) n (%) N (%) n (%) Major Depression 956 (97) 67 (7,0) 299 (97) 23 (7,7) 0,700 Andere Depressive Störung 957 (97) 86 (9,0) 300 (98) 19 (6,3) 0,188 Panikstörung 973 (99) 48 (4,9) 300 (98) 21 (7,0) 0,189 Andere Angststörung 950 (96) 54 (5,7) 299 (97) 23 (7,7) 0,216 Somatoforme Störung 930 (94) 169 (18,2) 299 (97) 42 (14,0) 0,112 p-Wert Testverfahren: Exakter Test nach Fisher p-Wert bezogen auf n (%) Abkürzungen: n (%) – Anzahl von Patienten mit psychischer Störung (Anteil an Gesamtzahl), N (%) – Anzahl auswertbarer Fragebögen (Anteil an Gesamtzahl), PHQ-D – Gesundheitsfragebogen für Patienten Es folgt Abbildung 3, die die psychische Komorbidität der beiden Patientengruppen vergleicht. Patienten, die nach PHQ-D die Diagnose einer Major Depression oder anderen depressiven Störung erhielten, wurden in der Grafik der Kategorie „Depression“ zugeordnet. Bestand beim Patienten eine andere Angststörung oder eine Panikstö34 rung, erfolgte die Zuteilung zur Fraktion „Angststörung“. In der Gruppe „Somatoforme Störung“ finden sich Patienten mit nach PHQ-D diagnostizierter somatoformer Störung. Bei 24,0 Prozent der Patienten mit Tresen-Überweisungen bestand eine psychische Störung, bei den Patienten der regulären Sprechstunde waren es sogar 28,3 Prozent, wobei dieser Unterschied jedoch keine statistische Signifikanz erreichte. Patienten aus der Sprechstunde Depression 2.1% Patienten mit Tresen-Überweisung Angststörung 6.6% Depression Angststörung 5.1% 1.4% 2.1% 3.5% 3.8% Somatoforme Störung Somatoforme Störung 8.7% 2.1% 3.1% 1.6% 4.4% 2.4% p-Wert = 0.153 Patienten ohne psychische Komorbidität: 71.7% 5.5% Patienten ohne psychische Komorbidität: 76.0% Abbildung 3: Prävalenz der nach PHQ-D diagnostizierten psychischen Komorbidität Testverfahren: Chi-Quadrat-Test Abkürzungen: PHQ-D – Gesundheitsfragebogen für Patienten 35 3.1.3 Dauerdiagnosen Der Vergleich der zwei Kollektive in Bezug auf die Dauerdiagnosenzahl pro Patient ist in Tabelle 5 dargestellt. Es konnte kein signifikanter Unterschied ermittelt werden. Bei jedem Patienten waren im Mittel etwa vier bis fünf Dauerdiagnosen in den elektronischen Behandlungsunterlagen des Hausarztes vermerkt. Tabelle 5: Anzahl der vom Hausarzt dokumentierten Dauerdiagnosen pro Patient Patienten aus der Sprechstunde (N=985) Patienten mit Tresen-Überweisung (N=307) N (%) mw (sd) N (%) mw (sd) 973 (99) 4,4 (4,2) 306 (99) 4,5 (3,9) p-Wert 0,190 Testverfahren: Wilcoxon-Mann-Whitney-Test p-Wert bezogen auf mw (sd) Abkürzungen: mw (sd) – Mittelwert (Standardabweichung), N (%) – Anzahl auswertbarer Fragebögen (Anteil an Gesamtzahl) Um die Analyse der Vielzahl an einzelnen Dauerdiagnosen zu ermöglichen, wurden diese zu 27 Diagnosen zusammengefasst, die in Tabelle 6 dargestellt sind. Bei den Patienten mit Tresen-Überweisungen wurden am häufigsten sonstige internistische Erkrankungen (31,6 %), eine arterielle Hypertonie (29,0 %) und Rückenschmerzerkrankungen (19,2 %) diagnostiziert. Auch bei 29,0 Prozent der Patienten aus der Sprechstunde bestand eine arterielle Hypertonie, bei 23,5 Prozent Rückenschmerzerkrankungen und bei 14,7 Prozent eine Depression. Zwischen beiden Gruppen bestanden signifikante Unterschiede in Hinblick auf die Häufigkeit von malignen, sonstigen internistischen, sonstigen neurologischen, sonstigen psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen. 36 Tabelle 6: Diagnosen Patienten aus der Sprechstunde (N=985) Patienten mit Tresen-Überweisung (N=307) p-Wert Angststörung 38 (3,9) 11 (3,6) 1,000 Arterielle Hypertonie 283 (28,7) 89 (29,0) 0,943 Asthma/COPD 91 (9,2) 27 (8,8) 0,910 Chronische Schmerzstörung/Fibromyalgie 36 (3,7) 6 (2,0) 0,195 Chronisch-entzündliche Darmerkrankung 3 (0,3) 3 (1,0) 0,150 Depression 144 (14,6) 40 (13,0) 0,514 Diabetes 95 (9,6) 28 (9,1) 0,825 Epicondylitis 6 (0,6) 2 (0,7) 1,000 Erkrankung des atopischen Formenkreises 93 (9,4) 41 (13,4) 0,054 Halswirbelsäulen-Syndrom 73 (7,4) 16 (5,2) 0,199 Knie-/Hüftschmerzerkrankung 93 (9,4) 34 (11,1) 0,442 Kopfschmerzerkrankung 48 (4,9) 15 (4,9) 1,000 Maligne Erkrankung 75 (7,6) 41 (13,4) 0,003 Marcumartherapie/Vorhofflimmern 48 (4,9) 15 (4,9) 1,000 Morbus Parkinson 7 (0,7) 2 (0,7) 1,000 Multiple Sklerose 4 (0,4) 1 (0,3) 1,000 Psychosomatische Erkrankung 62 (6,3) 20 (6,5) 0,894 Rheumatoide Arthritis 21 (2,1) 7 (2,3) 0,825 Rückenschmerzerkrankung 230 (23,4) 59 (19,2) 0,137 Schizophrenie 2 (0,2) 1 (0,3) 0,557 Schulter-Arm-Syndrom 19 (1,9) 5 (1,6) 1,000 Schwere Herzerkrankung 112 (11,4) 38 (12,4) 0,611 Sonstige internistische Erkrankung 143 (14,5) 97 (31,6) <0,001 Sonstige neurologische Erkrankung 26 (2,6) 16 (5,2) 0,040 Sonstige psychische Erkrankung 78 (7,9) 11 (3,6) 0,009 Suchterkrankung 64 (6,5) 4 (1,3) <0,001 Zustand nach Apoplex 21 (2,1) 6 (2,0) 1,000 Testverfahren: Chi-Quadrat-Test Werte sind n (%) Abkürzungen: COPD – chronisch obstruktive Lungenerkrankung 37 Tabelle 7 zeigt die Häufigkeit von sieben Erkrankungsklassen, die durch weiteres Zusammenfassen der in Tabelle 6 vorgestellten Diagnosen gebildet wurden. Patienten mit Tresen-Überweisungen litten im Vergleich zu den Patienten der Sprechstunde häufiger an malignen (13,4 % vs. 7,6 %) und chronisch internistischen Erkrankungen (57,7 % vs. 46,3 %). Suchterkrankungen waren in diesem Kollektiv hingegen seltener (1,3 % vs. 6,5 %). In Bezug auf die anderen Erkrankungsklassen fanden sich keine weiteren signifikanten Unterschiede. Tabelle 7: Erkrankungsklassen Patienten aus der Sprechstunde (N=985) Patienten mit Tresen-Überweisung (N=307) p-Wert Chronisch internistische Erkrankung 456 (46,3) 177 (57,7) 0,001 Erkrankung des atopischen Formenkreises 93 (9,4) 41 (13,4) 0,054 Erkrankung des Bewegungsapparats 338 (34,3) 91 (29,6) 0,145 Maligne Erkrankung 75 (7,6) 41 (13,4) 0,003 Neurologische Erkrankung 101 (10,3) 35 (11,4) 0,594 Psychosomatische/psychische Erkrankung 237 (24,1) 61 (19,9) 0,140 Suchterkrankung 64 (6,5) 4 (1,3) <0,001 Testverfahren: Chi-Quadrat-Test Werte sind n (%) Die Erkrankungsklassen wurden durch Zusammenfassen der folgenden Diagnosen gebildet: - Chronisch internistische Erkrankung: Arterielle Hypertonie, Asthma/Chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Chronisch-entzündliche Darmerkrankung, Diabetes, Marcumartherapie/Vorhofflimmern, Schwere Herzerkrankung oder Sonstige internistische Erkrankung - Erkrankung des Bewegungsapparats: Chronische Schmerzstörung/Fibromyalgie, Epicondylitis, Halswirbelsäulen-Syndrom, Knie/Hüftschmerzerkrankung, Rheumatoide Arthritis, Rückenschmerzerkrankung oder SchulterArm-Syndrom - Neurologische Erkrankung: Kopfschmerzerkrankung, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, Sonstige neurologische Erkrankung oder Zustand nach Apoplex - Psychosomatische oder psychische Erkrankung: Angststörung, Depression, Psychosomatische Erkrankung, Schizophrenie oder Sonstige psychische Erkrankung 38 3.1.4 Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen In Tabelle 8 ist der Vergleich der Parameter für das Inanspruchnahmeverhalten während der letzten zwölf Monate dargestellt. Das Patientenkollektiv mit Tresen-Überweisungen nahm im Vergleich zu der Patientengruppe der regulären Sprechstunde mehr Überweisungen in Anspruch (Mittelwert 6,6 vs. 3,7), suchte aber die hausärztliche Praxis seltener auf (Mittelwert 13,9 vs. 15,2). Für die Arbeitsunfähigkeitsdauer konnte kein signifikanter Unterschied ermittelt werden. Im Durchschnitt schrieb der Hausarzt die Patienten etwa sieben bis acht Tage im Jahr krank. Tabelle 8: Inanspruchnahmeverhalten während der letzten zwölf Monate Patienten aus der Patienten mit TresenSprechstunde (N=985) Überweisung (N=307) p-Wert N (%) mw (sd) N (%) mw (sd) Anzahl Überweisungen 980 (99) 3,7 (4,1) 307 (100) 6,6 (4,4) <0,001 Hausärztliche Praxiskontaktzahl 981 (99) 15,2 (16,4) 307 (100) 13,9 (9,3) 0,024 Anzahl Arbeitsunfähigkeitstage 907 (92) 7,5 (23,2) 306 (99) 7,6 (24,7) 0,445 Testverfahren: Wilcoxon-Mann-Whitney-Test p-Wert bezogen auf mw (sd) Abkürzungen: mw (sd) – Mittelwert (Standardabweichung), N (%) – Anzahl auswertbarer Fragebögen (Anteil an Gesamtzahl) Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse der binär logistischen Regressionsanalyse, die der Ermittlung von Prädiktoren für das Inanspruchnahmeverhalten diente. Die abhängigen Variablen wurden dabei anhand des jeweiligen Medians dichotomisiert. Als sogenannte „high utilizer“ wurden auf diese Weise all jene Patienten definiert, die in den letzten zwölf Monaten öfter als elf Mal die hausärztliche Praxis aufsuchten, mehr als drei Überweisungen in Anspruch nahmen oder länger als zehn Tage krankgeschrieben waren. Weitere Details zur statistischen Auswertung können dem Kapitel 2.3 entnommen werden. 39 Tabelle 9: Prädiktoren für die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen Praxiskontakte > 11 pro Jahr Überweisungszahl > 3 pro Jahr Arbeitsunfähigkeit > 10 Tage pro Jahr OR (95%KI) p-Wert OR (95%KI) p-Wert OR (95%KI) p-Wert 1,3 (0,7-2,5) 0,430 2,1 (1,1-4,0) 0,022 2,5 (1,2-4,8) 0,009 Angststörung 1,8 (0,8-4,4) 0,166 4,1 (1,8-9,6) 0,001 4,2 (1,7-10,5) 0,002 Panikstörung 1,4 (0,5-3,8) 0,500 5,9 (2,1-16,4) 0,001 2,8 (0,9-8,1) 0,064 Somatoforme Störung 2,4 (1,4-4,3) 0,003 2,2 (1,2-4,0) 0,008 2,2 (1,2-4,2) 0,011 Maligne Erkrankung 2,2 (1,4-3,6) 0,001 4,0 (2,3-7,0) <0,001 0,9 (0,4-1,8) 0,724 Neurologisch 2,6 (1,4-4,7) 0,002 3,4 (1,8-6,6) <0,001 1,3 (0,6-3,1) 0,551 Bewegungsapparat 1,3 (1,0-1,7) 0,092 1,3 (1,0-1,7) 0,097 1,4 (1,0-2,1) 0,081 Chronisch internistisch 2,5 (1,9-3,3) <0,001 2,0 (1,5-2,7) <0,001 1,1 (0,7-1,5) 0,724 Psychosom,/Psychisch 2,9 (2,1-3,8) <0,001 2,4 (1,8-3,3) <0,001 1,9 (1,3-2,7) <0,001 1,1 (0,8-1,5) 0,640 4,4 (3,1-6,0) <0,001 1,2 (0,8-1,8) 0,286 Diagnose nach PHQ-D: Depression + Erkrankungsklasse liegt vor: Am Erhebungstag: Mit Tresen-Überweisung Testverfahren: binär logistische Regression, jeweils separat gerechnet für Gesamtstichprobe (n=1292) Adjustierung der abhängigen Variablen für Alter, Geschlecht, Schulbildung und Praxiszugehörigkeit > 11 hausärztliche Praxiskontakte, > 3 Überweisungen und > 10 Tage in Arbeitsunfähigkeit pro Jahr wurde als verstärkte Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen definiert (Dichotomisierung am Median) + Vorliegen von Depression bei Diagnose einer Major Depression oder anderen Depressiven Störung Abkürzungen: KI – Konfidenzintervall, OR – Odds Ratio, PHQ-D – Gesundheitsfragebogen für Patienten, Psychosom. – psychosomatisch Alle vier der untersuchten psychischen Störungen waren Risikofaktoren für eine vermehrte Inanspruchnahme von Überweisungen, wobei eine bestehende Panikstörung mit einem Odds Ratio von 5,9 den größten Einfluss ausübte. Das Vorliegen einer somatoformen Störung, Depression oder Angststörung vergrößerte die Wahrscheinlichkeit für eine lange Krankschreibung (OR 2,2 bzw. OR 2,5 bzw. OR 4,2), während sich für Panikstörungen kein statistischer Zusammenhang ergab. Eine somatoforme Störung stellte sich mit einem Odds Ratio von 2,4 als Prädiktor für ein vermehrtes Aufsuchen der hausärztlichen Praxis heraus. Eine nach PHQ-D diagnostizierte Depression, Panik- oder Angststörung zeigte dagegen keinen Einfluss auf die Praxiskontaktrate. Die Betrachtung der beim Patienten diagnostizierten Erkrankungsklassen ergab für maligne, neurologische, chronisch-internistische und psychosomatisch/psychische 40 Dauerdiagnosen eine Assoziation mit einer erhöhten Inanspruchnahme von Überweisungen und einem vermehrten Aufsuchen der hausärztlichen Praxis. Mit einem Odds Ratio von 4,0 stellten sich dabei bestehende maligne Erkrankungen als stärkster Prädiktor für die Überweisungszahl heraus, während vorliegende psychosomatische oder psychische Störungen den größten Einfluss auf die Praxiskontaktzahl ausübten (OR 2,9). Ein Zusammenhang zu einer verlängerten Krankschreibung konnte lediglich für psychosomatisch/psychische Erkrankungsbilder mit einem Odds Ratio von 1,9 ermittelt werden. Für Erkrankungen des Bewegungsapparats ergab sich kein statistischer Zusammenhang zu einer erhöhten Inanspruchnahme der Leistungen des Gesundheitswesens. Darüber hinaus hatten Patienten mit Tresen-Überweisungen, im Vergleich zu den Patienten aus der Sprechstunde, eine 4,4fach erhöhte Wahrscheinlichkeit, mehr als drei Überweisungen pro Jahr in Anspruch zu nehmen. Für die hausärztliche Praxiskontaktzahl und die Arbeitsunfähigkeitsdauer ergaben sich dagegen keine statistischen Zusammenhänge. 3.1.5 Partizipations- und Informationspräferenz Die an der Untersuchung beteiligten Hausärzte wurden gebeten, jedem Studienteilnehmer den bevorzugten Interaktionsstil in der Patient-Arzt-Beziehung zuzuordnen. Gemäß der Tabelle 10 ergab die Auswertung einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen. Die Partizipationspräferenz der Patienten mit Tresen-Überweisungen wurde am häufigsten als autonom (41 %) oder partnerschaftlich (51 %) beurteilt, während nur eine geringe Zahl als paternalistisch beschrieben wurde (8 %). Auch für die meisten Patienten der Sprechstunde erfolgte die Zuordnung zum partnerschaftlichen Modell (65 %). Im Vergleich zum Kollektiv mit Tresen-Überweisungen war hier aber der Anteil der Patienten mit autonomer Partizipationspräferenz kleiner (17 %) und mehr Patienten wurden als paternalistisch eingestuft (18 %). 41 Tabelle 10: Beurteilung der Partizipationspräferenz der Patienten durch den Hausarzt Patienten aus der Sprechstunde (N=985) Patienten mit TresenÜberweisung (N=307) N (%) N (%) Autonom Partnerschaftlich n (%) 168 (17) 975 (99) Paternalistisch 630 (65) p-Wert n (%) 126 (41) 305 (99) 177 (18) 156 (51) <0,001 23 (8) Testverfahren: Chi-Quadrat-Test p-Wert bezogen auf n (%) Abkürzungen: n (%) – Anzahl von Patienten mit dieser Partizipationspräferenz (Anteil an Gesamtzahl), N (%) – Anzahl auswertbarer Fragebögen (Anteil an Gesamtzahl) Die nachfolgende Tabelle 11 zeigt die Auswertung des Autonomie-Präferenz-Index, der eine Selbsteinschätzung der Patienten ermöglicht. Patienten mit TresenÜberweisungen hatten ein höheres Informationsbedürfnis als Patienten aus der Sprechstunde (Mittelwert 93,2 vs. 91,4). In Bezug auf die Partizipationspräferenz ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen. Tabelle 11: Mittelwerte des Autonomie-Präferenz-Index (API) Patienten aus der Sprechstunde (N=985) Patienten mit TresenÜberweisung (N=307) N (%) mw (sd) N (%) mw (sd) Informationspräferenz 958 (97) 91,4 (9,5) 304 (99) 93,2 (8,1) 0,002 Partizipationspräferenz 960 (97) 46,4 (19,3) 304 (99) 46,9 (19,5) 0,694 p-Wert Testverfahren: Wilcoxon-Mann-Whitney-Test (Informationspräferenz), t-Test (Partizipationspräferenz) p-Wert bezogen auf mw (sd) Abkürzungen: mw (sd) – Mittelwert (Standardabweichung), N (%) – Anzahl auswertbarer Fragebögen (Anteil an Gesamtzahl) 3.1.6 Analyse der Non-Responder In der Überweisungsstudie wurden 591 Patienten und in der Erststudie 1185 Patienten dokumentiert, die die Kriterien zur Studienteilnahme erfüllten. Von dieser Gesamtstichprobe konnte ein Anteil von 72,7 Prozent für die Untersuchung rekrutiert werden. Die übrigen Patienten (27,3 %) lehnten entweder eine Studienmitwirkung von Beginn an ab oder sendeten den ausgehändigten Fragebogen nicht an das Institut zurück. Diese 484 Non-Responder werden in Tabelle 12 mit den 1292 Patienten verglichen, 42 die an der Befragung teilnahmen. Das durchschnittliche Alter der Responder war geringer als das der Non-Responder (49,8 vs. 55,7 Jahre). Bezüglich der Geschlechterverteilung bestand kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen. Weitere Details zum Ablauf der Patientenrekrutierung können der Abbildung 1 auf Seite 13 entnommen werden. Tabelle 12: Non-Responder-Analyse der Erststudie und der Überweisungsstudie Responder Non-Responder p-Wert Anzahl; N (%) 1292 (72,7) 484 (27,3) Alter in Jahren; mw (sd) 49,8 (17,8) 55,7 (16,7) <0,001 Weiblich; n (%) 776 (60,1) 312 (64,5) 0,101 Testverfahren: t-Test (Alter), Exakter Test nach Fisher (Geschlecht) Abkürzungen: mw (sd) – Mittelwert (Standardabweichung) Die im Rahmen der Überweisungsstudie dokumentierten Responder und NonResponder wurden einer separaten Analyse unterzogen. Hier wurde von Patienten, die die Kriterien zur Studienteilnahme erfüllten, auch die Überweisungszahl der letzten zwölf Monate dokumentiert. Gemäß der Tabelle 13 zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den zwei Gruppen. Im Vergleich zu der vorausgegangenen Erststudie konnte für die Überweisungsstudie nur ein geringerer Anteil der insgesamt angesprochenen Patienten rekrutiert werden (85,3 % vs. 47,5 %). Tabelle 13: Non-Responder-Analyse der Überweisungsstudie Responder Non-Responder p-Wert Anzahl; N (%) 281 (47,5) 310 (52,5) Alter in Jahren; mw (sd) 51,6 (17,5) 53,8 (16,5) 0,107 Weiblich; n (%) 183 (65,1) 206 (66,5) 0,795 Überweisungszahl letzte 12 M; mw (sd) 6,65 (4,30) 6,72 (5,10) 0,489 Testverfahren: t-Test (Alter), Exakter Test nach Fisher (Geschlecht), Wilcoxon-Mann-Whitney-Test (Überweisungen) Abkürzungen: M – Monate, mw (sd) – Mittelwert (Standardabweichung) 43 3.2 Patienten mit sinnvollen Überweisungen im Vergleich zu Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung 3.2.1 Beschreibung der Stichprobe In die Erststudie und die Überweisungsstudie wurden 486 Patienten eingeschlossen, die am Erhebungstag eine oder mehrere Überweisungen in Anspruch nahmen. Jeder Überweisungsvorgang wurde von den beteiligten Hausärzten als sinnvoll oder nicht sinnvoll beurteilt. Gemäß dieser hausärztlichen Einschätzung erhielten 414 Patienten ausschließlich sinnvolle und 72 Patienten mindestens eine nicht sinnvolle Überweisung. Abbildung 4 zeigt die beschriebenen Kollektive. Darüber hinaus ist dargestellt, wie viele Patienten im Rahmen der vorliegenden Überweisungsstudie rekrutiert wurden. Im Rahmen der Erststudie oder der Überweisungsstudie rekrutiert: 486 Patienten mit Überweisungen 414 Patienten mit sinnvollen Überweisungen 72 Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung Davon im Rahmen der Überweisungsstudie rekrutiert: 281 Patienten mit Überweisungen 232 Patienten mit sinnvollen Überweisungen 49 Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung Abbildung 4: Rekrutierung von Patienten mit sinnvollen Überweisungen und von Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung Tabelle 14 zeigt den Vergleich der beiden Gruppen in Bezug auf den soziodemographischen Hintergrund und die vom Hausarzt dokumentierte Dauerdiagnosenzahl. Patienten, die mindestens eine nicht sinnvolle Überweisung erhielten, hatten häufiger Abitur oder Fachabitur als Patienten mit sinnvollen Überweisungen (44 % vs. 31 %). In Bezug auf Alter, Geschlecht, Familienstand, Studium, Erwerbstätigkeitsstatus und Dauerdiagnosenzahl zeigten sich keine weiteren signifikanten Unterschiede. 44 Tabelle 14: Soziodemographischer Hintergrund und Anzahl der vom Hausarzt dokumentierten Dauerdiagnosen pro Patient Patienten mit mind. einer nicht sinnvollen Ü. (N=72) N (%) n (%) Alter in Jahren; mw (sd) 72 (100) Weiblich + Patienten mit sinnvollen Überweisungen (N=414) p-Wert + N (%) n (%) 50,6 (18,2) 414 (100) 51,2 (16,9) 0,756 72 (100) 49 (68) 414 (100) 260 (63) 0,428 Verheiratet oder fester Partner 72 (100) 56 (78) 406 (98) 297 (73) 0,469 Fachabitur oder Abitur 71 (99) 31 (44) 406 (98) 124 (31) 0,039 Fach- oder Hochschulstudium 71 (99) 20 (28) 403 (97) 97 (24) 0,458 In Erwerbstätigkeit 72 (100) 41 (57) 405 (98) 216 (53) 0,609 Anzahl Dauerdiagnosen; mw (sd) 71 (99) 4,1 (3,7) 413 (99) 4,5 (4,0) 0,511 Fragen zur Person: Testverfahren: t-Test (Alter), Exakter Test nach Fisher (Geschlecht), Chi-Quadrat-Test (Fragen zur Person), Wilcoxon-Mann-Whitney-Test (Dauerdiagnosen) p-Wert bezogen n (%) bzw. mw (sd) + wenn nicht anders angegeben Abkürzungen: mind. – mindestens, mw (sd) – Mittelwert (Standardabweichung), n (%) – Anzahl von Patienten mit soziodemographischem Kriterium (Anteil an Gesamtzahl), N (%) – Anzahl auswertbarer Fragebögen (Anteil an Gesamtzahl), Ü. – Überweisung 3.2.2 Psychische Komorbidität In Tabelle 15 ist der Vergleich der beiden Gruppen in Bezug auf die Summenwerte der in der Studie eingesetzten PHQ-D-Module dargestellt. Patienten, die mindestens eine nicht sinnvolle Überweisung erhielten, wiesen eine leicht höhere Ängstlichkeit auf als Patienten mit sinnvollen Überweisungen (Mittelwert 5,2 vs. 4,4). Hinsichtlich Depressivität, Panik und Somatisierung ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den zwei Kollektiven. 45 Tabelle 15: Summenwerte der PHQ-D-Module Depression, Panik, Andere Angststörungen und Somatoforme Syndrome Patienten mit mind. einer nicht sinnvollen Überweisung (N=72) Patienten mit sinnvollen Überweisungen (N=414) N (%) mw (sd) N (%) mw (sd) Depressivität 70 (97) 5,4 (4,3) 398 (96) 5,2 (4,9) 0,338 Panik 71 (99) 1,3 (3,7) 403 (97) 1,3 (3,5) 0,721 Ängstlichkeit 70 (97) 5,2 (3,4) 401 (97) 4,4 (3,5) 0,043 Somatisierung 69 (96) 7,8 (4,5) 392 (95) 7,2 (4,9) 0,240 p-Wert Testverfahren: Wilcoxon-Mann-Whitney-Test p-Wert bezogen auf mw (sd) Abkürzungen: mind. – mindestens, mw (sd) – Mittelwert (Standardabweichung), N (%) – Anzahl auswertbarer Fragebögen (Anteil an Gesamtzahl), PHQ-D – Gesundheitsfragebogen für Patienten Tabelle 16 zeigt die Ergebnisse des nur in der Überweisungsstudie eingesetzten GAD7-Fragebogens. Die kategoriale Analyse ergab für die Gruppe mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung häufiger die Schweregrade geringe (34 % vs. 23 %) und mittelgradige Ängstlichkeit (13 % vs. 5 %). In diesem Kollektiv bestand im Vergleich zu den Patienten mit sinnvollen Überweisungen aber seltener eine minimale Ängstlichkeit (47 % vs. 65 %). Das Signifikanzniveau erreichten diese dargestellten Unterschiede jedoch nicht. Tabelle 16: Ängstlichkeits-Schweregrade gemäß dem Generalized Anxiety Disorder-7Fragebogen (GAD-7) Patienten mit mind. einer nicht sinnvollen Ü. (N=49) Patienten mit sinnvollen Überweisungen (N=232) N (%) N (%) Minimal Gering Mittelgradig n (%) 22 (47) 47 (96) Schwer p-Wert n (%) 149 (65) 16 (34) 228 (98) 6 (13) 3 (6) 52 (23) 12 (5) 0,058 15 (7) Testverfahren: Chi-Quadrat-Test p-Wert bezogen auf n (%) Abkürzungen: mind. – mindestens, n (%) – Anzahl von Patienten mit Ängstlichkeitsschweregrad (Anteil an Gesamtzahl), N (%) – Anzahl auswertbarer Fragebögen (Anteil an Gesamtzahl), Ü. – Überweisung 46 3.2.3 Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen Der Vergleich der zwei Patientenkollektive in Bezug auf das Inanspruchnahmeverhalten ist in Tabelle 17 abgebildet. In der Gruppe mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung war die jährliche Überweisungszahl höher als bei Patienten mit sinnvollen Überweisungen (Mittelwert 7,7 vs. 5,7). In Bezug auf die hausärztlichen Praxiskontakte und die Arbeitsunfähigkeitstage der letzten zwölf Monate ergaben sich keine weiteren signifikanten Unterschiede. Tabelle 17: Inanspruchnahmeverhalten während der letzten zwölf Monate Patienten mit mind. einer nicht sinnvollen Überweisung (N=72) Patienten mit sinnvollen Überweisungen (N=414) N (%) mw (sd) N (%) mw (sd) Anzahl Überweisungen 72 (100) 7,7 (5,5) 414 (100) 5,7 (3,9) 0,013 Hausärztliche Praxiskontaktzahl 72 (100) 13,0 (9,6) 414 (100) 13,9 (11,0) 0,670 Anzahl Arbeitsunfähigkeitstage 70 (97) 4,3 (7,7) 403 (97) 7,0 (22,5) 0,947 p-Wert Testverfahren: Wilcoxon-Mann-Whitney-Test p-Wert bezogen auf mw (sd) Abkürzungen: mind. – mindestens, mw (sd) – Mittelwert (Standardabweichung), N (%) – Anzahl auswertbarer Fragebögen (Anteil an Gesamtzahl) 3.2.4 Dysfunktionale Kognitionen Der nur in der vorliegenden Überweisungsstudie verwendete Fragebogen zu Körper und Gesundheit ist in fünf Skalen gegliedert, deren Auswertung in Tabelle 18 dargestellt ist. Der Vergleich der beiden Patientengruppen ergab keine signifikanten Unterschiede. 47 Tabelle 18: Summenwerte des Fragebogens zu Körper und Gesundheit (FKG) Patienten mit mind. einer nicht sinnvollen Überweisung (N=49) Patienten mit sinnvollen Überweisungen (N=232) N (%) mw (sd) N (%) mw (sd) Katastrophisierende Bewertung 48 (98) 13,6 (6,1) 230 (99) 14,6 (6,6) 0,345 Vegetative Missempfindungen 45 (92) 3,3 (2,2) 228 (98) 3,5 (2,5) 0,700 Körperliche Schwäche 48 (98) 5,2 (3,7) 227 (98) 5,9 (4,1) 0,275 Intoleranz 48 (98) 5,1 (2,4) 229 (99) 4,7 (2,2) 0,223 Gesundheitsverhalten 48 (98) 5,9 (1,8) 229 (99) 5,8 (1,8) 0,766 p-Wert Testverfahren: t-Test p-Wert bezogen auf mw (sd) Abkürzungen: mind. – mindestens, mw (sd) – Mittelwert (Standardabweichung), N (%) – Anzahl auswertbarer Fragebögen (Anteil an Gesamtzahl) 3.2.5 Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit Tabelle 19 zeigt die Ergebnisse des nur in der vorliegenden Überweisungsstudie eingesetzten Fragebogens zur Erhebung von Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit. Beide Kollektive unterschieden sich nur in Bezug auf die Fatalistische Externalität voneinander. Hier erzielten Patienten mit sinnvollen Überweisungen im Durchschnitt höhere Summenwerte als Patienten, die mindestens eine nicht sinnvolle Überweisung erhielten (Mittelwert 15,9 vs. 13,3). Für die Dimensionen Internalität und Soziale Externalität wurden hingegen keine signifikanten Unterschiede ermittelt. Tabelle 19: Summenwerte des Fragebogens zur Erhebung von Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit (KKG) Patienten mit mind. einer nicht sinnvollen Ü. (N=49) Patienten mit sinnvollen Überweisungen (N=232) N (%) mw (sd) N (%) mw (sd) 46 (94) 25,6 (6,7) 224 (97) 24,7 (6,3) 0,388 Fatalistische Externalität 44 (90) 13,3 (5,3) 221 (95) 15,9 (7,2) 0,019 Soziale Externalität 23,1 (7,1) 223 (96) 22,0 (5,7) 0,289 Internalität 45 (92) p-Wert Testverfahren: t-Test p-Wert bezogen auf mw (sd) Abkürzungen: mind. – mindestens, mw (sd) – Mittelwert (Standardabweichung), N (%) – Anzahl auswertbarer Fragebögen (Anteil an Gesamtzahl), Ü. – Überweisung 48 3.3 Analyse der Überweisungsvorgänge 3.3.1 Dokumentation der Überweisungen Im Rahmen der Überweisungstudie und der vorausgegangenen Erststudie wurden insgesamt 632 Überweisungsvorgänge dokumentiert. Gemäß der Abbildung 5 wurden 412 Überweisungen am Tresen der Praxis und 220 Überweisungen im Rahmen der Sprechstunde ausgegeben. Überweisungsstudie Erststudie 281 Patienten erhielten insgesamt: 1011 Patienten erhielten insgesamt: 371 Überweisungen am Tresen der Praxis 261 Überweisungen 26 dieser Patienten erhielten: 41 Überweisungen am Tresen der Praxis 307 Patienten erhielten zusammen: 985 dieser Patienten erhielten: 412 Überweisungen am Tresen der Praxis 220 Überweisungen in der Sprechstunde Abbildung 5: Am Tresen und in der Sprechstunde ausgestellte Überweisungen 3.3.2 Fachgebiete und Anteil nicht sinnvoller Überweisungen Vor Studienbeginn wurden die beteiligten Hausärzte gebeten, zwei Fragestellungen zu beantworten. Die zwölf Ärzte sollten schätzen, wie viele Überweisungen im Quartal am Tresen ausgegeben werden und welcher Anteil davon als nicht sinnvoll einzustufen ist. Tabelle 20 zeigt den genauen Wortlaut und die Ergebnisse dieser Befragung. Um Anonymität zu gewährleisten, wurden die Namen der Hausärzte durch die Buchstaben A bis L ersetzt. Gemäß der Einschätzung der mitwirkenden Ärzte werden im Mittel 50,7 Prozent der Überweisungen außerhalb der regulären Sprechstunde am Tresen der Praxis ausgegeben. Des Weiteren seien durchschnittlich 38,2 Prozent der Tresen-Überweisungen als nicht sinnvoll einzustufen. 49 Tabelle 20: Häufigkeit und Sinnhaftigkeit von Tresen-Überweisungen (beurteilt durch die an der Studie mitwirkenden Hausärzte) Arzt A B C D E F G H I J K L min max mw (sd) Frage 1* 50 33 50 50 60 25 70 75 60 40 55 40 25 75 50,7 (14,6) Frage 2** 67 33 50 50 5 10 40 45 55 30 40 33 5 67 38,2 (17,7) Werte sind % Abkürzung: max – Maximum, min – Minimum, mw (sd) – Mittelwert (Standardabweichung) * Frage 1: „Was schätzen Sie, wie viele der Überweisungen im Quartal werden außerhalb der regulären Sprechstunde am Tresen der Praxis ausgestellt (sogenannte Tresen-Überweisung)?“ ** Frage 2: „Was denken Sie, wie viel Prozent dieser Tresen-Überweisungen sind als nicht sinnvoll einzustufen?“ Zusätzlich zu dieser allgemeinen Einschätzung wurden die Hausärzte im Laufe der Erststudie und der Überweisungsstudie gebeten, jeden einzelnen dokumentierten Überweisungsvorgang einzustufen. Insgesamt beurteilten die Ärzte 12,3 Prozent aller Überweisungen als nicht sinnvoll. Gemäß der Tabelle 21 waren 13,6 Prozent der am Tresen und 10,0 Prozent der in der Sprechstunde ausgegebenen Überweisungen nicht sinnvoll, wobei dieser Unterschied keine statistische Signifikanz erreichte. Die Überweisungsvorgänge richteten sich an insgesamt 36 verschiedene Fachrichtungen und Teilgebiete der Medizin. Diese wurden zur vereinfachten Auswertung zu zwölf Fachdisziplinen zusammengefasst. Detaillierte Informationen diesbezüglich können der Legende der Tabelle 21 entnommen werden. Die Aufschlüsselung nach Fachrichtung ergab, dass Patienten aus der Sprechstunde am häufigsten Überweisungen in die Innere Medizin (15,5 %) erhielten, gefolgt von Überweisungen in die Orthopädie (13,6 %), Gynäkologie (10,9 %) und Dermatologie (10,4 %). Im Vergleich dazu richteten sich 17,8 Prozent der am Tresen ausgegebenen Überweisungen an die Gynäkologie, 15,5 Prozent an die Innere Medizin, 14,6 Prozent an die Augenheilkunde und 12,9 Prozent an die Dermatologie. Signifikante Unterschiede zwischen beiden Kollektiven zeigten sich lediglich für die dermatologischen Überweisungen. So wurden 41,5 Prozent der am Tresen ausgestellten Überweisungen von den Hausärzten als nicht sinnvoll eingestuft, im Vergleich zu 13,0 Prozent nicht sinnvoller DermatologieÜberweisungen, die Patienten aus der regulären Sprechstunde erhielten. 50 Tabelle 21: Fachgebiet und Anteil nicht sinnvoller Überweisungen Überweisung aus der Sprechstunde Davon nicht sinnvoll TresenÜberweisung Davon nicht sinnvoll p-Wert Gesamtzahl Überweisungen 220 (100,0) 22 (10,0) 412 (100,0) 56 (13,6) 0,206 Augenheilkunde 16 (7,2) 2 (12,5) 60 (14,6) 2 (3,3) 0,193 Chirurgie 13 (5,9) 1 (7,7) 9 (2,2) 0 (0,0) 1,000 Dermatologie 23 (10,4) 3 (13,0) 53 (12,9) 22 (41,5) 0,018 Gynäkologie 24 (10,9) 0 (0,0) 73 (17,8) 0 (0,0) 1,000 HNO 16 (7,2) 5 (31,3) 22 (5,4) 8 (36,4) 1,000 Innere Medizin 34 (15,5) 3 (8,8) 64 (15,5) 1 (1,6) 0,119 Neurologie 16 (7,3) 1 (5,9) 19 (4,6) 3 (16,7) 0,608 Nuklearmedizin/Radiologie 16 (7,2) 0 (0,0) 7 (1,7) 0 (0,0) 1,000 Orthopädie 30 (13,6) 4 (13,3) 50 (12,2) 16 (32,0) 0,069 Psychiatrie/Psychotherapie 15 (6,8) 0 (0,0) 32 (7,8) 2 (6,3) 1,000 Urologie 8 (3,6) 1 (12,5) 16 (3,9) 1 (6,3) 1,000 Sonstige 9 (4,1) 2 (22,2) 7 (1,7) 1 (14,3) 1,000 Testverfahren: Chi-Quadrat-Test Werte sind n (%) Zu diesen Fächern wurden folgende Teilgebiete zugeordnet: - Chirurgie: Chirurgie, Gefäßchirurgie, Handchirurgie, Neurochirurgie, plastische Chirurgie, Transplantationschirurgie - Innere Medizin: Angiologie, Diabetologie, Endokrinologie, Gastroenterologie, Innere Medizin, Kardiologie, Nephrologie, Onkologie, Phlebologie, Pulmonologie, Rheumatologie, Toxikologie - Sonstige: Allergologie, Allgemeinmedizin, D-Arzt, Proktologie, Schmerztherapie, physikalische Medizin, Psychosomatik 3.3.3 Angaben zum Grund der Überweisung Die Überweisungsstudie erfasste nicht nur die Fachrichtung, sondern auch die jeweils auf dem Schein vermerkten Informationen zur Krankengeschichte des Patienten. Gemäß der Tabelle 22 wurde auf 21 Prozent der insgesamt 371 Tresen-Überweisungen keine Angabe zum Grund der Überweisung notiert oder „auf Patientenwunsch“ vermerkt. Auch wenn auf den Überweisungen Angaben gemacht wurden, waren diese zum Teil sehr unscharf formuliert, wie zum Beispiel der Vermerk „Ausschluss gynäkologische Erkrankung“ auf Überweisungen in die Gynäkologie. Beispiele für je exakte oder vage Formulierungen finden sich in Tabelle 22. Die genannten Beispiele sind dabei wortwörtliche Transkriptionen des Textes der Überweisungsscheine. 51 Tabelle 22: Angaben zum Grund der Überweisung Keine Angabe oder „Auf Patientenwunsch“ Formulierter Auftrag Beispiele für exakte Formulierung Beispiele für vage Formulierung Alle (n=371) 79 (21) 292 (79) Augenheilkunde (n=56) 11 (20) 45 (80) -Netzhautablösung -Nachsorge Grauer Star -Rezidivierende Iritis -Sehstörung -Sehschwäche Chirurgie (n=8) 4 (50) 4 (50) -Schwerste Coxarthrose -Oberschenkelfraktur -Leberzirrhose Dermatologie (n=50) 16 (32) 34 (68) -Morbus Bowen -Chronische Hautveränderung Knie -Neurodermitis -Ausschluss Hauterkrankung -Hautveränderung -Muttermal 12 (20) 49 (80) -Kontrazeption -Vorsorgeuntersuchung -Z.n. Mamma-Karzinom -Endometriose -Ausschluss gynäkologische Erkrankung -fachfremde gynäkologische Erkrankung HNO (n=19) 8 (42) 11 (58) -Verdacht auf Otitis -Zerumen -Infekt -Schwindel Innere Medizin (n=58) 7 (12) 51 (88) -Verlaufskontrolle multifokal atriale Tachykardie -Koloskopie bei massiven Stuhlveränderungen -Myalgie Neurologie (n=17) 4 (24) 13 (76) -Keilbeinmeningeom -Epilepsie -Multiple Sklerose -Schlafstörung Nuklearmedizin/ Radiologie (n=7) 1 (14) 6 (86) -Struma-Knoten: bitte Schilddrüsen-Szinti -Röntgen-Kontrolle Infiltrat bei Z.n. Pneumonie Orthopädie (n=47) 5 (11) 42 (89) -Kreuzbandruptur -Z.n. TEP Knie links -Entzündung der Achillessehne -Kniebeschwerden -Z.n. Operation Psychiatrie/ Psychotherapie (n=27) 7 (26) 20 (74) -Depression -Anpassungsstörung -Angststörung -Psychosomatik -Gesprächstherapie Urologie (n=15) 4 (27) 11 (73) -Prostata-Karzinom -Blasen-Karzinom -Nephrolithiasis -Ausschluss Prostataerkrankung -Nachsorge Sonstige (n=6) 0 (0) 6 (100) Gynäkologie (n=61) Werte sind n(%) Die Beispiele sind wortwörtliche Transkriptionen des auf dem Überweisungsschein vermerkten Textes. Abkürzungen: Z.n. – Zustand nach 52 4 DISKUSSION Im hausärztlichen Praxisalltag werden Überweisungen häufig ohne direkten Arztkontakt außerhalb der regulären Sprechstunde ausgestellt. Entgegen der ursprünglichen Hypothese handelt es sich hierbei nicht um Patienten mit einer erhöhten psychischen Komorbidität. Die Studie bestätigte den Zusammenhang von psychischen Störungen mit einer verstärkten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Insgesamt wurde etwa jeder zehnte dokumentierte Überweisungsvorgang von den beteiligten Hausärzten als nicht sinnvoll beurteilt. Bei einer von fünf Tresen-Überweisungen fehlte eine Angabe zum Grund der Überweisung. 4.1 Diskussion der Methoden 4.1.1 Datenerhebung und Auswertung In der Erststudie und der Überweisungsstudie wurde eine Gesamtzahl von 1292 Patienten untersucht. Diese hohe Patientenzahl gehört, wie auch die große Zahl teilnehmender Hausarztpraxen, zu den Stärken der vorliegenden Erhebung. Die Patientenrekrutierung der Erststudie erfolgte in 13 verschiedenen Praxen. Die nachfolgende Überweisungsstudie wurde nur in zwölf dieser Praxen durchgeführt, da in einer Praxis nicht alle geforderten Daten erhoben werden konnten. Demnach waren die Rekrutierungsorte beider Erhebungen nahezu identisch. Dies ist eine gute Voraussetzung, um einer verzerrten Auswahl von Studienteilnehmern im Sinne eines Selektionsbias vorzubeugen. Die beteiligten Praxen wurden mittels Faxaufruf rekrutiert. Zur Gewährleistung von Repräsentativität wurden sowohl ländliche als auch städtische Praxen aus dem Lehrärzteregister des Instituts für Allgemeinmedizin der TU München ausgewählt. Dennoch ist denkbar, dass sich die im südlichen Bayern ermittelten Zusammenhänge in anderen deutschen Bundesländern abweichend darstellen könnten. In der Vergangenheit wurden zahlreiche Studien zu den Unterschieden zwischen Patientengruppen aus verschiedenen Regionen Deutschlands durchgeführt. Aus historischen Gründen wurden dabei besonders häufig Kollektive aus den alten und neuen Bundesländern miteinander verglichen. Die Ost- und Westdeutschen unterschieden sich unter anderem in Bezug auf die Prävalenz psychischer Erkrankungen, das Inanspruchnahmeverhalten und das Partizipationsbedürfnis voneinander. So leiden Personen aus den 53 neuen Bundesländern seltener an Depressionen, aber häufiger an somatoformen Störungen. Des Weiteren weisen sie eine etwas höhere Praxiskontaktzahl auf und präferieren weniger oft eine partizipative Entscheidungsfindung als das westdeutsche Vergleichskollektiv (Atzpodien 2009; Hamann 2012). Da die vorliegende Erhebung die genannten Parameter untersucht, kann eine mögliche Abhängigkeit der ermittelten Zusammenhänge von der Herkunft der Studienteilnehmer nicht ausgeschlossen werden. Folglich sollten die Ergebnisse durch weitere Untersuchungen von Patienten aus anderen Regionen Deutschlands bestätigt werden. Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen, wurde bei der Planung von der Erststudie und der Überweisungsstudie auf einen möglichst identischen Ablauf geachtet. Da sich aber die Rekrutierung von Patienten mit Tresen-Überweisungen in der Erststudie schwierig gestaltete, musste für die Überweisungsstudie ein geringfügig abweichendes Durchführungskonzept entwickelt werden. Hier erhielten die Patienten ein vorfrankiertes Kuvert mit dem Fragebogen, der zu Hause beantwortet und an das Institut für Allgemeinmedizin gesendet werden konnte. Nach Eingang der Materialien wurde eine Aufwandsentschädigung in Höhe von zehn Euro an das Konto des Studienteilnehmers überwiesen. Bei der zuvor durchgeführten Erststudie wurde der Fragebogen hingegen vor Ort in der Praxis ausgefüllt. Auf die Zahlung eines Probandenentgelts konnte hier verzichtet werden, da auch ohne finanziellen Anreiz eine ausreichende Zahl von Patienten zur Studienteilnahme bereit war. Aus diesem Grund kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Überweisungsstudie eine verzerrte Auswahl von Patienten im Sinne eines Selektionsbias stattgefunden hat. Die gezahlten zehn Euro könnten insbesondere finanziell schwächer gestellte Patienten zur Studienteilnahme motiviert haben. Bis heute existieren nur wenige Untersuchungen, die den Einfluss von Aufwandsentschädigungen auf die Stichprobenzusammensetzung evaluieren. Als Beispiel kann eine Fragebogenerhebung von über 3000 kanadischen Haushalten genannt werden. In dieser Studie erhielt die Fallgruppe ein Probandenentgelt, während an die Kontrollgruppe kein Geld gezahlt wurde. Durch die Aufwandsentschädigung wurde eine signifikante Steigerung der Rücklaufquote erreicht. Die Analyse der soziodemographischen Merkmale zeigte, dass das Probandenentgelt nicht zur Selektion einer bestimmten Subgruppe geführt hatte. So wiesen die rekrutierten Stichproben keine Unterschiede in Bezug auf das Geschlecht, das Alter, den Bildungsstand oder das Einkommen auf (Warriner 1996). Gemäß einer systematischen Übersichtsarbeit konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden, 54 ob die Zahlung einer Aufwandsentschädigung das Auftreten von Selektionsbias begünstigt (Singer 2012). Vermutlich wurden die in Kapitel 4.2.1 diskutierten Ergebnisse demnach nicht durch das eingesetzte Probandenentgelt, sondern durch tatsächliche Unterschiede hervorgerufen. Folglich enthält das Kollektiv mit Tresen-Überweisungen mehr Frauen und verheiratete oder in fester Partnerschaft lebende Personen als die Patientengruppe der regulären Sprechstunde. Die vorliegende Erhebung beurteilt das Inanspruchnahmeverhalten anhand der Arbeitsunfähigkeitsdauer, der Überweisungszahl und der Praxiskontaktrate. Vor allem außerdeutsche Studien geben darüber hinaus häufig weitere Parameter für das Inanspruchnahmeverhalten an, wie beispielsweise die Zahl der Krankenhaustage oder Facharztbesuche (Barsky 2006; Ford 2004; Pinkhasov 2010; MacKay 2010). Während in diesen Ländern zentrale Datenregister zu den gewünschten Informationen existieren, gestaltet sich die Forschungssituation in Deutschland weitaus komplizierter. Hier findet weder eine strukturierte Informationserfassung, beispielsweise in Form der elektronischen Gesundheitskarte statt, noch fließen alle medizinischen Daten beim Hausarzt zusammen. Aus diesem Grund wurden in einigen deutschen Studien die Patienten selbst um Angabe der Inanspruchnahmeparameter gebeten (Schmitz 2002; Rattay 2013). Da die Datengewinnung der vorliegenden Erhebung jedoch möglichst objektiv erfolgen sollte, wurden die untersuchten Werte aus den elektronischen Behandlungsunterlagen des Hausarztes entnommen. Auf diese Weise konnten aber nicht alle gewünschten Parameter für das Inanspruchnahmeverhalten erhoben werden. Dazu gehören unter anderem die Krankenhaustage. Dieser Wert besitzt große Bedeutung, da die Krankenhauskosten in Deutschland den größten Ausgabenblock der gesetzlichen Krankenkassen darstellen (Bundesministerium für Gesundheit 2012). Ein zweites Beispiel ist die Facharztkontaktrate. Eine in den USA durchgeführte Erhebung zeigte, dass immerhin 80 Prozent der überwiesenen Patienten tatsächlich beim jeweiligen Facharzt vorstellig werden (Forrest 2007). Demnach kann die in der vorliegenden Studie erhobene Überweisungszahl vermutlich als grober Indikator für die Facharztkontaktzahl dienen, insbesondere da die Untersuchung noch zu Zeiten der Praxisgebühr mit der damit verbundenen höheren Überweisungsrate durchgeführt wurde. Nach Zahlung der zehn Euro konnten die Patienten allerdings auch in dieser Zeit den gewünschten Arzt aufsuchen. Aus diesem Grund dürfte die in der Studie ermittelte Überweisungszahl die tatsächliche Facharztbesuchsrate bei Weitem unterschätzen. Diese Überlegungen werden von einer Erhe55 bung aus Baden-Württemberg untermauert. Im Jahr 2012 suchten die bei der AOK versicherten Patienten etwa vier Mal einen Spezialist mit einer hausärztlichen Überweisung auf. Hinzu kamen zwei weitere Facharztkontakte ohne vorherige Überweisung durch den Hausarzt (Gerlach 2014). Die in der vorliegenden Erhebung analysierten Inanspruchnahmeparameter wurden den elektronischen Behandlungsunterlagen des jeweiligen Patienten entnommen. Die Recherche gestaltete sich anspruchsvoll, da in den teilnehmenden Praxen verschiedene Praxissoftwaresysteme verwendet werden. Ein Teil der Programme ermöglichte die automatische Zählung der genannten Parameter. In anderen Praxen hingegen mussten die Werte manuell ausgezählt werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass bei dieser Vorgehensweise vereinzelte Fehler aufgetreten sind. Diese sind jedoch zufälliger Natur und können zu keiner systematischen Verzerrung der Ergebnisse geführt haben. Gemäß dem Kapitel 1.1.2 war die Thematik der Sinnhaftigkeit von Überweisungen bisher nur selten Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Dafür gibt es vielfältige Gründe. Eine entscheidende Rolle spielt aber sicherlich, dass sich die Abgrenzung einer sinnvollen von einer nicht sinnvollen Überweisung schwierig gestaltet. Einige Studien zogen hierfür lokale Leitlinien als Referenz heran (Fertig 1993), andere baten die jeweils behandelnden Ärzte um ihre Einschätzung (Schneider 2005). Weitere Erhebungen untersuchten, ob sich aus der Überweisung Konsequenzen für die Diagnostik und Therapie des Patienten ergaben (Rosemann 2006). In der vorliegenden Untersuchung beurteilten die Hausärzte selbst die Sinnhaftigkeit der ausgestellten Überweisungen. Diese Verfahrensweise muss fraglos als Limitation dieser Erhebung gelten. So beruht diese Klassifikation lediglich auf der subjektiven Einschätzung des Hausarztes. Ein Bias in Richtung sozialer Erwünschtheit könnte zu einer Unterschätzung der Zusammenhänge zwischen nicht sinnvollen Überweisungen und Parametern, wie der psychischen Komorbidität, geführt haben. Darüber hinaus besaßen die aus dem Lehrärzteregister rekrutierten Hausärzte vermutlich ein besonders hohes Interesse an der Thematik. Der Vergleich zu Hausärzten ohne Lehrarzttätigkeit könnte Unterschiede in Bezug auf die Häufigkeit und Richtung von nicht sinnvollen Überweisungen aufzeigen. Des Weiteren ist fraglich, ob der Hausarzt im Nachhinein immer in der Lage war, die Tresen-Überweisungen zutreffend zu klassifizieren. Bei am Tresen ausgestellten Überweisungen wird der Arzt nicht in jedem Fall 56 in den Entscheidungsprozess eingebunden und kann später nur vermuten, aus welchem Grund der Patient die Vorstellung bei einem anderen Facharzt für notwendig erachtete. Eine Studienkonzeption mit einer weniger störanfälligen Beurteilung gestaltet sich in Deutschland aber schwierig. Mithilfe des Vergleichs zu lokalen Leitlinien hätte nur eine geringe Zahl von Überweisungen beurteilt werden können, da im primärärztlichen Bereich bisher nur zu ausgewählten Erkrankungsbildern Handlungsempfehlungen existieren (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. 2014). Auch die Überprüfung der diagnostischen und therapeutischen Konsequenzen einer Überweisung ist in Deutschland nicht ohne Weiteres möglich. Trotz der Berichtspflicht der Spezialisten wird dem Hausarzt nur bei einem Teil der Überweisungen ein Arztbrief zugestellt. Eine Untersuchung der Überweisungen in die Orthopädie ergab zum Beispiel, dass der Hausarzt in nur etwa einem Drittel der Fälle einen Bericht des Kollegen erhielt (Chenot 2009). In Deutschland erschwert dieser ungenügende Informationsfluss die Erforschung der Patientenströme zwischen Hausarzt und Spezialist. Gemäß dem Kapitel 1.3.2 üben die bei Patienten bestehenden Erkrankungen einen wesentlichen Einfluss auf deren Inanspruchnahmeverhalten aus. Um diesen Zusammenhang zu erfassen, wurden die in den elektronischen Behandlungsunterlagen vermerkten Dauerdiagnosen erhoben (Definition siehe Kapitel 1.3.2, Seite 14). Diese sind zur Abbildung der Morbidität der Patienten aber nur bedingt geeignet. Hausärzte können Dauerdiagnosen aus dem Vorquartal übernehmen, obwohl diese nicht mehr aktuell oder behandlungsbedürftig sind. Dies könnte einerseits zu einer Überschätzung der Krankheitslast der Patienten geführt haben. Andererseits besteht das Risiko, die Morbidität zu unterschätzen, da der Hausarzt nicht immer über alle Erkrankungen des Patienten unterrichtet wird. Im Vergleich zu Ländern mit einem Primärarztsystem fließen in Deutschland nicht alle Informationen beim Hausarzt zusammen. Patienten können den Spezialist der Wahl aufsuchen (Linden 2004), ohne dass dem Hausarzt die Ergebnisse dieser Konsultation mitgeteilt werden. Wie bereits im vorausgegangenen Abschnitt dargelegt, sind aber auch ausgestellte Überweisungen keine Garantie dafür, dass Hausärzte über die Facharztbesuche ihrer Patienten informiert werden. Auch kodieren die Hausärzte vermutlich nicht alle beim Patienten bestehenden Erkrankungen. In der ICD-10-GM gilt dies wohl besonders für die F-Diagnosen. Hierbei handelt es sich um die Verschlüsselungen für psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen. Das Beschlussprotokoll des Deutschen Ärztetags aus dem Jahr 2005 forderte 57 die Ärzte auf, bei der Dokumentation dieser Diagnosen besondere Sorgfalt walten zu lassen (Maas 2005). In der vorliegenden Studie ergab der Vergleich der Dokumentationsleistung der einzelnen Hausärzte starke interindividuelle Unterschiede. Während einer der Ärzte auch bestehende Fußanomalitäten erfasste, beschränkte sich ein anderer auf die Kodierung von schwerwiegenden Erkrankungen. Hieraus wird ein weiterer Nachteil der Verwendung von Dauerdiagnosen ersichtlich. Der Schweregrad der einzelnen Diagnosen ist nicht miteinander vergleichbar. Die Ziffer C25.0 steht in der ICD-10-GM zum Beispiel für eine bösartige Neubildung des Pankreaskopfs, E66.0 verschlüsselt hingegen eine Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr (Graubner 2012). Um dieser Varianz Rechnung zu tragen, wurden die einzelnen Dauerdiagnosen zu 27 Diagnosen, wie beispielsweise schwerer Herzerkrankung oder maligner Erkrankung, zugeordnet. Die auf diese Weise ermittelten Prävalenzraten lagen dabei in der gleichen Größenordnung wie in anderen Erhebungen ermittelte Werte. In der vorliegenden Untersuchung litten zum Beispiel etwa 29 Prozent der Teilnehmer an einer arteriellen Hypertonie, die DETECT-Studie ergab hingegen eine Prävalenz von 35,5 Prozent (Targets and Essential Data for Commitment of Treatment) (Labeit 2012). Entsprechend der „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ bestand bei 2,5 Prozent der Befragten eine rheumatoide Arthritis (Fuchs 2013), in der vorliegenden Untersuchung lag die Häufigkeit dieser Erkrankung zwischen 2,1 und 2,3 Prozent. Die Bestimmung von Prävalenzraten war jedoch nicht Ziel dieser Erhebung. Vielmehr sollte die Verwendung von Dauerdiagnosen den Vergleich der Morbidität verschiedener Patientenkollektive ermöglichen. Das umfangreiche Datenmaterial wurde mit Hilfe einer Vielzahl von statistischen Tests ausgewertet. Dieses multiple Testen birgt das Risiko einer Alphafehler-Kumulierung. Signifikante Ergebnisse könnten, statt tatsächliche Unterschiede abzubilden, lediglich durch Zufall entstanden sein. Da die verschiedenen Ergebnisse der vorliegenden Studie aber stets in dieselbe Richtung zeigten, ist eine hohe Aussagekraft dennoch gewährleistet. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit basieren auf der Analyse einer Stichprobe von insgesamt 1292 Patienten. Weitere 484 Patienten wurden kontaktiert, die aber entweder von Beginn an eine Studienteilnahme ablehnten oder den ausgehändigten Fragebogen nicht an das Institut zurücksendeten. Folglich lag die Rücklaufquote bei 72,7 58 Prozent – ein Wert, der als gut bewertet werden kann (Evans 1991). In Bezug auf das Geschlechterverhältnis unterschieden sich Responder und Non-Responder nicht voneinander. Die Analyse der Altersverteilung ergab jedoch für die Non-Responder ein im Durchschnitt höheres Alter (55,7 vs. 49,8 Jahre). An der vorliegenden Erhebung hat folglich eine größere Zahl von jüngeren Patienten teilgenommen. Dies könnte zu einer Unterschätzung der Krankheitslast und Inanspruchnahmeparameter geführt haben, da ein niedrigeres Alter mit einer geringeren Zahl von Erkrankungen, Arztbesuchen und Überweisungen einhergeht (Rocca 2014; Laux 2008). Da sich die Rekrutierung von Patienten mit Tresen-Überweisungen schwierig gestaltete, war die Response-Rate der Überweisungsstudie (47,5 %) weitaus geringer als die der Erststudie (85,3 %). Um mehr Patienten zur Studienteilnahme zu motivieren, wurden in der Überweisungsstudie vorfrankierte Kuverts und eine Aufwandsentschädigung eingesetzt. Diese zwei Maßnahmen sind gemäß den Ergebnissen einer systematischen Übersichtsarbeit sehr effektive Strategien zur Steigerung der Rücklaufquote (Edwards 2002). Dennoch nahmen lediglich 47,5 Prozent der insgesamt kontaktierten Patienten an der Untersuchung teil. Zusätzlich zu Alter und Geschlecht wurde im Rahmen der Überweisungsstudie auch die jährliche Überweisungszahl von allen Patienten erhoben. Der Vergleich der Responder und Non-Responder zeigte keine Unterschiede in Bezug auf diese Parameter auf. Da ein Bias durch die Non-Responder (non-response bias) aber nicht abschließend ausgeschlossen werden kann, muss die niedrige Rücklaufquote als Limitation der vorliegenden Erhebung gelten. 4.1.2 Verwendete Fragebögen Der in der vorliegenden Studie verwendete Fragebogen enthielt vier Module des Gesundheitsfragebogens für Patienten. Gemäß dem Kapitel 2.2.2 weist der auf Selbsteinschätzung basierende PHQ-D gute diagnostische Testeigenschaften bei der Detektion von psychischen Erkrankungen auf. Dennoch stellen die nach PHQ-D diagnostizierten Störungen keine Erkrankungen im Sinne der ICD-10-GM dar. Damit der behandelnde Arzt beispielsweise die Diagnose einer depressiven Episode stellen kann, muss er das Vorliegen definierter Haupt- und Nebensymptome überprüfen. Anschließend werden andere Ursachen, wie Demenzen oder Suchterkrankungen, ausgeschlossen. Es folgt die Abgrenzung der verschiedenen depressiven Störungen und 59 die Bestimmung des Schweregrads der Erkrankung (Härter 2010). Positive Ergebnisse im PHQ-D-Screening sind daher lediglich Hinweise für das Vorliegen einer Erkrankung und müssen durch Ärzte validiert werden. Eine ärztliche Überprüfung war in der vorliegenden Erhebung aufgrund des hohen Mehraufwands aber nicht möglich. Aus diesem Grund sollte die Interpretation der Ergebnisse zur psychischen Komorbidität mit Vorsicht erfolgen. Eine Limitation dieser Studie ist die mögliche Unterschätzung der Häufigkeit psychischer Erkrankungen. Gegebenenfalls haben Studienteilnehmer aus Angst vor dem Missbrauch ihrer Daten einen Teil der Fragen, wie zum Beispiel zur Suizidalität, nicht wahrheitsgemäß beantwortet. Zudem überprüfen die PHQ-D-Skalen nur die Symptome der letzten zwei bis vier Wochen. Aus diesem Grund könnten psychisch Kranke, die sich zum Erhebungszeitpunkt in Remission oder unter erfolgreicher Therapie befanden, nicht die Diagnosekriterien des PHQ-D erfüllt haben. Ziel dieser Studie war jedoch, wie im vorausgegangen Kapitel erwähnt, nicht die Bestimmung von Prävalenzraten, sondern der Vergleich der Komorbidität verschiedener Patientenkollektive. In der Auswertung wurden deshalb nicht nur die Häufigkeiten der nach PHQ-D diagnostizierten Störungen, sondern auch die Ergebnisse der metrischen Analyse angegeben. Diese Durchschnittswerte sind geeignet, um Gruppenunterschiede abzubilden. Patienten können in unterschiedlichem Ausmaß in den medizinischen Entscheidungsprozess einbezogen werden. Je nachdem welche Position Arzt und Patient im Gespräch einnehmen, werden die verschiedenen Vorgehensweisen in der Fachliteratur als autonom, partnerschaftlich oder paternalistisch beschrieben. In der vorliegenden Studie wurde das Partizipations- und Informationsbedürfnis der Patienten mithilfe des Autonomie-Präferenz-Index beurteilt. Dieser Fragebogen besitzt unter anderem eine gute Retest-Reliabilität und interne Konsistenz (Details siehe Kapitel 2.2.3). Gleichzeitig weisen aber die Items der Informationspräferenz-Skala wenig Varianz und sehr starke Deckeneffekte auf (Giersdorf 2004). Verschiedene Forschungsprojekte widmeten sich deshalb der Aufgabe den API weiterzuentwickeln, mit dem Ziel die Testgütekriterien zu verbessern. Bei der Durchführung der vorliegenden Studie standen diese neu entwickelten Instrumente, darunter die CDMS-Skala (Clinical Decision Making Style), aber noch nicht zur Verfügung (Puschner 2013). Ohnehin ist eine Fragebogenerhebung nur bedingt dazu geeignet, den Patienten die gewünschte Interaktionsweise präzise zuzuordnen. So ist die Kommunikation zwischen Arzt und Patient ein höchst 60 komplexer Prozess, der durch kulturelle, krankheits- und persönlichkeitsbezogene Faktoren beeinflusst wird. Eine Erhöhung der Aussagekraft der Messung ist aber möglich, indem die subjektive Einschätzung des Patienten durch eine Fremdbeurteilung ergänzt wird (Giersdorf 2004). In der vorliegenden Studie wurde die Partizipationspräferenz der Patienten aus diesem Grund nicht nur mithilfe des API, sondern ebenfalls durch die beteiligten Hausärzte eingestuft. Dysfunktionale Kognitionen sollen bei der Entwicklung einer somatoformen Störung von Bedeutung sein. Der in der vorliegenden Erhebung verwendete Fragebogen zu Körper und Gesundheit weist bei der Erfassung dieser Gedankenmuster eine gute diagnostische Leistung auf (Details siehe Kapitel 2.2.4). Der FKG überprüft fünf verschiedene Dimensionen und hat daher eine höhere Aussagekraft als andere in diesem Bereich verwendete Instrumente. Mithilfe der 31 Items ist eine differenzierte Beurteilung der Gedankenmuster von Patienten möglich. Es gilt jedoch zu bedenken, dass bis heute nicht abschließend geklärt ist, auf welche Weise dysfunktionalen Kognitionen entstehen und in welchem Ausmaß sie zur Entwicklung und Aufrechterhaltung einer somatoformen Störung beitragen (Hiller 1997). Individuelle Kontrollüberzeugen zu Krankheit und Gesundheit beeinflussen die Entwicklung von psychischen Störungen. Der in der vorliegenden Erhebung verwendete KKG erfasst diese individuellen Vorstellungen und überprüft die drei Dimensionen Internalität, fatalistische und soziale Externalität (Definitionen siehe Kapitel 1.3.2, Seite 16). Gemäß dem Kapitel 2.2.5 weist der Fragebogen eine mittlere Reliabilität und Validität auf (Lohaus 1989). Gleichwohl werden der KKG und englischsprachige Versionen weltweit zur Erforschung vielfältiger Themengebiete eingesetzt (Schneider 2006; Berglund 2014; Konkolÿ Thege 2014; Härkäpää 1991). In jüngster Vergangenheit ergaben Studien eine mögliche Überlegenheit vierdimensionaler Konzepte gegenüber der zuvor favorisierten dreifaktoriellen Lösung. Demnach kann die soziale Externalität weiter in „Doctors“ und „Other people“ unterteilt werden, je nachdem ob Patienten glauben, dass Ärzte oder nahestehende Personen das Auftreten von Lebensereignissen beeinflussen (Wallston 1994; Otto 2011). 61 4.2 Diskussion der Ergebnisse 4.2.1 Vergleich von Patienten aus der regulären Sprechstunde mit Patienten, die Überweisungen am Tresen erhalten Patienten mit Tresen-Überweisungen werden in der vorliegenden Studie mit Patienten aus der regulären Sprechstunde verglichen. In Bezug auf die psychische Komorbidität zeigten sich keine relevanten Gruppenunterschiede. Der Vergleich der Dauerdiagnosen ergab für Patienten mit Tresen-Überweisungen mehr chronisch internistische und maligne Erkrankungen, während bei Patienten aus der regulären Sprechstunde häufiger Suchterkrankungen vorlagen. Insgesamt nahmen die Patienten eine hohe Zahl von Überweisungen in Anspruch und suchten häufig die hausärztliche Praxis auf. Patienten mit Tresen-Überweisungen verlangten dabei erheblich mehr Überweisungen, suchten aber die Praxis seltener auf, als Patienten aus der regulären Sprechstunde. Psychische Erkrankungen waren deutlich mit einer erhöhten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen assoziiert. Patienten mit Tresen-Überweisungen hatten ein höheres Informationsbedürfnis als Patienten der regulären Sprechstunde. Während die Auswertung der Partizipationspräferenz nach Selbsteinschätzung der Patienten keinen Unterschied ergab, zeigte die hausärztliche Beurteilung dieses Parameters bedeutende Gruppendifferenzen auf. 4.2.1.1 Beschreibung der Stichprobe Obwohl das Ausstellen von Tresen-Überweisungen kein seltenes Ereignis im Praxisalltag ist, wurde diese Thematik bisher noch nie in Studien aus Deutschland behandelt. Die Frage, welche Patientencharakteristika mit der verstärkten Inanspruchnahme dieser Überweisungen einhergehen, konnte also bisher nicht beantwortet werden. Die vorliegende Untersuchung ergab, dass insbesondere verheiratete oder in fester Partnerschaft lebende Personen Tresen-Überweisungen erhielten. Verschiedene Studien bestätigten den lebensverlängernden Effekt der Ehe (Brockmann 2002). Zur Frage, wie aber der Familienstand das Überweisungsverhalten beeinflusst, können nur Vermutungen angestellt werden. In der Literatur findet sich eine Erhebung, die die Facharztbesuchsrate von Personen unterschiedlicher Familiensituationen vergleicht. Während Verheiratete den Facharzt etwas öfter mit Überweisung durch den Hausarzt aufsuchten, wurden Alleinstehende häufiger ohne Überweisung vorstellig (Lüngen 62 2012). Die in der vorliegenden Studie für Verheiratete ermittelte höhere Zahl von Tresen-Überweisungen könnte folglich ein Resultat dessen sein, dass Verheiratete generell mehr Überweisungen in Anspruch nehmen. Das Überweisungsverhalten der Patienten wurde aber nicht nur durch den Familienstand, sondern auch durch das Geschlecht beeinflusst. So lag der Frauenanteil in der Patientengruppe mit Tresen-Überweisungen bei 66 Prozent, im Kollektiv aus der Sprechstunde hingegen nur bei 58 Prozent. Die Ursachenfindung für diesen zweiten Unterschied gestaltet sich aber im Vergleich einfacher. Die Auswertung der einzelnen Fachdisziplinen ergab, dass 17,8 Prozent der am Tresen und 10,9 Prozent der in der Sprechstunde ausgestellten Überweisungen an die Gynäkologie gerichtet waren. Folglich nahmen weibliche Patienten einen großen Anteil der Tresen-Überweisungen in Anspruch. Die vor allem an Männer ausgestellten Tresen-Überweisungen in die Urologie beliefen sich im Vergleich auf lediglich 3,9 Prozent und diese wurden fast ebenso häufig im Rahmen der Sprechstunde ausgegeben (3,6 %). Darüber hinaus scheinen Frauen hohen Wert auf eine selbstbestimmte Arztwahl zu legen. Eine israelische Studie untersuchte die Merkmale von Patienten, die sich für ein „Gatekeeper“Modell anstelle eines freien Zugangs zum Arzt entscheiden. Den Ergebnissen zufolge wollten Frauen öfter selbst entscheiden, ob eine Vorstellung bei einem anderen Facharzt notwendig ist. Männer hingegen favorisierten eine Steuerung durch den behandelnden Arzt (Gross 2000). Es ist fraglich, ob diese Ergebnisse auf die deutsche Versorgungslandschaft übertragen werden können. Unbestreitbar sollten sich zukünftige Studien der Frage widmen, welche Beweggründe und Charakteristika mit der vermehrten Inanspruchnahme von Tresen-Überweisungen einhergehen. 4.2.1.2 Psychische Komorbidität Im Einklang mit anderen Studien bestätigte auch die vorliegende Erhebung die weite Verbreitung von psychischen Erkrankungen (Wittchen 2011; Jacobi 2014; Hanel 2009; Mergl 2007). Entgegen der ursprünglichen Hypothese konnte jedoch nicht gezeigt werden, dass Patienten mit Tresen-Überweisungen eine höhere psychische Komorbidität aufweisen als Patienten aus der regulären Sprechstunde. Lediglich die metrische Analyse des PHQ-D-Depressionsmoduls ergab einen geringen Unterschied zwischen beiden Kollektiven. Demnach waren Patienten, die Überweisungen außerhalb der Sprechstunde ohne direkten Arztkontakt erhielten, um 0,5 Punktwerte weniger de- 63 pressiv als das Vergleichskollektiv. Auf einer Skala von 0 bis 27 kann diese Differenz jedoch nicht als bedeutungsvoll eingestuft werden. So liegt der für das Depressionsmodul ermittelte klinisch relevante Mindestunterschied bei fünf Punkten. Erst wenn diese Punktzahl in der Verlaufsbeobachtung überschritten wird, kann von einer tatsächlichen Verbesserung des psychischen Zustands ausgegangen werden (Löwe 2004b). Der Hausarzt sollte jedoch all jene Patienten identifizieren, die ohne erklärende Diagnose sehr viele Überweisungen einfordern. Die Regressionsanalyse der vorliegenden Untersuchung zeigte einen deutlichen Zusammenhang von psychischen Erkrankungen mit einer hohen Überweisungszahl. Diese Assoziation war für bestehende Angstund Panikstörungen am stärksten ausgeprägt. Die entsprechenden PHQ-D-Module fragen unter anderem nach anfallsartigem Herzrasen, Erstickungsgefühlen oder Ohnmachtsattacken (Löwe 2002) und legen nahe, es könne sich hierbei um Patienten mit einer hohen Gesundheitsangst handeln. Derartige Ängste können zu einer verstärkten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und einem „Doctor-Hopping“ führen (Barsky 2001). Wird ein Patient in dieser Hinsicht auffällig, muss der Arzt diese Problematik im Gespräch thematisieren. Nur so kann der Patient vor Überdiagnostik geschützt werden, die gemäß dem Kapitel 1.2.2 ein großes Verletzungspotenzial birgt (Fink 1992; Kouyanou 1997). Die Versorgungssteuerung unter Berücksichtigung der genannten Aspekte gestaltet sich jedoch seit der Abschaffung der Praxisgebühr im Januar 2013 noch schwieriger. Patienten können nun wieder ohne zusätzliche Gebühr direkt beim Spezialist vorstellig werden und forderten in der Folge deutlich weniger Überweisungen vom Hausarzt an (Ollenschläger 2013). Momentan ermöglicht allein das Hausarztmodell eine gewisse Patientensteuerung. Der Nutzen dieser Versorgungsform sollte aber noch endgültig durch weitere Begleitforschung bestätigt werden. Zur Einschätzung der Krankheitslast wurden, neben dem auf Selbsteinschätzung basierenden PHQ-D, ebenfalls die vom Hausarzt attestierten Dauerdiagnosen herangezogen. Auch hier zeigte der Vergleich psychischer Erkrankungen keine Differenzen zwischen beiden Kollektiven auf. Einzig bei den Suchterkrankungen bestand ein Unterschied. Während 6,5 Prozent der Patienten aus der Sprechstunde an einer Suchtkrankheit litten, waren beim Vergleichskollektiv mit Tresen-Überweisungen lediglich 1,3 Prozent der Studienteilnehmer betroffen. Eine Erklärung für diesen Unterschied findet sich bei Betrachtung der Qualifikationen der an dieser Studie beteiligten Lehr64 ärzte. Einer der Ärzte behandelt aufgrund seiner Zusatzbezeichnung „Suchtmedizinische Grundversorgung“ einen großen Anteil suchtkranker Patienten. Viele seiner Patienten nehmen an einer Substitutionstherapie teil. Um den Heroin-Ersatzstoff zu erhalten, müssen diese Patienten regelmäßig beim Arzt für Gespräche und Kontrollen vorstellig werden. Deshalb weisen sie eine im Durchschnitt hohe Kontaktrate auf (Tretter 2010). Werden Überweisungen benötigt, können diese im Rahmen einer der vielen Sprechstundentermine angefordert werden. In der vorliegenden Studie finden sich aus diesem Grund in der Patientengruppe der regulären Sprechstunde mehr Suchtkranke als im Kollektiv mit Tresen-Überweisungen. 4.2.1.3 Somatische Morbidität Wie auch andere Studien bestätigte die vorliegende Erhebung eine insgesamt hohe Prävalenz chronischer Erkrankungen (Beyer 2007; Violan 2014). Im Durchschnitt waren bei jedem Studienteilnehmer etwa 4,5 verschiedene Dauerdiagnosen in den elektronischen Behandlungsunterlagen des Hausarztes vermerkt. Gemäß dem Kapitel 1.3.2 sind chronische Erkrankungen mit einer verstärkten Inanspruchnahme von Überweisungen assoziiert. Auch in dieser Erhebung wurde dieser Zusammenhang bestätigt. Im Vergleich zum Kollektiv aus der Sprechstunde bestanden bei Patienten mit Tresen-Überweisungen häufiger chronisch internistische (57,7 % vs. 46,3 %) und fast doppelt so oft maligne Erkrankungen (13,4 % vs. 7,6 %). Patienten, die zum Beispiel an einem Diabetes mellitus oder kolorektalem Karzinom leiden, müssen regelmäßig bei anderen Fachärzten für Kontrolluntersuchungen vorstellig werden (AWMF 2010b; Leitlinienprogramm Onkologie 2014). Für diese Routine-Überweisungen ist meist keine Konsultation des Hausarztes erforderlich. Vielmehr erscheint in diesem Fall, auch vor dem Hintergrund eines effektiven Zeitmanagements, eine Ausstellung von Tresen-Überweisungen sinnvoll. 4.2.1.4 Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen In den Jahren 2008 bis 2011 untersuchte die „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ eine repräsentative Stichprobe von über 8000 Personen aus ganz Deutschland. Eines der zahlreichen Module widmete sich der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Innerhalb von zwölf Monaten suchten die Befragten den Hausarzt im Durchschnitt 3,2 Mal auf (Rattay 2013). Im Vergleich dazu ermittelte die 65 vorliegende Untersuchung deutlich höhere Kontaktzahlen zwischen 13,0 und 15,2 pro Jahr. Diese Werte entstammten den elektronischen Behandlungsunterlagen der Patienten, während in der genannten bundesweiten Erhebung die Teilnehmer selbst die Zahl der Arztbesuche bezifferten. Vermutlich erinnerten sich die Befragten nicht an alle zurückliegenden Praxiskontakte und gaben daher zu geringe Zahlen an, sodass die tatsächliche Inanspruchnahme unterschätzt wurde. Des Weiteren fragte die bundesweite Erhebung lediglich nach den persönlichen Kontakten zum Hausarzt im Rahmen der Sprechstunde. In der vorliegenden Studie wurden hingegen auch Praxisbesuche ohne direkten Arztkontakt, wie zum Beispiel für eine Blutentnahme oder zur Abholung einer Überweisung, gezählt. Die in der vorliegenden Erhebung ermittelte außerordentlich hohe Zahl von Kontakten zum Hausarzt wurde auch in anderen Studien bestätigt und gilt als typisch für das deutsche Gesundheitswesen (Maydell 2010; Riens 2012). Laut den Ergebnissen eines internationalen Vergleichs behandeln in Deutschland tätige Hausärzte pro Woche mehr als doppelt so viele Patienten wie ihre Kollegen in Kanada, Frankreich, Schweden, Großbritannien oder den USA. Bei einem derart hohen Patientendurchsatz bleibt nur wenig Zeit für den einzelnen Patienten. So ergab diese Erhebung für Deutschland eine durchschnittliche Kontaktzeit von 9,1 Minuten, während Hausärzte in Schweden pro Patient 28,8 Minuten aufwendeten. Die Autoren dieser Vergleichsstudie konnten aufgrund der unzureichenden Studienlage keine klare Erklärung für die beschriebenen dramatischen Unterschiede anführen (Koch 2011). Eine Rolle scheinen die spezifischen Abrechnungsmodalitäten in Deutschland mit einer quartalsbezogenen Vergütung pro Behandlungsfall zu spielen. Dieses Vergütungssystem belohnt Hausärzte, die möglichst viele Patienten im Quartal behandeln. Die momentane Versorgungssituation stellt insbesondere für Patienten mit psychischen Erkrankungen ein Problem dar, da auf deren Belange in der kurzen Zeit nicht immer in ausreichender Tiefe eingegangen werden kann. Darüber hinaus zeigte sich in der vorliegenden Erhebung eine hohe Inanspruchnahme von Überweisungen. Gemäß einer Erhebung aus den USA erfolgte in den letzten zehn Jahren fast eine Verdoppelung der Überweisungszahlen. Als Erklärung führen die Autoren neue Screening-Maßnahmen und Präventionsprogramme an, sowie auch die immer komplexer werdende Medizin mit zunehmender Multimorbidität und Polypharmazie. Da der Hausarzt in der kurzen Kontaktzeit nicht in der Lage ist, alle Beratungsanlässe abzuklären, müsse er die Patienten vermehrt zu anderen Fachärzten 66 überweisen (Barnett 2012). In der vorliegenden Erhebung erhielten Patienten durchschnittlich 3,7 bis 6,6 Überweisungen pro Jahr. Dieses Ergebnis steht in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen einer Studie aus Baden-Württemberg. Im Jahr 2012 suchten die bei der AOK versicherten Patienten etwa vier Mal einen Spezialist mit einer Überweisung durch den Hausarzt auf (Gerlach 2014). Bedeutende Gruppenunterschiede ergab der Vergleich des Inanspruchnahmeverhaltens der zwei untersuchten Kollektive. Innerhalb eines Jahres forderten Patienten mit Tresen-Überweisungen erheblich mehr Überweisungen an (Mittelwert 6,6 vs. 3,7), konsultierten den Hausarzt aber seltener als das Kollektiv aus der Sprechstunde (Mittelwert 13,9 vs. 15,2). Die vorliegende Studie ergab für Patienten mit Tresen-Überweisungen eine stärker ausgeprägte somatische Morbidität als für Patienten der Sprechstunde. Gemäß dem Kapitel 1.3.2 müssen Patienten mit chronischen Erkrankungen öfter bei Spezialisten vorstellig werden und weisen folglich eine höhere Überweisungsrate auf. Die etwas geringere Kontaktzahl zum Hausarzt war bei Patienten mit Tresen-Überweisungen möglicherweise Resultat des häufigen Kontakts zum Spezialist, der vermutlich einen Teil der Beratungsanlässe abklären konnte. Große Bedeutung kommt auch dem Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und der Arbeitsunfähigkeitsdauer zu. In der vorliegenden Erhebung waren Angststörungen, Depressionen und somatoforme Störungen mit einer verlängerten Krankschreibung assoziiert. Alle großen Krankenkassen verzeichneten während der vergangenen zehn Jahre einen bedeutenden Anstieg der Ausfalltage aufgrund von psychischen Erkrankungen (BundesPsychotherapeutenKammer 2012). Mittlerweile belegen psychische Störungen in der Ursachenstatistik für Arbeitsunfähigkeit innerhalb aller Diagnosegruppen den dritten Platz (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2012). Eine Rolle spielen vermutlich sowohl der wachsende Kenntnisstand der Ärzteschaft zu diesen Erkrankungen als auch die Weiterentwicklung moderner Diagnosesysteme mit einem differenzierten und erweiterten Erkrankungsspektrum. Dennoch sollte zukünftige Forschung klären, welche weiteren Faktoren für die Bedeutungszunahme psychischer Erkrankungen bedeutsam sind. Die Erkenntnisse können bei der Optimierung von Therapiestrategien und der Entwicklung präventiver Maßnahmen Verwendung finden. 67 4.2.1.5 Partizipations- und Informationspäferenz In der vorliegenden Studie ergaben Selbst- und Fremdbeurteilung der Partizipationspräferenz voneinander abweichende Ergebnisse. Nach Einschätzung der Hausärzte präferierten weit mehr Patienten mit Tresen-Überweisungen eine autonome Vorgehensweise (41 % vs. 17 %), während Patienten der Sprechstunde öfter einen paternalistischen Interaktionsstil bevorzugten (18 % vs. 8 %). Die Auswertung des auf Selbsteinschätzung basierenden Autonomie-Präferenz-Index ergab hingegen keinen Unterschied für die Partizipationspräferenz. Ursache dieser Diskrepanz könnte ein sogenannter Recall-Bias sein (Coughlin 1990), da die Hausärzte dem Ausstellen von Tresen-Überweisungen sehr ambivalent gegenüber stehen. Einerseits muss der Hausarzt nicht zwingend für jede Routine-Überweisung konsultiert werden und der Zeitdruck und das hohe Patientenaufkommen lassen auch keine genaue Prüfung jeder Überweisung zu. Andererseits drohen Patienten bei Restriktionen mit einem Arztwechsel oder suchen den Spezialist ohne Überweisung auf. Wird am Tresen die gewünschte Überweisung ausgestellt, kann dies beim Hausarzt eine ablehnende Haltung provozieren, da die Ansprüche an die eigene Arbeit nicht erfüllt werden und die Patienten sich einer effektiven Versorgungskoordination entziehen. Diese negativen Emotionen und Erfahrungen könnten in der vorliegenden Erhebung zu einer verzerrten Beurteilung der Partizipationspräferenz durch den Hausarzt geführt haben. Im Vergleich zu dieser hausärztlichen Beurteilung ergab die Auswertung des API keinen Gruppenunterschied. Entgegen der ursprünglichen Hypothese wollten Patienten mit Tresen-Überweisungen nicht stärker an medizinischen Entscheidungen beteiligt werden als Patienten aus der Sprechstunde. Die Studienteilnehmer wiesen insgesamt ein nur mittelgradiges Partizipationsbedürfnis auf. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen verschiedener Untersuchungen, in denen die Befragten – unabhängig von deren Geschlecht, Kenntnisstand, Erkrankungsbild oder Alter – generell nur mittlere Punktwerte auf der Partizipationspräferenz-Skala erzielten (Sung 2010; Neame 2005; Nease 1995). Im Gegensatz dazu war das Informationsbedürfnis der Teilnehmer dieser Studien weitaus stärker ausgeprägt. Die Patienten wollten in der Regel umfassend informiert werden und tendierten so zu insgesamt hohen Werten (Sung 2010; Neame 2005; Nease 1995). Die Auswertung der vorliegenden Erhebung detektierte aber dennoch einen Unterschied zwischen beiden Kollektiven. Patienten mit Tresen-Überweisungen 68 wiesen ein noch höheres Informationsbedürfnis auf als Patienten aus der Sprechstunde (Mittelwert 93,2 vs. 91,4). Die entsprechenden Items des API fragen zum Beispiel nach dem Wunsch, alle Nebenwirkungen eines Medikaments zu kennen, oder nach dem Bedürfnis bei einer Erkrankung eine vollständige Erklärung der Vorgänge im Körper zu erhalten (Ende 1989). Wie auch bei den PHQ-D-Modulen zu Angst- und Panikstörungen könnte der besonders hohe Punktwert der Patienten mit TresenÜberweisungen folglich mit einer verstärkten Gesundheitsangst einhergehen. Diese Patienten fordern möglicherweise Überweisungen außerhalb der Sprechstunde an, um beim Spezialisten der Wahl scheinbar benötigte Informationen zu verschiedenen bestehenden Symptomen einzufordern. Bei der Interpretation dieses Befunds gilt zu beachten, dass ein Gruppenunterschied von 1,8 Punkten auf einer Skala von 0 bis 100 nicht zwingend mit einem klinischen Unterschied einhergehen muss. 4.2.2 Patienten mit sinnvollen Überweisungen im Vergleich zu Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung Die vorliegende Untersuchung vergleicht Patienten mit sinnvollen Überweisungen und Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung am Erhebungstag. In Bezug auf die psychische Komorbidität und das Vorliegen von dysfunktionalen Kognitionen bestand kein Unterschied zwischen beiden Kollektiven. Patienten mit nicht sinnvollen Überweisungen nahmen eine größere Zahl von Überweisungen in Anspruch und erzielten einen niedrigeren Punktwert auf der Skala „Fatalistische Externalität“ des KKG als das Vergleichskollektiv. Die an der Untersuchung beteiligten Hausärzte wurden gebeten, die Sinnhaftigkeit jedes dokumentierten Überweisungsvorgangs zu beurteilen. So konnten die Patienten zu zwei Gruppen zugeordnet werden, je nachdem ob diese am Erhebungstag ausschließlich sinnvolle oder mindestens eine nicht sinnvolle Überweisung erhalten hatten. Wie bereits in Kapitel 4.1.1 diskutiert, beruht diese Zuteilung allein auf den subjektiven Kriterien des Hausarztes und muss aus diesem Grund mit Vorsicht interpretiert werden. Der Vergleich des soziodemographischen Hintergrunds der so gebildeten Kollektive zeigte lediglich für die Schulbildung einen Unterschied auf. Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung hatten öfter Abitur oder Fachabitur als die Vergleichsgruppe mit sinnvollen Überweisungen (44 % vs. 31 %). Wegen der unzureichenden Studienlage zur Thematik der Sinnhaftigkeit von Überweisungen kann 69 keine Erklärung für dieses Ergebnis angeführt werden. Die Relevanz dieses Befunds erscheint aber ohnehin fraglich, da die zwei Patientengruppen sich nicht in Bezug auf das Studium oder den Erwerbstätigkeitsstatus voneinander unterschieden. Die Auswertung der in der Studie verwendeten PHQ-D-Module ergab lediglich für die „Anderen Angststörungen“ einen geringgradigen Gruppenunterschied. Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung besaßen eine etwas höhere Ängstlichkeit als das Vergleichskollektiv (Mittelwert 5,2 vs. 4,4). Diese geringe Differenz kann aber, trotz statistischer Signifikanz, auf einer Skala von 0 bis 21 nicht als klinisch relevant eingestuft werden. Des Weiteren ergab auch der GAD-7 keinen Unterschied zwischen beiden Kollektiven, obwohl dieser Fragebogen als weiterentwickelte Version über bessere Testeigenschaften verfügt. Entgegen der ursprünglichen Vermutung war die psychische Komorbidität von Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung demnach nicht stärker ausgeprägt als von Patienten mit sinnvollen Überweisungen. Im Einklang mit den Hypothesen zeigte die Patientengruppe mit nicht sinnvollen Überweisungen eine höhere Inanspruchnahme von Überweisungen als das Vergleichskollektiv (Mittelwert 7,7 vs. 5,7). Alle weiteren Überlegungen zum Inanspruchnahmeverhalten, wie auch zu dysfunktionalen Kognitionen und Kontrollüberzeugungen, wurden durch die Untersuchungsergebnisse widerlegt. Es bestand kein Unterschied in Bezug auf die Arbeitsunfähigkeitsdauer, die Praxisbesuchsrate oder das Vorliegen dysfunktionaler Kognitionen gemäß dem Fragebogen zu Körper und Gesundheit. Die Auswertung der Kontrollüberzeugungen ergab bei der Dimension „Fatalistische Externalität“ eine Differenz. Entgegen der ursprünglichen Vermutung erzielten Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung einen im Durchschnitt niedrigeren Punktwert (Mittelwert 13,3 vs. 15,9). Demnach waren Personen dieses Kollektivs weniger oft davon überzeugt, dass Lebensereignisse durch den Zufall oder das Schicksal beeinflusst werden (Lohaus 1989). Aufgrund der unzureichenden Studienlage bleibt aber ungewiss, ob dieses Ergebnis für die hausärztliche Tätigkeit von Relevanz ist. Die Unterschiede zwischen Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung und Patienten mit sinnvollen Überweisungen waren folglich weniger stark ausgeprägt als angenommen. Es bleibt somit weitestgehend unklar, aus welchem Grund nicht sinnvolle Überweisungen in Anspruch genommen werden. Bei der Klärung die70 ser Frage spielen möglicherweise systembedingte Faktoren eine bedeutendere Rolle als patientenbezogene Parameter. Als Beispiel soll das Glaukom-Screening genannt werden. In der S1-Leitlinie der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft wird die regelmäßige Messung des Augeninnendrucks ab einem Alter von 40 Jahren als äußerst wichtig bewertet (AWMF 2000). Demgegenüber sprechen sich andere Fachgesellschaften und der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen vehement gegen diese Maßnahme ohne gesicherten Nutzennachweis aus (IGeL-Monitor 2012). Auch an der Studie beteiligte Hausärzte beurteilten Überweisungen zum Augenarzt für ein Glaukom-Screening als nicht sinnvoll. In diesem Fall leistet der Patient lediglich den Anweisungen des Augenarztes Folge und trägt demnach keine Verantwortung für diesen nicht sinnvollen Überweisungsvorgang. Eine der wenigen Studien, die sich dieser Thematik widmeten, bestätigt die geschilderten Zusammenhänge. In dieser Untersuchung wurde ein großer Teil der „avoidable referrals“ durch äußere Umstände, wie eine fehlende Informationsweitergabe des Krankenhauses an den Hausarzt, verursacht (Elwyn 1994). Vor dem Hintergrund der begrenzten Ressourcen des Gesundheitssystems sollten nicht sinnvolle Überweisungen in Zukunft in weiterführender Forschung thematisiert werden. 4.2.3 Dokumentierte Überweisungsvorgänge Nach Einschätzung der an der Untersuchung beteiligten Hausärzte wird etwa die Hälfte aller Überweisungen am Tresen der Praxis ausgegeben. Fast vier von zehn dieser Tresen-Überweisungen seien dabei als nicht sinnvoll einzustufen. Die Beurteilung jedes einzelnen dokumentierten Überweisungsvorgangs im Studienverlauf ergab im Vergleich einen geringeren Anteil nicht sinnvoller Überweisungen. Die Überweisungen, die im Rahmen der Sprechstunde ausgegeben wurden, unterschieden sich nicht in Bezug auf die Sinnhaftigkeit von den Überweisungen, die am Tresen ausgestellt wurden. Lediglich Tresen-Überweisungen in die Dermatologie wurden weitaus häufiger als nicht sinnvoll beurteilt. Beide Überweisungsgruppen richteten sich an unterschiedliche Fachdisziplinen. Regelmäßig fehlen auf den Überweisungsformularen Angaben zum Grund der Überweisung. Gemäß der Vermutung der zwölf an der Untersuchung beteiligten Hausärzte werden Überweisungen je etwa zur Hälfte in der Sprechstunde (49,3 %) und am Tresen der Praxis (50,7 %) ausgegeben. Eine Überprüfung dieser Einschätzung ist nicht möglich, 71 da in Deutschland bislang keine systematischen Untersuchungen dieser Frage existieren. Nach der Schätzung der Hausärzte sind im Durchschnitt 38,2 Prozent der TresenÜberweisungen als nicht sinnvoll zu beurteilen, wobei die Antworten der einzelnen Ärzte in diesem Punkt stark voneinander abwichen. Während ein Hausarzt nur eine von 20 Tresen-Überweisungen als vermeidbar ansah, stufte ein anderer zwei von drei dieser Überweisungen als nicht unbedingt erforderlich ein. Wie bereits in Kapitel 4.1.1 ausführlich dargelegt, ist die Abgrenzung einer sinnvollen von einer nicht sinnvollen Überweisung eine komplexe Aufgabe. Einerseits unterschätzte vermutlich ein Teil der Ärzte den Anteil nicht sinnvoller Überweisungen, da bei Beantwortung der Frage die eigene Tätigkeit kritisch beleuchtet werden muss. Andererseits haben weitere Ärzte womöglich zu hohe Prozentsätze angegeben. Gemäß dem Kapitel 1.1.2 stehen Ärzte dem Ausstellen von Tresen-Überweisungen generell sehr ambivalent gegenüber. In der Folge kann dieser Prozess mit negativen Emotionen verknüpft werden, sodass dessen Sinnhaftigkeit stärker in Frage gestellt wird, als dies der Realität entspricht. Im Einklang mit dieser Überlegung ergab die Beurteilung jedes einzelnen Überweisungsvorgangs im Studienverlauf einen Anteil von lediglich 13,6 Prozent nicht sinnvoller Tresen-Überweisungen. Entgegen der ursprünglichen Vermutung war die Sinnhaftigkeit von am Tresen und in der Sprechstunde ausgestellten Überweisungen nicht unterschiedlich ausgeprägt. Insgesamt betrug der Anteil nicht sinnvoller Überweisungen 12,3 Prozent und liegt damit in der gleichen Größenordnung wie in anderen Studien ermittelte Werte. In Großbritannien ergab der Vergleich zu lokalen Leitlinien einen Anteil von 15,9 Prozent an „possibly inappropriate referrals“ (Fertig 1993). In einer Erhebung aus den USA waren gemäß der Einschätzung der Hausärzte 17,4 Prozent der Überweisungen „not indicated“ (Albertson 2000). In Deutschland bezifferten die Spezialisten neun Prozent der an sie gerichteten Überweisungen als „inappropriate“ (Rosemann 2006). Demzufolge könnte etwa eine von zehn Überweisungen vermieden werden. Eine Reduktion dieser Patientenströme würde zur Kosteneinsparung und effektiveren Verteilung der begrenzten Gesundheitsressourcen führen. In Deutschland gestaltet sich eine Versorgungssteuerung unter Berücksichtigung dieser Aspekte jedoch zum aktuellen Zeitpunkt schwierig, da Patienten auch ohne Überweisung den Spezialist der Wahl aufsuchen können. Zukünftige Forschung sollte sich der Frage widmen, ob eine Stärkung der Position des Hausarztes, zum Beispiel in Form der hausarztzentrierten Versorgung, zur verbesserten Patientensteuerung beiträgt. 72 Gemäß den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung spielt bei Beurteilung der Sinnhaftigkeit einer Überweisung die jeweilige Fachrichtung eine entscheidende Rolle. Während die Hausärzte zum Beispiel Überweisungen in die Gynäkologie oder Radiologie stets als sinnvoll bewerteten, zeigte sich bei den Fachdisziplinen HNO, Orthopädie und Dermatologie ein hoher Anteil vermeidbarer Überweisungen. Überweisungen in die Dermatologie waren am Tresen weitaus häufiger nicht sinnvoll, als wenn diese im Rahmen der Sprechstunde ausgestellt wurden (41,5 % vs. 13,0 %). Um nicht sinnvolle Überweisungsvorgänge zu identifizieren, sollten die Hausärzte Überweisungen zu den genannten Fachdisziplinen einer genauen Prüfung unterziehen. Für die Thematisierung ist jedoch mehr Zeit für den einzelnen Patienten notwendig. Erfolgt auch in Zukunft keine bessere Honorierung des Patientengesprächs (Rieser 2013), kann diese Aufgabe im hausärztlichen Praxisalltag nur schwer umgesetzt werden. Die meisten der in der Studie dokumentierten Tresen-Überweisungen richteten sich an die Fächer Gynäkologie, Augenheilkunde, Innere Medizin, Dermatologie und Orthopädie. Gynäkologie-Überweisungen werden in Deutschland regelmäßig außerhalb der Sprechstunde ausgestellt, da für typische Symptome oder die jährliche Vorsorgeuntersuchung meist keine hausärztliche Beratung vonnöten ist. Auch das Auge betreffende Beratungsanlässe werden hierzulande nur selten vom Hausarzt abgeklärt (Fink 2007). Aufgrund der fehlenden hausärztlichen Expertise auf diesem Gebiet fordern die Patienten Augenheilkunde-Überweisungen meist ohne Rücksprache mit dem Arzt am Tresen der Praxis an. Wenn Patienten mit chronischen Erkrankungen regelmäßig für Kontrollen beim Spezialisten vorstellig werden, bedürfen auch nicht alle Überweisungen in die Innere Medizin der Konsultation des Hausarztes. Dies trifft zum Beispiel auf Patienten mit einem Diabetes mellitus zu, die gemäß der Nationalen Versorgungsleitlinie einmal pro Jahr einen Augenarzt aufsuchen sollten (AWMF 2010b). In Bezug auf die Fächer Dermatologie und Orthopädie zeigten auch andere Studien einen hohen Prozentsatz von Überweisungen auf Patientenwunsch (Forrest 2001; Hirsch 2012). In diesen Fällen könnten die Hausärzte vermutlich einen großen Anteil der Beratungsanlässe selbst abklären. Eine Studie aus Deutschland untermauert diese Überlegungen. Hier wurde ein Drittel aller Orthopädie-Überweisungen wegen Rückenschmerzen ausgestellt (Chenot 2009), obwohl die Nationale Versorgungsleitlinie nur wenige Situationen nennt, in denen eine Überweisung aufgrund von unkomplizierten Kreuzschmerzen indiziert ist (AWMF 2010a). Die Mehrzahl dieser Überweisungen erfolgte dabei auf Wunsch des Patienten. Gründe waren zum Beispiel die Unzufrie73 denheit mit der bisherigen Behandlung oder die Hoffnung auf neue Therapiemöglichkeiten (Chenot 2009). Unbestreitbar wäre die Reduktion dieser Überweisungsströme eine sinnvolle Maßnahme. Wie bereits ausführlich diskutiert, können die Hausärzte Deutschlands jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nur eingeschränkt als „Gatekeeper“ wirksam werden, da Patienten über einen freien Zugang zum Spezialist der Wahl verfügen. Um die Behandlung der Patienten effektiv und sicher zu gestalten, sollte der Überweisungsschein detaillierte Angaben zur Krankengeschichte und Medikation des Patienten enthalten. Gemäß der Schlussfolgerung einer systematischen Übersichtsarbeit findet in den USA in etwa der Hälfte der Überweisungen keine Kommunikation zwischen Hausarzt und fachärztlichem Kollegen statt (Mehrotra 2011). In einer deutschen Erhebung erhielten die Spezialisten in nur 61 Prozent angemessene Informationen zur Krankengeschichte des betreffenden Patienten (Rosemann 2006). Die Autoren einer Studie gehen sogar soweit, ihrer Untersuchung folgenden Titel zu geben: „Communication breakdown in the outpatient referral process“ (Gandhi 2000, S. 626). Im Einklang mit den Hypothesen gestaltete sich der Informationsgehalt der Überweisungen der vorliegenden Studie als unzureichend. Insgesamt wurde das Feld „Auftrag/Diagnose/Verdacht“ auf 21 Prozent der Tresen-Überweisungen leer gelassen oder lediglich „auf Patientenwunsch“ notiert. Auch wenn der Überweisungsschein Informationen zur Krankengeschichte des Patienten enthielt, wurden zum Teil nur vage Formulierungen verwendet. Beispiele sind die Angaben „Ausschluss gynäkologische Erkrankung“ für den gynäkologischen Facharzt, „Infekt“ für einen HNO-Arzt oder „Psychosomatik“ für den Psychiater. Es ist fraglich, wie dem Spezialisten auf der Basis von unpräzisen Angaben eine effektive und fehlerfreie Arbeitsweise möglich sein soll. Dies gilt insbesondere für Patienten, die den betreffenden Facharzt zum ersten Mal aufsuchen oder dort aufgrund eines neu aufgetretenen medizinischen Problems vorstellig werden. Bei anderen Patienten mögen hingegen kurze Vermerke ausreichend sein. So zum Beispiel beim Diabetiker, der alljährlich den Augenarzt zur Kontrolluntersuchung aufsucht. Aber auch in diesem Fall wären Angaben zur aktuellen Medikation, dem letzten HbA1c oder zusätzlichen Risikofaktoren wahrscheinlich sinnvoll. Vermutlich enthalten die in der Sprechstunde ausgestellten Überweisungen exaktere und ausführlichere Daten als am Tresen ausgestellte Überweisungen. Möglicherweise fehlt auch die Zeit für einen ausführlichen Bericht zum Patienten. Zukünftige Forschung sollte diese Fragen klären. Als Limitation 74 der vorliegenden Arbeit muss fraglos gelten, dass die Doktorandin und der Dissertationsbetreuer selbst die Einstufung der Überweisungsscheine in exakt und vage formuliert vornahmen. In nachfolgenden Untersuchungen sollte diese Beurteilung durch verschiedene Parteien, wie die Hausärzte und Spezialisten selbst, erfolgen. Die Verbesserung der Informationsübermittlung zwischen Hausarzt und Spezialist ist unbestreitbar eine wichtige Zukunftsaufgabe für das deutsche Gesundheitswesen. Mögliche Verbesserungsvorschläge sind die Überarbeitung des Überweisungsformulars (Chenot 2009), die Möglichkeit den jeweiligen Spezialist per Telefon zu kontaktieren (Roland 1992) oder die Einrichtung gemeinsamer Sprechstunden von Hausärzten und Spezialisten (Vlek 2003). Des Weiteren sollte die „Gatekeeper-Funktion“ des Hausarztes fest im deutschen Gesundheitswesen verankert werden. In diesem Versorgungssystem würde der Hausarzt einen koordinierten und fachübergreifenden Behandlungsablauf sicherstellen (Zentner 2008). Die Patienten hätten einen festen Ansprechpartner für gesundheitliche Belange, bei dem auch alle medizinischen Informationen zusammenfließen. Der Hausarzt wäre in der Lage „Doctor-Hopping“ zu identifizieren (Reibling 2009) und könnte gemeinsam mit dem Patienten Lösungsstrategien erarbeiten. 4.3 Schlussfolgerungen und Ausblick Die vorliegende Studie verfolgte drei Hauptanliegen. Zum einen wurde untersucht, ob sich die Patientengruppe mit Tresen-Überweisungen von dem Kollektiv aus der regulären Sprechstunde unterscheidet. Des Weiteren wurde analysiert, welche Merkmale Patienten aufweisen, die nicht sinnvolle Überweisungen in Anspruch nehmen. Und drittens erfolgte eine Aufschlüsselung der Überweisungsvorgänge nach Notwendigkeit, Fachrichtung und Grund der Überweisung. Damit leistet die Arbeit einen Beitrag zur Versorgungsforschung im deutschen Gesundheitssystem. Bisher wurden am Tresen ausgestellte sowie nicht sinnvolle Überweisungen nur selten in wissenschaftlicher Forschung thematisiert. Unbestreitbar sollten sich zukünftige Studien der Frage widmen, welche Beweggründe und Charakteristika mit der vermehrten Inanspruchnahme von Tresen-Überweisungen einhergehen. Die vorliegende Erhebung ergab einen Zusammenhang für chronische Erkrankungen und ein erhöhtes Informationsbedürfnis des Patienten. Die Vermutung zur erhöhten Prävalenz psychischer Erkrankungen in diesem Kollektiv konnte hinge75 gen nicht bestätigt werden. Dennoch sollte der Hausarzt all jene Patienten identifizieren, die ohne erklärende Diagnose sehr viele Überweisungen einfordern. So bestätigte die vorliegende Erhebung die Assoziation psychischer Erkrankungen mit einer erhöhten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Insgesamt wiesen die Patienten eine außerordentlich hohe Zahl von Kontakten zum Hausarzt auf und nahmen eine große Zahl von Überweisungen in Anspruch. Die Hausärzte Deutschlands verfügen nur über wenig Zeit für den einzelnen Patienten. Diese Versorgungssituation stellt insbesondere für Patienten mit psychischen Erkrankungen ein Problem dar, da auf deren Belange in der kurzen Zeit nicht immer in ausreichender Tiefe eingegangen werden kann. Auch zur Thematisierung von nicht sinnvollen Überweisungsvorgängen benötigt der Hausarzt mehr Zeit für den einzelnen Patienten. Unterschiede zwischen Patienten mit sinnvollen und mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung waren weniger stark ausgeprägt als angenommen. Es bleibt somit weitestgehend unklar, aus welchem Grund diese Überweisungen in Anspruch genommen werden. Bei der Klärung dieser Frage spielen möglicherweise systembedingte Faktoren eine bedeutendere Rolle als patientenbezogene Parameter. Vor dem Hintergrund der begrenzten Ressourcen des Gesundheitssystems sollten nicht sinnvolle Überweisungen in Zukunft in weiterführender Forschung thematisiert werden. Eine Versorgungssteuerung unter Berücksichtigung dieser Aspekte gestaltet sich zum aktuellen Zeitpunkt schwierig, da Patienten auch ohne Überweisung beim Spezialist der Wahl vorstellig werden können. Um die Behandlung der Patienten effektiv und sicher zu gestalten, sollte der Überweisungsschein detaillierte Angaben zur Krankengeschichte und Medikation des Patienten enthalten. Die in der vorliegenden Studie dokumentierten Tresen-Überweisungen konnten diese Zielvorgabe jedoch nicht in jedem Fall erfüllen. Die Verbesserung der Informationsübermittlung zwischen Hausarzt und Spezialist ist damit fraglos eine wichtige Zukunftsaufgabe für das deutsche Gesundheitswesen. Weitere Forschung sollte sich der Frage widmen, ob eine Stärkung der Position des Hausarztes, zum Beispiel in Form der hausarztzentrierten Versorgung, zur verbesserten Patientensteuerung beiträgt. 76 5 ZUSAMMENFASSUNG Im hausärztlichen Praxisalltag werden Überweisungen häufig ohne direkten Arztkontakt außerhalb der regulären Sprechstunde angefordert (Tresen-Überweisung). Hierbei könnte es sich um Patienten mit einer erhöhten psychischen Komorbidität handeln, da psychische Störungen gemäß der Fachliteratur mit einer verstärkten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen einhergehen. Das Ausstellen von Tresen-Überweisungen ist problematisch, da sich Patienten auf diese Weise der hausärztlichen Versorgungskoordination entziehen können. Vor dem Hintergrund der begrenzten Ressourcen des Gesundheitssystems sollten nicht-sinnvolle Überweisungsvorgänge reduziert werden. Der Überweisungsschein muss detaillierte Angaben zur Krankengeschichte enthalten, um eine sichere und effektive Behandlung der Patienten zu gewährleisten. In dieser Querschnittserhebung wurden Patienten mit Tresen-Überweisungen in zwölf hausärztlichen Praxen im Raum München rekrutiert und mit den Patienten der regulären Sprechstunde verglichen. Mit Hilfe des Gesundheitsfragebogens für Patienten wurden somatoforme Störungen, Depressionen, Angst- und Panikstörungen erfasst. Die Parameter Arbeitsunfähigkeitsdauer, Überweisungszahl und Praxiskontakte während der vergangenen zwölf Monate dienten der Einschätzung des Inanspruchnahmeverhaltens. Die an der Studie beteiligten Hausärzte beurteilten die Sinnhaftigkeit jedes erfassten Überweisungsvorgangs. Die psychische Komorbidität von Patienten mit sinnvollen Überweisungen im Vergleich zu Patienten mit mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung wurde analysiert. Am Tresen und in der Sprechstunde ausgestellte Überweisungen wurden in Bezug auf die Sinnhaftigkeit und Fachrichtung miteinander verglichen. Bei Tresen-Überweisungen erfolgte die Dokumentation der auf dem Formular vermerkten Angaben zum Grund der Überweisung. Der Vergleich von 307 Patienten mit Tresen-Überweisungen und 985 Patienten der regulären Sprechstunde ermittelte keine relevanten Unterschiede in Bezug auf die psychische Komorbidität. Der Vergleich der Dauerdiagnosen ergab für Patienten mit Tresen-Überweisungen mehr chronisch internistische (57,7% vs. 46,3%) und maligne Erkrankungen (13,4% vs. 7,6%), während bei Patienten aus der regulären Sprechstunde häufiger Suchterkrankungen (1,3% vs. 6,5%) vorlagen. Patienten mit TresenÜberweisungen verlangten pro Jahr erheblich mehr Überweisungen (Mittelwert 6,6 vs. 3,7), suchten aber die Praxis seltener auf als das Vergleichskollektiv (Mittelwert 13,9 77 vs. 15,2). In der Regressionsanalyse waren psychische Erkrankungen deutlich mit einer erhöhten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen assoziiert. Hohe Überweisungszahlen konnten durch Depressionen (Odds Ratio-OR 2,1), somatoforme Störungen (OR 2,2), Panik- (OR 5,9) und Angststörungen (OR 4,1) erklärt werden. Eine lange Arbeitsunfähigkeitsdauer hing mit somatoformen Störungen (OR 2,2), Depressionen (OR 2,5) und Angststörungen (OR 4,2) zusammen. Für eine hohe Praxiskontaktrate fand sich ein Zusammenhang zu somatoformen Störungen (OR 2,4). Die zwei Kollektive mit sinnvollen und mindestens einer nicht sinnvollen Überweisung zeigten ebenfalls keine Unterschiede in Bezug auf die psychische Komorbidität. Die Hausärzte beurteilten 12,3 Prozent aller dokumentierten Überweisungsvorgänge als nicht sinnvoll. Im Rahmen der Sprechstunde und am Tresen ausgestellte Überweisungen unterschieden sich nicht in Bezug auf die Sinnhaftigkeit voneinander, richteten sich aber je an unterschiedliche Fachdisziplinen. Bei 21 Prozent der Tresen-Überweisungen fehlte eine Angabe zum Grund der Überweisung. Im Einklang mit den Ergebnissen anderer Studien bestätigte die vorliegende Erhebung den Zusammenhang von psychischen Störungen mit einer verstärkten Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Der Hausarzt sollte aus diesem Grund all jene Patienten identifizieren, die ohne erklärende Diagnose sehr viele Überweisungen einfordern. Da bei Patienten mit Tresen-Überweisungen keine erhöhte psychische Komorbidität besteht, ist es dabei nicht von Relevanz, ob die Überweisungen am Tresen oder in der Sprechstunde ausgestellt werden. Die Hausärzte Deutschlands können jedoch nur eingeschränkt als „Gatekeeper“ wirksam werden. So steht ihnen nur wenig Zeit für den einzelnen Patienten zur Verfügung. Zudem können Patienten aufgrund des Rechts auf freie Arztwahl auch ohne Überweisung beim gewünschten Spezialist vorstellig werden. Diese Versorgungssituation erschwert die Identifikation, das Besprechen und die Ausarbeitung von Lösungsansätzen für „Doctor-Hopping“. Es bleibt weitestgehend unklar, aus welchem Grund nicht sinnvolle Überweisungen in Anspruch genommen werden. Bei der Klärung dieser Frage spielen möglicherweise systembedingte Faktoren eine bedeutendere Rolle als patientenbezogene Parameter. Eine Reduktion dieser Patientenströme würde zur Kosteneinsparung und effektiveren Verteilung der begrenzten Gesundheitsressourcen führen. Die Verbesserung der Informationsübermittlung zwischen Hausarzt und Spezialist ist eine wichtige Zukunftsaufgabe für das deutsche Gesundheitswesen. 78 6 ANHANG 6.1 Einverständniserklärung 79 80 81 6.2 Patientenfragebogen 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 6.3 Auszahlung von Probandenentgelt 92 7 LITERATURVERZEICHNIS Albertson, G.A., Lin, C.T., Kutner, J., Schilling, L.M., Anderson, S.N., Anderson, R.J. (2000): Recognition of patient referral desires in an academic managed care plan: frequency, determinants, and outcomes. Journal of general internal medicine 15, 242–247. Atzpodien, K., Bergmann, E., Bertz, J., Busch, M., Eis, D., Ellert, U., Fuchs, J., Gaber, E., Gutsche, J., Haberland, J. (2009): 20 Jahre nach dem Fall der Mauer: Wie hat sich die Gesundheit in Deutschland entwickelt?: Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Robert-Koch-Institut, Berlin. AWMF (2000): Leitlinien der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft und des Berufsverbandes der Augenärzte Deutschlands. Detektion des primären Offenwinkelglaukoms (POWG): Glaukom - Screening von Risikogruppen, Glaukomverdacht, Glaukomdiagnose. http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/045-005a_S1_Primaeres_chronisches_ Offenwinkelglaukom__Normaldruckglaukom_und_okulaere_Hypertension_10-2006_102011.pdf (Aufruf am 08.11.2014). AWMF (2010a): Nationale VersorgungsLeitlinie. Kreuzschmerz. Langfassung. http://www.leitlinien.de/mdb/downloads/nvl/kreuzschmerz/nvl-kreuzschmerz-lang.pdf (Aufruf am 05.05.2015). AWMF (2010b): Nationale VersorgungsLeitlinie. Typ-2-Diabetes: Prävention und Therapie von Netzhautkomplikationen. Langfassung. http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/ fileadmin/Redakteur/Leitlinien/Evidenzbasierte_Leitlinien/NVL_T2DM_Netzhaut-lang-ddg2.6_100215.pdf (Aufruf am 08.11.2014). Barnett, M.L., Song, Z., Landon, B.E. (2012): Trends in physician referrals in the United States, 1999-2009. Arch. Intern. Med. 172, 163–170. Barsky, A.J., Borus, J.F. (1999): Functional somatic syndromes. Ann. Intern. Med. 130, 910–921. Barsky, A.J., Ettner, S.L., Horsky, J., Bates, D.W. (2001): Resource utilization of patients with hypochondriacal health anxiety and somatization. Med Care 39, 705–715. Barsky, A.J., Orav, E.J., Bates, D.W. (2005): Somatization increases medical utilization and costs independent of psychiatric and medical comorbidity. Arch. Gen. Psychiatry 62, 903–910. Barsky, A.J., Orav, E.J., Bates, D.W. (2006): Distinctive patterns of medical care utilization in patients who somatize. Med Care 44, 803–811. 93 Berglund, E., Lytsy, P., Westerling, R. (2014): The influence of locus of control on self-rated health in context of chronic disease: a structural equation modeling approach in a cross sectional study. BMC Public Health 14, 492. Beyer, M., Otterbach, I., Erler, A., Muth, C., Gensichen, J., Gerlach, F. (2007): Multimorbidität in der Allgemeinpraxis Teil I: Pragmatische Definition, Epidemiologie und Versorgungsprämissen. Z Allg Med 83, 310–315. Borstel, S. von, Neumann, P. (2011): Die Praxisgebühr funktioniert nicht. http://www.welt.de/ wirtschaft/article13570298/Die-Praxisgebuehr-funktioniert-nicht.html (Aufruf am 05.05.2015). Brenner, G., Koch, H., Franke, A. (2005): Steuert die Praxisgebühr in die richtige Richtung? Analyse des Versorgungsgeschehens nach Einführung der „Praxisgebühr”. Z Allg Med 81, 377–381. Brockmann, H., Klein, T. (2002): Familienbiographie und Mortalität in Ost- und Westdeutschland. Z Gerontol Geriatr 35, 430–440. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2012): Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2011. Unfallverhütungsbericht Arbeit. Bonifatius GmbH, Paderborn. Bundesministerium für Gesundheit (2012): Daten des Gesundheitswesens 2012. Druckund Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main. BundesPsychotherapeutenKammer (2012): BPtK-Studie zur Arbeitsunfähigkeit. Psychische Erkrankungen und Burnout. http://www.bptk.de/uploads/media/20120606_AU-Studie-2012.pdf (Aufruf am 05.05.2015). Charles, C., Gafni, A., Whelan, T. (1997): Shared decision-making in the medical encounter: what does it mean? (or it takes at least two to tango). Soc Sci Med 44, 681–692. Chenot, J.-F., Pieper, A., Kochen, M.M., Himmel, W. (2009): Kommunikation und Befundaustausch zwischen Hausärzten und Orthopäden bei Rückenschmerzen: Eine retrospektive Beobachtungsstudie. Schmerz 23, 173–179. Coughlin, S.S. (1990): Recall bias in epidemiologic studies. J Clin Epidemiol 43, 87–91. den Boer-Wolters, D., Knol, M.J., Smulders, K., Wit, N.J. de (2010): Frequent attendance of primary care out-of-hours services in the Netherlands: characteristics of patients and presented morbidity. Fam Pract 27, 129–134. 94 Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. (2012): DEGAMZukunftspositionen. Allgemeinmedizin - spezialisiert auf den ganzen Menschen. Positionen zur Zukunft der Allgemeinmedizin und der hausärztlichen Praxis. http://www.degam.de/files/ Inhalte/Degam-Inhalte/Ueber_uns/Positionspapiere/DEGAM_Zukunftspositionen.pdf (Aufruf am 05.05.2015). Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. (2014): DEGAMLeitlinien. http://www.degam.de/leitlinien-51.html (Aufruf am 05.05.2015). Donker, G.A., Fleming, D.M., Schellevis, F.G., Spreeuwenberg, P. (2004): Differences in treatment regimes, consultation frequency and referral patterns of diabetes mellitus in general practice in five European countries. Fam Pract 21, 364–369. Edwards, P., Roberts, I., Clarke, M., DiGuiseppi, C., Pratap, S., Wentz, R., Kwan, I. (2002): Increasing response rates to postal questionnaires: systematic review. BMJ (Clinical research ed.) 324, 1183. Elwyn, G.J., Stott, N.C. (1994): Avoidable referrals? Analysis of 170 consecutive referrals to secondary care. BMJ (Clinical research ed.) 309, 576–578. Ende, J., Kazis, L., Ash, A., Moskowitz, M.A. (1989): Measuring patients' desire for autonomy: decision making and information-seeking preferences among medical patients. J Gen Intern Med 4, 23–30. Evans, S.J. (1991): Good surveys guide. BMJ (Clinical research ed.) 302, 302–303. Fertig, A., Roland, M., King, H., Moore, T. (1993): Understanding variation in rates of referral among general practitioners: are inappropriate referrals important and would guidelines help to reduce rates? BMJ 307, 1467–1470. Fink, P. (1992): Surgery and medical treatment in persistent somatizing patients. J Psychosom Res 36, 439–447. Fink, W., Haidinger, G. (2007): Die Häufigkeit von Gesundheitsstörungen in 10 Jahren Allgemeinpraxis. Z Allg Med 83, 102–108. Fleming, D.M. (1993): The European study of referrals from primary to secondary care. Thesis Publishers Amsterdam, Amsterdam. 95 Ford, J.D., Trestman, R.L., Steinberg, K., Tennen, H., Allen, S. (2004): Prospective association of anxiety, depressive, and addictive disorders with high utilization of primary, specialty and emergency medical care. Soc Sci Med 58, 2145–2148. Forrest, C.B., Weiner, J.P., Fowles, J., Vogeli, C., Frick, K.D., Lemke, K.W., Starfield, B. (2001): Self-referral in point-of-service health plans. JAMA 285, 2223–2231. Forrest, C.B., Nutting, P.A., Starfield, B., Schrader, S. von (2002): Family physicians' referral decisions: results from the ASPN referral study. J Fam Pract 51, 215–222. Forrest, C.B., Shadmi, E., Nutting, P.A., Starfield, B. (2007): Specialty referral completion among primary care patients: results from the ASPN Referral Study. Ann Fam Med 5, 361–367. Fuchs, J., Rabenberg, M., Scheidt-Nave, C. (2013): Prävalenz ausgewählter muskuloskelettaler Erkrankungen: Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1). Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 56, 678–686. Gandhi, T.K., Sittig, D.F., Franklin, M., Sussman, A.J., Fairchild, D.G., Bates, D.W. (2000): Communication breakdown in the outpatient referral process. J Gen Intern Med 15, 626–631. Gerlach, F.,Szecsenyi, J. (2014): Evaluation der Hausarztzentrierten Versorgung (HzV) nach §73b SGB V in Baden‐Württemberg (2013‐2016). Ergebnisbericht (Stand 09.09.2014). http://www.aok-bw-presse.de/src/php/download.php?fileId=680&fileName=HzV_AOKBW_Ergebnisbericht_2013-2014.pdf (Aufruf am 05.05.2015). Giersdorf, N., Loh, A., Härter, M. (2004): Messung der partizipativen Entscheidungsfindung. Z Arztl Fortbild Qualitatssich 98, 135–141. Graubner, B. (2012): ICD-10-GM 2012 Systematisches Verzeichnis. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme; 10. Revision German modification. Dt. Ärzte-Verl., Köln. Gröber-Grätz, D., Gulich, M., Zeitler, H.-P. (2011): Überweisungspraxis zwischen niedergelassenen Allgemeinärzten und Gebietsärzten in Baden-Württemberg vor Einführung der Hausarztverträge. Z Allg Med 87, 415–421. Gross, R., Tabenkin, H., Brammli-Greenberg, S. (2000): Who needs a gatekeeper? Patients' views of the role of the primary care physician. Fam Pract 17, 222–229. 96 Hahn, S.R., Thompson, K.S., Wills, T.A., Stern, V., Budner, N.S. (1994): The difficult doctorpatient relationship: somatization, personality and psychopathology. J Clin Epidemiol 47, 647–657. Hamann, J., Bieber, C., Elwyn, G., Wartner, E., Hörlein, E., Kissling, W., Toegel, C., Berth, H., Linde, K., Schneider, A. (2012): How do patients from eastern and western Germany compare with regard to their preferences for shared decision making? Eur J Public Health 22, 469–473. Hanel, G., Henningsen, P., Herzog, W., Sauer, N., Schaefert, R., Szecsenyi, J., Löwe, B. (2009): Depression, anxiety, and somatoform disorders: vague or distinct categories in primary care? Results from a large cross-sectional study. J Psychosom Res 67, 189–197. Härkäpää, K., Järvikoski, A., Mellin, G., Hurri, H., Luoma, J. (1991): Health locus of control beliefs and psychological distress as predictors for treatment outcome in low-back pain patients: results of a 3-month follow-up of a controlled intervention study. Pain 46, 35–41. Härter, M., Berger, M., Schneider, F., Ollenschläger, G. (2010): S3 Praxisleitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie. Nationale VersorgungsLeitlinie-Unipolare Depression. Springer Verlag GmbH, Berlin Heidelberg New York. Hibbeler, B. (2011): Psychische Erkrankungen. Nationales Forschungszentrum gefordert. Dtsch Ärztebl 108, A-1603. Hiller, W., Rief, W., Elefant, S., Margraf, J., Kroymann, R., Leibbrand, R., Fichter, M.M. (1997): Dysfunktionale Kognitionen bei Patienten mit Somatisierungssyndrom. Zeitschrift für Klinische Psychologie 26, 226–234. Hirsch, O., Träger, S., Bösner, S., Ilhan, M., Becker, A., Baum, E., Donner-Banzhoff, N. (2012): Referral from primary to secondary care in Germany: Developing a taxonomy based on cluster analysis. Scand J Public Health. Hörlein, E.A. (2013): Dissertation: Bedeutung der psychischen Komorbidität für das Inanspruchnahmeverhalten von Patienten in der Hausarztpraxis. Technische Universität München, München. IGeL-Monitor (2012): Messung des Augeninnendrucks zur Glaukom-Früherkennung. http://www.igel-monitor.de/Igel_A_Z.php?action=view&id=69 (Aufruf am 05.05.2015). 97 Jacobi, F., Klose, M., Wittchen, H.-U. (2004): Psychische Störungen in der deutschen Allgemeinbevölkerung: Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und Ausfalltage. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 47, 736–744. Jacobi, F., Höfler, M., Siegert, J., Mack, S., Gerschler, A., Scholl, L., Busch, M.A., Hapke, U., Maske, U., Seiffert, I., Gaebel, W., Maier, W., Wagner, M., Zielasek, J., Wittchen, H.-U. (2014): Twelve-month prevalence, comorbidity and correlates of mental disorders in Germany: the Mental Health Module of the German Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1-MH). Int J Methods Psychiatr Res 30, 304–319. Jütte, R., Gerst, T. (1997): Geschichte der deutschen Ärzteschaft. Dt. Ärzte-Verl, Köln. Kloppenborg, J. (1998): NAV-Virchow-Bund. Nein zum Primärarztsystem. Dtsch Ärztebl 95, A3044. Koch, K., Miksch, A., Schürmann, C., Joos, S., Sawicki, P.T. (2011): The German health care system in international comparison: the primary care physicians' perspective. Dtsch Arztebl Int 108, 255–261. Kochen, M. (2012): Allgemeinmedizin und Familienmedizin. 4. Aufl. Thieme, Stuttgart. Konkolÿ Thege, B., Rafael, B., Rohánszky, M. (2014): Psychometric properties of the multidimensional health locus of control scale form C in a non-Western culture. PLoS ONE 9, e107108. Korzilius, H. (2012): Hausarztzentrierte Versorgung. Minister auf Lernbesuch. Deutsches Ärzteblatt 109, A-237. Kouyanou, K., Pither, C.E., Wessely, S. (1997): Iatrogenic factors and chronic pain. Psychosom Med 59, 597–604. Kunstmann, W., Butzlaff, M., Böcken, J. (2002): Freie Arztwahl in Deutschland - eine historische Perspektive. Gesundheitswesen 64, 170–175. Labeit, A.M., Klotsche, J., Pieper, L., Pittrow, D., Einsle, F., Stalla, G.K., Lehnert, H., Silber, S., Zeiher, A.M., März, W., Wehling, M., Wittchen, H.-U. (2012): Changes in the prevalence, treatment and control of hypertension in Germany? A clinical-epidemiological study of 50.000 primary care patients. PLoS ONE 7, e52229. 98 Laux, G., Kuehlein, T., Rosemann, T., Szecsenyi, J. (2008): Co- and multimorbidity patterns in primary care based on episodes of care: results from the German CONTENT project. BMC Health Serv Res 8, 14. Lehr, A., Visarius, J. (2010): Themenschwerpunkt: hausarztzentrierte Versorgung - internationale Vernetzung. L-et-V-Verl, Bonn. Leitlinienprogramm Onkologie (2014): Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF: S3-Leitlinie Kolorektales Karzinom, Langversion 1.1, 2014, AWMF Registrierungsnummer: 021-007OL. http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/021-007OLl_S3_KRK_ 2014-08.pdf (Aufruf am 05.05.2015). Levenson, H. (1974): Activism and Powerful Others: Distinctions within the Concept of Internal-External Control. Journal of Personality Assessment 38, 377–383. Linden, M., Gothe, H., Ormel, J. (2004): Ländervergleich Deutschland/Niederlande. Der Hausarzt als Gatekeeper. Deutsches Ärzteblatt 101, A-2600. Lohaus, A., Schmitt, G.M. (1989): Fragebogen zur Erhebung von Kontrollüberzeugungen zu Krankheit und Gesundheit (KKG). Hogrefe, Göttingen. Löwe, B., Spitzer, R.L., Zipfel, S., Herzog, W. (2001): Manual PHQ-D (Gesundheitsfragebogen für Patienten). Komplettversion und Kurzform. 1. Auflage. Pfizer GmbH, Karlsruhe. Löwe, B., Spitzer, R.L., Zipfel, S., Herzog, W. (2002): Manual PHQ-D (Gesundheitsfragebogen für Patienten). Komplettversion und Kurzform. 2. Auflage. Pfizer GmbH, Karlsruhe. Löwe, B., Gräfe, K., Zipfel, S., Spitzer, R.L., Herrmann-Lingen, C., Witte, S., Herzog, W. (2003): Detecting panic disorder in medical and psychosomatic outpatients: comparative validation of the Hospital Anxiety and Depression Scale, the Patient Health Questionnaire, a screening question, and physicians' diagnosis. J Psychosom Res 55, 515–519. Löwe, B., Spitzer, R.L., Gräfe, K., Kroenke, K., Quenter, A., Zipfel, S., Buchholz, C., Witte, S., Herzog, W. (2004a): Comparative validity of three screening questionnaires for DSM-IV depressive disorders and physicians' diagnoses. J Affect Disord 78, 131–140. Löwe, B., Unützer, J., Callahan, C.M., Perkins, A.J., Kroenke, K. (2004b): Monitoring depression treatment outcomes with the patient health questionnaire-9. Med Care 42, 1194– 1201. 99 Löwe, B., Decker, O., Müller, S., Brähler, E., Schellberg, D., Herzog, W., Herzberg, P.Y. (2008): Validation and standardization of the Generalized Anxiety Disorder Screener (GAD-7) in the general population. Med Care 46, 266–274. Lüngen, M.,Siegel, M. (2012): Gesundheitliche Ungleichheit, Struktur der Inanspruchnahme und Zufriedenheit mit der Versorgung. http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2010-368-4-1.pdf (Aufruf am 05.05.2015). Maas, H.-J. (2005): Beschlussprotokoll des 108. Deutschen Ärztetages vom 3. – 6. Mai 2005 in Berlin. http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/Beschluesse108.pdf (Aufruf am 05.05.2015). MacKay, C., Canizares, M., Davis, A.M., Badley, E.M. (2010): Health care utilization for musculoskeletal disorders. Arthritis Care Res (Hoboken) 62, 161–169. Maydell, B. von, Kosack, T., Repschläger, U., Sievers, C., Zeljar, R. (2010): Achtzehn Arztkontakte im Jahr. Hintergründe und Details. In: Repschläger, U., Schulte, C., Osterkamp, N. (Hg.): Gesundheitswesen aktuell 2010: Beiträge und Analysen. 1. Auflage. BARMER GEK, Düsseldorf, S. 176–191. Medical Tribune (2013): Auch ohne Praxisgebühr: Überweisungen sind wichtig! http://www.medical-tribune.de/home/fuer-patienten/artikeldetail/auch-ohne-praxisgebuehrueberweisungen-sind-wichtig.html (Aufruf am 05.05.2015). Mehrotra, A., Forrest, C.B., Lin, C.Y. (2011): Dropping the baton: specialty referrals in the United States. The Milbank quarterly 89, 39–68. Mergl, R., Seidscheck, I., Allgaier, A.-K., Möller, H.-J., Hegerl, U., Henkel, V. (2007): Depressive, anxiety, and somatoform disorders in primary care: prevalence and recognition. Depress Anxiety 24, 185–195. Neame, R., Hammond, A., Deighton, C. (2005): Need for information and for involvement in decision making among patients with rheumatoid arthritis: a questionnaire survey. Arthritis Rheum. 53, 249–255. Nease, R.F., Brooks, W.B. (1995): Patient desire for information and decision making in health care decisions: the Autonomy Preference Index and the Health Opinion Survey. J Gen Intern Med 10, 593–600. Ollenschläger, P. (2013): Abschaffung der Praxisgebühr: Patientenverhalten kaum verändert. Dtsch Arztebl International 110, A-1542. 100 Otto, C., Bischof, G., Rumpf, H.-J., Meyer, C., Hapke, U., John, U. (2011): Multiple dimensions of health locus of control in a representative population sample: ordinal factor analysis and cross-validation of an existing three and a new four factor model. BMC Med Res Methodol 11, 114. Pinkhasov, R.M., Wong, J., Kashanian, J., Lee, M., Samadi, D.B., Pinkhasov, M.M., Shabsigh, R. (2010): Are men shortchanged on health? Perspective on health care utilization and health risk behavior in men and women in the United States. Int. J. Clin. Pract. 64, 475–487. Puschner, B., Neumann, P., Jordan, H., Slade, M., Fiorillo, A., Giacco, D., Egerházi, A., Ivánka, T., Bording, M.K., Sørensen, H.Ø., Bär, A., Kawohl, W., Loos, S. (2013): Development and psychometric properties of a five-language multiperspective instrument to assess clinical decision making style in the treatment of people with severe mental illness (CDMS). BMC Psychiatry 13, 48. Rattay, P., Butschalowsky, H., Rommel, A., Prütz, F., Jordan, S., Nowossadeck, E., Domanska, O., Kamtsiuris, P. (2013): Inanspruchnahme der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung in Deutschland: Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1). Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 56, 832–844. Reibling, N., Wendt, C. (2009): Gesundheitszustand und Nutzung von Gesundheitsleistungen im europäischen Vergleich. Zeitschrift für Sozialreform 55, 329–346. Rief, W., Hiller, W., Margraf, J. (1998): Cognitive aspects of hypochondriasis and the somatization syndrome. J Abnorm Psychol 107, 587–595. Riens, B., Erhart, M.,Mangiapane, S. (2012): Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland: Arztkontakte im Jahr 2007 – Hintergründe und Analysen. http://www.versorgungsatlas.de/fileadmin/ziva_docs/ID_14_Dok1_Bericht.pdf (Aufruf am 05.05.2015). Rieser, S. (2013): Reform der Vergütung für Niedergelassene: Mehr Geld für die Grundversorgung. Dtsch Arztebl International 110, A-1348. Ring, A., Dowrick, C., Humphris, G., Salmon, P. (2004): Do patients with unexplained physical symptoms pressurise general practitioners for somatic treatment? A qualitative study. BMJ 328, 1057. 101 Rocca, W.A., Boyd, C.M., Grossardt, B.R., Bobo, W.V., Finney Rutten, Lila J, Roger, V.L., Ebbert, J.O., Therneau, T.M., Yawn, B.P., St Sauver, Jennifer L (2014): Prevalence of multimorbidity in a geographically defined american population: patterns by age, sex, and race/ethnicity. Mayo Clinic proceedings 89, 1336–1349. Roland, M., Bewley, B. (1992): Boneline: evaluation of an initiative to improve communication between specialists and general practitioners. Journal of public health medicine 14, 307–309. Rosemann, T., Wensing, M., Rueter, G., Szecsenyi, J. (2006): Referrals from general practice to consultants in Germany: if the GP is the initiator, patients' experiences are more positive. BMC Health Serv Res 6, 5. Rotter, J.B. (1966): Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychol Monogr 80, 1–28. Schmitz, N., Kruse, J. (2002): The relationship between mental disorders and medical service utilization in a representative community sample. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 37, 380–386. Schneider, A., Rosemann, T., Wensing, M., Szecsenyi, J. (2005): Physicians perceived usefulness of high-cost diagnostic imaging studies: results of a referral study in a German medical quality network. BMC Fam Pract 6, 22. Schneider, A., Körner, T., Mehring, M., Wensing, M., Elwyn, G., Szecsenyi, J. (2006): Impact of age, health locus of control and psychological co-morbidity on patients' preferences for shared decision making in general practice. Patient Educ Couns 61, 292–298. Schneider, A., Hörlein, E., Wartner, E., Schumann, I., Henningsen, P., Linde, K. (2011): Unlimited access to health care-impact of psychosomatic co-morbidity on utilisation in German general practices. BMC Fam Pract 12, 51. Schneider, A., Wartner, E., Schumann, I., Hörlein, E., Henningsen, P., Linde, K. (2013): The impact of psychosomatic co-morbidity on discordance with respect to reasons for encounter in general practice. Journal of psychosomatic research 74, 82–85. Simon, D., Kriston, L., Loh, A., Spies, C., Scheibler, F., Wills, C., Härter, M. (2010): Confirmatory factor analysis and recommendations for improvement of the Autonomy-PreferenceIndex (API). Health Expect 13, 234–243. Singer, E., Ye, C. (2012): The Use and Effects of Incentives in Surveys. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 645, 112–141. 102 Spitzer, R.L., Kroenke, K., Williams, J.B. (1999): Validation and utility of a self-report version of PRIME-MD: the PHQ primary care study. Primary Care Evaluation of Mental Disorders. Patient Health Questionnaire. JAMA 282, 1737–1744. Sung, V.W., Raker, C.A., Myers, D.L., Clark, M.A. (2010): Treatment decision-making and information-seeking preferences in women with pelvic floor disorders. Int Urogynecol J 21, 1071–1078. Tretter, F. (2010): Leitfaden für Ärzte zur substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger. Bayerische Akademie für Suchtfragen. 2. Aufl, München. van Ravesteijn, H., Wittkampf, K., Lucassen, P., van de Lisdonk, E., van den Hoogen, H., van Weert, H., Huijser, J., Schene, A., van Weel, C., Speckens, A. (2009): Detecting somatoform disorders in primary care with the PHQ-15. Ann Fam Med 7, 232–238. Violan, C., Foguet-Boreu, Q., Flores-Mateo, G., Salisbury, C., Blom, J., Freitag, M., Glynn, L., Muth, C., Valderas, J.M. (2014): Prevalence, determinants and patterns of multimorbidity in primary care: a systematic review of observational studies. PLoS ONE 9, e102149. Vlek, J.F., Vierhout, W P M, Knottnerus, J.A., Schmitz, J.J., Winter, J., WesselinghMegens, A M K, Crebolder, H.F. (2003): A randomised controlled trial of joint consultations with general practitioners and cardiologists in primary care. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners 53, 108–112. Vogt, G. (1998): Ärztliche Selbstverwaltung im Wandel. Eine historische Dokumentation am Beispiel der Ärztekammer Nordrhein. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln. Wallston, K.A., Stein, M.J., Smith, C.A. (1994): Form C of the MHLC scales: a conditionspecific measure of locus of control. J Pers Assess 63, 534–553. Warriner, K., Goyder, J., Gjertsen, H., Hohner, P., McSpurren, K. (1996): Charities, No; Lotteries, No; Cash, Yes: Main Effects and Interactions in a Canadian Incentives Experiment. Public Opinion Quarterly 60, 542. Wartner, E.M. (2013): Dissertation: Bedeutung der psychischen Komorbidität für die Konkordanz in der Arzt-Patienten-Begegnung in der Hausarztpraxis. Technische Universität München, München. Weber, A., Hörmann, G., Köllner, V. (2006): Psychische und Verhaltensstörungen. Die Epidemie des 21. Jahrhunderts? Dtsch Ärztebl 103, A834-A841. 103 Wittchen, H.U., Jacobi, F., Rehm, J., Gustavsson, A., Svensson, M., Jönsson, B., Olesen, J., Allgulander, C., Alonso, J., Faravelli, C., Fratiglioni, L., Jennum, P., LIEB, R., Maercker, A., van Os, J., Preisig, M., Salvador-Carulla, L., Simon, R., Steinhausen, H.-C. (2011): The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol 21, 655–679. World Health Organization (1978): Primary health care. Report of the international conference on primary health care, Alma-Ata, U.S.S.R., 6-12 September 1978. World Health Organization, Geneva. Zantinge, E.M., Verhaak, P.F.M., Kerssens, J.J., Bensing, J.M. (2005): The workload of GPs: consultations of patients with psychological and somatic problems compared. Br J Gen Pract 55, 609–614. Zentner, A., Garrido, M.V., Busse, R. (2008): Effekte des Gatekeeping durch Hausärzte. Systematischer Review für das Sondergutachten „Koordination und Integration – Gesundheitsversorgung in einer Gesellschaft des längeren Lebens“ des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Berlin 18.12.2008. 104 8 DANKSAGUNG An erster Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinem Doktorvater, Herrn Univ.-Prof. Dr. Antonius Schneider, für die Überlassung des Themas und die zahlreichen Hilfestellungen bei der Erstellung der Arbeit. Des Weiteren gilt mein besonderer Dank Herrn Prof. Dr. Klaus Linde für die engagierte Unterstützung bei der statistischen Auswertung. Zudem bedanke ich mich bei Dr. Isabelle Schumann für die Betreuung der Rekrutierungsphase und bei Nicola Möll für die Beantwortung aller organisatorischen Fragen. Mein Dank gilt auch meinen Mitdoktorandinnen, Elisabeth Hörlein und Eva Wartner, für die Bereitstellung ihrer Ergebnisse und für eine erste Einführung in die Auswertung statistischer Daten. Ich bedanke mich herzlich bei Sonja Störzbach, Silvia Ender und Silvia Hilbert für die hilfreichen Anmerkungen und die Korrektur meiner Dissertation. Abschließend gilt mein besonderer Dank den Patienten, Hausärzten und Praxismitarbeitern, die an der Studie mitwirkten und so deren Durchführung erst ermöglichten. 105 9 LEBENSLAUF ANGABEN ZUR PERSON Name Bernadett Maria Hilbert Geburtsdaten 04.03.1988 in Dresden Nationalität Deutsch DOKTORARBEIT Seit 01/2011 Thema der Arbeit: „Psychosomatische Aspekte an der Schnittstelle Hausarzt – Spezialist: eine Überweisungsstudie“ 09/2013 Publikation der Ergebnisse: Schneider, A., Hilbert, B., Hörlein, E., Wagenpfeil, S., Linde, K.: „The effect of mental comorbidity on service delivery planning in primary care: an analysis with particular reference to patients who request referral without prior assessment“, in: Dtsch Arztebl Int 110, S.653–659 09/2012 Vortrag zu den Ergebnissen, DEGAM-Kongress, Rostock: „Vergleich von Patienten, die Überweisungen ohne Arztkontakt in Anspruch nehmen, mit Patienten aus der normalen Sprechstunde.“ ENGAGEMENT FÜR DIE ALLGEMEINMEDIZIN 11/2014 Artikel in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin: „Was denkt der allgemeinmedizinische Nachwuchs? Ergebnisse einer Umfrage innerhalb der DEGAM-Nachwuchsakademie“ 11/2014 Artikel in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin: „Bericht über die WONCA-Europe-Konferenz 2014 in Lissabon“ Seit 07/2014 Mitglied AG „Internationales“, Junge Allgemeinmedizin Deutschlands 03/2014 Teilnahme Podiumsdiskussion, Hausärztetag Baden-Württemberg: „Allgemeinmedizin hat Zukunft! Perspektiven für Hausärzte mit der neuen Regierung?“ 11/2013 Artikel in der Zeitschrift MWW-Fortschritte der Medizin: „Allgemeinmedizinisches PJ-Quartal für alle Studierenden.“ 106 10/2013 Vortrag in der Berufsfelderkundung, Universität Duisburg-Essen: „Traumberuf Hausarzt!“ 09/2013 Leitung eines Workshops, DEGAM-Kongress, München: „Evidenzbasierte Medizin in der Hausarztpraxis. Einführung in die kritische Bewertung von Studien.“ 09/2013 Teilnahme an der Pressekonferenz, DEGAM-Kongress, München 06/2013 Vortrag auf dem GHA-Symposium, Baierbrunn „Allgemeinmedizin hat Zukunft!“ AUSZEICHNUNGEN 10/2012 – 09/2013 Hochschulstipendium, Technische Universität München 04/2012 – 09/2014 Mitglied der DEGAM-Nachwuchsakademie 09/2011 – 12/2012 Gefördert durch Jochner’sche Stiftung, Klinik Josephinum München WEITERBILDUNG ZUM FACHARZT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN Seit 11/2014 Ärztin in Weiterbildung: Innere Medizin, Krankenhaus Agatharied, Hausham MEDIZINSTUDIUM 10/2009 – 06/2014 Klinischer Teil, Technische Universität München Zweiter Abschnitt der Ärztlichen Prüfung, Note 1.0 10/2007 – 09/2009 Vorklinischer Teil, Ludwig-Maximilians-Universität, München Erster Abschnitt der Ärztlichen Prüfung, Note 2.0 PRAKTISCHES JAHR 08/2013 – 11/2013 Allgemeinmedizin: Praxis Dr. Lothar Schmittdiel, München 04/2013 – 07/2013 Allgemein-/Unfallchirurgie: Spital Linth, Uznach, Schweiz Viszeralchirurgie: Klinikum rechts der Isar, München 12/2012 – 03/2013 Notaufnahme: Royal London Hospital, London, Großbritannien Innere Medizin: Spital Linth, Uznach, Schweiz 107