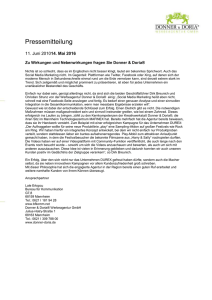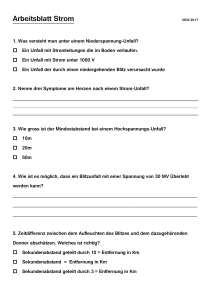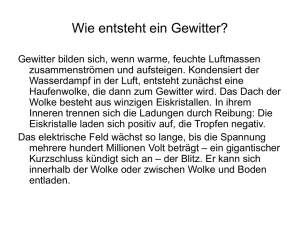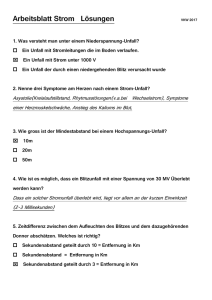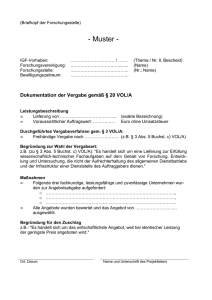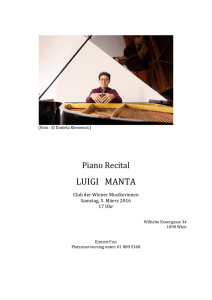Otto Donner und die „Forschungsstelle für Wehrwirtschaft“ 1939 bis
Werbung

Oliver Werner Otto Donner und die „Forschungsstelle für Wehrwirtschaft“ 1939 bis 1945 Die Studien von Volkswirten und Finanzökonomen im Rahmen der Wehrwirtschaftsforschung waren unverzichtbare, thematisch breit angelegte Expertisen, die unmittelbar in die Beurteilung der feindlichen Kriegswirtschaft und ab 1939 in die konkrete Gestaltung der deutschen Besatzungspolitik in Europa einflossen. An ihnen wird der hohe Stellenwert erkennbar, den die jeweilige institutionelle Einbettung und Anbindung an wirtschaftspolitische Entscheidungszentren für die Durchsetzungsfähigkeit einer Forschungseinrichtung besaß. Förderlich waren weiterhin eine große inhaltliche Anpassungsbereitschaft sowie die Fähigkeit, politische und wissenschaftliche Netzwerke für die eigene Wehrwirtschaftsforschung zu mobilisieren. Die „Forschungsstelle für Wehrwirtschaft“ (FfW) 1939 bis 1942 Hjalmar Schacht war bereits im November 1937 als Reichswirtschaftsminister zurückgetreten, und das Ministeramt wurde bis zur Neubesetzung durch den wenig einflussreichen Walther Funk kommissarisch von Hermann Göring verwaltet. Funk suchte nach seinem Dienstantritt im Februar 1938 Wege, um die relativ schwache politische Position seines Ministeriums auszubauen, und fand im Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Bernhard Rust, einen Verbündeten. Rust verkündete am 7. Januar 1939 per Runderlass die Bildung einer „Forschungsstelle für Wehrwirtschaft“. Beim Reichswirtschaftsministerium angesiedelt, allerdings der Funktion des „Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft“ (GBW) zugeordnet, sollte die Forschungsstelle der „wissenschaftlichen Bearbeitung aller mit der Vorbereitung und Durchführung einer Kriegswirtschaft zusammenhängenden Fragen“ dienen. Sie wurde u. a. beauftragt, „Verbindung mit den Hochschulen aufzunehmen, um die dortigen Arbeiten für Zwecke der Verwaltung nutzbar zu machen, sowie andererseits Anregungen und Vorschläge der Verwaltung an die Hochschulen gelangen zu lassen“. Während der Konflikt zwischen Göring und Funk weiter schwelte, wurde die FfW offenbar rasch als Akteur wahrgenommen. Bereits im April 1939 vereinbarte die „Volkswirtschaftliche Abteilung“ der IG Farben mit der Forschungsstelle einen „Informations- und Erfahrungsaustausch“. Heinrich Hellmer vom Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt stellte im Sommer 1939 die zu erwartenden wissenschaftlichen und publizistischen Aufgaben der Forschungsstelle zusammen. Hier findet sich auch eine Übersicht über die geplanten Referate und die gewünschten Wissenschaftler der FfW, darunter die Ökonomen Hans Langelütke (Referat Gewerbliche Wirtschaft), Eberhard Scherbening (Referat Arbeitseinsatz), Otto Donner (Referat Finanzwesen) und Alexander Görner (Referat Ausland). Auch wenn sich die personelle Zusammensetzung noch mehrfach ändern sollte, erwies sich die FfW -1- doch zu Kriegsbeginn als derart arbeitsfähig, dass sie auf Anregung von Achim von Arnim, seit 1933 Professor für Wehrwissenschaften an der Technischen Hochschule BerlinCharlottenburg, langjähriger Rektor der TH Berlin und bis zum seinem Tod im Juni 1940 Kurator der FfW, „ein Merkblatt über die ‚Wehrwirtschaft des Auslandes‘ als Lehrmaterial für Hochschullehrer zu wehrwirtschaftlichen oder allgemeinen volkswirtschaftlichen Vorlesungen“ verfasste. Der „Sachzwang des Krieges“ bot schließlich im Dezember 1939 den entscheidenden Impuls für Göring, die Dienststelle des GBW aufzulösen und wesentliche Aufgaben der Vierjahresplanbehörde zu übertragen. Damit verfestigte sich deren „machtpolitisches Übergewicht gegenüber den Wehrmachtsstäben“, und die gerade erst etablierte FfW fiel als weitere wehrwirtschaftliche Kompetenz an Görings Behörde. Otto Donner als Leiter der FfW Offenbar wusste man allerdings bei der Vierjahresplanbehörde vorerst nicht viel mit der Forschungsstelle anzufangen. Die ursprüngliche Referatsstruktur wurde jedenfalls rasch fallengelassen, einige Wissenschaftler sprangen ab, sodass im Frühjahr 1940 nur die Ökonomen Otto Donner und Eberhard Scherbening an der FfW verblieben. Leiter der Stelle wurde zunächst kommissarisch Otto Donner, dessen Position nach dem Kriegstod Achim von Arnims im Mai 1940 verstetigt wurde. Otto Donner, 1902 in Berlin geboren, hatte Volkswirtschaft in Berlin studiert und von 1925 bis 1933 am Berliner Institut für Konjunkturforschung (unter Ernst Wagemann) sowie dann bis 1934 unter Jens Jessen am Kieler Institut für Weltwirtschaft gearbeitet. Anschließend war er im Statistischen Reichsamt und beim Reichskommissar für das Kreditwesen beschäftigt. Donner, der sich vor allem mit konjunktur- und währungspolitischen Fragen befasste, gilt als innovativer Volkswirtschaftler, der sich bereits früh mit der finanzökonomischen Dynamik des „deficit spending“, aber auch mit der statistischen Generierung saisonbereinigter Daten befasste. Ab 1937 hatte er Lehrstühle in Hamburg und Berlin inne, zuletzt an der dortigen Wirtschaftshochschule. Für Donners Leitungstätigkeit erwies sich vor allem seine Vernetzung mit wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Stellen wie dem Mitteleuropäischen Wirtschaftstag als förderlich, dessen „Volkswirtschaftlichem Ausschuss“ er ab 1940 angehörte. Die engen Kooperationskontakte zur „Volkswirtschaftlichen Abteilung“ der IG Farben prädestinierten ihn zudem für das Umfeld der Vierjahresplanbehörde. Die finanzielle Ausstattung des FfW erlaubte es Donner, Wissenschaftlern, an deren Mitarbeit er interessiert war, verlockende finanzielle Angebote machen. Beides – seine Vernetzung und der materielle Hintergrund der Vierjahresplanbehörde – boten beste Voraussetzungen, mit einem kleinen Stamm an Mitarbeitern wissenschaftliche Expertise zu akquirieren. -2- Das Aufgabenfeld der FfW Die Forschungsstelle war innerhalb der Vierjahresplanbehörde dem Devisen-Referat von Friedrich Kadgien zugeordnet und bestand durchgängig aus nur wenigen festen Mitarbeitern, die zumeist über Kooperationsverträge und wissenschaftliche Netzwerke zusätzliche Expertise heranzogen. Paul Körner, Staatssekretär in der Vierjahresplanbehörde und ‚rechte Hand’ Görings, charakterisierte die FfW nach dem Krieg gegenüber alliierten Vernehmungsoffizieren etwas abschätzig als „kleine nichtssagende statistische Abteilung“, die neben ihrem Leiter „vielleicht noch 3 bis 4 Mitarbeiter“ gehabt habe. Tatsächlich arbeiteten an der FfW neben Otto Donner ab dem Frühjahr 1940 noch fünf weitere Wirtschaftswissenschaftler: Neben Eberhard Scherbening wurden neu eingestellt: Otto Barbarino, Wilhelmine Dreißig, Wilhelm Marquardt und Gottlieb Klauder. Dreißig, Marquardt und Klauder erhielten erstmals im Juli 1940 Lesesaalkarten der Preußischen Staatsbibliothek für eigene Recherchen, Barbarino folgte im Januar 1941. Donners Stelle – und mit großer Wahrscheinlichkeit auch die der übrigen Mitarbeiter – wurden über den preußischen Staatshaushalt finanziert. Die beiden wesentlichen Aufgaben der FfW mochten aus dem Zusammenhang des GBW herrühren und waren spätestens im Frühjahr 1939 festgelegt: Sie sollte zum einen Material zur statistischen Unterfütterung wirtschaftlicher Planungen und politischer Argumentationen bereitstellen und zum zweiten „wehrwirtschaftliche Lehrgänge“ sowie „Hochschullehrer-Tagungen“ durchführen. Die Lehrgänge und Tagungen fanden zunächst in enger Zusammenarbeit mit dem federführenden Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt statt, etwa im Februar und März 1939 zur „Fühlungnahme mit einem ausgewählten Kreis von Hochschullehrern, denen ein Ausschnitt aus den wehrwirtschaftlichen Arbeiten gezeigt werden sollte“. Es lag schon aus Gründen der Geheimhaltung nahe, dass sich die Forschungsstelle nach Kriegsbeginn auf ihre zweite Aufgabe konzentrierte, wehrwirtschaftlich relevantes Material statistisch aufzubereiten und in Form von Studien und Expertisen deutschen Behörden und militärischen Dienststellen zur Verfügung zu stellen. Die Expertisen der FfW fanden durchaus weite Verbreitung und sind heute nicht nur in den Beständen der Vierjahresplanbehörde archiviert, sondern auch beim Reichswirtschaftsministerium, beim Reichsfinanzministerium, beim Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt, beim Statistischen Reichsamt sowie bei der Reichsstelle für Raumordnung. Thematisch reichen die Studien von der wirtschaftlichen Bedeutung einzelner Länder und deren Kriegsfinanzierung über die Möglichkeiten, von den deutschen Truppen besetzte Länder optimal für die deutsche Kriegswirtschaft auszubeuten bis hin zu Studien über Entwicklungspotentiale europäischer Regionen unter der Prämisse einer vom Deutschen reich dominierten „Großraumwirtschaft“. Insgesamt bleibt es schwierig, die genauen Anteile einzelner Wissenschaftler an den jeweiligen Expertisen zu ermitteln, zumal die Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen nur kursorisch dokumentiert ist. Eine Liste des Kieler Instituts für -3- Weltwirtschaft vom 1940 führt beispielsweise 157 Forschungsarbeiten für diverse Auftraggeber auf. Zwar entstand ein Großteil im Auftrag des OKW, aber auch mindestens 15 Expertisen wurden für die FfW erstellt, die diese Arbeiten dann offenbar weiterreichte bzw. in eigene Recherchen einfließen ließ – eine Vorgehensweise, die in der deutschen Wehrwirtschaftsforschung offenbar üblich war. Nachweisbar ist auch die Beteiligung der FfW an Forschungen des Dortmunder Instituts für landwirtschaftliche Arbeitswissenschaft. Die Forschungsstelle für Wehrwirtschaft konzentrierte sich also keineswegs „von vornherein auf die bevölkerungspolitischen Aspekte der Wirtschaftspolitik in Südosteuropa“, auch wenn die Expertise über die wirtschaftliche Ausbeutung Südosteuropa vom Januar 1941 die in der historischen Forschung bekannteste Studie ist. Sie wurde bereits 1973 von Wolfgang Schumann veröffentlicht und seitdem immer wieder zitiert. In ihr kommt die durchgängige Ausbeutungsbereitschaft und Geringschätzung der Verfasser für europäische Nachbarvölker zum Ausdruck. Zugleich wird eine Logik der verkürzten Perspektive erkennbar, die im Verlauf des Krieges immer mehr in den Vordergrund rückte: Die deutsche Wirtschaft und die Besatzungsverwaltung sollten sich „weniger für die Inangriffnahme sozialer Maßnahmen und großer Wirtschaftsprojekte mit langer Reifezeit einsetzen“, sondern vielmehr auf Produktionen konzentrieren, „die schnelle Erträge erwarten“ ließen und „eine kurze Anlaufzeit“ hätten. Es bleibt allerdings zu prüfen, in welchem Umfang solche Überlegungen tatsächlich konzeptionelle Vorausplanungen darstellten. Auch ist die Autorenschaft keineswegs eindeutig: Otto Donner zeichnete zwar als Leiter der FfW für die anonymisierten Expertisen verantwortlich. Aber seine Fachkenntnisse lagen in erster Linie in der westeuropäischen Finanzpolitik, während sich Otto Barbarinos Tätigkeit in der FfW nach einiger Zeit „auf das besetzte Griechenland“ konzentrierte, bei ihm demnach eher Kenntnisse der südosteuropäischen Wirtschaft anzunehmen sind. Der Niedergang der Forschungsstelle im totalen Krieg 1942 bis 1945 Im Frühjahr 1942 veränderten sich für die Forschungsstelle für Wehrwirtschaft die Rahmenbedingungen grundlegend. Ausschlaggebend war der Machtantritt Albert Speers als Reichsminister für Bewaffnung und Munition im Februar 1942. Zwar blieb die FfW vorerst bestehen. Allerdings wurde ihre Existenz prekär und letztlich an die erodierende Machtposition Hermann Görings gebunden. Auch Otto Donner antizipierte den Bedeutungsverlust seiner Forschungsstelle und nutzte in den folgenden Monaten und Jahren seine zahlreichen Kontakte, um seinen Unabkömmlichkeitsstatus erfolgreich zu erhalten. Donner war darüber hinaus offenbar schon seit 1940/41 bereit gewesen, der USamerikanischen Botschaft in Berlin Details seiner Tätigkeit mitzuteilen. 1938 hatte er die USAmerikanerin Jane Esch geheiratet, eine Nichte von Mildred Harnack. Über deren Ehemann Arvid Harnack kam Donner in Kontakt mit einem Mitarbeiter der US-Botschaft, Donald R. Heath, der für das US-Finanzministerium „Informationen über die deutsche Wirtschaft -4- besorgen sollte“. In der Folge gehörte Otto Donner neben Arved Harnack zu einer wesentlichen Quelle für Wirtschaftsinformationen und berichtete etwa 1941 davon, dass er „eine statistische Ausarbeitung über die Sowjetunion anfertigen“ sollte. Er gehörte damit zu den Menschen, die mindestens indirekt der sowjetischen Führung im Frühjahr 1941 Hinweise auf einen bevorstehenden deutschen Angriff gaben. Die Enttarnung des Widerstandsnetzwerkes „Rote Kapelle“ überstand Otto Donner offenbar unbeschadet, auch wenn sein Name in Vernehmungen durch die Gestapo auftauchte. Selbst wenn Otto Donner lange „Görings finanzpolitischer Berater“ (Götz Aly) gewesen sein mag, spätestens ab 1943 sicherte ihm das nicht mehr die berufliche Existenz und schützte ihn schon gar nicht vor der Einziehung durch die Wehrmacht. Andere Stellen vergaben nun Unabkömmlichkeitsstellungen und Donner konnte diese Stellen für sich interessieren. Sein wichtigster Kontakt war Hugo Fritz Berger, Ministerialrat im Reichsfinanzministerium, der Donner im Sommer 1943 über das Auswärtige Amt eine Stelle beim Delegierten der Reichsregierung für Wirtschafts- und Finanzfragen bei der französischen Regierung, Hans Hemmen, verschaffte. Hier blieb er ein Jahr, „um ein Gutachten anzufertigen über die Steuerpolitik in Frankreich“, und reiste anschließend – wieder in Bergers Auftrag – im Herbst 1944 nach Budapest, „um die Möglichkeiten einer strafferen Steuerpolitik und stärkeren Kaufkraftabschöpfung in Ungarn zu untersuchen“. Diese letzte Expertise Otto Donners ist ein Dokument seines beruflichen Opportunismus. Während er in Budapest kaum relevante Gesprächspartner fand und keine aussagekräftigen Unterlagen zur Ansicht erhielt, wog er in seinem „Gutachten“ die Einnahmemöglichkeiten der ungarischen Regierung ab, wobei er vom „Wert des beschlagnahmten jüdischen Vermögens“ nur „die leicht realisierbaren Vermögensteile“ ins Kalkül zog, nicht hingegen den enteigneten jüdischen Grundbesitz. Daher werde nach ungarischer Ansicht „die dem Budget 1944 zugute kommende Ausbeute kaum ins Gewicht fallen“, was indes auch an „der abwartenden und einen scharf antijüdischen Kurs bewusst ablehnenden Politik“ der gegenwärtigen ungarischen Regierung liegen könnte. In dieser Zeit hatte Donner kaum noch etwas mit der stagnierenden FfW zu tun, deren Arbeit sich darin erschöpfte, statistisches Material aufzubereiten, beispielsweise für einen Bericht über die „finanziellen Leistungen der besetzten Gebiete bis Ende März 1944“. Eine statistische Zusammenstellung des Planungsamts im Speer-Ministerium vom Sommer 1944 bediente sich eher der Unterlagen der Forschungsstelle, als dass hier noch deren eigenständige Mitarbeit erkennbar wäre. In der partiell zusammenbrechenden Gesamtwirtschaft des Dritten Reiches entwickelten verschiedene Reichsstellen neue Ambitionen. So war das erwähnte Planungsamt im Frühjahr 1944 bestrebt, „zur Erkundung der feindlichen Wehrwirtschaft“ eine „wissenschaftliche Nachrichtenstelle“ aufzubauen. Im Reichswirtschaftsministerium organisierte Staatssekretär Otto Ohlendorf mit Blick auf mögliche Nachkriegsplanungen eine „Jagd nach vagabundierenden wirtschaftspolitischen Informationsträgern“. Sein Mitarbeiter Heinrich -5- Willy Lück wurde beauftragt, in einem „Sonderreferat“ den Grundstock für eine nachkriegsorientierte volkswirtschaftlich-statistische Abteilung aufzubauen. Donner, der inzwischen eine Professur an der Wirtschaftshochschule Berlin angetreten hatte, machte sich diesen Impuls zunutze und bot Ohlendorf den Überrest der Forschungsstelle an, der sie im Dezember 1944 ins Reichswirtschaftsministerium übernahm. Auf diese Weise wieder unabkömmlich gestellt, überlebte Donner den Krieg. Obwohl er seiner Funktionen im „Dritten Reich“ unter „automatic arrest“ gestellt wurde, gelang es ihm mit Hilfe der Familie seiner Frau, 1947 in die USA überzusiedeln. Eine zweite Karriere führte ihn im selben Jahr an die Georgtown University in Washington und in den 1950er Jahren zum Internationalen Währungsfonds. 1954 wurde er schließlich Exekutivdirektor der Weltbank, eine Funktion, die er bis 1968 innehatte. Otto Donner starb 1981 in Washington. Resümee Die berufliche Nachkriegsentwicklung Otto Donners führt uns aus dem Bereich der NSWehrwirtschaftsforschung heraus, belegt aber seine hohe Adaptionsfähigkeit und Anpassungsbereitschaft, die eben auch ein wichtiges Element der Mobilisierung von Wissenschaftsressourcen im Nationalsozialismus darstellte. Die FfW eignete sich als kleine Agentur in besonderer Weise, Anpassungsfähigkeit und persönliche Netzwerke in wissenschaftliche Expertise zu transformieren. Zugleich blieb sie flexibel und konnten ohne großen Aufwand erweitert oder reduziert und schließlich abgewickelt werden. Die Forschungsstelle funktionierte in dieser Dynamik solange als Kompetenzzentrum, wie sich die angestellten und assoziierten Wissenschaftler auf die rasch wechselnden politischen und militärischen Expertise-Erwartungen einstellen konnten. Dabei spielte die Stellung und Ausstattung der hinter ihnen stehenden Wehrwirtschaftsakteure eine entscheidende Rolle, nicht nur für ihre wissenschaftliche Durchsetzungsfähigkeit, sondern für ihre pure Existenz. Der schwindende Einfluss Hermann Görings reduzierte ab 1942 die Fähigkeit der Forschungsstelle für Wehrwirtschaft, Aufträge zu akquirieren und – ebenso wichtig – ihren Wissenschaftlern Unabkömmlichkeit zu bescheinigen. Schon deshalb bildeten die Netzwerke der einzelnen Wissenschaftler eine wichtige Voraussetzung für die Fortführung der Forschung unter den Bedingungen des „totalen Krieges“. Hier war Otto Donner erfolgreich, und sein Beispiel zeigt, wie wichtig die Bildung paralleler Netzwerke und Informationswege als eine – durchaus riskante – Absicherung in alle Richtungen sein konnte. Donner ermöglichte den Krieg – seine Expertisen zu lohnenswerten sowjetischen Zielen für deutsche Luftangriffe flossen unmittelbar in die militärischen Planungen ein – und im selben Augenblick versuchte er, die Kriegsanstrengungen des Deutschen Reiches zu unterminieren. -6-