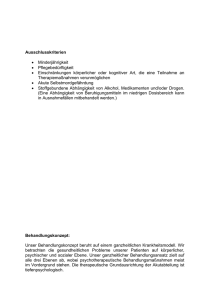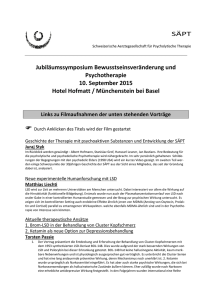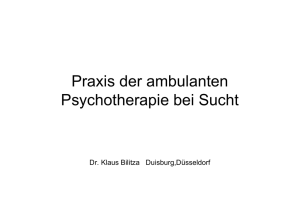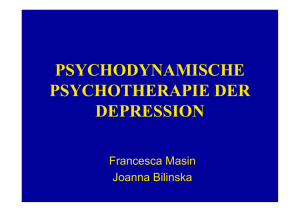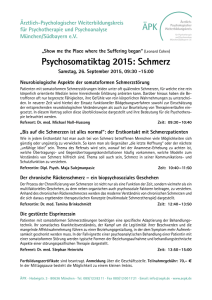interventionspsychologie - Institut für Psychologie
Werbung
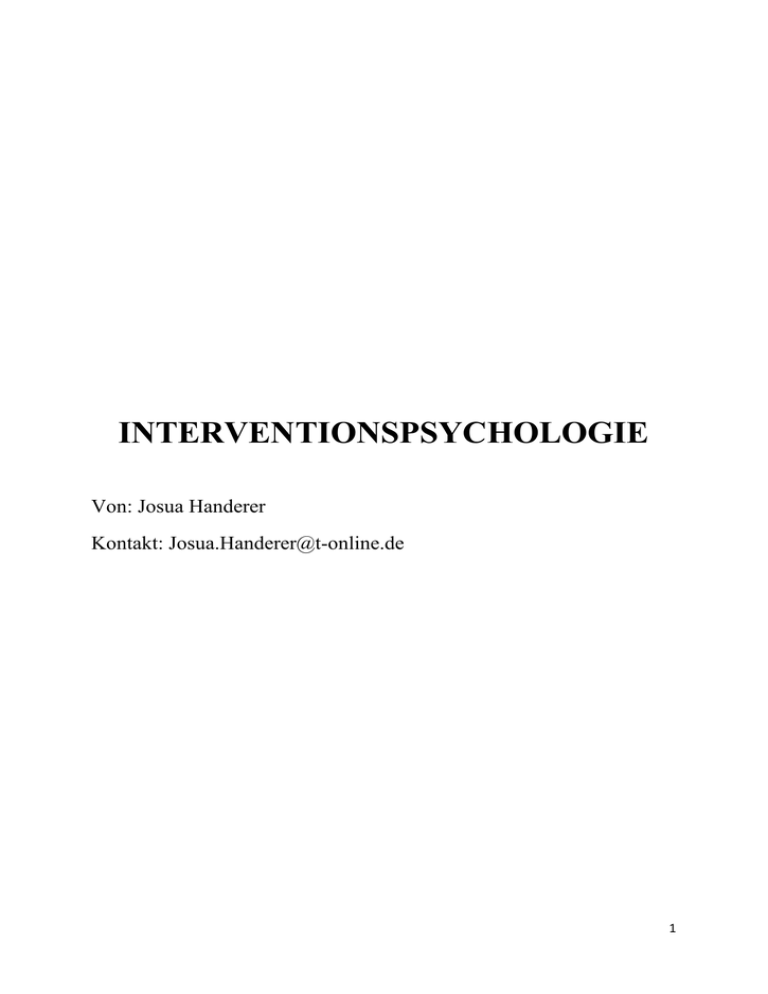
INTERVENTIONSPSYCHOLOGIE Von: Josua Handerer Kontakt: [email protected] 1 1. Wissenschaftstheoretische und methodische Grundlagen 1.1. Wissenschaftstheorische Grundlagen der Psychotherapie: 1.1.1. Allgemeines Blabla: Warum wissenschaftstheoretische Überlegungen im Kontext der Psychotherapie überhaupt wichtig sind: Wissenschaftstheorie reflektiert über die Grundlagen von Wissenschaft: Welche Ziele hat Wissenschaft? Welchen Kriterien muss sie genügen? Wann ist eine Theorie logisch konsistent? In welcher Beziehung steht die Theorie zur Praxis? Etc. etc. Die Wissenschaftstheorie kann vor diesem Hintergrund als eine Metawissenschaft beschrieben werden. Sie umfasst… a) Fachübergreifende Methodologien: z.B. die Falsifikationsmethodologie Poppers b) Epistemologien (=Erkenntnistheorien): z.B. Empirismus vs. Rationalismus c) Metatheorien: z.B. die strukturalistische Theoriekonzeption (Kuhn Sneed, Stegmüller) Im Kontext der Psychotherapie kann die Wissenschaftstheorie bei der Beantwortung folgender Fragen helfen: Ist Psychotherapie überhaupt wissenschaftlicher Analyse zugänglich? Welcher Zusammenhang besteht zwischen psychologischen Grundlagentheorien und psychotherapeutischen Methoden und ist ein solcher Zusammenhang überhaupt notwendig? Welche psychotherapeutischen Theorien sind wissenschaftlich bzw. empirisch überprüft? Etc. etc. 3 Wissensformen können unterschieden werden: 1) Nomologisches (=theoretisches) Wissen: umfasst Erkenntnisse über gesetzmäßige Zusammenhänge zwischen Variablen, wobei diese Zusammenhänge je nach wissenschaftstheoretischer Ausrichtung entweder deterministisch oder probabilistisch (s.u.) aufgefasst werden können. Beurteilungsmaßstab nomologischen Wissens ist das Wahrheitskriterium! Wissenschaftliches Beispiel: Gesetz der klass. Konditionierung Alltagsbeispiel: „Wie der Herr, so der Knecht“ 2) Nomopragmatisches (=technologisches) Wissen: ist das Wissen um Handlungsregeln (in der Psychotherapie: Indikationsaussagen); Beurteilungsmaßstab ist hier das Effektivitätskriterium! Wissenschaftliches Beispiel: Methode der Expositionstherapie Alltagsbeispiel: „Wer Großes will, muss sich zusammenraffen“ 3) Tatsachenwissen: Singuläre Beobachtungstatsachen ohne „Wenn-dann“ oder „Jedesto“-Verknüpfungen; Beurteilungsmaßstab von Tatsachen ist das Wahrheitskriterium! Wissenschaftliches Beispiel: Epidemiologische Verteilung einer Störung in einer Stichprobe Alltagsbeispiel: „Anna ist heute aber sehr zerstreut!“ Methodik vs. Methodologie: Methodik: Lehre von den allgemeinen Prinzipien einer bestimmten Klasse von Methoden Methodologie: Prinzipien der fachwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung / Theoretische Reflexion über die Methoden eines Faches 2 Wissenschaftliche Erkenntnisse sind immer vorläufig und unvollkommen, werden aber systematisch gewonnen und sind methodisch abgesichert. Im Vgl. zu anderen Erkenntnisformen sind wissenschaftliche Erkenntnisse daher: a) Präziser formuliert b) Systematischer überprüft c) Objektiver abgesichert Formuliert werden wissenschaftliche Erkenntnisse in Form von: Annahmen/Postulaten (deren Gültigkeit vorausgesetzt wird, so dass weitere Überlegungen möglich werden) Hypothesen (Aussagen, von denen man annimmt, dass sie sich empirisch bestätigen werden) Gesetzen (empirisch gut bestätigte Aussagen über UrsacheWirkungszusammenhänge) Theorien (mehrere zusammenhängende Gesetze) Modellen (vereinfachende Veranschaulichungen komplexer Zusammenhänge) Theorien leiten wissenschaftliches (und psychotherapeutisches) Handeln; „gute“ Theorien sind dabei durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 1) Relevanz/Wichtigkeit 5) Präzision/Klarheit 2) Fruchtbarkeit 6) Einfachheit 3) Praktikabilität/Anwendbarkeit 7) Operationalisierbarkeit 4) Ausführlichkeit/Explizitheit 8) Empirische Überprüfbarkeit (!!!) 1.1.2. Wissenschafts- bzw. erkenntnistheoretische Grundpositionen Empirismus vs. Rationalismus: Empiristisch geprägte Forschung: geht überwiegend induktiv vor, weshalb abstrakte/integrierende Theorien eine eher untergeordnete Rolle spielen; Ziel ist die Ansammlung von möglichst viel (vermeintlich) sicheren Faktenwissens. Beispiele: Behavioristen wie Watson, Skinner und Hull; heute v.a. in der Neurobiologie und physiologischen Psychologie verbreitet Rationalistisch geprägte Forschung: geht eher deduktiv vor und lässt sich dementsprechend von Modellvorstellungen, theoretischen Annahmen und hypothetischen Konstrukten leiten. Beispiele: Kognitionspsychologie, Persönlichkeitspsychologie etc. Vorteil: Theoriegeleitete Forschung verhindert ein beliebiges Ansammeln empirischer Daten! Deterministische vs. probabilistische Theorien: Deterministische Auffassungen: gehen davon aus, dass die Wirklichkeit durch eindeutige und unveränderliche Kausalgesetze determiniert ist und dass diese Gesetze wissenschaftlich offengelegt werden können. Beispiel: In den Anfängen der VT ging man davon aus, Verhalten anhand von Lerntheorien genau vorhersagen zu können (deduktiv-nomologischer Ansatz). Probabilistische Auffassungen (Humphrey): gehen dagegen davon aus, dass Wissenschaft lediglich probabilistische Kausalerklärungen liefern kann; sprich: sie kann zeigen, welche Ursachen F die Wirkung Y in einem System S zu einem Zeitpunkt t wahrscheinlicher machen und welche Ursachen I ihr entgegenwirken. In diesem Sinn sind alle wissenschaftlichen Modelle offen für Erweiterungen und Korrekturen. Beispiel: Verschiedene Ätiologiemodelle von Störungen etc. 3 Kritischer Rationalismus vs. strukturalistische Wissenschaftstheorie: Kritischer Rationalismus (Popper): Theorien sind das Primäre der Wissenschaft, sie können nicht verifiziert, sondern allenfalls falsifiziert werden, so dass jedes Wissen Vermutungswissen ist – gerade deshalb aber müssen die geltenden Theorien immer wieder kritisch an der Realität geprüft werden Ein vorwiegend normativer Ansatz, der vorschreibt, wie Wissenschaft sein soll, aber nur bedingt wiedergibt, wie sie tatsächlich ist! Strukturalistische Wissenschaftstheorie (Sneed, Stegmüller): stark von Thomas Kuhn geprägt => richtet sich gegen die strikte Trennung von Empirie und Theorie und bemüht sich um eine Rekonstruktion und Präzisierung von Theorien Metaphysischer Realismus vs. (sozialer) Konstruktivismus: Der metaphysische Realismus: kann heute als überholt gelten (Kant, Heisenbergsche Unschärferelation etc.) Er basiert auf 4 Prinzipien: 1) Prinzip der Unabhängigkeit: Wissenschaftliche Wahrheit ist unabhängig vom Wissenschaftler (absolute Objektivität) 2) Prinzip der Korrespondenz: Wahrheit ist eine Angelegenheit strikter Korrespondenz (Entsprechung) mit der Realität 3) Prinzip der Zweiwertigkeit: Jede wissenschaftliche Behauptung ist entweder wahr oder falsch 4) Prinzip der Eindeutigkeit: Es gibt nur eine vollständige und wahre Beschreibung der Realität Der Konstruktivismus: leugnet sämtliche Annahmen des Realismus und betont stattdessen, dass Wirklichkeit immer ein Konstrukt des einzelnen Menschen und/oder der Gesellschaft ist. Der soziale Konstruktivismus betont dabei v.a. letzteres, also die Tatsache, dass Wahrnehmung und Wissenschaft immer auch durch Konventionen, gesellschaftliche Übereinkünfte und andere soziale Faktoren beeinflusst werden. Die 4 Grundannahmen des sozialen Konstruktivismus (nach Gergen): 1) Unser Weltwissen entsteht nicht durch Induktion! 2) Die Begrifflichkeiten, mit denen wir die Welt verstehen, sind soziale Artefakte und als solche geschichtlich geworden. 3) Ob sich Auffassungen durchsetzen, hängt weniger von ihrer empirischen Validität als vielmehr von sozialen Prozessen (Prestige, Rhetorik etc.) ab. 4) Beschreibungen und Erklärungen der Welt sind selbst Formen sozialen Handelns und daher mit dem gesamten Spektrum menschlicher Aktivität verbunden. 1.1.3. Der soziale Konstruktivismus als Grundlage der Psychologie Psychologie ist in sich inhomogen, sie ist zugleich Wissenschaft, Technologie und Praxis (= 3 Tätigkeitsklassen): 1) Wissenschaft: wissenschaftliche Innovations- und Forschungstätigkeit Z.B. Entwicklung und/oder Überprüfung einer Lerntheorie 2) Technologie: technologische Innovations- und Forschungstätigkeit Z.B. Entwicklung und/oder Überprüfung einer Paartherapie 3) Praxis: nicht-forschende, technisch-praktische Tätigkeit Z.B. Durchführung einer Paartherapie Psychologie und Psychotherapie befassen sich mit Themen und Problemen, die in besonderem Maße durch soziale Konstruktionen bestimmt sind: Was ist z.B. eine psychische Störung? Wie sollte sie behandelt werden? Was ist eine erfolgreiche 4 Behandlung? – Die Antworten auf diese Fragen können empirisch nicht erzwungen werden, sondern müssen ausgehandelt werden! Beispiel: Diagnostische Kriterien (ICD-10, DSM-IV) stützen sich zwar auf empirische Befunde, sind aber letztlich das Ergebnis sozialer Übereinkünfte (WHO, APA)! Daraus folgt, dass es sich bei den gängigen Diagnosen um soziale Konstrukte handelt, die als solche nicht absolut-, sondern lediglich in einem bestimmten Raum und zu einer bestimmten Zeit gültig sind (raum-zeitliche Relativität). Daraus folgt jedoch nicht, dass verbindliche und empirisch möglichst gut abgesicherte Diagnosesysteme überflüssig wären. Im Gegenteil: Vor der Etablierung des DSM und der ICD (80er/90er) herrschte ziemliche Willkür! Experiment von Kendell (1978): Britische und amerikanische Psychiater bekamen denselben Fall auf Video gezeigt – kamen aber zu völlig unterschiedlichen Diagnoseergebnissen. Während die Mehrheit der Amis (69%) auf Schizophrenie tippte, klassifizierte die Mehrheit der Briten den Patienten als abnorme Persönlichkeit (75%). Fazit: Welche Annahmen sich durchsetzen, und zwar sowohl im Großen (WHO etc.) als auch im Kleinen (an einer UNI, in einer Klinik), hängt stark von sozialen Faktoren ab („scientific community“). Trotzdem bzw. gerade deshalb müssen psychologische Theorien und psychotherapeutische Verfahren empirisch fundiert sein! Die sozial-konstruktivistische Fundierung psychotherapeutischen Handelns am Beispiel dreier Problembereiche: 1) Die Erklärbarkeit psychischer Störungen Psychische Störungen werden heute nicht mehr deduktiv-nomologisch, sondern probabilistisch erklärt (s.o.); die so gewonnenen Ätiologiemodelle sind nicht nur offen für Verbesserungen, sondern lassen auch alternative Modelle gelten – vorausgesetzt natürlich: auch die alternativen Vorschläge stützen sich auf empirische Befunde! 2) Die Planbarkeit therapeutischen Handelns Die Systemiker vertreten die These dass menschliches Verhalten nicht vorhersagbar ist und therapeutische Maßnahmen daher nur bedingt geplant werden können! Diese radikale Sicht ist jedoch (zumindest nach Kübler) zurückzuweisen: 1) ist ein planvolles Vorgehen bei der Therapie unverzichtbar. 2) kann zumindest die Wahrscheinlichkeit richtiger Vorhersagen mit Hilfe empirisch bestätigter Theorien massiv erhöht werden. 3) Die Begründbarkeit therapeutischer Entscheidungen Westmeyers „Verhandlungsmodell“ zufolge sind bei der Begründung therapeutischer Entscheidungen mehrere Instanzen von Bedeutung: Der Praktiker (=Entscheider) steht einem Rationalitätsprüfer gegenüber, vor dem er sein Vorgehen zu rechtfertigen hat. Beide Seiten stützen sich in ihrer Argumentation auf Sachverständige (Methodiker, empirische Forscher etc.) und Zeugen (andere Praktiker, den Auftraggeber); der Rationalitätsbeurteiler bewertet schließlich die Entscheidung d. Praktikers. 4 Begründungsmuster lassen sich unterscheiden: 1. Rekurs auf empirisch bewährte Handlungsregeln (das Ideal) 2. Heuristische Nutzung grundwissenschaftlicher Theorien (in der Praxis wohl am häufigsten) 3. Fallbezogene Erweiterung eines therapeutischen Ansatzes 4. Einbettung in eine subjektive Wissensstruktur (geht heute eigentlich nicht mehr!) 5 1.2. Methodische Grundlagen: 1.2.1. Grundsätzliches zur Psychotherapieforschung Ernst zu nehmende Psychotherapieforschung wird erst seit Mitte des letzten Jahrhunderts betrieben. Eysenck sprach der Psychotherapie 1952 jede Wirksamkeit ab und brachte damit Bewegung in die Therapieszene (ein heilsamer Schock). C. Rogers war der erste, der Therapieverläufe dokumentierte und evaluierte (QSorts). Grawe („Psychotherapie im Wandel – Von der Konfession zur Profession“) setzte sich vehement für die empirische Fundierung therapeutischer Verfahren ein. Die ideologischen Grabenkämpfe der therapeutischen Schulen hielt er für überholt! Fragen der Psychotherapieforschung: Was sind die Effekte verschiedener Formen von Psychotherapie? Mögliche Effekte sind: Verschlechterung, keine Veränderung („NonResponse“), spontane Verbesserung (Spontanremission) und die therapeutische Verbesserung Von einer wirksamen Therapie ist zu erwarten, dass die Varianz der Testwerte und der Anteil therapiebedingter Verbesserungen höher als in der Kontrollgruppe ausfällt, während der Anteil an „Non-Respondern“ zurückgehen sollte. Wie wirksam sind verschiedene Formen von Psychotherapie bei bestimmten Störungsbildern? Wie interagieren die verschiedenen innerhalb einer Therapie wirksamen Variablen miteinander (Prozessanalyse)? Zu berücksichtigen sind: Merkmale der Störung, Merkmale des therapeutischen Vorgehens, Therapeutenvariablen, Patientenvariablen und Beziehungsvariablen (Therapeut-Patient). Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer bestimmten Therapie und zwar sowohl auf Makro- als auch auf Mikroebene? Die wissenschaftliche Evaluation einer Psychotherapieform erfolgt i.d.R. in mehreren Stufen: Phase I und II: Fallberichte, Einzelfallstudien, Kleingruppenstudien und Analogforschung Phase III: Kontrollierte und randomisierte Erfolgs- bzw. „Efficacy“-Studien, auch „Randomized Controlled Trials“ (RCT) genannt Phase IV: Realistische, im Feld durchgeführte Wirksamkeits- bzw. „Effectiveness“-Studien „APA Task Force on Psychological Intervention Guidelines“: Die Beurteilung einer Psychotherapieform hängt vom Evidenzgrad der Studien ab, mit denen die Wirksamkeit dieser Therapieform überprüft wurde. I) Als „wirksam“ wird eine Psychotherapieform eingestuft, wenn mindestens 2 randomisierte, kontrollierte Studien aus unabhängigen Gruppen (Evidenzgrad Ib) oder Metaanalyse(n) über mehrere randomisierte, kontrollierte Studien vorliegen (Evidenzgrad Ia). II) Als „möglicherweise wirksam“ wird eine Psychotherapieform eingestuft, wenn entweder eine Serie von gut angelegten quasi-experimentellen Studien wie z.B. „Effectiveness“-Studien“ oder experimentelle Einzelfallstudien vorliegen (IIb) oder eine randomisierte, kontrollierte Studie vorliegt (IIa). 6 III) „Bislang ohne ausreichende Wirknachweise“ sind Psychotherapieformen, die lediglich mit nichtexperimentellen oder deskriptiven Studien, also z.B. EinGruppen-Prä-Post-Vergleichen oder Korrelationsstudien (III) oder überhaupt nicht bzw. lediglich mit unsystematischen Einzelfallstudien überprüft wurden (IV). 1.2.2. Wichtige Begriffe der Psychotherapieforschung Vier Arten von Kontrollgruppen können unterschieden werden: 1) „No treatment“-Kontrollgruppe: Patienten werden weder behandelt, noch wird ihnen eine Behandlung in Aussicht gestellt (um Erwartungseffekte auszuschließen) 2) „Wartelisten“-Kontrollgruppe: Patienten bleiben zunächst unbehandelt, bekommen aber eine Behandlung in Aussicht gestellt 3) „Attention/Placebo“-Kontrollgruppe: Patienten erhalten unspezifische Behandlung, die sich lediglich in einem oder einigen wenigen Aspekten von der der Experimentalgruppe unterscheidet 4) „Standard-Treatment“-Kontrollgruppe: Patienten werden nach bewährter Methode behandelt, während in der Experimentalgruppe etwas Neues ausprobiert wird! „Efficacy“ vs. „Effektiveness“: Efficacy-Studien sind experimentelle Laborstudien (RCT-Studien = Randomized Controlled Trials); ihr Vorteil besteht darin, dass sie eine hohe interne Validität aufweisen; ihre externe Validität ist jedoch fraglich! Effectiveness-Studien sind Feldstudien ohne randomisierte Gruppenzuteilung und Treatmentmanipulation (=> Post-hoc-Vergleiche). Ihr Vorteil besteht in der hohen externen Validität, ihre Schwachstelle ist die interne Validität! Statistische vs. klinische Signifikanz: Eine statistisch signifikante Veränderung liegt vor, wenn sie mit einer hohen (meist 95%igen) Wahrscheinlichkeit nicht zufällig aufgetreten ist! Klinisch signifikant ist eine Veränderung nur dann, wenn sie darüber hinaus einen klinisch bedeutsamen Unterschied macht. Wenn Depressive sich nach einer bestimmten Therapie statistisch gesehen besser fühlen, aber trotzdem noch depressiv sind, ist das z.B. nicht der Fall! Welches Ergebnis als klinisch signifikant gelten kann, lässt sich durch die Festlegung von Cut-Off-Points und mit Hilfe des „Reliable Change Index“ (RCI) berechnen: a) Cut-off-Points: z.B. mindestens 2 Standardaweichungen vom Mittelwert der gestörten Population oder (bei starker Überlappung der Verteilungen): näher am Mittelwert der nicht-gestörten Population b) RCI: (x2 – x1) / Sdiff (Standardfehler der Differenzen) Einige Dinge, die zu beachten sind: Zufällige Zuweisung zu den Bedingungen (um sicherzustellen, dass Effekt auf Treatment zurückgeht) Behandlungsintegrität der Therapeuten = Manualtreue Unabhängige Effektbeurteilung (sprich: die Beurteilung der Effekte darf weder durch den Therapeuten, noch durch die Studienleiter erfolgen) Berücksichtigung der Spontanremissionsrate Hinreichend große Stichprobe (da mit hohem Drop-out zu rechnen ist)! Faustregel: Je größer der zu erwartende Effekt, desto kleiner kann die untersuchte Stichprobe sein! 7 1.2.3. Effektstärkenberechnung bei Interventionsstudien Der Unterschied zwischen Effektgröße und statistischer Signifikanz: Statistische Signifikanz: Der p-Wert (nach Fisher) entspricht der Wahrscheinlichkeit für die gefundene oder eine noch extremere Stichprobenmittelwertsdifferenz unter einer gültigen Nullhypothese. Der p-Wert hängt dabei von folgenden 3 Faktoren ab: a) der Mittelwertsdifferenz, b) der Merkmalsstreuung und c) der Stichprobengröße (nämlich über den Standardfehler der Mittelwertsdifferenz). Problem: Die statistische Signifikanz sagt noch nichts über die Größe, geschweige denn über die klinische Relevanz eines Effekts aus - bei hinreichend großer Stichprobe werden nämlich bereits sehr kleine Effekte signifikant! Die Effektgröße bzw. –stärke (= Cohens d): ist eine standardisierte Größe und wird von der Stichprobengröße kaum beeinflusst; eine hohe Effektgröße (s.u.) deutet daher auf einen „klinisch“ bzw. „praktisch“ bedeutsamen Unterschied hin. Obwohl die Angabe von Effektstärken von der APA und der DGP empfohlen und im CONSORT-Statement (Consolidated Standard of Reporting Trials) gefordert wird, hat sie sich noch nicht allgemein durchgesetzt! Möglicher Grund dafür: Unklare Richtlinien, was die Berechnung betrifft! Unterschiedliche Berechnungsmöglichkeiten: Zwei-Gruppen-Vergleich (unabhängige Stichproben): Die Differenz von 2 Mittelwerten wird an der Streuung relativiert, um die gefundene Streuung zu standardisieren. Als Schätzer für die Populationsstreuung kann dabei a) die Streuung einer der beiden Stichproben, b) die gepoolte Streuung beider Stichproben oder c) die Streuung der Kontrollgruppe verwendet werden! 𝑑= M 1 − M(2) SD(x) Ein-Gruppen-Prä-Post-Vergleich (abhängige Stichproben): a) SRM (Standardized Response Mean): Relativierung der Mittelwertsdifferenz an der der Streuung der Differenzen; eine hohe Effektgröße kann hier durch einen großen Mittelwertsunterschied und/oder durch eine homogene Veränderung (Homogenität der Differenzen) erzielt werden! 𝑑= M t1 − M(t2) SD(D) b) SES (Standardized Effect Size) nach Kazis: Relativierung der Mittelwertsdifferenz an der Streuung der Präwerte (um den Einfluss der Differenzhomogenität zu reduzieren) 𝑑= M t1 − M(t2) SD(Prä) c) Hartmann: Schätzt die Merkmalsstreuung in der Population über die gepoolte Streuung der Prä- und Post-Werte; sollte nur bei Varianzhomogenität verwendet werden, da durch die Intervention u.U. nicht nur der Mittelwert, sondern auch die Streuung verändert wird. 𝑑= M t1 − M(t2) SD(PräPost) 8 Mehr-Gruppen-Prä-Post-Vergleich: Relativierung an den gepoolten PräStreuungen der Gruppen oder (bei fehlender Varianzhomogenität): an der Kontrollgruppenstreuung Zur Interpretation von Effektstärken: Cohen: unterscheidet bei unabhängigen Stichproben zwischen kleinen (d = 0,2); mittleren (d=0,5) und großen Effekten (d=0,8). Neben der Effektstärke als solcher ist bei der Bewertung folgendes zu beachten: 1) Sollte der gefundene Effekt immer mit den in vergleichbaren Untersuchungen gefundenen Effektstärken verglichen werden; schließlich ist eine Intervention bereits dann sinnvoll, wenn ein positiver Effekt vorliegt; zeigen andere Interventionen jedoch größere Effekte ist die untersuchte Intervention aber trotzdem kritisch zu beurteilen! 2) Muss auf die Homogenität der Stichprobe geachtet werden; je homogener diese nämlich ist, desto größer die Effektstärke; Maßnahmen für sehr spezielle Gruppen werden daher leicht überbewertet! Wichtige Zusammenhänge: Je größer der erwartete Effekt ist, desto kleiner kann die Stichprobe sein! Je größer der zugelassene α-Fehler, desto kleiner kann die Stichprobe sein! Je größer die Teststärke [p(H1/H1) = (1 – β)] sein soll (=> meist 80%), desto größer muss die Stichprobe sein! Bei abhängigen Messungen reicht eine kleinere Stichprobe als bei unabhängigen! 9 2. Ethische und rechtliche Aspekte der Psychotherapie 2.1. Ethische Aspekte der Psychotherapie 2.1.1. Allgemeines: Im Zentrum der Ethik (griech. Ethos = Sitte, Brauch) steht die Kantsche Frage: „Was sollen wir tun?“ Die Ethik befasst sich dementsprechend a) mit menschlichen Handlungen, b) den dahinterstehenden Gesinnungen, c) den aus den Handlungen resultierenden Wirkungen und d) mit Werten und Normen. Ethische Überlegungen spielen auf allen Stufen der Psychotherapie eine wichtige Rolle; die Verantwortung trägt dabei immer der Therapeut! Indikationsstellung (Soll behandelt werden und wenn ja, wie?!) Planung/Durchführung Ablauf (Nähe und Distanz, Abhängigkeit etc.) Beendigung Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse Anders als für die Medizin gibt es für die Psychotherapie keine spezifischen Normen und Wertmaßstäbe. Das Vier-Prinzipien-Modell der Medizinethik (nach Beauchamp & Childress) kann jedoch als Leitfaden dienen. Das Vier-Prinzipien-Modell der Medizinethik: 1) Nichtschädigung (Verbot, Schaden zuzufügen) 2) Autonomie (Wünsche, Ziele und Wertvorstellungen d. Patienten respektieren) 3) Fürsorge (Recht auf Linderung) 4) Gleichheit/Gerechtigkeit (Gleichbehandlung aller) Probleme im psychotherapeutischen Kontext: a) Stehen die verschiedenen Prinzipien (z.B. das Wohl und der Wille des Patienten) oft im Widerspruch zueinander und erfordern daher Abwägungsentscheidungen! b) Ist gerade das Autonomieprinzip im psychotherapeutischen Kontext oft nur schwer einzuhalten. Schließlich ist Psychotherapie immer auch ein „Eingriff“ in das Persönlichkeitsrecht und nicht nur die Wiederherstellung eines Normalzustandes; darüber hinaus sind die Voraussetzungen für autonome Entscheidungen bei psychisch Kranken oft nicht gegeben! Drittens, endet die Autonomie des Patienten dort, wo sie die Autonomie Dritter einschränkt! Eng mit dem Autonomieprinzip hängt die Forderung nach informierter Einwilligung („informed consent“) zusammen. Informierte Einwilligung setzt auf Seiten des Patienten die Fähigkeit voraus, den eigenen Zustand adäquat einschätzen und beurteilen zu können (Einwilligungsfähigkeit). Vom Therapeuten ist Folgendes zu erwarten: Ausführliche Aufklärung (über die Krankheit, die geplanten Maßnahmen und deren Grenzen, mögliche Folgeprobleme etc.) Neutrale Darstellung aller möglichen (also auch anderer) Therapien (Kosten/Nutzen/Risiko) Nicht manipulative Information (manipulative Züge können z.B. die Auswahl, Akzentuierung oder Darstellung der Infos betreffen) 10 2.1.2. Sexuelle Übergriffe Sexuelle Kontakte zwischen Psychotherapeut und Klient sind bei Strafe untersagt (§174c StGB): das gilt nicht nur für die Zeit während der Therapie, sondern auch für die Zeit danach; die Verantwortung liegt dabei immer beim Therapeuten (auch wenn die Initiative vom Patienten bzw. der Patientin ausging!) Häufigkeit: Die Prävalenz sexueller Übergriffe im Rahmen psychologischer Beratung liegt in der BRD bei unter einem Prozent; das entspricht aber immerhin 300-600 Übergriffen pro Jahr! Risikofaktoren: weibliches Geschlecht, frühere sexuelle Gewalterfahrungen Ein nicht unwesentlicher Anteil der Opfer ist zum Zeitpunkt des Übergriffs minderjährig! Folgen: Studien zeigen, dass sexuelle Übergriffe im therapeutischen Kontext in den meisten Fällen (87%!) negative Folgen für die Betroffenen haben: Isolation, Misstrauen, emotionaler Rückzug; rund 90% sind traumatisiert, aber nur wenige leiten rechtliche Schritte ein! 2.2. Rechtliche Grundlagen der Psychotherapie 2.2.1. Geschichtlicher Abriss Bei den Psychotherapierichtlinien handelt es sich um Vereinbarungen zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (BVK) und den Krankenkassen; die Richtlinien legen fest, wer Psychotherapie anbieten darf und welche Leistungen erstattet werden. 1967: wurden die ersten Psychotherapierichtlinien verabschiedet. Den Richtlinien zufolge durfte heilkundliche Psychotherapie ausschließlich von Ärzten angeboten werden; von den Kassen erstattet wurden dabei lediglich tiefenpsychologische und psychoanalytische Therapien. 1972: wurde das Delegationsverfahren eingeführt Danach konnte Psychotherapie auch von Diplom-Psychologen, Soziologen oder Pfarrern durchgeführt werden, allerdings nur unter ärztlicher Aufsicht und sofern die Betroffenen eine 3-jährige Zusatzausbildung und 2 Jahre praktische Erfahrung aufweisen konnten! 1976: wurde das Delegationsverfahren auf Diplom-Psychologen eingeschränkt! 1987: wurde die Verhaltenstherapie in die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen! 1. Januar 1999: Mit dem Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes (erster Gesetzesentwurf: 1997) endet die diskriminierende Rechtslage für Psychologen (Delegationsverfahren). Es wurden 2 neue akademische Heilberufe geschaffen: 1) Psychologischer Psychotherapeut (PP) 2) Kinder- und Jugendpsychotherapeut (KJP) Diese Änderung des Berufsrechts hatte Auswirkungen auf das Sozialrecht, genauer: auf das Krankenversicherungsrecht; dabei wurden die beiden neuen Heilberufe in das bestehende Modell der vertragsärztlichen Versorgung integriert (Integrationsmodell) 11 2.2.1. Das Psychotherapeutengesetz und seine Folgen Titelschutz: Der Titel „Psychotherapeut“ ist rechtlich geschützt; er setzt eine entsprechende Approbation oder eine auf max. 3 Jahre „befristete Erlaubnis“ voraus. Voraussetzungen für die Approbation zum psychologischen Psychotherapeut: Abgeschlossenes Psychologiestudium (inklusive klinischer Psychologie) 3- bzw. 5-jährige Ausbildung (Voll-/Teilzeit) an einem staatlich anerkannten Institut und in einem wissenschaftlich anerkannten Verfahren (s.u.) mit abschließender Staatsprüfung - Gesamtumfang der Ausbildung: min. 4200 Stunden - Inhalte: Praktische Tätigkeit (in Psychiatrie und psychotherapeutischen Einrichtungen), theoretische Ausbildung (Grundkenntnisse anerkannter Verfahren, vertiefte Kenntnisse in einem Verfahren, medizinische Grundlagen etc.), Selbsterfahrung etc. Außerdem: Zuverlässigkeit und Würde; körperliche und geistige Eignung; deutsche Staatsbürgerschaft, EU-Angehöriger, heimatloser Ausländer Voraussetzungen für die Approbation zum Kinder- u. Jugendpsychotherapeuten: Abgeschlossenes Studium in Psychologie, Pädagogik oder Sozialpädagogik 3- bzw. 5-jährige Ausbildung (Voll-/Teilzeit) in einem staatlich anerkannten Institut und in einem wissenschaftlich anerkannten Verfahren (s.u.) mit abschließender Staatsprüfung - Gesamtumfang der Ausbildung: ebenfalls 4200 h; die Inhalte sind auch ähnlich, allerdings stärker auf Kinder und Jugendliche bezogen (Patienten von KJP: jünger als 21 Jahre) Einrichtung des Wissenschaftlichen Beirats für Psychotherapie (WBP) Aufgaben: Der WBP erstellt auf Basis wissenschaftlicher Wirksamkeitsstudien ein Gutachten zur Anerkennung psychotherapeutischer Verfahren Zugelassene Verfahren und Methoden: - Psychodynamische Therapien; Verhaltenstherapie; Gesprächspsychotherapie; Neuropsychologische Therapie; Systemische Therapie; Psychodramatherapie; Hypnotherapie; Interpersonelle Psychotherapie; EMDR Wissenschaftlich anerkannte Verfahren: - Psychodynamische Therapien (Tiefenpsychologie, Psychoanalyse) - Verhaltenstherapie - Gesprächspsychotherapie (seit 2002) - Systemische Therapie (seit 2009) Richtlinienverfahren (werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt): - Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie - Analytische Psychotherapie - Verhaltenstherapie Zusammensetzung des Wissenschaftlichen Beirats für Psychotherapie Der WBP besteht aus 12 wechselnden Mitgliedern: - 6 ärztliche Vertreter (aus den Bereichen Psychiatrie, Psychosomatik und Kinder- und Jugendpsychiatrie) - 4 psychologische Psychotherapeuten - 2 Kinder- und Jugend-Psychotherapeuten Kriterien für die wissenschaftliche Anerkennung eines Verfahrens: 1) Das Verfahren bzw. die Intervention bezieht sich auf Störungen mit Krankheitswert und führt zu einer Heilung oder Linderung derselben (es dürfen keine Hinweise auf schädliche Wirkungen vorliegen) 12 2) Die Wirksamkeit ist intersubjektiv feststellbar und replizierbar (Vorliegen entsprechender Studien) 3) Die Wirksamkeitsstudien müssen intern valide sein (RCTs) 4) Die Wirksamkeitsstudien müssen extern valide sein, d.h. unter den Bedingungen des hiesigen Gesundheitswesens effektiv durchführbar sein! Vom Berufsrecht (Psychotherapeutengesetz) ist das Sozialrecht zu unterscheiden; dabei handelt es sich, zumindest was die Regelung der gesetzlichen Krankenversicherungen betrifft, um Kollektivverträge zwischen den Krankenkassen und den kassenärztlichen Vereinigungen. Das Berufsrecht wird v.a. durch den wissenschaftlichen Beirat für Psychotherapie geprägt, das Sozialrecht vom Bundesausschuss für Ärzte und Krankenkassen! Integrationsmodell: Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten sind, sofern sie einen Kassensitz haben, Mitglied in den kassenärztlichen Vereinigungen. Die Kostenerstattung ist dabei im Sozialgesetzbuch, 5. Buch, wie folgt geregelt: Bezahlt werden (zumindest von der Gesetzlichen Krankenversicherung (Beihilfe) nur tiefenpsychologisch fundierte, analytische und verhaltenstherapeutische Verfahren (=Richtlinienverfahren), jedoch nur dann, wenn sie zur Behandlung einer Störung mit Krankheitswert eingesetzt werden (Erziehungs-, Sexual- oder Eheberatung sind demnach z.B. ausgeschlossen) Die Anerkennung eines Verfahrens als Richtlinienverfahren erfolgt durch den Bundesausschuss für Ärzte und Krankenkassen; Voraussetzungen sind: ein positives Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates, 10 Jahre erfolgreiche ambulante Anwendung, das Vorhandensein anerkannter Weiterbildungseinrichtungen und ein Beitrag zur Verbesserung der vertragsärztlichen Versorgung! Unterschieden wird zwischen 3 Kostenerstattungsverfahren: 1. Konsiliarbericht (wird von Vertragsärzten erstellt und stellt sicher, dass keine medizinischen Einwände gegen eine PT vorliegen) 2. Antragsverfahren (Antrag des Versicherten, der die Diagnose, Indikation und geplante Therapie des Therapeuten enthält) 3. Gutachterverfahren (wird von qualifiziertem Gutachter durchgeführt und soll sicher stellen, dass die Voraussetzungen der Psychotherapierichtlinien erfüllt sind) 13 3. Interventionsbezogene Diagnostik und Indikationsfragen 3.1. Allgemeines zu Diagnostik, Indikation, Intervention und Prognose 3.1.1. Diagnostik Die Diagnostik gilt als „verlängerter Arm der Therapie“. Sie spielt in allen Phasen der Therapie eine entscheidende Rolle: 1. Deskription der Ausgangslage Abklärung 2. Klassifikation der Störung (Störungsdiagnostik) (Erstgespräch, 3. Ätiologie und funktionale Analyse klinisches Interview, Fragebögen etc.) 4. Fallkonzeption (Problemstellung) 5. Selektion von Problem- und Zielbereichen Therapie 6. Differentielle und selektive Indikation (s.u.) (Prozess-, Verlaufs7. Prognose (s.u.) Ergebnismessung) 8. Prozess- u. Qualitätskontrolle => adaptive Indikation (s.u.) Katamnese 9. Evaluation (nach 6-, 12-, 18 Monaten) Vor diesem Hintergrund lassen sich allgemein 3 Arten bzw. Funktionen von Diagnostik unterscheiden: 1) Indikationsorientierte Diagnostik: Welche Störung liegt vor? Was soll durch die Therapie erreicht werden? - Ziel interventionsbezogener Diagnostik ist die Sammlung relevanter Infos, um auf deren Basis eine fundierte und optimale Indikationsentscheidung zu treffen! 2) Verlaufs- und Prozessdiagnostik: Wie entwickelt sich die Störung im Verlauf der Therapie? - Ziel ist zum einen die Qualitätskontrolle der jeweiligen Therapie, zum anderen die optimale Anpassung der gewählten Interventionen an den Patienten (adaptive Indikation) 3) Evaluative Diagnostik: War die Therapie erfolgreich? - Erfolgt einmal am Ende der Therapie und im Rahmen der Katamnese Voraussetzungen für eine fundierte Diagnose: a) Störungsspezifisches Wissen (Welche Störungen gibt es, wie äußern sie sich, wie entstehen sie etc. etc.) b) Veränderungswissen (Wie lassen sich psychische Störungen beeinflussen?) c) Messinstrumente zur Evaluation (z.B. die klassischen Diagnose-Systeme DSMIV und ICD-10; strukturierte und standardisierte Interviews, Checklisten etc.) Kriterien für die Auswahl von Messinstrumenten: Reliabilität (Sensitivität, Spezifität), Validität, klinische Nützlichkeit, Akzeptanz beim Patienten, Kosteneffizienz Beispiele für diagnostische Messinstrumente: - Symptomcheckliste (SCL-90): enthält 90 Items; man erhält z-Werte für 9 Skalen (darunter Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsicherheit, Depressivität etc.); darüber hinaus lassen sich 3 globale Kennwerte ermitteln: der GSI (General Symptomatic Index) entspricht dem Durchschnittswert über alle Antworten, der PST (Positive Symptome Total) entspricht der Anzahl positiver Antworten und der PSDI (Positive 14 Symptom Distress Index) dem Durchschnittswert über alle positiven Antworten. - Patienten-Stundenbogen (Version 2000): wird zur Verlaufs- und Prozessdiagnose eingesetzt; dabei beantwortet der Patient nach jeder Sitzung einen kurzen Fragebogen, anhand dessen sich folgende Dimensionen ablesen lassen: Ressourcenaktivierung durch positive Kontrolloder positive Selbstwerterfahrungen; positive Bindungserfahrung; positive Therapiebeziehung; Problemaktualisierung; positive Problembewältigungserfahrungen; positive Klärungserfahrungen Funktionen des Erstgesprächs: Gegenseitiges Kennenlernen durch Informationsaustausch: Klare Kontaktaufnahme und Gesprächseröffnung, gezieltes Fragen, Zusammenfassen, Rückfragen, Gelegenheit zu Gegenfragen geben etc. Einleitung der interpersonellen Beziehung: Empathie, Wertschätzung, Kongruenz; Definition der eigenen Rolle etc. Helferfunktion: Klare Absprachen treffen, Prozess in Gang bringen Verhaltensanalyse: SORKC-Modell (siehe: Klinische); außerdem: Unterscheidung zwischen interner und externer Situation, sowie internen und externen Konsequenzen 3.1.2. Indikation Bei Indikationsentscheidungen (von lat. „indicare“ = anzeigen) geht es allgemein um die optimale Zuordnung bzw. Anpassung von Patient und Intervention. Nach Paul ist die Indikationsfrage die zentrale Frage der Interventionsforschung; sie lautet: Welche Intervention ist für diese Person bzw. Situation mit diesem spezifischen Problem bei welchem Therapeuten und unter welchen Umständen am effektivsten? Zu berücksichtigen sind demnach Patienten-, Störungs-, Therapeuten-, Behandlungs- und Settingvariablen! Zu erheben sind diese Variablen im Rahmen der Diagnose, wobei entweder induktiv (Erhebung möglichst vieler Variablen) oder deduktiv (theoriegeleitet) vorgegangen werden kann. Grundsätzlich gilt, dass Indikation keine einmalige Ja/Nein-Entscheidung, sondern ein kontinuierlicher Prozess der Urteilsbildung ist. Folgende Arten von Indikation (bzw. Entscheidungsstrategien) können unterschieden werden: Selektive Indikation: Auswahl geeigneter Patienten für eine bestimmte Therapieform (bzw. Auswahl einer geeigneten Therapieform für bestimmte Patienten) Adaptive (bzw. prozessuale) Indikation: Anpassung des therapeutischen Vorgehens an den jeweiligen Einzelfall (Störung und Persönlichkeit); erfolgt diese Anpassung erst im Verlauf des therapeutischen Prozesses (was meistens der Fall ist), spricht man auch von prozessualer Indikation. Die adaptive Indikation wird oft als Gegensatz zur selektiven Indikation betrachtet; aufgrund der therapeutischen Identität hat sie jedoch Grenzen: Es wäre illusorisch zu glauben, ein einzelner Therapeut könnte in allen Schulen und Verfahren gleichermaßen zuhause sein! Differentielle Indikation: liegt immer dann vor, wenn verschiedene Therapieverfahren zur Auswahl stehen; es also nicht nur um die Frage geht, ob ein bestimmter Patient für eine bestimmte (meine) Therapie geeignet ist. 15 Der „Uniformitätsmythos“ (Kiesler), sprich die Annahme, zwischen verschiedenen Patienten, Therapeuten oder Therapieverfahren bestünde kein Unterschied, hat heute kaum noch Anhänger; stattdessen werden zunehmend störungsspezifische Interventionen entwickelt und möglichst differenzierte Indikationsentscheidungen verlangt. Untersuchungsbeispiel: Bei chronischen Depressionen mit frühem Trauma ist Psychotherapie sowohl effektiver als auch nachhaltiger als eine Psychopharmakabehandlung mit Antidepressiva. Bei chronischen Depressionen ohne Kindheitstrauma ist es umgekehrt: Hier wirkt die Psychopharmakabehandlung besser als die Psychotherapie! Indikation ist dann rational, wenn… die Entscheidung ein bestimmtes Ziel verfolgt! Mittel und Methoden zur Zielerreichung bewusst ausgewählt werden! Mittel und Ziele begründbar miteinander verknüpft sind! Präferenzen explizit normativ begründet sind! alle relevanten Kenntnisse herangezogen werden! die Einzelentscheidungen in eine größere Strategie eingebunden sind! die Entscheidungen logisch aus den Vorannahmen abgeleitet werden! Bedarf, Nutzen, Kosten und Effektivität von Alternativen abgewogen wurden (setzt eine gegenseitige Anerkennung der verschiedenen therapeutischen Schulen voraus) moralische und ethische Dimensionen berücksichtigt werden! 3.1.3. Intervention Psychologische Interventionen sind eine heterogene Gruppe von Methoden, die Verhalten, Erleben und Kognition von Personen mit unterschiedlichen Problemen in Richtung eines bestimmten Ziels beeinflussen sollen. Ziel psychologischer Interventionen ist es a) funktionales Verhalten aufzubauen, b) dysfunktionales Verhalten abzubauen, c) Selbstkontrolle zu erwerben, d) Verhaltenssteuerung zu lernen, e) soziale Anpassung zu erzielen, f) die Lebensqualität zu steigern und g) Problembewältigung zu ermöglichen Kurz: es geht um die Förderung von Klärungs-, Problemlöse- und Selbststeuerungskompetenz! Was den verschiedenen Strategien und Techniken gemeinsam ist, ist a) ihre wissenschaftliche Orientierung (ihnen allen geht es um die Anwendung psychologischer Prinzipien auf praktische Problembereiche), b) offene Problemund Störungskonzepte und c) bestimmte Interventionsprinzipien ( wie z.B. ein vertrauensvolles Arbeitsverhältnis, Transparenz, Psychoedukation und Information, funktionale Problem- und Bedingungsanalyse, Zielorientierung, ökonomische Gestaltung, evidenzbasierte Begründung etc.)! Psychologische Prinzipien, die verschiedenen Interventionen zugrunde liegen, sind z.B. das Prinzip der positiven und negativen Selbst- und Fremdverstärkung; das Modelllernen; das Phänomen der Löschung und Habituation etc. Psychologische Intervention ist eine auf den individuellen Patienten bzw. die konkrete Problemlage zugeschnittene Gesamtstrategie! Dabei sind folgende Interventionsphasen zu unterscheiden: 1. Erstkontakt 5. Einsatz bestimmter Verfahren 2. Analysephase 6. Stabilisierung 3. Zielformulierung 7. Ablösung 4. Therapeutisches Angebot 8. Beendigung 16 3.1.4. Prognose Längsschnittstudien, in denen die Entwicklung von Respondern und Non-Respondern verglichen wird, zeigen: Die später erfolgreich behandelten Patienten sind bereits in der 3. Woche zu erkennen (erste Symptomreduktion) Dementsprechend liegt die Chance auf eine erfolgreiche Behandlung schon nach 3 Wochen, sofern in dieser Zeit keine Besserung eingetreten ist, nur noch bei 50%! 3.2. Wirkfaktoren psychologischer Intervention 3.2.1. Konzept der therapeutischen Wirkfaktoren (nach Frank) Therapeutische Wirkfaktoren sind die Elemente einer Therapie, die zu einer Besserung beitragen. Unterschieden werden kann zwischen spezifischen und allgemeinen Wirkfaktoren: Allgemeine Wirkfaktoren unterscheiden sich von spezifischen in zweierlei Hinsicht: 1. Es wird angenommen, dass sie in jeder Form von psychologischer Intervention mehr oder weniger stark zum Tragen kommen. 2. Anders als spezifische Wirkfaktoren, sind sie nicht beliebig variierbar, d.h. sie sind nicht Bestandteil einer bestimmten Interventionstechnik, die ein Therapeut einzusetzen erlernt. Allgemeine (in allen Therapieformen zum Tragen kommende) Wirkfaktoren nach Frank: 1) Intensive, emotional besetzte, vertrauensvolle Beziehung zwischen Hilfesuchendem und Helfer 2) Ein Erklärungsprinzip (Glaubenssystem, Mythos) bezüglich der Ursachen der Erkrankung und eine damit zusammenhängende Methode für ihre Beseitigung 3) Eine Problemanalyse, die dem Patienten Möglichkeiten der Bewältigung eröffnet 4) Die Vermittlung von Hoffnung mit dem Ziel, die Demoralisation des Patienten abzubauen 5) Die Vermittlung von Erfolgserlebnissen, die sowohl die Hoffnung nähren, als auch dem Patienten zunehmend Sicherheit und Kompetenz vermitteln 6) Die Förderung emotionalen Erlebens als Voraussetzung für eine Einstellungsund Verhaltensänderung Die Effekte spezifischer Wirkfaktoren lassen sich durch den Vergleich spezifischer und unspezifischer Behandlungen messen (s.o.: Attention-Kontrollgruppe) 3.2.2. Allgemeines Modell von Psychotherapie (nach Orlinsky und Howard) Das Allgemeine Modell von Psychotherapie (AMP) versucht die verschiedenen bestehenden psychotherapeutischen Modelle (Psychoanalyse, Verhaltenstherapie etc.) zu integrieren und die hinter diesen Modellen stehenden klinischen Theorien in einen begründeten Zusammenhang zu stellen. Genau wie bei dem Konzept der therapeutischen Wirkfaktoren geht es also um eine Systematisierung psychotherapeutischer Prozesse; dadurch soll nicht zuletzt ein allgemeiner Rahmen bereitgestellt werden, anhand dessen die unterschiedlichen Formen von Psychotherapie miteinander verglichen werden können. 17 Es werden 3 Gruppen von Einflussfaktoren (Variablengruppen) unterschieden: 1) Input-Variablen: Elemente des Behandelns z.B. „Deutung“ in der Psychoanalyse oder „Verstärkung“ in der Verhaltenstherapie 2) Prozess-Variablen: Elemente des Behandlungsprozesses, die jeweils als Voraussetzung für Veränderungen angesehen werden z.B. Bewusstwerdung unbewusster Inhalte, Erhöhung der Selbstexploration oder gehäuftes Auftreten erwünschter Reaktionen 3) Output-Variablen: Elemente der Behandlungseffekte (sprich: grundsätzliche Veränderungen auf Seiten des Patienten) Neben den 3 Variablengruppen werden im AMP 6 zentrale Komponenten psychotherapeutischer Verfahren unterschieden: 1) Formaler Aspekt: Therapievertrag Dazu zählen Vereinbarungen bezüglich des Settings, der Frequenz, der Therapiedauer, der Finanzierung etc. 2) Technischer Aspekt: Therapeutische Maßnahmen Welche therapeutischen Maßnahmen im Einzelnen ergriffen werden (z.B. Reitkonfrontation oder freie Assoziation etc.) wird vor dem Hintergrund des jeweiligen Behandlungsmodells und der zugrunde gelegten Störungstheorie (Ursachen etc.) festgelegt und mit dem Patienten abgesprochen 3) Interpersonaler Aspekt: Therapeutische Beziehung Ist sowohl personenabhängig als auch abhängig vom jeweiligen Therapiemodell (in der Gesprächstherapie nimmt die Beziehung z.B. einen weitaus größeren Raum ein als in verhaltenstherapeutischen Ansätzen) 4) Intrapersonaler Aspekt: Innere Selbstbezogenheit Wie erleben Patient und Therapeut sich selbst? Auf was dabei besonders geachtet wird, hängt vom jeweiligen Therapiemodell ab (in der Psychoanalyse geht‟s z.B. v.a. um die Stärke der Abwehr, in der Gesprächstherapie dagegen v.a. um das Ausmaß an Kongruenz bzw. Inkongruenz) 5) Klinischer Aspekt: Unmittelbare Auswirkung des Therapiesitzung Damit sind die Reaktionen von Patient und Therapeut auf das therapeutische Geschehen gemeint, z.B. der Gewinn einer Einsicht, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, das Gefühl des Angenommenseins etc. 6) Zeitlicher Aspekt: sequentiell verlaufender Prozess Darunter fallen zeitlich aufeinanderfolgende Abläufe (z.B. Exploration, Diagnose, Ablösung etc.) oder Gesetzmäßigkeiten (z.B. Zunahme an Vertrautheit usw.) Folgende Wirkfaktoren müssen nach dem AMP zueinander passen: 1) Behandlungsmodell des Therapeuten 2) Erkrankung des Patienten 3) Therapierelevante Merkmale des Therapeuten (Menschenbild, Sympathie etc.) 4) Therapierelevante Merkmale des Patienten (Motivation etc.) 3.2.3. Modell der allgemeinen Psychotherapie (nach Grawe) Die vier Wirkfaktoren einer allgemeinen Psychotherapie nach Grawe: 1) Ressourcenaktivierung Wirksame Psychotherapie knüpft an die positiven Möglichkeiten, Eigenheiten, Fähigkeiten und Motivationen des Klienten an, indem die Interventionen auf die Stärken und Schwächen des Klienten abgestimmt werden. 18 Beispiel: Die Erklärung einer Störung und die daraus resultierenden Behandlungsvorschläge müssen auch und v.a. vom Klienten für einleuchtend und plausibel gehalten werden! 2) Problemaktualisierung Dieser Wirkfaktor wird von Grawe als „Prinzip der realen Erfahrung“ definiert; er versteht darunter den Umstand, dass die Probleme, wegen derer ein Klient in die Therapie kommt, in der Therapie zunächst real erfahren werden müssen, wenn sie behoben werden sollen. Beispiele: geschieht in der Verhaltenstherapie z.B. durch Konfrontationsübungen; in der Gesprächstherapie durch Spiegelung etc. 3) Aktive Hilfe zur Problembewältigung Wirksame Psychotherapien ermöglichen dem Klienten die Erfahrung, Probleme zu bewältigen, die zuvor unlösbar erschienen Beispiel: in der Verhaltenstherapie z.B. durch Verhaltensübungen 4) Motivationale Klärung Wirksame Psychotherapien klären die Frage, warum ein Patient so empfindet und sich so verhält wie er es tut. Beispiele: in der Psychoanalyse durch Aufdeckung unbewusster Inhalte, in der Verhaltenstherapie durch Verhaltensanalyse etc. Später erweiterte Grawe das Modell zum Würfelmodell der allgemeinen Psychotherapie; dazu setzte er die vier Wirkfaktoren zueinander in Beziehung und erweiterte sie um zwei Dimensionen, sofern sie jeweils aus intrapersonaler als auch aus interpersonaler Perspektive betrachtet werden können. Die sechs Seiten des Würfels stellen demnach jeweils unterschiedliche Perspektiven dar, unter denen therapeutisches Handeln betrachtet werden kann: 1. Klärung – Bewältigung (s.o.) 2. Problemaktivierung – Ressourcenaktivierung (s.o.) 3. Intrapersonal – Interpersonal Mithilfe des Würfels lässt sich zum einen beschreiben, welche der Perspektiven die einzelnen Therapieverfahren jeweils betonen, zum anderen lassen sich für jede Perspektive kritische Fragen formulieren, an denen sich die Therapieplanung orientieren kann: Z.B. Wird den individuellen Motiven und innerpsychischen Problemen des Patienten genügend Rechnung getragen (intrapersonale Klärung)? Wird der zwischenmenschlichen Funktion dieser Probleme in realen Beziehungen Rechnung getragen (interpersonelle Klärung)? 3.2.4. Die Konsistenztheorie von Grawe (siehe: Kapitel 10) Anliegen der Theorie: Grawe versteht die Konsistenztheorie als Basis der von ihm geforderten allgemeinen (über den therapeutischen Schulen stehenden) Psychotherapie; damit diese nicht in einen willkürlichen Eklektizimus abdriftet, soll die Konsistenztheorie dabei helfen, konkrete Fälle zu konzeptualisieren und so eine adäquate Therapieplanung ermöglichen. Kurz: Die Konsistenztheorie ist ein allgemeines Modell zur Genese psychischer Störungen Grundannahmen der Konsistenztheorie: Nach Grawe streben Organismen nach Konsistenz; er versteht darunter die Übereinstimmung bzw. Vereinbarkeit gleichzeitig ablaufender neuronaler und psychischer Prozesse. 19 Darüber hinaus geht Grawe von 4 evolutionär angelegten Grundbedürfnissen aus: 1. Dem Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle 2. Dem Bedürfnis nach Lustgewinn bzw. Unlustvermeidung 3. Dem Bedürfnis nach Bindung 4. Dem Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung bzw. -schutz Den Grundbedürfnissen entsprechen motivationale Schemata, die dazu dienen, die Grundbedürfnisse zu befriedigen bzw. zu schützen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen Annäherungs- und Vermeidungsschemata. Das Bedürfnis nach Konsistenz ist selbst kein Grundbedürfnis, sondern ein „Grundprinzip psychischen Funktionierens“; trotzdem hängen Konsistenzregulation und Bedürfnisbefriedigung eng miteinander zusammen. Die beiden wichtigsten Formen von Inkonsistenz im psychischen Geschehen sind nämlich: a) Die Inkongruenz: die Nichtübereinstimmung der realen Erfahrungen mit den aktivierten motivationalen Zielen (kurz: Inkongruenz tritt auf, wenn In beiden Fällen sind gleichzeitig, miteinander die Bedürfnisbefriedigung scheitert) unvereinbare neuronale b) Die Diskonkordanz: die Nichtvereinbarkeit zweier oder mehrerer Erregungsmuster aktiviert! gleichzeitig aktivierter Grundbedürfnisse oder motivationaler Tendenzen (Annäherungs- und Vermeidungstendenzen hemmen sich gegenseitig) Psychische Störungen resultieren aus einer über längere Zeit andauernden Erhöhung des Inkonsistenzniveaus. Schlussfolgerungen für die Therapie Psychotherapie wirkt v.a. über zwei Prozesse: 1. Konsistenzverbesserung durch Reduktion der wichtigsten Inkongruenzquellen im Leben des Patienten (Störungsund problemspezifische Interventionen) 2. Konsistenzverbesserung durch bedürfnisbefriedigende Erfahrungen im Therapieprozess (Beziehungsgestaltung und Ressourcenaktivierung) - Welche Bedürfnisse dabei ins Zentrum gestellt werden (Orientierung/Kontrolle; Lustgewinn/Unlustvermeidung; Bindung; Selbstwert) hängt vom jeweiligen Patienten und dessen Störung ab Die Beziehung zw. Therapeut und Patient ist überaus wichtig; oft, z.B. bei der Behandlung von Depression, macht sie über die Hälfte des Behandlungserfolgs aus. Ergo: Komplexe, methodenreiche Programme erzeugen nicht zwangsläufig bessere Ergebnisse; gelingt die positive Beziehungsgestaltung nicht, kann ein Misserfolg bereits frühzeitig vorhergesagt werden! 20 4. Humanistische Verfahren 4.1. Allgemeines zur humanistischen Psychologie 4.1.1. Selbstverständnis und Menschenbild der humanistischen Psychologie 1962: Gründung der „Gesellschaft für humanistische Psychologie“ durch Charlotte Bühler, Carl Rogers und Abraham Maslow Anders als bei anderen therapeutischen Schulen werden unter dem Begriff der „humanistischen Psychologie“ z.T. sehr unterschiedliche Ansätze subsummiert (theoretische Heterogenität). Gemeinsam ist diesen Ansätzen „lediglich“ ihr humanistisch geprägtes Menschenbild und die Leitprinzipien, an die sie sich halten (paradigmatisch-methodische Homogenität). Wichtige Vertreter der humanistischen Psychologie: Carl Rogers (1902-1987) Gesprächspsychotherapie Charlotte Bühler (1893-1974) Abraham Maslow (1908-1970) Positive Psychologie (Bedürfnispyramide...) Fritz Perls (1983-1970) Gestalttherapie Viktor Frankl (1905-1997) Existenzanalyse bzw. Logotherapie Iacov Moreno (1889-1974) Psychodrama, Gruppentherapie Eric Berne (1910-1970) Transaktionsanalyse Wichtige humanistische Verfahren: Gesprächspsychotherapie; EncounterGruppen; Transaktionsanalyse; Gestalttherapie; Psychodrama; Musik-, Tanz- und Kunsttherapie; bioenergetische Therapie Die humanistische Psychologie versteht sich als Gegenbewegung zur Tiefenpsychologie (Psychoanalyse) und zum Behaviorismus (Verhaltenstherapie); sie wird deshalb auch als „dritte Kraft“ bezeichnet. Wogegen sie sich wendet: gegen ein monokausales, mechanistisches, biologistisches und deterministisches Menschenbild Worauf sie sich beruft (philosophische Grundlagen): Existenzphilosophie (Kierkegaard, Buber etc.): Der Mensch ist frei; seine zentralen Aufgaben sind Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung Humanismus: Der Mensch ist von Natur aus gut! Sich selbst und die Welt zu verbessern gehört zu seiner Bestimmung! Phänomenologie: Die Erfahrungswirklichkeit ist das Entscheidende! An den aktuellen und konkreten Erfahrungen des Einzelnen muss daher angesetzt werden! Wofür sie steht (Menschenbild): Autonomie und intersoziale Dependenz: Der Mensch ist selbstbestimmt, in seiner Freiheit jedoch sozial verantwortlich! Selbstverwirklichung: Der Mensch strebt nach Wachstum und Selbstaktualisierung Ziel- und Sinnorientierung: Das menschliche Handeln ist nicht nur durch materielle Güter, sondern auch durch (humanistische) Werte und Ideale bestimmt! Ganzheitlichkeit: Gefühl und Vernunft, Körper und Geist etc. bilden eine Einheit! 21 4.2. Die Gesprächspsychotherapie (nach C. Rogers) 4.2.1. Theoretische Grundlagen der Gesprächstherapie Die Aktualisierungstendenz: ist ein übergeordnetes Prinzip der menschlichen Verhaltensorganisation; Rogers versteht darunter die jedem Organismus innewohnende Tendenz, sich optimal zu entwickeln, genauer: sich zu erhalten (Sicherung der Existenz, Aufrechterhaltung der eigenen Identität etc.) und zu entfalten (Weiterentwicklung des Selbst in Abhängigkeit von der sich verändernden Umwelt). Die beiden zentralen Komponenten der Aktualisierungstendenz sind die Selbstbehauptungs- und die Selbstaktualisierungstendenz. Die Aktualisierungstendenz ist eine Art Wachstumspotenzial; wichtig ist jedoch, dass dieses Potenzial nur genutzt werden kann, wenn keine Bedrohung herrscht! Das Bedürfnis nach „positiver Zuwendung“ („positive regard“) ist das zentrale Bedürfnis des Menschen; erst wenn dieses Bedürfnis zu einem gewissen Grad erfüllt ist, kann Selbstaktualisierung stattfinden! Erfahrung: Erfahrung ist nach Rogers immer bewusst und gegenwartsbezogen! Er versteht darunter Repräsentationen der Umwelt, die vom Einzelnen dahingehend bewertet werden, ob sie zur Erhaltung und/oder Entfaltung des Selbst beitragen oder nicht (=> Selbsterfahrung). Symbolisierung: ist der Prozess des Bewusst- bzw. Gewahrwerdens von Erfahrungen; Erfahrungen, die eine Bedrohung für das Selbstkonzept darstellen, werden dabei nach Rogers oft nur teilweise oder gar nicht symbolisiert (s.u.): Exakte Symbolisierung: Vollständige und bewusste Abbildung der eigenen Wirklichkeit; z.B. wenn man sich darüber bewusst ist, dass die Einladung zu einem Vortrag sowohl Freude (über die wissenschaftliche Anerkennung) als auch Angst und Unbehagen (wegen möglicher Blamage) auslöst. Abgewehrte oder verzerrte Symbolisierung: z.B. wenn die Einladung zum Vortrag lediglich die körperlichen Symptome von Angst auslöst, diese Symptome aber nicht zugeordnet werden können oder auf etwas anderes (z.B. Wut über einen Studenten) zurückgeführt werden. Das Selbst bzw. Selbstkonzept: ist nicht identisch mit der Person, sondern entspricht dem Bild, das eine Person von sich selbst hat; es handelt sich dabei also um ein Konstrukt, weshalb das Selbst auch veränderbar ist! Der Inhalt des Selbst erwächst nach Rogers daraus, wie man sich selbst in der Interaktion mit der Umwelt erfährt und bewertet! Das Selbst ist dem Bewusstsein zugänglich, muss aber nicht immer bewusst sein; verändert werden (Selbstaktualisierung) kann es jedoch nur, wenn es bewusst ist!!! Kongruenz/Inkongruenz: meint die Übereinstimmung bzw. Diskrepanz zwischen Selbstkonzept und Erfahrung. Kongruente Personen: sind mit sich in Einklang (= „echt“, „authentisch“); ihre Erfahrungen werden von ihnen nicht als Bedrohung für ihr Selbstkonzept wahrgenommen und können daher vollständig symbolisiert werden, was wiederum die Voraussetzung für Weiterentwicklung bzw. Selbstaktualisierung ist (s.o.)! Inkongruente Personen: sehen sich durch bestimmte Erfahrungen in ihrem Selbstkonzept bedroht und klammern sie daher aus, anstatt sie in ihr Selbstkonzept zu integrieren (unvollständige oder verzerrte Symbolisierung). Letzteres aber wäre notwendig, um sich zu entfalten (=> Überbetonung der Selbsterhaltungstendenz auf Kosten der Selbstaktualisierungstendenz)! Die Konsequenzen von Inkongruenz sind gravierend: Inkongruenz als Ursache psychischer Störungen (insbes. Angst) 22 Inkongruenz als Ursache von Stagnation und Selbstentfremdung: Man ignoriert, was zentral ist; erhält keine akkuraten Infos mehr über die eigenen Motive, das eigene Befinden etc., lebt an den eigenen Bedürfnissen vorbei, kann keine klaren Ziele mehr formulieren (mangelnde Problemlösekompetenz) und entwickelt sich nicht weiter! 4.2.2. Die zentralen Prinzipien der GPT Ziele der Gesprächstherapie: Das übergeordnete Ziel ist die Reduktion von Inkongruenz im Erleben, damit der Patient die durch die Inkongruenz hervorgerufenen Störungen (Ängste, Depressionen, Beziehungsprobleme etc.) überwindet. Erreicht wird dieses Ziel: …durch eine Veränderung des Selbstkonzepts (Idealerweise gelingt es dem Klienten am Ende der Therapie zu sich selbst die Beziehung aufzubauen, die der Therapeut ihm angeboten hat) …indem der Patient zu Selbstexploration und Selbstaktualisierung sowie einer differenzierteren Wahrnehmung und Bewertung der Wirklichkeit angestoßen wird (kurz: durch eine Aktualisierung des Erlebens im Hier und Jetzt!) …durch Bewusstwerdung und Integration geleugneter Erfahrungen Darüber hinaus soll die GPT zu mehr Autonomie und Selbstverantwortlichkeit befähigen (Was bin und will ich eigentlich?) Beziehung: Der entscheidende Faktor ist nach Rogers die Beziehung zwischen Therapeut und Klient; damit sie wirksam wird, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Der Therapeut muss 3 Voraussetzungen erfüllen: 1. Empathie: Er muss a) den inneren Bezugsrahmen des Patienten verstehen (sprich: die Welt durch seine Augen sehen), b) das innere Erleben des Patienten unmittelbar und trotzdem reflektiert miterleben und c) das auf diese Weise verstandene und im wahrsten Sinne des Wortes Nachvollzogene mitteilen (Prinzip der „Spiegelung“). 2. Kongruenz: Er muss kongruent bzw. „echt“ sein, d.h.: sich über seine eigenen Gefühle und Gedanken gegenüber dem Patienten bewusst sein und sie gegebenenfalls artikulieren (Vermeidung reaktiver und primärer Inkongruenz) 3. Bedingungsfreie positive Beachtung: Er muss dem Patienten positive Zuwendung schenken und darf diese nicht an Bedingungen knüpfen; dazu gehört nicht zuletzt, eigene Wertvorstellungen weitestgehend zu suspendieren. Erreicht werden soll durch die bedingungslose Zuwendung, dass sich der Patient angenommen fühlt und sich daher auch unangenehmen, selbstwertbedrohlichen Erfahrungen zuwenden kann. Zum Zusammenhang der 3 Variablen: Im Vordergrund steht die Empathie, sofern Verstehen nach Rogers nur dann empathisch ist, wenn der Therapeut kongruent ist und seine bedingungsfreie positive Beachtung nicht nachhaltig beeinträchtigt ist! Voraussetzungen auf Seiten des Patienten: Der Patient muss a) unter Inkongruenz leiden und b) das Beziehungsangebot des Therapeuten annehmen bzw. darauf ansprechen. Grundsätzlich gilt: Der Klient weiß selbst am besten, wer er ist und wo er hin will (Aktualisierungstendenz!); daraus folgt zweierlei: 1) Der Therapeut hat sich mit Deutungen und Anweisungen zurückzuhalten; er tritt nicht als Experte auf, sondern als Gesprächspartner, dem es primär darum geht, 23 den Klienten besser zu verstehen und der dem Klienten gerade dadurch (etwa durch „Spiegelung“) hilft, sich selbst besser zu verstehen ( Non-direktives, personen- bzw. klientenzentriertes Vorgehen) 2) Im Zentrum der Therapie stehen das unmittelbare Erleben des Patienten und die Frage, wie dieser seine Erfahrungen bewertet – nicht aber die Konflikte (Psychoanalyse) und Symptome (VT) des Patienten. 3) Es geht in der GPT weniger um das Ziel (das oft noch gar nicht klar ist) als vielmehr um den Weg! Prinzip der Sparsamkeit: Die Gesprächstherapie basiert auf einigen wenigen theoretischen Postulaten. Rogers nennt dementsprechend nicht mehr als 6 notwendige und hinreichende (!) Bedingungen für eine erfolgreiche Therapie (s.o.): 1. Zwei Personen befinden sich in psychologischem Kontakt (Begegnung). 2. Die erste Person, der Patient, befindet sich in einem Zustand der Inkongruenz, ist verletzbar bzw. ängstlich. 3. Die zweite Person, der Therapeut ist in der therapeutischen Beziehung kongruent. 4. Der Therapeut schenkt dem Patienten bedingungslose positive Zuwendung. 5. Der Therapeut versteht empathisch den inneren Bezugsrahmen des Patienten. 6. Der Patient nimmt wenigstens in einem gewissen Ausmaß die bedingungslose positive Zuwendung und das empathische Verstehen des Therapeuten wahr. Der zentrale Wirkmechanismus, den Rogers hinter diesen Prinzipien vermutet, ist nicht komplizierter als die Prinzipien selbst: Emotionale Wärme und bedingungslose Akzeptanz bieten dem Patienten die nötige Sicherheit, um bedrohliche und widersprüchliche Erfahrungen zu symbolisieren und schließlich zu integrieren => Der Patient lernt sie gewissermaßen so zu akzeptieren, wie der Therapeut sie akzeptiert! Diese Annahme entspricht den Annahmen der Bindungstheorie (Bowlby), der zufolge eine sichere Bindung die Voraussetzung für Explorationsverhalten (und damit für Weiterentwicklung) ist! Zusammenfassung: Die wichtigsten Besonderheiten der GPT nach Rogers sind: A) Die zugrundegelegte Persönlichkeitstheorie Vom Humanismus und der Existenzphilosophie geprägt; geht davon aus, dass das menschliche Sein durch Wachstum, Selbstwerdung, Freiheit und Begegnung gekennzeichnet ist! B) Das existenzphilosophische Menschenbild Der Mensch versucht das zu sein, was er „in Wahrheit“ ist C) Die spezifische Therapeut-Patienten-Beziehung D) Das Verständnis von Psychotherapie als zwischenmenschliche Begegnung, die sich nichtsdestotrotz wissenschaftlich untersuchen lässt 4.2.3. Konkretes Vorgehen (Techniken und Methoden) Erstgespräch (i.d.R. 1-5 Sitzungen): Im Erstgespräch geht es primär um folgende Fragen: 1. Welche psychische Störung weist der Patient auf? 2. Ist Psychotherapie induziert (und wenn nein: welche anderen Hilfen gibt es?) 3. Ist GPT induziert und wenn nein, welche andere Psychotherapieform ist erfolgversprechender? 4. Welches Setting ist angemessen (Einzel-, Gruppen- oder Paartherapie)? 5. Welcher zeitliche Rahmen scheint angemessen? 24 Klar unterschieden werden sollten der Probetherapieteil und der Informationsteil: Probetherapie: Erstes In-Beziehung-Treten, gesprächstherapeutischer Umgang mit den geäußerten Problemen etc. Informationsteil: Info über die Therapieform und den üblichen Therapieverlauf, Abklärung der Formalitäten (Finanzierung, zeitlicher Rahmen usw.) Einige praktische Tipps: „Was führt sie zu mir?“ statt: „Welches Problem führt sie zu mir?“ oder „Wie kann ich ihnen helfen?“ So wenig Struktur wie möglich (abhängig vom Patienten) Wenig explorativ vorgehen, stattdessen die Selbstexplorationsfähigkeit des Patienten einschätzen Auf Erwartungen, Befürchtungen und Reaktionen des Patienten achten Indikationskriterien für GPT: Es liegt eine psychische Störung vor, die durch Inkongruenz bedingt ist und durch die Aufhebung derselben vermutlich geheilt werden kann Selbstkonzept und Beziehungsfähigkeit sind gegeben Die Inkongruenz wird wahrgenommen und besteht der Wunsch nach Veränderung Beziehungsangebot kann wahr- und angenommen werden (notwendige Bedingung!) Differentielle Indikation: Ist generell schwer, da über die störungsspezifische Wirkung unterschiedlicher Psychotherapieformen bisher nur wenig bekannt ist Grawes Metaanalyse zeigt, dass GPT besser als andere Therapien dazu geeignet ist, die internalen Kontrollüberzeugungen eines Patienten zu fördern! Wie für alle Therapien gilt auf für die GPT: Die Passung zw. Therapeut, Patient und Methode muss stimmen! Spezifisch für die GPT ist, dass GPT recht niedrige Anforderungen an den Klienten stellt und daher ein breites Indikationsspektrum hat (freilich handelt es sich bei harten Fällen meist weniger um Therapie als um Begleitung) Prognose: Generell gilt: Es gibt kein einzelnes prognostisches Kriterium für Therapieerfolg Positiv sind jedoch: Ansprechbarkeit bzw. Annahme des therapeutischen Beziehungsangebots und ein hohes Maß an Selbstexploration auf Seiten des Klienten Um die Ansprechbarkeit des Klienten auf das Beziehungsangebot des Therapeuten zu überprüfen, bietet sich der „Bielefelder Klientenfragebogen“ an; dieser wird nach jeder Sitzung ausgefüllt (25 Items zur Sitzung, 4 stufige Antwortskala), wobei der Therapeut die Antworten des Patienten zuvor für sich schätzt. Prognostisch günstig für eine positive P-T-Beziehung ist,… - wenn das Erleben der Sitzung vom P überwiegend positiv eingeschätzt wird - wenn zwischen den Einschätzungen des T und des P keine nennenswerten Differenzen bestehen - wenn die Einschätzungen nicht nach jeder Sitzung ähnlich sind, sondern in Abhängigkeit von deren tatsächlichem Verlauf variieren Ein wesentliches Element der GPT ist es, das Erleben des Klienten nicht nur zu verstehen, sondern zu verbalisieren, um es ihm auf diese Weise zu spiegeln. 25 Die Äußerungen bzw. „sprachlichen Interventionen“ des Therapeuten beziehen sich demnach v.a. auf: Das im Hier und Jetzt tatsächlich gegebene und stattfindende Erleben des Patienten Die Bedeutung dieses Erlebens für das Selbstkonzept des Patienten Die Wertvorstellungen, die der Patient mit diesem Erleben verbindet Die Bedeutung, die das Erleben für die therapeutische Beziehung hat 4.2.4. Zur historischen Entwicklung und den Unterarten der Gesprächstherapie Historische Entwicklung der GPT nach Rogers: 40er Jahre: Phase der nicht-direktiven Therapie Im Zentrum stand zunächst der Gedanke, dass sich Therapeut und „Klient“ (!) auf Augenhöhe begegnen müssten (es gehe eher um Beratung als um Heilung)! Gefordert wurden Anteilnahme, emotionale Wärme und Akzeptanz 50er Jahre: Gefühlverbalisierende Phase In den 50ern verschob sich der Fokus von der Non-Direktivität zur Klientenzentrierung => Entwicklung verschiedener Interventionstechniken (Spiegelung; Verbalisierung von Gefühlen etc.) Gefordert wurde, den Klienten zu Selbstexploration anzustoßen Ebenfalls in die 50er Jahre fällt die Formulierung der 3 Basisvariablen des Therapeutenverhaltens: Empathie, Kongruenz und bedingungslose positive Zuwendung 60er Jahre: Phase der Erlebniszentrierung Die therapeutische Beziehung rückt ins Zentrum 70er Jahre: Phase der Erweiterung und Integration Subsummierung verschiedener therapeutischer Ansätze (kommunikationstheoretische- und kognitionspsychologische Theorien etc.) in das gesprächstherapeutische Konzept! Heute lassen sich im Wesentlichen 3 Formen von Gesprächspsychotherapie unterscheiden: 1) Die klassische-rogerianische GPT S.o. 2) Die prozesserfahrungsorientierte GPT (= process-experiential psychotherapy) Wurde von Laura Rice entwickelt, ist stärker handlungsorientiert und betont v.a. emotionale Prozesse Ziel ist die Veränderung negativer emotionaler Schemata bzw. die Konstruktion neuer emotionaler Bedeutungen. Zwar ist der therapeutische Prozess in ein Beziehungsangebot eingebettet (Empathie, Kongruenz, BPB) – der Therapeut übernimmt darin aber eine direktivere Rolle als in der klass. Gesprächstherapie: Es werden gezielte Anregungen für eine neue, konstruktivere Verarbeitung gegeben! 3) Die zielorientierte GPT Basiert weniger auf Rogers als auf kognitionsund motivationspsychologischen Ansätzen Der Therapeut wird als Experte betrachtet und soll als solcher direktiv in den Therapieprozess eingreifen; er soll sich an die konkreten Probleme des Patienten halten, konkrete Vorschläge unterbreiten, Annäherungstendenzen des Patienten fördern und Vermeidungstendenzen reduzieren. Eine zentrale Bedeutung wird dem Explizierungsprozess beigemessen: Probleme sollen möglichst genau (Ursachen, Motive, zugrundeliegende Annahmen etc.) verbalisiert und dem Patienten so bewusst gemacht werden! 26 4.2.5. Empirische Evaluation: Zur Wirksamkeit der Gesprächstherapie Die Metaanalyse von Grawe (s.o.: „Psychotherapie im Wandel“) umfasst 35 kontrollierte Wirksamkeitsstudien zur Gesprächspsychotherapie. Insgesamt 2400 Patienten mit einem im Vergleich zu anderen humanistischen Verfahren recht breiten Diagnosespektrum (Angststörungen, Alkoholismus, Schizophrenie etc.) Dauer der Studien: meist unter 20 Sitzungen; max. 33 Sitzungen Vorwiegend (2/3) ambulante Einzeltherapie, aber auch stationäre- und Gruppentherapie Güteprofil der Studien (klinische Relevanz, interne Validität, Güte der Information, Vorsicht bei der Interpretation, Reichhaltigkeit der Messung, Güte und Reichhaltigkeit der Auswertung, Reichhaltigkeit der Ergebnisse, Indikationsrelevanz): Methodisch sind die Studien zur GPT eher unterdurchschnittlich z-Werte unter 0 bei interner Validität, Güte der Information und Vorsicht bei der Interpretation Der Aufwand bei der Messung und Auswertung der Therapieeffekte ist jedoch überdurchschnittlich (Einbezug des Therapieprozesses!) z-Werte über 0 bei Reichhaltigkeit der Messung, Auswertung und Ergebnisse und bei Indikationsrelevanz Ergebnisse der Metastudie und späterer Studien: Es zeigen sich fast immer signifikante Therapieeffekte für die Symptomatik und Befindlichkeit der Klienten (sowohl in Prä-Post-Vergleichen als auch in Kontrollgruppenvergleichen) Das gilt insbesondere für die ambulante Therapie von Angstpatienten Im Persönlichkeits- und interpersonalen Bereich führt GPT dagegen seltener zu Verbesserungen, wenngleich sich auch hier im Vergleich zu anderen Therapieformen recht regelmäßig positive Veränderungen zeigen. Im Gruppensetting sind die Effekte im zwischenmenschlichen Bereich stärker als in Einzelsettings! Im stationären Setting ist die GPT generell weniger erfolgreich (wobei das auch damit zusammenhängen könnte, dass stationäre Fälle meist schwerer erkrankt sind) Vergleich mit anderen Therapieformen: Insgesamt überzeugend nachgewiesene Wirksamkeit (und das bei einem recht breiten Störungsspektrum und verhältnismäßig kurzer Dauer!) Vergleichsstudien zw. GPT und Psychoanalyse sind selten, deuten aber auf eine Überlegenheit der GPT hin Vergleich mit der VT (20 Studien) belegen eine deutliche Überlegenheit der VT (und zwar nicht nur im Symptombereich!) Ergebnisse zur Wirkweise: Die Therapievariablen Empathie und bedingungsfreie positive Beachtung (BPB) haben genau wie die Patientenvariable Selbstexploration einen positiven Einfluss auf das Therapieergebnis. Für die Therapeutenvariable Kongruenz konnte dagegen kein Zusammenhang zum Therapieerfolg nachgewiesen werden. Autonome Patienten profitieren stärker als submissive Patienten! Patienten mit gutem Sozialverhalten und wenig Ängstlichkeit sprechen besser auf GPT an! Ergebnisse zur differentiellen Indikation: Wenn Veränderungen im zwischenmenschlichen Bereich angestrebt werden, scheint GPT eher weniger geeignet zu sein. 27 Non-direktive Therapie ist kontrainduziert bei Patienten mit gering entwickelter Autonomie und vorherrschend externalen Kontrollerwartungen; kurz: GPT setzt voraus, dass die Patienten die Fähigkeit und Motivation haben, sich relativ selbstbestimmt mit ihren Schwierigkeiten auseinanderzusetzen! Zusammenfassung: Die empirische Evaluierung der GPT ist im Vergleich zu vielen anderen Therapieformen verhältnismäßig weit fortgeschritten, so dass differenzierte Aussagen über ihre Wirksamkeit möglich sind! GPT ist ein nachweislich wirksames Verfahren für ein breites Spektrum von Störungen (Angst- und Zwangsstörungen, Alkoholismus, Schlafstörungen etc.) Die Qualität der P-T-Beziehung spielt jedoch in allen Verfahren eine große Rolle, so dass sich hier die Frage stellt, ob die Ergebnisse spezifisch für die GPT sind! Im Vergleich zu kognitiv-verhaltenstherapeutischen Verfahren (systematische Desensibilisierung, Training sozialer Fertigkeiten etc.) ist die GPT unterlegen – und zwar auch, wenn der Erfolg an Kriterien gemessen wird, für die sich die GPT als besonders wirksam erwiesen hat. Zu Unrecht vernachlässigt wird im klassischen Konzept der GPT: a) die Tatsache, dass auch der Patient starken Einfluss auf die therapeutische Beziehung hat und b) die Bedeutung der Gesprächs-führung! Die prozesserlebnisorientierte und die zielorientierte GPT schneiden im Vergleich zu behavioralen Methoden besser ab als die klassische GPT nach Rogers! Fazit: Therapeutische Gespräche allein können sehr bedeutsame Veränderungen im klinischen Zustandsbild von Patienten, auch solchen mit schwerwiegenden Symptomen, herbeiführen. Aber: Ein spezifisch auf die Bewältigung der Probleme zugeschnittenes Vorgehen scheint insgesamt trotzdem effektiver zu sein als ein rein klärungsorientiertes Vorgehen! 28 5. Psychodynamische Psychotherapien 5.0. Allgemeines zur Tiefenpsychologie 5.0.1. Was ist Tiefenpsychologie? Tiefenpsychologie ist ein Sammelbegriff für psychologische und psychotherapeutische Ansätze, die dem Unbewussten einen zentralen Stellenwert für die Erklärung menschlichen Verhaltens und Erlebens beimessen; darüber hinaus beschreiben tiefenpsychologische Ansätze das psychische Geschehen als dynamischen Prozess, insofern ihm verschiedene Triebe und Konflikte zugrunde liegen (man spricht daher auch von psychodynamischen Ansätzen). Die klassische Form der Tiefenpsychologie ist die Psychoanalyse Freuds; seine Schüler (Adler, Jung etc.) beschritten jedoch z.T. schon bald eigene Wege, so dass es heute eine Vielzahl tiefenpsychologisch fundierter Theorien und Therapien gibt, die sich zum Teil stark unterscheiden (s.u.). Wichtige Vertreter und Ausprägungen der Tiefenpsychologie sind: Sigmund Freud (1856-1939) Begründer der klassischen Psychoanalyse (s.u.) Alfred Adler (1870-1937) Begründer der Individualpsychologie C.G. Jung (1875-1961) Begründer der analytischen Psychologie Otto Rank (+1939) Neopsychoanalyse Karen Horney (+ 1952) Neopsychoanalyse Harry Stack Sullivan (+ 1949) Neopsychoanalyse Erich Fromm (+ 1980) Neopsychoanalyse/humanistische Psychologie Erik Erikson (1902-1994) Ich-Psychologie 5.0.2. Biographische Schlaglichter zu Sigmund Freud Geboren 1956 in Freiberg (Mähren); ab 1860 in Wien Medizinstudium in Wien Ab 1986: Privatpraxis als Nervenarzt; Freundschaft mit Breuer; gemeinsame Erforschung und Behandlung von Hysterie (zunächst mittels Hypnose; später zunehmend mit den Methoden der Traumdeutung und der freien Assoziation) 1900: erscheint Freuds erstes Hauptwerk, die „Traumdeutung“ Bis 1920: Topographische Unterscheidung zwischen unbewusst – vorbewusst – bewusst; Entwicklung der Konzepte „Widerstand“, „Übertragung“ und „Neurose“ 1920: Entwicklung des Instanzenmodells („Es – Ich – Überich“) 1939: stirbt Freud an Zungenkrebs 29 5.1. Die klassische Psychoanalyse nach Freud 5.1.0. Die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs „Psychoanalyse“: Der Begriff „Psychoanalyse“ wird in unterschiedlichen Bedeutungen verwendet: Er bezeichnet a) eine Wissenschaft, b) eine Methode und c) eine Therapieform A) Im wissenschaftlichen Sinn ist die Psychoanalyse eine allgemeine psychologische Theorie des menschlichen Erlebens und Verhaltens. Die wichtigsten Elemente dieser Theorie sind: die Trieblehre (Libido und Thanatos), das Instanzenmodell (Ich-Es-Überich); das Stufenmodell der psychosexuellen Entwicklung und die Neurosenlehre! B) Im methodischen Sinn ist die Psychoanalyse eine Technik zur Erforschung psychischer Vorgänge. Sie stützt sich dabei v.a. auf die freie Assoziation und die Traumdeutung! C) Im therapeutischen Sinn ist die Psychoanalyse ein Verfahren zur Behandlung psychischer Störungen. Die zentralen Methoden bzw. Wirkmechanismen sind dabei: die bewusste Forcierung von Übertragung und Gegenübertragung, die Analyse von Widerständen, diverse Deutungstechniken etc. 5.1.1. Die Psychoanalyse als Wissenschaft: Ihre theoretischen Grundannahmen Zum Bewusstsein: Freud unterscheidet zwischen bewussten, vorbewussten und unbewussten Inhalten. Vorbewusste Inhalte sind Inhalte, die uns zwar zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht bewusst sind, auf die unser Bewusstsein aber, wenn wir wollen, jederzeit zugreifen kann. Unbewusste Inhalte sind dem willkürlichen Zugriff unseres Bewusstseins dagegen entzogen. Dieses Konzept wurde von Freud später zu seiner Instanzenlehre (s.u.) ausgebaut! Zur Bedeutung von Träumen: Träume werden von Freud als maskierte Ausdrucksform des Unbewussten interpretiert und entsprechend gedeutet (Unterscheidung zw. manifesten und latenten Trauminhalten). Diese Auffassung wird von heutigen Wissenschaftlern jedoch kaum noch geteilt (Vgl. hierzu: Allan Hobson und McCarley) Traumphänomen Freud: Hobson et. al: WunscherfüllungsVerhüllungs-Zensor-Modell Ursache Aktivierungs-Synthese-Modell Unterdrückte unbewusste Wünsche Regression auf das sensorische Niveau Primäre Denkprozesse Aktivierung des Gehirns während des REM-Schlafs Aktivierung höherer visueller Zentren Verlust des Arbeitsgedächtnisses durch Deaktivierung des dorsolateralen PFC der Aktivierung führt zu übermäßigen (latenten) Assoziationen Visuelle Vorstellungen Akzeptanz wahnhafter Ereignisse als real Bizarre Inhalte Verhüllung eigentlichen Traumbotschaft Emotionalität Sekundär verteidigende Aktivierung des limbischen Systems Reaktion des Ichs Gedächtnisverlust Verdrängung Organische (durch einen Mangel an Neurotransmittern) bedingte Amnesie Bedeutung aktiv verschleiert transparent, erkennbar Interpretation Nötig unnötig 30 Die Trieblehre: Nach Freud wird unser Verhalten durch Triebe bestimmt, die ihrerseits physiologisch bedingt sind, sprich: aus „innersomatischen Reizquellen“ hervorgehen, aber psychologisch repräsentiert sein können (physiologische Energie = psychische Energie) und nach Ausgleich (Homöostase) streben. Sämtliche Triebe (z.B. das Bedürfnis nach Nahrung, Schlaf oder Sex) lassen sich dabei auf 2 antagonistische Grundtriebe, nämlich den Liebes- bzw. Selbsterhaltungstrieb (Eros) und den Todestrieb (Thanatos) zurückführen. Eros: die dem Liebes- bzw. Lebenstrieb zugrundeliegende Triebenergie bezeichnet Freud als Libido (ein entsprechendes Äquivalent für den Todestrieb gibt es nicht); das dem Eros zugrundeliegende Prinzip ist das Lustprinzip: Ziel ist die Herstellung größerer Einheiten durch das Eingehen und Erhalten von Bindungen. Quellen der Libido sind verschiedene Organe und Körperstellen (erogene Zonen), wobei sich deren jeweiliger Stellenwert im Lauf der psychosexuellen Entwicklung jedoch immer wieder verschiebt (s.o.). Generell wird die ursprünglich rein narzisstische Libido im Lauf der Entwicklung zunehmend auf Objekte übertragen („Besetzung“) und dadurch in eine Objektlibido transformiert (letztere ist ihrerseits flexibler, kann aber in manchen Fällen auch fixiert bleiben) Thanatos: der Todes- bzw. Destruktionstrieb zielt auf die Auflösung von Zusammenhängen und auf Zerstörung (Eindruck des 1. Weltkriegs) Wie die Libido wird auch der Thanatos im Laufe der Entwicklung von einem selbst (Selbstzerstörung) auf Objekte, d.h. nach außen, gerichtet. Wie jeder Triebenergie muss auch die dem Thanatos zugrundeliegende Energie regelmäßig entladen werden (=> Katharsis) Das Instanzenmodell: ist ein Strukturmodell der Persönlichkeit; es unterscheidet zwischen folgenden Instanzen: Das „Es“: ist Sitz der angeborenen (biologisch bedingten) Triebe und Hauptquelle der psychischen bzw. nervösen Energie; es initiiert sämtliche Primärprozesse, bleibt aber weitgehend unbewusst. Nicht nur phylogenetisch, sondern auch ontogenetisch ist das Es die älteste Instanz! Im „Über-Ich“: sind die verinnerlichten moralischen Wertvorstellungen der Eltern und der Gesellschaft repräsentiert; es entspricht demnach dem Gewissen (negativ) bzw. dem Ideal-Ich (positiv): die Triebimpulse aus dem „Es“ werden vom Über-Ich „bestraft“ (Schuldgefühle etc.); dabei sind Teile des Über-Ichs bewusst, andere nicht! Das „Ich“: vermittelt zwischen den beiden anderen Instanzen und ist damit die zentrale Steuerungs- und Entscheidungsinstanz; es agiert bewusst und folgt dem Realitätsprinzip! Freuds Phasenmodell der psychosexuellen Entwicklung: 1) Orale Phase (0-1. Jahr) Lustgewinn: Lippen-Mundraum Triebobjekt: Brust der Mutter, später: Schnuller, Flasche etc. Entwöhnung: führt zu einer ersten Ich-Umwelt-Differenzierung / Anpassungsreaktionen und Aggression gegenüber der Mutter Einfluss auf die spätere Entwicklung: Wurzel für optimistische oder pessimistische Grundhaltung 2) Anale Phase (1.-3. LJ) Lustgewinn: durch Ausscheidung (willkürlicher Einsatz der Ausscheidungsorgane, um Gehorsam oder Protest auszudrücken) Triebobjekt: der eigene Kot 31 Einfluss auf die spätere Entwicklung: - Bei übermäßiger Strenge: Entweder Geiz und Eigensinn („anal-retentiv“) oder grausam, unordentlich, chaotisch („anal-expulsiv“) - Bei Lob: kreativ, produktiv 3) Phallische Phase (ca. 3.-6. LJ) Lustgewinn: Geschlechtsorgane Triebobjekt: gegengeschlechtlicher Elternteil (Ödipuskomplex/ Kastrationsangst bzw. Elektrakomplex/Penisneid) Einfluss auf die spätere Entwicklung: Ödipaler Konflikt führt schließlich zur Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil („Aggressor“) => Grundstein für die eigene Geschlechterrolle und die Ausbildung des Über-Ichs - Der Ödipus- bzw. Elektrakomplex wird in der Latenzphase verdrängt und tritt in der Pubertät noch einmal auf! 4) Latenzphase (ca. 6.-11. LJ) Sexuelle Interessen treten (vorübergehend) hinter intellektuell-sachlichen Interessen zurück Durch Sublimierung und Reaktionsbildung wird die libidinöse Energie für die Ausbildung von sozialen Gefühlen, Sexualhemmungen („Inzestschranke“) und intellektuellen Fertigkeiten aufgewendet. 5) Genitale Phase (11.-20. LJ) Libido manifestiert sich endgültig im Genitalbereich Größte Entwicklungsaufgabe ist die „Objektwahl“, d.h. die Wahl eines gegengeschlechtlichen Partners außerhalb der Familie („Inzestschranke“); sie ist abhängig von den in der frühen Kindheit erworbenen Mustern (=> bei Störungen der Eltern-Kind-Beziehung: sexuelle „Störungen“ wie z.B. Homosexualität) Ätiologisches Störungsmodell: Freud führt neurotische (nicht auf einen Defekt des Nervensystems zurückführbare) Störungen auf (a) verdrängte Konflikte und/oder (b) Defizite in der psychosexuellen Persönlichkeitsentwicklung zurück. Konflikte, die nicht gelöst, sondern verdrängt wurden (Freud verortet sie meist in der frühen Kindheit), führen zu einer inneren Dauerspannung, die sich ihrerseits in entsprechenden Symptomen niederschlägt, sobald das jeweilige Konfliktthema (z.B. die Angst vorm Verlassen-werden oder die Unfähigkeit zu dauerhafter Bindung) in einem neuen Kontext wieder akut wird. 5.1.2. Die Psychoanalyse als Methode und Therapieform Ziel analytischer Psychotherapie ist die Bewusstmachung verdrängter Konflikte und deren „Deutung“ durch den Therapeuten, um auf diese Weise die Symptome zu reduzieren. Aber: Psychoanalyse ist mehr als eine analytische Psychotherapie! - Letzterer geht‟s um Heilung; sie ist dementsprechend beendet, wenn die Symptome verschwunden sind (zeitliche Begrenzung); einer Psychoanalyse in Reinform geht‟s dagegen weniger um die Behandlung einer Störung als um Selbstfindung. Und wann ist die schon abgeschlossen?! Von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert wird die Psychoanalyse freilich nur, wenn sie ein therapeutisches Ziel verfolgt (=analytische Psychotherapie)! Sozialgesetzbuch V § 12: Behandlungen müssen notwendig (!), zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Methoden: Freie Assoziation und Traumdeutung Freilegung von Widerständen und Unbewusstem 32 Gezielte Forcierung von Regression (Wiederbelebung infantiler Grunderfahrungen) und Übertragung (Übertragung infantiler Beziehungsmuster auf den Therapeuten) Freilegung und erneutes Durchleben verdrängter Konflikte, um sie der Analyse zugänglich zu machen und einen Neuanfang zu ermöglichen Wenn der Patient z.B. in der Analyse plötzlich wieder in die Rolle des ungeliebten Kindes schlüpft (Regression) und in dem Analytiker seinen herrischen Vater sieht (Übertragung), kann der zurückliegende Vaterkonflikt nicht nur verbalisiert und gedeutet, sondern im Hier und Jetzt bearbeitet und emotional korrigiert werden. Übertragungs-, Gegenübertragungs-, Widerstandsanalyse und –deutung durch den Therapeuten sollen dem Patienten Einsicht in seine „wahren“ Probleme geben. Hinweise zum Setting: Stundenfrequenz: 2-4 Sitzungen pro Woche; max. 300 Stunden (von der Kasse bezahlt werden max. 240 h) => Dauer: i.d.R. 2, 5 Jahre Couchlage: verweist den Patienten auf sich selbst und ermöglicht es ihm, freier und offener zu sprechen, da die Reaktionen des Analytikers nicht bemerkt werden. Zurückhaltung: Der Analytiker selbst hält sich bis zur Deutung enorm zurück und beschränkt sich fast ausschließlich darauf, zuzuhören und zu beobachten (Signale des Unbewussten? Widerstände? Hinweise auf innere Konflikte? Übertragungsund Gegenübertragungsprozesse? Etc. etc.) Das Behandlungsende: wird bereits im letzten Drittel der Therapie behutsam vorbereitet (um zu vermeiden, dass der Patient dieses als erneutes Trauma erlebt) Hinweise zur Diagnostik: Ursprünglich war es üblich, die Befunde frei zu formulieren (wenig reliabel!); mittlerweile arbeiten jedoch auch die meisten Analytiker mit den klassischen Diagnosesystemen (ICD-10); darüber hinaus gibt‟s seit 2004/2006 eigene Diagnosesysteme für Analytiker (etwa zur Feststellung des Strukturniveaus der Persönlichkeit oder unbewussten Konflikten) 5.1.3. Evaluation und Kritik Kritik an der Psychoanalyse als Wissenschaft: Freuds Theorien sind nicht nur nicht empirisch abgesichert, sie sind nicht einmal empirisch überprüfbar! Sie basieren ausschließlich auf Einzelfallstudien, die noch dazu aus dem Gedächtnis aufgeschrieben wurden und weniger empirisch als hermeneutisch angelegt waren (=> kleine und selektive Stichprobe, Erinnerungsverzerrungen, fließende Grenzen zwischen Beobachtung und Interpretation etc. etc.) Schwammige Begrifflichkeit („Es“, „Ich“, „Über-Ich“ sind Metaphern, keine klar umrissenen Konstrukte, ähnliches gilt auch für andere Begriffe) Wenig spezifisch (wenn man will, lässt sich mit Freud alles erklären)! Zu enger Fokus auf Kindheit und Sexualität Frauenfeindlich Dogmatisch (elitärer Zirkel!) ABER: Trotzdem war und ist Freud enorm wichtig für die Geschichte der Psychologie (Bedeutung der Kindheit; Bedeutung des Unbewussten, der Emotionen und der Motivation, erster psychotherapeutischer Ansatz überhaupt etc.) 33 Evaluation der analytischen Psychotherapie: Ein Nachweis, dass die analytische Psychotherapie besser wirkt als andere psychodynamische Verfahren (s.u.) steht bisher aus, was nicht zuletzt daran liegt, dass man sich in analytischen Kreisen lange gegen empirische Wirksamkeitsstudien gewehrt hat. Noch 1985 (Grawes Metaanalyse) lag keine einzige Studie zur Psychoanalyse vor, die den Eingangskriterien genügt hätte! Erst nach und nach gibt‟s erste Hinweise zur Effektivität der analytischen Psychotherapie (Heidelberger Psychotherapiestudie), wobei sie jedoch auch nicht wirksamer als andere tiefenpsychologisch fundierte Verfahren zu sein scheint (Berliner Psychotherapiestudie) 5.2. Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 5.2.1. Tiefenpsychologisch fundierte Verfahren allgemein Zur historischen Entwicklung: Schon in den Anfängen der Psychoanalyse gab es Bestrebungen, die klassische Analyse zu verkürzen und zu modifizieren. Für eine kürzere Dauer traten zunächst v.a. Stekel (1938), Ferenczi und Rank ein. Für eine flexiblere Handhabung der analytischen Methoden setzten sich erstmals French und Alexander (1946) ein; sie vertraten u.a. die damals hoch umstrittene These, dass nicht die Deutung, sondern die korrigierende emotionale Erfahrung („corrective emotional experience“) der entscheidende Wirkfaktor einer analytischen Therapie sei! Seitdem wurde die klassische Analyse auf unterschiedliche Weise modifiziert. Der Begriff „tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie“ wurde 1967 von Winkler eingeführt – und zwar im Zusammenhang mit der Einführung der Psychotherapierichtlinien: der Begriff umfasst seitdem alle von der Krankenkasse finanzierten psychodynamischen Verfahren außer der Psychoanalyse! In den aktuellen Psychotherapierichtlinien (Sozialgesetzbuch V) werden dementsprechend 2 Arten von psychoanalytisch begründeten Verfahren unterschieden: 1) die analytische Psychotherapie (s.o.) und 2) tiefenpsychologisch fundierte Verfahren Psychodynamische Therapie Psychoanalytisch orientierte Kurzzeittherapie Psychoanalytisch orientierte Fokaltherapie Tiefenpsychologisch fundierte Verfahren sind die im Rahmen der Richtlinienpsychotherapie am häufigsten beantragten Verfahren! Sie werden v.a. von Ärzten angewandt! Die verschiedenen tiefenpsychologisch fundierten Verfahren unterscheiden sich zwar im Einzelnen voneinander, weisen aber auch bestimmte Gemeinsamkeiten auf. Einerseits haben sie alle einen psychoanalytischen Hintergrund: Wie in der klassischen Analyse wird z.B. davon ausgegangen, dass Krankheitsentstehung, Krankheitsbewältigung und Krankheitsverhalten weitgehend von unbewussten Faktoren gesteuert werden und auf intrapsychischen und interpersonellen Konflikten beruhen (Neurosenlehre). Ebenso übernommen wird das Instanzenmodell, wenn es auch meist anders gewichtet wird (stärkere Betonung des „Ich“ und damit der bewussten Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen) Neopsychoanalytisches Modell der Sekundärfolgen psychosozialer Störungen 34 Andererseits sind tiefenpsychologisch fundierte Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass sie im Unterschied zur klassischen Psychoanalyse… a) eine geringere Behandlungsfrequenz und –dauer aufweisen (max. 100 h) b) in einem anderen Behandlungssetting stattfinden - Der Patient liegt nicht auf der Couch, sondern sitzt dem Therapeuten gegenüber c) bestimmte Techniken (insbes. die gezielte Förderung von Regression und Übertragung) in geringerem Umfang einsetzen d) stärker auf die aktuellen neurotischen Konflikte des Patienten fokussieren e) insgesamt zielorientierter sind - Klare Zielabsprachen und Fokussierung auf einen Hauptkonflikt Kurz: tiefenpsychologisch fundierte Verfahren sind Modifikationen der Psychoanalyse – und zwar v.a. im Sinne einer Begrenzung und Fokussierung! Theoretischer Hintergrund der genannten Modifikationen: Kürzere Dauer und stärkere Ziel- und Konfliktzentrierung => Stärkere Orientierung an den Bedürfnissen des Patienten Vermeidung von Regression und Übertragung (etwa indem der Therapeut klare Grenzen setzt) => Vermeidung unnötiger emotionaler Belastungen; Stabilisierung statt Traumatisierung; Ernstnahme des Patienten als erwachsenes Individuum (daher auch Blickkontakt), weniger Abhängigkeit und Beziehungsasymmetrie Verändertes Setting => „Entängstigung“ des Patienten und „Vernatürlichung“ der Patient-Therapeut-Beziehung Weitere Kennzeichen tiefenpsychologisch fundierter Verfahren: Abstinenz (Ausklammerung von Privatem) Neutralität (Ausklammerung eigener Wertvorstellungen) Früher: völlige Neutralität (utopisch) Heute: stützende und beratende Grundhaltung Stärkere Handlungsorientierung (P. soll Konflikte nicht nur erinnern und verarbeiten, sondern aktiv angehen!) Evaluation: Prinzipiell gilt: Die Evaluation tiefenpsychologisch fundierter Verfahren steht in Diskrepanz zu ihrer Verbreitung (eine allenfalls mittelgut untersuchte Therapieform) In der Metaanalyse von Grawe (1985) sind 12 Studien (1104 Patienten) enthalten (mittlere Dauer: 57 Sitzungen, 14 Monate) Die methodische Qualität dieser Studien ist eher unterdurchschnittlich (häufig fehlende Kontrollgruppen) Ergebnisse zur Wirksamkeit: Auffallend schlechte Effekte bei Angststörungen (es wird weder die Symptomatik noch die Befindlichkeit nennenswert verbessert) Bei anderen Störungen Verbesserung der Hauptsymptomatik, seltener der Befindlichkeit Persönlichkeitsveränderungen bei 50% Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen nur im Gruppensetting Immerhin: Die Verbesserungen sind nachhaltig (zeitlich stabil) Ergebnisse zur Indikation: Besonders wirksam, wenn… ein hoher Leidensruck und eine entsprechende Veränderungsmotivation besteht der Schwerpunkt der Symptomatik im neurotischen Erleben und nicht im Verhalten liegt 35 wenn die Ausdrucksfähigkeit wenig beeinträchtigt ist (hoher Bildungsstand, mäßige Störungsausprägung) wenn sich während der Behandlung eine starke Übertragungsbeziehung entwickelt 5.2.2. Dynamische Psychotherapie (nach Annemarie Dührssen) Die dynamische Psychotherapie nach Dührssen unterscheidet sich von der klassischen Psychoanalyse v.a. dadurch, dass sie stärker strukturiert ist und dem Therapeuten eine aktivere Rolle beimisst: es werden klärende, stimulierende Fragen gestellt, konkrete Verhaltensvorschläge unterbreitet => kurz: ein echter Dialog geführt! Gemeinsamkeiten mit der Psychoanalyse: Theoretische Grundannahmen Methoden: freie Assoziation; Deutung (Aufzeigen von Zusammenhängen zwischen Vergangenem und Gegenwärtigem) Unterschiede zur Psychoanalyse: Flexible Termingestaltung (Termine müssen nicht fixiert sein; es gibt terminfreie Intervalle und insgesamt weniger Termine) Anderes Setting (P und T sitzen sich gegenüber) Therapeut greift stärker in die Gesprächsführung ein: klärende (Nach-)Fragen, Initiierung von Themenwechseln, „Verwörterung“ bzw. Versprachlichung von Empfindungen und Zusammenhängen, die der Patient nicht artikulieren kann etc. etc. Therapeut schafft affektives Klima: Trost, Aufmunterung (ggf. aber auch Kritik und Missbilligung) Therapeut stößt Lernprozesse an: gibt Infos, unterbreitet konkrete Vorschläge, Empfehlungen etc. ( pädagogisch-verhaltensorientierte Interventionen!) Regressionstendenzen werden nicht gefördert, Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene nur angesprochen, wenn sie den Therapieprozess gefährden! Konzentration auf aktuelle(!) Probleme und deren Konsequenzen –aber: keine ausschließlich fokale Zentrierung ( s.u.: Kurztherapie)! - Gearbeitet wird u.a. an sog. „inneren Formeln“ (z.B. „Ich bin sowieso dumm“), die übrigens eine konzeptuelle Brücke zur KVT darstellen! Dührssen hat ein strukturiertes Interview zur biographischen Anamnese entworfen, das sowohl bei der Diagnosestellung, als auch bei der psychodynamischen Hypothesenbildung helfen soll. Die Fragen zielen darauf, den Gegenwartskonflikt und dessen Vorgeschichte freizulegen; der Therapeut darf jedoch nicht nur auf die Antworten als solche achten, sondern muss darüber hinaus auch die Art der Beantwortung (Emotionen, Widerstände etc.) berücksichtigen! Indikation: Alle psychischen Störungen mit psychodynamischem Hintergrund V.a. wenn die Behandlung von „Gegenwartsunbewusstem“ im Vordergrund steht Keine Kontraindikation im engeren Sinne (da sehr flexibel) 5.2.3. Psychoanalytische Kurztherapie Wegbereiter der psychoanalytischen Kurzzeittherapie: Stekel, Balint, Klüwer etc. Im deutschsprachigen Raum wurde die Kurztherapie kaum rezipiert Sie wird überwiegend von Ärzten und zwar in ambulantem Einzelsetting durchgeführt 36 Die wichtigsten Kennzeichen: Zeitbegrenzung (max. 25 Stunden) Verlängerung (Überführung in eine Langzeittherapie) muss bis zur 20. Stunde beantragt werden Beschränkt auf die Behandlung akuter Krisen (Konzentration aufs Hier und Jetzt) Gezielte Bearbeitung eines Fokusses (klar umrissene Zielformulierung) Kombination mit anderen Therapieelementen: z.B. Psychopharmaka, unterstützende Maßnahmen (Beratung, Ermutigung etc.) Voraussetzungen: Beim Therapeuten: Kenntnisse der Kurzpsychotherapie, lange klinische Erfahrung, tiefenpsychologische Selbsterfahrung, Kenntnisse benachbarter Disziplinen (Familientherapie, Verhaltenstherapie etc.) Beim Patienten: Leidensdruck und hohe Therapiemotivation; innerliche Flexibilität Indikation: Bei akuter Lebenskrise bzw. einem klar abgrenzbaren neurotischen Konflikt Wenn keine behandlungsbedürftige neurotische Grundproblematik vorliegt Wenn der Patient sein Problem beheben möchte, ohne lang in der Biographie zu wühlen Vorteil: Zeitbegrenzung kann beruhigend und ent-ängstigend wirken! Evaluation: Prinzipiell gilt: Die psychoanalytische Kurztherapie ist das am besten untersuchte psychodynamische Verfahren! In Grawes Metastudie (1985) gingen 29 Studien (1104 Patienten) ein (Durchschnittsdauer: 16 Sitzungen; 4 Monate), wobei die Qualität dieser Studien als überdurchschnittlich eingestuft wurde! Ergebnisse: Psychoanalytisch orientierte Kurztherapie führt insbes. bei neurotischen und Persönlichkeitsstörungen zu einer deutlichen Symptomreduktion (und ist in dieser Hinsicht einer rein medikamentösen Behandlung sogar überlegen) ABER: Der Effekt fällt in Prä-Post-Vergleichen deutlich stärker aus als in Kontrollgruppenvergleichen Keine Überlegenheit gegenüber anderen Kurztherapien! Keine Veränderungen im Persönlichkeits- und zwischenmenschlichen Bereich Mangelnde Nachhaltigkeit: Nach 12 Monaten keine Unterschiede zu unbehandelten Kontrollgruppen Bei psychosomatischen Patienten kontraindiziert!! 37 6. Hypnose und andere Entspannungsverfahren 6.1. Hypnose und Hypnotherapie: 6.1.1. Allgemeines zu Hypnose Definition: Hypnose ist ein Verfahren zur Fremdeinleitung von Trancezuständen (Tranceinduktion) – und zwar im Wesentlichen durch verbale Suggestion. Unter Trance versteht man dabei Bewusstseinszustände, die subjektiv als verändert wahrgenommen werden. Unterschieden werden kann zwischen experimenteller Hypnose und klinischer Hypnotherapie. Erstere findet im Rahmen der Grundlagenforschung statt (Wirkfaktoren etc.), letztere wird im klinischen Kontext angewandt (und zwar nicht nur in der Psychotherapie, sondern z.B. auch in der Zahnmedizin) Zur Hypnotisierbarkeit gibt es 2 Theorien: Die „State“-Theorie geht davon aus, dass es sich dabei um einen stabilen Persönlichkeitsfaktor handelt; die „Non-State“Theorie geht dagegen davon aus, das Hypnotisierbarkeit erlernbar ist und dementsprechend trainiert werden muss. Was passiert bei Hypnose? Veränderung des körperlichen Empfindens Atmung, Herzfrequenz, Muskeltonus etc. Wärme-/Kälte-/Schwere-Sensationen Analgesie (Schmerzunempfindlichkeit bzw. Schmerzreduktion): s.u. Möglicherweise Dissoziation der Körperwahrnehmung (z.B. kann„s passieren, dass eigene Bewegungen als von außen gesteuert wahrgenommen werden: s.u.) Kognitive Veränderungen Intensives farbliches und bildhaftes Erleben (Imagination) Zunahme holistischer Suchstrategien (statt Detailsuche) Gesteigertes bildhaftes Gedächtnis Hochsuggestible zeigen unter Hypnose generell bessere Ergebnisse beim Erlernen und Abruf von Inhalten Verminderte Aktivierung Verschiebung des Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsfokus nach innen Eingeschränkte Wahrnehmung der Umwelt Verzerrte Zeitwahrnehmung Positiver Affekt Reduzierte Kommunikation Weitere Trancephänomene Katalepsie (Beibehaltung ungewöhnlicher Haltungen) Ideomotorische Reaktionen (Bewegungen, die nicht als solche wahrgenommen werden, z.B. Heben des Armes) Regression Amnesie Physiologische Korrelate: sind nicht eindeutig (da abhängig von der Trancetiefe, den Erhebungsmethoden bzw. der Ableitungstechnik etc.), aber: Hypnose-EEG ist eindeutig vom Schlaf-EEG unterscheidbar: Es treten v.a. niedrigamplitudige Alpha-Wellen auf (typisch für die Phase kurz vorm Einschlafen) Es kommt zu einer Zunahme der Thetabandleistung (typisch für leichte Schlafphasen) in den frontalen, zentralen und okzipitalen Kortizes (v.a. bei Hochsuggestiblen) 38 fMRT-Untersuchungen: Vergleicht man die Aktivierungsmuster bei realer Farbbetrachtung mit den Mustern, die beim Betrachten von Schwarz-Weiß-Bildern unter suggestiver Instruktion zu beobachten sind, zeigt sich: - Eine verstärkte bilaterale Aktivierung im Gyrus fusiformis („Sehzentrum“) - Bilaterale Aktivierung im anterioren Zingulum - Verstärkte Aktivierung des Okzipitallappens Okzipitale Aktivierung korreliert mit dem subjektiv berichteten Relaxationsgrad und der Trancetiefe Beim Erlernen und Abruf hochbildhafter Wortpaare zeigen Hypnotisierte eine vermehrte Einbindung okzipitaler und frontaler Strukturen (=> vermehrte Nutzbarmachung multimodaler Verarbeitungsstrategien unter Hypnose) Schlussfolgerungen: fMRT-Ergebnisse bestätigen den Vorteil bildhaften Vorgehens bei der Hypnose Ansprechen verschiedener Sinnesmodalitäten vorteilhaft Verarbeitung komplexen, abstrakten Materials ist unter Hypnose herabgesetzt Implizite Suggestionen führen zu leichterem Lernen/Umlernen bestimmter Inhalte und Verhaltensweise 6.1.2. Hinweise zur Hypnotherapie Die Hypnotherapie hat eine extrem lange Geschichte: Eingesetzt wurde Hypnose bereits vor 4000 Jahren in China; außerdem: im alten Griechenland etc. Der Begriff „Hypnose“ wurde jedoch erst 1843 von dem schottischen Arzt James Braid eingeführt. Er leitet sich von „Hypnos“ her, dem griechischen Gott des Schlafes, und soll zum Ausdruck bringen, dass das Verhalten Hypnotisierter schlafähnlich ist. Mesmer (Anfang 19.Jh.) führte Hypnose auf das Phänomen des Magnetismus zurück (Mesmerismus, „to mesmerize“) Charcot (1825-1893), ein Lehrer Freuds, versuchte, mithilfe von Hypnose die Hysterie zu behandeln – Freud selbst übernahm dieses Konzept zunächst, ließ es dann aber zugunsten der freien Assoziation und Traumdeutung wieder fallen. Den größten Einfluss auf die Hypnotherapie in ihrer heutigen Form hatte der Arzt Milton Erickson; zum einen verschaffte er ihr nach Freuds Ablehnung wieder mehr Beachtung in der Psychotherapieszene, zum anderen trat er für eine sehr individuelle Form der Hypnose ein, bei der der Patient nicht direkt, sondern indirekt beeinflusst wird. Ziel: Ressourcenaktivierung, Veränderung gewohnter Denk- und Empfindungsstrukturen, mentale Flexibilität Methode: Erickson ließ den Patienten viel Wahlfreiheit bei der Hypnose, versuchte jedoch durch Irritationen und die Induktion von Zweifeln, festgefahrene Denkmuster trotzdem aufzusprengen! Ziele von Hypnotherapie: Entspannung Ressourcenaktivierung Veränderung festgefahrener Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensmuster Hypnostische Analgesie Schmerzreduktion (wird z.B. bei Migräne, dermatologischen Erkrankungen, Tumorschmerzen und anderen chronischen Beschwerden eingesetzt) 39 Techniken: a) Dissoziative Technik: Ablenkung der Aufmerksamkeit durch Fokussierung auf angenehme Vorstellungen b) Assoziative Technik: zunächst Fokussierung auf Schmerz, dann Einengung („in Grenzen halten“) und Veränderung (spitz – abgestumpft) c) Symbolische Verarbeitung: Schmerz wird in Form eines Symboles oder Bildes externalisiert (z.B. ein Sturm, der abebbt) Wirkmechanismus: Das Schmerzerleben (affektive Komponente) wird von der physiologischen Schmerzempfindung abgetrennt! Die Schmerzreduktion wird nicht durch eine Endorphinausschüttung vermittelt, sondern durch eine veränderte Aktivierung schmerzrelevanter Areale (Amygdala Insula etc.) Vorgehen: 1) Tranceinduktion (mittels verbaler Instruktion und Fixations- oder Farbkontrastmethode) 2) Fokussierung nach innen 3) Veränderter Bewusstseinsprozess 4) Veränderung mentaler und physiologischer Prozesse 5) Beendigung der Trance Der Patient behält immer die Kontrolle u. kann die Trance jederzeit selbst beenden! Indikation und Kontrainduktion: Indikation bei: Angststörungen, Depression, Essstörungen, Übergewicht, Tabakmissbrauch, Schlafstörungen, akutem und chronischem Schmerz, psychosomatischen Beschwerden, kardiovasukären (das Herz- und Gefäßsystem betreffenden) Erkrankungen, Asthma, Anästhesie (nach einer OP), zahnärztlichen Behandlungen etc. Kontraindikation bei: Psychosen Schizophrenie Evaluation: Grawes Metaanalyse (1985) enthält 19 Studien mit 1068 Patienten: Bevorzugte Anwendungsbereiche: Schmerzen, Ängste, Phobien, psychosomatische Beschwerden (Asthma, Bluthochdruck etc.) Gute Wirksamkeit im Prä-Post- und Kontrollgruppenvergleich, wobei die Wirkung positiv mit der Tiefe der Trance und dem Vertrauen des Patienten korreliert Wirkung i.d.R. dauerhaft Aber: Keine Überlegenheit gegenüber anderen Entspannungsverfahren Neuere Untersuchung: Effektstärken zw. d=0,5 (nach OP) und 1,2 (bei Angststörungen); bei Rauchen: d=0,9 Fazit: Der breite Einsatz von Hypnose (im Rahmen verschiedener Therapierichtungen) ist empirisch gerechtfertigt. Die Technik sollte zum Rüstzeug jedes Therapeuten gehören! 40 6.2. Andere Entspannungsverfahren 6.2.0. Zu Entspannungsverfahren allgemein Entspannungsverfahren dienen: a) der Förderung von Selbstkontrolle b) der Konzentrationsschulung c) der Beruhigung d) der Steigerung des Wohlbefindens Physiologische Prozesse bei Entspannungsverfahren: Kurzfristige Effekte: Neuromuskulär kommt es zu einer Senkung des Muskeltonus (Skelettmuskulatur) und der Reflextätigkeit Kardiovaskulär kommt es a) zu einer peripheren Gefäßerweiterung (Vasodilatation => Wärmesensation), b) zu einer Senkung der Herzrate und c) zu einer Senkung der arteriellen Blutdrucks Respiratorisch kommt es zu einer Senkung der Atemfrequenz und des Sauerstoffverbrauchs Elektrodermal zu einer Senkung der Hautleitfähigkeit Langfristige Effekte: Verminderung sympatho-adrenerger Erregungsbereitschaft ZNS-Modulation 6.2.1. Autogenes Training Definition: Autogenes Training ist ein autosuggestives, übendes Entspannungsverfahren, das der konzentrierten Selbstentspannung dient. Entwickelt wurde die Methode in der 20er Jahren von dem Berliner Nervenarzt Schultz, der feststellte, dass Menschen unter Hypnose typische Reaktionen zeigen: nämlich Wärme- und Schweresensationen sowie das Gefühl von Ruhe und Entspannung; diese Reaktionen autohypnoid zu erzeugen, war Schultz„ Ziel. Psychische Effekte des autogenen Trainings: Kurzfristig: körperliche und geistige Frische, Wohlbefinden, Entspannungsgefühl, Deaktivierung, Erholung, Förderung von Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen, Steigerung der Konzentrationsfähigkeit Langfristig: Abnahme der Depressionswerte, Abnahme der Neurotizismuswerte im FPI Aufbau: Das autogene Training ist hierarchisch gegliedert; es unterteilt sich in eine Grund- bzw. Unterstufe, eine Oberstufe und spezielle Übungen. Die Grundstufe des AT besteht aus 2 allgemeinen Grundübungen, nämlich der Schwereübung zur Entspannung der Muskulatur sowie der Wärmeübung zur Entspannung der Blutgefäße; darüber hinaus enthält die Grundstufe 4 Organübungen für Herz, Atmung, Bauchorgane und Kopf. Ziel der besagten Übungen ist eine Intensivierung der Binnenwahrnehmung. 1. Schwereübung: „Mein rechter/linker Arm ist ganz schwer!“ 2. Wärmeübung: „Mein rechter/linker Arm ist ganz warm!“ 3. Herzübung: „Mein Herz schlägt ruhig und regelmäßig!“ 4. Atemübung: „Meine Atmung ist ruhig und regelmäßig; es atmet mich!“ 5. Sonnengeflechtsübung: „Das Sonnengeflecht (Plexus solaris) ist ruhig und strömend warm“ (=> zielt auf vermehrte Durchblutung der Unterleibsorgane) 6. Kopf- bzw. Stirnkühleübung: „Meine Stirn ist angenehm kühl; mein Kopf ist frei und klar.“ 41 Die Oberstufe: Die Übungen der Grundstufe können mit individuellen Imaginationen (Fantasiereisen etc.) und formelhaften Vorsatzbildungen (z.B. „Ich nehme mich an.“; „Ich bin Teil einer Gemeinschaft!“ etc.) kombiniert werden. Durchführung: Autogenes Training will geübt sein; es bedarf einer speziellen Ausbildung, die meist in Gruppen durchgeführt wird und 8-12 Sitzungen umfasst Evaluation: Autogenes Training ist das im therapeutischen Setting am häufigsten eingesetzte Entspannungsverfahren. Es ist jedoch weder das am besten untersuchte, noch das nach bisherigem Kenntnisstand wirksamste Verfahren. In Grawes Metaanalyse (1985) sind lediglich 14, allerdings qualitativ leicht überdurchschnittliche Studien (647 Patienten) enthalten; wobei überwiegend die Auswirkung auf Schlafstörungen und psychosomatische Beschwerden untersucht wurde. Die Auswirkungen auf die Hauptsymptomatik erwies sich im Vergleich zu anderen Entspannungsverfahren als eher gering Empirische Aussagen zur Wirkungsweise sind nicht möglich Fazit: Das Verfahren sollte nicht unkritisch für eine möglichst breite Anwendung propagiert werden! Indikation und Kontraindikation: Indikation (mit Vorsicht!): Körperliche und psychische Erschöpfungszustände und Belastungen; Nervosität und innere Anspannung; Symptome psychophysiologischer Dysregulation; Leistungs- und Verhaltensschwierigkeiten; Belastungen durch Schmerzzustände; Persönlichkeitsprobleme in der Selbstbestimmung und Selbstkontrolle Kontraindikation: Wenn physiologische Störungen auftreten (starkes Herzrasen, Zittern, Schweißausbruch, Ohnmachtsanfall etc.) Bei vielen psychischen Störungen (insbes. Zwangsstörungen und akuten Psychosen) 6.2.2. Progressive Muskelentspannung (nach Jacobson) Definition: Die progressive Muskelrelaxation ist eine Selbstentspannungstechnik, bei der einzelne Muskelgruppen nacheinander angespannt und dann wieder entspannt werden. Grundannahme: Der Zustand der Entspannung wird am deutlichsten und zuverlässigsten in einer Reduktion des neuromuskulären Tonus sichtbar. Zentrales Ziel: Willentliche und kontinuierliche Spannungsreduktion einzelner Muskelgruppen. Durchführung: Die Technik der progressiven Muskelrelaxation liegt mittlerweile in verschiedensten Versionen vor. Gemeinsam ist ihnen das Grundprinzip (Anspannung: ca. 5 bis 10 Sekunden; Entspannung: ca. 30 Sekunden – zunächst fremdinstruktive Einübung; später selbstinstruktive Durchführung) Evaluation und Wirksamkeit: Grawe (1985): 66 qualitativ überdurchschnittliche Studien mit 3254 Patienten (v.a. solche mit Hypertonie, Schlafstörungen oder Kopfschmerzen); kurze Dauer: max. 10 Wochen Bedeutsame Verbesserung der Hauptsymptomatik und vegetativen Stabilität Bei 60% Verbesserung der allgemeinen Befindlichkeit Bei 50% Auswirkungen auf den zwischenmenschlichen Bereich Spezifische Wirkung am besten gesichert bei Angst- und Spannungsgefühlen 42 Ansprechbarkeit ist bei jüngeren, weniger schwer gestörten und von der Wirkung überzeugten Patienten am besten Wirksamkeit nachgewiesen bei: Angst (sofern progressive Muskelrelaxation eine wichtige Komponente systematischer Desensibilisierung ist) Belastung (Rückgang physiologischer Reaktionen beim Schauen eines emotional belastenden Films) Spannungskopfschmerz; Migräne; Rückenschmerzen; essentieller Hypertonie etc. Fazit: PMR kann in der klinischen Praxis empfohlen werden! Vorteile: hohe Wirksamkeit – geringer Aufwand (leicht erlernbar); nicht an therapeutische Orientierung gekoppelt und daher in unterschiedlichste Therapieformen integrierbar! 43 7. Interpersonale Verfahren 7.1. Intervention in Gruppen 7.1.1. Verschiedene Modelle von Gruppenarbeit Die Encounter-Bewegung setzte nach dem zweiten Weltkrieg ein und erreichte ihren Höhepunkt in den 60er Jahren; man setzte damals enorme Hoffnungen in die Wirkung von Gruppen (Gründung von Selbsterfahrungs- und Wachstumsgruppen, Etablierung von Selbsthilfegruppen, Beginn der Gruppenpsychotherapie etc.) Wegbereiter der Bewegung waren u.a. Kurt Lewin (T-Groups), Jacob Levi Moreno (Psychodrama) und Carl Rogers (Encountergruppen); der Begriff „Encounter“ (=Begegnung) wurde von V. Frankl geprägt. Im Bereich der psychosozialen Versorgung lassen sich, je nach Zielsetzung und Grad der Professionalisierung, vier Arten von Gruppen(arbeit) unterscheiden: 1) Selbsthilfegruppen (z.B. die Anonymen Alkoholiker; gegründet 1935): Zielsetzung: Gegenseitige Unterstützung bei der Bewältigung bestimmter Probleme (Scheidung, Alleinerziehung, Krebs, Aids etc.) bzw. Störungen (Ängste, Alkoholismus usw.) Professionalisierung: keine professionelle Leitung, evtl. fachliche Beratung Wirksamkeit: uneinheitliche Forschungsbefunde; aber: insbesondere bei schweren Störungen reichen Selbsthilfegruppen nicht aus; positive Wirkung entfalten sie v.a. nach Abschluss einer professionellen Psychotherapie 2) Professionell geleitete Aufklärungs- bzw. Präventionsgruppen für Betroffene Werden von Kirchen, Beratungsstellen oder Volkshochschulen angeboten; prototypisch sind Programme zur Verbesserung partnerschaftlicher oder ehelicher Beziehungen (Prävention von Scheidung, Missbrauch, Gewalt etc.) Zielsetzung: „Empowerment“ (=Hilfe zur Selbsthilfe) Professionalisierung: die professionelle Unterstützung beschränkt sich hauptsächlich auf technische, psychoedukative und organisatorische Hilfen: Raumbeschaffung, Psychoedukation, informelle Vermittlung von Experten etc. (eine Mischung aus Selbsthilfe und professioneller Initiative also) 3) Encountergruppen (Selbsterfahrungs- oder Wachstumsgruppen) Sind methodisch und konzeptuell eng an die gesprächstherapeutisch orientierte Gruppentherapie angelehnt und lassen sich daher nur schwer von dieser abgrenzen! Zielsetzung: Entfaltung des persönlichen Potenzials (Selbsterfahrung und – verwirklichung; Verbesserung der Kommunikationsund Kooperationsfähigkeit etc.) Professionalisierung: Anleitung durch „Trainer“ bzw. Therapeuten, die sich aber bewusst zurücknehmen und eher Anregungen statt Vorgaben geben; keine strikte Hierarchie, sprich: jeder kann Ideen, Übungen und Themen einbringen 4) Psychotherapiegruppen Zielsetzung: Beseitigung psychischer Störungen/Wiederherstellung seelischer Gesundheit Professionalisierung: werden von Psychotherapeuten geleitet 44 7.1.2. Gruppentherapie Psychotherapeutische Gruppen unterscheiden sich von anderen psychosozial orientierten Gruppen (Selbsterfahrungsgruppen etc.) v.a. dadurch, dass sie ausdrücklich die therapeutische Behandlung psychischer Störungen zum Ziel haben. Die Gruppe erfüllt dabei verschiedene Funktionen: 1. Die Gruppe als Publikum bzw. Auditorium - Psychoedukative, didaktische, informative Funktion 2. Die Gruppe als Übungsfeld - Zur Einübung von Kompetenzen und Strategien 3. Die Gruppe als Beziehungsfeld - Beziehungslernen 4. Die Gruppe als Entwicklungsfeld - Rückmeldungen, Modellfunktion, Unterstützung Der Therapeut tritt im gruppentherapeutischen Setting als Helfer, Unterstützer oder „Faciliator“ auf Zwei Grundkonzepte gruppentherapeutischer Arbeit lassen sich unterscheiden: 1) Konflikt-, beziehungs- und interaktionsorientierte Gruppen Im Vordergrund steht die Gruppe selbst bzw. ihre Dynamik; Störungen werden nämlich v.a. aus psychosozialer Perspektive betrachtet. Die Gruppe wird dabei als ungefähres Abbild der zwischenmenschlichen Umwelt der Patienten verstanden und die ablaufenden Gruppenprozesse dementsprechend als die entscheidenden Wirkfaktoren betrachtet. Beispiele: a) Psychoanalytische und tiefenpsychologische Therapiegruppen b) Interpersonelle bzw. interaktionelle Therapiegruppen c) Personzentrierte bzw. gesprächspsychotherapeutische Gruppen 2) Störungs-, methoden- und einzelfallorientierte Gruppen Die Gruppe bzw. Gruppendynamik wird als sekundär betrachtet; im Vordergrund stehen stattdessen die einzelnen Mitglieder und deren jeweiligen Störungen. Dem entspricht, dass die Arbeit mit der Gruppe der Arbeit mit dem Einzelnen untergeordnet wird. Beispiele: a) Psychodramagruppen b) Verhaltenstherapeutische Gruppen - Multimodale Verhaltenstherapie in und mit Gruppen - Zieloffene Verhaltenstherapie in und mit Gruppen c) Gestalttherapeutische Gruppen d) Transaktionsanalyse Konflikt-, beziehungs- und interaktionsorientierte Gruppentherapie: 1) Interpersonelle Therapiegruppen: Die interpersonelle Therapie (IPT) betrachtet Störungen v.a. aus psychosozialer Perspektive, sie konzentriert sich dementsprechend auf die Behandlung ihrer zwischenmenschlichen Ursachen und Folgen! Die Therapiegruppe wird als Mikro-Umwelt verstanden, in der soziales Lernen stattfinden kann, ohne das volle soziale Risiko zu haben. Die Gruppe ist demnach ein Übungsfeld mit Reflektor-, Katalysatorund Entwicklungsfunktion Für den entscheidender Wirkfaktor wird die Gruppenkohäsion gehalten; v.a. sie muss daher vom Therapeuten empathisch gestützt werden! 45 2) Psychoanalytische bzw. tiefenpsychologische Gruppentherapie Individuelle Therapieprozesse und Gruppenprozesse werden gleichermaßen beachtet (jede Aussage eines Einzelnen ist nicht nur eine Aussage über ihn selbst, sondern auch über die Gruppe) Die Methodik und Zielsetzung ist ansonsten im Grunde dieselbe wie im Einzelsetting: Aufdeckung und Deutung von Widerständen und Übertragungen, Bewusstmachung von Unbewusstem, Unterstützung konstruktiver Veränderungen 3) Personzentrierte bzw. gesprächspsychotherapeutische Gruppen Hier muss zwischen tatsächlichen Therapiegruppen und personzentrierten Selbsterfahrungsgruppen (Encountergruppen) unterschieden werden, was nicht immer so leicht möglich ist (s.o.) Die Gruppe hat Modellfunktion für angstfreie Kommunikation und die Äußerung von Bedürfnissen, sie bietet Wertschätzung, ein Übungsfeld für Kongruenz, verbessert die Selbst- und Fremdwahrnehmung etc. etc. Evaluation: Grawes Metastudie (1985) enthält 9 kontrollierte Studien zur Wirksamkeit von Encountergruppen bei unterschiedlichen Störungen; die Studien zeigen: Verbesserung der individuellen Hauptsymptomatik, aber kaum Verbesserung im zwischenmenschlichen und persönlichen Bereich sowie im allgemeinen Wohlbefinden Fazit: Als klinisches Therapieverfahren nur mit Vorbehalt zu empfehlen, im Selbsterfahrungsbereich jedoch von großer Bedeutung! Störungs-, methoden- und einzelfallorientierte Gruppentherapie: 1) Gruppentherapie nach Moreno: Gruppentherapie als Methode zur lebensnahen Bearbeitung zwischenmenschlicher Beziehungen und Interaktionen Ziele: Aufhebung störungsspezifischer Blockaden; Förderung und Weiterentwicklung der gesunden Spontaneität, Kreativität, Handlungs- und Begegnungsfähigkeit und psychosozialen Integration Methoden: a) Soziometrie zur Beschreibung der Gruppendynamik: „Wahl“- oder „Ablehnungs“-Verbindungen zwischen den Mitgliedern b) Psychodrama: Darstellung zwischenmenschlicher oder intrapsychischer Konflikte in Form von Rollenspielen, wobei i.d.R. der Patient, der den Konflikt einbringt, der Protagonist ist, während die übrigen Gruppenmitglieder entweder zuschauen oder Antagonisten sind. Ziele: Tiefere Einsicht in die Wirklichkeit; Erkennen von Verzerrungen und Illusionen; Anregung von Veränderungen; Erprobung alternativer Verhaltensweisen Evaluation: In Grawes Metaanalyse (1985) sind 6 Studien enthalten; Prä-PostVergleiche zeigen signifikante Verbesserung im zwischenmenschlichen Bereich, Kontrollgruppenvergleiche zeigen eine spezifische Wirkung nur bei der stationären Behandlung Schizophrener Indikation: Bei Psychosen eher kontraindiziert; generell eher eine Behandlungskomponente als eine eigenständige Therapieform! 2) Verhaltenstherapeutische Gruppentherapie (s.u.) Unterschieden werden kann zwischen: a) Multimodularer Verhaltenstherapie in und mit Gruppen b) Zieloffener Verhaltenstherapie in und mit Gruppen 46 Wirkfaktoren von Gruppentherapie: Unterschieden wird (zumindest von Verhaltenstherapeuten) zwischen instrumentellen Gruppenfaktoren und spezifischen Wirkfaktoren von Gruppen; die instrumentellen Faktoren bilden die Voraussetzung dafür, das die spezifischen Faktoren wirksam werden können. Instrumentelle Gruppenfaktoren: 1. Kohäsion (Zusammenhalt, „Wir-Gefühl“; wertschätzendes Klima etc.) 2. Offenheit (der Gruppenmitglieder untereinander) 3. Vertrauen (Gruppenmitglieder stützen sich gegenseitig, Kritik kann geäußert werden etc.) 4. Arbeitshaltung (Gruppe arbeitet aktiv mit, zieht an einem Strang etc.) Spezifische Wirkfaktoren von Gruppen: 1. Feedback (geben und annehmen) 2. Unterstützung (geben und erhalten) 3. Altruismus (kommt etwa bei der Übernahme von therapeutischen Aufgaben zum Tragen und gibt den Patienten das Gefühl, gebraucht zu werden => Erhöhung des Selbstwerts) 4. Modelllernen (Nachahmung anderer Gruppenmitglieder) 5. Rollenspiele 6. Universalität des Leidens (zu sehen, dass andere unter denselben Symptomen leiden und die Erfahrung, verstanden zu werden, hilft und fördert Offenheit) 7. Korrigierende Rekapitulation gestörter Beziehungsmuster (kommt bei Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomenen zum Tragen) 8. Katharsis (Affektabfuhr in der Gruppe) 9. Hoffnung (durch Gruppenmitglieder, die bei ihrer Problembewältigung bereits Erfolge erzielen konnten) 10. Existenzielle Einsicht (Behandlung existenzieller Fragen) Als besonderer Wirkfaktor wird darüber hinaus oft der Einsatz von Medien genannt (Austeilen von Handouts, Mikro-Teaching-Methoden, Tonband- und Videofeedback, Einbeziehung von Lehrbüchern und/oder Lehrfilmen, Transfer-, Übungs- und Hausaufgaben, therapeutische Exkursionen etc.) Wie sich Therapieabbruch und der Deteriorationseffekt vermeiden lassen: Sorgsame Vorgespräche (einzeln) Homogene Gruppen (insbes. was die Schwere der Störung betrifft) Prozessanalysen, Transparenz Vermeidung von Therapeutenfehlern Direkte oder unterschwellige Feindseligkeit gegenüber einzelnen Teilnehmern Fehlende Solidarität mit Außenseitern in der Gruppe Überforderung einzelner Patienten Orientierung an den Gruppennormen und nicht am Einzelnen Wirksamkeit: Gruppenpsychotherapie hat sich für die meisten psychischen Störungen als gleichrangige Alternative zur Einzeltherapie erwiesen! Es sollten jedoch folgende Leitlinien beachtet werden: a) Gruppentherapie ist Einzeltherapie in der Gruppe! b) Patienten entscheiden selbst, ob, wann und wie sie mitarbeiten! c) Interessenunterschiede in der Gruppe haben Vorrang! 47 7.1.3. Verhaltenstherapeutische Gruppentherapie In der VT wird Gruppentherapie v.a. aus ökonomischen Gründen propagiert. Sie wird als Einzeltherapie in der Gruppe verstanden! Psychotherapeutische Gruppenkonzepte (insbesondere die aus der Verhaltenstherapie stammenden) bewegen sich zwischen 2 Polen: 1) Multimodale Standardisierung: Standardisierte Behandlung einer bestimmten Störung mittels verschiedener Interventionsmethoden mit dem Ziel der Effizienzsteigerung bzw. Zeit- und Kosteneinsparung (Ökonomie) Wird v.a. in folgenden 3 Bereichen angewandt: a) Einübung sozialer Kompetenz b) Gesundheitsvorsorge (Prävention) c) Störungsspezifische Verhaltenstherapie in Gruppen 2) Zieloffenheit: Offenheit bezüglich der Methodenauswahl und Therapieziele (Problemanalyse, Zielanalyse, Planung und Evaluation sind Teil der Behandlung erfolgen in der Gruppe und werden immer wieder neu an die jeweiligen Erfordernisse adjustiert); therapeutisches Vorgehen ist auf den Einzelfall zugeschnitten (Einzeltherapie in der Gruppe), die Gruppe übernimmt ihrerseits im Therapieverlauf zunehmend therapeutische Aufgaben (Erstellung von Problemund Zielanalysen, Therapieplänen etc.) Offene Gruppenarbeit bietet sich v.a. an bei: a) Patienten, die sich diagnostisch nicht eindeutig zuordnen lassen und daher in besonderem Maße einer adaptiven Indikation bedürfen! b) Patienten mit „komplexen Störungen des Beziehungsverhaltens“ c) heterogenen Patientengruppen (in denen versch. Störungsbilder vorliegen) Allgemeine Kennzeichen verhaltenstherapeutisch orientierter Gruppentherapie: 3 Phasen, die sowohl in zieloffenen als auch standardisierten Verfahren enthalten sind: 1. Patientenschulung (Psychoedukation) 2. Psychotherapeutische Behandlung (Einübung oder Training von Verhaltensweisen und Kompetenzen) 3. Transfersicherung Wichtige Merkmale: Der einzelne Patient steht im Zentrum und nicht die Gruppe als Ganze Phänomenorientierung / Störungsspezifität Ressourcenorientierung (Ziel: Selbstbehandlung) Lösungsorientierung Beispiel für ein Gruppenprogramm bei Depression im Alter (multimodal standardisiert): 15-Wochen-Programm mit offenen Gruppen à 5-7 Teilnehmer (zw. 65 und 85 Jahren): 1 Einzelgespräch zur Einführung 5 Gruppensitzungen zum Modul „Aktivierung“ Problemanalyse, Zielsetzung, Wochenplan, Integration angenehmer Tätigkeiten, Hausaufgaben etc. 4 Gruppensitzungen zum Modul „Kognitionen“ Aufklärung über den Zusammenhang von Kognition und Emotion, Gedankenkontrollen, kognitive Umstrukturierung etc. 4 Gruppensitzungen zum Modul „Soziale Fertigkeiten“ Rollenspiele und Verhaltensübungen zu den Themen „Selbstbehauptung“, „Initiierung und Aufrechterhaltung von Kontakten“ etc. 1 Einzelgespräch zum Abschluss Rückschau, Notfallplanung etc. 48 7.2. Systemische Psychotherapie 7.2.1. Theoretischer Hintergrund und geschichtliche Entwicklung Definition: Die systemische Psychotherapie hat sich aus der Familientherapie heraus entwickelt und ist dadurch gekennzeichnet, dass sie den Fokus auf den sozialen Kontext psychischer Störungen legt; konsequenter Weise bezieht sie daher wichtige Bezugspersonen des Patienten in die Therapie mit ein; das kann entweder direkt („in vivo“) oder indirekt (z.B. durch spezielle Fragetechniken) geschehen. Der Clou des Ganzen: Pathologisch ist nicht der Einzelne, sondern das „System“ (sprich: die jeweilige Familie, die Ehe, der Betrieb etc.); der Einzelne, im systemischen Jargon auch „Symptomträger“ bzw. „Indexpatient“ genannt, kann dementsprechend nur geheilt werden, wenn das System verändert wird. Theoretische Grundlagen: Systemtheorie und Kybernetik: Emergenzprinzip: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile und das Einzelne nur im Gesamtkontext verständlich! Annahme der Zirkularität: das Verhalten jedes Systemmitglieds ist gleichzeitig Ursache und Wirkung des Verhaltens der anderen Mitglieder Rückkopplungsschleifen und kybernetische Schaltkreise halten jedes System in einem Zustand des Gleichgewichts (Homöostase); wird ein Element verändert, verändert sich daher das gesamte System. Kommunikationstheorie (Watzlawick & Co.): Jedes menschliche Verhalten ist Kommunikation (= wechselseitiger Austausch); man kann dementsprechend „nicht nicht kommunizieren“! Jede sprachliche Mitteilung enthält mehrere Botschaften (Beziehungsebene vs. Sachebene) Konstruktivismus: Die Wahrnehmung von Wirklichkeit hängt, insbesondere wenn es sich um soziale Wirklichkeiten handelt, vom Standpunkt des Betrachters ab; die eine Wahrheit gibt es dementsprechend nicht, sondern lediglich verschiedene Konstrukte! Geschichtliche Entwicklung: Virginia Satir (ab den 50er Jahren): Experientelle (erlebnisorientierte) Familientherapie Satir gilt als die Mutter der Familientherapie; sie war u.a. Mitglied der PaloAlto-Gruppe (Forschungsteam in Kalifornien um Jackson, Watzlawick, Haley) Satir entwickelte die Methode der Familienskulptur (=Aufstellen von Familien zur Aufdeckung von systemischen Zusammenhängen: Nähe – Distanz usw.) Salvador Minuchin (70er/80er Jahre): Strukturell-strategische Familientherapie Jede Familie ist durch eine eigene Struktur gekennzeichnet; entscheidend für Familienstrukturen sind dabei v.a. die Grenzen der familiären Subsysteme und die zugrundeliegenden Hierarchien Normatives Fundament: Familiensysteme funktionieren gut, wenn die Hierarchien intakt sind und die Grenzen weder zu schwach bzw. diffus (Verstrickung) noch zu starr (Loslösung) sind. Berühmt geworden ist Minuchin nicht zuletzt durch seinen provokanten Stil („Wie haben Sie es nur geschafft, solche Monster großzuziehen?“) 49 Mara Selvinin Palazzoli (70er Jahre): Mailänder Modell Die von Palazzoli 1967 gegründete Mailänder Schule übernahm viele Annahmen der Palo-Alto-Gruppe und entwickelte sie kreativ weiter: Familien als funktionale und daher schwer veränderbare Regelsysteme (Kybernetik 2. Ordnung) Technik des zirkulären Fragens (triadische Frageweise, die zu Perspektivwechseln anregt): „Was meinen Sie, wie Ihre Frau Ihre Beziehung zu Ihrem Sohn beschreiben würde?!“ Paradoxe Interventionen: z.B. Reframing (positive Umdeutung eines Symptoms), Rückfallvorhersage („Sie werden ohnehin einen Rückfall haben“), Symptomverschiebung (zu einem Ehemann: „Sie dürfen bis zur nächsten Sitzung keinen Strich im Haushalt tun!“) Schlusskommentare: Die Verhaltensweisen der Familienmitglieder loben, weil sie den Zusammenhalt der Familie sichern und dazu auffordern, nichts zu ändern! „Zweikammersystem“ (Co-Therapeut beobachtet den therapeutischen Prozess hinter einer Einwegscheibe) Ivan Boszormenyi-Nagy: Mehrgenerationenperspektiven Psychoanalytisch geprägt; Grundannahme: ungelöste Probleme werden an nachfolgende Generationen weitergegeben (intergenerationale Loyalitäten und Verstrickungen) Helm Stierlin: „Heidelberger Modell“ Stierlin übernahm von allen etwas, insbes. aber von der Mailänder Schule und Boszormenyi-Nagy! Narrative Perspektive: Soziale Systeme konstituieren sich v.a. durch Erzählungen (=> Betonung sprachlicher und kommunikativer Prozesse) Trademark-Therapien: In den USA zeichnet sich der Trend ab, standardisierte und auf spezifische Störungsbilder zugeschnittene Behandlungspakete zu entwickeln (z.B. BRFT: „Brief Stratetic Family Therapy“) Grundlegender Konsens: Gemeinsam ist den verschiedenen systemischen Ansätzen… Wechselwirkungsbeziehung: Individuum und (soziale) Umwelt beeinflussen sich wechselseitig! Dauerhafte Interaktionsmuster: entwickeln sich in jeder Beziehung und sind nur schwer zu verändern, da sie sich wechselseitig verstärken (Prinzip der Zirkularität) Wechselseitige Verflochtenheit: Mikrosysteme sind immer in Makrosysteme eingebettet, es muss daher auch der kulturelle, soziale und materielle Kontext beachtet werden. Problem und Symptom: das Problem ist das, woran es im System hapert, das Symptom ein paradoxer Lösungsversuch des Problems, durch den das in die Krise geratene System stabilisiert wird. Ideen und Bedeutungen: Die Beurteilung von Verhaltensweisen (z.B. Alkoholkonsum) ist nie objektiv, sondern immer abhängig von den Ideen und Bedeutungen, die damit verknüpft werden. Lösung des Problems: Ein Problem kann gelöst werden, indem entweder bestimmte Elemente (Interaktionsmuster) des Systems verändert werden oder indem deren Bewertung durch die Betroffenen verändert wird. Aufgabe des Therapeuten: ist es, solche Veränderungen herbeizuführen; dabei ist der Therapeut selbst Teil des Systems! 50 7.2.2. Merkmale und Methoden systemischer Psychotherapie Charakteristisch für die systemische Psychotherapie ist (neben der systemischen Betrachtungsweise psychischer Störungen): A) „Kundenorientierung“ (Was ist das konkrete Anliegen des Klienten – und wie lässt es sich sein bzw. ihr Problem möglichst schnell lösen?!) Pragmatische, niederschwellige Zielsetzung B) Ressourcenorientierung Z.B.: „Verflüssigende“ Sprache (Nicht: „Der Vater ist aggressiv“, sondern: „Der Vater verhält sich aggressiv.“) C) Allparteilichkeit/Neutralität (Verständnis für alle Systemmitglieder) D) Einsatz verblüffender und humorvoller Interventionen (paradoxe Interventionen etc.) Diagnostik: Die Achse V des DSM-IV (GARF: „Global Assessment of Relationship Functioning Scale”) ermöglicht eine Klassifizierung von Beziehungs- und Interaktionsproblemen; im ICD-10 ist so eine Kodierung noch nicht möglich! Darüber hinaus gibt es verschiedene standardisierte Verfahren zur Erfassung von Familiendaten: Fragebogentests Projektive Tests (z.B. „Familie in Tieren“) „Figure Placement Techniques“ (z.B. den Familiensystemtest, kurz: FAST) Generell gilt jedoch: a) Systemiker orientieren sich zwar an den klassischen Klassifikationssystemen, haben aber darüber hinaus nur ein begrenztes Interesse an standardisierter Diagnostik; sie schöpfen ihre Information v.a. aus folgenden Quellen (Familienanamnese): 1. Beobachtung der Interaktionen (zw. den Familienmitgliedern) 2. Aussagen der Patienten zu ihrem Beziehungserleben 3. Beobachtung und Analyse der Interaktionen mit dem Therapeuten (Übertragung und Gegenübertragung) 4. Rekonstruktion der Familiengeschichte (s.u. Genogramm) 5. Materielle und soziale Lebenslage der Familie b) Worauf bei der Analyse familiärer (und anderer) Interaktionen zu achten ist: - Wiederkehrende Interaktionsmuster (z.B. Vorwurf – Gegenvorwurf) - Prämissen und Regeln des Systems - Grenzen, Koalitionen, Triangulationen - Stärken und Ressourcen Einzelner und des Gesamtsystems - Position des Therapeuten im System - Äußere Einflüsse (Mehrgenerationenperspektive, wirtschaftliche Lage, kultureller Hintergrund etc.) c) Was als „gesunde“ und was als „kranke“ Familie beurteilt wird, hängt immer auch von den expliziten und impliziten Vorstellungend des Therapeuten ab. d) Die Grenzen zwischen Diagnostik und Intervention sind in der systemischen Therapie fließend. Der therapeutische Prozess und typisch systemische Methoden: Rahmenbedingungen und Setting: Kurze Dauer: I.d.R. weniger als 25 Sitzungen; zwischen den Sitzungen z.T. große Abstände (niederfrequentes Arbeiten) Systemische Therapie kann im Einzel- oder Gruppensetting stattfinden 51 Im Idealfall erfolgt die Therapie im „reflecting team“ (Sitzung wird von Kollegen hinter Einwegscheibe beobachtet und anschließend diskutiert: verschiedene Hypothesen etc.) Zu den Forderungen an den Therapeuten: s.o. (Allparteilichkeit, Humor etc.) Im Erstgespräch geht es um 3 Dinge: 1. Gewinnung von Informationen über das Familiensystem und die beteiligten Individuen 2. Einführung neuer Informationen in das System (Vorgehen des systemischen Therapie erläutern, familiäre Einbettung des Symptoms herausarbeiten etc.) 3. Herstellung einer tragfähigen Beziehung mit dem/den Beteiligten (Aufsetzen eines Kontrakts über die Therapieziele, die Rahmenbedingungen etc.) Spezielle Interventionstechniken: Systemische Fragen: zielen darauf ab, den systemischen Kontext von Symptomen freizulegen - Triadische oder zirkuläre Fragen (s.o.): In Anwesenheit des Vaters wird z.B. die Mutter über dessen Beziehung zu seinem Sohn befragt oder er selbst wird danach gefragt, wie wohl seine Frau diese Beziehung einschätzen würde. - Hypothetische Fragen: „Was wäre, wenn über Nacht ein Wunder geschehen würde?“ (Wunderfrage); „Woran würden Sie als erstes merken, dass ihr Problem verschwunden ist?“ - Fragen zur „Verflüssigung“ von Eigenschaften: „Was tut ihre Frau, wenn Sie sie für depressiv halten?“ Genogramme: sind graphische Darstellungen der Familiengeschichte (sehen aus wie Stammbäume, enthalten aber z.T. andere Daten: Krankheiten, Umzüge, Scheidungen etc.) Familienskulpturen: sind symbolische Darstellungen der Familienstruktur; wichtige Dimensionen sind dabei die Darstellung von Hierarchien, Nähe und Distanz; Abwendung und Zuwendung etc. - „Lebende Skulpturen“: Echte Menschen werden aufgestellt - „Figure Placements Techniques“: Ersatzfiguren (z.B. FAST = Familiensystemtest) Schlussinterventionen: „Take-Home-Messages”, Hausaufgaben etc. (z.B. Reframing, paradoxe Interventionen etc.) Evaluation: In Grawes Metaanalyse (1985) sind nur wenige (insgesamt 8) Studien zur systemischen Therapie enthalten (es gab damals halt noch nicht so viele); diese beziehen sich überwiegend auf Kinder und Jugendliche und weisen z.T. gravierende methodische Mängel auf. Eine Verbesserung der Familieninteraktionen tritt fast immer ein, diese führt jedoch nicht immer zu einer Symptomverbesserung des Indexpatienten (eine zusätzliche Einzelbehandlung des Indexpatienten scheint daher angeraten) Insgesamt stellte Grawe fest: keine eindeutigen Aussagen möglich! Mittlerweile (seit Anfang diesen Jahres: 2009) ist die systemische Psychotherapie in Deutschland wissenschaftlich anerkannt! 52 8. Kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze 8.1. Allgemeines zur kognitiven Verhaltenstherapie 8.1.1. Geschichte der (kognitiven) Verhaltenstherapie Definition: Die Verhaltenstherapie ist eine auf der empirischen Psychologie basierende psychotherapeutische Grundorientierung; sie umfasst eine Vielzahl störungsspezifischer und –unspezifischer Therapieverfahren, die auf möglichst hinreichend überprüftem Störungs- und Änderungswissen beruhen und allgemein gesprochen, auf die Ausbildung und Förderung von Fertigkeiten zielen. Charakteristisch für (kognitiv-)verhaltenstherapeutische Ansätze und Verfahren ist, dass sie… a) sich an der empirischen Psychologie (insbesondere dem methodologischen Behaviorismus) orientieren (und dementsprechend ein genuin psychologischer Heilkundeansatz sind) b) sich ständig um Weiterentwicklung und systematische Evaluation bemühen c) an den prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Problembedingungen ansetzen und dabei möglichst störungsspezifisch vorgehen d) problem-, ziel- und handlungsorientiert sind (es werden konkrete und operationalisierte Ziele auf den verschiedenen Ebenen des Verhaltens und Erlebens angestrebt) e) transparent sind (Psychoedukation und Evaluation sind feste Bestandteile) f) „Hilfe zur Selbsthilfe“ bieten wollen Ätiologische Grundverständnis von Störungen: Die (K)VT erklärt Störungen, indem sie folgende Faktoren in den Blick nimmt: Prädisposition Auslösende Bedingungen Aufrechterhaltende Bedingungen Gesundheitsfördernde, schützende Bedingungen Die wichtigsten Errungenschaften der KVT sind: Entwicklung spezieller (und nachhaltig wirksamer!) Therapieprogramme für fast alle psychischen Störungen Ständige Offenheit gegenüber neuen Entwicklungen (wie z.B. achtsamkeitsbasierte Verfahren) Empirische Überprüfung geht mit jeder Neuentwicklung automatisch einher Historische Entwicklung der (kognitiven) Verhaltenstherapie: Grundsätzlich gilt, dass es in Verhaltenstherapie anders als z.B. in der Psychoanalyse (Freud) oder der Gesprächstherapie (Rogers) keine einzelne Gründerfigur gibt. Die Entwicklung erfolgte vielmehr so, dass verschiedene Psychologen nach und nach damit anfingen, die in der empirischen Psychologie „herausgefundenen“ Prinzipien und Lerntheorien im klinischen Kontext anzuwenden! 1900-1930: Die theoretischen und methodischen Wurzeln der (K)VT liegen im Behaviorismus: Pawlow, Watson & Co. (s.u.) 1924: Mary Cover Jones behandelte durch Konfrontation, Habituation und Gegenkonditionierung die Tierphobie eines Kleinkindes (Peter); sie machte damit als eine der ersten die theoretischen Erkenntnisse des Behaviorismus therapeutisch nutzbar! 53 50er Jahre: Als Entstehungsepoche der VT werden meist die 50er Jahre genannt; zum einen war in dieser Zeit die lerntheoretische Grundlagenforschung so weit fortgeschritten, dass sich deren klinische Anwendung geradezu aufdrängte, zum anderen wurde in dieser Zeit die Kritik an der mangelnden Effektivität der etablierten Psychotherapieverfahren (insbes. der Psychoanalyse) immer lauter. Die Zeit war dementsprechend reif für die VT! 40er/50er Jahre: In Südafrika waren Joseph Wolpe, Rachman, Arnold Lazarus u.a. aktiv; ersterer entwickelte 1954/58 die Methode der systematischen Desensibilisierung (reciprocal inhibition), letzterer verwendete 1958 im „South African Medical Journal“ erstmals den Begriff „behaviour therapy“ 1950/52: In England waren Eysenck (außerdem: Jones, Shapiro u.a.) aktiv; Eysenck warf der Psychoanalyse Unwirksamkeit vor (erzielte Verbesserungen seien lediglich das Ergebnis spontaner Remission) und gab damit der empirischen Psychotherapieforschung einen enormen Anstoß (1952); seine Berufung zum Leiter des Londoner Maudsley Hospital gilt als der Beginn der europäischen VT (1950): erforscht wurde dort zunächst v.a. die Anwendung der Konditionierungstheorien auf psychologische Probleme! 50er Jahre: In den USA waren v.a. Skinner und Lindsley aktiv; sie erforschten dort v.a. operante Verfahren („Token economy“, funktionale Analyse des Verhaltens etc.) – ihre Bemühungen blieben jedoch bis in die 60er Jahre von der europäisch-südafrikanischen VT unbemerkt! 60er Jahre: Weiterentwicklung und Konsolidierung der VT Wolpe und Lazarus erhalten Professuren in den USA 1963: erscheint die erste Ausgabe der Zeitschrift „Behaviour Research and Therapy“ (Hrsg. Ist Eysenck) 1966: wird die „Association for the Advancement of Behavior Therapy” gegründet; Präsident ist Cyrill Franks, Vizepräsident Joseph Wolpe 70er Jahre: Etablierung der VT im deutschsprachigen Raum 1969: Aufbau stationärer VT an der Uni Konstanz; erste Vorstellung der VT auf der Tagung experimentell arbeitender Psychologen 1971: Gründung der „European Association of Behaviour Therapy“, deren Vorsitzender Johannes C. Brengelmann wird. Letzterer wird dann auch Leiter der psychologischen Abteilung des Münchener Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, wo die erste Generation deutscher Verhaltenstherapeuten heranwächst: Renate DeJong, Dirk Revenstorf, Heiner Ellgring Weitere wichtige Namen: Niels Birbaumer (der in den USA bei Lazarus, Wolpe und Co. in Schulung war); Jürgen Margraf etc. 60er/70er Jahre: „Kognitive Wende“ in der Psychologie Pionierarbeit leistete in diesem Zusammenhang Albert Bandura (1965) mit seinen Konzepten des Modell-Lernens und der „self-efficacy“ Außerdem bedeutsam sind: - Ellis: Entwicklung der rational-emotiven Therapie (1962) - Beck: Entwicklung der kognitiven Therapie der Depression (1967) - Meichenbaum: Selbstinstruktionstraining (1975) VT und KT wurden lange als getrennte Schulen betrachtet; eine wechselseitige Integration der verschiedenen Konzepte fand erst nach und nach statt. - 1992: Umbenennung der „European Association of Behavior Therapy” in „European Association of Cognitive and Behavior Therapy” - 1995: „World Congress of Behavioral and Cognitive Therapies“ 54 8.2. Respondente Verfahren 8.2.1. Theoretischer Hintergrund der respondenten Verfahren Das klassische Konditionieren geht auf den russischen Mediziner Pawlow zurück. Der „Pawlowsche Hund“: Dadurch, dass die Futtervergabe wiederholt mit dem Läuten einer Glocke einherging, „lernte“ der Hund, bereits beim Hören der Glocke Speichel abzusondern. Zuvor hatte das Läuten lediglich eine Orientierungsreaktion (Ohrenaufstellen) ausgelöst. Beim klassischen Konditionieren wird also ein neuer bzw. „bedingter“ Reiz (CS) als Auslöser für eine biologisch vorgegebene Verhaltensweise [(U)CR] gelernt! Man spricht deshalb auch von Reiz-Reaktions- bzw. S-R-Lernen. Ein unbedingter Reiz (z.B. Nahrung) führt zu einer unbedingten Reaktion (z.B. Speichelsekretion). Im Rahmen der Konditionierung wird der unbedingte Reiz an einen neutralen Reiz (z.B. das Aufleuchten einer Lampe) gekoppelt. Wichtig ist dabei a) die zeitliche- und räumliche Nähe des bedingten und unbedingten Reizes (Kontiguität) sowie b) die Wiederholung dieser Reizkombination: Ist beides gegeben, wird der neutrale Reiz mit dem unbedingten assoziiert! Deshalb auch: assoziatives Lernen Dadurch entsteht eine neue Reiz-Reaktions-Beziehung: Der ursprünglich neutrale Reiz (Lampe) wird zu einem bedingten Reiz, der allein ausreicht, um die jeweilige Reaktion (nun eine bedingte Reaktion) hervorzurufen. Experimente zum klassischen Konditionieren laufen i.d.R. in 3 Phasen ab: 1) Kontrollphase Unbedingter Reiz (z.B. Nahrung) Unbedingte Reaktion (z.B. Speichelfluss) Neutraler Reiz (z.B. Glocke) Orientierungsreaktion (z.B. Ohrenaufstellen) 2) Konditionierungsphase Unbedingter Reiz + Neutraler Reiz Unbedingte Reaktion Nach einigen Wiederholungen: Bedingter Reiz bedingte Reaktion 3) Extinktionsphase: Wiederholte Darbietung des bedingten Reizes (Glocke) ohne den unbedingten (Nahrung) wird die bedingte Reaktion (Speichelfluss gelöscht) Weitere wichtige Prinzipien des klassischen Konditionierens: Gegenkonditionierung: Der bedingten Reaktion (z.B. Angst) wird eine unvereinbarere, stärkere Reaktion (z.B. Entspannung) entgegengesetzt S.u.: Systematische Desensibilisierung Habituation: Abnahme der Reaktionsbereitschaft auf einen in kurzen Intervallen mehrfach dargebotenen Reiz S.u.: Flooding Dishabituation: Wiederauftreten einer Reaktion bei Darbietung eines leicht veränderten oder unbekannten Reizes Spontane Erholung: Eine bereits ansatzweise gelöschte bedingte Reaktion tritt nach einer längeren Pause spontan erneut auf (allerdings mit geringerer Intensität) Schizokinese: Entstehung einer Aufspaltung (der Reaktion) Reaktionen erfolgen auf 3 Ebenen: a) Subjektiv/kognitive CR (z.B. Angstgefühl oder sorgenvolle Gedanken) b) Behaviorale CR (z.B. Vermeidung) c) Physiologische CR (z.B. Anstieg der Herzrate, Schwitzen etc.) Eine Aufspaltung entsteht, wenn eine CR (z.B. die behaviorale) gelöscht wird, während andere (z.B. vegetative) Reaktionen weiterbestehen. 55 Reizgeneralisierung: Um eine bedingte Reaktion zu konditionieren, müssen die bedingten Reize nicht identisch sein; es reicht aus, wenn sie einander ähnlich sind. Z.B. konnte die Speichelproduktion beim „Pawlowschen Hund“ nicht nur durch denselben-, sondern auch durch verschiedene Glockentöne ausgelöst werden. Generell gilt jedoch: Je ähnlicher die verwendeten Auslöser, desto stärker die konditionierte Reaktion (Generalisationsgradient). Reizdifferenzierung: Koppelt man immer nur einen von mehreren einander ähnlichen Reizen mit dem unbedingten Reiz, erfolgt die Reaktion nur auf diesen (Kontrastmethode). Reizdifferenzierung bildet die Grundlage für das Diskrimationslernen bei Tieren. So kann z.B. Hunden beigebracht werden, zw. Kreisen und Ellipsen zu unterscheiden. Wird die Unterscheidung aufgrund zu starker Annäherung unmöglich => experimentelle Neurosen Konditionierung höherer Ordnung: Auch durch die mehrfache Kopplung mit einem bedingten Reiz (Ton) kann ein neutraler Reiz (Licht) konditioniert werden und die entsprechende Reaktion (Speichelsekretion) auslösen. Zwei-Faktoren-Modell der Angst (Mowrer & Miller) Zwei Lernschritte bzw. Faktoren sind entscheidend: 1) Klassische Konditionierung: In einem ersten Schritt wird durch klassische Konditionierung Angst als Reaktion auf einen Reiz gelernt Innere SchmerzFurcht-Reaktion 2) Operante Konditionierung: Im zweiten Schritt wird Angst durch operante Konditionierung zum Antrieb für das Erlenen von Vermeidungsverhalten, sofern letzteres durch die Reduktion der Angst negativ verstärkt wird Offene Vermeidungsreaktion Angst lässt sich vor diesem Hintergrund aus 2 Perspektiven betrachten: als emotionale Reaktion, die gelernt wird wie jede andere Reaktion als Stimulus bzw. Antrieb für Vermeidungsverhalten Grundannahme der VT: Klassisch konditionierte Störungen basieren auf der Koppelung ursprünglich neutraler Reize mit unkonditionierten Stimuli; die Behandlung erfordert daher die Auflösung dieser S-S-Koppelung! Beispiele: UCS (Hundebiss) UCR (Schmerz) [ CS (Hund) CR (Angst)] Außerdem: Enuresis (Einnässen), Asthma, Übelkeit (Chemotherapie) etc. 8.2.2. Die wichtigsten respondenten Verfahren Eine der wichtigsten verhaltenstherapeutischen Methoden ist die der Reizkonfrontation (= Expositionstherapie): Dabei werden genau die Situationen, in denen die Probleme auftreten, mit therapeutischer Hilfe aufgesucht und erst wieder verlassen, wenn die Erregung des Patienten nachgelassen hat und er eine neue Sichtweise über die Situation gewonnen hat. Je nachdem ob die Konfrontation „in vivo“ oder „in sensu“, „massiert“ oder „graduiert“ erfolgt, lassen sich dabei vier Arten von Expositionsverfahren unterscheiden: Intensität der Vorgehensweise Graduiert massiert Imaginiert Systematische Implosion („in sensu“) Desensibilisierung StimuliTyp Real bzw. virtuell Graduierte „In vivo- Flooding („in vivo”) Exposition” 56 Die wichtigsten Wirkmechanismen dieser Verfahren sind: Habituationsprozesse (physiologische Erregungsreduktion) Wahrnehmungs- und Bewertungsveränderungen (=> durch die kortikale Hemmung subkortikaler Affektzentren wie der Amygdala) Das Erlernen neuer Handlungskompetenzen Reziproke Hemmung und Gegenkonditionierung Ablauf: Eine Reizkonfrontation läuft üblicherweise in 4 Schritten ab 1) Diagnostische Phase - Abklärung der Indikation für eine Reizkonfrontation 2) Kognitive Vorbereitung - Entwicklung eines Störungs- und Veränderungsmodells: dabei ist a) darauf zu achten, dass das Modell vom Patienten verstanden und angenommen wird, da die Motivation des Patienten äußerst wichtig ist und b) für eine „Entpathologisierung“ der Störung zu sorgen! 3) Intensivphase - Durchführung der Konfrontation, wobei der Patient, unabhängig davon, ob die Konfrontation graduiert oder massiert erfolgt, solange in der Situation verweilen muss, bis es zu einer deutlichen Abnahme der Reaktion (Angst, Alkoholverlangen etc.) kommt; darüber hinaus darf er kein Vermeidungsverhalten (abwenden etc.) zeigen; stattdessen müssen die Gefühle vom Patienten bewusst zugelassen werden. - Aufbau neuer differenzierender Bewertungen und Gefühle 4) Selbstkontrollphase - Der Patient begibt sich zunehmend eigenverantwortlich in konfrontative Situationen; der Therapeut zieht sich dagegen zunehmend zurück Indikation: V.a. bei Angststörungen (Phobien, Zwänge etc.) sind Konfrontationsverfahren die Methode der Wahl! Sie werden jedoch auch bei anderen Störungen eingesetzt, so z.B. bei: Bulimie (Konfrontation mit Versuchungssituationen), Alkoholund Drogenabhängigkeit, Depression, Psychosen und sexuellen Störungen Bewertung: Konfrontationsverfahren sind extrem wirksam und zudem sehr ökonomisch; der Vorwurf, sie würden lediglich zu einer Symptomverschiebung führen, lässt sich empirisch nicht bestätigen. Systematische Desensibilisierung: wurde 1958 von Wolpe entwickelt und ist nach wie vor eine verhaltenstherapeutische Standardmethode, die insbesondere zum Abbau von Ängsten eingesetzt wird! Das zugrundeliegende Prinzip ist das der Gegenkonditionierung: Wenn eine mit Angst unvereinbare Reaktion (nämlich Entspannung) an einen angsteinflößenden Stimulus gekoppelt wird, kommt es zu einer vollständigen oder teilweisen Unterdrückung der Angstreaktion (reziproke Hemmung), was letztlich dazu führt, dass die Assoziation zwischen dem Reiz und der Angstreaktion abgeschwächt wird! Die systematische Desensibilisierung beruht daher auf 2 Komponenten: 1. Systematisch gesteigerte (graduierte) Reizkonfrontation „in sensu“ 2. Entspannungstraining Vorgehen: A) Besprechung des therapeutischen Vorgehens - Infos über die Prinzipien der systematischen Desensibilisierung B) Entspannungstraining - meist progressive Muskelrelaxation nach Jacobson 57 C) Verhaltensanalyse und Angsthierarchie - Exploration der Angstsituationen (in welchen Situationen tritt die Angst auf?) - Formulierung von Angstitems auf Karteikarten und hierarchische Anordnung dieser Items auf einer Thermometerskala (von angstfreier Situation, über mäßig angstbesetzte Situationen hin zu hoch angstbesetzten Situationen) D) Übungen der Vorstellungskraft - Notwendig, da eine lebhafte Vorstellung essenziell für den Therapieerfolg ist! E) Schrittweise Darbietung der Items bei gleichzeitiger Entspannung - Begonnen wird mit dem niedrigsten Angstitem (z.B. „Mit Kommilitonen über die bevorstehenden Prüfungen sprechen“); sobald Angst auftritt, wird die Imagination abgebrochen und die Entspannung wieder hergestellt (=> allmähliches und mehrfaches Durcharbeiten der Hierarchie) - Beendet wird die Sitzung immer mit einem angstfreien Item! Die Wirkmechanismen sind z.T. umstritten: Reziproke Hemmung: Wolpe ging davon aus, dass der Erfolg seiner Methode darauf zurückzuführen ist, dass die Angst durch die Kopplung an inkompatible Emotionen und Verhaltensweisen gehemmt wird (s.o.). Aber: Systematische Desensibilisierung wirkt auch ohne Entspannung (allerdings nicht so gut). Es scheinen daher noch weitere Mechanismen wirksam zu sein: Steigerung der Selbstwirksamkeit, Erwartungshaltung, einfache Habituation, Extinktion, Neuattribuierung etc. Studien zeigen, dass die Wirksamkeit v.a. mit der Lebhaftigkeit der Vorstellungen und der Kopplung an Entspannung korreliert! Indikation: Bei Ängsten, bei denen in vivo-Konfrontationen nur schwer oder gar nicht durchführbar sind (z.B. bei Prüfungsängsten, posttraumatischen Belastungsstörungen, sexuellen Funktionsstörungen etc.) Wenn massierte Konfrontationen vom Patienten abgelehnt werden Weiterentwicklungen: z.B. das Selbstinstruktionstraining von Meichenbaum (s.u.) oder das Angstbewältigungstraining 8.2.3. Ein konkretes Beispiel: Reizkonfrontation bei Abhängigkeit Der zugrundeliegende Lernprozess: US Drogenkonsum UR psychologische und physiologische Wirkung CS Geruch, Aussehen Situationen, Umgebung Stimmung etc. CR subjektives Verlangen (Craving), körperliche Reaktionen, Annäherung, Konsum Fokus der Therapie liegt auf dem gestörten Annäherungs- und Konsumverhalten! Vorgehen: Der Patient wird mit Hinweisreizen (z.B. Lieblingsschnaps) konfrontiert, die das Problemverhalten auslösen, das Verhalten selbst aber wird unterdrückt (Konfrontation mit Reaktionsvermeidung)! Patient soll sich bewusst auf das in ihm aufsteigende Verlangen konzentrieren und es „raten“. Erst wenn das Verlangen wieder sinkt, wird die Situation verlassen. 58 Effekte: Reduktion bzw. Löschung der physiologisch messbaren „Cue Reactivity“ und damit des Verlangens („Craving“)! Angenommene Wirkmechanismen (Hypothesen): Extinktion der Craving-Reaktion (die eine konditionierte Reaktion ist: s.o.) Unterbrechung von Konsumroutinen bzw. automatisierten Verhaltensketten Erwartungsänderung hinsichtlich der Kontrollierbarkeit des Verlangens Abstinenzzuversicht (Vertrauen in die eigene Kompetenz) Etablierung zustandsabhängiger Bewältigungsstile Empirische Evaluation: Konfrontationsverfahren ist bei Anhängigkeit nicht ganz so effektiv wie bei Angstund Zwangsstörungen Aber: Das Ausmaß an subjektivem Verlangen wird deutlich reduziert! Die Abstinenzraten werden nicht beeinflusst, aber: im Mittel geringerer Alkoholkonsum nach der Therapie! Konfrontationsverfahren stellen eine wichtige Erweiterung multimodaler Behandlungsprogramme zur Verminderung von Rückfällen dar. 8.3. Operante Verfahren 8.3.1. Theoretischer Hintergrund der operanten Verfahren Das Grundprinzip operanter Verfahren formuliert Thorndike in seinem Gesetz der Auswirkung („Law of effect“): Das Gesetz besagt, dass Verhaltensweisen, die angenehme Konsequenzen haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholt werden, während Verhaltensweisen mit negativen Folgen eher nicht wiederholt werden. Die operante Lerntheorie ist demnach eine hedonistische Theorie; sie geht davon aus, dass ein Organismus prinzipiell danach strebt, Angenehmes zu vermeiden und Unlust zu vermeiden! Als Begründer des operanten Konditionierens gilt B.F. Skinner. Wie bei der klassischen Konditionierung handelt es sich dabei um eine Form des assoziativen Lernens. Allerdings wird beim operanten Lernen kein vorhergehender Reiz mit einer Reaktion-, sondern eine Verhaltensweise mit der nachfolgenden Konsequenz assoziiert. Kurz: Es wird gelernt, welche Wirkung das eigene Verhalten hat (daher auch: „instrumentelles“ Lernen). Die „Skinner-Box“: Skinner konditionierte so z.B. Ratten und Tauben darauf, einen Mechanismus (Hebel, Knopf etc.) zu betätigen, um die Futterzufuhr zu regulieren- oder Stromschläge zu vermeiden. Die Tiere lernten in diesem Fall, dass auf spontan gezeigtes (operantes) Verhalten (Hebeldrücken) eine positive Konsequenz erfolgt ( Verstärkung) Zum Unterschied zwischen Verstärkung und Bestrafung: Verstärkung: Verstärker sind nach Skinner alle Konsequenzen, die die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens erhöhen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen positiver und negativer Verstärkung. Positive Verstärkung: Darbietung eines angenehmen Reizes Negative Verstärkung: Beseitigung eines unangenehmen (aversiven) Reizes Bestrafung: Bestrafung umfasst alle Konsequenzen, die zur Unterdrückung eines Verhaltens führen. Auch hier sind 2 Formen zu unterscheiden. Direkte Bestrafung: Hinzufügung eines aversiven Reizes (=negativer Verstärker) Indirekte Bestrafung: Beseitigung eines angenehmen Reizes (=positiver Verstärker) 59 Verschiedene Formen von Verstärkung: Primäre Verstärker: beruhen auf den Grundbedürfnissen eines Organismus (z.B. Nahrung, Sex) Sekundäre Verstärker: beruhen auf der assoziativen Paarung mit primären Verstärkern und sind demnach gelernt (z.B. Lob, Geld etc.). Soziale Verstärkung: Verstärkung erfolgt durch Bezugsperson in der Umgebung Selbstverstärkung: Methode zur Selbstkontrolle („Wenn ich das gelernt habe, belohne ich mich mit…“) Das Premack-Prinzip (Tätigkeitsverstärker): Häufige Verhaltensweisen (beliebte Verhaltensweisen) können als Verstärker für seltenes Verhalten (weniger beliebte Tätigkeiten) wirken. - „Du darfst spielen, wenn du vorher dein Zimmer aufräumst!“ Umgekehrt kann seltenes Verhalten dazu dienen, häufiges und unerwünschtes Verhalten zu reduzieren. - „Wenn du in dieser Woche noch mal zu spät heimkommst, musst du eine Woche lang den Abwasch erledigen!“ Komplexe Verstärkung: liegt vor, wenn verschiedene Verhaltensweisen gleichzeitig gelernt werden sollen (erfolgt meist über Token-Systeme und/oder Kontingenzverträge: s.u.) Intermittierende Verstärkung: liegt vor, wenn das Verhalten nicht immer verstärkt wird, sondern z.B. nur jedes 10. Mal. Bei intermittierender Verstärkung dauert es zwar länger, bis das gewünschte Verhalten gelernt ist, dafür hat es dann aber eine größere Löschungsresistenz! Weitere Begriffe: Kontingenz: Regelmäßigkeit der Verknüpfung von Verhalten und Konsequenz Fading-out: Intermittierende Verstärkung am Ende eines Lernprozesses. Shaping (Verhaltensformung): Stufenweise Annäherung an eine gewünschte Verhaltensweise, indem anfänglich jede Verhaltensweise verstärkt wird, die in Richtung des erwünschten Endverhaltens weist. Chaining: Verstärkung des letzten Glieds einer komplexen Verhaltenskette Prompting: verbale und behaviorale Hilfestellungen beim Erlernen einer Reaktion; etwa indem die Aufmerksamkeit auf das gewünschte Verhalten gelenkt wird, dieses entsprechend erläutert und erklärt wird etc. etc. Löschung: Ohne Verstärkung tritt ein Verhalten immer seltener auf! Spontane Erholung: Nach längerer Zeit ohne Verstärkung tritt ein Verhalten ohne äußerlich erkennbaren Anlass erneut auf. Generalisierung: kann sich auf Stimuli (s.o.) und Reaktionen beziehen; letzteres ist der Fall, wenn in bestimmten Situationen zwar nicht identische, aber ähnliche Reaktionen gezeigt werden. Diskrimierung (s.o.): von Reizen, die eine spätere Belohnung anzeigen (SD) und solchen, die dies nicht tun (S ). Die SORKC-Gleichung zur Verhaltensanalyse: S (Stimuli): bezieht sich auf die Stimuli und Umgebungsfaktoren, die dem problematischen Verhalten vorausgehen Bei Schlafstörungen z.B. das Schlafzimmer O (Organismus): bezieht sich auf die relevanten psychologischen und physiologischen Faktoren innerhalb der Person, die den Umwelteinfluss moderieren. Bei Schlafstörungen z.B. eine hohe Erregung durch Ehe- oder Berufsprobleme 60 R (Reaktion): bezieht sich auf die Verhaltensmuster, die das Problem bedingen bzw. damit einhergehen Bei Schlafstörungen z.B. wach im Bett liegen, etwas essen, fernsehen etc. K (Kontingenz): bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen R und C. C (Konsequenzen): bezieht sich auf die Ereignisse, die der Reaktion folgen und diese verstärken bzw. bestrafen. Kurzfristige Konsequenzen: positive Verstärkung (interessanter Film, gutes Essen); negative Verstärkung (Ablenkung von Sorgen) Mittel- und langfristige Konsequenzen: „Bestrafung“ (Konzentrationsprobleme, Müdigkeit etc.) 8.3.2. Die wichtigsten operanten Verfahren Methoden des Verhaltensaufbaus: orientieren sich an der Verhaltenskette S-C-R! Auf der Ebene der Situation (S): wird mit Diskriminationslernen und Generalisierung gearbeitet! Auf der Ebene der Reaktion (R): wird mit Shaping, Chaning und Prompting gearbeitet. Auf der Ebene der Konsequenzen (C): wird mit differentieller Verstärkung gearbeitet! Aversionsbehandlung: Zeitliche Kopplung eines aversiven Reizes (C-) an klinisch unerwünschtes Verhalten mit dem Ziel, dieses Verhalten zukünftig zu reduzieren. Anwendung: v.a. bei selbstverletzendem Verhalten und Suchtentwöhnung, wobei andere Verfahren aufgrund ethischer Überlegungen immer vorzuziehen sind! Z.B. Alkoholismusbehandlung mit Antabus (das bei Alkoholkonsum zu Übelkeit führt)! Durchführung: Absprache mit dem Patienten, kontingenter Strafreiz (z.B. sich selbst mit einer Nadel piksen, immer wenn problematische Gedanken auftauchen); Behandlung muss mit Aufzeigen und Verstärken von gewünschten Verhaltensalternativen einhergehen! Time-Out-Methode: Vollständiger Verstärkerentzug beim Eintreten eines unerwünschten Verhaltens, gekoppelt mit kontingenter Verstärkung alternativer Verhaltensweisen. Anwendung: v.a. wenn keine eindeutige Identifikation oder andere Entfernung der Verstärker des Problemverhaltens möglich ist. Prinzipiell sind auch hier eher andere Verfahren vorzuziehen Problem: Isolation nur möglich, wenn keine massive Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt Beispiel: Aggressiver Heimbewohner wird bei aggressivem Verhalten aus der Wohngruppe herausgenommen und in ein reizarmes Zimmer gebracht, während adäquates Verhalten verstärkt wird! Token-Programme (Kontingenzmanagement): Token sind sekundäre Verstärker (Münzen, „Smilies“ etc.), die durch adäquates Verhalten verdient- und bei einer bestimmten Anzahl gegen primäre Verstärker (z.B. Süßigkeiten, Ausgang etc.) eingetauscht werden können. Anwendung: z.B. in der Schule bei hyperaktiven Kindern, in der Psychiatrie: bei geistig behinderten Menschen (Förderung der Selbständigkeit, des Sozialverhaltens etc.), bei Suchtkranken (Reduktion des Drogenmissbrauchs) etc. Durchführung: Definition der erwünschten Verhaltensweisen und verfügbaren Verstärker; Festlegen der Regeln für das Verdienen und den Umtausch der Token 61 Response Cost: Vorher erhaltene Verstärker (z.B. Punkte, Token) werden bei unerwünschtem Verhalten wieder entzogen (=indirekte Bestrafung) Durchführung: Auch hier ist vorab eine klare Definition des Verhaltens und der darauf folgenden Konsequenzen notwendig Anwendung: ethische unbedenklich; weniger unerwünschte Nebeneffekte wie bei der direkten Bestrafung (z.B. weniger reaktantes Verhalten) Kontingenzverträge: schriftliche Festlegung erwünschter Verhaltensweisen und der daran gekoppelten Verstärker! Anwendung: dienen v.a. der Selbstmotivation des „Patienten“ (werden v.a. bei Schul- und Erziehungsproblemen eingesetzt) Durchführung: es sollte möglichst kleinschrittig vorgegangen werden (sprich: die ersten Ziele sollten leicht und schnell erreichbar sein); darüber hinaus sollte die Zielperson aktiv in die Gestaltung des Vertrages miteinbezogen werden! Festgelegt werden müssen auch die Konsequenzen bei Vertragsbruch! Stimuluskontrolle: basiert auf der Erkenntnis, dass Verhalten nicht nur von den Konsequenzen, sondern auch von der Situation abhängig ist (Vgl. SORKC-Modell); situative Bedingungen, die das erwünschte Verhalten wahrscheinlicher machen, werden dementsprechend aktiv hergestellt bzw. aufgesucht, während Situationen, in denen unerwünschtes Verhalten auftritt, gemieden werden! Anwendung: z.B. bei Übergewicht (für einen leeren Kühlschrank sorgen!), Abhängigkeit (für eine leere Schnapsbar sorgen!) und Schlafstörungen (für eine förderliche Schlafzimmeratmosphäre sorgen!) Beispiel (systematische Stimuluskontrolle bei Schlafstörungen): Patient darf sich nur ins Bett legen, wenn er müde ist und überhaupt: sein Bett und Schlafzimmer nur und ausschließlich zum Schlafen nutzen (mies!); ist er nach 10 Minuten noch nicht eingeschlafen, muss er das Schlafzimmer dementsprechend verlassen und etwas anderes tun bis er meint, einschlafen zu können. Mehr als die Hälfte der Patienten schläft nach kurzem Training in weniger als 25 Minuten ein! Habit Reversal: Unerwünschte Verhaltensweisen, die Teil einer Verhaltenskette sind, die durch ständige Wiederholung aufrechterhalten wird, teilweise unbewusst abläuft und sozial toleriert wird, sind nur schwer zu löschen; es bedarf dazu einer adäquaten Selbstwahrnehmung und einer systematischen Unterbrechung der betreffenden Verhaltenskette durch konkurrierende Reaktionen (Competing Response Technik)! Anwendung: v.a. bei nervösen Verhaltensgewohnheiten wie Nägelkauen und Trichotillomanie und bei Tics (90%ige Erfolgsrate schon nach 1-2 Sitzungen!) Durchführung: A) Verhaltensbeschreibung: Genaue Verhaltensbeobachtung und BaselineErhebung (etwa durch Verhaltenstagebücher, Videofeedback etc.), wobei es v.a. darauf ankommt, frühe Anzeichen herauszufiltern, um die Kette später gleich unterbrechen zu können B) Aufbau von Veränderungsmotivation: Hervorhebung der negativen Auswirkungen des Problemverhaltens, Einbezug von Bezugspersonen (soziale Verstärkung), tägliche Rückmeldung und Besprechung der Fortschritte (evtl. telefonisch) C) Competing Response Training(!): Kontingente Anwendung vom zum Problemverhalten inkompatiblem Verhalten (bei Nägelkauen z.B.: Fäuste ballen); dazu sind konsequente Übung und viel Lob notwendig! D) Generalisierungstraining: Ziel ist es, die gelernte Reaktion im Alltag (auch unter Stress etc.) anzuwenden; dazu werden zunächst die relevanten Situationen bewusst gemacht und die Anwendung in der Vorstellung geübt! 62 Beim Biofeedback: werden körperliche Veränderungen (z.B. die Herzrate oder Muskeltonus) extern (meist über einen Computer) zurückgemeldet und deren willkürliche Kontrolle systematisch belohnt (operante Verstärkung). Ziel ist es, auf diese Weise eine stabile Selbstkontrolle über die betreffenden Körperfunktionen zu fördern. Die Methode basiert auf der Kybernetik, der zufolge Systeme v.a. durch negative und positive Rückkopplung reguliert werden. Anwendung: z.B. bei Entspannungstrainings, bei Schmerzreduktion, der Prophylaxe von epileptischen Krampfanfällen, Skoliose (Verbiegung der Wirbelsäule), Inkontinenz, Bluthochdruck, ADHS etc. Konkrete Beispiele: Bei Skoliose wird z.B. ein Korsett eingesetzt, dass Rückmeldung über fehlerhafte Körperpositionen gibt; bei Inkontinenz wird mit EMG-Biofeedback der Beckenbodenmuskulatur gearbeitet, bei ADHS können Brain Computer Interfaces eingesetzt werden etc. etc. Durchführung: zu Beginn Shaping; später: intermittierende Verstärkung! Die „Constraint-Induced-Movement-Therapy” (Taub et al.): ist eine Therapie zur Behandlung motorischer Störungen; sie basiert auf dem Phänomen des „Learned Non-Use“, das dadurch zustande kommt, dass die Benutzung gesunder Extremitäten positiv verstärkt, die der verletzten Extremität dagegen bestraft (Misserfolge) wird! Die Therapie, so die Annahme, muss diesen Zusammenhang umkehren! Die empirische Basis dieses Ansatzes bilden Tierversuche, die zeigen, dass die Entwicklung und Aufrechterhaltung chronischer Bewegungsausfälle deafferentierter Affen nicht zuletzt durch die besagten lernpsychologischen Mechanismen beeinflusst werden. Durchführung: Bewegungsrestriktion der gesunden Extremität (etwa indem diese festgebunden wird) Training der verletzten Extremität Anwendung: Effektivität ist empirisch bestätigt; Voraussetzung ist freilich eine gewisse Restbeweglichkeit der betroffenen Extremität! 8.4 Kognitive Verfahren 8.4.0. Allgemeines: Kognitive Annahmen der Verhaltenstherapie: Menschen reagieren v.a. auf kognitive Repräsentationen ihrer Umgebung und nicht auf die Umgebung selbst! Kognitionen beeinflussen als „transformierte Reize“ das Verhalten Kognitive Repräsentationen sind erlernt! Menschliches Lernen ist zu großen Teilen kognitiv vermittelt! Gedanken, Gefühle und Verhalten interagieren miteinander und bedingen sich wechselseitig! Störungen kognitiver Funktionen: Selektive Aufmerksamkeit Selektives Gedächtnis Interpretations-Bias (negative) Schemata Verhaltensprobleme sind das Ergebnis… falscher Annahmen unvollständiger Schlüsse inadäquater Selbstinstruktionen unzureichender Problemlösefähigkeiten 63 Ansatz: Veränderung von dysfunktionalen („falschen“) Annahmen, Glaubenssystemen, Schemata etc. Systematische Veränderung von Bewertungen (= kognitive Umstrukturierung) Realitätsüberprüfungen Realistische Neueinschätzung von Situationen und Handlungen 8.4.1. Rational-emotive Therapie nach Ellis Grundannahmen: 1) Gedanken bestimmen unsere Gefühle! 2) Irrationale Gedanken und Überzeugungen lassen „unangenehme“ Ereignisse zu Katastrophen werden und behindern das Glücksstreben des Menschen! Drei (grundlegende) dysfunktionale Imperative: a) „Ich muss perfekt sein!“ b) „Andere Menschen müssen mich zuvorkommend behandeln!“ c) „Die Umstände müssen so sein, wie ich es will!“ Verschiedene Kategorien irrationaler Gedanken: a) Schwarzweißmalererei b) „Musturbationen“ (= Soll- und Mussgedanken) c) Unrealistische Erwartungen d) Übertreibung der eigenen Wichtigkeit! Das ABC-Modell: A - Activating Event z.B.: „Meine Freunde haben mich unfair behandelt!“ B - Belief System Rationale Überzeugung: „Ich wünschte, sie hätten das nicht getan. Ich lehne ihr Verhalten ab!“ Irrationale Überzeugung: „Sie dürfen mich so nicht behandeln. Ich kann das nicht ertragen. Sie sind schlecht!“ C - Consequences Angemessene Konsequenzen: Frustration, Bedauern; Versuche, die Freunde zu fairem Verhalten zu bewegen etc. Unangemessene Konsequenzen: Hass, aggressives Verhalten etc. D - Disputation „Warum genau ist es so schlimm für mich, unfair behandelt zu werden?“; „Wo steht eigentlich geschrieben, dass ich es nicht ertragen kann?“; „Wieso sind unfaire Menschen eigentlich schlechte Menschen?“ etc. E - Effects Kognitive Effekte: „Mein Leben hängt nicht davon ab, ob sie mich mögen!“ Emotionale Effekte: Weniger Frustration und Enttäuschung! Verhaltenseffekte: Probleme offen ansprechen, evtl. neue Freunde suchen... Das Vorgehen: Die Therapieschritte: Vermittlung der Grundlagen der rational-emotiven Therapie (ABC-Modell...) Erfassung des Belief-Systems (Herausarbeitung irrationaler Überzeugungen...) Disputation irrationaler Annahmen Durcharbeitung zentraler Themen Vermittlung von Strategien zur Selbsthilfe Techniken: a) Kognitive Techniken: Sokratischer Dialog, Vorstellungstechniken - Sokratischer Dialog: Methode der Mäeutik (Hebammenkunst) setzt Hypothesen voraus 64 b) Emotive Techniken: Einsatz von Humor, Empathie, Sprichwörter, Lieder, Gedichte etc. c) Behaviorale Techniken: Risikoübungen; Übungen in schwierigen Situationen, gezielte Belohnung Anwendung und Wirksamkeit: Zwang: möglicherweise wirksam; genauso wirksam wie ExpositionsReaktionsverhinderungstherapie Soziale Ängste, Unsicherheit, Depression, Persönlichkeitsveränderungen: Wirksamkeit noch wenig untersucht Bei Depression mit ausgeprägten kognitiven Defiziten hat die RET einen additiven Effekt zur medikamentösen Behandlung! 8.4.2. Kognitive Therapie nach Beck Beck führt Depressionen auf 3 sich wechselseitig bedingende Faktoren zurück: 1) Die „kognitive Triade der Depression“: negative Beurteilung der eigenen Person, der Umwelt und der Zukunft, 2) Negative Schemata und dysfunktionale Annahmen 3) Kognitiven Verzerrungen / kognitive Fehler Negative Schemata werden durch negative Lebenserfahrungen (z.B. Verlusterlebnisse, Zurückweisung, Kritik oder depressive Modelle) in der Kindheit und Adoleszenz oder durch aktuelle Belastungen erworben und wirken meist unbewusst. Kognitive Schemata bestimmen die Reizwahrnehmung und Informationsverarbeitung, indem sie automatische Gedanken aktivieren. Ein Beispiel für ein solches Schema ist z.B. der Anspruch, immer perfekt zu sein oder von allen geliebt zu werden. Dysfunktional sind solche Annahmen bzw. Schemata deshalb, weil sie zu Fehlschlüssen bzw. kognitiven Verzerrungen führen, die ihrerseits die negativen Schemata zu bestätigen scheinen (=Teufelskreislauf)! So führt z.B. die unbewusste Annahme, immer perfekt sein zu müssen, bei Misserfolg zu der zweifelhaften Schlussfolgerung, wertlos zu sein (bewusst), was wiederum die Annahme verstärkt. Beispiele für dysfunktionale Schemata: Physische Gefahrenschemata (z.B. Befürchtung einer Herzattacke) Soziale Schemata (Angst vor Blamage, Zurückweisung etc.) Mentale Schemata (z.B. die Befürchtung, verrückt zu werden) Kognitive Verzerrungen sind Denkfehler, die durch negative Schemata bedingt werden. Typische Denkfehler sind z.B.: Übertriebene Verallgemeinerungen (Übergeneralisierung): Eine schlechte Note als Beweis für die eigene Dummheit! Über- oder Untertreibung: Positives klein reden, Negatives überbewerten. Voreilige bzw. willkürliche Schlussfolgerungen: Hans hat sich nicht gemeldet – er mag mich nicht! Dinge persönlich nehmen (Personalisierung): Dass ich die Praktikum nicht bekommen habe, liegt nicht daran, dass kein Platz mehr war, sondern daran, dass man mich nicht wollte! Alles-oder-nichts-Denken (= Schwarz-Weiß- bzw. dichotomes Denken): Alles, was nicht der erste Platz ist, ist eine Niederlage! 65 Das Vorgehen: Therapieziele: Vermittlung des theoretischen Modells (Bedeutung negativer Schemata etc.) Identifikation und In-Frage-Stellung negativer Schemata und Gedanken Entwicklung alternativer, hilfreicher Gedanken Setting: Therapie als „Joint Venture“: gemeinsame Erarbeitung von Zielen Kollaborativer Empirismus: Therapeut und Klient arbeiten bei der Baselineerhebung und Verhaltensbeobachtung zusammen Therapeutenverhalten: Das Übliche (Akzeptanz, Wertschätzung, Transparenz etc.) Techniken und Verfahren: Verbale Verfahren: - Tagebuch - Gedankenprotokoll („Thought record“) - Spalten-Technik (1. Situation; 2. Gefühle/Stimmung; 3. Automatische Gedanken/Bilder; 4. Erfahrungen, die die Gedanken stützen; 5. Erfahrungen, die gegen die Gedanken sprechen; 6. Neue Gedanken/Bilder, die hilfreich sind; 7. Stimmungsänderung) - Sokratischer Dialog (In-Frage-Stellung der Realitätsangemessenheit, Aufdeckung logischer Widersprüche etc.) Behaviorale Verfahren: Rollenspiele, Realitätsüberprüfung Zugrundeliegendes Menschenbild: Der Mensch ist nicht passives Opfer seiner Passionen (z.B. Freud) – diese unterliegen vielmehr seiner intellektuellen Kontrolle! Empirische Befunde und Evaluation: Dass depressive Patienten tatsächlich durch negative Schemata und kognitive Verzerrungen gekennzeichnet sind, konnte in einer Vielzahl von Studien nachgewiesen werden. Problematisch ist jedoch Becks Annahme, dass diese kognitiven Faktoren die Depression kausal bedingen. Schließlich kann es sich bei ihnen genauso gut um eine Folge von Depression handeln! Allgemeine Studien zum Zusammenhang von Kognition und Emotion zeigen, dass sich die beiden Größen wechselseitig beeinflussen: Eine Manipulation der Kognitionen hat Einfluss auf den Affekt – umgekehrt hat aber auch die Manipulation der Stimmung Einfluss auf die Kognition! Die Ergebnisse prospektiver Studien sind meist nicht minder uneindeutig: Es konnte bisher also nicht belegt werden, dass negative Kognitionen depressiven Verstimmungen zwangsläufig vorausgehen. Fazit: Am besten erscheint eine bidirektionale Sichtweise, der zufolge sich Kognition und Depression wechselseitig beeinflussen. Trotzdem kann aber davon ausgegangen werden, dass negative Denkmuster einen Risikofaktor darstellen! Anwendung: Depression: Laut APA „wirksam und spezifisch“; ähnlich gute Effekte wie medikamentöse Therapie; längerfristige Wirksamkeit Generalisierte Angst: KVT nach Beck gehört zu den wirksamsten Therapien; längerfristige Wirksamkeit Panik: v.a. bei agoraphobischem Vermeidungsverhalten indiziert! 66 8.4.3. Selbstinstruktionstraining nach Meichenbaum Grundannahme: Emotionen (Ängste etc.) werden durch Selbstinstruktionen („inneres Sprechen“) beeinflusst! Folgende Arten von Selbstinstruktionen bzw. –verbalisationen lassen sich unterscheiden: Orientierung und Planung: „Was ist als nächstes zu tun?!“ Eigene Bewältigungsmöglichkeiten: „Ich kann das!“ Selbstermutigung: „Du kannst die Angst aushalten!“ Selbstbewertung und –verstärkung: „Es ging schon besser als letztes Mal!“ Stressimpfungstraining (Vorgehen): Identifikation unangemessener Selbstinstruktionen und Erarbeitung angemessener Selbstinstruktionen, wobei letztere präventiv eingesetzt werden sollen (daher: „Impfung“) Modellierung durch den Therapeuten Training mit Rollenspielen und Konfrontation mit Stresssituationen Kombination der Selbstinstruktionen mit weiteren Techniken (Stressbewältigungsfertigkeiten wie spontane Muskelentspannung, emotionale Abreaktion etc.) Anwendung und Wirksamkeit: Das Training ist ursprünglich v.a. für Prüfungs- und Sprechangst sowie Hyperaktivität bei Kindern entwickelt worden. Mittlerweile wird es jedoch für ein wesentlich breiteres Störungsspektrum eingesetzt: insbes. bei posttraumatischen Belastungsstörungen; (kindlichen) Ängsten und sozialen Ängsten Bei der PTB hat sich die Stressimpfung als genauso wirksam wie Expositionsverfahren erwiesen. Grawe et al. (1994): sehr eindrucksvolles Wirkungsprofil; additive Effekte mit verhaltensübenden Verfahren; äußerst potent und ökonomisch (ca. 12 Sitzungen; Wirksamkeit nach 6 Monaten nachgewiesen) 8.4.4. Vergleich der 3 Methoden Die Therapieformen nach Ellis, Beck und Meichenbaum zählen alle drei zu den „kognitiv-behavioralen Therapien“; sie setzen jedoch jeweils unterschiedliche Schwerpunkte: Ellis: Erst irrationale Grundannahmen verändern (Top-down) Beck: Erst Denkfehler verändern, dann Grundannahmen (Bottom-up) Meichenbaum: Bewältigungsaussagen und Selbstverbalisation Zunehmende Nivellierung der Unterschiede: Mittlerweile werden die besagten Verfahren in engem Zusammenhang gesehen! Wirksamkeit: Die kognitive Therapie nach Beck ist die am besten evaluierte! 67 8.5. Abschließende Bemerkungen zur Wirksamkeit von Psychotherapie 8.5.1. Versorgungsproblem Zwischen 21 und 33% der Patienten in Allgemeinpraxen leiden unter psychischen Störungen! Davon werden jedoch lediglich 3-4% richtig diagnostiziert! Allgemeinärzte und Internisten verschreiben am häufigsten Psychopharmaka (insbesondere Tranquilizer und Schlafmittel) 30% der Patienten, die stationär in eine Fachklinik aufgenommen werden, leiden seit mehr als 10(!) Jahren an ihrer Krankheit! In den 2 Jahren vor der Aufnahme haben die meisten Patienten überdurchschnittlich viele Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und medizinischtechnische Untersuchungen! Diese Fehlversorgung kommt der Gesellschaft verdammt teuer! Einberechnet werden müssen die weiterbestehenden Kosten für das Problem (z.B. Fehltage), die Kosten für die unwirksamen Behandlungsmethoden (z.B. Tranquilizer, Besuche beim Allgemeinarzt etc.) sowie deren Folgekosten (z.B. unerwünschte Nebenwirkungen von Psychopharmaka) Vorenthalten wird den Patienten: Kognitives Bewältigungstraining für Stresssituationen Kognitive Therapie bei Depression Reizkonfrontationsbehandlungen bei Angststörungen Paartherapie bei Ehekrisen Familientherapeutische Intervention bei problematischen oder belastenden Familienkonstellationen ... 8.5.2. Allgemeines zur Effektivität von Psychotherapie Alle wichtigen psychischen Störungen können psychotherapeutisch behandelt werden. Dem Großteil psychisch Kranker könnte also innerhalb relativ kurzer Zeit (1 Jahr: 40-50 Sitzungen) mit begrenztem Aufwand geholfen werden! Darüber hinaus hilft Psychotherapie bei psychosomatischen Störungen, belastenden organischen Erkrankungen, medizinischen Eingriffen, traumatischen Ereignissen und bei der Bewältigung schwieriger Lebenskonstellationen. Die durch Psychotherapie erzielten Verbesserungen gehen dabei häufig über die Hauptsymptomatik hinaus (=> allgemeine Verbesserung der Lebensqualität!) Grawe et al. (2001): Der auf Psychotherapie zurückführbare Behandlungseffekt liegt bei 1,11! Damit ist die Effektstärke von PT um das 14-fache höher als die anerkannter medikamentöser Maßnahmen zur Herzinfarktprävention (z.B. Beta-Blocker). Werden zur Berechnung der Effektstärke nur Studien zur KVT herangezogen, ist die Effektstärke noch höher; dasselbe gilt, wenn lediglich die Wirkung auf die Hauptsymptomatik berücksichtigt wird! 8.5.3. Wirkungsspezifität: Wirkfaktoren von Psychotherapie: Unspezifische Wirkfaktoren: Die Beziehung ist der empirisch am besten abgesicherte Wirkfaktor von PT Der Patient selbst, genauer dessen Offenheit und Mitarbeit, leisten den wichtigsten Beitrag zu einem guten Therapieergebnis; sie hängen ihrerseits wiederum von der Beziehungsqualität zwischen Therapeut und Klient ab! 68 Die Wirksamkeit von PT hängt jedoch darüber hinaus von spezifischen Wirkfaktoren ab; zwischen den verschiedenen Therapieformen gibt es daher massive Unterschiede ( „Dodo-Bird-Effekt“) Die Berner Therapievergleichsstudie (Grawe et al. 1990) zeigt: Allgemein: Unterschiedliche Therapiemethoden haben unterschiedliche Wirkungsprofile - Enges Wirkungsspektrum (z.B. Hypnose, Biofeedback) vs. breites Wirkungsspektrum (z.B. kognitive Therapie, Training sozialer Kompetenzen, kognitives Bewältigungstraining) Ein nicht-signifikantes Ergebnis für ein PT-Verfahren kann auch dadurch bedingt sein, dass es für manche Patienten gut-, für andere jedoch gar nicht wirkt! Wenn Veränderungen im zwischenmenschlichen Bereich angestrebt werden, empfiehlt sich ein erweitertes Setting (Gruppentherapie, Familientherapie => besser als VT und GPT) Paar- und Familientherapie (systemisch und verhaltenstherapeutisch): Die überindividuelle (systemische) Perspektive hat einen Erklärungswert für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Störungen und die auf ihr beruhenden Therapieformen können als gut untersucht gelten (= wissenschaftlich fundiert => mittlerweile sogar: wissenschaftlich anerkannt!) Psychoanalytische Therapie: Wissenschaftlich fundiert Wirkung meist auf Hauptsymptomatik beschränkt (kaum Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens) Wirkt v.a. bei neurotischen- und Persönlichkeitsstörungen – keine Verbesserung bei psychosomatischen Patienten Wirksamkeit liegt insgesamt deutlich unter der der VT (insbesondere bei Depression und Angststörungen) Gesprächspsychotherapie: Wirksamkeit sehr gut bestätigt Breit einsetzbares Verfahren, aber: nicht für alle Patienten geeignet Die Wirkung verhaltenstherapeutischer Interventionen geht i.d.R. über die der GPT hinaus. - Ausnahme: GPT führt zu einem Anstieg der internalen Kontrollerwartung, die so weder bei VT noch bei GT gefunden werden kann! Kognitive Verhaltenstherapie: Wirksamkeit ist mit weitem Abstand am besten untersucht (nicht nur intensiver, sondern auch in mehr Anwendungsbereichen) KVT hat sich im direkten Vergleich als signifikant wirksamer als alle anderen PT-Verfahren erwiesen 69 9. Neuropsychotherapie 9.1. Einführung: 9.1.1. Einige Meilensteine der Neurowissenschaften Ramon y Cayal (Nobelpreis 1906): stellt als erster die These auf, dass das Gehirn aus einzelnen Nervenzellen besteht und dass Impulse zwischen ihnen durch Kontaktstellen übertragen werden. Sherrington (Nobelpreis 1932): prägte den Begriff der „Synapse“ Die Entwicklung von Elektronenmikroskopen (1931/38) ermöglichte es, die theoretischen Annahmen zu überprüfen! Carlsson und Greengard (Nobelpreis 2000): Rolle des Dopamins bei der Signalübertragung! Eric Kandel (Nobelpreis 2000): Neuronale Grundlagen des Lernens (Langzeitpotenzierung, Genexpression durch den Transkriptionsfaktor CREB: s.u.) Zentral für Kandel‟s Erkenntnisse waren seine mit Experimente mit kalifornischen Seehasen („Aplysia californica“), die nur wenige (ca. 20.000) und ungewöhnlich große Nervenzellen aufweisen und sich daher gut für neurologische Untersuchen eignen! Taktile Reizung des Syphons löst bei der Aplysia einen Kiemenrückzugsreflex aus, der jedoch bei häufiger Reizung zunehmend schwächer wird (Habituation)! Kandel zeigte, dass diese Habituation nicht auf eine reduzierte Erregbarkeit der beteiligten Neurone, sondern auf eine Reduktion der synaptischen Transmission zurückgeht: das sensorische Neuron schüttet weniger Glutamat aus! Durch Konditionierung (Kopplung mit einem elektrischen Reiz am Schwanz) konnte der Kiemenrückzugsreflex nach taktiler Reizung des Siphons auch gesteigert werden! Kandel zeigte, dass die Steigerung auf postsynaptische Prozesse zurückgeht (Öffnung der NMDA-Rezeptoren => Aktivierung von Transkriptionsfaktoren => Freisetzung retrograder Botenstoffe; Erhöhung der Rezeptor- und Synapsenzahl etc.) Fazit: Lernen (und damit auch ein simples Gedächtnis) findet auf der Ebene einzelner synaptischer Verbindungen statt! 9.1.1. Wie dualistisch sind wir? Die Erkenntnisse der Neurowissenschaft haben weitreichende Implikationen: „You are your Synapses. They are who you are.“ (LeDoux) Diverse Studien zeigen, dass dualistische Vorstellungen von Körper und Geist nach wie vor weit verbreitet sind (in etwa 50:50): Sie finden sich v.a. bei jüngeren Menschen, Frauen und Angehörigen einer Religionsgemeinschaft. Bei Leuten, die im medizinischen Bereich arbeiten, sind dualistische Vorstellungen zwar generell weniger verbreitet, immerhin mehr als ein Drittel glaubt jedoch trotzdem, dass Geist und Gehirn zwei unterschiedliche Dinge sind. 70 9.2. Lernen und Gedächtnis 9.2.1. Neurochemische Grundlagen des Lernens Hebb’sche Regel: „Neurons, that fire together, wire together!“ Wird ein Neuron wiederholt aktiviert, wenn das postsynaptische Neuron feuert, dann wird die Synapse zw. den beiden Neuronen durch biochemische bzw. strukturelle Veränderungen gestärkt. Beispiel: Ein Luftstoß (UCS) führt zu einer Lidschlagreaktion (UCR); durch den Luftstoß wird ein Neuron des somatosensorischen Systems aktiviert, das über eine starke Synapse A ein Motoneuron aktiviert, das den Lidschlag auslöst. Wird unmittelbar vor dem Luftstoß ein bestimmter Ton (NS) dargeboten, feuert das entsprechende Neuron des auditiven Systems zeitgleich mit dem (postsynaptischen) Motoneuron für den Lidschlag. Bei häufiger Wiederholung kommt es zur Stärkung der Synapse B, die das Neuron des auditiven Systems mit dem Motoneuron für den Lidschlag verbindet. Der Ton (CS) reicht nach einiger Zeit aus, einen Lidschlag (CR) auszulösen! Die wichtigsten ionotropen Rezeptoren (direktes Gating) sind die AMPA- und GABA-Rezeptoren. AMPA-Rezeptoren reagieren auf Glutamat und wirken erregend (Natrium+ und Kalium+-Einstrom); GABA-Rezeptoren reagieren auf GABA (GammaAmino-Buttersäure) und wirken hemmend (Chlorid--Einstrom). AMPA- und GABA-Rezeptoren finden sich überall im Gehirn und sind v.a. für schnelle Übertragungsprozesse zuständig! Die Übertragungsbereitschaft einer Zelle als solche wird durch die Aktivierung der AMPA- und GABA-Rezeptoren nicht verändert! NMDA-Rezeptoren sind ebenfalls Glutamat-Rezeptoren; im Unterschied zu den AMPA-Rezeptoren sind sie jedoch nicht nur liganden-, sondern auch spannungsgesteuert und reagieren dementsprechend langsamer! Schließlich öffnen sie sich nur, wenn 2 Ereignisse zusammenkommen: 1. die Depolarisation der postsynaptischen Zelle und 2. die Aktivierung des Rezeptors durch Glutamat! Ist die postsynaptische Zelle nicht hinreichend aktiviert, werden die NMDARezeptoren durch Magnesium blockiert! Bei Depolarisation löst sich das Magnesium und der Kanal wird frei für den Einstrom von Kalziumionen. Damit die postsynaptische Membran depolarisiert, sind meist mehrere parallel einlaufende Aktionspotenziale nötig; aus diesem Grund ist der NMDA-Rezeptor eine Art Koinzidenzdetektor für unterschiedliche, aber zeitnah einlaufende Reize (die biochemische Grundlage für Konditionierungsprozesse)! Der Kalziumeinstrom setzt seinerseits verschiedene „Second-messengerProzesse“ in Gang, die zu einer selektiven Verstärkung der Übertragungsbereitschaft jener Synapsen führen, die die Depolarisation ausgelöst haben (= „Bahnung“ bzw. „Langzeitpotenzierung!). Non-NMDA-Rezeptoren (?!): sind metabotrope Rezeptoren (also z.B. Dopaminund Serotoninrezeptoren), die an der Innenseite der Membran ein G-Protein binden und über Second-messenger-Prozesse auf die Ionenkanäle der postsynaptischen Membran einwirken (indirektes Gating). Auch sie sind an der Bahnung bzw. Langzeitpotenzierung hochfrequent bzw. kovariierend aktivierter Synapsen beteiligt! 71 Langzeitpotenzierung: Vorübergehende (Sekunden bis Minuten) oder anhaltende Zunahme der synaptischen Effizienz (= höhere EPSPs bzw. höhere Erregungsbereitschaft der postsynaptischen Zelle) aufgrund wiederholter hochfrequenter Aktivität eines oder mehrerer präsynaptischer Neurone. Dauerhafte Veränderungen der Erregungsbereitschaft werden durch folgende second-messenger-Prozesse erreicht: Andauernde Stimulation der postsynaptischen Zelle Erhöhung der cAMP-Konzentration (zellinterner Botenstoff) Aktivierung des Transkriptionsfaktors CREB (ein Protein, das die Genexpression im Zellkern aktiviert und damit strukturelle Veränderungen einleitet)! 1. Vermehrung der Ionenkanäle => erhöhte Erregungsbereitschaft! 2. Ausbildung weiterer Synapsen 3. Erhöhung der Transmitterausschüttung der präsynaptischen Neurone durch retrograde Botenstoffe 9.2.2. Neuroanatomische Grundlagen des Gedächtnisses Der Hippocampus (im medialen Temporallappen gelegen): ist v.a. für die Gedächtnisbildung (Neubildung und Konsolidierung expliziter Gedächtnisinhalte) zuständig, ist aber auch am Wiederherstellen von Erinnerungen beteiligt. Erinnerungen sind dabei nichts anderes als kortikale Erregungsmuster! Neubildung, Konsolidierung (=Verfestigung) und z.T. Wiederherstellung von Gedächtnisinhalten! Den entscheidenden Hinweis darauf gaben Läsionsstudien (Henry M.) Folgende Regionen sind an der Speicherung von Informationen (=> explizites Gedächtnis) beteiligt: Primäre sensorische Areale (somatosensorischer Kortex, auditorischer Kortex, visueller Kortex): sinnesspezifische Repräsentationen von Objekten und Ereignissen Rhinaler Kortex: Integration der verschiedenen sensorischen Repräsentationen zu einer multimodalen Repräsentation der augenblicklichen Situation (Wahrnehmung => Konzept) und Weiterleitung an den Hippocampus! Hippocampus: stärkt (über NMDA-Rezeptoren) die Verbindung zwischen gleichzeitig aktivierten Mustern, so dass diese reproduziert werden können; damit letzteres möglich ist, müssen die betreffenden Inhalte jedoch als bedeutsam erachtet werden (motivationale, über Dopamin vermittelte Komponente) und im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Thamalus: Entscheidet über Wichtigkeit der eingehenden Informationen und ist zu diesem Zweck nicht nur eng mit den sensorischen Arealen, sondern auch mit der Amygdala (emotionale Reizverarbeitung), dem Präfrontalkortex (aktuelle Ziele und überdauernde Motivation) sowie dem Arbeitsspeicher (Aufmerksamkeitszuteilung) verbunden! 9.2.3. Schlussfolgerungen für die Therapie Der Schwerpunkt der Therapie sollte nicht zu lange auf der Problemaktualisierung liegen (keine „AMPA-Gespräche“). Letztere dient zwar der Vorbereitung der Intervention (Zielaktivierung und Motivation => DA-System) – ist aber nicht deren Zweck: Worum es geht, ist, neue Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen zu etablieren, sprich: neue neuronale Erregungsmuster zu „bahnen“ bzw. schwache Verbindungen zu stärken! 72 Letzteres erfordert Zeit: die neuen Denk- und Verhaltensweisen müssen wiederholt hergestellt- und über längere Zeiträume aufrecht erhalten werden; ein häufiger Zielund Methodenwechsel ist daher kontraindiziert! Stattdessen heißt es: „Dran bleiben“ am Problem bzw. Ziel! Es bedarf klarer Zielvorstellungen und der Therapeut sollte den Patienten aktiv lenken! Frühkindliche und andere Erinnerungen sagen weniger etwas darüber aus, wie etwas tatsächlich passiert ist, als vielmehr darüber, welche Bedeutung es für den Patienten in der Gegenwart hat (begrenzte Validität von Erinnerungen)! Valide Erinnerungen an Ereignisse vor dem 4. LJ sind kaum möglich, da in dieser Zeit der Hippocampus noch nicht hinreichend ausgereift ist, um explizite Gedächtnisspuren zu bilden! Fazit: 1) Wenn allen psychischen Prozessen neuronale Vorgänge zugrunde liegen, dann kann Psychotherapie dauerhaft neuronale Strukturen und Prozesse verändern! 2) Psychotherapie soll Menschen, die durch die Einwirkung von Lebenserfahrungen auf ihr Gehirn krank wurden, durch die Einwirkung neuer Lebenserfahrungen auf das Gehirn wieder gesund machen! 9.3. Neuronale Korrelate wichtiger psychischer Prozesse 9.3.1. Angst Die Amgydala (auch Mandelkern genannt) ist ein paarig angelegtes Kerngebiet im medialen (inneren) Teil des Temporallappens; sie ist Teil des limbischen Systems (zu dem darüber hinaus der Hippocampus, der Fornix, die Corpora mamillarae und der Gyrus Cinguli gehören) Traditionell ging man davon aus, dass sensorische Informationen im Neokortex semantisch interpretiert- und erst dann an die Amygdala weitergeleitet werden. LeDoux (1996) hat jedoch entdeckt, dass die Infos vom Thalamus auch direkt an die Amygdala weitergeleitet werden können („Low route“), weshalb zwischen 2 Arten der emotionalen Informationsverarbeitung zu unterscheiden ist: „Low Road“: Durch die direkte Weiterleitung emotional relevanter Infos vom Thalamus zur Amgydala wird der Körper in Alarmbereitschaft versetzt (wir schrecken vor einer Gummischlange oder einem Ast zurück, weil die Umrisse dieser Gegenstände Gefahr signalisieren) „High Road“: Erst in einem zweiten Schritt werden die sensorischen Infos im Neokortex genauer verarbeitet und die eingeleitete Reaktion ggf. korrigiert! Reiz „High road“ SENSORISCHER THALAMUS „Low Road” NEOKORTEX - Primärer sensorischer Kortex (Umrisse) - unimodaler Assoziationskortex (Objekte) - polymodaler Assoziationskortex AMYGDALA (Konzepte) (Kontexte) emotionale Wirkungen Entorhinaler Kortex Hippocampus Subiculum 73 Outputsysteme der Amygdala: Die Informationen (Afferenzen) kommen im lateralen Nucleus der Amygdala an (s.o.) und werden von dort über den basalen Nucleus zum Zentralen Nucleus („Output-Kern“) der Amygdala weitergeleitet. AMYGDALA (Zentraler Nucleus) 1) Nucleus Reticularis Pontis caudalis Potenzierung des Startle-Reflexes Periaquäduktales Grau 2) Dorsales zentrales Grau Verteidigung, Kampf, Flucht 4) Hypothalamus Autonomes Nervensystem Blutdruck, Herzrate,... HPA-Achse 5) Locus coeruleus Noradrenalin (Vigilanz) 3) Ventrales zentrales Grau 6) Ventrales Tegmentum (VTA) „Freezing“ (Verhaltensstarre) Dopamin (Verhaltenserreg.) Reize, auf die die Amygdala besonders stark reagiert, sind neben unkonditionierten Reizen (z.B. laute, überraschende Geräusche oder Schmerz) Gesichter (insbes. wenn diese ängstlich, wütend oder sonstwie furchteinflösend aussehen)! Aufgrund der „low route“ reagiert die Amygdala dabei auch dann, wenn die Gesichter gar nicht bewusst wahrgenommen werden (s.u.). Die Amygdala hat dementsprechend eine wichtige Funktion bei der Regulierung nonverbaler Kommunikation! Merke: Selbst minimale Gesichtsentgleisungen im therapeutischen Gespräch werden vom Klienten registriert! Die Amygdala bildet das Zentrum der Furchtkonditionierung; hier werden CS und UCS assoziativ miteinander verknüpft! Input (z.B. ein Ton) von Zelle A (im auditorischen Thalamus) ist nicht stark genug, um Zelle C (in der Amygdala) zu aktivieren; sind Zelle A (auditorischer Thalamaus: Ton) und Zelle B (somatosensorischer Thalamus => Elektroshock) bzw. deren Synapsen an Zelle C jedoch gleichzeitig aktiv, wird eine Reaktion ausgelöst. Die Koaktivität von Zelle A und C stärkt deren Verbindung (Hebb’sche Plastizität), so dass in den folgenden Durchgängen der Input von Zelle A ausreicht, um in Zelle C eine Reaktion hervorzurufen! Wichtig: Angstkonditionierung kann ohne Beteiligung des Bewusstseins und damit auch ohne Aufmerksamkeit ablaufen; wahrgenommen werden lediglich die vegetativen Reaktionen! Pbn mit halbseitiger kortikaler Blindheit wird in der blinden Gesichtshälfte ein neutrales Gesicht dargeboten; nachdem dieses mit einem aversiven Reiz (einem lauten Schrei) gepaart wurde, zeigen die Pbn, wenn sie es tatsächlich sehen, einen erhöhten Startle-Reflex, eine erhöhte Aktivität im Parietallappen und beurteilen das Bild schlechter, als wenn sie es vor der Konditionierung gezeigt bekommen! - Erklärung: Die Gesichter wurden zwar nicht bewusst verarbeitet, konnten aber über die „Low route“ trotzdem mit dem aversiven Reiz assoziiert werden! Die Amygdala ist bei sozialer Phobie überaktiviert! Psychopathischen Patienten (PP), Soziophobikern (SP) und „Healthy Controls“ (HC) werden 4 neutrale Gesichter dargeboten, wobei zwei von diesen immer mit einem schmerzhaften Druck verbunden waren (CS+) und manche nie (CS-); erhoben wurden die Hirnaktivität, die SCR und das subjektive Rating. 74 - Ergebnis: Überaktivierung der Amygdala bei SPs und allgemeine Unteraktivierung bei PP! Konditionierte Angstreaktionen können (neurobiologisch betrachtet) nicht „gelöscht“, sondern lediglich gehemmt werden! Einmal „gebahnte“ Verbindungen bleiben zumindest latent ein Leben lang erhalten; sie lassen sich daher immer wieder leicht reaktivieren. Es gibt weniger Projektionen aus frontalen Regionen zur Amygdala als umgekehrt! Dem entspricht, dass unsere Emotionen unser Denken stärker beeinflussen als unser Denken unsere Emotionen zu beeinflussen vermag! Ängste lassen sich daher nur schwer willkürlich kontrollieren; meist werden sie durch Vermeidung zu kontrollieren versucht; diese Strategie wirkt jedoch kontraproduktiv, da so keine neuen Bahnen gebildet-, sondern vielmehr die vorhandenen Bahnen gestärkt werden. Indem man sich angstbesetzten Situationen dagegen bewusst aussetzt und dabei feststellt, dass die befürchteten Konsequenzen ausbleiben und die Angst nachlässt, kann die Angst kognitiv zunehmend kontrolliert werden: Aktive Hemmung durch den präfrontalen Kortex durch Ausbildung neuer Bahnen! Schlussfolgerungen für die Therapie: Psychotherapeutische Interventionen (auch Habituationsund Konfrontationsverfahren) führen nicht zu einer Löschung, sondern zur Hemmung dysfunktionaler Verbindungen! Bei Konfrontationsverfahren kommt es daher v.a. auf die Kontextgestaltung an (dem Patienten muss das Gefühl vermittelt werden, die Situation kontrollieren zu können, er muss entspannt sein etc. etc.) Grundliegender Perspektivwechsel: Der Fokus liegt nicht mehr auf dem, was problematisch ist, sondern auf dem, was an seine Stelle gesetzt werden soll! Ziel ist es, den Aufbau möglichst vieler angsthemmender Synapsen zu fördern! Ressourcenorientierte Betrachtungsweise: es geht nicht darum, etwas zu löschen, sondern darum etwas in Ansätzen bereits Vorhandenes zu stärken! 9.3.2. Intentionales Handeln Reflexion, Kommunikation und intentionales Handeln bilden die Grundlage therapeutischer Veränderungen! Am effektivsten sind „Problemlösetherapien“, also solche Therapien, die versuchen, den Patienten zur selbständigen Bewältigung seiner Probleme anzuleiten! Ermöglicht wird eine solche Problembewältigung durch die Fähigkeit zu zielorientiertem Handeln; letzteres setzt voraus, mehrere, hierarchisch abgestufte Ziele parallel zu repräsentieren: z.B. das Ziel, ein netter Mensch zu sein (Prinzipienebene), das Ziel, den Gästen einen Kaffee anzubieten (Programmebene), das Ziel, den Kaffe aus dem Schrank zu holen usw. Kurz: Handlungsregulation setzt die neuronale Repräsentation von Zielhierarchien voraus! Neuroanatomisch sind höhere kognitive Funktionen wie die Repräsentation längerfristiger Ziele im Frontalkortex angesiedelt. Letzterer besteht aus einer Reihe von Arealen, die ihrerseits in enger Verbindung miteinander stehen und jeweils verschiedene Funktionen erfüllen. 75 Prinzipiell gilt, dass die im Frontalkortex ankommenden Infos stark vorverarbeitet sind; was ankommt, sind also nicht sensorische Einzelinfos, sondern multimodale Repräsentationen der Umgebung! Der orbitofrontale Kortex: hat enge Verbindungen zum Hippocamus, dem Hypothalamus und der Amygdala; zusammen mit letzterer ist er maßgeblich an der emotionalen Bewertung eingehender Infos beteiligt und bestimmt die motivationale Ausrichtung der ablaufenden Prozesse (im Sinne von Annäherung oder Vermeidung) Regelwissen: Um das Verhalten situationsadäquat regulieren zu können, muss der Mensch über Regelwissen verfügen (z.B.: „wenn ich sie heute nachmittag sehe und sie gut gelaunt ist, werde ich sie ansprechen“ bzw. „wenn eine rote Karte kommt, muss ich sie auf den roten Stapel legen, wenn eine grüne kommt,…“); Repräsentiert ist unser Regelwissen im PFC und zwar in Form von Zellverbünden bzw. „Assemblies“! Die Neuronenverbünde, die relevante Regeln repräsentieren, müssen über längere Zeit hinweg aktiv bleiben. Darüber hinaus muss der PFC wissen, welche Bedingungen zur Zielerreichung führen und welche nicht; zuständig dafür ist der laterale und ventrale PFC, der durch dopaminerge Projektionen aus dem Nucleus Accumbens und dem ventralen Tegmentum darüber informiert wird, ob eine Belohnung zu erwarten ist oder nicht. Am stärksten feuern die dopaminergen Neuronen, wenn eine unerwartete Belohnung eintritt, sie feuern jedoch auch dann, wenn eine Belohnung zu erwarten ist, bleibt eine erwartete Belohnung dagegen aus, werden sie aktiv gehemmt. Auf diese Weise kodieren die dopaminergen Neuronen Abweichungen von den Erwartungen (und zwar sowohl in die positive als auch in die negative Richtung) Ein Phasenmodell intentionaler Handlungen ist das Rubikon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer: Es geht von 4 Handlungsphasen (prädeszional, präaktional, aktional, postaktional) und 2 korrespondierenden Bewusstseinslagen (motivational / volitional) aus. 9.3.3. Bewusstsein / explizite und implizite Prozesse Das Bewusstsein entspricht (zumindest nach Grawe) dem Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis! Die Kontinuität und Konsistenz des Bewusstseinsstroms wird dadurch sichergestellt, dass die Inhalte des Arbeitsspeichers zu einem wesentlichen Teil bestimmen, was als nächstes aufgenommen wird (was nicht passt, wird nicht aufgenommen) Ist natürlich Quatsch, denn wie sollte aus Einheiten von 7 +/- 2 Items ein über ein ganzes Leben hinweg kohärenter Strom zusammengesetzt werden?! Die Kohärenz muss durch etwas anderes zustande kommen! (ich denke z.B. grad„ an den anstehenden Urlaub, obwohl das überhaupt nicht zum Thema passt und hab trotzdem noch das Gefühl von Kohärenz und Konsistenz). In den Arbeitsspeicher aufgenommen werden Inputs durch die Fokussierung der Aufmerksamkeit! Die für das Bewusstsein entscheidenden Hirnregionen sind der Hirnstamm, der Thalamus und die Assoziationskortizes! Daraus darf jedoch nicht geschlossen 76 werden, dass das Bewusstsein genau lokalisierbar wäre; stattdessen ist es vielmehr das Produkt verteilter neuronaler Netzwerke! Unterschieden wird zwischen impliziten (unbewussten) und expliziten (bewussten) psychischen Prozessen. Explizit ist das deklarative Gedächtnis (= „Wissensgedächtnis“), das sich in ein semantisches (Weltwissen) und ein episodisches (autobiographische) Gedächtnis unterteilt! Implizit ist das non-deklarative Gedächtnis (= „Verhaltensgedächtnis“); dazu zählen a) das prozedurale Gedächtnis, b) Primingerfahrungen und c) konditionierte Reaktionen! Entgegen unserer Intuition haben implizite Prozesse enormen Einfluss auf unser Verhalten und bewusstes Erleben (Libet, LeDoux etc.); nicht zuletzt die von unseren übergreifenden motivationalen Zielen bestimmten Zielhierarchien sind stark automatisiert und damit zu einem großen Teil implizit! Schlussfolgerungen für die Psychotherapie: Erfahrungen im impliziten Funktionsmodus brauchen viele Wiederholungen! Der explizite Funktionsmodus ist für Neu- und Umlernen (= Veränderungen der neuronalen Verbindungen) daher der geeignetere; er zeichnet sich aus durch: bewusste Reflexion, Intentionsbildung, Planung, willentliche Kontrolle, sprachliche Kommunikation etc. Bei all diesen Fähigkeiten handelt es sich um wichtige therapeutische Ressourcen! Ergo: Psychotherapie nutzt den expliziten Funktionsmodus, um im impliziten System Veränderungen herbeizuführen! Was in der Therapie bewusst abläuft, ist dennoch nur ein kleiner Teil und selbst dieser wird von impliziten Prozessen stark beeinflusst! 9.3.4. Neuronale Plastizität Dass Psychotherapie neuronale Prozesse und Strukturen tatsächlich verändern kann, konnte u.a. durch ein Experiment von Furmark (2002) nachgewiesen werden - nach Grawe ein „Meilenstein“ auf dem Weg zu einer neuropsychotherapeutischen Forschung, wie er sie sich vorstellt! Furmark et al. (2002): ordnete 18 Vpn mit Angst vor öffentlichem Sprechen einer von 3 Bedingungen zu: a) 8 Wochen KVT, b) Pharmakotherapie (SSRI), c) Wartegruppe => erhoben wurde einmal unmittelbar vor- und nach der Therapie sowie ein Jahr später (Follow up): insgesamt 7 Fragebögen zu verschiedenen Aspekten sozialer Angst (STAI etc.) sowie die Herzrate und Gehirnaktivität (PET) während eines 2minütigen Vortrags! - Ergebnisse: Die Pbn in den Therapiegruppen zeigten im Gegensatz zur Wartegruppe in der Post- und Follow-up-Messung signifikante Verbesserungen in den Fragebögen (SSRI-Gruppe: in 2 von 7; KVT: in 5 von 7); - Das Ausmaß dieser Verbesserung korrelierte mit Veränderungen in der Hirnaktivität während des Vortrages: Insbesondere in der Amygdala (v.a. rechts) und im zingulären Kortex (anteriorer und ventral-rostraler Bereich) war die Aktivierung nach der medikamentösen und der kognitivbehavioralen Therapie signifikant geringer – und das sogar noch nach einem Jahr! - Ergo: Erfolgreiche PT führt zu dauerhaften Veränderungen im Gehirn! 77 Psychotherapie wird durch die Hirnforschung nicht überflüssig; sie wird auch in Zukunft nicht durch Psychopharmaka ersetzt werden können! Psychopharmaka können nicht dafür sorgen, dass Menschen andere, positivere und weniger schädliche Erfahrungen machen. Erst solche Erfahrungen führen jedoch zu neuen, funktionaleren Strukturen und Abläufen im Gehirn! Ergo: Die Verschreibung von Psychopharmaka ohne Verantwortungsübernahme für die Erfahrungen, die ein Patient begleitend dazu macht, ist unverantwortlich! Dass Kombinationstherapien häufig erfolgreicher sind als Monotherapien, lässt sich neurowissenschaftlich wie folgt erklären: Psychotherapie führt zu einer gezielten Veränderung der Neurotransmission durch eine Veränderung des Verhaltens und durch die Ermöglichung neuer, positiver Erfahrungen! Pharmakotherapie führt dagegen zu einer generellen Erhöhung bzw. Senkung des Transmitterspiegels! 78 10. Grawes Konsistenztheorie 10.1.0. Allgemeines zur Konsistenztheorie Anliegen: Grawes Konsistenztheorie versucht nicht nur zu klären, worauf psychische Prozesse gerichtet sind – sondern erhebt zugleich den Anspruch, damit ein allgemeines Modell zur Genese psychischer Störungen zu liefern. Was sich Grawe wünscht: Die Konsistenztheorie als Grundlage der von ihm geforderten „allgemeinen Psychotherapie“ (s.o.) Die Konsistenztheorie geht von 4 Ebenen aus, die sich ihrerseits wechselseitig beeinflussen (entweder direkt oder durch Rückkopplungsschleifen). Die vier Ebenen sind: A) Die Systemebene (=> Streben nach systemimmanenter Konsistenz) B) Die Ebene der Grundbedürfnisse (=> Streben nach Bedürfnisbefriedigung) C) Die Ebene der motivationalen Schemata (=> Annäherung vs. Vermeidung) D) Erleben und Verhalten Konsistenz: Nach Grawe streben Organismen nach Konsistenz (Systemebene); er versteht darunter die Übereinstimmung bzw. Vereinbarkeit gleichzeitig ablaufender neuronaler und psychischer Prozesse. Grundbedürfnisse: Darüber hinaus geht Grawe von 4 evolutionär bedingten Grundbedürfnissen aus. Diese Bedürfnisse sind: 1. Das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle 2. Das Bedürfnis nach Lustgewinn bzw. Unlustvermeidung 3. Das Bedürfnis nach Bindung 4. Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung bzw. -schutz Gemeinsam ist diesen Grundbedürfnissen,… a) dass sie bei allen Menschen vorhanden (= universal) sind! b) dass ihre dauerhafte Verletzung bzw. Nicht-Befriedigung zur Schädigung der Gesundheit und des psychischen Wohlbefindens führt. Motivationale Schemata: dienen dazu, die Grundbedürfnisse zu befriedigen bzw. zu schützen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen Annäherungsund Vermeidungsschemata. Das Bedürfnis nach Konsistenz ist selbst kein Grundbedürfnis, sondern ein „Grundprinzip des psychischen Funktionierens“! Während Grundbedürfnisse sich auf Erfahrungen mit der Umwelt beziehen, ist Konsistenz ein Zustand des Organismus! Die Herstellung von Konsistenz entspricht also der Regulation bzw. Koordination neuronaler Prozesse, während die Bedürfnisbefriedigung auf die Angleichung von Umwelt und Innenleben zielt! Trotzdem hängen Konsistenzregulation und Bedürfnisbefriedigung eng miteinander zusammen. Die beiden wichtigsten Formen von Inkonsistenz im psychischen Geschehen sind nämlich: c) Die Inkongruenz: die Nichtübereinstimmung der realen Erfahrungen mit den aktivierten motivationalen Zielen (kurz: Inkongruenz tritt auf, wenn die Bedürfnisbefriedigung scheitert) d) Die Diskonkordanz: die Nichtvereinbarkeit zweier oder mehrerer gleichzeitig aktivierter Grundbedürfnisse oder motivationaler Tendenzen (Annäherungs- und Vermeidungstendenzen hemmen sich gegenseitig) 79 Um Formen von Inkonsistenz handelt es sich bei diesen Zuständen, sofern sie dazu führen, dass gleichzeitig neuronale Erregungsmuster aktiviert sind, die nicht miteinander vereinbar sind! Das Bindeglied zwischen Konsistenzregulation (Streben nach Konsistenz) und Bedürfnisbefriedigung (Streben nach Kongruenz) ist die Kongruenz: die Übereinstimmung zwischen den aktuellen motivationalen Zielen und den realen Wahrnehmungen! Psychische Störungen resultieren aus einer über längere Zeit andauernden Erhöhung des Inkonsistenzniveaus. Da immer mehrere Prozesse parallel ablaufen, ist Inkonsistenz unvermeidbar; auf Dauer führt sie jedoch zu einer massiven Beeinträchtigung zielgerichteten Handelns und damit zu einer beeinträchtigten Bedürfnisbefriedigung (Inkongruenz). Das wiederholte Verfehlen von Annäherungs- und/oder Vermeidungszielen (Annäherungsinkongruenz/Vermeidungsinkongruenz) führt wiederum zu Stress und negativen Emotionen; diese können bewusst erlebt werden (Angst, Enttäuschung, Ärger etc.) oder auch unbewusst wirken (physiologische, hormonelle, endokrinologische Reaktion) und führen letztlich zu psychischen Störungen! Mechanismen, die der Konsistenzsicherung dienen (Abwehrmechanismen, Coping, Emotionsregulation etc.) sind vor diesem Hintergrund nicht nur für die Bedürfnisbefriedigung entscheidend, sondern auch für die Wahrung psychischer Gesundheit! 80 10.1.1. Das Bedürfnis nach Bindung Allgemeines: Die Bedeutung des Bindungsbedürfnisses wurde erstmals von Bowlby und Ainsworth erkannt und empirisch untersucht. Sie unterscheiden 4 Bindungstypen: 1. Sichere Bindung 2. Unsicher-vermeidende Bindung 3. Unsicher-ambivalente Bindung 4. Unsicher-desorganisierte Bindung Der Bindungstyp und das Beziehungsverhalten einer Person werden in der Kindheit grundgelegt und haben tiefgreifende Konsequenzen für das gesamte weitere Leben. Ainsworth: Ca. 1/3 der 11-20 Monatigen Kinder haben keine sichere Bindung und haben negative Emotionen und zeigen nach einer vorübergehenden Trennung von der Mutter vermeidendes-, ambivalentes oder desorganisiertes Verhalten. Der Bindungsstil der Mutter und der der Großmutter sagen zu 81 bzw. 75% den Bindungsstil des Kindes voraus! Der Bindungstyp hat Einfluss auf das Spiel- und Kontaktverhalten, die Ausgewogenheit, die kommunikative Kompetenz, die Autonomie und das Selbstvertrauen im Vorschulalter! Der in der Kindheit ausgebildete Bindungstyp ist relativ stabil, er bildet somit die Grundlage für die „motivationalen Schemata“ (Annäherung vs. Vermeidung) im Erwachsenenalter (Bowlby spricht in diesem Zusammenhang nicht von „motivationalen Schemata“, sondern von „inneren Arbeitsmodellen“). Aufrecht erhalten werden Schemata nicht zuletzt dadurch, dass sie i.d.R. Rückmeldungen provozieren, die sie zu bestätigen scheinen (Teufelskreis)! Die neurobiologischen Grundlagen des Bindungsbedürfnisses: wurden v.a. im Rahmen von Tierversuchen (insbes. mit Rhesusaffen) untersucht: Wenn man sozial lebende Jungtiere (z.B. Küken oder Rhesusaffen) isoliert, zeigen sie Protest- bzw. Verzweiflungsreaktionen. Planksepp konnte zeigen, welche neurologischen Prozesse diesen Reaktionen zugrundliegen. Aktivierung eines Panik-Schaltkreises, bestehend aus dem zentralen Höhlengrau, dem dorso-medialen Thalamus, dem zingulären Kortex und der Amygdala, also Regionen, die an der Ausschüttung von Stresshormonen und Endorphinen beteiligt sind! - Gehemmt wird die Aktivität des Panik-Schaltkreises durch die Ausschüttung von Neuropeptiden (Oxytocin und Proctalin) und endogenen Opiaten; diese Stoffe werden nicht nur bei Befriedigung des Bindungsbedürfnisses ausgeschüttet, sondern lösen darüber hinaus mütterliches Fürsorgeverhalten aus und haben eine gedächtnisfördernde Wirkung (Geruch, körperliche Empfindungen etc. werden genau abgespeichert) - Die Aktivierbarkeit des Panik-Schaltkreises nimmt mit zunehmendem Alter ab; bei Männern jedoch stärker als bei Frauen (was vermutlich auf Testosteron zurückzuführen ist) - These: Während bei Säuglingen und Kleinkindern die homöostatische Regulation auf Inputs von außen angewiesen ist, geht sie später zunehmend in Selbstregulation über! 81 Eine unsichere Bindung (keine Isolation!) führt bei Rhesusaffen zu einer erhöhten Stressanfälligkeit und unsichererem Verhalten! Andrews: teilte Affenmütter und ihre 3-monatigen Kinder über 14 Tage einer von zwei Gruppen zu: in der einen war immer viel Nahrung vorhanden, so dass die Mütter viel Zeit für die Kinder hatten; in der anderen gab es dagegen immer wieder Phasen, in denen die Mutter nach Fressen suchen und die Kinder allein lassen musste. - Ergebnisse: a) Nach den 14 Tagen zeigten die Jungen aus der zweiten Gruppe weniger Erkundungs- und Spielverhalten in neuer Umgebung! b) Nach 3 Jahren: Stärkere Reaktion auf (erregende) Noradrenalingabe, schwächere Reaktion auf (hemmende, beruhigende) Serotoningabe! c) Im Alter von 4 Jahren: signifikant erhöhter CRF-Spiegel in der Zerebrospinalflüssigkeit (Cortikotropin-Releasing-Faktor) => langfristig erhöhte Stressanfälligkeit! Genetische Grundlagen: Der Bindungsstil wird nicht vererbt, sondern resultiert aus Bindungserfahrungen! Liegt das Serotonintransportergen (5-HTT) in der kurzen Variante vor, findet sich i.d.R. eine geringere serotonerge Aktivität! Aber: das gilt nur für Affen, die ohne Mutter aufgewachsen sind! Bei Affen mit sicherer Bindung spielt der Genotyp keine Rolle für den Serotoninstoffwechsel! - Ein klarer Beleg für das Diathese-Stress-Modell: eine weniger günstige genetische Ausstattung kann durch Umwelteinflüsse vollständig ausgeglichen werden! Risikoaffen (besonders erregbar, weniger Serotonin) wurden auf Ersatzmütter verteilt, von denen ein Teil vorher durch besonders fürsorgliches Verhalten aufgefallen war („Supermütter“), ein Teil nicht (normale Mütter) - Ergebnis: Die von den Supermüttern großgezogenen Risikoaffen entwickelten sich prächtig, die von den normalen Müttern großgezogenen dagegen entwickelten sich (wie aufgrund ihrer genetischen Ausstattung erwartet) eher schlecht! Mutter-Kind-Interaktion: Das angeborene Temperament eines Kindes kann einen ungünstigen Einfluss auf die Bindungserfahrung nehmen. Bei stark irritierbaren Säuglingen sind Mütter z.B. weniger feinfühlig und bieten weniger Stimulation, was die Wahrscheinlichkeit eines ungünstigen Bindungsstils erhöht. Entsprechende Studien zeigen, dass die Feinfühligkeit von Müttern durch spezielles Training erhöht werden kann, was zugleich positive Auswirkungen auf die Bindung zum Kind hat! Ergo: Bindungserfahrungen sind kein unausweichliches Schicksal (Gene, Bezugsperson), sondern können durch gezielte Maßnahmen in eine positive Richtung gelenkt werden! Verletzungen des Bindungsbedürfnisses führen in einen Teufelskreislauf: es bilden sich stabile Vermeidungstendenzen heraus, die auch in Zukunft positive Bindungen eher unwahrscheinlich machen; darüber hinaus steht eine ausgeprägte Vermeidungstendenz auch der Befriedigung anderer Bedürfnisse im Weg! Positive Rückkopplung: Bei Kindern, die eine sichere Bindung erfahren, werden zugleich die anderen 3 Grundbedürfnisse erfüllt: positive Kontrollerfahrungen, selbstwerterhöhende Erfahrungen und positive Emotionen! 82 Inkongruenzerfahrungen bezüglich des Bindungsbedürfnisses führen dagegen zu intensiven negativen Emotionen, einer schlechteren Emotionsregulation und Gefühlen der Nicht-Kontrollierbarkeit. Es werden nicht nur in der Kindheit, sondern auch später weniger positive Lebenserfahrungen gemacht! Die Konsequenzen: a) Überwiegen von Vermeidungstendenzen b) Dauerhafte Konflikte zwischen Annäherungs- und Vermeidungstendenz! Fazit: Ein unsicherer Bindungsstil erhöht die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Störung enorm! Fast alle Psychotherapiepatienten konnten ihr Bedürfnis nach Bindung in lebensgeschichtlich wichtigen Beziehungen nicht ausreichend befriedigen! Ca. 60% der Normalbevölkerung sind sicher gebunden, in klinischen Stichproben sind es dagegen nur 10% (gemessen mit dem „Adult Attachement Interview“)! Ergo: Ein unsicherer Bindungsstil ist der größte Risikofaktor für die Ausbildung einer psychischen Störung! Schlussfolgerungen für die Psychotherapie: Bindungsmuster sind sehr stabil! Durch kurzfristige und stark störungsspezifische Therapien können sie daher nicht verändert werden, sondern bleiben ein lebenslanger Risikofaktor! Ergo: Bei ausschließlich störungsspezifischen Interventionen, seien sie medikamentöser oder psychotherapeutischer Art, sind Rückfälle sehr wahrscheinlich! Der zwischenmenschliche Bereich muss bei der Therapie stärker berücksichtigt werden! Entsprechende Befragungen zeigen, dass die Bewältigung interpersoneller Probleme das am häufigsten genannte Therapieziel von Patienten ist (78%); es rangiert also noch vor der Problem- und Symptombewältigung (59%)!! Das ist natürlich nicht bei allen Störungen so, sondern bezieht sich lediglich auf den Durchschnitt. Bei Depressionen ist es z.B. tatsächlich so, dass dem interpersonellen Bereich größeres Gewicht als der Symptom- und Problembewältigung beigemessen wird, bei Angststörungen ist es dagegen umgekehrt! 10.1.2. Das Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung Positive Kontrollerfahrungen, also die Erfahrung, dass durch das eigene Handeln intendierte Wirkungen erzielt werden können, führen zu einer positiven Kontrollüberzeugung (Rotter) bzw. Selbstwirksamkeitserwartung (Bandura). Dieses Gefühl, also das Gefühl, etwas bewirken zu können, ist für die Psyche unabdingbar. Dabei geht es nicht nur darum, in der aktuellen Situation Kontrolle auszuüben, sondern auch darum, sich vorbereitend einen möglichst großen Handlungsspielraum zu erhalten. Das Bedürfnis nach Orientierung, also das Bedürfnis, die Welt um sich herum zu verstehen, ist die kognitive Komponente des Kontrollbedürfnisses! Das Kontrollbedürfnis steht in besonders engem Zusammenhang mit dem Gefühl der Inkongruenz: Da sich bei wahrgenommener Inkongruenz immer die Frage stellt, wie diese behoben bzw. kontrolliert werden kann, wird durch das Kontrollbedürfnis durch jede Art von Inkongruenz aktiviert. 83 Inkongruenz in Bezug auf Vermeidungsziele ist dabei schwerer zu kontrollieren als Annäherungsinkongruenz; sprich: das Vorhaben, etwas anzustreben ist leichter umzusetzen als das Vorhaben, etwas zu vermeiden (s.u.)! Durch Befriedigung des Kontrollbedürfnisses wird Inkongruenz (auch bezüglich anderer Bedürfnisse) reduziert, durch Nicht-Befriedigung evoziert! Neurobiologische Grundlage: Um Inkongruenzen zu entdecken und zu überwachen, bedarf es eines „Komparators“, der permanent zwischen der Realität und den aktivierten Zielen vergleicht und ausgehend davon entsprechende Erwartungen bildet, wie es von der aktuellen Situation aus weitergehen wird. Geleistet werden diese Aufgaben von Regionen des limbischen Systems und den Assoziationskortizes: Hier werden die sensorischen Inputs, die als nächstes geplanten Schritte, das Zusammenhangs- bzw. Regelwissen sowie gespeicherte Verhaltens-Wirkungs-Kontingenzen verarbeitet und in entsprechende Erwartungen transformiert (s.u.)! Wenn der „Komparator“ eine bedrohliche Situation anzeigt, wird das „Behavior Inhibition System“ (BIS) aktiviert! Inkongruenz löst Stress aus. Unterschieden werden muss dabei zwischen kontrollierbarer und unkontrollierbarer Inkongruenz: Erstere wirkt sich positiv auf die Entwicklung aus, letztere negativ. Folgen kontrollierbarer Inkongruenz: Stress, den man glaubt, bewältigen bzw. kontrollieren zu können, wird nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung empfunden. Kurzfristiger Stress führt über das sympathische Nervensystem (absteigende Bahnen) zu Ausschüttung von Noradrenalin (unspezifische Erregung); die adrenerge Stimulierung macht den Organismus leistungsfähiger und das Gehirn lernfähiger: Es können leichter neue Verbindungen gebahnt und damit neue Netzwerke aufgebaut werden; letztere helfen, die Situation in Zukunft zu bewältigen. Bei anhaltendem Stress kommt es zur Aktivierung der HypothalamusHypophysen-Nebennierenrinden-Achse und damit zu einer erhöhten Kortisolausschüttung, die auf die Dauer zu mehreren Beeinträchtigungen führt (s.u.)! Kurz: Solange Inkongruenz kontrollierbar und zeitlich begrenzt bleibt, ist sie positiv zu werten: Sie ist gewissermaßen der Motor der psychischen Entwicklung! Junge Ratten wurden 3 Wochen lang während der Stillphase jeden Tag für 15 Minuten von der Mutter entfernt (Stressimpfung). Als Erwachsene waren sie weniger furchtsam in neuer Umgebung und zeigten eine geringere hormonelle Stressreaktion, was v.a. durch eine bessere Rückkopplung der HPA-Achse bedingt war! Folgen unkontrollierbarer Inkongruenz: Bei unkontrollierbarem Stress (z.B. Kindesmissbrauch) wird die negative Rückkopplungsschleife der HPA-Achse durchbrochen (eskalierende Dysregulation) Der Gluckortikoidspiegel nimmt weiter zu und führt u.a. zu Schädigungen am Hippocampus (Angriff der Glutamatrezeptoren) und dem Kortex, wodurch bereits erworbene Verhaltensweisen wieder gelöscht werden können. Verstärkt werden Verhaltensweisen, die die Inkongruenz herab regulieren (Dissoziationen, sozialer Rückzug etc.); gelernt wird v.a. der durch den Stressor ausgelöste Zustand, nämlich Angst (letztere ist dabei umso größer, je 84 höher die Relevanz der Situation und je geringer die wahrgenommene Kontrolle)! Aktivierung des „Behavior Inhibition Systems“ (BIS), das v.a. im ventromedialen und dorsolateralen Teil des rechten PFC (Vermeidung) lokalisiert ist und der Vorbereitung von Flucht- oder Angriffsverhalten dient (= antizipatorische Angst): s.u.! Fazit: A) Hohe Kontrollerwartungen erfüllen eine protektive Funktion und sind damit wichtiger Bestandteil der psychischen Gesundheit! B) Sie gehen einher mit mehr Selbstvertrauen, höherer Lebenszufriedenheit, stärkerem Wohlbefinden und höherer Stressresistenz! C) Darüber hinaus führen sie zu mehr positiven Lebenserfahrungen! 10.1.3. Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung Die Regulation des Selbstwertes setzt Ich-Bewusstheit und die Fähigkeit zur Reflexion voraus; das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung ist dementsprechend ein spezifisch menschliches Bedürfnis! Nach Alfred Adler (Individualpsychologie) ist die Überwindung des eigenen Minderwertigkeitsgefühls die wichtigste Motivationsquelle des Menschen! Das Selbstbild entwickelt sich durch Interaktion mit anderen Menschen (Buber: „Der Mensch wird am Du zum Ich!“) Ein neurologisches Korrelat des Selbstwertes wurde bisher nicht gefunden! Entscheidend für die Entwicklung des Selbstwerts sind v.a. die frühen Bindungsund Kontrollerfahrungen eines Menschen! Sind diese negativ, ist auch das Selbstbild eher schlecht: Die motivationalen Schemata sind v.a. auf Vermeidung ausgerichtet, so dass keine oder nur wenige Erfahrungen gemacht werden können, die den Selbstwert erhöhen könnten! Bei gesunden Menschen besteht eine allgemeine Tendenz zur Selbstwerterhöhung und zum Selbstwertschutz! Die Tendenz zur Selbstwerterhöhung ist dabei Teil des Annäherungs-, die Tendenz zum Selbstwertschutz Teil des Vermeidungssystems! Die besagten Tendenzen können explizit oder implizit zum Ausdruck kommen. Implizites und explizites Selbstwertgefühl müssen dabei nicht immer übereinstimmen! Verhaltenswirksam wird vermutlich v.a. das implizite Selbstwertgefühl, weshalb in der Therapie der Schwerpunkt darauf gelegt werden sollte, eben dieses zu erhöhen! Positive Infos über einen selbst werden schneller verarbeitet und besser erinnert als negative! Memory-Bias: Selbstwertabträgliche Aussagen werden schlechter erinnert als selbstwertzuträgliche, allerdings nur dann, wenn sich die Aussagen auf Aspekte des Selbsts beziehen, die den Vpn wichtig sind! („Iconsistencynegativity-neglect model“ von Sedikides und Green) Menschen neigen dazu, sich selbst positiver zu beschreiben als den Durchschnitt (z.B. halten sich die meisten für einen überdurchschnittlich guten Autofahrer, was rein logisch nicht möglich ist)! Zum Vergleich mit anderen Menschen werden positive Attribute herangezogen! Kurz: Gesunde Menschen neigen zu einer verzerrten Wahrnehmung der eigenen Person; sie haben Selbstwert- und (Kontroll-)Illusionen! Depressive und Menschen mit negativem Selbstwert haben solche Illusionen nicht; sie haben ein realistischeres, dafür aber wesentlich ungesünderes Selbstbild! Dasselbe gilt für viele andere psychische Störungen! 85 Fazit: Die Tendenz zur Erhöhung und zum Schutz des eigenen Selbstwerts ist ein wichtiger Bestandteil psychischer Gesundheit! Personen, deren Selbstwertbedürfnis stark verletzt wurde (etwa durch Mobbing oder indem das Bindungs- und Kontrollbedürfnis nicht hinreichend befriedigt wurden) entwickeln diese Tendenz nicht! Sie haben ein erhöhtes Risiko, psychische Störungen zu entwickeln! Schlussfolgerungen für die Therapie: Es geht nicht darum, dem Patienten ein möglichst realistisches Selbstbild zu vermitteln! Stattdessen muss selbstwerterhöhendes Verhalten unterstützt werden, auch wenn es etwas übertrieben erscheint! 10.1.4. Das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung Die Bewertung, ob etwas gut oder schlecht ist, ist ein ständig aktiver Motor des psychischen Geschehens. Dabei läuft diese Bewertung, insbesondere was ihre emotionale Komponente betrifft, zu großen Teilen unbewusst ab: noch bevor eine Situation überdacht wurde, kommt es dadurch zur automatischen Aktivierung von Annäherungs- oder Vermeidungstendenzen (BAS und BIS). Positive Wörter werden während einer Armbeugung (Annäherung) und negative während einer Armstreckung (Vermeidung) schneller der richtigen Kategorie zugeordnet! Interpretation: Psychische Prozesse laufen leichter und schneller ab, wenn die gut-schlecht-Bewertung kompatibel ist mit der Verhaltensausrichtung (Annäherung – Vermeidung); letztere scheint der bewussten Bewertung also vorauszugehen! Die Erreichung von Annäherungszielen lässt sich leichter kontrollieren als die von Vermeidungszielen (s.o.). Annäherungsziele können in Teilziele untergliedert werden, mit intrinsischer Motivation verfolgt werden, die Wirksamkeit des eigenen Handelns ist unmittelbar feststellbar, man kann sich ganz auf das Ziel konzentrieren etc. etc. Vermeidungsziele erfordern dagegen dauernde Kontrolle, eine verteilte statt fokussierte Aufmerksamkeit, können nie mit Sicherheit erreicht werden (schließlich kann das Problem immer auftauchen!), führen nicht zu positiver, sondern allenfalls negativer Verstärkung, werden nicht von positiven, sondern negativen Emotionen begleitet etc. etc. Neurobiologische Grundlagen der Annäherung und Vermeidung: Das Annäherungssystem (BAS) ist im linken- das Vermeidungssystem (BIS) im rechten PFC angesiedelt: Linkshemisphärisch: - Repräsentation von Annäherungszielen: DLPFC - Positive Emotionen: Ventromedialer PFC Rechtshemisphärisch: - Repräsentation von Vermeidungszielen: DLPFC - Negative Emotionen: Ventromedialer PFC Die Tendenz zu stärkerer Links- oder Rechtsverarbeitung ist angeboren („affective Style“) Die Tendenz zu stärkerer Rechtsverarbeitung korreliert mit Neurotizismus und stellt ein erhöhtes Risiko für Depressionen und Angststörungen dar (Disposition zu negativen Emotionen)! 86 - Die Betroffenen sind schon als Kinder störanfälliger, sind eher vermeidend als explorativ, haben ein höheres Risiko, keine gute Bindung aufzubauen, und machen i.d.R. seltener positive Erfahrungen! Eine stärkere Linksaktivierung korreliert mit Extraversion! Wichtig ist: Das Vermeidungs- und Annäherungssystem sind voneinander unabhängige Motivationssysteme! Dementsprechend lassen sich außerhalb des Normalbereichs vier (und nicht nur zwei) Extremtypen unterscheiden: 1. Depressive: starke Vermeidungstendenz, schwache Annäherungstendenz 2. „Genügsame Langweiler“: schwache Vermeidungstendenz, schwache Annäherungstendenz 3. Interessante und aktive, aber instabile Persönlichkeiten: starke Vermeidungstendenz, starke Annäherungstendenz 4. Stabile, aktive Frohnaturen: starke Annäherungstendenz, schwache Vermeidungstendenz Der „Fragebogen zur Erfassung motivationaler Schemata“ (FAMOS) von Grawe erfasst die Annäherungs- und Vermeidungsziele einer Person sowie deren Konsistenz bzw. Inkonsistenz. Seine Auswertung zeigt v.a. eines: Zwischen Annäherungs- und Vermeidungszielen besteht keine signifikante Korrelation => Annäherungs- und Vermeidungssystem sind also unabhängig voneinander! - Es gilt jedoch: Wer viele Vermeidungsziele hat, kann seine Annäherungsziele schlechter realisieren! Sprich: Vermeidungsziele hemmen Annäherungsaktivität! Neurobiologischer Ablauf en Detail: Hypothalamus informiert den PFC über den Bedürfniszustand Ausgehend davon trifft der PFC eine Annäherungs- oder Vermeidungsentscheidung Der Nucleus Accumbens bringt das Verhalten in Gang und verstärkt es bei positivem Ausgang (Dopamin) => Bahnung assoziativer Verbindungen Bei Beendigung bzw. Hemmung motivierten Verhaltens steigt der Acteylcholinspiegel im Nucleus Accumbens! Vermeidungsdominanz korreliert negativ mit einer positiven Lebenseinstellung und einem hohen Selbstwert; positiv korreliert sie mit interpersonellen Problemen, Annäherungsinkongruenz, sozialer Angst, psychopathologischer Symptomatik (SCL90) und Depressivität! Können Vermeidungsziele durch Therapie verändert werden?! Prä-PostVergleiche mit dem FAMOS zeigen: Ja, sie können! Es wird eine Effektstärke von 1.06 erreicht, was in Anbetracht der Tatsache das motivationale Ziele an sich stabile Merkmale sind, extrem gut ist! Darüber hinaus korreliert die Veränderung der motivationalen Ziele mit Veränderung an anderen Therapieerfolgsmaßen. Schlussfolgerungen für die Therapie: Bei aktiviertem Vermeidungssystem werden negative Bewertungen gefördert; Vermeidungsziele zu erreichen ist zudem schwieriger und weniger befriedigend! Der Therapeut muss vor diesem Hintergrund das Annäherungssystem aktivieren! 87 10.2. Schlussfolgerungen für die Psychotherapie 10.2.1. Formen von Inkonsistenz und ihre Auswirkungen auf die Psyche Inkonsistenz ist die Unvereinbarkeit gleichzeitig ablaufender Prozesse; da Ziele immer nur auf Kosten anderer Ziele erreicht werden können – und im Gehirn immer mehrere Verarbeitungsprozesse gleichzeitig aktiv sind, ist ein gewisses Maß an Inkonsistenz unvermeidbar. Wenn Inkonsistenz nicht abgebaut werden kann, gefährdet sie jedoch die Bedürfnisbefriedigung und damit die psychische Gesundheit einer Person. Folgende Formen von Inkonsistenz lassen sich unterscheiden: a) Interferenz zweier oder mehrerer Prozesse: tritt z.B. beim Strooptest auf - Das anteriore Zingulum ist bei Aufgaben wie dem Strooptest besonders aktiv; es fungiert als eine Art Konfliktmonitor und lenkt die Aufmerksamkeit auf die Quellen der Interferenz b) Kognitive Dissonanz (Festinger): liegt vor, wenn zwei füreinander relevante Kognitionen nicht miteinander vereinbar sind (z.B. eine engagierte Linke, die ihren Mann liebt, obwohl er in der CDU ist) - Einstellungsänderungen, die aufgrund zur Reduktion kognitiver Dissonanz vorgenommen werden, sind echt und stabil; sie sind eines der am besten abgesicherten Phänomene der Psychologie! - Personen, die habituell verdrängen, werden „Repressors“ genannt! c) Dissoziation: entsteht durch Verdrängung und liegt dementsprechend vor, wenn implizite Annahmen mit expliziten im Widerspruch stehen - Dissoziation ist ein hervorstechendes Merkmal vieler psychopathologischer Beschwerdebilder (z.B. bei der PTSD, dissoziativen Störungen etc.) d) Motivationale Konflikte (=Diskonkordanz): liegt vor, wenn sich gleichzeitig aktivierte Ziele widersprechen - Annäherungs-Annäherungskonflikte („Nehm ich das Gericht oder das?“) - Annäherungs-Vermeidungskonflikte („Geh ich hin oder nicht?“) - Vermeidungs-Vermeidungskonflikte („Pest oder Cholera?“) - Doppelte Annäherungs-Vermeidungskonflikte („Lern ich oder geh ich schwimmen?“) - Vermeidungs-Annäherungskonflikte (wenn Vermeidungsziel überwiegt, man sich aber trotzdem annähert) e) Inkongruenz (s.o.): liegt vor, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt werden, wenn also die realen Wahrnehmungen („Niemand liebt mich!“) nicht mit den motivationalen Zielen übereinstimmen. Fazit: Die Kernannahme des Konsistenzmodells, nämlich, dass der Mensch nach Konsistenz strebt, kann sich auf eine breite empirische Basis stützen! Neuronale Mechanismen der Konsistenzsicherung: Die Sicherung von Konsistenz findet auf unterschiedlichen Ebenen statt: Einen der basalsten Mechanismen stellt das Corpus Callosum dar, sofern es den Informationsaustausch zwischen den beiden Hemisphären ermöglicht! Ein ähnlich basaler Mechanismus ist die aktivitätsabhängige Hemmung, die auf allen Ebenen des Nervensystems eine Rolle spielt (Auf der motorischen Ebene wird z.B. durch die Aktivierung des Streckers der Beuger gehemmt, auf kognitiver Ebene hemmen sich z.B. entgegengesetzte Ziele: den Kuchen essen oder in den Kühlschrank stellen?!) 88 Ein weiterer Mechanismus ist die selektive Aufmerksamkeit (sensorischer Filter) Indikatoren von Inkonsistenz sind auf physiologischer Ebene: Muskelspannung, humurale Indikatoren, erhöhte Aktivität des anterioren Zingulums etc.; auf der Wahrnehmungsebene: ein unangenehmes „Spannungsgefühl“ Inkonsistenzreduktion als Motor der psychischen Entwicklung: Neue Denk- und Verhaltensweisen, die Inkonsistenz reduzieren, werden extrem schnell gelernt. Der dahinter stehende Mechanismus: Es kommt im Gehirn immer wieder zu instabilen Fluktuationen, sprich: völlig neuen Erregungsmustern. Führen solche Fluktuationen zur Reduktion von Inkonsistenz, werden sie verstärkt. Die Reduktion von Inkonsistenz führt nämlich zur Ausschüttung von Dopamin - und zwar v.a. an den für die Reduktion verantwortlichen Synapsen! Auf diese Weise wird nicht nur Erfolg signalisiert, sondern zugleich (über „second messenger“-Prozesse und die Öffnung der NMDARezeptoren) die Übertragungsbereitschaft dieser Synapsen dauerhaft erhöht! Dass Verhaltensweisen, die zur Reduktion von Inkonsistenz führen, besonders schnell gelernt werden, muss jedoch nicht immer adaptiv sein. Schließlich werden auf diese Weise nicht nur Verhaltensweisen gelernt werden, die die Inkonsistenz durch eine überraschende Bedürfnisbefriedigung reduzieren, sondern auch vermeidende Verhaltensweisen! Teilkomponenten psychischer Störungen werden häufig gelernt, weil sie zu einer kurzfristigen Reduktion von Inkonsistenz führen; immer wenn Inkonsistenz auf diese Weise reduziert wird, werden jedoch nicht nur die relevanten Komponenten, sondern das gesamte Störungsnetzwerk negativ verstärkt! Auf diese Weise wird das Störungsmuster auf die Dauer von der aktuellen Inkonsistenzspannung entkoppelt und kann irgendwann auch ohne Inkonsistenz aktiviert werden! Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass anhaltende Inkonsistenz krank macht – und zwar in den unterschiedlichsten Formen! Sogar dissonante Musik wirkt sich negativ auf die psychische und physische Gesundheit aus! Unser psychisches System scheint also in der Tat durch und durch auf Harmonie angelegt zu sein! Fuhrmeister (1973): Mitglieder in einem Orchester, in dem viel zeitgenössische (=dissonante) Musik gespielt wurde, wiesen deutlich mehr psychische und physische Beschwerden (Kopfschmerzen, Nervosität, Schlafstörungen etc.) auf als Mitglieder eines klassischen Orchesters! Sogar sie selbst führten diese Beschwerden auf die Musik zurück! Das Ausmaß an Diskordanz bzw. motivationalen Konflikten korreliert mit psychischen Beschwerden! Studenten sollten ihre 15 wichtigsten persönlichen Ziele angeben und einschätzen, wie gut diese miteinander zu vereinbaren sind. Diejenigen, deren Ziele schlecht miteinander vereinbar waren, hatten erhöhte Werte auf der Symptom-Checkliste (SCL-90) und mehr negative Emotionen! - Schlussfolgerung für die Therapie: Therapieziele wollen gut überlegt sein und müssen zu den übergeordneten Zielen des Patienten passen! 89 Die wichtigste Form von Inkonsistenz ist die Inkongruenz; sie ist damit zugleich der wichtigste Indikator für die Inkonsistenz einer Person! Grawe hat einen Inkongruenzfragebogen entworfen, bei dem die Patienten für jedes der Ziele aus dem FAMOS angeben sollen, inwiefern es in der letzten Zeit erfolgreich erreicht bzw. vermieden werden konnte. - 14 Werte für Annäherungsinkongruenz und 9 Werte für Vermeidungsinkongruenz! Die so gemessene Inkongruenz einer Person korreliert stark negativ mit dem Wohlbefinden (-.78) und stark positiv mit der anhand der Symptomcheckliste erhobenen Symptombelastung (.68); darüber hinaus finden sich u.a. positive Korrelationen zum Stellenwert von Vermeidungszielen (FAMOS) und zu interpersonellen Problemen. Die Veränderung der Inkongruenz nach einer Therapie korreliert mit vielen anderen Veränderungen, die während der Therapie sonst noch eintraten, insbesondere mit dem Wohlbefinden (-.76), der Symptombelastung (.64) und der Depressivität (.64) - Ergo: Durch Therapie können Inkongruenz und Symptomatik signifikant reduziert werden - ob die Symptomatik dabei durch die Reduktion der Inkongruenz verringert wird oder ob es umgekehrt ist, kann jedoch nicht gesagt werden! - Die Effektstärken für die Veränderung der Inkongruenz durch Psychotherapie liegen für Annäherungsinkongruenz bei ca. 2 und für Vermeidungsinkongruenz etwa bei 1,5. 10.2.2. Schlussfolgerungen für die Psychotherapie Allgemeines: Psychische Störungen sind zugleich Ursache und Folge misslungener Inkonsistenzregulation (ein Teufelskreis)! Sie äußern sich in einer Vermeidungsdominanz und einem erhöhten Inkongruenzniveau! Physiologisch entspricht dem eine Überaktivierung der HPA-Achse - sowie eine Hypersensibilität der Amygdala, des Hippocampus und des orbitofrontalen Kortex. Genetisch basieren psychische Störungen meist auf einer erhöhten Bereitschaft, auf Inkongruenz mit langanhaltender autonomer Erregung zu reagieren! Inkongruenz korreliert zu r = .87 mit subjektivem Wohlbefinden (N > 1000)! Daraus folgt: Wenn es Menschen gelingt, ihre motivationalen Ziele zu realisieren, dann geht es ihnen gut. Psychotherapie wirkt nicht zuletzt über die Reduktion von Inkonsistenz. Um mögliche Ansatzpunkte für eine Intervention auszumachen, muss der Therapeut daher 3 Perspektiven einnehmen: 1. Störungsperspektive: Welche Symptome liegen vor (DSM-IV, ICD 10) und was sind deren neuronale Grundlagen? 2. Prozessperspektive: Wie können konsistenzerhöhende Erfahrungen ermöglicht werden?! 3. Inkonsistenzperspektive: Wie genau sieht das Inkonsistenzniveau des Patienten aus und welche Quellen von Inkonsistenz lassen sich neben der diagnostizierten Störung ausmachen?! 90 Störungsperspektive: Störungen sind selbst eine Quelle von Inkonsistenz! Der Zusammenhang zwischen der Abnahme der psychopathologischen Symptomatik und der Abnahme der Inkongruenz liegt bei r = .64 (s.o.)! Dabei ist davon auszugehen, dass sich Inkongruenz und Symptomatik wechselseitig beeinflussen (positiver Rückkopplungsprozess)! Sprich: Die Symptomatik fördert die Inkongruenz und die Inkongruenz die Symptomatik! Ergo: In der Therapie muss immer beides zugleich angegangen werden: Die Symptomatik und die Inkongruenz! Prozessperspektive: Neben den störungs- und problemspezifischen Interventionen muss es in der Therapie immer auch darum gehen, das Annäherungssystem zu aktivieren („motivationales Priming“): 1. Wird durch den Annäherungsmodus die für psychische Störungen typische Vermeidungsaktivität gehemmt 2. Wird die Wahrscheinlichkeit positiver Erfahrungen erhöht 3. Fördert der Annäherungsmodus die Bahnung neuer Erregungsmuster, die das Problemverhalten hemmen oder ersetzen Aktiviert wird der Annäherungsmodus v.a. durch eine positive Beziehungsgestaltung (Bindungsbedürfnis) und Ressourcenaktivierung (Selbstwert- und Kontrollbedürfnis). Nach dem Berner Prozessforschungsansatz werden für jede Therapie sowohl die Stundenoutcomes (Patienten-Stundenbögen), als auch der Therapieoutcome als Ganzer erhoben (Gesamtbeurteilung durch den Patienten, den Therapeuten, Symptomreduktion etc. etc.). Darüber hinaus werden einzelne Therapieausschnitte (meist 10 Minuten) von unabhängigen Beurteilern dahingehend geratet, inwiefern Ressourcenaktivierung stattfindet bzw. inwiefern dem Patienten bedürfnisbefriedigende Erfahrungen ermöglicht werden! Mit Hilfe dieses Forschungsansatzes wurden die Annahmen der Konsistenztheorie eindrucksvoll bestätigt: - Ressourcenaktivierung: Das Ausmaß bedürfnisbefriedigender Erfahrungen in der Therapiesitzung trägt mehr zu einem produktive Ergebnis bei, als die Art, in der die jeweiligen Probleme behandelt werden (d = 0.8)! - Beziehung bzw. Bindung: Die Therapiebeziehung trägt mehr zum Therapieergebnis bei (d = 1.36) als das Therapeutenengagement und die Therapeutenkompetenz! Inkonsistenzperspektive: Inkongruenzanalyse Inkongruenzniveau: Die wichtigsten Indikatoren sind: hohe Komorbidität, Anzahl der Behandlungsanliegen und Wert im Inkongruenzfragebogen Inkongruenzquellen: Können Z.B. sein: ungünstige momentane Lebensbedingungen, ungünstige Beziehungen, ungünstige Konsistenzsicherungsmechanismen, ungünstige Kognitionen, Vermeidungsdominanz, motivationale Konflikte Paradoxer Schluss: Die wichtigsten Ursachen psychischer Störungen liegen zwar in der frühen Kindheit (Bedürfnisverletzung), aber der Blick in die Vergangenheit bringt nichts für die Veränderung ihrer Grundlagen. Stattdessen wird Veränderung nur durch reale Erfahrungen in Gegenwart bewirkt! 91 11. Depression 11.1. Darstellung des Störungsbildes: 11.1.1. Diagnostische Kriterien nach der ICD 10: Affektive Störungen nach dem ICD-10: F 30: Manische Episode F 31: Bipolare Störung F 32: Depressive Episode F 33: Rezidivierende depressive Störung F 34: Anhaltende affektive Störung (= Dysthymie, Zyklothymie) F 38: Sonstige Affektive Störungen F 39: Andere affektive Störungen NNB F 43: Anpassungsstörung F53.0: Postpartum-Depression (in den ersten 4 Wochen nach einer Entbindung) F 06.3: Organische affektive Störung Diagnostische Kriterien für eine depressive Episode: Über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen müssen mindestens 2 der folgenden 3 Symptome erfüllt sein: 1. Depressive Verstimmung 2. Interessen- und Freudlosigkeit (Anhedonie) 3. Verminderter Antrieb (Energielosigkeit) und gesteigerte Ermüdbarkeit Darüber hinaus müssen mindestens 2 weitere Symptome vorliegen: 4. Verlust des Selbstvertrauens oder des Selbstwertgefühls 5. Unbegründete Selbstvorwürfe und unangemessene Schuldgefühle 6. Wiederkehrende Gedanken an Tod oder Suidzid (bis hin zu suizidalem Verhalten) 7. Verminderte Denk-, Konzentrations- und Entscheidungsfähigkeit 8. Psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung 9. Schlafstörungen, Appetitverlust oder gesteigerter Verlust (mit entsprechenden Gewichtsveränderungen) Diagnostische Kriterien für eine manische Episode: Eine manische Episode ist eine mindestens einwöchige Periode mit deutlich gehobener, expansiver oder gereizter Stimmung. Dabei müssen mindestens 3 (bei nur reizbarer Stimmung: 4) weitere Symptome erfüllt sein: 1. Gesteigerte Aktivität oder motorische Ruhelosigkeit 2. Gesteigerte Gesprächigkeit 3. Ablenkbarkeit 4. Ideenflucht oder subjektives Gefühl des Gedankenrasens 5. Vermindertes Schlafbedürfnis 6. Gesteigerte Libido oder sexuelle Taktlosigkeit 7. Tollkühnes oder leichtsinniges Verhalten, dessen Risiken nicht beachtet werden 8. Überhöhte Selbsteinschätzung oder Größenideen 9. Verlust sozialer Hemmungen 92 Diagnostische Kriterien für eine hypomane Episode: Eine hypomane Episode ist eine mindestens 4-tägige Periode mit deutlich gehobener oder gereizter Stimmung, wobei mindestens 3 weitere Symptome erfüllt sein müssen, die zum größten Teil denen der manischen Episode entsprechen, aber weniger ausgeprägt sind. Manische Symptome, die bei einer hypomanen Episode nicht vorkommen, sind: Ideenflucht oder subjektives Gefühl des Gedankenrasens Überhöhte Selbsteinschätzung oder Größenideen Hohe Komorbiditätsrate: In 77% der Fälle sind Depressionen komorbid; am häufigsten sind dabei: Angststörungen, substanzinduzierte Abhängigkeiten und somatoforme Störungen Differentialdiagnose: Geprüft werden muss, ob die Depression organisch bedingt (z.B. Schilddrüsenunterfunktion, Eisenmangel) oder substanzinduziert ist! Ausgeschlossen werden müssen andere affektive Störungen (bipolare Störung, Dysthymie etc.) Ist deshalb wichtig, weil eine unipolare Depression anders behandelt wird als eine depressive Episode im Rahmen einer bipolaren Störung! Bei chronischem Verlauf (> 2 Jahre), können folgende Störungen diagnostiziert werden: Typische depressive Episode, derzeit chronisch Teilremittierte depressive Episoden Dysthymie Double Depression: Dysthymie mit typischer depressiver Episode 11.1.2. Epidemiologie, Verlauf und Prognose Häufigkeit: Lebenszeitprävalenzen: Depressionen: ca. 18% - Inzidenz: 1-2% Dysthymie: ca. 4% Bipolare Störung: ca. 3% Es kann davon ausgegangen werden, dass in Deutschland ca. 4 Mio. Menschen an Depressionen leiden, davon sind zwar rund 60-70% in hausärztlicher Behandlung, nur bei wenigen wird die Depression jedoch erkannt (30-35%) bzw. adäquat behandelt (2,5-4%). Durch eine bessere Kooperation mit den Hausärzten und entsprechende Fortbildungen könnte die Versorgung demnach erheblich verbessert werden (großer Optimierungsspielraum)! Nach der „Burden of Disease“ - Studie der WHO (2001) ist die unipolare Depression in den Industrieländern die häufigste Ursache für mit Beeinträchtigung gelebte Lebensjahre; weitaus häufiger als z.B. Demenzen, Diabetes oder altersbedingte Sehschwächen. Verlauf und Prognose: Wiederherstellung der alten Leistungsfähigkeit: bei ca. 50-65% Chronifizierung (> 2 Jahre): bei ca. 10-20% Suizidrisiko: 15% 93 11.2. Ätiologie 11.2.1. Biologische Faktoren Genetische Faktoren: Konkordanzraten: Monozygot: 30-90% (~ 60%) Dizygot: 0-25% (~ 14%) Prospektive Studien mit Zwillingen schätzen… den genetischen Einfluss auf 41% den Umwelteinfluss auf 46% Störungen im Neurotransmitter-System: Katecholamin-/Noradrenalin-Theorie: Eine zu niedrige NA-Konzentration führt zu Depression, eine zu hohe zu Manie Fehlfunktion des Nucleus Coeruleus (neuronaler Syntheseort für NA) Tierversuche zeigen, dass die Applikation von Tyrosin (Vorstufe des NA) depressionsähnliches Verhalten verschwinden lässt. Serotonin-Theorie: Ein zu niedriger Serotoninspiegel führt zu Depression Fazit: Depression basiert vermutlich nicht auf der Dysfunktion eines einzelnen Transmittersystems, sondern eher auf der Dysregulation mehrerer Transmittersubstanzen und Rezeptortypen Neuroanatomische Faktoren: 1) Veränderungen im präfrontalen Kortex: Im rechten Präfrontalkortex werden eher negative Emotionen verarbeitet und er reagiert stärker auf Bestrafung (Vermeidungs- und Rückzugssystem); im linken Präfrontalkortex werden dagegen eher positive Emotionen verarbeitet und er reagiert stärker auf Belohnung (Annäherungssystem) Bei Depressiven finden sich folgende neurologischen Auffälligkeiten: a) Der linke Präfrontalkortex ist im Vergleich zum rechten unteraktiviert. - Depression ist durch einen Mangel an zielorientierter Aktivität und durch negatives Denken gekennzeichnet. - Depressive reagieren auf Bestrafung stärker als auf Belohnung! b) Der Präfrontalkortex im Ganzen ist bei Depressiven eher hypoaktiviert und die graue Substanz im PFC weist häufig ein verringertes Volumen auf! - Depressive zeigen generell eine verringerte Verhaltensaktivität und ein reduziertes Leistungsvermögen. Nach medikamentöser und/oder psychotherapeutischer Behandlung nimmt die Aktivität im linken dorsolateralen Präfrontalkortex wieder zu! 2) Veränderungen im anterioren (vorderen) Zingulum (ACC): Das Zingulum ist direkt über dem Balken (Corpus callosum) gelegen; der anteriore Teil ist sowohl an affektiven, als auch an kognitiven Verarbeitungsprozessen beteiligt und ist eng mit dem dorsolateralen PFC verbunden. Verarbeitet werden dabei v.a. kognitiv anforderungsreiche Informationen (uneindeutige, konflikthafte Situationen, motivationale Konflikte etc.); wobei die Hauptaufgabe des anterioren Zingulums darin besteht, Verarbeitungsressourcen bereitzustellen (Reaktionsselektion, Steuerung von Aufmerksamkeitsprozessen => „Inkonsistenzmonitor“). 94 Bei Depressiven ist das anteriore Zingulum unteraktiviert; Ursache dafür könnte die aktive Hemmung durch einen hyperaktiven rechten PFC sein! Mit abklingender Depression steigt die Aktivität im ACC wieder an. - ACC- Subtyp: Resignation, keine Lösung von Konflikten möglich - PFC-Subtyp: Diskrepanz zwischen Zustand und Anforderung wird erlebt, aber es kann kein zielorientiertes Handeln zur Veränderung aktiviert werden. 3) Veränderungen im Hippocampus Der Hippocampus ist v.a. für die Konsolidierung und Koordination von Gedächtnisinhalten zuständig (s.o.) Bei Depressiven weist der Hippocampus ein um 8-19% geschrumpftes Volumen auf; Ursache dafür könnte lang anhaltender Stress (über Glukokortikoidrezeptoren) sein. - Das verringerte Hippocampusvolumen führt zu einer verschlechterten Regulation des Kortisolspiegels bei Stress und damit zu einer schlechteren kontextabhängigen Emotionsregulation Antidepressiva führen (zumindest bei Ratten) u.a. zur Neubildung von Neuronen im Hippocampus 4) Veränderungen der Amygdala Die Amygdala lenkt die Aufmerksamkeit auf emotional wichtige Reize und löst die physiologischen Reaktionen auf diese aus. Darüber hinaus spielt sie eine wichtige Rolle bei Konditionierungsprozessen. Bei Depressiven findet sich sowohl im Wach- als auch im Schlafzustand eine dauerhafte Übererregung der Amygdala; darüber hinaus korreliert die Aktivierung der Amygdala mit dem Schwergrad der Depression! Nach medikamentöser Therapie kommt es zu einer Reduktion der Amygdala-Aktivität – außer bei Patienten mit Familiengeschichte! Die erhöhte Aktivationsbereitschaft der Amygdala könnte ein Risikofaktor sein! 11.2.2. Psychologische Ansätze und Theorien A) Kritische Lebensereignisse („Life events“) Insbesondere die erste Major-Depression-Episode wird häufig durch aversive Ereignisse ausgelöst bzw. mit-bedingt: z.B. Verlust eines Elternteils, Scheidung, psychische oder physische Erkrankung eines Elternteils etc. Aber: a) Nicht alle Menschen entwickeln nach Life-events eine depressive Symptomatik (eine gewisse Vulnerabilität muss also gegeben sein) b) Bei 25% der depressiven Patienten liegt kein Life-event vor (bei manchen scheint es also eine biologisch bedingte Bereitschaft zu geben, schon auf minimale Veränderungen depressiv zu reagieren) B) Kognitive Theorie der Depression (nach Beck) BECK führt Depressionen auf 3 sich wechselseitig bedingende Faktoren zurück: 1) Die „kognitive Triade der Depression“ (negative Beurteilung der eigenen Person, der Umwelt und der Zukunft) 2) Negative Schemata und dysfunktionale Annahmen 3) Kognitiven Verzerrungen / kognitive Fehler Negative Schemata werden durch negative Lebenserfahrungen (z.B. Verlusterlebnisse, Zurückweisung, Kritik oder depressive Modelle) in der Kindheit 95 und Adoleszenz oder durch aktuelle Belastungen erworben und wirken meist unbewusst. Kognitive Schemata bestimmen die Reizwahrnehmung und Informationsverarbeitung, indem sie automatische Gedanken aktivieren. Ein Beispiel für ein solches Schema ist z.B. der Anspruch, immer perfekt zu sein oder von allen geliebt zu werden. Dysfunktional sind solche Annahmen bzw. Schemata deshalb, weil sie zu Fehlschlüssen bzw. kognitiven Verzerrungen führen, die ihrerseits die negativen Schemata zu bestätigen scheinen (=Teufelskreislauf)! So führt z.B. die unbewusste Annahme, immer perfekt sein zu müssen, bei Misserfolg zu der zweifelhaften Schlussfolgerung, wertlos zu sein (bewusst), was wiederum die Annahme verstärkt. Kognitive Verzerrungen sind Denkfehler, die durch negative Schemata bedingt werden. Typische Denkfehler sind z.B.: Übertriebene Verallgemeinerungen (Übergeneralisierung): Eine schlechte Note als Beweis für die eigene Dummheit! Über- oder Untertreibung: Positives klein reden, Negatives überbewerten. Voreilige bzw. willkürliche Schlussfolgerungen: Hans hat sich nicht gemeldet – er mag mich nicht! Dinge persönlich nehmen (Personalisierung): Dass ich die Praktikum nicht bekommen habe, liegt nicht daran, dass kein Platz mehr war, sondern daran, dass man mich nicht wollte! Alles-oder-nichts-Denken (= Schwarz-Weiß-Denken): Alles, was nicht der erste Platz ist, ist eine Niederlage! C) Theorie der gelernten Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit (Seligman, Abramson) Es gibt mehrere kognitive Theorien, die Depression auf eine generalisierte Hilflosigkeit bzw. Hoffnungslosigkeit zurückführen. 3 Varianten lassen sich unterscheiden: 1) Die ursprüngliche Theorie der gelernten Hilflosigkeit (von Seligman) 2) Die attributionsbezogene Umformulierung dieser Theorie (Seligman, Abramson) 3) Die Theorie der Hoffnungslosigkeit (Abramson, Metalsky & Alloy) Theorie der gelernten Hilflosigkeit (Seligman, 1974): Unangenehme Erfahrungen und Traumata, die ein Individuum erfolglos zu überwinden versucht hat, führen zu Passivität und Kontrollverlust auch in anderen Situationen Depression. Experimentelle Grundlage: Hunde, die in einer ersten Phase unkontrollierbare Elektroschocks erleiden mussten, lernen in einer zweiten Phase, in denen diese vermieden werden können, das dazu nötige Verhalten langsamer als Tiere, die zuvor keine unkontrollierbaren Schocks appliziert bekommen hatten. Erklärung: In den kognitiven, motivationalen und emotionalen Defiziten der „geschockten“ Hunde äußert sich eine „gelernte Hilflosigkeit“! Gelernte Hilflosigkeit + Attributionsstil: Da sich die Ergebnisse nicht 100%-ig auf Menschen übertragen ließen, legten Seligman und Abramson 1978 eine revidierte Fassung der Theorie vor: Darin wird davon ausgegangen, dass der Effekt durch den Attributionsstil einer Person moderiert wird. Probleme: Bei Versuchen mit Menschen zeigte sich, dass induzierte Hilflosigkeit auch dazu führen kann, dass nachfolgend die notwendigen Vermeidungshandlungen einfacher gelernt werden. Darüber hinaus schreiben sich viele Depressive selbst die Verantwortung für ihre Misserfolge zu - ein Umstand, der mit dem Begriff „Hilflosigkeit“ nur schwer zu vereinbaren ist! 96 Lösung: Ob gelernte Hilflosigkeit auftritt oder nicht, hängt nicht nur von der Situation, sondern auch von deren Interpretation ab, genauer: davon, wie eine Person ihre eigenen Misserfolge attribuiert. Mit WEINER können Attributionen dabei anhand dreier Dimensionen unterschieden werden: 1. Internale vs. externale Attribution 2. Stabile vs. variable Attribution 3. Globale vs. spezifische Attribution Ein negativer Attributionsstil äußert sich in internalen (=> schlechter Selbstwert), stabilen (=> Hilflosigkeit) und globalen Ursachenzuschreibungen. (=> Verstärkung dieser beiden Aspekte) Die Mathearbeit war weder dumm gestellt (external, variabel, spezifisch), noch hab ich mich zu wenig angestrengt (internal, variabel). Stattdessen war ich zu dumm (internal, stabil) – und zwar nicht nur, weil ich mathematisch unbegabt bin, sondern weil ich generell nichts drauf habe (global). These: Machen Menschen mit einem negativen Attributionsstil (Diathese) negative Erfahrungen (Stress) sind sie besonders gefährdet, depressiv zu werden. Erstens: halten ihre negativen Gefühle nach solchen Erlebnissen länger an als bei Personen mit einem positiven Attributionsstil; zweitens: entwickeln sie eine „gelernte Hilflosigkeit“. Hoffnungslosigkeit: Die neueste Fassung der Theorie erweitert das Konzept um den Begriff der Hoffnungslosigkeit; letztere äußert sich nicht nur im Gefühl der Hilflosigkeit (mangelnde Kontrollüberzeugung), sondern darüber hinaus in der pessimistischen Zukunftserwartung, dass positive Ereignisse ausbleiben, negative dagegen eintreten werden. Der Vorteil dieser Fassung besteht darin, dass neben dem Attributionsstil weitere Diathesen in Betracht gezogen werden: dazu zählen v.a. der erwähnte Pessimismus, zum anderen ein geringes Selbstwertgefühl. Darüber hinaus bietet die Theorie eine gute Erklärung für den engen Zusammenhang von Depression und Angststörungen: Pessimistische Erwartungen führen zu Angst; treten die erwarteten Ereignisse ein, kommt es zu Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit! D) Verstärkerverlust-Modell (nach Lewinsohn) Das Verstärker-Verlust-Modell von Lewinsohn (1974) ist ein verhaltenstheoretisches Modell: Depression wird dabei auf einen sich durch die Depression (verbales und nonverbales Verhalten, interaktionelle Auffälligkeiten) weiter verschärfenden Mangel an positiver Verstärkung zurückgeführt. Die Menge positiver Verstärkung hängt dabei von 3 Faktoren ab: 1) Der Anzahl und Qualität möglicher verstärkender Ereignisse Was wirkt auf eine Person zumindest potenziell verstärkend (ist es beruflicher Erfolg, Glück in der Liebe oder ein großer Freundeskreis?) 2) Der Erreichbarkeit solcher Verstärker in der Umgebung Ist die Person berufstätig und wenn ja, inwiefern besteht in diesem Beruf die Möglichkeit, für das eigene Handeln verstärkt zu werden (Arbeitsloser vs. Lehrer vs. Schauspieler)? Hat eine Person Familie?... 3) Dem instrumentellen Verhalten einer Person Ist eine Person dazu in der Lage, die potenziellen Verstärker in der Umgebung auch zu erhalten (berufliche Fähigkeiten, soziale Kompetenz etc.)? 97 Wer über längeren Zeitraum keine Verstärkung erhält, befindet sich nach behavioristischer Theorie unter Löschungsbedingungen und hört im Extremfall ganz auf, irgendetwas zu tun. Die Folge ist eine Depression. Letztere lässt sich damit als Teufelskreislauf beschreiben: Ein Mangel an Verstärkern führt zu Depression – und diese führt wiederum zu einer weiteren Reduktion an Verstärkern (berufliches Desinteresse, sozialer Rückzug etc.). E) Multifaktorieller Ansatz Am sinnvollsten ist es, die verschiedenen Theorien zu integrieren. In diesem Fall lassen sich folgende Einflussfaktoren unterschieden: 1. Genetische Prädisposition 2. Traumatische Erfahrungen „Life-Events“ 3. Persönlichkeitsfaktoren Gelernte Hilflosigkeit Attributionsstil Kognitive Schemata 4. Physikalische Einwirkungen Z.B. Lichtentzug 5. Aktuelle psychosoziale Belastungen (Stress) Alle diese Faktoren werden neurobiologisch vermittelt (Serotoninmangel etc.) und führen so zu einer Depression. 11.3. Zur Wirksamkeit verschiedener therapeutischer Verfahren 11.3.1. Allgemeines Metaanalysen zur Wirksamkeit verschiedener therapeutischer Verfahren bei Depression kommen i.d.R. zu äußerst hohen Effektstärken; die durchschnittliche Behandlungsdauer beträgt dabei nicht mehr als 10 Wochen (13 Therapiesitzungen): Abgesehen von den humanistischen Verfahren (0.7), haben alle Verfahren Effektstärken > 1. Die höchste Effektstärke haben medikamentöse Behandlungen (2.2); es folgen: Paartherapien (1.9), Kombinations- und psychodynamische Therapien (~1.8), die VT, KVT (~1.6) und IPT (1.5) Diese Zahlen vermitteln den Eindruck, als sei Depression im Vergleich zu anderen Störungen besonders gut behandelbar und als sei die medikamentöse Therapie die Methode der Wahl. Diese Schlussfolgerungen sind jedoch aus mehreren Gründen falsch: 1. Der Anteil an Spontanremissionen ist bei Depression äußerst hoch (die Veränderungen in den Kontrollgruppen erreichen eine durchschnittliche Effektstärke von 1.59)! Wird die Spontanremissionsrate berücksichtigt, fallen die Effektstärken für die verschiedenen Interventionen daher deutlich geringer aus: - IPT = .50; KVT = .57; Paartherapie = .79 2. 25% Behandlungsabbrecher in den pharmakologischen Studien, in den psychologischen nur 13%! 3. Bei Wirksamkeitsstudien muss immer darauf geachtet werden, wer der Auftrag- bzw. Geldgeber der betreffenden Studien ist (Drittmittel bzw. Öffentlichkeit vs. Pharmaindustrie) und welche Beurteilungsmaße herangezogen wurden! 98 - In Pharmastudien werden fast ausschließlich Fremdbeurteilungsmaße herangezogen (z.B. „Hamilton Rating Scale for Depression“) – diese Maße verbessern sich i.d.R. auch in den Kontrollgruppen. Eine Katamnese (zur Beurteilung der langfristigen Wirkung) bleibt meistens aus! Elemente einer wirksamen Depressionstherapie: Individuelles Erklärungsmodell Formulierung von Plan und Struktur der Behandlung Konkrete Zielsetzung Gestuftes Vorgehen Ressourcenorientierung Anwendung des Besprochenen außerhalb des Therapiesettings (Hausaufgaben) Aktive, direktive (aber nicht dominante) Therapeuten 11.3.2. KVT bei unipolarer Depression: Die Ansätze der kognitiven Verhaltenstherapie zur Behandlung von Depression basieren v.a. auf Becks Modell der negativen Triade und Lewinsohns „VerstärkerVerlust-Modell“. Sie sind problemzentriert und zielen auf Veränderungen auf der Kognitionsund Handlungsebene; ein besonderer Fokus liegt auf kognitiven Prozessen. Nach Hautzinger lässt sich der Ablauf einer kognitiven Verhaltenstherapie in 6 Phasen untergliedern: 1) Problemanalyse und Aufbau einer therapeutischen Beziehung Identifikation und Benennung der Schlüsselprobleme (Kriterien: Wichtigkeit, Dringlichkeit, Veränderbarkeit) - Aufstellung einer Zielmatrix: was will der Patient kurz-, mittel- und langfristig in den verschiedenen Lebenskontexten (Beruf, Familie etc.) erreichen?! Aufbau einer therapeutischen Beziehung: Empathie, positive Wertschätzung, Kongruenz, Professionalität etc. 2) Vermittlung des therapeutischen Modells und Psychoedukation bezüglich der jeweiligen Störung Grundannahmen der KVT erläutern: Verhalten, Denken und Fühlen beeinflussen sich wechselseitig etc. pp. Aufklärung über die biologischen und psychologischen Grundlagen der Depression 3) Aktivitätsaufbau Guter Einstieg: Erläuterung der „Depressionsspirale“ (soz. Rückzug und Passivität führen zu einer Reduktion positiver Verstärkung und damit zu einer Verschlimmerung der Depression => Ausweg: sich aufraffen und positive Aktivitäten aufsuchen!) Aufstellung eines Wochenplans: in dem sowohl die Aktivitäten als auch die damit einhergehenden Stimmungen protokolliert werden sollen. - Der Plan dient zunächst zur Erhebung des Ist-Zustandes (Baseline) - In einem zweiten Schritt werden positiv erlebte Aktivitäten gesammelt und zunehmend in den Plan integriert, negative Aktivitäten dagegen reduziert (langfristiges Ziel: Etablierung einer neuen Tagesstruktur)! - Wichtig: Keine allgemeinen, sondern konkrete Aktivitäten (wie z.B. 2 Mal die Woche eine halbe Stunde spazieren gehen) 99 4) Bearbeitung und Modifikation kognitiver Muster Aufklärung des Patienten darüber, was Kognitionen sind und wie unsere Stimmung und unser Verhalten beeinflussen! A) Identifikation und Beobachtung automatischer Gedanken - Vermittlung der ABC-Technik: Gefühle sind die Konsequenz (C) einer auslösenden Situation (A) und deren Bewertung (B), die meist automatisch abläuft. Entscheidend ist, das die auslösende Situation („Hans grüßt nicht“) und deren Bewertung („er mag mich nicht“) voneinander getrennt werden müssen, da es v.a. letztere ist, die das Gefühl auslöst! B) Veränderung automatischer Gedanken - Erweiterung der ABC-Technik: Wird der Zusammenhang zwischen Kognition und Emotion erkannt, können alternative Bewertungen (B„) in Betracht gezogen und angenommen werden („Hans war wohl gerade gestresst“), was wiederum zu einer veränderten Konsequenz (C„), sprich: einem anderen Gefühl, führt! Wichtig: Der Patient darf weder zu neuen Bewertungen überredet werden, noch dürfen seine gewohnten Bewertungen von vornherein als irrational abgetan werden. Stattdessen muss der Patient selbst zu seinen Einsichten kommen => Mögliche Methoden, eine Reattribuierung herbeizuführen: - „Sokratischer Dialog“ (gelenktes Fragen) - Kognitive Verzerrungen erkennen und benennen: „Keiner mag mich!“ = Übergeneralisierung! - Negative Schemata auf ihren Realitätsgehalt überprüfen (Verhaltensexperimente): „Ich weiß von nichts bescheid!“ – „Von welchen Themen z. B.?“ – „Z. B. von Politik“ – „Wie viele Politiker werden sie wohl kennen, wenn ich ihnen etwas aus der Zeitung vorlese?!“ – „10 %“ – „Mal sehen: …“ - Rollenspiele: a) Beurteilung einer anderen Person, die in der gleichen Situation wie der Patient ähnlich handelt (=> Aufdeckung von „Doppelstandards“); b) Eine Situation nicht nur aus der eigenen Perspektive, sondern auch aus der eines unbeteiligten „Dritten“ beurteilen usw. usw. 5) Verbesserung der sozialen Kompetenz Ziele: Erkennen und Durchsetzen eigener Wünsche, Äußern positiver Gefühle, Aufbau und Pflege sozialer Kontakte und Aktivitäten, Problemlösefähigkeit etc. Methoden: a) Grundlage bildet eine genaue Verhaltensbeobachtung (zur realistischen Einschätzung der Stärken und Schwächen); b) Rollenspiele und Verhaltensübungen (im stationären Setting meist in Gruppen): - z.B. Blickkontakt halten, loben, sich entschuldigen, Kritik ausüben etc. - sich von anderen Loben lassen, positive Eigenschaften von sich selbst sammeln und der Gruppe vorstellen, Rede vor den anderen halten 6) Rückfallprophylaxe Sensibilität für Warnsignale um depressive Episoden frühzeitig zu bemerken; Training der gelernten Techniken und Methoden „Notfallkoffer“ (Karteikarten mit positiven Aktivitäten etc.),… „Booster-Sitzungen“: Bearbeitung aktueller Rückschläge, Auffrischen der gelernten Strategien 100 11.3.3. Weitere Therapieformen Pharmakologische Behandlung: Drei Hauptkategorien von Antidepressiva lassen sich unterscheiden: 1) Trizyklika: - hemmen die Wiederaufnahme der ausgeschütteten Neurotransmitter in die präsynaptische Zelle (Serotonin, Noradrenalin, Dopamin etc.) - haben eine sehr breite (unspezifische) Wirkung 2) MAO-Hemmer: - hemmen den Abbau von Serotonin und Noradrenalin durch das Enzym Mono-Amino-Oxydase (MAO) - haben die schwersten Nebenwirkungen und werden daher heute nur noch selten eingesetzt! 3) Selektive Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI; NaRI; SNRI) - Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRIs) hemmen das Transportmolekül, das Serotonin wieder in seine Speicher zurückführt; wirken daher nur an den Synapsen, deren Übertragung mittels Serotonin erfolgt (spezifischer Wirkort). Hinzu kommen atypische und pflanzliche Antidepressiva: 4) Atypische Antidepressiva: erhöhen die Ausschüttung von Serotonin und Noradrenalin! 5) Johanneskrautpräparate: Die Wirksamkeit ist, v.a. bei leichten und mittelschweren Depressionen, empirisch belegt; der Wirkmechanismus jedoch nicht abschließend geklärt => Auch Johanneskraut scheint aber auf die neuronale Transmission einzuwirken! IPT: Die Interpersonale Therapie (IPT) ist als ambulante Kurzzeittherapie angelegt (12-20 Einzelsitzungen) und gehört zur Gruppe der psychodynamischen Kurzzeittherapien (STPP); sie zielt v.a. darauf ab, die konkreten Lebensbezüge des Klienten zu verbessern; der Hauptfokus liegt dementsprechend auf der Bearbeitung zwischenmenschlicher und psychosozialer Probleme im Hier und Jetzt: Trauerbewältigung, Rollenwechsel/Lebensveränderungen, Einsamkeit, zwischenmenschliche Konflikte etc. IPT gilt bei Depressionen als „wirksam“ (Evidenzgrad I) MBCT: Die „Mindfullness Based Cognitive Therapy“ (MBCT) wurde speziell für die Erhaltungstherapie bei unipolaren Depressionen entwickelt; sie enthält neben den kognitiv-behavioralen Elementen (Aktivitätsaufbau, Reattribuierung etc.) Achtsamkeitsübungen, die auf das bewusste und nichtwertende Erleben des Augenblicks zielen (Yoga, Atemmeditation, Aufmerksamkeit auf alltägliche Handlungen) etc. MBCT ist „möglicherweise wirksam“ (Evidenzgrad II) CBASP: Das „Cognitive Behavioral Analysis System for Psychotherapy“ (CBASP) ist die einzige Therapieform, die speziell zur Behandlung von chronischen Depressionen und Dysthymie entwickelt wurde; die Therapie vereint interpersonelle, psychodynamische, kognitive und behaviorale Strategien und zielt v.a. auf sozialinterpersonelles Lernen ab (Situationsanalyse, Zusammenhang zwischen Verhaltensbzw. Denkmustern und deren jeweiligen Konsequenzen, Aufbau von Verhaltensfertigkeiten). Grundannahme: Patienten sind für Konsequenzen und Feedback aus der Umgebung nicht erreichbar, weil ihre Wahrnehmung von der Umwelt entkoppelt ist! Als „wirksam“ erwiesen haben sich bei der Behandlung chronischer Depressionen folgende Kombinationstherapien: KVT + Antidepressiva; CBASP + Antidepressiva 101 11.3.4. Wirksamkeit Die wichtigsten Ansätze zur Depressionsbehandlung und ihre Wirksamkeit: Niederschwellige Maßnahmen: bei subklinischen (minoren) Depressionen Als „wirksam“ haben sich erwiesen: kognitiv-verhaltenstherapeutisch orientierte Bibliotherapie (Selbsthilfe mit Hilfe von Fachbüchern) und kognitiv-verhaltenstherapeutische Gruppenprogramme (8 bis 10 Sitzungen) „Möglicherweise wirksam“ sind internetbasierte KVT-Programme Hinzu kommen: Selbsthilfe, Laienhilfe etc. Akuttherapie: beginnt meist am Tiefpunkt und dauert so lange, bis eine spürbare Besserung eingetreten ist (durchschnittliche Dauer: ein Monat) Als „wirksam“ haben sich erwiesen: Medikamentöse Behandlung (Antidepressiva); kognitive Verhaltenstherapie (KVT); Interpersonelle Psychotherapie (IPT); Psychodynamische Kurzzeittherapie (STPP); Kombinationstherapien (Antidepressiva + Psychotherapie) „Möglicherweise wirksam“ ist: prozess-erfahrungsorientierte Gesprächspsychotherapie (PE-GPT) „Bislang ohne ausreichende Wirknachweise“: Psychoanalyse, psychodynamische Langzeittherapie und alle anderen Therapien Erhaltungstherapie: beginnt nach der Remission und dauert 3-6 Monate; Ziel ist die Verhinderung bzw. Hinauszögerung von Rückfällen Als „wirksam“ haben sich erwiesen: Prophylaktische Therapie: kann je nach Schwere der Depression Jahre dauern Die wichtigsten Ergebnisse zur Wirksamkeit: Die wirksamste Psychotherapie bei Depression ist (über alle Bedingungen hinweg: Akuttherapie, Erhaltungstherapie, Gruppensetting, Einzelsetting etc.) die kognitive Verhaltenstherapie (KVT), ebenfalls als wirksam erwiesen haben sich die Interpersonale Therapie (IPT) und (zumindest in der akuten Einzeltherapie) die psychodynamische Kurzzeittherapie (STPP) Keine Wirksamkeit konnte bisher für die klassische Psychoanalyse und alle anderen Therapieformen nachgewiesen werden. Was die kurzfristige Wirkung betrifft, sind psychotherapeutische (genauer: KVT und IPT), die verschiedenen medikamentösen und kombinierte Interventionen gleichwertig! Sie alle sind einer Placebobehandlung überlegen! Langfristig sind jedoch psychotherapeutische (KVT / IPT) oder kombinierte Interventionen rein medikamentösen Behandlungen vorzuziehen, da bei ihnen die Abbrecherund Rückfallquote geringer ausfällt (bessere Medikamentencompliance und Kooperationsbereitschaft) und weniger Nebenwirkungen auftreten! Die KVT ist auch bei schweren Depressionen der medikamentösen Behandlung nicht (unbedingt) unterlegen; trotzdem ist bei schweren Depressionen eine kombinierte Therapie die Methode der Wahl. Bei chronischen Depressionen ist eine Kombination von Pharmakotherapie und spezifischer Psychotherapie (KVT oder CBASP) angezeigt (Erhöhung der Medikamentencompliance, Verringerung der Abbrecherquote etc.). Bei subklinischer Symptomatik reichen meist Psychoedukation, Bibliotherapie oder kurzzeitige, kogitiv-verhaltenstherapeutische Gruppenbehandlung aus (Evidenzgrad I) 102 12. Panikstörung und Agoraphobie 12.1. Darstellung des Störungsbildes 12.1.1. Allgemeines Panikstörung und Agoraphobie sind eng miteinander verknüpft! Ca. 2/3 aller Panikstörungen gehen mit einer Agoraphobie einher! Die Betroffenen meiden bestimmte Situationen, weil sie befürchten dort eine Panikattacke zu bekommen („Angst vor der Angst“). Umgekehrt geht auch die Agoraphobie meist mit Panikattacken, in jedem Fall aber mit Paniksymptomen einher! Sowohl mit als auch ohne Panikstörung geht die Agoraphobie mit der Angst vor einer Attacke einher. Im ICD 10 wird zwischen Agoraphobie mit und ohne Panikstörung unterschieden (F 40) und einer reinen Panikstörung (F 41) unterschieden; im DSM IV zwischen Panikstörung mit und ohne Agoraphobie und Agoraphobie ohne Panikstörung. Panikstörung und Agoraphobie… …machen zusammen mit der Generalisierten Angststörung den größten Teil der Angstpatienten aus. …werden häufig falsch diagnostiziert (weil die Patienten meist nicht kommen und sagen, dass sie Angst haben, sondern über andere Beschwerden klagen) …haben einen ungünstigen Verlauf (kaum Spontanremissionen: ca. 14%) …wurden erst relativ spät als eigenständige Störungsbilder anerkannt (DSM-III; 1980) Die Panikstörung ist eher eine Zustandsangst (nicht situativ bedingt) als z.B. Agoraphobie (bei der es oft konkrete Auslöser gibt). 12.1.2. Diagnostische Kriterien nach der ICD 10 Die Panikstörung: ist durch wiederholte Panikattacken gekennzeichnet, die oft spontan auftreten und nicht ausschließlich auf eine spezifische Situation, ein spezifisches Objekt, eine reale Gefahr oder besondere Anstrengung bezogen sind! Eine Panikattacke ist eine einzelne Episode intensiver Angst und Unbehagens. Sie beginnt abrupt, erreicht innerhalb weniger Minuten ein Maximum und dauert mindestens einige Minuten; dabei müssen mindestens 4 der folgenden Symptome vorhanden sein (wobei mindestens eines zur Gruppe der ersten 4 Symptome gehören muss). 1. Palpitationen, Herzklopfen oder erhöhte Herzfrequenz 2. Schweißausbrüche 3. Fein- oder grobschlägiger Tremor 4. Mundtrockenheit 5. Atembeschwerden 6. Beklemmungsgefühl 7. Thoraxschmerzen und –missempfindungen 8. Nausea (Übelkeit) oder abdominale Missempfindungen 9. Derealisations- oder Depersonalisationsgefühl Kognitive 10. Angst vor Kontrollverlust oder verrückt zu werden Komponenten 11. Angst zu sterben 103 Unterschieden wird zwischen: Mittelgradige Panikstörung (F 41.00): mindestens 4 Panikattacken in 4 Wochen Schwere Panikstörung (F41.01): mindestens 4 Panikattacken pro Woche über einen Zeitraum von 4 Wochen Die Agoraphobie: ist eine deutliche und anhaltende Furcht vor oder Vermeidung von… …mindestens 2 der folgenden Situationen: Menschenmengen (z.B. Warteschlangen, Einkaufsstraßen etc.) Öffentliche Plätze (z.B. Supermarkt, Kino, Straßenbahn etc.) Alleine Reisen Reisen mit weiter Entfernung von Zuhause Mindestens ein Mal nach Beginn der Störung müssen mindestens zwei Angstsymptome der Panik-Symptome (s.o.) gleichzeitig vorhanden gewesen sein – und zwar im Zusammenhang mit den gefürchteten Situationen (s.o.) Unterschieden wird zwischen: Agoraphobie ohne Panikstörung Agoraphobie mit Panikstörung 12.1.3. Differentialdiagnostik Abgrenzung von anderen Angststörungen: Da Panikattacken auch bei anderen Angststörungen auftreten (und zwar in 80% der Fälle!), ist es wichtig, a) die Häufigkeit der Attacken zu beachten und b) ihren Kontext und zentrale Befürchtungen herauszuarbeiten! Panikstörung: Angst vor körperlichen und/oder geistigen „Katastrophen“ („Ich werde sterben!“; „Ich werde verrückt!“) Soziale Phobie: Angst vor Bewertung und Blamage Spezifische Phobien: Angst vor spezifischen Situationen (situationsgebundene Befürchtungen) PTSD: Angst vor Reizen und Situationen, die an das Trauma erinnern Zwangsstörung: Angst für Objekt der Zwangsvorstellung! Die Abgrenzung von organischen Erkrankungen: ist bei der Panikstörung besonders wichtig, da sie sich v.a. in physiologischen Symptomen äußert und die meisten Patienten von einer physiologischen Ursache überzeugt sind! 12.1.4. Epidemiologie, Verlauf und Prognose Komorbidität: Nur eine Minderheit der Panikpatienten (rund 12%) weisen keine Komorbidität auf, fast 50% weisen drei oder mehr komorbide Störungen auf! Am häufigsten sind: Affektive Störung: 71,4% Alkoholmissbrauch: 50% Medikamentenmissbrauch: 28,6% Prävalenzen: Panikstörung ohne Agoraphobie: Männer: 0,7%; Frauen: 1,2% ( Verhältnis in etwa 1:1) Panikstörung mit Agoraphobie: Männer: 0,6%; Frauen: 2,0% ( Verhältnis ca. 3:1) Agoraphobie ohne Panikstörung: Männer: 0,6%; Frauen: 1,5% ( Verhältnis ca. 2:1) 104 Verlauf und Prognose: Kaum Spontanremissionen (nur in ca. 14% der Fälle) Gravierende Folgeprobleme (s.o.): Affektive Störungen, Allkohol- und Medikamentenmissbrauch In 80% der Fälle liegen im Jahr vor der ersten Panikattacke mehrere kritische Lebensereignisse Weitere Risikofaktoren: Geschlecht (weiblich), Alter (20-30 Jahre; bei Männern zweiter Peak nach 40), Familienstand (ledig) 12.2. Ätiologiefaktoren: 12.2.1. Psychophysiologisches Modell der Panikstörung nach Ehlers und Margraf: Ein Anfall beginnt in der Regel mit körperlichen (Schwindel, Herzrasen etc.) und/oder psychischen Veränderungen (Gedankenrasen, Attribution von Kontrollverlust etc.), die ihrerseits durch interne oder externe Stressoren hervorgerufen werden. Diese Veränderungen werden wahrgenommen und mit Gefahr assoziiert (z.B. einem Herzinfarkt), woraufhin der Betroffene mit Angst bzw. Panik reagiert, was wiederum mit physischen und/oder psychischen Veränderungen einhergeht, die als solche wahrgenommen und erneut mit Gefahr assoziiert werden etc. etc. Konkretes Beispiel: Wahrnehmung des eigenen (normalen) Herzschlags => Assoziation mit Gefahr => Angst => Erhöhung der Herzrate => … Die physiologischen Reaktionen von Panikpatienten auf Stresssituationen unterscheiden sich kaum von denen gesunder Personen; sie interpretieren diese lediglich anders! Beeinflusst wird dieser Prozess außerdem durch individuelle Prädispositionen (z.B. Interozeptionsfähigkeit; Angstsensitivität etc.) und situative Faktoren (z.B. Hitze, Koffein etc.). In diesem Sinn ist das psychophysiologische Modell ein Diathese-StressModell! Beendet wird eine Attacke entweder durch Bewältigungsstrategien (Vermeidung, Hilfe suchen etc.) oder durch negative Rückkopplungsprozesse (Habituation, Ermüdung), die irgendwann automatisch einsetzen, allerdings sehr viel langsamer vonstatten gehen als die positive Rückkopplung zwischen Panik und psychischen bzw. physischen Veränderungen! 12.2.2. Die Zwei-Faktoren-Theorie der Angst von Mowrer Die Zwei-Faktoren-Theorie der Angst (von Mowrer): geht davon aus, dass die Entstehung und Aufrechterhaltung von Angst auf zwei Prozessen basiert: 1) Klassische Konditionierung (=> Entstehung / Akquisition) Ursprünglich neutrale Reize (z.B. Kaufhaus) werden aufgrund traumatischer Ereignisse (Schwindel, Herzrasen) mit einem Angstzustand assoziiert! 2) Operante Konditionierung (=> Aufrechterhaltung) Die Vermeidung des Reizes (Kaufhaus) wird negativ verstärkt, sofern dadurch die Angst reduziert wird. Problem: Viele Patienten erinnern sich nicht an ein traumatisches Erlebnis! Möglich ist, dass harmlose Erfahrungen traumatisch verarbeitet wurden, ohne dass sich die Betroffenen darüber bewusst sind! Implikation: Die 2-Faktoren-Theorie (und ihre Erweiterungen) stellen die theoretische Grundlage der Konfrontationsverfahren dar! 105 12.2.3. Biologische Ätiologiefaktoren Gentische Diathese: Familiäre Häufung Höhere Konkordanz bei monozygoten als bei dyzygoten Zwillingen Erhöhte Angstsensivität (= Tendenz, körperliche Empfindungen als Hinweis auf Bedrohung oder Krankheit zu deuten) Ist nicht nur genetisch, sondern auch durch Lernerfahrungen bedingt! Verringerte Herzratenvariabilität Noradrenerge Hyperaktivität: Stimulation des Locus Coeruleus führt bei Affen zu scheinbaren Panikattacken! Stärkere Aktivierung des rechten im Vergleich zum linken PFC: Empirische Befunde: Rechter PFC ist bei Panikpatienten nicht nur beim Betrachten panikrelevanter Bilder (z.B. Unfallszenen), sondern auch im Ruhezustand stärker aktiviert als der linke! Zwischen dieser Asymmetrie und den Angstwerten in der SCL-90 und dem STAI-S besteht eine signifikante Korrelation (zum BDI besteht dagegen keine!) Erklärung: Durch die Überaktivierung des Vermeidungssystems können negative Emotionen und Vermeidungsreaktionen leichter ausgelöst werden! 12.3. Indikation und Behandlung 12.3.1. Indikation Liegen andere Störungen vor, die gegebenenfalls vorrangig behandelt werden müssen? Psychosen Depressionen Substanzmissbrauch (Alkohol und Medikamente) Schulte: Unabhängig vom Ergebnis der Problemanalyse sind immer konfrontative Verfahren indiziert! Aber: Für die individuelle Ausgestaltung der Konfrontationsverfahren ist Problemanalyse wichtig. Abgeklärt werden müssen… Die Bedingungen, die die Ängste auslösen (=> Angsthierarchie), verschlimmern, verringern und aufrechterhalten Die bisherigen Bewältigungsstrategien Individuelle Kognitionen Körperempfindungen (Herausarbeitung der körperlichen Leitsymptome: Herzrasen, Atembeschwerden, Schwindel etc.?!) Prinzipiell gilt: Bei Panikstörung ohne oder mit leichter bis moderater Agoraphobie: kogbnitivverhaltenstherapeutisches Programm Bei starkem agoraphobischem Vermeidungsverhalten: Konfrontationstherapie Bei Panikattacken und schwerer Agoraphobie: Kombination aus beidem 106 12.3.2. Behandlungsformen: Pharmakologische Behandlung: Einsatz von Antidepressiva (SSRIs, Trizyklika) und Anxiolytika (Benzodiazepine wie z.B. Tavor) Nachteile: Erneutes Auftreten der Symptome nach Absetzen Abbruch der Behandlung wegen Nebenwirkungen (Gewichtszunahme, Herzrasen etc.) Bei Benzodiazepinen besteht eine hohe Suchtgefahr! Kognitiv-verhaltenstherapeutische Maßnahmen (zahlreiche Manuale): Psychoedukation Teufelskreismodell nach Ehlers und Margraf (Aufschaukelungsprozess) Diathese-Stress-Modell (veränderte Wahrnehmungsschwelle für körperliche Empfindungen bei Panikpatienten) Kognitive Therapie bei Panikstörung: Setzt an bei Fehlinterpretationen (erhöhte Wahrnehmung, selektive Aufmerksamkeit, Memory-Bias etc.) Ziel: Modifikation der Interpretation körperlicher Vorgänge Interozeptive Exposition bei Panikstörung Bewusste Provokation körperlicher Symptome ohne Vermeidung (z.B. durch Hyperventilationstest, Drehstuhl, Treppensteigen etc.) Extinktion der Furchtreaktion In-vivo Exposition bei Agoraphobie: Konfrontation mit angstbesetzten Situationen (z.B. Kaufhaus) bis Angst nachlässt, wobei die Konfrontation nach neueren Studien keineswegs so lange dauern muss, bis die Angst ganz verschwunden ist (wichtig ist lediglich, dass der Patient die Angstreduktion wahrnimmt) Wichtig: a) die Konfrontation sollte in möglichst verschiedenen Situationen erfolgen (nicht immer dasselbe Kaufhaus), b) Lob für „in die Situation gehen“ (nicht für „Angstfreiheit“) Weitere Techniken: Entspannungsverfahren (progressive Muskelrelaxation nach Jacobson) Sport (zwecks Ausdauertraining und Induktion körperlicher Symptome) Psychodynamische Kurzzeittherapie nach Milrod (manualisiert): Grundprinzipien: Der Therapeut fokussiert auf alle Erfahrungen des Patienten, die mit dessen Panikattacken verknüpft sind! Methoden: Übertragung, freie Assoziation Das Programm gliedert sich in 3 Phasen: 1. Herausarbeitung der unbewussten Bedeutung der Panik a) Konzentration auf 3 Konfliktbereiche: a) Unabhängigkeit und Trennung; b) Umgang mit dem Ausdruck von Ärger; c) Sexuelle Erregung und deren wahrgenommene Gefährlichkeit 2. Herausarbeitung der Vulnerabilitätsfaktoren a) Analyse der Übertragungsprozesse 3. Thematisierung des Konflikts „Unabhängigkeit und Trennung“ a) Beendigung der Therapie wird aktiv thematisiert (Trennungskonflikt) und neue Bewältigungsmöglichkeiten werden vermittelt 107 Gesprächspsychotherapie nach Teusch und Finke (manualisiert): Gliedert sich ebenfalls in 3 Phasen: 1. Symptomphase a) Fokus auf Entkatastrophisierung funktioneller Beschwerden b) Förderung aktiver Angstbewältigung c) Sensibilisierung für Zusammenhänge zwischen Angstsymptomen und seelischen Belastungen 2. Beziehungs- und Konfliktphase a) Hilfe bei der Erweiterung der Autonomie 3. Abschiedsphase a) Zulassen von Abschiedsschmerz 12.3.3. Wirksamkeit: Panikstörung ohne Agoraphobie: KVT: Wirksamkeit als Monotherapie und in Kombination mit Psychopharmaka (zum Zweck des Absetzens der Medikamente) am besten belegt. KVT ist genauso wirksam wie medikamentöse Therapie (Langzeitvergleiche für beide Therapien liegen nicht vor) Auch die langfristige Wirksamkeit von KVT ist empirisch belegt Als „wirksam“ erwiesen hat sich außerdem angewandte Entspannung Für alle anderen Psychotherapieverfahren liegen keine Wirksamkeitsnachweise vor Fazit: KVT ist die Methode der Wahl! Response-Rate: 75-92%! Effektstärke für Hauptsymptomatik: 1.5 Panikstörung mit Agoraphobie: KVT: Wirksamkeit als Monotherapie und in Kombination mit Psychopharmaka (zum Zweck des Absetzens der Medikamente) am besten belegt. KVT wirkt langfristig sogar besser als Kombinationsbehandlung; letztere ist ihrerseits besser als eine ausschließlich medikamentöse Behandlung In vivo-Exposition ist umso wichtiger, je stärker das agoraphobische Vermeidungsverhalten ist! Entspannungsverfahren haben keinen zusätzlichen Effekt; werden sie trotzdem angewandt, ist darauf zu achten, dass sie vom Patienten nicht zur Flucht und Vermeidung verwendet werden! Psychodynamische Kurzzeittherapie und Gesprächspsychotherapie: Evidenz im Vergleich zur KVT wesentlich geringer! Methodische Qualität und Vielseitigkeit der Fragestellungen der Studien sind geringer als bei den Studien zur KVT! Durch die störungsspezifischen und manualisierten Interventionsprogramme (s.o.) kann die Wirksamkeit gesteigert werden! Medikamente: bisher nur kurzfristige Wirkung nachgewiesen Fazit: KVT ist die Methode der Wahl (ES= 1.2)! Der Schwerpunkt sollte auf interozeptive und situative Exposition gelegt werden; sollten schnelle Erfolge notwendig sein, sind darüber hinaus Medikamente indiziert! Agoraphobie ohne Panikstörung: KVT: Wirksamkeit als Monotherapie am besten belegt Die Studien dazu sind meist schon etwas älter (bis 1992) und beziehen sich v.a. auf In-Vivo-Expositionsverfahren Psychodynamische Kurzzeittherapie in Kombination mit basaler KVT ist „möglicherweise wirksam“ 108 12.3.4. Faustregel: 109 13. Generalisierte Angststörung 13.1. Darstellung des Störungsbildes 13.1.1. Klassifikation und Diagnose: Klassifikationskriterien nach dem DSM-IV: Übermäßige Angst und Sorge (furchtsame Erwartung) bezüglich mehrerer (meist alltäglicher) Ereignisse oder Tätigkeiten, die über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten an der Mehrzahl der Tage auftreten. Die betroffene Person hat Schwierigkeiten, die Sorgen zu kontrollieren! Angst und Sorge sind mit mindestens 3 der folgenden 6 Symptome verbunden: 1. Ruhelosigkeit 2. Leichte Ermüdbarkeit 3. Konzentrationsschwierigkeiten oder Leere im Kopf 4. Reizbarkeit 5. Muskelspannung 6. Schlafstörungen Die Angst und Sorgen sind nicht auf Merkmale einer psychischen Störung beschränkt (sie beziehen sich z.B. nicht darauf, eine Panikattacke zu erleiden) Das Kernsymptom der generalisierten Angststörung ist die Sorge! Prinzipiell unterscheiden sich die Sorgen von GAS-Patienten dabei nicht von denen Gesunder: Es handelt sich bei ihnen um ängstliche Erwartungen, die sich auf ein mögliches unangenehmes Ereignis bzw. auf den schlechten Ausgang eines Ereignisses beziehen! Die Sorgen von GAS-Patienten sind dabei keineswegs immer unrealistisch – sie sind jedoch wesentlich zahlreicher, intensiver (mehrere Stunden am Tag) und unkontrollierbarer! Differentialdiagnose: Die GAS wird anders als viele andere (Angst-)Störungen (Agoraphpobie, spezifische Phobien, Zwangsstörung, Hypochondrie etc.) nicht nur durch spezifische Situationen oder Objekte ausgelöst, sondern ist eine generalisierte Zustandsangst! Neben den genannten Störungen müssen ausgeschlossen werden: Depression, Schilddrüsenüberfunktion (bei der zwar Angst, im Allgemeinen aber keine Sorge auftritt) Offenes Vermeidungsverhalten kann bei der GAS fehlen! 13.1.2. Epidemiologie, Verlauf und Prognose Epidemiologie: Mit einer Lebenszeitprävalenz von ca. 5% ist die GAS einer der häufigsten Angststörungen. In Allgemeinpraxen ist GAS die häufigste Angststörung – in psychotherapeutischen Einrichtungen ist sie dagegen seltener als andere Angststörungen (Vermutliche Ursache: GAS-Patienten halten sich nicht für psychisch krank, ihre Sorgen sind ichsynton)! In den letzten Jahren scheint die Häufigkeit der GAS zuzunehmen. 110 Frauen sind etwas häufiger betroffen und weisen häufiger komorbide Störungen auf! Die GAS beginnt häufig zwischen 20 und 30, ein zweiter Gipfel liegt jedoch (v.a. bei Frauen) zwischen 55 und 60 Jahren! Die GAS ist die häufigste Angststörung im höheren Alter! Verlauf und Prognose: Die GAS ist eine chronische Störung mit geringer Spontanremission, was nicht heißt, dass es keine Schwankungen im Befinden gibt! Psychotherapeutische Hilfe wird, wenn überhaupt, meist erst sehr spät aufgesucht und dann v.a. aufgrund komorbider Störungen! Die Komorbiditätsrate (85-91%) ist äußerst hoch! Am häufigsten sind: Spezifische Phobien, Sozialphobie, Depression! 13.2. Behandlung 13.2.1. Störungsmodelle Biologische Vulnerabilitätsfaktoren: Die Befundlage zur Erblichkeit von GAS ist uneinheitlich: die Schätzungen bewegen sich zwischen 15 und 40%! Patienten mit GAS weisen eine eingeschränkte Herzratenvariabilität auf (= eingeschränkte Anpassung der Herzrate an unterschiedliche Situationen) Nach Thayer und Lane (2000) wird die Herzratenvariabilität vom „zentralen autonomen Netzwerk“ („central autonomous network“, CAN) gesteuert. Das CAN erhält und integriert viszerale, humorale und Umgebungsinformationen und koordiniert die autonomen, endokrinen und verhaltensbezogenen Reaktionen. Es wirkt über den Sympathikus aktivierende Schaltkreise und unterliegt seinerseits vagaler Hemmung (über GABA-Interneurone). Letztere setzt bei GAS-Patienten nicht oder nicht stark genug ein. Diese Disinhibition bedingt nach Thayer und Lane nicht nur die Aufrechterhaltung der GAS, sondern ist ursächlich an dessen Entstehung beteiligt! Sie führt dazu, dass… - …die Aufmerksamkeit nicht mehr flexibel von Furchtreizen abgezogen werden kann, die Habituation der Orientierungsreaktion sowie die Herzratenvariabilität reduziert sind und sich die Patienten ständig „auf dem Sprung“ fühlen (defensiver, auf die Antizipation von Gefahren ausgerichteter Aufmerksamkeitsstil => ständige Anspannung) Eine Habituation der Sorge bleibt aus, weil die physiologischen Angstreaktionen zwar konstant hoch sind, aber nie wirklich durchbrechen! Psychologische Vulnerabilitätsfaktoren: Verletzung des Bindungs- und Kontrollbedürfnisses in der Kindheit => Unsicher-ambivalentes Bindungsverhalten Erworbenes Gefahren-Schema: Unkontrollierbare und unvorhersehbare Ereignisse werden als gefährlich eingeschätzt! Niedrige Unsicherheitstoleranz Niedrige Selbstwirksamkeitserwartung (= weniger Vertrauen in die eigenen Ressourcen) Positive Annahmen über Sorgen (z.B. „Die Sorgen schützen meine Lieben!“) 111 Die Aufrechterhaltung der GAS basiert auf negativer Verstärkung: Paradoxer Weise geht die negative Verstärkung dabei v.a. von der Sorge aus, sofern diese eine Form der kognitiven Vermeidung darstellt! Sorgen werden nicht zu Ende, d.h. bis hin zur befürchteten Katastrophe, gedacht; stattdessen wird die Gedankenkette ab einem bestimmten Angstniveau abgebrochen und beginnt wieder von vorn oder es wird zu einem neuen Sorgeninhalt übergegangen. Darüber hinaus sind die Sorgen von GAS-Patienten recht abstrakt: bildhafte Vorstellungen, die stärkere Angst auslösen, werden unterdrückt. Auf diese Weise verhindern Sorgen starke physiologische Reaktionen (die sympathische Aktivierung wird verhältnismäßig niedrig gehalten) und Panik. Kurz: Durch Sorgen wird Panik – zum Preis chronischer Anspannung vermieden! Neben der Sorge wirken auch die zahlreichen Kontrollstrategien von GASPatienten negativ verstärkend: Ablenkung Vermeidungsverhalten Rückversicherungen Gedankenunterdrückung Selbstmedikation Wie nahezu alle Störungen lässt sich somit auch die GAS als Teufelskreislauf beschreiben: 13.2.2. Indikation und Behandlung Indikation: Komorbidität beachten! Behandlungserfolg bei anderen Störungen (z.B. Panikstörung) überträgt sich nicht automatisch auf die Sorgen, die als unkorrigierbar empfunden werden! Anders als bei anderen Störungen lassen sich Entspannungsverfahren nicht gut mit Konfrontationsverfahren kombinieren, da es bei letzteren darum geht, die Sorgen bildhaft zu Ende zu denken! Eine ausschließlich medikamentöse Behandlung ist wegen der hohen Rückfallraten nicht zu empfehlen; auch in Kombination mit Psychotherapie sind Medikamente jedoch problematisch, da sie häufig zu einer Euphorisierung führen und dadurch die Bereitschaft zur Therapie massiv schwächen! 112 Verschiedene Behandlungsverfahren: Kognitive Verhaltenstherapie: Psychoedukation / Informationsvermittlung: Teufelskreislauf der GAS; Bedeutung kognitiver Schemata, kritischer Lebensereignisse und anderer Vulnerabilitätsfaktoren etc. Problemanalyse: Sorgenbereiche sammeln, Sorgenbereich auswählen, Inhalt der Sorgen spezifizieren, Sorgenhierarchie erstellen! Konfrontationsübungen (v.a. in Form von Vorstellungsübungen): Die Patienten werden, nachdem man eine Sorge herausgesucht hat, dazu angeleitet, sich den Inhalt dieser Sorge möglichst bildhaft und genau vorzustellen („Sie liegen im Krankenhaus…“) Ziel solcher Übungen ist es, a) die Sorgenketten zu durchbrechen, indem einzelne Sorgen isoliert werden, b) eine emotionale Verarbeitung der Sorgen zu ermöglichen und c) vorübergehend starke Angst auszulösen, um eine Habituation zu ermöglichen! - Evtl. ist dabei zur Vorbereitung allgemeines Vorstellungs- bzw. Imaginationstraining notwendig! Angewandte Entspannung (nach Öst): Bietet sich v.a. an, wenn körperliche Symptome im Vordergrund stehen und die Sorgen nicht erkannt und benannt werden können. Sollte nicht mit Konfrontationsverfahren kombiniert werden (s.o.) Ziel ist es, Anzeichen von Angst und Anspannung möglichst schnell als solche zu erkennen und sich daraufhin möglichst schnell zu entspannen! Zu diesem Zweck wird zunächst die progressive Muskelrelaxation trainiert dann dessen Kurzform dann nur noch Entspannung Entspannung mit Selbstinstruktion Entspannung in allen Lagen Schnelle Entspannung Anwendung in realen Situationen! Wirksamkeit: Generell gilt: Die therapeutischen Erfolge bei GAS sind i.d.R. geringer als bei den meisten anderen Angststörungen. Darüber hinaus liegen zur GAS nur wenige kontrollierte Therapiestudien vor und Komorbiditäten in den meisten Studien ausgeschlossen wurden! Die Wirksamkeit von KVT (d = 1.43) und VT (d = 1.2) ist zumindest in Bezug auf die Hauptsymptomatik gut belegt und zudem recht stabil! Auch die angewandte Entspannung hat eine hohe Effektstärke (d = 1.65), dafür aber auch eine hohe Abbrecherquote (25%) Bedacht werden muss, dass hohe Effektstärken nichts über die klinische Signifikanz aussagen! 113 14. Posttraumatische Belastungsstörung 14.1. Darstellung des Störungsbildes 14.1.1. Diagnose Hintergrundinfo: Die posttraumatische Belastungsstörung wurde erst verhältnismäßig spät als eigenständiges Störungsbild (an)erkannt (früher: „Kompensationsneurose“). Die Symptome wurden erstmals Ende des 19./ Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieben. Anlass waren schwere Eisenbahnunfälle, die Weltkriege und später die Holocaustopfer! Entscheidende Ereignisse waren: der Vietnamkrieg (zahllose „unehrenhafte Entlassungen“ gestörter Soldaten) und die Frauenbewegung (offenerer Umgang mit sexuellem Missbrauch) Definition: Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine auf extreme Belastungserfahrungen zurückgehende Angststörung, die durch folgende Kernsymptome gekennzeichnet ist: 1. (Ungewolltes) Wiedererleben des traumatischen Ereignisses im Gedächtnis, Tagträumen oder Träumen Das Wiedererleben ist dabei durch extreme Realitätsnähe gekennzeichnet! 2. Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die mit dem Trauma assoziiert sind und Unterdrückung der Erinnerung an das Trauma (bis hin zur Amnesie). 3. Symptome autonomer Überregung (Hypervigilanz, übertriebene Schreckreaktion, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen etc.) 4. Emotionale Stumpfheit, Teilnahmslosigkeit und Anhedonie Kriterien nach der ICD-10: Traumatisches Ereignis, das „bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde“ Symptome: notwendig: Beharrliches Wiedererleben des Traumas (s.o.) typisch: Vermeidung; Gefühlstaubheit; vegetative Überregung Dauer: Die Symptome treten i.d.R. innerhalb von 6 Monaten nach dem Ereignis auf und dauern mindestens einen Monat an ( akute Belastungsstörung)! 14.1.2. Epidemiologie, Verlauf und Prognose Die Mehrheit der Bevölkerung erlebt im Lauf des Lebens mindestens eine traumatische Situation! Männer erleben dabei im Schnitt häufiger traumatische Ereignisse (berufsbedingt) als Frauen; trotzdem liegt das Geschlechterverhältnis bei 2:1, was daran liegt, dass Frauen mehr Ereignisse mit traumatischer Wirkung erleben! Die Wahrscheinlichkeit, nach einer Vergewaltigung eine PTSD zu entwickeln, liegt bei ca. 50%! Lebenszeitprävalenz: Männer: 5-6% Frauen: 10-12% Verlauf und Prognose: Meist treten die Symptome sofort nach dem traumatischen Erlebnis auf; ein verzögerter Beginn findet sich lediglich bei 11%! Spontanremission im ersten Jahr: 50% 114 Chronischer Verlauf: 1/3 aller Fälle Das Risiko einer Chronifizierung ist dabei umso höher, je schwerwiegender die anfänglichen Symptome! Großer Risikofaktor: „Sich aufgeben in der Traumasituation“ (Autonomieverlust) Die Komorbidität bei der PTB ist sehr hoch: In 80-90% der Fälle liegen weitere Störungen vor! Am häufigsten sind affektive Störungen, weitere Angststörungen, Substanzmissbrauch und Somatisierung (die zeitliche Abfolge ist ungewiss); Darüber hinaus besteht eine erhöhte Anfälligkeit für somatische Beschwerden (v.a. Infektionen und Erkrankungen des Nervensystems). 12.2. Ätiologie: 12.2.1. Modell der chronischen PTB nach Ehlers und Clark Die Angst von PTB-Patienten unterscheidet sich von anderen Ängsten dadurch, dass sie nicht auf eine zukünftige Bedrohung gerichtet ist, sondern aufgrund eines vergangenen Ereignisses entsteht. Eine chronische posttraumatische Belastungsstörung entsteht dabei dann, wenn das traumatische Ereignis so verarbeitet wird, dass der Betroffene das Gefühl hat, gegenwärtig bedroht zu sein (extern: „Überall lauert Gefahr!“; intern: Bedrohung des Selbstwerts)! Die Wahrnehmung einer gegenwärtigen Bedrohung basiert nach Ehlers und Clark auf 2 Prozessen: Zum einen auf der Interpretation des Traumas und seiner Konsequenzen, zum anderen auf den Eigenheiten des Traumagedächtnisses. 1. Personen, die eine PTB entwickeln, interpretieren das traumatische Ereignis und dessen Konsequenzen durchweg negativ: Sie sind davon überzeugt, falsch gehandelt zu haben, verstehen das traumatische Ereignis nicht als zeitlich begrenzt, gehen von globalen Konsequenzen aus etc. etc. Trauma: „Ich wurde vergewaltigt, weil man mir ansieht, dass ich ein leichtes Opfer bin.“; „Es kann jederzeit wieder passieren!“ etc. Konsequenzen: Reizbarkeit: „Ich habe mich als Person zum Negativen hin entwickelt!“; Alpträume: „Ich werde nie darüber hinwegkommen!“; Konzentrationsprobleme: „Mein Hirn hat Schaden genommen!“; Unterstützung durch andere: „Ich werde mich anderen nie wieder nahe fühlen!“ etc. 2. Das Traumagedächtnis ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet: a) Ungenügende Elaboration (Verarbeitung) der Inhalte und mangelnde Einbettung in das sonstige autobiographische Gedächtnis: Traumatische Erinnerungen sind dementsprechend meist ungeordnet, bruchstückhaft und kontextlos; einzelne Aspekte werden dafür umso lebhafter wiedererlebt! b) Starke Reiz-Reiz- und Reiz-Reaktions-Assoziationen: Die Inhalte im Traumagedächtnis sind besonders eng und vielfältig miteinander verknüpft und können dementsprechend leicht getriggert werden, wobei die auslösenden Reize oft unbewusst sind (z.B. löst ein Donner die Erinnerung ans Schlachtfeld aus) c) Starkes Priming: Reize, die ein Wiedererleben des Traumas auslösen können, werden besonders leicht bemerkt und schlecht diskriminiert (sind also wenig spezifisch)! 115 Verhaltensweisen und kognitive Verarbeitungsstrategien, die zur Kontrolle bzw. Vermeidung der gegenwärtigen Bedrohung dienen, halten die Störung aufrecht und sind daher dysfunktional! 1. Erzeugen sie viele Symptome der PTSD (paradoxer Effekt der Gedankenunterdrückung, Gefühlstaubheit etc.)! 2. Verhindern sie die Veränderung der negativen Interpretation des Traumas und seiner Konsequenzen! 3. Verhindern sie die Elaboration des Trauma-Gedächtnisses! 12.2.2. Biologische Grundlagen Bei trauma-exponierten Menschen mit und ohne PTSD findet sich eine reduzierte visuelle Verarbeitung von bedrohlichen Reizen (geringere Aktivierung des Okzipitallappens)! Durch traumaassoziierte Reize wird die Amygdala aktiviert; bei PTSD-Patienten wird die Amygdala dabei aber nur unzureichend durch den PFC (der die Gesamtsituation bewertet) gehemmt: Das Kontextgedächtnis wird nicht aktiviert und kann daher nicht mit dem aktuellen Kontext verglichen werden (keine Entwarnung!) Traumatische Erfahrungen in der Kindheit führen zu einer stärkeren hormonellen Stressreaktion (HPA-Achse) Ein kleineres Volumen des Hippocampus scheint ein Vulnerabilitätsfaktor für die Entstehung einer posttraumatischen Belastungsstörung zu sein. Gilbert et al.: Fallkontrollstudie mit monozygoten Zwillingen Je geringer das Hippocampus-Volumen von Kriegsveteranen mit PTSD, desto ernster die Symptomatik! Dass das geringe Hippocampusvolumen dem Trauma vorausging und nicht erst durch dieses ausgelöst wurde, konnte sichergestellt werden, indem man sich auch die nicht-traumatisierten Zwillingsbrüder der Soldaten anschaute und feststellte, dass auch sie ein geringeres Hippocampusvolumen aufwiesen. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass Zwillingspaare, bei denen ein Geschwisterteil an einer PTSD litt, signifikant kleinere Hippocampusvolumen aufwiesen als Zwillingspaare, bei denen kein Geschwisterteil eine PTSD hatte! Fazit: Die mangelnde Elaboration der traumatischen Inhalte im Traumagedächtnis scheint durch folgende Faktoren bedingt zu sein: 1. Bereits vorgeschädigter Hippocampus 2. Beeinträchtigung der akuten Gedächtnisbildung zu hohen Stresshormonspiegel 3. Vermiedene Auseinandersetzung mit dem Erlebten 116 12.3. Behandlung 12.3.1. Allgemeines Die wichtigsten Behandlungsziele sind: 1. Elaboration des Traumagedächtnisses und kontextuelle Einordung der traumatischen Gedächtnisinhalte, um auf diese Weise die Intrusionen zu reduzieren! 2. Veränderung der problematischen Interpretationen, die das Gefühl aktueller Bedrohung hervorrufen! 3. Aufgabe der dysfunktionalen Verhaltensweisen und kognitiven Verarbeitungsstrategien, mit Hilfe derer die Patienten das Gefühl der Bedrohung zu kontrollieren bzw. zu vermeiden versuchen! Ablauf der Therapie: 1. Sitzung: Psychoedukation (Vermittlung des Behandlungsrationals und Störungsmodells) Die PTSD als normale Reaktion auf eine abnormale Situation Faktoren, die die Symptome aufrechterhalten (Grübeln, Vermeidung etc.) Behandlungsziele Interventionsstrategien in den weiteren Sitzungen: Imaginatives Nacherleben des Traumas Identifikation u. Diskrimination von Auslösern des intrusiven Wiedererlebens In-vivo-Exposition Kognitive Umstrukturierung Modifikation aufrechterhaltender Verhaltensweisen und kognitiver Strategien „Hausaufgaben“ zum „Zurückerobern des Lebens“ Rückfallprophylaxe (am Ende der Therapie) 12.3.2. Die wichtigsten Methoden Imaginatives Nacherleben des Traumas: Ziele: Habituation an angstausösende Reize Elaboration des Traumagedächtnisses Identifikation der negativen Interpretationen Vorgehen: Das imaginative Nacherleben bedarf einer guten Vorbereitung und sollte mit kognitiven Techniken kombiniert werden: Identifikation der „hot spots“, genaue Aufklärung über die Wirkweise von Expositionsverfahren, Besprechung der Ängste und Zweifel des Patienten, Training kognitiver Techniken zur Entkatastrophisierung und emotionalen Distanzierung; wichtig ist v.a., dem Patienten möglichst viel Kontrolle zu geben (er bestimmt, wann die Imagination unterbrochen wird etc. etc.)! - Bei zu großer Angst sollten zunächst andere Formen des Nacherlebens gewählt werden: z.B. Schreiben! Das traumatische Ereignis soll vom Patienten mehrmals – und zwar möglichst detailliert, bildhaft und korrekt – nacherlebt und wiedergegeben werden („Ich-Form“, Präsens, sensorische Eindrücke etc.); die Sitzungen werden dabei auf Tonband aufgenommen und sollen zuhause täglich angehört werden! - Während des Erinnern: Mehrmalige Belastungseinschätzung auf einer Skala von 1 bis 100! - Verlauf: Anfänglich starke Belastungssteigerung; dann zunehmende Habituation, so dass das Erinnern immer leichter fällt! 117 Nachbesprechung: Einschätzung der Lebhaftigkeit der Erinnerungen (Wie gut ist das Nacherleben gelungen?!); erfolgreiche Reduktion bei Belastungswerten von 15-20 in den schlimmsten Momenten Probleme: Niedrige Belastungsratings können auch auf Gedankenunterdrückung zurückgehen! Verlust des Kontaktes zum „Hier und Jetzt“ Identifikation und Diskrimination von Auslösern des intrusiven Wiedererlebens! Die zugrundeliegende Idee: Eine bessere Elaboration des Traumagedächtnisses führt zu einer besseren Diskrimination zwischen Reizen, die während des Traumas auftraten, und solchen aus der gegenwärtigen Umwelt, was seinerseits zu einer Reduktion des intrusiven Wiedererlebens führt! Vorgehen: Patienten sollen genau protokollieren, in welchen Situationen intrusives Wiedererleben auftaucht und zusammen mit dem Therapeuten überlegen, wodurch es jeweils ausgelöst wurde! In-vivo-Exposition und Exposition in virtueller Realität: Prinzip: Konfrontation mit Reizen, die mit dem Trauma assoziiert sind und bisher vermieden wurden (z.B. indem der Ort des Geschehens aufgesucht wird) Ziele: Habituation => Löschung konditionierter Furchtreaktionen; bessere Elaboration des Traumagedächtnisses und Diskrimination zwischen „damals“ und „heute“, kognitive Umstrukturierung (z.B. indem die Übergeneralisierung der Gefahr als Fehlschluss entlarvt wird => Verhaltensexperiment) Beispiel für Exposition in virtuelle Realität: 11. September: graduelle Exposition in 11 Stufen (1. Stufe: Tag in New York mit Blick aufs WTC 11. Stufe: vollständige Simulation des Anschlags) - Ergebnis: Bei 5 von 9 Patienten (von denen 6 mit Hilfe traditioneller Verfahren nicht geheilt worden waren) konnten die Symptome in 14 Sitzungen so weit reduziert werden, dass sie keine Diagnose mehr erfüllten! Vorteile virtueller Realitäten: Realisierbarkeit sonst nicht willkürlich herstellbarer Situationen (z.B. Krieg, Anschläge etc.) Graduierte Exposition möglich Wiederholte Exposition einfacher und günstiger als in-vivo Realistischere Emotionsinduktion als beim imaginativen Nacherleben (v.a. bei Patienten mit geringem Vorstellungsvermögen oder zu großen Widerständen) Niedrigere Hemmeschwelle als bei „in-vivo“-Expositionen Kognitive Umstrukturierung: Allgemeines: Ziel: Modifikation dysfunktionaler Interpretationen Vorgehen: Therapeut und Patient arbeiten gemeinsam daran, die Interpretationen an der Realität zu überprüfen; die Interpretationen werden also als Hypothesen ernst genommen und systematisch hinterfragt! Prinzip des „geleiteten Entdeckens“ Methoden: sokratischer Dialog, Ermittlung automatischer Gedanken und kognitiver Verzerrungen, Verhaltensexperimente und Imaginationsverfahren etc. 118 Typische Denkfehler und ihre Modifikation Übergeneralisierung von Gefahr - Emotionale Schlussfolgerungen („Ich fühle mich ängstlich – also muss es gefährlich sein!“) - Beziehungen zwischen unabhängigen Ereignissen sehen („Was ein Mal passiert ist, kann immer wieder passieren!“) - Übergeneralisierung („Die Gefahr lauert überall!“) - Selektive Aufmerksamkeit auf traumassoziierte Reize und andere Unglückliche Befürchtungen des zerbrechlichen Selbst (Verrückt werden, Kontrolle verlieren, Zusammenbrechen) - Patienten vermeiden Gedanken an das Trauma, weil sie befürchten, dass durch diese eine Katastrophe herbeigeführt wird ( widerlegt werden kann diese Überzeugung z.B. durch imaginatives Nacherleben) Verantwortlichkeit für das Trauma (Schuld- und Schamgefühle) - Schuld- und Schamgefühle resultieren z.B. daraus, das Ereignis nicht verhindert zu haben, inakzeptabel reagiert zu haben (z.B. ungewollte sexuelle Erregung bei Vergewaltigung), im Vergleich zu anderen so glimpflich davongekommen zu sein etc. etc. ( widerlegt werden können solche Fehlschlüsse z.B., indem man den Patienten anhand eines Tortendiagramms den prozentualen Anteil der eigenen Schuld und den Beitrag anderer Faktoren einschätzen lässt; anschließend wird der Patient gefragt, wie die Anteile bei einer anderen Person einschätzen würde) Rückfallprophylaxe: Die Therapie kann beendet werden, wenn der Patient in den letzten 2-3 Sitzungen folgende Kriterien erfüllt: Niedrige Werte auf PTSD-Fragebögen Kein intrusives Wiedererleben mehr Kein Vermeidungsverhalten mehr Keine Gefühls- und Erinnerungsunterdrückung mehr Imaginatives Nacherleben kann ohne starke Belastung durchgeführt werden Wichtig ist es, am Ende das in der Therapie Gelernte noch einmal zusammenzufassen! 12.3.3. Probleme und Wirksamkeit Typische Probleme bei der Durchführung und ihre Lösung: Der Patient erscheint unregelmäßig (Zeichen von Vermeidung, Schlafstörungen oder generellem Chaos) Verständnis zeigen, Termine nachmittags legen, Sicherheit vermitteln Der Patient führt das imaginative Nacherleben nicht aus genaue Aufklärung über Wirkweise, andere Variante des Nacherlebens (z.B. Aufschreiben) etc. Der Patient dissoziiert im Rahmen der Konfrontation Reaktion normalisieren, graduiert vorgehen, Kontakt zum „Hier und Jetzt“ steigern; Stressbewältigungsstrategien vermitteln etc. Der Patient gibt dysfunktionales Verhalten nicht auf Konsequenzen der Vermeidung besprechen etc. Der Patient hält an dysfunktionalen Interpretationen fest Exploration und Modifikation der zugrundeliegenden Einstellungen Der Patient führt Hausaufgaben nicht aus In-vivo-Arbeit unter Beteiligung des Therapeuten etc. 119 Der Patient bekommt durch Wutausbrüche Probleme mit der Familie, im Beruf oder mit der Polizei Ärgerkontrolle trainieren; „Flash-Cards“ mit Selbstinstruktionen etc. Der Patient hat finanzielle, gesundheitliche oder familiäre Probleme Problemlösetraining, evtl. direkte Intervention durch Therapeuten etc. Der Patient erlebt ein weiteres Trauma Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten, ansonsten vorgehen wie beim anderen Trauma Der Therapeut fühlt sich durch traumatisches Ereignis persönlich beeinträchtigt Supervision, Unterstützung durch Kollegen, körperliche Arbeit etc. Befunde zur Wirksamkeit: Generell gilt: Traumafokussierte Therapien (die mit Konfrontationsverfahren arbeiten) scheinen zwar kurzfristig oft weniger effektiv zu sein als andere Behandlungen (z.B. Stressbewältigungstraining, Entspannungstraining), erweisen sich aber langfristig als wesentlich erfolgreicher (stabile Effekte)! Zu den traumafokussierten Therapien gehören: - Die KVT (d = 1,27) - EMDR (Augenbewegungs-Desensibilisierung) von Shapiro (d = 1,24) Andere Behandlungsformen sind: - Training zur Stressbewältigung (Entspannungs- und Atemtraining, Gedanken-Stopp etc.) - Bloßes Entspannungstraining - Psychodynamische Therapie (d = 0,9) - Hypnotherapie (d = 0,94) Ein Problem traumafokussierter Verfahren ist die oft hohe Abbrecherquote (1/4 bis 1/3 steigen aus), die wohl v.a. auf die Angst vor Konfrontation zurückgeht! Pharmakologische Behandlung: SSRIs (d = 1,34) Medikament der Wahl MAO-Hemmer (d=0,61) nicht wirksamer als Placebo Trizyklika (d = 0,54) nur bei weniger schweren Fällen Antileptika (d = 0,93) noch nicht genügend erforscht Benzodiazepine (d = 0,49) nicht wirksam + Rebound-Effekt 120 13. Sucht bzw. Abhängigkeit 13.1. Darstellung des Störungsbildes: 13.1.1. Abhängigkeit Definition der WHO: Abhängigkeit ist ein Syndrom, das sich in einem Verhaltensmuster äußert, bei dem die Aufnahme der Droge Priorität gegenüber anderen Verhaltensweisen erlangt, die früher einen höheren Stellenwert hatten. Dieses Verhaltensmuster muss nicht dauerhaft vorhanden sein: Abhängigkeit ist also nicht absolut, sondern existiert in unterschiedlicher Stärke. Die Intensität des Syndroms wird an den Verhaltensweisen gemessen, die im Zusammenhang mit der Drogensuche und –aufnahme gezeigt werden und anderen Verhaltensweisen, die daraus resultieren. Komponenten süchtigen Verhaltens nach dem DSM-IV: Die wichtigsten Kriterien: 1. Zunehmende Ausschließlichkeit der Drogensuche (!!) 2. Toleranzentwicklung 3. Entzugssymptome 4. Stärkerer und häufigerer Konsum als beabsichtigt 5. Konsum entgegen Wunsch nicht kontrollierbar 6. Zwanghafter Konsum trotz körperlicher, psychischer und sozialer Folgeprobleme („Irrationalität“) Wichtig: Das zwanghafte Bedürfnis und die Suche stehen im Vordergrund der Definition und nicht: das Erreichen eines positiven Zustandes, die Toleranzentwicklung oder die Beseitigung von Entzugserscheinungen! Arten von Abhängigkeiten: Legal Stofflich Nikotin, Alkohol, Medikamente Sucht nicht-stofflich z.B. Glücksspiel, Kaufsucht, Arbeitssucht, PC Illegal Stimulanzien (Kokain, Amphet.) Opioide (Heroin…) Halluzinogene (LSD etc.) Usw. 13.1.2. Verlauf und Prognose: In Gang gesetzt wird der Drogenkonsum durch operante Konditionierung und die Ausbildung diskriminativer Stimuli! Das Gebrauchsmuster wird durch positive und negative Verstärkung bestimmt. Negative Verstärkung: Beendigung negativer emotionaler und sozialer Situationen Positive Verstärkung: Entspannung, gehobene Stimmung Körperliche Abhängigkeit: Stoffwechselmangel bei Fehlen der Droge Entzugserscheinungen Diskriminative Stimuli für erneuten Drogenkonsum 121 Verschiebungen im Verhaltensrepertoire: Verhalten wird vom Erwerb und Konsum der Droge kontrolliert Beseitigung der Entzugssymptome rückt in den Mittelpunkt! In Gang gehalten wird eine Sucht dadurch, dass der Anreiz der Substanz kontinuierlich erhöht- und ihr Konsum zunehmend automatisiert wird! Dabei spielen sowohl psychologische, als auch biologische und soziale Mechanismen eine Rolle. Unterschieden werden kann dementsprechend zwischen… 1. Einem intrapsychischen Teufelskreis Beeinträchtigte Selbstwahrnehmung, unrealistische Wirkungserwartung, Copingdefizite, suchtbezogene Grundannahmen, Abstinenzverletzungssyndrom 2. Einem neurobiologischen Teufelskreis 1) Toleranzentwicklung, 2) Endorphinmangel, 3) Suchtgedächtnis 3. Einem psychosozialen Teufelskreis Gesellschaftliches Klima, veränderte Familieninteraktion, soziale Folgeschäden, Mangel an Alternativressourcen Schutz- und Risikofaktoren der Suchtentwicklung: Schutzfaktoren: starker und positiver Familienzusammenhalt, elterliche Kontrolle und Konsequenz, Erfolg in der Schule, Bindung an Institutionen (wie Schule oder Kirche), negative Einstellung gegenüber Drogen im Umfeld (Familie, Peers, Gesellschaft etc.) Risikofaktoren: geringer Familienzusammenhalt, mangelnde elterliche Kontrolle und Konsequenz etc. etc. Rückfallmodelle: Dass es so häufig zu Rückfällen kommt (nach 2 Jahren: 50-70%!), kann folgendermaßen erklärt werden: 1) Lerntheoretisches Modell: Konditionierte Auslöser (= diskriminative Stimuli) als Ursache (klassische Konditionierung) 2) Kognitives Modell: Fehlende Bewältigungsstrategien in kritischen Lebenssituationen und negative Einschätzung der eigenen Bewältigungsfähigkeit 3) Integratives Modell: Es gibt klassisch konditionierte Auslöser; sie führen jedoch nicht automatisch zu einem Rückfall, sondern nur im Zusammenspiel mit kognitiven Mechanismen! 13.1.3. Epidemiologie: Rauchen: Ca. 1/3 der Erwachsenenbevölkerung (~16 Mio.) 140.000 Leute sterben jährlich an den direkten Folgen; 3.300 an den Folgen des Passivrauchens! Volkswirtschaftliche Kosten: 18.8 Mio. Der Anteil jugendlicher Raucher (12-17 Jahre) ist seit 2001 von rund 27% auf 14,7% zurückgegangen! Alkohol: Ca. 9,4 Mio. legen einen riskanten Alkoholkonsum an den Tag, 1,3 Mio. sind abhängig! 70.000 sterben pro Jahr an den Folgen Durchschnittlicher Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland: 10 Liter reinen Alkohols pro Jahr Damit gehört Deutschland im internationalen Vergleich zur Spitzengruppe (oberes Zehntel!) Der Anzahl an Akloholvergiftungen unter 10- bis 15-jährigen (insbes. Mädchen!) ist seit 2001 dramatisch angestiegen (um 143% auf rund 23.000!) Medikamente (v.a. Benzodiazepine): 1,4 bis 1,9 Mio. Abhängige, davon 70% Frauen! 122 Illegale Drogen: Konsum ist seit 2004 um 3% angestiegen 2008: rund 1.500 Drogentote (Anstieg um knapp 4% gegenüber dem Vorjahr) Die am häufigsten konsumierte illegale Droge ist Cannabis: Die Prävalenz ist zwar leicht rückläufig, liegt aber bei 12- bis 25-Jährigen nach wie vor bei knapp 30%! Glückspielsucht: 55% der Bevölkerung hat mindestens ein Mal gespielt (EinjahresPrävalenz), 0,2% sind süchtig! Online- und Computersucht: 3-7% der Internetnutzer sind „onlinesüchtig“ 13.1.4. Neurobiologische Grundlagen der Sucht Die für die Sucht wichtigste Gehirnregion ist das mesolimbische System (das auch als „Belohnungszentrum“ bezeichnet wird) - der entscheidende Neurotransmitter ist Dopamin. Entdeckt wurde das „Belohnungszentrum“ von Olds und Milner: Ratten, die die Möglichkeit bekommen, das mesolimbische System zu stimulieren (intrakranielle Selbststimulation) bzw. sich Drogen in dieses zu applizieren (Substanzselbstapplikation), tun dies bis zur Erschöpfung! Die wichtigsten Komponenten des mesolimbischen Systems sind: Das ventrale tegmentale Areal (VTA) im Mesencephalon: Ausgangpunkt der dopaminergen Bahnen zum Präfrontalkortex (mesokortikales System) und zum Nucleus Accumbens, zur Amygdala und zum Hippocampus (mesolimbisches System) Die Amgydala: Angst und Aggression, Konditionierung Hippocampus: Gedächtniskonsolidierung und –koordinierung Nucleus Accumbens (im Vorderhin, genauer: im Striatum gelegen): „Lustzentrum“ (Bei Belohnung und Freude aktiv) Die wichtigste Bahn ist die zwischen dem ventralen tegmentalen Areal und dem Nucleus Accumbens. Wirkorte verschiedener Drogen: Alkohol und Canabis wirken v.a. im ventralen tegmentalen Areal und führen dort zu einer Erhöhung der dopaminergen Aktivität. Nikotin erhöht die cholinerge Aktivierung des ventralen tegmentalen Areals, wirkt aber auch direkt im Nucleus accumbens. Amphetamin, Kokain und Heroin wirken direkt im Nucleus accumbens! Barbiturate, Benuodiazepine, Morphium und Heroin reduzieren die vom ventralen Pallidum ausgehende GABAerge Hemmung der dopaminergen Neuronen im ventralen tegmentalen Areal! Kurz: Sämtliche Drogen haben direkten oder indirekten Einfluss auf die dopaminerge Aktivität des mesolimbischen Systems; letztere bestimmt den Anreizwert der Drogen und der mit ihnen assoziierten Reize! Das I-RISA Modell (Impaired Response Inhibition and Salience Attribution - Modell) betont, dass neben dem mesolimbischen System auch frontale Gehirnregionen, und zwar insbesondere der Orbitofrontalkortex und das anteriore Cingulum, an der Aufrechterhaltung von Süchten beteiligt sind. Empirischer Beleg: Neuro-Imaging-Studien zeigen, dass der Orbitofrontalkortex und das anteriore Cingulum während des Rausches (intoxication), dem Craving und beim Konsum („bingeing“) eine erhöhte Aktivität aufweisen, nicht aber während des Entzugs. 123 Vermutet wird eine Wechselwirkung zwischen dem mesolimbischen und dem mesokortikalen Dopaminsystem: Mesolimbisches System: - Hippocampus: Suchtgedächtnis - Amygdala: löst konditionierte Reaktionen aus - Nucleus Accumbens: Verstärkung Mesokortikales System: - Anteriores Cingulum: Bewertung - Orbitofrontaler Kortex: Salience Attribution (zusammen mt Hippocampus und Amygdala); Unterdrückung konkurrierender Infos und Reaktionen Kurz: Frontale Gehirnregionen, genauer: der Orbitofrontalkortex und das anteriore Cingulum, sind für die Überbewertung drogenbezogener Verstärker, die Abwertung alternativer Verstärker und die Defizite bei der inhibitorischen Kontrolle über konditionierten Suchtreaktionen (Craving, Bingeing) verantwortlich! Anreizmotivation („incentive motivation“): Der Anreiz eines Suchtstoffs nimmt mit der Dauer des Konsums zunehmend zu, während die durch den Konsum ausgelöste Freude und Euphorie mit der Dauer des Konsums abnimmt. Übergang vom „Mögen“ (Freude bzw. positive Verstärkung) zum „Möchten“ (Verlangen bzw. negative Verstärkung) Der Anstieg des Anreizes ist durch folgende Prozesse bedingt: 1. Operante Konditionierung: Die positiven Konsequenzen des Drogenkonsums führen zur Erregung der neuronalen Substrate für positive Verstärkung (Nucleus accumbens etc.) 2. Klassische Konditionierung: Die positiven Empfindungen werden mit dem Ort, dem Objekt, der Handlung oder dem Anlass des Konsums assoziiert! Auf diese Weise entstehen diskriminative Hinweisreize, die das Craving bzw. den Drogenkonsum auslösen! 3. Anreizhervorhebung (incentive salience): Die auf diese Weise mit positiver Verstärkung assoziierten Reize werden aus den übrigen Reizen hervorgehoben. Klassische Konditionierung spielt bei Abhängigkeit eine doppelte Rolle: 1) Wird Sucht u.a. durch klassische Konditionierung aufrecht erhalten, sofern das Craving und der Konsum durch diskriminative Hinweisreize getriggert werden! Vietnamveteranen, die im Krieg süchtig geworden sind, hatten wesentlich seltener Rückfälle als normale Klinikpatienten. 2) Ist die sog. Kompensatorische klassische Konditionierung ein wichtiger Faktor bei der Toleranzentwicklung: Bei häufigem Konsum lernt der Körper, in welchen Situationen er mit einer Intoxikation zu rechnen hat und leitet entsprechend schon bevor es losgeht, kompensatorische Gegenmaßnahmen ein! Ratten, denen man regelmäßig eine geringe Menge Heroin verabreichte, überlebten es (zumindest in knapp 70% der Fälle), wenn man ihnen am Ende des Experiments in derselben Umgebung (Käfig oder Versuchsraum) eine an sich tödliche Heroin-Dosis verabreichte. Ratten, die die hohe Dosis in einer anderen Umgebung appliziert bekamen, starben im Vergleich dazu wesentlich häufiger (Todesrate: 64,3%) und Ratten, die vorher keinen Kontakt zu Heroin hatten, fast immer (Todesrate: 96,4%). 124 (Körperliche) Abhängigkeit ist v.a. durch 2 Phänomene gekennzeichnet: 1) Toleranzentwicklung (und Entzugssymptomatik), 2) dauerhafte Anreiz-Sensitivierung Die Toleranzentwicklung und damit einhergehend die Entzugssymptomatik sind reversibler Prozesse, die u.a. durch eine reduzierte D2-Rezeptordichte bedingt sind: Belohnungssystem gewöhnt sich an DA-Überschuss Es kommt zu einer homöostatischen Gegenreaktion, indem die natürliche Dopaminaktivierung und –sensitivität verringert wird. Um den gleichen Effekt zu erzielen, ist daher eine Dosissteigerung notwendig (=> Teufelskreislauf) Abhängigkeit und Entzugssymptomatik: Körperliches und seelisches Unwohlsein, wenn die Substanz fehlt! Die Anreiz-Sensitivierung ist ein irreversibler Prozess, der möglicherweise durch eine erhöhe Anzahl dendritischer Dornen bei den Zellen im Nucleus Accumbens bedingt ist: Das Suchtgedächtnis: manifestiert sich in einer subkortikalen (im Belohnungszentrum angesiedelten) Hypersensibilität gegenüber substanzbezogenen Stimuli („Cue Reactivity“) => kurz: das Dopaminsystem reagiert stärker auf suchtbezogene Reize! Craving: Unwiderstehliches Verlangen schon bei kleinsten Auslösern! Biochemische Grundlage: Transkriptionsfaktoren sind Proteine, die im Zellkern die Genexpression (z.B. zum Auf- und Abbau von Rezeptoren) regulieren. Die biochemischen Folgen dauerhaften Drogenkonsums werden v.a. durch zwei „Transkriptionsfaktoren“ im Nucleus accumbens bedingt: CREB und delta-FosB. Das Protein CREB leitet bei dauerhafter dopaminerger Überaktivierung die homöostatische Gegenregulation ein. Indem es die Produktion bestimmter Proteine anregt, hemmt es beispielsweise es die dopaminerge Aktivität des VTA und reduziert die Anzahl der D2-Rezeptoren. Aktiviert wird CREB durch den Botenstoff cAMP, dessen Konzentration seinerseits von der Anzahl der eingehenden dopaminergen Signale abhängt. - Sofern das Protein CREB die dopaminerge Aktivität während der Zeit des Drogenkonsums drosselt, ist es für die Toleranzentwicklung und die akute Entzugssymptomatik verantwortlich; schon nach ein paar Tagen Abstinenz wird CREB jedoch wieder deaktiviert; es ist somit nicht dafür verantwortlich, dass Süchtige auch nach Jahren noch rückfallgefährdet sind! Das Protein delta-FosB akkumuliert im Gegensatz zu CREB recht langsam, bleibt dafür aber wesentlich länger bestehen. Es entsteht bei dopaminerger Aktivierung des Nucleus accumbens (also nicht nur bei Drogeneinnahme, sondern auch bei nicht-stofflichem Vergnügen: z.B. Laufrad) und führt letztlich zu einer chronisch erhöhten Sensitivität gegenüber suchtrelevanten Hinweisreizen („incentives“). - Kurz: Delta-FosB löst strukturelle Veränderungen (Ausbildung dendritischer Dornen?!) aus, die für die lebenslange Rückfallgefahr verantwortlich sein könnten: es führt zu dauerhafter Sensitivierung und Craving! Anhang: Zwischen der Aktivierung des ventralen Putamens (ausgelöst durch Alkoholstimuli) und dem nachfolgenden Alkoholkonsum besteht ein positiver Zusammenhang! 125 Fazit: Neurobiologische Erklärungen allein greifen zu kurz (Medikament gegen Sucht) – stattdessen ist Sucht nur durch Berücksichtigung verschiedener Ebenen erklärbar! V.a. bei der Suchtentstehung scheinen soziale Faktoren vielfach eine größere Rolle zu spielen als neurobiologische Faktoren. Aufrechterhalten wird Sucht durch „erlernte Motivation“! Anreizhervorhebung (Sensitivierung) Übergang vom „Mögen“ zum „Möchten“ Drogenkonsum wird auch ohne hedonische Qualität aufrechterhalten! 13.1.5. Behandlung Interventionsprinzipien: Motivationspsychologische Niederschwelligkeit Keine konfrontative Grundhaltung, sondern Verständnis Ziel muss es sein, möglichst viele Betroffene möglichst früh in ihrer Suchtentwicklung zu erreichen Harm Reduction Die Sicherung des Überlebens und die Verhinderung bzw. Behandlung schwerer Folge- und Begleitschäden haben Vorrang! Beachtung subcortikaler Prozesse und eingeschränkter Willensfreiheit Ein gezieltes Training zur Überwindung des Suchtreflexes ist erforderlich Außerdem müssen Bewältigungsstrategien für Rückfallsituationen vermittelt werden Zukunftsorientierung der Behandlung Bedingungen im Anschluss an die Behandlung sind entscheidend (Abstinenzentwicklung); nicht zuletzt deshalb ist es sinnvoll, die Bezugspersonen in die Therapie mit einzubeziehen. Ob eine stationäre oder eher eine ambulante bzw. teilstationäre Behandlung vorzuziehen ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Beides hat vor- und Nachteile. Stationäre Behandlung: ermöglicht eine intensivere Therapie und bietet eine stärkere Entlastung von Alltagsproblemen! Sie ist indiziert: a) bei behandlungsbedürftigen psychischen Störungen (z.B. Delir oder Psychose), b) wenn der Patient schon mehrere Therapien abgebrochen hat bzw. wiederholt rückfällig wurde und c) kein soziales Stützsystem vorhanden ist. Ambulante/teilstationäre Behandlung: ist billiger und ermöglicht eine leichtere Einbeziehung von Bezugspersonen Sie ist indiziert: a) wenn der Patient nicht weit weg wohnt, b) ein soziales Stützsystem vorhanden ist, und c) davon auszugehen ist, dass es ungünstig wäre, ihn aus der Familie oder dem Beruf herauszureißen! Ansatzpunkte für die Therapie sind: Körperliche Suchtmechanismen Psychische Standhaftigkeit gegenüber den betreffenden Drogen und Versuchungssituationen Soziale Stabilisierung Die wichtigsten Behandlungskomponenten sind: Entzugsbehandlung: unter ärztlicher Aufsicht, meist stationär und mit medikamentöser Begleitung Entwöhnungsbehandlung: Aufbau einer stabilen Abstinenz Nachsorge: weitere Unterstützung, wichtig v.a. im ersten Jahr der Abstinenz (Selbsthilfegruppe, ambulante Weiterbehandlu 126 13.2. Medikamentenabhängigkeit 13.2.1. Allgemeines Medikamentenabhängigkeit ist die vielleicht unauffälligste Sucht von allen, sollte aber gerade deswegen nicht unterschätzt werden! Epidemiologie: 1,4 bis 1,9 Mio. Abhängige, davon 70% Frauen (s.o.)! Lebenszeitprävalenz (18-59): 2,9%! Am stärksten betroffen ist die Altersgruppe zwischen 50 und 59! Nur ca. 2000 Fälle pro Jahr werden behandelt! Am häufigsten (75%!) ist die Abhängigkeit von Benzodiazepinen (als Schlafund Beruhigungsmittel), außerdem: andere Schlaf- und Beruhigungsmittel, Schmerzmittel, Anregungsmittel und Appetitzügler Hohe Kormorbidität: Am häufigsten sind Angststörungen, Alkoholmissbrauch und Schlafstörungen; darüber hinaus: chronische Schmerzen (sind wie etwa bei einem Tumor unerträglich, ist natürlich kein Entzug inmdiziert!) Ursachen für Medikamentenabhängigkeit: Konsum zu Rauschzwecken: gezielter Einsatz wegen des psychotropen Effektes Iatrogener (durch den ärztliche Behandlung hervorgerufener) Anstoß: Aufgrund körperlicher oder psychischer Befindlichkeitsstörungen (Nervosität, Schmerzen, Ängste etc.) werden Medikamente verschrieben, die dann nicht mehr abgesetzt werden! Konsum gleichbleibend: Niedrigdosisabhängigkeit Konsum steigend: Hochdosisabhängigkeit Wirkweise von Sedativa: Barbiturate: Blockieren generell die Neurotransmission im Gehirn Dämpfen die Formatio Reticularis Dämpfen die Atmung (und können daher zu absichtlicher oder unbeabsichtigter Selbsttötung führen) Benzodiazepine: Verstärken die hemmende Wirkung des GABAergen Systems Hemmung v.a. im limbischen System (anxiolytische Wirkung) Folgen: Endogene hemmende Substanzen werden reduziert Rezeptorsensibilität und –dichte werden kompensatorisch erhöht Modelle der Medikamentenabhängigkeit: Soziokulturelle Faktoren Verordnungsgewohnheiten Akzeptanz von Medikamenteneinnahme bei psychischen Problemen Persönlichkeit So etwas wie eine Suchtpersönlichkeit konnte bisher nicht nachgewiesen werden! Lernerfahrung Linderung aversiver Zustände (negative Verstärkung) Direkte Wirkung auf Belohnungszentren Genetische Faktoren Ergebnisse bisher nicht schlüssig 127 13.2.2. Therapie Entzug (Dauer: ca. 1 Jahr; Kernsymptom sind Affektstörungen) Sollte graduiert erfolgen (die erste Reduktion sollte also nicht gleich auf eine subtherapeutische Dosis abzielen) Bei Mischabhängigkeiten ist stationärer Entzug indiziert! Vermittlung alternativer Bewältigungstechniken Symptom-management Bewältigungsstrategien im Umgang mit Entzgsbeschwerden Vermittlung von Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (Umgang mit Stresssituationen etc.) Angstbewältigungstraining Rückfallprophylaxe Nach Entzug Konzentration auf die Probleme, die der Abhängigkeit zugrunde liegen „gefährliche Situationen“ (Tagebuch) Ziel: lebenslange Abstinenz! 128 14. ADHS 14.1. Darstellung des Störungsbildes 14.1.1. Diagnostische Kriterien Definition: ADHS äußert sich in häufiger Unaufmerksamkeit, übermäßiger motorischer Aktivität und erhöhter Impulsivität. Ob die besagten Merkmale tatsächlich störungsspezifisch sind oder sich noch im Rahmen des „Normalen“ bewegen, hängt dabei vom Entwicklungsstand bzw. Alter des jeweiligen Kindes ab. Diagnostische nach dem DSM-IV: Das DSM-IV unterscheidet zwischen 3 Arten der „Aufmerksamkeits/Hyperaktivitätsstörung“: 1. Einem vorwiegend unaufmerksamen Typus 2. Einem vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Typus 3. Einem Mischtypus Dem entspricht die Unterscheidung zwischen 2 Arten von Symptomen, nämlich a) Symptomen der Unaufmerksamkeit und b) Symptomen von Hyperaktivität und Impulsivität. Für eine Diagnose müssen über einen Zeitraum von 6 Monaten mindestens 6 Symptome aus einer der beiden Gruppen vorhanden gewesen und in mehreren Situationen (Schule, Familie etc.) aufgetreten sein. Zu den Symptomen der Unaufmerksamkeit gehören u.a.: Nichtbeachten von Einzelheiten oder Flüchtigkeitsfehler Probleme mit der Daueraufmerksamkeit (sprich: damit, sich länger auf eine Sache zu konzentrieren) Ablenkbarkeit Vergesslichkeit Häufiger Verlust von Dingen Organisationsschwierigkeiten Probleme beim Zuhören Zu den Symptomen der Hyperaktivität und Impulsivität gehören u.a.: Ruhelosigkeit / Getriebenheit …redet übermäßig Hyperaktivität …zappelt oder rutscht auf dem Stuhl herum …steht oft auf, wenn Sitzenbleiben erwartet wird …platzt mit Antworten zu früh heraus Impulsivität …kann kaum erwarten, an die Reihe zu kommen (Ungeduld) …unterbricht und stört andere Zumindest einige dieser Symptome müssen nach dem DSM-IV schon vor dem 7. Lebensjahr aufgetreten sein; darüber hinaus müssen sie in mindestens zwei Bereichen (z.B. Schule, Familie, Peers) zu Beeinträchtigungen führen! Sonstiges: Weitere Defizite: mangelnde Selbststeuerung und Einschränkung der Informationsaufnahme und -verarbeitung! Die Schwierigkeiten zeigen sich v.a. dann, wenn Stetigkeit / Selbststeuerung / Impulskontrolle / Belohnungsaufschub verschlangt werden! 129 14.1.2. Epidemiologie, Verlauf und Prognose Epidemiologische Daten: ADHS ist einer der häufigsten Gründe, derentwegen sich Eltern an Erziehungsberatungsstellen oder schulpsychologische Dienste wenden. Die Störung ist jedoch bei weitem nicht so weit verbreitet, wie oft von Lehrern und Eltern angenommen wird! Lehrer diagnostizieren bei 16% ihrer Schüler ADHS! Die Prävalenz liegt in Deutschland bei Schulkindern zwischen 3,9 und 6 %, bei Erwachsenen bei ca. 3%! Der unaufmerksame Typ (ca. 50%) ist häufiger als der hyperaktivimpulsive- (ca. 33%) und der Mischtypus (ca. 17%) Jungen sind insgesamt häufiger betroffen als Mädchen: die diesbezüglichen Schätzungen bewegen sich zwischen 4:1 und 9:1! Verlauf: 25-50% der Kinder verlieren die Störung mit zunehmendem Alter, beim Rest bleibt sie bis ins Erwachsenenalter bestehen! Bei Erwachsenen äußert sich ADHS häufig in antisozialem Verhalten (bis hin zu einer antisozialen Persönlichkeitsstörung), Delinquenz und Drogenmissbrauch! ADHS stellt eine massive „Entwicklungsgefährdung“ dar, sofern sie in vielen Bereichen (insbesondere in der Schule und im sozialen Bereich) zu starken Beeinträchtigungen führt (s.u.)! Die wichtigsten Komorbiditäten (betreffen v.a. den hyperaktiv-impulsiven Typus): Störung des Sozialverhaltens (ca. 60%) Oppositionelles Verhalten (ca. 40%) Depressionen (ca. 27%) Lernstörungen (ca. 11%) Begleit- und Folgeprobleme: Reaktionen der Bezugspersonen Kinder werden oft nicht als krank, sondern als unerzogen, unreif oder rücksichtslos wahrgenommen Erziehungsschwierigkeiten Umgang mit Gleichaltrigen ADHS-Kinder werden von Gleichaltrigen oft gemieden! Schulleistungen Selbstbild Schlechtes Selbstbild, das häufig durch expansives Verhalten kaschiert wird 14.1.3. Diagnostik und Indikation ADHS erfordert eine multiaxiale Diagnostik: 1) Exploration der Eltern und des Kindes 2) Ermittlung der störungsspezifischen Entwicklungsgeschichte und eventueller Begleitstörungen 3) Informationen aus der Schule (z.B. über belastende Bedingungen, Erklärungen der Lehrer) einholen Lehrer vs. Eltern: stärkere Gewichtung des Elternurteils 4) (Orientierende) Intelligenzdiagnostik 5) Genauere Abklärung der schulischen Leistungsfähigkeit, wenn Leistungsprobleme (schlechte Noten etc.) vorhanden sind. 6) Neuropsychologische und körperliche Untersuchung (Seh- und Hörfähigkeit…) 130 Schwerpunkte der Störung: Mängel in der Verfügbarkeit und Anwendung von Operatoren Mängel in der Verhaltensregulation Beeinträchtigungen im strategischen Planungsverhalten Lernschwierigkeiten Sozialverhalten 14.2. Störungsmodelle 14.2.1. Biologische und psychologische Modelle Grundsätzlich gilt: Bei der Ätiologie von ADHS wird neurologischen und genetischen Faktoren i.d.R. mehr Einfluss zugeschrieben als psychologischen Faktoren. Biologische Ätiologiefaktoren: Es besteht eine genetische Prädisposition für ADHS: Die Konkordanzraten liegen bei eineiigen Zwillingen zwischen 55 und 70% und Kinder, deren Eltern ADHS haben, erkranken 8 Mal häufiger! Neurophysiologische Auffälligkeiten: Verlangsamtes Spontan-EEG: erhöhter Theta- und reduzierter Alpha- und Beta-Wellen-Anteil Reduzierte neurale Erregbarkeit: reduzierte CNV („Contingent negative variation“) während kognitiver Verarbeitung Frontale Unteraktivierung (kognitive Defizite) und subkortikale Überregung (Impulsivität) Dopaminmangelhypothese: Eine erhöhte Dichte des Dopamintransporters führt zu einem Dopaminmangel in den synaptischen Spalten! Strukturelle Veränderungen: Weniger graue und weiße Substanz in den frontalen Hirnregionen und den Basalganglien schlechtere Aufmerksamkeits- und Verhaltenssteuerung fMRI: weniger präfrontale Aktivierung (wird durch Ritalin ausgeglichen: s.u.) Psychologische Ätiologiefaktoren Chronische Konfliktsituationen und verminderter familiärer Zusammenhalt Psychopathologische Auffälligkeiten auf Seiten der Eltern (insbes. der Mutter) Modelllernen Operantes Lernen (Hyperaktivität wird mit erhöhter Aufmerksamkeit belohnt) 14.2.2. Integratives Modell nach Lauth und Schlottke Lauth und Schlottke beschreiben ADHS auf mehreren Ebenen; dabei gehen sie davon aus, dass diese Ebenen durch positive Rückkopplungsschleifen miteinander verknüpft sind: 1) Neurobiologische Grundlage des Syndroms: ist eine Störung der zentralnervösen Aktivitätsregulation. Aufgrund dieses Defizits können die Kinder ihre zentralnervöse Aktiviertheit („geistige Wachheit“) nicht oder nur unzureichend auf die Anforderungen der jeweiligen Situation ausrichten, so dass es immer wieder zu Phasen der Über- und Unteraktivierung kommt. 2) Verminderte Selbstkontrollkompetenzen (Störung des Exekutivsystems) Betroffen sind u.a. das Planungsverhalten, das Arbeitsgedächtnis und die Daueraufmerksamkeit 131 3) Beeinträchtigungen der Verhaltensregulation: Kinder führen nur unvollständige Problem- und Zielanalysen durch, prüfen selten alternative Lösungsmöglichkeiten und sind kaum dazu in der Lage, ihr Verhalten strategisch zu planen; es fehlt ihnen an metakognitivem Wissen etc. etc. 4) Verhaltensauffälligkeiten Hyperaktivität, Impulsivität, Unaufmerksamkeit 5) Reaktionen der Umwelt Fokussierung aufs Fehlverhalten, Sanktionen, Zurückweisung, soziale Isolation in der Gruppe der Peers etc. 6) Reaktive Verarbeitung beim Kind Geringes Selbstwertgefühl, geringe Frustrationstoleranz Vermeidung von misserfolgsbesetzten Anforderungssituationen Weitere Problemverschärfung (Aggressivität etc.) 14.3. Behandlung 14.3.1. Allgemeines: Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und – psychotherapie (2000): Aufklärung und Beratung der Eltern / Lehrer und des Kindes Training der Eltern / Intervention in der Familie, um die familiäre Belastung zu verringern Intervention in Kindergarten und Schule Kognitive Therapie des Kindes zur Verminderung des impulsiven und unorganisierten Verhaltens Ergänzende (!) Psychopharmakotherapie zur Verminderung der hyperkinetischen Symptome, wenn ausgeprägte situationsübergreifende Verhaltensprobleme oder krisenhafte Zuspitzungen vorliegen! 14.3.2. Medikamentöse Therapie Bei ADHS werden v.a. 2 Arten von Medikamenten verschrieben: Stimulanzien (die die dopaminerge Aktivität erhöhen) und Noradrenergica (die die noradrenerge Aktivität erhöhen). Stimulanzien: Das am häufigsten verschriebene Präparat ist Methylphenidat (Handelsnamen: Ritalin, Concerta etc.); darüber hinaus können Amphetamine verschrieben werden; Die Wirkdauer von Methylphenidat liegt bei ca. 3h (Retard: 7-12 h) Blockierung der Dopamintransporter => Erhöhung der Dopaminkonzentration => verstärkte frontale Aktivierung (fMRT); reduzierte Aktivierung in sensumotorischen Arealen Zur Wirksamkeit: Durch Stimuanzien können die Konzentrationsfähigkeit, die zielgerichtete Aktivität und das störende Verhalten der meisten Kinder (75%!) signifikant verbessert werden! Die Effektstärken liegen bei ca. 0.8! Nur ca. 25% reagieren nicht auf die Gabe von Stimulantien (sog. „NonResponder“) 132 Wichtig: Die medikamentöse Behandlung von ADHS ist eine rein symptomatische Behandlung ohne Ätiologiebezug. Warum genau die Medikamente wirken, ist nach wie vor unklar! Probleme: Rebound-Effekt: Die Probleme treten nach Absetzen der Medikamente i.d.R. wieder auf! Bei 4-10% der Kinder haben die Stimulanzien mehr oder minder starke Nebenwirkungen: Appetitverlust Schlafprobleme Wachstumsstörungen Überdosierung führt zu Krämpfen, Fieber, Zittern bis hin zum Kreislaufkollaps und Atemlähmung! Ritalin wird immer häufiger als Freizeitdroge (Wachmacher) missbraucht! Fazit: Methylphenidat sollte nur dann verschrieben werden,… a) wenn die Auffälligkeiten sehr stark ausgeprägt sind und dadurch erhebliche Probleme in der Schule und/oder der Familie auftreten, die die Entwicklung des Kindes gefährden b) wenn sich die Verhaltensauffälligkeiten durch andere Maßnahmen und Therapieformen nicht hinreichend vermindern lassen! 14.3.3. Weitere Behandlungsmethoden Neurofeedback: Zahlreiche Studien (die jedoch meist auf kleinen Stichproben basieren) zeigen, dass die ADHS-Symptomatik durch Neurofeedback (der Theta- und Betawellen oder der „Slow Cortical Potentials“) massiv verbessert werden kann. Beispiele: 8-13-Jährige bekamen für 3×2 Wochen (à 10 Sitzungen) ein Neurofeedbacktraining, bei dem es entweder darum ging, die Theta-Wellen zu unterdrücken und die Betawellen zu verstärken, oder darum, die Richtung der „Slow Cortical Potentials“ (SCPs) zu regulieren. Ergebnis: Die Kinder lernten die Hirnpotenziale zu kontrollieren und konnten das Gelernte auf den familiären und schulischen Bereich übertragen; die dadurch erzielten Verbesserungen blieben dabei bis zu 2 Jahren, mindestens aber bis 6 Monate nach dem Training bestehen. - Elternrating: signifikante Verbesserung der DSM-IV-Kriterien; Abnahme häuslicher Probleme - Lehrerrating: Verbesserung der Hyperaktivität, Impulsivität und des Sozialverhaltens - Kognitive Maße: Verbesserung der Intelligenz und der Aufmerksamkeit Metaanalyse: Neurofeedback wirkt bei 75% der Betroffenen und erzielt ähnlich positive Effekte wie medikamentöse Behandlung! Im Hinblick auf psychotherapeutische Verfahren wird allgemein zwischen kindzentrierten und familienzentrierten Ansätzen unterschieden; erstere zielen v.a. auf eine Verbesserung der Selbstregulations- und Problemlösefähigkeit der Kinder, letztere auf eine Verbesserung der familiären Interaktion! 133 14.2.4. Trainingsprogramm nach Lauth und Schlottke Allgemeines zum Programm: Selbstverständnis: Das Programm versteht sich nicht als „Kampf gegen die Symptome“ (oberflächliche Sichtweise), sondern als „Entwicklungsintervention“, die es den Kindern ermöglichen soll, eigenständig, selbstreflexiv und situationsangemessen zu handeln! Grundprinzipien: Sozial-ökologische Verankerung der Therapie (Einbeziehung der Bezugspersonen, Behandlung schulisch relevanter Inhalte etc.) Individualisierung (das Programm enthält 4 Bausteine, die je nach Kernsymptom und Ausprägung unterschiedliche kombiniert werden können) Die vier Bausteine sind: 1) Basistraining Ist v.a. dann indiziert, wenn eine Einschränkung der Verhaltensregulation und Defizite in der Verfügbarkeit und Anwendung von Operatoren vorliegen. - Einschränkung der Daueraufmerksamkeit - Mangelnde inhibitorische Kontrolle - Tendenz zu vermehrter Reizsuche Ziele: - Vermittlung handlungsrelevanten Wissens über ADHS (anhand eines Films) - Einübung notwendiger Basisfertigkeiten (genaues Zuhören, Hinschauen, Wahrgenommenes genau wiedergeben) - Ausbildung von Reaktionsverzögerungen (nachdenken, prüfen) - Steuerung des Aufmerksamkeitsverhaltens durch verbale Selbstinstruktion Trainingseinheiten: - Einüben von Basisfertigkeiten: Bilder beschreiben und nachzeichnen, Geschichten nacherzählen, Einführung der Stopp-Signalkarte - Reaktionskontrolle und –verzögerung: Einübung von Prüfprozessen mit Hilfe der Stopp-Signalkarte - Verbale Handlungsregulation: Lösung von Aufgaben (Diktattexte, geometrische Figuren) - Umgehen mit Ablenkung: Zuordnungsaufgaben Aufbau der Trainingseinheiten und verwendete Methoden: - Einführung (in das Thema und Festlegung der Verstärkerkontingenzen: Token-System) - Modellierung des erwünschten Verhaltens (durch den Therapeuten) - Übungsphase (Kinder versuchen analoge Aufgabe selbständig zu lösen) - Spielerischer Ausklang (Spiel, in dem das gelernte Verhalten verlangt wird) 2) Strategietraining: Ist v.a. dann indiziert, wenn Defizite in der Verhaltensorganisation und im strategischen Planungsverhalten vorliegen - Kein planvolles Vorgehen - Mangelnde Beherrschung übergeordneter Strategien 134 Ziele: - Störungswissen anhand eines Films Erkennung von Zielen und Merkmalen der Problem- und Aufgabensituation - Vorausschauende Handlungsplanung unter Verwendung von Problemlösestrategien - Verwendung von Selbstinstruktionen zur Verhaltenssteuerung - Erwerb von Strategien für den Umgang mit Ablenkung, Fehlern und Frustrationen Trainingseinheiten - Anfangs werden v.a. Zuordnungs- und Reihenbildungsaufgaben bearbeitet (z.B. anhand von Bildergeschichten), abschließend werden die dabei erworbenen Strategien auf schulische Inhalte (Diktattexte, Gedichte lernen, Schulbuchtexte) übertragen! Therapeutische Techniken - Operante Verstärkung (Token-System) - Kognitives Modellieren - Selbstinstruktionstraining („Halt! Stopp! Überprüfen!“) - Visualisierung (Vermittlung von Problemlösestrategien anhand von Signalkarten) - Generalisierung (durch die Bearbeitung unterschiedlicher, auch schulischer Aufgabentypen) 3) Wissensvermittlung Ist indiziert, wenn keine gravierenden Aufmerksamkeitsbeeinträchtigungen mehr bestehen, aber nach wie vor Schul- und Lernprobleme bestehen Ziel: Vermittlung von Lernstrategien und Transfer auf schulische Aufgaben 4) Vermittlung sozialer Kompetenzen Ist indiziert bei Störungen des Sozialverhaltens (trotziges, oppositionelles und z.T. aggressives Verhalten) Ziele: - Einübung von Reaktionsverzögerung in sozialen Situationen - Emotionen anderer erkennen lernen - Komplexe soziale Situationen erkennen und bewerten lernen - Perspektivenübernahme und Rollenwechsel - Alternatives Verhalten entwickeln und im Rollenspiel erproben - Erprobung des gelernten Verhaltens im Alltag Ergänzt werden die verschiedenen Bausteine durch Elternanleitung und die Zusammenarbeit mit Lehrern und Ärzten! Inhalte und Ziele der Elternanleitung: Infos zur Diagnose und Therapie Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung (durch prozessorientiertes Helfen) Aktuelle und strukturelle Belastung reduzieren Inhalte der Lehrerarbeit: Infos über ADHS und Beratung Einführung von Token-Programmen und eventuell speziellen Fördergruppen Häufige Probleme bei der Therapie: Provokation und Aggression (evtl. Einzelsetting besser als Gruppensetting) Unlust und Langeweile (=> kurzfristiger Aktivitätswechsel) 135 Unzureichende Therapiefortschritte Trainingseinheiten) (=> Wiederholung einzelner 14.2.5. Wirksamkeit Standardtherapie (unspezifisch, meist mit Einsatz von Medikamenten) und Verhaltenstherapie sind in etwa gleich wirksam: d = 0,9 - 1,3 Kölner Multimodalen Interventionsstudie (COMIS): Durch VT können hyperkinetische, aggressive und emotionale Auffälligkeiten signifikant reduziert werden, wobei die gefundenen Effekte über 18 Monate hinweg stabil sind. Rund 60% zeigen nach der Therapie nur noch minimale Verhaltensauffälligkeiten in der Schule und zuhause; etwa 30% benötigen zusätzlich eine medikamentöse Behandlung! Medikamentöse Behandlung mit Beratung und eine kombinierte Therapie sind noch wirksamer: d = 1,5 - 1,8 Fazit: Die Methode der Wahl ist eine Kombinationsbehandlung, da a) eine geringere Dosierung benötigt wird und b) neben der Reduktion der Symptomatik weitere positive Effekte (z.B. Leistungsverbesserung) erzielt werden! 136 15. Essstörungen 15.1. Allgemeines 15.1.1. Darstellung des Störungsbildes Drei Hauptarten von Essstörungen lassen sich unterscheiden: 1) „Anorexia nervosa“ (= Magersucht): Essstörung, bei der der Betroffene sich weigert, ein normales Gewicht zu halten, starke Angst vor Gewichtszunahme und eine so gestörte Körperwahrnehmung hat, dass er sich noch immer zu dick fühlt, selbst wenn er abgemagert ist. Unterschieden wird im DSM-IV zwischen einem Binge-Eating/Purgingund einem restriktivem Typus! 2) „Blulimia nervosa“ (=Bulimie): Essstörung, bei der der Betroffene Heißhungeranfälle erleidet und danach Ausgleichsmaßnahmen wie Erbrechen, Fasten oder übermäßige körperliche Betätigung ergreift, um eine Gewichtszunahme zu verhindern. Unterschieden wird im DSM IV zwischen einem „Purging-“ und einem „Non-Purging“-Typus! 3) „Binge-Eating-Disorder“: Essstörung, die durch unkontrollierbare Fressattacken gekennzeichnet ist, über die der Betroffene verzweifelt ist. Es kommt aber weder zu Gewichtsverlust (Magersucht), noch zu Gegenmaßnahmen (Bulimie) Fällt in der ICD-10 (und im DSM-IV) noch unter die „Nicht näher bezeichneten Essstörungen“, ist also noch keine formale Diagnose; wird aber zunehmend erforscht, wobei sich die Hinweise mehren, dass es sich um ein eigenständiges Störungsbild handelt. Epidemiologie und Verlauf: Die Prävalenz ist im Vergleich zu vielen anderen psychischen Störungen (etwa Depression oder Angststörungen) recht gering: Sie liegt über alle Essstörungen etwa bei 1%! Das Geschlechtsverhältnis liegt für AN und BN bei 10 bzw. 11 : 1! Bei der BED ist das Verhältnis ausgeglichener! In den meisten Fällen werden Essstörungen, insbes. BN, durch Diäten eingeleitet. Häufig ändert sich die Art der Essstörung im Verlauf der Krankengeschichte (1/4 der BN-Patienten hatte vorher AN) => Der Endpunkt der Entwicklung ist meist eine nicht näher bezeichnete Essstörung! 15.1.2. Ausgewählte Ätiologiefaktoren Geringer Selbstwert Der Selbstwert von Essgestörten ist generell geringer als der von Gesunden; was den impliziten und den körperbezogenen Selbstwert betrifft, zeigt sich jedoch zumindest bei BN-Patienten ein umgekehrtes Muster! 137 Perfektionismus: Im Hinblick auf Perfektionismus kann zwischen 2 Dimensionen bzw. Faktoren unterschieden werden: 1. „Maladaptive Perfectionism“: ist nicht selbstbestimmt, sondern hängt von den elterlichen und gesellschaftlichen Erwartungen ab; äußert sich in Sorgen bezüglich dem eigenen Handeln und „concern over mistakes“ 2. „Achievement Striving Perfectionism“: wird auch selbst-orientierter Perfektionismus genannt, zeichnet sich durch ein hohe persönliche Standards und Organisation aus! AN-Patienten haben allgemein höhere Werte auf beiden PerfektionismusSkalen, auch nach einer Remission verändern sich diese Werte kaum. Bei BN und BED-Patienten ist das Bild etwas inkonsistenter, nach Remission ist bei BN-Patienten i.d.R. ein Anstieg der Werte zu beobachten! Selbstkritik: Patienten mit Essstörung haben höhere Werte auf der Skala „Selbstkritik“ als Gesunde und andere Gestörte – und zwar selbst dann, wenn die Depressivität kontrolliert wird. Selbstkritik korreliert hoch negativ mit dem Selbstwert und positiv mit Depressivität und der Überbewertung von Figur und Gewicht! Der Einfluss des Perfektionismus auf Essstörungen scheint durch die Variable „Selbst-Kritik“ bedingt zu sein. Nimmt man sie nämlich heraus, besteht zwischen Perfektionismus und der Überbewertung von Gewicht und Figur kein Zusammenhang mehr! Wahrgenommene Kontrolle bzw. Kontrollverlust Kontrollverlust in anderen Bereichen wird durch Kontrolle über das Essverhalten kompensiert! Kontrollverlust als zentrales Merkmal von Fressattacken (Disinhibition-Effekt)! Bindungstypen: Essgestörte haben häufig einen unsicher-vermeidenden oder unsicherambivalenten Bindungsstil (gemessen mit dem AAI: „Adult Attachment Interview“)! Verstärkung: Folgende Aspekte der Krankheit werden von Essgestörten (insbes. ANPatientinnen) als verstärkend erlebt: die wahrgenommene Selbstkontrolle (73%); die Tatsache, wegen der Schlankheit wahrgenommen zu werden (39%); Kontrolle über andere (35%); Befreiung von sexuellen Belangen (31%), moralische Erhebung (27%); Ausbleiben der Menstruation (24%) Probleme bei Aufmerksamkeitsverschiebung: Essgestörte zeigen sowohl auf der kognitiven als auch auf der Handlungsebene erhöhte Inflexibilität und Rigidität (das zeigt sich z.B. beim WCST) Die verzögerte Aufmerksamkeitsverschiebung bleibt dabei auch nach der Remission bestehen! Dysfunktionale Annahmen: äußern sich v.a. im Perfektionismus und der Überbewertung der Kontrolle über das Essen, die eigene Figur und das Gewicht! 138 15.2. Behandlung 15.2.1. Kognitive Verhaltenstherapie 5 Prinzipien bzw. Grundannahmen: 1) Der Selbstwert der Patienten wird durch ihre Gewicht und ihre Figur bestimmt! 2) Durch diese Überbewertung des Gewichts und der Figur wird ein ansonsten geringer Selbstwert kompensiert! 3) Die Nahrungsaufnahme bzw. –verweigerung hat eine Funktion bei der Emotionsregulation und Stressverarbeitung 4) Die Symptome sind genauso wichtig wie die ihnen zugrundeliegenden Probleme! 5) Für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Essstörungen sind ist eine Vielzahl von Faktoren verantwortlich! Genetische Prädisposition, biochemische Auffälligkeiten (Serotoninmangel durch erhöhte Rezeptordichte?!); dysfunktionale Annahmen und kognitive Verzerrungen, soziokulturelle Faktoren (Schönheitsideal); diverse Verstärkungsprozesse etc. etc. Charakteristisch für die KVT (bei Essstörungen) ist: Fokussierung auf die Gegenwart Fokussierung auf die Symptome Hausaufgaben außerhalb der Sitzungen Durchschnittl. Dauer: 20 oder 40 (bei einem BMI < 17,5) Sitzungen à 50 Min. Der Ablauf einer typischen KVT: 1) Erste Stufe (4 Wochen, 8 Sitzungen) Normalisierung des Essverhalten durch verhaltenstherapeutische (Verstärkung) und kognitive Methoden (Self-Monitoring): Essensplan, Reduzierung des Wiegens und Begutachtens vor dem Spiegel Psychoedukation bezüglich der negativen Folgen der Störung 2) Zweite Stufe (8 Wochen, 8 Sitzungen Strategien um Diätverhalten zu reduzieren (Entscheidungsanalysen) Problemlöstraining und kognitive Umstrukturierung (Identifikation und Modifikation dysfunktionaler Annahmen und automatischer Gedanken) 3) Dritte Stufe (6 Wochen, 3 Sitzungen) Aufrechterhaltung der Therapieeffekte und Reduktion des Rückfallrisikos Empirische Basis für den kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansatz: Kognitive Verzerrungen sind nachgewiesen: z.B. Aufmerksamkeitsbias zugunsten körper- und essensbezogener Stimuli bei AN und BN Im Fall von AN ist der Bias bei körperbezogenen Stimuli deutlich stärker als bei essensbezogenen, bei BN nicht! Restriktionshypothese (bei BN): V.a. BN wird meistens durch eine Diät eingeleitet (Disinhibition-Effekt)! Durch eine Diät können Symptome von Essstörungen auch bei Gesunden induziert werden (Vgl. z.B. die Minnesota-Starvation-Study von Keys). 15.2.2. Interpersonelle Therapie Allgemeines und Charakteristisches zur IPT (bei Essstörungen): BN und AN als Krankheit, für die der Patient nichts kann! Fokussierung auf die interpersonalen Beziehungen des Klienten, da diesen eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung 139 zugeschrieben wird (zwischenmenschliche Probleme geringer Selbstwert, Dysphorie etc. …)! Orientierung an Rogers Prinzipien der Gesprächstherapie (Wertschätzung, Empathie, Non-Direktivität etc.) Dauer: 4-6 Monate wöchentliche Sitzungen à 50 min. Die IPT bei Essstörungen unterteilt sich in 3 Phasen: 1) Initiale Phase (4-5 Sitzungen) Diagnose und Anamnese: anamnestische Gewichtskurve Definition wichtiger Problemfelder: Trauer, Rollenübergänge, Rollenkonflikte, zwischenmenschliche „Defizite“ 2) Mittlere Phase (8-10 Sitzungen) Behandlung wichtiger Problemfelder: z.B. indem die für den Patienten typischen Beziehungsmuster aufgearbeitet werden, indem im Fall von Rollenübergängen der Umgang mit Verlust und Abschied behandelt wird etc. etc. 3) Beendigungsphase (4-5 Sitzungen) Die Auflösung der Therapeuten-Klienten-Verhältnisses wird explizit thematisiert! Rückfallprophylaxe: Warnsignale erkennen, Notfallpläne entwickeln etc. 15.2.3. Medikamentöse Behandlung Mögliche Medikamente: Bei AN: Antidepressiva (v.a. SSRIs wie Fluoxetin), antipsychotische Agenten (z.B. Risperidon), Zinkpräparate Bei BN: Antidepressiva (v.a. SSRIs wie Fluoxetin), Opiat-Antagonisten Bei BED: Antidepressiva und antiepileptische Medikamente Empirische Basis: Es wird angenommen, dass Essstörungen mit einem Mangel an endogenen Opiaten und Serotonin einhergehen; erstere werden bei Hunger ausgeschüttet, letzteres hat eine wichtige Rolle bei der Regulation des Essverhaltens, sofern es das Sättigungsgefühl bewirkt! Einzelbefunde: Die Menge an 5HT2A-Rezeptoren ist bei AN während der Krankheit normal, nach der Krankheit jedoch reduziert! Die Menge an 5HT1A-Rezeptoren ist während und nach der Krankheit erhöht, nach der Krankheit jedoch in geringerem Ausmaß! Die Serotonintransporter-Aktivität ist bei AN (bulemischer Typ) nach der Krankheit reduziert! 15.2.4. Wirksamkeit KVT: ist derzeit die wirksamste Therapieform Verhältnismäßig geringe Abbrecherquote: 20-25% Aber: 40 – 50% haben auch nach der Therapie noch Symptome! IPT: ist ähnlich wirksam wie die KVT, wirkt aber langsamer! Medikamente: sind, wenn überhaupt, nur in Kombination mit Psychotherapie zu empfehlen! Kombinationstherapie (KVT + Medikamente) hat sich als wirksamer erwiesen als KVT allein. Medikamentöse Behandlung oder IPT im Anschluss an KVT geht mit recht hohen Abbrecherquoten und geringer Abstinenz einher! 140 16. Psychotherapie bei chronischen Krankheiten 16.1. Einführung 16.1.1. Chronische Krankheiten Zu den chronischen Krankheiten gehören: Rheumatische Erkrankungen und chronische Schmerzen (s.u.) Chronisch obstruktive Lungenerkrankung [Übergewicht und Adipositas] Diabetes Mellitus Krebserkrankungen HIV und AIDS Herzkreislauferkrankungen (s.u.) Neurologische Erkrankungen (s.u.) DALYs steht für „Disability“- bzw. „Disease Adjusted Life Years“: es handelt sich dabei um die Anzahl der Lebensjahre, die durch frühzeitigen Tod und gravierende gesundheitliche Beeinträchtigung verloren gehen. WHO (2004): Die durch Krankheit verlorengegangene Lebenszeit beträgt für die gesamte Menschheit und über alle Krankheiten hinweg etwas über 1,5 Milliarden Jahre! Davon gehen rund 600 Mio. Jahre auf Kosten von Infektionskrankheiten (wie Tuberkulose oder AIDS). Über 700 Mio. Jahre verliert die Menschheit durch nichtübertragbare Krankheiten: v.a. durch kardiovaskuläre Krankheiten (ca. 150 Mio.), Verletzungen (ca. 188 Mio.) und neuropsychiatrische Krankheiten (ca. 199 Mio.), von denen wiederum Depression am meisten ins Gewicht fällt (rund 65 Mio.) Viele chronische Krankheiten sind vermeidbar! Die Vermeidbarkeit von Diabetes (Typ II) liegt beispielsweise bei über 80%, die koronarer Herzerkrankungen bei ca. 80% und die von Dickdarmkrebs und Schlaganfall bei über 70%! Die wichtigsten Risikofaktoren sind: Rauchen, Alkohol, Bewegungsmangel, eine ungesunde Ernährung, Übergewicht, Bluthochdruck und erhöhte Cholesterinwerte! Durch Verzicht auf Nikotin, Normalgewicht, 30 Minuten körperliche Bewegung pro Tag, ausreichend Folsäure (z.B. in Obst und Gemüse enthalten), weniger als 3 Mal pro Woche rotes Fleisch und weniger als 3 alkoholische Getränke pro Tag kann die Lebenserwartung um 9, 3 Jahre erhöht werden! 16.1.2. Zur Bedeutung psychischer Faktoren Wechselwirkung zwischen Körper und Geist: Psychische Probleme können zur Entstehung körperlicher Krankheiten beitragen, eine Folge körperlicher Krankheiten sein oder deren Verlauf beeinflussen! Krankheitsentstehung: Nicht nur psychosomatische, sondern auch andere psychische Störungen (wie z.B. Substanzabhängigkeit) haben physiologische Konsequenzen! Psychische Störungen führen häufig zu gesundheitsgefährdendem Verhalten (z.B. Depression zu Alkoholismus, Magersucht zu Nahrungsverweigerung etc.) „Shared underlying aetiology model“ Nebenwirkungen von Psychopharmaka (Bluthochdruck etc.) 141 Folge: Körperliche Erkrankungen, die das Gehirn direkt betreffen (z.B. Schlaganfall) Körperliche Krankheiten, deren Symptome psychisch belastend sind! Diagnose als belastendes Ereignis! Behandlungsnebenwirkungen! Einen Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben: Die Einstellung zur Krankheit Die Verhaltensweisen im Umgang mit der Krankheit (z.B. Risikoverhaltensweisen) Belastende Lebensbedingungen Psychische Begleiterscheinungen Aufgaben und Methoden psychologischer Intervention: Behandlung psychischer Störungen: Psychotherapie, Pharmakotherapie Gesundheitsförderung und Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung: Stressbewältigungsprogramme, Patientenschulungsprogramme, Entspannungstrainings, Biofeedback Therapie operant verstärkten Problemverhaltens (z.B. Rauchen): Identifizierung der wirksamen Verstärker und Änderung der Kontingenzen! Integration psychologischer und medizinischer Behandlung: Motivationale Faktoren Schaffung einer Behandlungs- und Veränderungsmotivation Schaffung von Motivation zur Befolgung medizinischer Interventionen (Medikamentenadhärenz, Blutzuckerkontrolle, Vorsorgeuntersuchungen etc.) Motivation zur Veränderung von Risikoverhaltensweisen (z.B. Rauchen, Ernährung etc.) 16.2. Herz-Kreislauf-Erkrankungen 16.2.1. Darstellung des Störungsbildes Definition: Zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören alle Erkrankungen des Herzens und des Blutkreislaufes, die nicht auf Verletzung zurückgehen. Koronare Herzerkrankung: verminderte Durchblutung und Sauerstoffversorgung des Organismus (= Ischämie) => erhöhtes Herzinfarktrisiko Herzinfarkt: Durchblutungsstörung führt dazu, dass Teile des Herzmuskels absterben Arterielle Hypertonie: Bluthochdruck Schlaganfall: Durchblutungsstörung des Gehirns führt zu Hirnschäden Epidemiologie: Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in den Industrienationen die häufigste Todesursache überhaupt! Seit 1952 hat sich die Zahl der durch HKE verursachten Todesfälle verdoppelt! Momentan stirbt jeder zweite Deutsche an den Folgen einer HKE. Etwa 1/3 aller an einem Herzinfarkt Verstorbenen sind dabei jünger als 65 Jahre! Ursache: Die meisten HKE sind durch Fettablagerungen (Schaumzellen, Plaques) an der Innenseite der Gefäßwände (Intima) bedingt (=> Verengung der Arterien = Arterosklerose) Verengung der Herzkranzgefäße koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt 142 Verengung der Gehirnarterien Schlaganfall Verengung d. peripheren Gefäßeperiphere arterielle Verschlusskrankheit Risikofaktoren für HKE sind: Sozioökonomischer Status, psychosoziale Faktoren, Stress, Bewegungsmangel, Rauchen, fettreiche Ernährung, Übergewicht, erhöhte Blutfettwerte, Bluthochdruck, Diabetes Mellitus, familiäre Vorbelastung! Die koronare Herzkrankheit: …ist eine Durchblutungsstörung der Herzkrangefäße (Koronararterien), die zu einer verminderten Sauerstoffversorgung der Herzmuskulatur (=> Herzinsuffizienz) führt! Leitsymptom ist der koronaren Herzkrankheit ist „Angina pectoris“ (Brustenge), auf Dauer führt sie meist zu einem Herzinfarkt! Behandlung: Medikamentös (Nitrate, Betablocker => entlasten die Herzmuskulatur) Koronarangiopastie (Wiederöffnung verengter Herzkranzgefäße) Bypass (Überbrückung der arteriellen Engstellen) Arterielle Hypertonie (Bluthochdruck): …liegt vor bei einem systolischen Blutdruck > 140 mmHG und einem diastolischen Blutdruck > 90 mmHG Die Prävalenz in Industrieländern liegt bei 10-20% Bluthochdruck ist neben erhöhten Blutfettwerten und Zigarettenrauchen der größte Risikofaktor für eine koronare Herzkrankheit! Mögliche Folgen: KHK, Schlaganfall, hypertensive Herzkrankheit, hypertensive Krisen, Nierenkrankheiten, Veränderungen an den Netzhautgefäßen des Auges Behandlung: Medikamente: Betablocker, Diuretika etc. Verhaltensänderung: gesunde Ernährung, Bewegung etc. Psychische Begleiterkrankungen: Bei Herz-Patienten besteht eine erhöhte Prävalenz für Depression (17-27%) und Angststörungen (26%) Eine Metanalyse von Barth zeigt, dass bei Vorliegen einer Depression die Sterbewahrscheinlichkeit bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit in den ersten 2 Jahren doppelt so hoch ist wie bei Patienten ohne Depression! 143 16.2.2. Psychotherapeutische Intervention Diagnostik: Erfasst werden müssen: Gesundheitsverhalten (Ernährung etc.) und Behandlungsadhärenz Kognitives Leistungsvermögen (Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprache…) Krankheitsverarbeitung (Freiburger Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung) in Bezug auf Emotion, Kognition und Verhalten Ärger (State-Trait-Ärger-Ausdrucksinventar) Darüber hinaus ist eine Abklärung psychischer Störungen, insbes. von Angst und Depression, notwendig (z.B. BDI)! Psychologische Interventionen bei HKE kommen in 3 Bereichen zum Tragen: 1) Gesundheitsförderung: Ziel ist der Abbau von Risikoverhalten a) Bewegungsprogramme b) Patientenschulung c) Ernährungsberatung d) Psychotherapeutische Intervention (Selbstkontrolltechniken, Zielsetzungsstrategien, Aktivitätsaufbau, Stimuluskontrolle) Ornish: Bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit, die in einer Intensivgruppe zu einer radikalen Veränderung des Lebensstils angehalten werden, weisen nach 5 Jahren eine verringerte Verengung der Arterien auf, während die Verengung bei Patienten in einer Kontrollgruppe massiv zunimmt. Carney: Psychotherapie lindert nach einem Herzinfarkt zwar die Depressionssymptomatik, hat aber keinen Einfluss auf den Genesungsverlauf. Rees: Psychotherapie und Stressreduktionstrainings bei Herzkranken verbessern zwar psychische Beeinträchtigungen, verhindern aber keinen erneuten Infarkt und haben keinen Einfluss auf die Sterblichkeit! 2) Pharmakotherapie: zur Behandlung psychischer Begleiterkrankungen Der Einsatz von Psychopharmaka ist aufgrund ihrer Neben- und Wechselwirkungen (mit anderen Medikamenten) oft problematisch: - SSRIs haben zwar weniger kardiovaskuläre Nebenwirkungen als trizyklische Antidepressiva, hemmen aber die Funktion der Blutblättchen! - Bei Johanniskraut bestehen Wechselwirkungen mit Herz-KreislaufMedikamenten 3) Psychotherapie: a) Motivationsförderung b) Gesundheitsbildung c) Erlernen von Strategien des selbständigen Lernens und Informierens d) Skills-Trainings Rehabilitationsphasen nach einem Herzinfarkt: 1. Phase: Akutversorgung (bis zu 2 Wochen) Beruhigung und Förderung optimistischen Denkens 2. Phase: Anschlussbehandlung (3-6 Wochen) 3. Rehabilitation zuhause Verantwortungsübernahme für die Krankheit 144 16.3. Neurologische Erkrankungen 16.3.1. Darstellung der Störungsbilder Verschiedene Arten neurologischer Erkrankungen: (Neurologische) Gefäßerkrankungen Sind der häufigste Grund für Pflegebedürftigkeit - Prävalenz: 600 / 100.000 - Inzindenz: 150.000 plus 15.000 Rezidivfälle Beispiele: Ischämischer Schlaganfall (bei Hirnstamminfarkt => evtl. Locked-in-Syndrom), Hirnblutungen Basalganglienerkrankungen Z.B. Morbus Parkinson (Atrophie der dopaminergen Neuronen in der Substantia nigra), Chorea Huntington Neubildungen Gehirn und Rückenmarkstumoren Anfallsleiden Epilepsie, Gesichtsneuralgie, Migräne etc. Entzündliche Erkrankungen des ZNS Bakterielle und virale Infektionen von Hirn- und Rückenmarksgewebe oder –häuten. Entmarkungskrankheiten Z.B. Multiple Sklerose Primär degenerative Erkrankungen Demenzen: Alzheimer (fortschreitende Atrophie der Großhirnrinde durch Proteinablagerungen), vaskuläre Demenzen (durch Durchblutungsstörungen bedingt) Motoneuronerkrankungen: Amyotrophe Lateralsklerose (=> Locked-inSyndrom), spinale Muskelatrophien Degenerative Kleinhirnerkrankungen: Hereditäre Ataxien Häufige psychische Begleiterscheinungen sind: Affektive Labilität, emotionale Indifferenz, Antriebsmangel, disinhibitorische Syndrome, Verwirrtheitszustände, flüchtige Wahnsymptome und Halluzinationen. Bei multipler Sklerose finden sich zwar – v.a. in frühen und mittleren Stadien der Krankheit – erhöhte Depressionswerte, allerdings sind diese nicht höher als bei anderen chronischen Erkrankungen Nach einem Schlaganfall finden sich ebenfalls erhöhte Depressionswerte, ob eine Depression auftritt hängt dabei nicht vom Krankheitsstadium ab (in allen Stadien rund 33%), wohl aber vom Ort der Läsion! Depression stellt einen Risikofaktor für Demenzerkrankungen dar: Je länger die Depressionsdauer, desto höher das Risiko, an Alzheimer zu erkranken (ein Befund, der auf gemeinsame Ursachen hindeutet!). 16.3.2. Psychotherapeutische Intervention Neurologische Erkrankungen führen häufig zu dysfunktionalen Anpassungsprozessen: Stimulusgesteuertes Problemverhalten: Demenzkranke wehren sich z.B. gegen kognitive Überlastungen, indem sie Reize abwehren (Schreien) Operant verstärktes Problemverhalten: z.B. die Vermeidung motorischer Handlungen bei Parkinson! 145 Unterschieden werden muss zwischen psychischen Störungen, die eine unmittelbare Konsequenz der Hirnschädigung darstellen, und Störungen, die auf maladaptive Bewältigungsstrategien und Anpassungsprozesse zurückgehen! Die wichtigsten diagnostischen Verfahren sind: Intelligenztest (z.B. HAWIE), Aufmerksamkeitstests (Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung), WCST, Fragebogen zum Gesundheitszustand, Wechsler Gedächtnistest! Bei der Anwendung der Fragebögen müssen die neuropsychologischen Defizite berücksichtigt werden! Therapeutische Techniken: Stimuluskontrolle (z.B. zur Vermeidung kognitiver Überforderung), Symptomtagebücher, Verstärkung erwünschten Verhaltens, Bewegungsinduktionstraining, spezifische Trainingsprogramme (z.B. Entspannungstraining, Kommunikationstraining etc.), Angehörigen-betreuung etc. Wirksamkeit: Wirksamkeit von Psychotherapie: Bei Schlaganfall und Epilepsie: kein Nachweis Bei Alzheimer und Multipler Sklerose: Verbesserung der Befindlichkeit und der kognitiven Leistungsfähigkeit Wirksamkeit von Psychopharmaka: Bei Schlaganfall haben SSRIs keine depressionslindernde Wirkung! Bei Alzheimer und Parkinson führen SSRIs zu einer Verbesserung! 146 17. Psychotherapie bei chronischen Schmerzen 17.1. Was ist Schmerz? 17.1.1. Allgemeines Definition: Schmerz ist eine unangenehme sensorische und gefühlsmäßige Erfahrung, die mit bereits eingetretenen oder drohenden Verletzungen einhergeht oder als solche empfunden wird. Kurz: Schmerz ist das, was vom Patienten als solcher empfunden wird! Ausgelöst wird Schmerz durch noxische (gewebeschädigende oder potenziell gewebeschädigende) Reize! Nozizeptoren leiten die Infos an das Hinterhorn des Rückenmarks (NMDARezeptoren; Glutamat) weiter; dort finden einerseits Reflexverschaltungen statt, die eine unmittelbare Fluchtreaktion ermöglichen, andererseits werden die Infos zum Thalamus und zum Kortex weitergeleitet. Zentrale Sensitivierung: Bei häufiger Reizung werden die Neurone im Hinterhorn zunehmend sensibler und reagieren dementsprechend stärker! Absteigende Hemmung: Durch die Freisetzung schmerzhemmender Substanzen (endogene Opioide) wird dem Schmerz entgegengewirkt (Analgesie) Sofern Schmerz ein Warnsignal ist, ist er adaptiv: Personen mit angeborener Schmerzunempfindlichkeit haben dementsprechend eine kürzere Lebenserwartung! Chronischer Schmerz hat seine adaptive Funktion jedoch verloren und gilt daher als Krankheit! Die führende Schmerzpsychologin in Deutschland ist Herta Flor (Uni Heidelberg) 17.1.2. Schmerzkomponenten Schmerz ist nicht nur Nozizeption (Schmerzleitung zum Hirn), sondern das Ergebnis vielfältiger zentralnervöser Verarbeitungsprozesse! Folgende Komponenten von Schmerz lassen sich unterscheiden: 1. Sensorisch-diskriminative Komponente: Bewusste Sinnesempfindung durch Erregung der Schmerzrezeptoren (=Nozizeptoren) im ZNS und ANS (Lokalisation, Beginn, Intensität, Ende des Schmerzes); wird hervorgerufen durch die Ausschüttung chemisch bestimmbarer Substanzen (insbes. Substanz P und Serotonin) 2. Affektiv-motivationale Komponente: Die Schmerzwahrnehmung wird als aversiv erlebt und zu vermeiden versucht 3. Vegetative Komponente: Reflektorische Reaktion des ANS (erhöhter Blutdruck, erhöhte Herzrate etc.) 4. Kognitive Komponente: Schmerzbewertung durch Vergleich mit dem LZG; beeinflusst alle anderen Komponenten! 5. Psychomotorische Reaktion: Muskuläre Reaktion (z.B. reflektorisches Zurückziehen der Hand von einer heißen Herdplatte) und andere Verhaltensäußerungen (Ausdrucksmotorik) wie Mimik, Wehklagen,... Schmerz ist vor diesem Hintergrund ein äußerst vielschichtiges Phänomen, das nicht auf seine physiologische Prozesse reduziert werden darf! Drei Ebenen können unterschieden werden: 1. Die subjektiv-psychologische Ebene: dazu zählen die affektiven und kognitiven Reaktionen des Betroffenen; diese können entweder offen 147 (Weinen, Stöhnen, Klagen etc.) oder verdeckt (Gedanken, Gefühle, Vorstellungen) sein! 2. Die motorisch-verhaltensmäßige Ebene: dazu zählen Reflexe und Ausdrucksmotorik (s.o.) 3. Die physiologisch-organische Ebene: dazu zählen die elektrischen und chemischen Übertragungsprozesse der Nozizeption Wichtig ist, dass zwischen diesen 3 Ebenen nur ein geringer Zusammenhang besteht, sprich: Vom Vorhandensein eines Schmerzindikators auf einer Ebene, kann nicht auf das Vorhandensein von Schmerzindikatoren auf den anderen Ebenen geschlossen werden! Um zu einer adäquaten Einschätzung des Problems zu kommen, müssen daher Indikatoren auf allen drei Ebenen erhoben werden! Subjektiv-psychologische Ebene: Verhältnisschätzmethoden (visuelle Analogskala); Fragebögen (z.B. der McGill-Pain-Questionnaire); Vergleich mit experimentell induziertem Schmerz Motorisch-verhaltensmäßige Ebene: Verhaltensbeobachtung Psychologisch-organische Ebene: evozierte Potenziale (EEG), Pupillendurchmesser als Maß für den Sympathikustonus; bildgebende Verfahren etc. Fazit: Die Unterscheidung zwischen psychogenem und somatogenem Schmerz geht an der Sache vorbei, da Schmerz immer auf 3 Ebenen wirkt, die ihrerseits nicht miteinander korreliert sein müssen! Personen, die an chronischen Schmerzen leiden, sollten vor diesem Hintergrund nicht psychiatrisiert werden! 17.1.3. Chronische Schmerzstörung Unterscheidung zwischen akutem Schmerz und chronischem Schmerz: Dauer Ursache Akutschmerz - Kurz - Bekannt - Meist therapierbar - Warnfunktion (s.o.) - Schonung - Behandlung der Schmerzursache - Analgetische Behandlung Behandlungziele - Schmerzfreiheit Funktion Intervention Chronischer Schmerz - Lang (Monate) - Wiederkehrend - Unbekannt - Vielschichtig - Bekannt und nicht therapierbar - Evtl. soziale Funktion - Abbau schmerzstützender Faktoren - Linderung der Schmerzen - Besserer Umgang mit dem Schmerz - Minderung der Beeinträchtigung Chronischer Schmerz begleitet oft Erkrankungen oder Verletzungen, kann aber als Schmerzsyndrom einen eigenen Krankheitswert erlangen! Ein Schmerzsyndrom liegt vor, wenn die Schmerzen über einen längeren Zeitraum (mindestens 6 Monate) anhalten, auf verschiedenen Ebenen zu Beeinträchtigungen führen (kognitiv-emotional, behavioral, sozial) und die Ursache entweder nicht bekannt oder nur schwer oder gar nicht therapierbar ist! 148 Im DSM-IV wird betont, dass chronische Schmerzstörungen mit psychischen (!) und/oder medizinischen Krankheitsfaktoren in Verbindung stehen. Epidemiologie: Die Prävalenz für chronische Schmerzen liegt in Deutschland bei 5-10%! Am häufigsten sind wiederkehrende und andauernde Kopf- oder Rückenschmerzen (mit Prävalenzraten bis zu 70%!). Komorbidität: In 30-50% gehen wiederkehrende oder anhaltende Schmerzen mit Depression einher! Kosten: Studie in der UK: Keine andere Krankheit verursacht so viele Kosten wie Rückenschmerzen (wobei der größte Teil durch indirekte Kosten, also z.B. AU-Tage, zustande kommt)! An zweiter Stelle steht die koronare Herzkrankheit. Nur ein kleiner Anteil aller Patienten ist länger als 6 Monate krank, dieser Teil verursacht jedoch die mit Abstand größten Kosten! 17.2. Entstehung und Aufrechterhaltung 17.2.1. Neuronale Veränderungen bei chronischen Schmerzen Kortikale Reorganisation: Nach Amputationen kommt es auf der kontralateralen Seite des ambutierten Glieds zu einer Reorganisation des somotasensorischen Kortex (Gyrus postcentralis). Die Repräsentationsareale von Gliedern, die neben den durch die Amputation „frei gewordenen“ Repräsentationsarealen liegen, nehmen deren Platz ein. Diese Verschiebung korreliert dabei hoch positiv mit der Intensität des Phantomschmerzes (=> neuronales Korrelat?!)! Beispiel: Nach der Amputation eines Fingers, rückt das Repräsentationsareal des Mundes an die Stelle, an der zuvor der Finger repräsentiert war. Je stärker diese Verschiebung ist, desto größer ist dabei der Phantomschmerz. Schmerzgedächtnis: Da Schmerz auf allen Ebenen des nozizeptiven Systems Gedächtnisspuren hinterlässt, kann Schmerz auch ohne Reizung der peripheren Nozizeptoren auftreten. „Zentrale Sensitivierung“: äußert sich v.a. in einer erhöhten Erregbarkeit der Neurone im Hinterhorn des Rückenmarks. Bei starker und anhaltender Aktivierung dieser Neuronen (durch die primär afferenten Fasern bzw. das durch diese ausgeschüttete Glutamat) werden (oft schon nach Minuten) strukturelle Veränderungen eingeleitet (aktivitätsabhängige Genexpression): Die Dendriten bilden Verdickungen aus, es werden mehr Rezeptoren und Ionenkanäle aufgebaut und damit die Reaktionsbereitschaft der Zelle erhöht. Die Konsequenz: Auch schon durch schwache Reize können starke Schmerzempfindungen ausgelöst werden. Weitere Veränderungen: Erhöhung der intrazellulären Transmitteraktivität Aktivierung stiller Synapsen im Kortex Empirischer Befund: Tatsächlich lassen sich bei Schmerzpatienten nach Schmerzreizen höhere evozierte Potenziale beobachten als bei Gesunden! Kurz: Die wichtigsten neurologischen Chronifzierungsmechanismen sind: A) Schmerzgedächtnis, B) Plastische Veränderungen des Nervensystems durch Genexpression, C) Sensibilisierung der Nozizeptoren und zentraler Neurone 149 17.2.2. Psychologische Faktoren: Operante Verstärkung: Häufig wird chronischer Schmerz durch operante Verstärkung aufrechterhalten bzw. verschlimmert. Positive Verstärkung: Werden chronische Schmerzen vom Umfeld durch vermehrte Zuwendung verstärkt, reduziert sich nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie verschwinden, sie werden sogar schlimmer! Knost et al. (1999): Gesunde Pbn und Schmerzpatienten wurden mit unterschiedlichen Formen von Schmerz konfrontiert und letztere dabei entweder von einem Partner unterstützt oder nicht! - Patienten mit zuwendendem Partner zeigten bei ischämischem Schmerz (Handkraftdynamometer) signifikant mehr Schmerzverhalten als ohne Gesunde und Patienten, deren Partner sich ihnen nicht zuwandte. Das Schmerzrating der verschiedenen Gruppen unterschied sich dagegen nicht. - Eiswassertest: Patienten mit verstärkendem Partner behielten die Hand wesentlich kürzer im Eiswasser als solche mit nicht-verstärkendem oder keinem Partner! - Schmerzhafte elektrische Reize am Finger und Rücken plus EEG: Patienten mit einem verstärkenden Partner zeigten bei elektrischer Reizung des Rückens (!) eine deutlich stärkere EEG-Aktivität (im Gyrus Cinguli) als Gesunde und Patienten ohne verstärkenden Partner! Negative Verstärkung (Dekonditionierungssyndrom): Durch anhaltende Schonung schmerzhafter Organe, werden diese zusätzlich geschwächt, es entstehen neue Mikroschäden und damit neuer Schmerz (=> ein Teufelskreislauf!) Weitere psychologische Faktoren: Prädisposition, auf Stress mit Muskelverspannungen zu reagieren Fear-Avoidance-Belief: Angst vor Aktivität und Schmerz Kognitive Faktoren: Katastrophengedanken, Aufmerksamkeitbias, Selbstwirksamkeitserwartung, Kontrollüberzeugung, etc. Psychosoziales Krankheitsverhalten (s.o.: Vermeidung etc.) 17.2.3. Biopsychologisches Modell chronischer Schmerzen nach Flor Flor unterscheidet zwischen folgenden, sich wechselseitig beeinflussenden Faktoren: Prädisponierende Faktoren Genetik, Beruf, Lernerfahrung Auslösende Stimuli aversive externe und interne Stimuli Auslösende Reaktionen mangelnde Bewältigung inadäquate Wahrnehmung und Interpretation körperlicher Symptome Bewertungsprozesse: Antizipation von Schmerz, Schmerzgedächtnis, mangelnde Kontrollüberzeugung, mangelnde Selbstwirksamkeit Psychophysiologische Reaktionsstereotypie symptomspezifischer EMG-Anstieg Schmerzreaktion Verbal-subjektiv Verhalten Phsiologisch-organisch Aufrechterhaltende Prozesse Instrumentelles und respondentes Konditionieren 150 17.3. Therapie 17.3.1. Psychotherapeutische Ansatzpunkte und Methoden Die bevorzugt angewandte Bewältigungsstrategie (aktiv vs. passiv) und negative schmerzbezogene Kognitionen (Katastrophendenken, Selbstwirksamkeitserwartung, Kontrollüberzeugung etc.) sagen die Krankheitsanpassung, die erlebte Beeinträchtigung und die Schmerzintensität besser voraus als das Ausmaß der Grunderkrankung! V.a. die Selbstwirksamkeitserwartung und die subjektive Überzeugung der Kontrollierbarkeit haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Schmerztoleranz! Sie stehen in direktem Zusammenhang mit der endogenen, opioidvermittelten Schmerzhemmung! Fazit: Es gibt vielversprechende Ansatzpunkte für Psychotherapie! Somatische Verfahren: Medikamente (Analgetika, Tranquilizer, Antidepressiva, Muskelrelaxazien etc.) Wichtig: keine schmerzkontingente, sondern zeitkontingente Einnahme! Nervenblockade Elektrische Reizung (TENS) Akupunktur Physiotherapeutische Maßnahmen (passiv: Massage, Wärme usw.; aktiv: Krankengymnastik) Wichtig: zeit- und nicht schmerzkontingente Anwendung! Psychologische Verfahren: Biofeedback Entspannungsverfahren Kognitiv-verhaltenstherapeutische Schmerzbewältigung Operantes Gruppentraining Biofeedback: Ziel ist ein schnelles, fast reflektorisches Wahrnehmen und Verhindern dysfunktionaler physiologischer Reaktionen. EMG-Feedback (z.B. bei Rückenschmerzen): Generelles Entspannungstraining Stressbewältigungsstrategie Korrektur von Fehlhaltungen Reduktion der Muskelanspannung in spezifischen Muskelgruppen fMRI-Feedback (bei allen möglichen Schmerzen): Gelernt wird die willkürliche Beeinflussung von BOLD-Signalen Ziel ist eine Veränderung der neuronalen Netzwerke, die chronischen Schmerzen zugrundeliegen (insbesondere eine Reduktion der Aktivität des anterioren Zingulums!) Kognitive Methoden: Die Wahrnehmung nach außen oder auf ablenkende Gedanken richten lernen Imaginative Transformation des Kontextes (z.B. sich vorstellen, man wäre bei einem Fußballspiel verletzt worden und würde trotzdem weiterspielen) Erhöhung der Selbstwirksamkeitserwartung Operante Methoden: Modifikation der Verstärkerkontingenzen und Erhöhung des Aktivitätsniveaus Reduktion von Schmerz- und Vermeidungsverhalten (Arztbesuche, Medikamenteneinnahme etc.) Aufbau „gesunden“ Verhaltens einschließlich „Social Skills“-Training 151 Wirksamkeit: Operantes Gruppentraining ist bei chronischem Schmerzsyndrom effektiver als die traditionelle medizinische Behandlung! Klinikum Staffelstein: Multimodales interdisziplinäres Therapieprogramm bei chronischem Rückenschmerz (pharmakologische Behandlung, physiotherapeutische und kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden: authentische Arbeitsplatzsimulation, Wiederaufbautraining etc. etc.) 152 18. Altersspezifische Intervention 18.1. Allgemeines zum Altern 18.1.1. Einleitung: Statistiken: Das maximal erreichbare Alter liegt gegenwärtig bei 120-130 Jahren. Der älteste Mensch der Welt war die Französin Jaeanne Calment (122 Jahre alt)! Laut Schätzungen verbringen wir im Schnitt 25 Jahre mit Schlafen, 12 Jahre mit Fernsehen, 6 Monate auf Toilette und nur 2 Wochen damit, uns im Schneeanzug zu küssen ;) Das durchschnittliche Lebensalter des Menschen weltweit beträgt 73 Jahre, wobei Frauen im Schnitt 5 Jahre länger leben als Männer! Die durchschnittliche Lebenserwartung in Entwicklungsländern - z.B. Malawi (36 Jahre) Sambia (37 Jahre) oder Swasiland (39 Jahre) liegt dabei deutlich unter der Lebenserwartung in Industrieländern: Die höchste Lebenserwartung haben mit 81 Jahren die Japaner. In Deutschland liegt die Lebenserwartung bei 76 Jahren! Demographischer Wandel in den Industrieländern: Schrumpfung der Gesamtbevölkerung bei gleichzeitigem Anstieg des Durchschnittsalters! Der Altenquotient entspricht der Anzahl der Rentner geteilt durch die Anzahl der Erwerbsfähigen. Gegenwärtig liegt er in etwa bei 30; d.h. auf 100 Erwerbsfähige fallen rund 30 Über-65-Jährige; im Jahr 2050 wird er, wenn die Entwicklung so weiter geht, bei ca. 54 liegen! Gründe für den demographischen Wandel: Dramatischer Rückgang der Fertilität bzw. Geburtenrate (seit ca. 1960) Anstieg der Lebenserwartung durch eine verbesserte medizinische Versorgung, gesünderen Lebenswandel usw. Biologie des Alterns: Die wichtigsten biologischen Prozesse, die dem Altern zugrunde liegen, sind: a) Kumulative Zerstörung von Zellen (begrenzte molekulargenetische Aufrechterhaltungs- und Reperatursysteme) b) Oxydativer Stress = Überschuss an freien Radikalen (=> zerstörerische Veränderungen an Makromolekülen bzw. an der DNA) - Oxydativer Stress wird sowohl durch genetische, als auch durch Umweltfaktoren bedingt: erhöht wird er beispielsweise durch UVStrahlung, Chemotherapie und Umweltgifte (wie Nikotin), reduziert werden kann er dagegen durch Bewegung, eine verringerte Kalorienaufnahme, Vitamin E, ungesättigte Fettsäuren etc. c) Nachlassen der Immunkompetenz, bedingt durch eine Reduktion der natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) - Daher auch die mit dem Alter zunehmende Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken! Haupttodesursachen: Die Haupttodesursachen im 3. Lebensalter (65-84 Jahre) sind Herzkreislaufkrankheiten, dicht gefolgt von Krebserkrankungen; die Haupttodesursache im 4. Lebensalter (> 84 Jahre) sind mit weitem Abstand Herzkreislaufkrankheiten! 153 Insgesamt sterben in Deutschland pro Jahr wesentlich mehr Menschen an Herzkreislauferkrankungen als an Krebs (ca. 43.000 zu 15.000)! Herzkreislauferkrankungen sind damit die Todesursache Nummer 1! 18.1.2. Psychologie des Alterns Unter psychologischem Altern versteht man die Summe der kognitiven und subjektiv erlebten Veränderungen! Folgende Altersphasen werden unterschieden: Kindheit: 0 – 11 Jahre Jugend: 12 – 17 Jahre Frühes Erwachsenenalter: 18 – 29 Jahre Mittleres Erwachsenenalter: 30 – 65 Jahre 3. Erwachsenenalter („junge Alte“): 65 – 84 Jahre 4. Erwachsenenalter („alte Alte“): über 84 Jahre Bezüglich des hohen Alters wird zwischen „GO-GOs“, „Slow-GOs“ und „NO-GOs“ unterschieden. „GO-GOs“ (bis ca. 80 Jahre): sind die „jungen Alten“; sie zeichnen sich durch Fitness und Selbständigkeit aus und nehmen, wenn auch in veränderter Form, in vollem Umfang am Leben teil! Veränderte Form der Produktivität: Ehrenamt, Haus- und Gartenarbeit, Bildung, Reisen, Hobbies etc. „Slow-GOs“ (ca. ab 80 Jahren): sind die „alten Alten“; bei ihnen machen sich Abbauprozesse bemerkbar und es kommt zu deutlichen Einschränkungen (Beginn degenerativer Erkrankungen, Rückzug etc.) Zu den „NO-GOs“ gehört man, wenn die Abbauprozesse dominieren (Multimorbidität, stark eingeschränkter Aktivitätsradius, Pflegebedürftigkeit etc.) Altern ist keineswegs nur ein degenerativer Prozess; stattdessen stehen den Verlusten zumindest bei den „GO-GOs“ immer auch Gewinne gegenüber! Verluste und Gewinne des Alterns: Verluste: Einbußen physischer und psychischer Leistungsfähigkeit, Einsamkeit, Verlust an Attraktivität etc. etc. Gewinne: Wegfall von Verpflichtungen (=> Gewinn an Freiheit), zunehmende Lebenserfahrung etc. etc. 154 14.2. Intervention im Alter 18.2.1. Probleme beim Umgang mit alten Menschen Alte Menschen werden vielfach als problematische Patienten empfunden, da sie zu viel Zeit kosten: sie hören und sehen schlecht, verstehen daher vieles nicht, haben ein starkes Mitteilungsbedürfnis, wiederholen sich häufig usw. usw. Hinzu kommen, gerade bei medizinischem Fachpersonal, vielfach Vorurteile gegenüber alten Menschen und dem Alter (= „Ageismus“); diese Vorurteile sind oft sogar stärker als die gegenüber Minderheiten und gründen vermutlich auf der Furcht vor dem eigenen Älterwerden! Beispiele: Alte verstehen eh nur noch die Hälfte, sind hilfsbedürftig, leben in sozialer Isolation etc. etc. Folgen: Viele Probleme werden zu Unrecht dem Alter zugeschrieben daher: weniger Prävention, weniger intensive Behandlung, weniger Aufmerksamkeit und Zeit etc. etc. Häufige Fehler beim Umgang mit alten Menschen generell und bei der Anamnese im speziellen: Der Arzt/Therapeut wirkt desinteressiert (lässt den Patienten nicht ausreden, hört nicht richtig zu, spricht in Anwesenheit des Kranken über diesen in der 3. Person etc.) Der Arzt/Therapeut wirkt einschüchternd (spricht das Patienten nicht mit seinem Namen an, informiert ihn nicht darüber, was genau man mit ihm vorhat, redet zu schnell und zu viel, wirkt gehetzt und ungeduldig etc.) Befunde werden zu Unrecht als normale Alterserscheinungen abgetan (Atemnot, Vergesslichkeit etc.) Fixierung auf vordergründiges Ereignis (z.B. Fraktur) Pflichtbestandteile der Anamnese bei alten Menschen: Ernährungsgewohnheiten, BMI, Mobilität, Kontinenz, Schlaf, Sinne, Kognition/Gedächtnis, Medikamente und Nebenwirkungen, Ziele/Wertvorstellungen, Versorgungssituation, Fremdanamnese Grundregeln: Langsam und von vorne auf Patienten zugehen; langsam und mit ruhiger Stimme sprechen; dem Patienten, Zeit lassen, zu verstehen und zu reagieren; Handlungen am Patienten vorher ankündigen und langsam durchführen 18.2.2. Spezielle Themen des Alters Gedächtnis: Das Nachlassen des Gedächtnisses ist das am häufigsten beklagte Altersproblem! 90% der Varianz des kognitiven Altersabbaus lassen sich durch das Nachlassen der sensorischen und motorischen Funktionen erklären. Normal ist darüber hinaus ein Abbau in temporo-medialen Hirnstrukturen (=> Defizite bei der Reproduktion neu gelernter Inhalte) und im Frontalkortex (=> schlechtere Leistung bei Enkodierungs- und Abrufprozessen) Zu unterscheiden ist zwischen kristalliner und fluider Intelligenz (Cattell): Die kristalline Intelligenz nimmt bis ins hohe Alter zu oder bleibt zumindest stabil; sie umfasst die sprachlichen Fähigkeiten einer Person, sowie das durch Erfahrung angeeignete deklarative und prozedurale Wissen! (nach Kübler: das implizite Gedächtnis) Die fluide Intelligenz nimmt im hohen Alter stark ab; zu ihr gehören die Basisprozesse der Informationsverarbeitung (Arbeitsgedächtnis, 155 Verarbeitungsgeschwindigkeit etc.); nach Kübler auch das explizite Gedächtnis (was meiner Ansicht nach nicht stimmt) Intellektuelle Einbrüche im Alter sind die Folge geistig-körperlicher Inaktivität und/oder degenerativer Erkrankungen (z.B. Morbus Alzheimer) Sex: Sexualität im Alter ist nach wie vor ein Tabuthema, weshalb es nur wenige Forschungsergebnisse dazu gibt. Klar ist jedoch, dass Sexualität auch im Alter durchaus noch Thema ist! Interesse an Sex: Männer: mit 60 Jahren (80%); mit 78 Jahren (50-70%) Frauen: mit 60 Jahren (50-70%); mit 78 Jahren (30%) Die tatsächliche sexuelle Aktivität ist deutlich geringer – und zwar aus folgenden Gründen: a) Körperliche Veränderungen - Es werden weniger Sexualhormone produziert - Es kommt zu einer Veränderung des sexuellen Reaktionszyklus: verlangsamte Erregungsphase + verminderte Erektion bzw. Lubrikation; verlängerte Plateauphase; kürzere Orgasmusdauer b) Psychologische Probleme: Männer haben Angst zu versagen, Frauen Angst vor Schmerzen (=> Selfulfilling prophecy) c) Medizinische Probleme: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Prostata, medikamentöse Behandlungen etc. Intervention: Psychologisch: KVT Medizinisch: Hormone In der Zukunft: hoffentlich ein unverkrampfterer Umgang mit Sexualität im Alter! 18.2.3. Psychische Störungen im Alter: Demenzen sind nach Schlafstörungen die häufigste psychische bzw. psychiatrische Störung im Alter; sie führen zu einer progredienten Verschlechterung der intellektuellen Fähigkeiten! Unterschieden wird zwischen der Alzheimer-Demenz, fronto-temporalen- und vaskulären Demenzen; mit neuropsychologischen Verfahren lassen sich diese Formen jedoch allenfalls im frühen oder mittleren Entwicklungsstadium auseinanderhalten! Die Alzheimer-Demenz: ist die häufigste Form (60%); sie beruht auf einer fortschreitenden Atrophie der Großhirnrinde durch Proteinablagerungen (sog. Plaques) in den Zellkörpern der Neuronen Beginnt mit: Einschränkungen des episodischen Gedächtnisses, räumlichen und zeitlichen Orientierungsstörungen und Wortfindungsstörungen Später: Störungen des KZG, des Altgedächtnisses, Apraxien, Orientierungsstörungen bezüglich der eigenen Person Die fronto-temporale Demenz: Atrophie von Neuronen im Frontal- und Temporallappen Persönlichkeitsveränderungen (apathisch zurückgezogen oder sozial enthemmt); Störungen der Exekutivfunktionen; später: Echolalie Am Ende: verstummen Patienten vollständig Vaskuläre Demenzen: werden durch Durchblutungsstörungen im Gehirn hervorgerufen. Kortikaler Typus: Aphasie (Sprachverlust); Agnosie (Störung des Erkennens); Amnesie; Apraxie (Bewegungsstörungen) 156 Gemischter Typus (kortikal und subkortikal): unterschiedliche Schädigungsmuster Strategische Infarktdemenz: unterschiedlich Small-vessel-Erkrankung: Status lacunaris (kognitive Defizite); Status Binswanger (kognitive und motorische Defizite) Psychologische Interventionen bei Alzheimer: versuchen, die Basisfertigkeiten (Essen, Waschen etc.) so lange wie möglich zu erhalten und die Angehörigen zu entlasten; als wirksam erwiesen haben sich in frühen Stadien: verhaltenstherapeutisches Kompetenztraining; Realitätsorientierungstraining; Kommunikationstraining (wiedererkennen statt erinnern) Allgemeine Tipps für den Umgang mit Demenzkranken: Verständnisvoll und trotzdem bestimmt sein, Anschuldigungen und Vorwürfe überhören, klare Anweisungen geben, für Beständigkeit und Routine sorgen Depression: Die Prävalenz für Depression im Alter hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen; sie ist umso höher, je älter die zugrundegelegte Population ist (mit 75 Jahren: 17%) Ältere Frauen sind dabei häufiger von Depression betroffen als Männer, letztere begehen dafür häufiger Suizid (die Suizidrate bei Über-65-Jährigen ist um das 3-fache erhöht)! Beeinflussende Faktoren: Körperliche Erkrankungen, Verlust von Bezugspersonen, Unterbringung in Heimen, Erlernte Hilflosigkeit etc. Symptome: häufig körperliche Symptome (Schmerzen), psychomotorische Verlangsamung, Klagen über Gedächtnisschwierigkeiten, Ängste Vorsicht: Demenz vs. Depression (Depressive machen viele Auslassungsfehler, Demente raten oder konfabulieren) Psychologische Intervention: KVT-Gruppenprogramm für ältere Patienten mit Depression (von Hautzinger): 12 Sitzungen à 120 Minuten; d = 0.6 – 1.1 Interpersonelle Therapie: Aufarbeitung typischer Problembereiche im Alter (Abschied, Rollenverlust etc.) Psychopharmaka: SSRIs können hilfreich sein, sind aber aufgrund ihrer Nebenwirkungen und v.a.: aufgrund ihrer mitunter toxischen Nebenwirkung mit anderen Medikamenten vielfach nicht einsetzbar! Angststörungen: Insgesamt häufiger als Depression, aber weniger systematisch untersucht; am häufigsten sind bei alten Menschen: spezifische Phobien und generalisierte Angststörungen Evidenz gibt‟s bisher nur für KVT Schlafstörungen: Mehr als die Hälfte aller über 65-Jährigen leiden unter Schlafstörungen (Insomnie, v.a. bei Männern: Schlafapnoe)! Typisches Muster: häufiges Aufwachen, Verlust des vierten Schlafstadiums und Reduktion des dritten Stadiums (Tiefschlafphasen); Rückkehr zum biphasischen Schlaf (Mittagsschlaf) Folgen: Tagesmüdigkeit (kognitive Beeinträchtigungen, Unfälle etc.), Substanzmissbrauch etc. 157

![Wolf Affektive Störungen 2 [Schreibgeschützt]](http://s1.studylibde.com/store/data/001433559_1-745dca5f2a45ea3d3d02ed8f2515ee46-300x300.png)