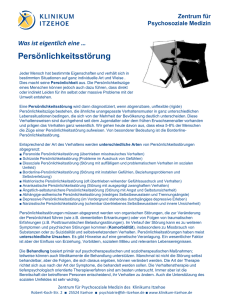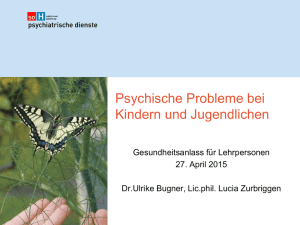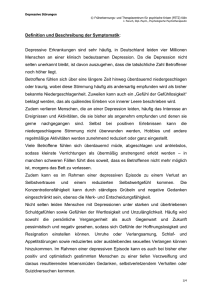2002, Heft 2: Psychische Erkrankungen
Werbung

2002/2 Mitteilungen der Lebensversicherer an die Schweizer Ärzteschaft Psychische Erkrankungen Beilage der Schweizerischen Ärztezeitung Nr. 51/52, 18. Dezember 2002 Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d’Assurances Associazione Svizzera d’Assicurazioni 2 Inhalt Herausgeber SVV Schweizerischer Versicherungsverband Dr. med. Roland von Känel Moderne Einteilung psychischer Erkrankungen 4 1941 – 1998 herausgegeben von den Lebensversicherern Die für die Herausgabe der «Mitteilungen» Dr. med. Francesca C. Steinmann Die Psychiatrie als medizinischer Fachbereich 20 Karl Groner Psychische Krankheiten aus Sicht des Privatversicherers 36 verantwortliche Kommission setzt sich wie folgt zusammen: • Josef Kreienbühl, PAX, Präsident • Karl Ehrenbaum, Zürich • Dr. med. Thomas Mall, Basler • Dr. med. Jan von Overbeck, Swiss Re • Dr. med. Walter Sollberger, Berner • Peter Suter, Winterthur • Dr. med. André Weissen, PAX Redaktion Dr. Jörg Kistler C.-F.-Meyer-Strasse 14 8022 Zürich, Telefon 01-208 28 28 E-mail [email protected] Druck Dürrenmatt Druck AG 3074 Muri-Bern Auflage 11 000 Exemplare Dr. Jakob Bösch, Petra Wildemann Die Reintegration der psychisch Kranken in die Arbeitswelt 46 3 Editorial Liebe Leserinnen, liebe Leser Rund ein Drittel aller IV-Bezüger leiden unter den Folgen psychischer Krankheiten. In seinem Artikel schildert Karl Groner, wie die privaten Versicherungsgesellschaften der Problematik begegnen und gibt Erläuterungen zur Antragsprüfung und zur Einschätzung des Todesfalls- und Erwerbsrisikos. Aber was sind psychiatrische Erkrankungen überhaupt und wie erkennt man sie. Frau Dr. Steinmann legt in ihrem Artikel eindrücklich dar, mit welch zwiespältigen Assoziationen die Psychiatrie verknüpft wird. Sie beschreibt Behandlungsmethoden und legt die Forschungsansätze dar. So werden heute in der psychiatrischen Forschung grosse Anstrengungen unternommen, um die biologischen Mechanismen zu analysieren, welche psychischen Erkrankungen zu Grunde liegen und die Wirkungsweise der verschiedenen Therapieansätze zu untersuchen. Dr. von Känel legt die moderne Einteilung psychischer Erkrankungen dar. In seinem Artikel legt er ein Schwergewicht auf die Tatsache, dass rund die Hälfte der psychischen Störungen in der medizinischen Grundversorgung nicht erkannt wird. Dies ist deshalb gravierend, weil ohne richtige Diagnose eine adäquate Therapie nicht möglich ist. Was kann getan werden, um die erwähnten Stigmatisierungen psychisch Kranker zu verhindern und die ständig wachsenden Belastungen aus der Erwerbsunfähigkeitsversicherung in den Griff zu bekommen? Petra Wildemann und Dr. Jakob Bösch zeigen auf, dass es bei frühzeitiger Erkennung des Problems Erfolg versprechende Möglichkeiten gibt, Betroffene davor zu bewahren, durch Chronifizierung der Leiden aus dem sozialen Kreislauf heraus zu fallen. Liebe Leserin, lieber Leser, Verständnis für die Kranken und rechtzeitige auf das Problem zugeschnittene medizinische Behandlung ist das Eine. Aber die Gesellschaft muss auch ein Vermehrtes tun, um Kranke wieder in die Arbeitswelt einzugliedern. Im Interesse der Kranken, aber auch im Interesse der Allgemeinheit, welche dem ständigen Wachstum der durch psychische Erkrankungen verursachten Kosten nicht einfach tatenlos zusehen kann. Dr. Jörg Kistler 4 Moderne Einteilung psychischer Erkrankungen Dr. med. Roland von Känel, FMH Innere Medizin, Psychosomatische und Psychosoziale Medizin (APPM), Abteilung für Psychosomatische Medizin, Zürcher Höhenklink Davos Zusammenfassung Psychische Störungen werden in der ärztlichen Grundversorgung häufig angetroffen und in bis zur Hälfte der Fälle nicht erkannt. Erst die korrekte Diagnose ermöglicht aber eine spezifische Therapie, welche das beträchtliche Leiden der betroffenen Patienten zu lindern vermag. Dieser Artikel stellt eine vereinfachte Einteilung der in der Grundversorgung häufig angetroffenen psychischen Störungen nach der ICD-10 vor. Depressionen werden hinsichtlich des zeitlichen Auftretens (einzelne Episode, rezidivierend, anhaltend) sowie nach ihrem Schweregrad (leicht, mittelgradig, schwer) eingeteilt. Die Angststörungen lassen sich in die Phobien, unter ihnen die Agoraphobie, die soziale Phobie und die isolierten Phobien, sowie in die sonstigen Angststörungen, zu denen die Panikstörung und die generalisierte Angststörung gehören, unterteilen. Bei den somatoformen Störungen lassen sich die mehr vegetativ bezogenen somatoformen autonomen Funktionsstörungen von der mehr auf den Schmerz bezogenen anhaltend somatoformen Schmerzstörung unterscheiden. Das Vollbild einer Somatisierungsstörung ist vergleichsweise selten. Für die Diagnose der somatoformen Schmerzstö- rung und der Belastungs- und Anpassungsstörungen werden ursächlich psychosoziale Problembereiche gefordert, die sich mit der ICD-10 kodieren lassen. Je nach zeitlichem Beginn und Dauer werden bei den Belastungs- und Anpassungsstörungen die akute Belastungsstörung, die posttraumatische Belastungsstörung und die Anpassungsstörung unterschieden. Ebenfalls häufig in der Grundversorgung angetroffen werden die Neurasthenie, Störungen durch übermässigen Alkoholkonsum und Persönlichkeitsstörungen. Einleitung Dieser Artikel soll eine Übersicht geben über die Einteilung psychischer Erkrankungen nach den klinisch-diagnostischen Leitlinien der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die ICD-10 ist in deutscher Sprache beim Verlag Hans Huber erhältlich. Obwohl immer wieder diskutiert wird, inwiefern eine deskriptive Diagnosestellung psychischer Erkrankungen nach einem Klassifikationsmanual wie der ICD-10 sinnvoll und für den klinischen Alltag dienlich sei, muss doch entgegengehalten werden, dass, in Analogie zu den 5 somatischen Erkrankungen, eine psychische Störung nur dann professionell behandelt werden kann, wenn sie als solche erkannt und diagnostiziert wird («vor die Therapie haben die Götter die Diagnose gestellt»). Psychische Störungen sind syndromale Diagnosen, d. h. eine bestimmte Anzahl von Auswahlsymptomen muss jeweils gegeben sein, damit eine bestimmte Störung diagnostiziert werden kann. Da die definitive Diagnosestellung einer psychischen Störung nie aufgrund eines Labortests oder eines Röntgenbilds gestellt werden kann, erlangen die Arzt-Patienten-Beziehung und die Anamneseerhebung eine besondere Bedeutung. Wie unten ausgeführt, werden psychische Störungen im nicht-fachärztlichen Bereich leider immer noch viel zu wenig erkannt und behandelt, mit für die betroffenen Patienten erwiesenermassen weit reichenden psychischen, sozialen und somatischen Konsequenzen hinsichtlich einer verminderten Lebensqualität und einer erhöhten Morbidität und Mortalität. Es ist zu betonen, dass die vielfältigen gesundheitlichen Auswirkungen einer psychischen Störung vergleichbar sind mit den durch eine somatische Erkrankung verursachten. Die Diagnosekriterien der ICD-10 ermöglichen im hek- tischen Praxisalltag eine rasche Einteilung psychischer Störungen, was die Einleitung spezifischer Therapiemassnahmen erst erlaubt. Ein spezifisches Störungswissen, bspw., dass die Depression mit steigendem Alter zunimmt und bei Frauen doppelt so häufig vorkommt wie bei Männern, ist diagnostisch zusätzlich hilfreich, kann in diesem Artikel aber nicht vermittelt werden. Überdies wird es angesichts der Kostenentwicklung im Gesundheitswesen zunehmend wichtiger, dass sich die unterschiedlichen Partner einer gemeinsamen Sprache bedienen, wenn sie sich über bestimmte Krankheiten und über dafür erbrachte und geforderte Leistungen unterhalten. So kann es für einen Versicherungsmitarbeiter verständlicherweise um einiges schwieriger sein, sich unter einer eher undifferenzierten «Erschöpfungsdepression bei psychosozialer Belastungssituation» einen konkreten Krankheitszustand vorzustellen, als bei einer definierten «Anpassungsstörung mit längerer depressiver Reaktion (ICD-10 F43.21) nach Tod des Ehepartners (ICD-10 Z63.4)». Dies kann unter Umständen dazu führen, dass die Kostengewährung für eine ambulante Psychotherapie oder einen stationären Rehabilita- 6 tionsaufenthalt unnötig restriktiver gestellt wird, obwohl natürlich unabhängig von der Diagnose sowohl die subjektive als auch die objektive Beeinträchtigung des an einer verzögerten Trauerreaktion mit Somatisierung Leidenden dieselbe ist. Psychische Störungen in der ärztlichen Grundversorgung Die epidemiologischen Untersuchungen über die Prävalenz von psychischen Störungen in der ärztlichen Grundversorgung («primary care») der Gruppe um Wittchen am Max Planck Institut in München unterstreichen die Wichtigkeit eines gewissenhaften und sorgfältigen Vorgehens in der Diagnostik psychischer Störungen. Diese Untersuchungen an über 20 000 Patienten haben gezeigt, dass von den in der ärztlichen Grundversorgung präsentierten und nach der ICD-10 diagnostizierten psychischen Störungen einerseits nur unmerklich mehr als die Hälfte als solche erkannt werden, und andererseits mehr als jeder zehnte Patient mit einer depressiven Störung diagnostiziert wird, obwohl er keine Depression hat. In drei von vier Fällen ist die soziale Beeinträchtigung (Familie, Beruf ) unter Patienten mit einer definierten psychischen Störung klinisch relevant und kann natürlich nur dann positiv beeinflusst werden, wenn die Störung erkannt wird. Durch die Therapie einer Fehldiagnose müssen unter Umständen subjektiv einschränkende Nebenwirkungen eines Medikaments in Kauf genommen werden und kann potenziell gesundheitlicher Schaden entstehen (Herzrhythmusstörungen beim Einsatz von trizyklischen Antidepressiva, Dyskinesien bei Neuroleptikagebrauch). Viel häufiger als eine falsche Behandlung wird in der Grundversorgung aber gar keine Indikation zur spezifischen Therapie einer psychischen Störung gestellt, sei es mit Psychopharmaka oder mit anderen psychotherapeutischen Interventionen. Verhältnismässig noch weniger häufig werden die so genannt subklinischen Formen einer psychischen Störung erkannt, bei denen die Anzahl Symptome nicht für die Diagnose einer voll ausgebildeten Störung qualifiziert. Auch subsyndromale psychische Störungen sind klinisch relevant. Mehrfach wurde bspw. eine DosisWirkungs-Beziehung zwischen dem Schweregrad einer depressiven Verstimmung und dem prospektiven Risiko im mehrjährigen follow-up einen Myokardinfarkt zu erleiden, gefunden. Dieser Zusammenhang macht deutlich, dass rechtzeitiges Erkennen und 7 Therapieren einer sowohl klinischen als auch subklinischen Depression nicht nur auf die Verbesserung der psychischen und sozialen Funktionen, sondern auch auf die somatische Morbidität und Mortalität einen positiven Einfluss haben kann. Jeder vierte Patient zeigt im Anschluss an einen Herzinfarkt eine «major depression», womit die Prävalenz einer «major depression» in dieser Population etwa dreimal grösser ist, als diejenige in der Durchschnittsbevölkerung. Eine Depression wird aber nur bei jedem vierten depressiven Herzpatienten diagnostiziert und nur jeder zweite Diagnostizierte wird mit einem Antidepressivum und/oder Psychotherapie behandelt. Es folgt, dass ein depressiv verstimmter Patient mit stattgehabtem Myokardinfarkt eine Chance von nur 1:10 hat, eine antidepressive Therapie mit potenziell günstigem Einfluss auf sein Überleben zu erhalten. Einteilung psychischer Störungen Im Rahmen dieses Artikels kann nicht das ganze Spektrum der psychischen Störungen nach der ICD-10 abgehandelt werden. Didaktisch soll die Unterteilung der verschiedener Krankheitsgruppen nicht zu komplex ausfallen, um dem Hauptanliegen des Artikels, der Anwendbarkeit einer Einteilung psychischer Störungen im Praxisalltag, nachzukommen. Je nach Population weisen etwa 10 bis 20% der Patienten, die beim Grundversorger in der Praxis vorstellig werden, eine psychische Störung nach der ICD-10 auf, und eine ebenso hohe Anzahl Patienten hat eine subsyndromale psychische Störung. Von hoher Wichtigkeit ist die Erkenntnis, dass Patienten mit einer psychischen Störung den Grundversorger in den allerwenigsten Fällen wegen einem psychischen Symptom aufsuchen, sondern überwiegend wegen somatischer Beschwerden, Schmerzen, Müdigkeit und Schlafproblemen. Unter den klinischen Störungen finden sich am häufigsten depressive Episoden, eine generalisierte Angststörung, eine somatoforme Störung, eine Neurasthenie und eine Alkoholabhängigkeit. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die so genannte Komorbidität psychischer Störungen ausgesprochen gross ist. Allgemein wurde gefunden, dass bei drei von fünf Patienten mit einer klinischen Depression mindestens eine weitere psychische Störung diagnostiziert werden kann. Bspw. stellt das gleichzeitige Auftreten einer depressiven Störung mit einer Angststörung eher die Regel 8 als die Ausnahme dar. Die hohe Komorbidität psychischer Störungen führt auch unter Experten immer wieder zu Diskussionen ob bspw. eine gleichzeitig vorhandene depressive und Angststörung als je eine eigenständige Diagnose aus den beiden Krankheitsgruppen «depressive Episode (ICD-10 F32)» und «sonstige Angststörungen (ICD-10 F41)» oder aber als «Angst und depressive Störung, gemischt (ICD-10 F41.2)» codiert werden soll. Für den Praxisalltag sei das erstere Vorgehen empfohlen, d. h. möglichst eigenständige Störungen abzugrenzen und diese gemäss der ICD-10 als Hauptdiagnose bzw. Nebendiagnose(n) miteinander (sog. komorbid) zu diagnostizieren. Bei Unklarheiten wird empfohlen, einen Fachkollegen beizuziehen. In jedem Fall soll man mit Hilfe der Anamnese versuchen herauszufinden, welche psychische Störung zuerst auftrat. So findet man bei Patienten, die sich mit der Komorbidität einer Depression und einer somatoformen Schmerzstörung präsentieren, nicht so selten eine langjährig vorbestehende posttraumatische Belastungsstörung durch traumatiserende Kindheitserlebnisse, die möglicherweise den Schlüssel zum therapeutischen Erfolg liefert. Depressive Störungen Depressive Störungen gehören zu den affektiven Störungen (ICD-10 F30F39). Manische bzw. hypomanische Zustände entweder alleine (manische Episoden F30) oder in Kombination mit einer depressiven Störung (bipolare affektive Störung F31) werden in der Grundversorgung eher selten angetroffen, so dass wir uns auf die so genannt depressiven Episoden (F32), rezidivierenden depressiven Störungen (F33) und anhaltend affektiven Störungen (F34) beschränken wollen. Anamnestisch lohnt es sich aber immer, bei einem depressiv verstimmten Patienten nach Phasen in seinem Leben zu fragen, während deren er sich selbst oder sein Umfeld ihn als bei überdurchschnittlich guter Stimmung, überdreht oder gar euphorisch erlebte, um eine insbesondere Bipolar II Störung (depressive Episoden gemischt mit hypomanischen Zuständen) zu erkennen, die medikamentös grundsätzlich anders therapiert werden muss als eine «reine», d. h. unipolare depressive Störung. Auf psychotische Symptome wie Wahnideen und Halluzinationen, die im Rahmen einer schweren Depression (F32.3) vorkommen können, soll hier nicht weiter eingegangen werden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass bei psychoti- 9 schen Phänomenen grundsätzlich ein Facharzt für Psychiatrie konsultiert werden sollte. Depressive Episoden nach ICD-10 F32 Es handelt sich um einen über mindestens zwei Wochen anhaltenden Zustand depressiver Stimmung in einem für den Betroffenen deutlich abnormen Ausmass während der meisten Zeit des Tages, an fast jedem Tag, weitgehend unbeeinflusst von äusseren Umständen. Der Begriff «depressive Episode» soll konsequent nur für eine einzelne depressive Episode verwendet werden; d. h., es soll beim Auftreten wiederholter depressiver Episo- den eine rezidivierende depressive Störung mit dem Typus der gegenwärtigen depressiven Episode (s. unten) diagnostiziert werden. Die folgenden zehn Symptome in Tabelle 1 sollen für die Einteilung des Schweregrads einer depressiven Episode (Tabelle 2) systematisch erfragt werden. Das Akronym «Die Miss USA» mag das Abfragen der depressiven Symptome während der Anamnese erleichtern. Für die Diagnose einer depressiven Episode müssen mindestens zwei der ersten 3 Symptome vorhanden sein. Ist nur ein Symptom der ersten drei vorhanden, so kann die Diagnose einer depressiven Episode streng genommen nicht diagnostiziert wer- Tabelle 1 Die 10 depressiven Symptome nach der ICD-10 («DIE MISS USA») 1. D epressive Stimmung 2. I nteressenverlust oder Freudlosigkeit an normalerweise angenehmen Aktivitäten 3. E nergielosigkeit oder verminderter Antrieb 4. Minderwertigkeitsgefühle und vermindertes Selbstvertrauen 5. I nappetenz und Gewichtsverlust 6. S chuldgefühle und Gefühle von Wertlosigkeit 7. S chlafstörungen 8. U nrealistisch negative Zukunftsperspektiven 9. S uizidgedanken und erfolgte Selbstverletzungen oder Suizidhandlungen 10. A ufmerksamkeits- und Konzentrationsdefizit 10 Tabelle 2 Einteilungen der depressiven Episoden Schweregrad der Depression Diagnostisches Kriterium Leichte depressive Episode (F32.0) Mindestens 4 der Symptome 1 – 10, darunter mindestens 2 der Symptome 1 – 3 Mindestens 5 der Symptome 1 – 10, darunter mindestens 2 der Symptome 1 – 3 Mindestens 7 der Symptome 1 – 10, darunter mindestens 3 der Symptome 1 – 3 Mittelgradige depressive Episode (F32.1) Schwere depressive Episode (F32.2) den. Es kann aber von einer subsyndromalen Depression gesprochen werden, die am besten als sonstige depressive Episode (F32.8) oder, wenn sie über eine genügend lange Zeit anhält, unter der Dysthymia (F34.1, s. unten) codiert werden kann. Können Patienten aufgrund einer besonderen (psychomotorischen) Agitiertheit oder Hemmung die Symptome nicht in allen Einzelheiten beschreiben, ist die zusammenfassende Einschätzung im Falle einer schweren depressiven Episode gerechtfertigt. Das Auftreten von bestimmten Symptomen mit klinischer Bedeutung im Verlauf einer depressiven Episode oder einer rezidivierenden depressiven Störung kann als so genanntes somatisches Syndrom abgegrenzt werden, sofern mindestens vier Symptome aus der Tabelle 3 gegeben sind. Das Vorkommen aber auch das Nichtvorhandensein des somatischen Syndroms wird mit einer fünften Stelle gekennzeichnet, also bspw. mittelgradige depressive Episode mit somatischem Syndrom F32.01 bzw. mittelgradige depressive Episode ohne somatisches Syndrom F32.00. Das somatische Syndrom weist darauf hin, dass eine Depression unter anderem mit Veränderungen der Motorik, der vegetativen Funktionen und zirkadianer Vorgänge einhergeht und damit den Erkrankten immer in seinem gesamten körperlichen und seelischen Verhalten und Erleben erfasst. 11 Tabelle 3 Merkmale des somatischen Syndroms 1. Interessenverlust oder Freudlosigkeit an normalerweise angenehmen Aktivitäten 2. Unvermögen emotional zu reagieren 3. Frühmorgendliches Erwachen 4. Morgentief 5. Objektivierte psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit 6. Appetitverlust 7. Gewichtsverlust von >5% des Körpergewichts im vorhergehenden Monat 8. Libidoverlust Rezidivierende depressive Störung nach ICD-10 F33 Die rezidivierende depressive Störung ist getreu ihrem Namen durch das wiederholte Auftreten mindestens zweier depressiver Episoden mit einer dazwischen liegenden mehrmonatigen Periode ohne affektive Symptomatik definiert. Haben die Episoden nicht zwei Wochen gedauert, bzw. war das Intervall ohne eine affektive Störung zwischen den Episoden deutlich kürzer als ein paar Monate, so ist eine sonstige rezidivierende affektive Störung (F38.1) zu diagnostizieren. Vereinfacht erfolgt die Einteilung einer rezidivierenden depressiven Störung durch den Typus der gegenwärtigen Episode bzw. das aktuelle klinische Bild, wobei zusätzlich das somatische Syndrom abgegrenzt werden kann (s. oben). rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode (F33.0) rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode (F33.1) rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode (F33.2) Dabei ist besonders zu erwähnen, dass eine rezidivierende depressive Störung auch remittieren kann; d. h., dass der Patient mit einer rezidivierenden depressiven Störung in der Anamnese zum Zeitpunkt der Untersuchung in einer vollständigen Remission sein kann. rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert (F33.4) 12 Anhaltend affektive Störungen nach ICD-10 F34 Als einzige Störung in dieser Kategorie soll die Dysthymia F34.1 erwähnt werden. Hierbei handelt es sich um eine chronische (mehrere Monate bis Jahre, manchmal lebenslange) und gewöhnlich fluktuierende depressive Verstimmung, die nach Schweregrad und Dauer der einzelnen Episoden nicht ausreichend schwer ist, um auch nur für eine leichte depressive Episode zu qualifizieren. Angststörungen Die ICD-10 unterscheidet bei den Angststörungen die phobischen Störungen von den sonstigen Angststörungen. Phobische Störungen zeichnen sich dadurch aus, dass die Angst durch ungefährliche, eindeutig definierte Situationen ausserhalb des Patienten hervorgerufen wird. Zu den phobischen Störungen werden die Agoraphobie («Platzangst»), die soziale Phobie und die isolierten, auf ein spezifisches Objekt gerichteten Phobien (z. B. Tierphobien, Höhenangst), gezählt. Auf letztere wird nicht weiter eingegangen, da die Patienten einem einzelnen phobischen Stimulus im Alltag meist ohne nennenswerte Beeinträchtigung ausweichen können. Für Phobien typisch sind eine Erwartungs- angst und ein Vermeidungsverhalten gegenüber der angstauslösenden Situation. Eine Phobie wird auch als solche diagnostiziert, wenn sie von Panikattacken begleitet wird. Im Gegensatz zu den Phobien zeichnen sich die sonstigen Angststörungen dadurch aus, dass sie sich nicht auf eine bestimmte Umgebungssituation beziehen. Zu den sonstigen Angststörungen werden die Panikstörung und die generalisierte Angststörung gezählt. Es wird vorgeschlagen, jegliche subsyndromale Angsterkrankungen, die klinisch relevant sind, als nicht näher bezeichnete Angststörung (F41.9) zu benennen. Phobische Störungen nach ICD-10 F40 Agoraphobie F40.0 Die Diagnose einer Agoraphobie fordert, dass in mindestens zwei von vier definierten Situationen (Menschenmenge, öffentliche Plätze, Reisen mit weiter Entfernung von zu Hause, alleine Reisen) Angst auftritt und eine starke Beeinträchtigung durch das Vermeidungsverhalten besteht. Je nach Vorliegen oder Fehlen einer Panikstörung (s. unten) kann eine Agoraphobie ohne Panikstörung (F40.00) bzw. eine Agoraphobie mit Panikstörung (F40.01) abgegrenzt werden. Typisch 13 ist die Angst, in der Öffentlichkeit zu kollabieren, sich dabei zu blamieren und keinen «Fluchtweg» offen zu haben, um sich möglichst rasch an einen sicheren Platz, meist nach Hause, zurückziehen zu können. Soziale Phobien F40.1 Die Diagnose einer sozialen Phobie erfordert, dass die Angst auf bestimmte soziale Situationen begrenzt ist und ein erhebliches Vermeidungsverhalten besteht, das mitunter zu einer sozialen Isolation führt. Typische Situationen, die Angst bereiten, sind das Essen oder Sprechen in der Öffentlichkeit oder ein Treffen mit dem anderen Geschlecht bei fehlender Symptomatik im engen Vertrautenkreis.Vegetative Zeichen wie Schwitzen, Erröten und Zittern kommen vor. Die Abgrenzung von einer Agoraphobie ist mitunter schwierig. Im Gegensatz zum Patienten mit einer Agoraphobie, fühlt sich der Patient mit einer sozialen Phobie in einer Menschenmenge nicht zwingend unwohl, fürchtet aber unter Umständen, jemanden in der Menschenmenge anzusprechen. Sonstige Angststörungen nach ICD-10 F41 Panikstörung F41.0 Es handelt sich um unvorhersehbare, anfallsweise Zustände von heftiger Angst («wie aus heiterem Himmel»), die der Betroffene nicht mit externen Stimuli in Verbindung bringen kann. Eine Panikstörung soll nur beim Fehlen einer Phobie diagnostiziert werden. Die Begriffe Panikattacken, Panikanfälle oder Angstanfälle werden synonym mit dem Begriff Panikstörung verwendet. Die Anfälle dauern wenige Minuten bis eine halbe Stunde und sind von heftigen körperlichen, durch die Aktivierung des vegetativen Nervensystems verursachten Symptomen begleitet, wobei Herzklopfen, Atemnot und Schwindel am häufigsten berichtet werden. Eine Zusammenstellung der somatischen Beschwerden bei einer Panikattacke findet sich in Tabelle 4. Mitunter stehen bei einer Panikattacke die körperlichen Beschwerden gegenüber dem Affekt «Angst» sowohl für den Patienten als auch für den Arzt im Vordergrund. Dadurch vergehen nicht selten Jahre, bis eine Panikstörung nach zahlreichen unauffälligen somatischen Untersuchungen diagnostiziert und behandelt wird. Zusätzliche kognitive Symptome be- 14 Tabelle 4 Körperliche Symptomatik bei einer Panikattacke Organsystem Symptome und Befunde Kardial Druck und Stechen auf Thorax, Herzklopfen, -rasen, -stolpern Atemnot, Erstickungsgefühl, Engegefühl, Hyperventilation Aufstossen, Kloss im Hals, Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall Muskuläre Schwäche und Verspannung, Zittern Blasse oder gerötete Haut, kühle Akren, Schwitzen Schwindel, Kopfschmerzen Respiratorisch Gastrointestinal Muskulär Dermatologisch Zentrales Nervensystem ziehen sich auf die mögliche Bedeutung der somatischen Empfindungen, wie eine «Angst zu sterben» oder «Angst verrückt zu werden». Generalisierte Angststörung F41.1 Es besteht ein über mindestens mehrere Wochen bestehender Zustand von allgemeinen Befürchtungen und Sorgen über die Zukunft verbunden mit motorischer Anspannung und vegetativer Übererregbarkeit, was sich, wenn auch in weniger heftigem Ausmass als bei einer Panikattacke, durch die in Tabelle 4 aufgeführten körperlichen Beschwerden und eine allgemeine Nervosität manifestiert. Somatoforme Störungen Somatoforme Störungen sind durch die wiederholte Darbietung körperlicher Symptome ohne die Beschwerden erklärende organische Befunde, in Verbindung mit der hartnäckigen Forderung nach medizinischer Untersuchung, definiert. Bei der somatoformen autonomen Funktionsstörung (F45.3) werden die Symptome derart geschildert, als beruhten sie auf einer körperlichen Krankheit eines Systems oder Organs, das unter Kontrolle des vegetativen (autonomen, daher der Name) Nervensystems steht. Typische dazugehörende Begriffe sind die «Herzneurose» als somatoforme autonome Funktionsstörung des kardiovasku- 15 lären Systems (F45.30) oder die «psychogene Hyperventilation» als somatoforme autonome Funktionsstörung des respiratorischen Systems (F45.33). Die Diagnose einer anhaltend somatoformen Schmerzstörung (F45.4) bedingt einen durch einen physiologischen Prozess oder eine körperliche Störung nicht erklärbaren quälenden und andauernden Schmerz (in der Regel >6 Monate), wobei so genannte Zufalls- oder Normalbefunde die Diagnose nicht ausschliessen. Obwohl im Einzelfall mitunter schwierig auszumachen, müssen psychosoziale Probleme oder emotionale Konflikte gegeben sein, die schwer genug sind, um die Störung ursächlich erklären zu können. Tabelle 5 zeigt einige typische psychosoziale Faktoren und kritische Lebensereignisse («life-events») die bei somatoformen Schmerzstörungen, aber auch bei anderen psychischen Störungen ursächlich (Belastungs- und Anpassungsstörungen F43) oder die Störung zumindest aufrechterhaltend gefunden werden und mit Hilfe der ICD-10 (Z00-Z99) codiert werden können. Chronische Schmerzen aufgrund psychophysiologischer Mechanismen sollten als psychische Faktoren oder Verhaltenseinflüsse bei andernorts klassifizierten Krankheiten (F54) sowie einer zusätzlichen Kodierung aus einem anderen Teil der ICD-10 diagnostiziert werden (z. B. chronische Rückenschmerzen bei M. Scheuerman mit inadäquater Krankheitsbewältigung ICD-10 M42.0 F54). Organisch nicht erklärbare Schmerzen können auch im Rahmen der «gros- Tabelle 5 Psychosoziale Problembereiche, die den Gesundheitszustand beeinflussen Ausbildung und Bildung (Z55) Berufstätigkeit und Arbeitslosigkeit (Z56) Wohnbedingungen und ökonomische Verhältnisse (Z59) Kulturelle Integration (Z60.3) Negative Kindheitserlebnisse (Z61) Paarkonflikt (Z63.0) Tod eines Familienmitglieds (Z63.3) Zerrüttung durch Trennung oder Scheidung (Z63.5) 16 Tabelle 6 Einteilung der Belastungs- und Anpassungsstörungen nach ICD-10 F43 Störung Beginn Dauer Akute Belastungsreaktion F43.0 Posttraumatische Belastungsstörung F43.1 Anpassungsstörung F43.2 Perakut innert Minuten 3 Tage Verzögert innerhalb von 6 Monaten nach dem Trauma Innerhalb von 1 (bis 3) Monaten nach nach dem Ereignis Mehrere Monate bis Jahre sen» Somatisierungsstörung (F45.0) auftreten bei der die Patienten über mindestens 2 Jahre andauernde multiple Symptome klagen, die meist vor dem 30 Lebensjahr beginnen und zu mehrfachen, unergiebigen Abklärungen führen («dicke Krankengeschichte»). In der Hausarztpraxis wird dieses Vollbild der Somatisierungsstörung im Gegensatz zu den zwei anderen erwähnten somatoformen Störungen selten gesehen. Belastungs- und Anpassungsstörungen Es handelt sich um Störungen, die ursächlich auf ein aussergewöhnlich belastendenes Lebensereignis («lifeevent», siehe Tabelle 5) oder auf eine besondere Veränderung der Lebensumstände zurückgeführt werden. Tabelle 6 zeigt, dass je nach zeitlichem 6 Monate Verlauf der Symptomatik drei Formen unterschieden werden. Diese Störungen sind regelmässig von teils heftigen emotionalen Reaktionen (z. B. Depressionen, Ängste, Ärger; mit einer fünften Stelle codiert) und vegetativen Symptomen begleitet. Immer besteht ein Missverhältnis zwischen den Anforderungen, die durch den psychosozialen Stressor an das Individuum gestellt werden und dessen Möglichkeiten, diese Anforderungen zu bewältigen. Erwähnung verdient, dass die Grenzen zwischen der Symptomatik einer abnormen, d. h. überdurchschnittlich intensiv oder lang anhaltenden Trauerreaktion im Sinne einer Anpassungsstörung und einer Depression fliessend sind. Es wird deshalb empfohlen, eine Trauerreaktion, die länger als sechs Monate anhält, als eine 17 depressive Störung zu kennzeichnen, sofern die diagnostischen Kriterien hierfür erfüllt sind. Übrige psychische Störungen Neurasthenie F48.0 Die Diagnosekriterien der Neurasthenie bzw. des «Erschöpfungssyndroms» haben vieles gemeinsam mit denjenigen des so genannten «Chronic Fatigue Syndroms», welches in der ICD-10 nicht aufgeführt wird. Die Diagnose erfordert eine vermehrte geistige Ermüdbarkeit nach mentaler Anstrengung mit Denk- und Konzentrationsschwierigkeiten oder eine körperliche Erschöpfung nach geringsten Anstrengungen. Mindestens zwei der folgenden sieben Symptome müssen zusätzlich vorliegen: Muskelschmerzen, Schwindel, Spannungskopfschmerzen, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Unmöglichkeit zu entspannen, Dyspepsie. Eine depressive oder Angststörung darf nicht gleichzeitig vorliegen. Persönlichkeitsstörungen nach ICD-10 F60 Die Persönlichkeitsstörungen werden anhand von Merkmalsgruppen unterteilt, die den häufigsten oder auffälligsten Verhaltensmustern entsprechen. Es finden sich stabile Verhal- tensmuster und starre Reaktionsweisen im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und in Beziehungen, welche mit Problemen im zwischenmenschlichen Bereich und beeinträchtigtem sozialen Funktionieren einhergehen. Davon abzugrenzen sind andauernde Persönlichkeitsänderungen (F62), die in Folge schwerer oder anhaltender Belastungen erworben wurden. Beim gleichzeitigen Vorliegen einer Persönlichkeitsstörung und einer anderen psychischen Störung sind beide Diagnosen zu stellen. Grundsätzlich soll die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung nur durch den Geschulten und zurückhaltend gestellt werden. Nicht selten werden Diagnosen wie «Borderline-Persönlichkeit» mit stigmatisierender Auswirkung für die Betroffenen über Jahre in Krankengeschichten weitergegeben, ohne dass die diagnostischen Kriterien tatsächlich je erfüllt waren. Störungen durch Alkohol nach ICD-10 F10 Ein schädlicher Gebrauch von Alkohol (F10.1) liegt dann vor, wenn der Alkoholkonsum tatsächlich zu einer körperlichen oder psychischen Störung der Gesundheit führt. Die Beurteilung des Umfelds, ob ein gewisses Mass an Alkohol nun gesundheitsschädigend 18 sei bzw. allfällige negative soziale Folgen durch den Alkoholkonsum, sind für die Diagnose nicht von Bedeutung. Beim Alkohol-Abhängigkeitssyndrom (F10.2) hat der Alkoholkonsum Vorrang gegenüber Verhaltensweisen, die früher für den Abhängigen wichtiger waren. Für die Diagnosestellung müssen während mindestens eines Jahres mindestens drei der folgenden sechs Kriterien gleichzeitig vorhanden gewesen sein: Übermässiges Verlangen nach Alkohol, Kontrollverlust, Entzugssymptome, Toleranzentwicklung, Vernachlässigung anderer Lebensbereiche, anhaltender Konsum trotz schädlichen Folgen. Literatur Berardi D, Berti Ceroni G, Leggieri G, Rucci P, Ustun B, Ferrari G. Mental, physical and functional status in primary care attenders. Int J Psychiatry Med 1999; 29:133 – 48 Carney RM, Freedland KE, Sheline YI, Weiss ES. Depression and coronary heart disease: a review for cardiologists. Clin Cardiol 1997; 20:196 – 200 Diling H, Mombour W. Schmidt MH. Internationale Klassifikation psychischer Störungen ICD-10. Bern: Huber 1993 Fink P, Sorensen L, Engberg M, Holm M, Munk-Jorgensen P. Somatization in primary care. Prevalence, health care utilization, and general practitioner recognition. Psychosomatics 1999; 40:330 – 8 Hautzinger M. Depressionen. Göttingen: Hogrefe 1998 Hemingway H, Marmot M. Evidence based cardiology: psychosocial factors in the aetiology and prognosis of coronary heart disease. Systematic review of prospective cohort studies. Br Med J 1999; 318:1460 –7 Linden M, Maier W, Achberger M, Herr R, Helmchen H, Benkert O. Psychiatric diseases and their treatment in general practice in Germany. Results of a World Health 19 Organization (WHO) study. Nervenarzt 1996; 67:205 – 15 Pini S, Perkonnig A, Tansella M, Wittchen HU, Psich D. Prevalence and 12-month outcome of threshold and subthreshold mental disorders in primary care. J Affect Disord 1999; 56:37 – 48 Sartorius N, Ustun TB, Lecrubier Y, Wittchen HU. Depression comorbid with anxiety: results from the WHO study on psychological disorders in primary health care. Br J Psychiatry Suppl 1996; 30:38 – 43 Schneider S, Margraf J. Agoraphobie und Panikstörung. Göttingen: Hogrefe 1998 von Känel R, Gander ML, Egle UT, Buddeberg C. Differenzielle Diagnostik chronischer Schmerzsyndrome am BewegungsapparatCodierung nach der ICD-10. Schweiz Rundsch Med Prax 2002; 91:548 – 56 Weiller E, Bisserbe JC, Maier W, Lecrubier Y. Prevalence and recognition of anxiety syndromes in five European primary care settings. A report from the WHO study on Psychological Problems in General Health Care. Br J Psychiatry Suppl 1998; 34:18 – 23 Wittchen HU, Kessler RC, Beesdo K, Krause P, Hofler M, Hoyer J. Gener- alized anxiety and depression in primary care: prevalence, recognition, and management. J Clin Psychiatry 2002; 63 Suppl 8:24 – 34 Wittchen HU, Hofler M, Meister W. Prevalence and recognition of depressive syndromes in German primary care settings: poorly recognized and treated? Int Clin Psychopharmacol 2001; 16:121 – 35 Wittchen HU, Lieb R, Wunderlich U, Schuster P. Comorbidity in primary care: presentation and consequences. J Clin Psychiatry 1999; 60 Suppl 7:29 – 36; discussion 37 – 8 Wittchen HU, Essau CA. Comorbidity and mixed anxiety-depressive disorders: is there epidemiologic evidence? J Clin Psychiatry 1993; 54 Suppl:9 – 15 Zisook S, Shuchter SR. Depression through the first year after the death of a spouse. Am J Psychiatry 1991; 148:1346 – 52 20 Die Psychiatrie als medizinischer Fachbereich Dr. med. Francesca C. Steinmann, Historische Entwicklung, Gegenwart und Zukunft FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinisches Zentrum Römerhof, Zürich Zusammenfassung Die Psychiatrie, als nicht unwesentlicher Teil moderner Medizin, ist mit zwiespältigen Assoziationen verknüpft. Die Vorstellungen sind meist vage, Verzerrungen ergeben sich zusätzlich durch Interaktionen mit persönlichen Projektionen oder Stigmatisierung durch historisch begangenes Unrecht. Imagepflege ist angebracht. Der vorliegende Artikel möchte das weite Feld der Psychiatrie, als medizinisch wissenschaftlicher Facharztbereich, in einer Übersicht darstellen, unter Einbezug der historischen Entwicklung wie auch der Ziele aktueller psychiatrischer Forschung für die nahe Zukunft. 1. Historische Entwicklung Ein Rückblick auf die letzten zweieinhalb Jahrtausende In den Schriften des Hippokrates finden sich im Corpus Hippocraticum unter «Von der heiligen Krankheit» (Morbus Sazer) moderne und aufgeschlossene Lehrmeinungen über psychische Störungen: «Es müssen aber die Menschen wissen, dass für uns die Lüste und Freuden und Lachen und Scherzen aus keiner anderen Ursache als vom Gehirn ihren Ursprung nehmen und ebenso Betrübnis und Ärger und Missstimmungen und Jammer. Und mit diesem vor allem denken, sehen und hören wir und erkennen das Hässliche und das Schöne, das Böse, und das Gute, das Angenehme und das Unangenehme, indem wir das eine nach dem Herkommen unterscheiden, anderes teils nach dem Nutzen bewerten, teils auch die Lüste und die Widerwärtigkeiten je nach den Umständen beurteilen, denn das Selbe gefällt uns nicht immer. Durch eben dieses Gehirn verfallen wir Menschen auch in Raserei und werden irre und Ängste und Schreckbilder treten uns vor die Seele, die einen in der Nacht, die anderen am Tage, und Träume und unzeitige Irrungen und grundlose Sorgen, Mangel an Erkenntnis der gegenwärtigen Verhältnisse, Ungewohntheit und Unerfahrenheit. All dieses erleiden wir durch das Gehirn, wenn dieses nicht gesund ist, sondern entweder unnatürlich warm oder kalt oder feucht oder trocken wird oder etwas Anderes wider seine Natur erleidet, was es nicht gewohnt ist und wir geraten in Raserei in Folge seiner übermässigen 21 Feuchtigkeit. Wenn aber das der Fall ist, kann weder das Sehvermögen, noch das Gehör zuverlässige Aussagen machen, sondern sieht und hört bald dieses, bald jenes und die Zunge spricht dann solche Dinge aus, wie sie der Kranke jedes Mal sieht und hört. Solange aber das Gehirn unversehrt ist, solange ist auch der Mensch bei Verstand. Wenn ihnen aber Schreckbilder vor die Seele treten, so kommt das von einer Veränderung des Gehirns. Aus diesen Gründen bin ich der Ansicht, dass das Gehirn die grösste Macht im Menschen hat. Denn dieses ist für uns der Deuter der Dinge, die die Luft ihm zuträgt, vorausgesetzt, dass es gesund ist. Es hat aber eine jede Krankheit die ihre eigentümliche Natur und Kraft und nichts ist unerklärbar und unmöglich. – Heilbar sind die meisten Krankheiten durch ganz dieselben Faktoren wie die, aus denen sie entspringen. Das also muss der Arzt wissen, damit er den rechten Zeitpunkt für jede Massnahme erfasst.» (Hippokrates 460 – 370 v. Chr.) Wesentlich in der hippokratischen Lehre ist der Grundsatz: «Auf die Ursache muss man zurückgehen und auf den Anfang der Ursachen.» So ist die Aetiologie der hippokratischen Ärzte eine durchaus rationale und frei von jeglichem Volksaberglauben (dessen Anhänger geneigt sind, überall merkwürdige Erscheinungen an Kranken auf unheimliche Dämonen zurückzuführen). Im Gegenteil werden solch atavistische Vorstellungen aufs Schärfste bekämpft. Der hippokratischen wissenschaftlichen Heilkunst liegt ein ganzheitliches Denken zu Grunde. Der hippokratische Arzt sieht stets den ganzen Organismus des Kranken, da der ganze leiblich-seelische Mensch als ein Organismus betrachtet wird. Nachdem also psychische Erkrankungen bereits in der griechischen und römischen Antike beschrieben wurden und als körperliche Erkrankung des Gehirns erkannt wurden, ging die Tradition der antiken medizinischen Heilkunst in der Folgezeit verloren. Im Mittelalter wurden psychiatrische Erkrankungen nicht mehr als solche erkannt und die psychisch Kranken wurden unter inhumanen Bedingungen in Gefängnissen verwahrt oder durch die Inquisition als Hexen oder Hexenmeister verfolgt. 22 Im 17. und 18. Jahrhundert wurden psychisch Kranke zusammen mit Behinderten, Armen, Landstreichern und Prostituierten als Asoziale in verschiedenartigen Zuchthäusern untergebracht. Dort waren sie oft angekettet und erfuhren keine Behandlung durch Ärzte. Im Zuge der Aufklärung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam es dann allmählich zu einer Humanisierung in der Behandlung der psychisch Kranken. Aus den alten zuchthausartigen Tollhäusern wurden «Irrenanstalten». In diesem Zusammenhang wird immer wieder die legendäre «Befreiung der Irren von ihren Ketten» durch den französischen Arzt Philippe Pinel erwähnt, der um 1794 in Paris die Geisteskranken im «Hospice de Bisétre» von ihren Ketten befreite. Pinel vertrat die Lehrmeinung, dass die Irren keine Schuldigen sind, die man bestrafen muss, sondern Kranke, die alle Rücksicht verdienen, die wir einer leidenden Menschheit schuldig sind. (Möller, Laux, Deister, 1995). Dies bedeutet den Beginn eines neuen Verständnisses von Geisteskrankheiten. In der Tendenz gleichgerichtete, stark sozialpsychiatrisch orientierte Impulse, gingen auch von England, in Form der so genannten «Non-Restraint-Be- wegung» aus. Insbesondere John Conolly (1794 bis 1866), der vollständig auf mechanische Zwangsmittel verzichtete und eine nachsichtige, gütige Haltung gegenüber den Patienten forderte, bestimmte eine neue Behandlungsära mit täglichen Visiten durch Ärzte, zahlreichen sozialen Veranstaltungen und regelmässiger Betätigung der Kranken in Handwerk und Landwirtschaft. (Möller, Laux, Deister, 1995). In der Schweiz führte Auguste Forel (1848 bis 1931), als Chefarzt an der Psychiatrischen Klinik Burghölzli, in diesem Sinne die bis heute bestehende Arbeits- und Beschäftigungstherapie ein, für die damals noch inaktiv und untätig gehaltenen Patienten. Auch setzte er durch, dass in der Klinik kein Alkohol mehr getrunken wurde. Zum Ersatz bot er eine klinikeigene Limonade an. Die deutsche Psychiatrie wurde im 19. Jahrhundert insbesondere durch den Streit über die Ursachen von psychischen Störungen in zwei Lager gespalten. Die «Psychiker» sahen Geisteskrankheiten als Erkrankungen der körperlosen Seele, als Folge der Sünde an. Die «Somatiker» formulierten demgegenüber naturwissenschaftliche bzw. anthropologische Erklärungsansätze. Gegen Ende des 23 19. Jahrhunderts kam es zu einer zunehmenden Integration der Psychiatrie in die Gesamtmedizin, insbesondere in die sich entwickelnde Neurologie. Emil Kraepelin (1856 bis 1926), Ordinarius für Psychiatrie in München, begründete eine Systematik psychischer Erkrankungen auf der Basis der Beobachtung des Gesamtverlaufs. Der Zürcher Professor für Psychiatrie und Chefarzt an der Psychiatrischen Klinik «Burghölzli», Eugen Bleuler (1857 bis 1939) führte, für die von Kraepelin beschriebene «Dementia praecox», den Begriff «Schizophrenie» ein. Karl Jaspers definiert 1913 den Kern der Depression als eine «tiefe Traurigkeit» und eine «Hemmung allen seelischen Geschehens». Die Krankheitssystematik, wie sie u.a. von Kraepelin und Bleuler entwickelt wurde, hatte massgeblichen Einfluss auf die weitere Entwicklung der psychiatrischen Krankheitslehre, die seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts mit dem psychiatrischen Teil der «International Classification of Diseases – ICD», vereinheitlicht wurde. In den USA wurde parallel das DSMSystem entwickelt, welches in Europa mehr in Forschungsbereichen seine Anwendung findet. Sigmund Freud (1856 bis 1936), Arzt für Neurologie und Psychiatrie, ausserordentlicher Professor in Wien, entwickelte um die Jahrhundertwende des 19./20. Jahrhunderts seine Lehre von unbewussten und neurotischen Verarbeitungsprozessen, die Grundzüge der Psychoanalyse als Erklärungsansatz für neurotische Störungen, sowie als Therapieform. Im Gefolge der Lehren von Pawlow und Skinner, über die Konditionierbarkeit bzw. das Erlernen von Verhaltensmustern, entwickelte sich eine lerntheoretische Psychologie, die psychische Störungen als Folge von Lernprozessen erklärte und mit der Verhaltenstherapie eine entsprechende Psychotherapieform bereitstellte, die heute noch zu den wichtigsten Psychotherapiemethoden gehört. Im 20. Jahrhundert gab es ganz wesentliche Fortschritte in den somatischen Behandlungsmethoden, welche die therapeutischen Möglichkeiten der Psychiatrie erheblich verbesserten und zunehmend zu einer positiven Veränderung der Versorgung psychisch Kranker beitrugen: Behandlung der progressiven Paralyse mit Fieberschüben durch Infektion mit Malariaerregern, erstmals eingeführt durch Julius Wagner. Später Ablösung dieser Therapieform durch 24 Penicilinbehandlungen. (Die Fieberkurven mit welchen die damaligen Malaria-Behandlungen dokumentiert wurden, sind zum Beispiel im Museum der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich noch heute zu besichtigen.) 1933: Publikation der Insulin-KomaBehandlung durch Manfred Sakel; diese Behandlungsmethode wurde bis in die Ära der Psychopharmakotherapie fortgeführt, ist seither obsolet. 1937: Einführung der Elektrokrampftherapie durch Kerletti und Bini. Diese noch heute erfolgreich eingesetzte Behandlungsform bei therapieresistenten Depressionen hat zu unrecht einen schlechten Ruf. Die Behandlungsform ist schonend, wird unter anästhetischer Überwachung in Narkose und peripherer Muskelrelaxation durchgeführt. Obwohl sie eine der wirksamsten und sichersten psychiatrischen Behandlungsformen darstellt und viele Patienten mit schweren – mit Psychopharmaka nicht befriedigend behandelbaren Depressionen – geholfen hat, ist sie eine der umstrittensten Therapiemethoden und ruft ausserhalb der Psychiatrischen Fachkreise grösstes Misstrauen und Angst hervor. Das Stigma der EKT, das international übrigens unterschiedlich ausgeprägt ist, tut sein Übriges dazu, dass EKT für viele Patienten und deren Angehörige inakzeptabel ist. Ab zirka 1950 Entwicklung der Psychopharmaka: 1949: Entdeckung des antimanischen Effekts von Lithium durch Cade (lithiumreiche Quellen wurden bereits bei den Römern als stimmungsstabilisierende Badekuren verordnet). 1952: Entwicklung von Chlorpromazine als erstes Neuroleptikum durch Delay und Deniker. 1954: Entdeckung des Meprobamats als Anxiolytikum durch Berger. 1957: Entdeckung des Imipramins als Antidepressivum durch Kuhn. Zunehmend gewann der biologische Forschungsansatz in der Psychiatrie an Bedeutung, eine Forschungsrichtung, die insbesondere in den letzten 40 Jahren weitgehend bestimmend war. Es geht dabei um die Klärung genetischer, neuropathologischer, neurophysiologischer und neurochemischer Fragen. Derzeit werden insbesondere Hoffnungen in die Transmitter- und Rezeptorforschung, sowie in die moderne molekulargenetische Forschung gesetzt, mit der Zielvorstellung, die biologischen Grundlagen der psychischen Erkrankungen weiter auf- 25 zudecken und darauf basierend, bessere Therapieansätze zu entwickeln. Zur Zeit des Nationalsozialismus kam es zu ungeheuren Gräueltaten in der Psychiatrie, unter anderem durch Zwangssterilisation und Ermordung unzähliger psychisch Kranker. Auch in der Schweiz gab es Zwangssterilisationen. Eine Übersichtsarbeit wurde in jüngster Zeit durch Florance Droz, unter der Leitung von Professor Daniel Hell, an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, im Rahmen einer Dissertation gemacht. Die Publikation steht kurz bevor, und soll an dieser Stelle nicht vorweggenommen werden. Sich über Jahrhunderte aufrecht erhaltende Vorstellungen von psychischen Erkrankungen als Strafe für sündhaftes Verhalten, die Verbrechen, welche in psychiatrischen Kliniken während des 2. Weltkrieges stattgefunden haben, der Umstand, dass psychische Störungen zu Verlusten oder Störungen von Kernkompetenzen (in Fühlen, Erleben, Bewusstsein, Ich-Funktionen, soziale Interaktionsfähigkeit, Kognition, Affekt) führen und gerade Krankheitseinsicht manchmal fehlen kann, was bei Selbst- oder Fremdgefährdung fürsorgerischen Freiheitsentzug und Zwangshospitalisationen/-behandlungen nötig werden las- sen, erschüttert das Ansehen der Psychiatrie. Nur langsam gelingt es, diesen Reputationsverlust auszugleichen. Imagepflege, Kommunikation und Informationsvermittlung sind heute zentrale Anliegen. So werden denn heute auch die meisten Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen von Ärzten für Allgemeinmedizin behandelt und nicht vom Facharzt (Brown; Schulberg. 1995; Hirschfeld et al., 1997). Für die psychische Gesundheit der Bevölkerung ist es deshalb wichtig, dass die in der Allgemeinpraxis angebotene psychiatrische Versorgung einen hohen Standard hat. Denn durch unzureichend behandelte und unerkannte psychiatrische Erkrankungen steigen Morbidität, Mortalität und Kosten. (Hirschfeld, 1997). In diesem Bereich ist sicherlich Handlungsbedarf vorhanden, durch verstärktes Einbringen der Psychiatrie ins Medizinstudium, in die Facharztausbildungen und die Weiterbildungen. Ein wesentlicher Grund für die Unterbehandlung psychiatrischer Erkrankungen liegt wahrscheinlich auch in der Stigmatisierung der Psychiatrie und deren Erkrankungen (Lauber et al. 2000, 2001). Diese Stigmatisierung mit Ängsten und vorgefassten fixen Meinungen (auch bei den Angehöri- 26 gen medizinischer Berufe, nicht zuletzt unter der Ärzteschaft selber, ja sogar unter Fachärzten der Psychiatrie zu finden) führt zu mangelndem Wissen des aktuellen Stands der Wissenschaft hinsichtlich der Erkennung und Behandlung psychischer Störungen. Auf emotionaler Ebene scheinen wir heute hinsichtlich psychiatrischer Erkrankungen immer noch stark durch überholte und inadäquate Vorstellungen geprägt zu sein: So ergab eine repräsentative Umfrage in der Schweizer Bevölkerung, dass depressive Erkrankungen immer noch hauptsächlich als Folge von nicht bewältigten Lebensereignissen verstanden werden und erfolgreiche, wirksame Therapieformen der Psychiatrie gar nicht in Betracht gezogen werden (Lauber et al. 2002). Die Studie legt erschreckenderweise nahe, dass die wesentlichen, und evidence-based auch erfolgreichen Behandlungsformen der Psychiatrie, von weiten Teilen der Bevölkerung abgelehnt werden, ihr nicht bekannt sind oder deren Indikationen in Bezug auf Krankheitsbilder nur vage vertraut sind, wenn solche überhaupt in Betracht gezogen werden. Imagepflege der Psychiatrie und durch die psychiatrischen Fachärzte, Kommunikation auf vielschichtigen Ebenen und Informationsvermittlung der erfolgreichen und schonenden Behandlungsformen sind heute ein zentrales Public-Health-Anliegen und im Rahmen von zunehmendem Kostendruck wichtiger denn je! 2. Gegenwart Was beinhaltet die Psychiatrie? Psychiatrie ist die medizinische Wissenschaft und fachärztliche Tätigkeit, welche die Erforschung, Diagnostik und Therapie psychischer Krankheiten des Menschen umfasst. Dabei werden in einem multidimensionalen Ansatz und einem so genannten «biopsychosozialen» Verständnis biologische und psychosoziale Faktoren und deren Auswirkungen auf das psychopathologische Erscheinungsbild betrachtet. Die Psychiatrie gliedert sich in vielfältige Untergebiete auf, so wird zum Beispiel unterschieden zwischen Erwachsenenpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, forensischer Psychiatrie, Psychopharmakologie, biologischer Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. 27 Diagnostik Neben der somatischen Untersuchung des Patienten, sowie den klassischen bildgebenden Verfahren, steht vor allem die Psychodiagnostik im Vordergrund. Im Gegensatz zur somatischen Medizin, wo der Arzt objektive körperliche Befunde erheben kann, muss heute in der Psychiatrie weitgehend noch indirekt vorangegangen werden. Die Veränderungen, die es zu erfassen gilt, werden hauptsächlich durch Gespräche und genaue Verhaltensbeobachtung erfasst. Krankheitssymptome, welche sich in Form von Verhaltensauffälligkeiten zeigen, sind der Beobachtung leichter zugänglich. Viel schwieriger ist es, Symptome zu erkennen, die sich vorwiegend auf der inneren Erlebensebene abspielen. Gestik, Mimik und Bewegungsabläufe können dabei helfen, etwas über das innere Erleben sagen zu können. Wiederum über das Gespräch versucht man, Informationen über das Erleben eines Anderen und seiner motivationalen Hintergründe zu bekommen. Zur Validierung der so erhaltenen Information erfolgt die Orientierung an der Indikatorfunktion der Sprache und des Verhaltens. (Indikatoren sind vom Sprechenden unbeabsichtigte Mitteilungen, verbaler oder nonverbaler Art, die der geübte Untersucher erschliessen kann.) Damit einhergehend ergibt sich in der Psychiatrie eine wichtige Besonderheit: Gespräch und Verhalten werden durch die Persönlichkeit des Untersuchers und durch die emotionale Interaktion zwischen Patient und Arzt mitgeprägt, sodass der auf Verhaltensbeobachtung und Gespräch basierende Untersuchungsprozess in weit stärkerem Masse subjektiven Beobachtungsinterpretationen ausgesetzt ist, als die meisten diagnostischen Prozesse in der somatischen Medizin. Emotionale Ausgangsbasis der Gesprächspartner, sowie die Interaktion zwischen Arzt und Patient nehmen auf den Gesprächsablauf und die damit verbundenen Wahrnehmungsprozesse prägenden Einfluss. Trotz dieser Besonderheiten ist die Psychiatrie ein Teil der Medizin. Das Besondere der Psychiatrie liegt gerade darin, dass Körperliches und Psychisches als mögliche Ursachen für psychopathologische Veränderungen in gleichem Masse Berücksichtigung finden. 28 Therapie Die psychiatrischen Therapieverfahren sind vielfältig in ihrer Methodik. Neben der Psychopharmakotherapie werden Lichtbehandlungen, EKT (Elektrokrampftherapie), Schlafentzug partiell oder ganz erfolgreich eingesetzt, je nach Indikation. Die Psychotherapie beinhaltet die Behandlung von Kranken mit psychischen Mitteln, insbesondere durch Gespräche und übende Verfahren. Die Methoden sind auch hier vielfältig. Die wichtigsten Grundlagen der Psychotherapieformen bilden Tiefenpsychologie (Psychodynamik) einerseits und Lern-/Verhaltenspsychologie andererseits. Als besonders wichtig haben sich im Rahmen des biopsychosozialen Krankheitsverständnisses die Soziotherapien herauskristallisiert. Das heisst, die Behandlung von Kranken durch Milieufaktoren, Strukturierung des Tagesablaufs, Interaktion im Rahmen von Gruppenprozessen, Beschäftigungs- und Arbeitstherapie. Nicht verschwiegen werden soll aber, dass trotz dieser positiven Entwicklungen, nach wie vor Handlungsbedarf zur Optimierung der Versorgung psychisch Kranker besteht. Sowohl im ambulanten wie auch stationären Bereich nehmen die Behandlungsbe- dürfnisse konstant zu, was insbesondere, und gerade weil die Psychiatrie ein psychisch interaktives Gebiet – und deshalb enorm aufwendig in Bezug auf Manpower – ist, bedeutet, dass wir dringend fachlich geschulte und von ihrer Persönlichkeitsstruktur her reife, belastbare, interessierte und innovative Ärzte benötigen. Im Bereich zwischen stationärer und ambulanter Behandlung gibt es noch viel zu wenig qualifizierte Übergangseinrichtungen, (z. B. betreutes Wohnen, Tagesklinik) und auch adäquate Versorgungsangebote für die wachsende Zahl psychisch kranker Alterspatienten müssen geschaffen werden. Exkurs Wie stehen wir zur Psychiatrie? Neben steigendem Interesse für lange vernachlässigte psychische Faktoren hat die Psychiatrie unter ärztlichen Kollegen ein zwiespältiges Image. Das Besondere in der Psychiatrie liegt aber auch in der Rolle des psychisch Kranken. Der psychisch Kranke wird in unserer Gesellschaft noch immer ganz anders gesehen als der körperlich Kranke. Symptome einer psychischen Erkrankung sind für viele schwer verständlich, werden abgelehnt, als 29 schuldhaft interpretiert, oder gar als gefährlich angesehen. Hilfe zu suchen wegen psychischer Probleme ist für einen Patienten meist viel problematischer, als die Inanspruchnahme ärztlicher Beratung wegen körperlicher Beschwerden. Es fällt einem Patienten oft sehr schwer, sich einzugestehen, dass er psychische Probleme hat und dass er sie nicht selbst lösen kann. Viele Patienten denken nicht daran, dass hinter diesen «psychischen» Problemen nicht immer eine mangelnde Bewältigung der Lebensschwierigkeiten, sondern häufig eine echte körperliche Erkrankung stecken kann. Es braucht von ärztlicher Seite meist viel Geduld und grossen zeitlichen Aufwand, dem Patienten – der in misstrauischer, ängstlicher Abwehrhaltung steht – die auf mikrobiologischer und zellulärer Ebene stattfindenden pathophysiologischen Mechanismen seiner Krankheitssymptome anschaulich zu erklären und ein Krankheitsverständnis zu erarbeiten und so eine Motivation zur Therapie zu entwickeln, die auf Information und Wissen beruht. Insbesondere völlig vom normalen Denken und Erleben abweichende Symptome, wie zum Beispiel Wahnideen oder Sinnestäuschungen, aber auch Symptome depressiver Störungen versucht der Patient oft lange für sich geheim zu halten, um die «Verrücktheit» seines Erlebens nicht nach Aussen dringen zu lassen. Psychisch Kranke müssen die Sorge haben, durch Tabuisierungs- und Diskriminierungsprozesse aus den normalen gesellschaftlichen Beziehungen ausgeschlossen zu werden. Auch hier sind wir mit emotionalen Beurteilungsmechanismen konfrontiert, welche mit einer Stigmatisierung einhergehen. Besonders tragisch wirkt sich dies darin aus, dass der psychisch Kranke nicht nur unter seinen Krankheitssymptomen leiden muss und er aufgrund von Angst, Unwissenheit und vorgefassten Meinungen, Therapiemöglichkeiten ablehnt, welche grosse Vorteile in Bezug auf den Langzeitverlauf, das subjektive Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit usw. bringen könnten, sondern er muss zusätzlich, emotional hoch besetzte Bewertungen seiner Krankheit erleben, welche mit Scham, Angst, Verzweiflung, Suizidalität, Einsamkeit, Ausgrenzung und Ablehnung einhergehen. Anschaulich zeigt sich dies z. B. im Unterschied der persönlichen Betreuung von Seiten Angehöriger und Bekannter, welche den verschiedenen Kranken entgegengebracht wird: Während auf somatischen Stationen 30 Blumen, Geschenke und Karten geschickt werden, Familien, Kollegen und Mitarbeiter anrufen und rege Besuche stattfinden und der Kranke einer breiten sozialen Akzeptanz und Unterstützung begegnet, findet sich auf einer psychiatrischen Station kaum ein Gruss, ein Blumenstrauss von Mitarbeitern, Freunden und es fehlen die üblichen Pralinenschachteln, Karten und Glücksbringer von Bekannten und Kollegen. Die Kranken sind alleine und einsam. Oft schämen sie sich, ihren Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik bekannt werden zu lassen. Besuche finden kaum statt, wenn, dann nur von Seiten engster Angehöriger, wie Eltern oder Geschwister, die ebenfalls stark leiden. Die Kranken, wie ihre Umgebung sind irritiert durch die psychischen Krankheitssymptome und aufgrund der Verunsicherung, die diese auslösen, überlässt man die Patienten nicht selten sich selber und der Institution. 3. Zukunft Forschung In der psychiatrischen Forschung werden heute die grössten Anstrengungen unternommen, die biologischen Mechanismen, welche den Funktionsstörungen des Gehirns bei psychiatrischen Erkrankungen zu Grunde liegen, zu identifizieren und die Wirkungsweise therapeutischer Interventionen zu analysieren. Ziel ist eine mehrdimensionale Erfassung und Charakterisierung psychischer Störungen auf verschiedenen biologischen Ebenen: genetisch, funktionell, strukturell, elektrophysiologisch, biochemisch, neurophysiologisch, usw. Damit werden neben den indirekten Untersuchungsmethoden direkte, objektivierbare, weniger vom Untersucher abhängige Methoden entwickelt. Diese sollen und können die klinische Exploration durch den erfahrenen Arzt jedoch nicht ersetzen, sondern sollen diesen vielmehr hilfreich unterstützen. In der Folge seien nur zwei Gebiete im Ansatz vorgestellt, aus dem weit umfassenden, lebendigen Forschungsbereich der Psychiatrie: 31 Neuro-Imaging Strukturelle und funktionelle Bildgebungsverfahren haben das Wissen über die Funktion des Gehirns im Rahmen psychiatrischer Störungen erweitert und bringen laufend neue Erkenntnisse. Brain-Imaging könnte dazu beitragen, das Verständnis für psychiatrische Erkrankungen zu revolutionieren. Mit Beginn der 90er Jahre entwickelten sich in der Magnetresonanztomographie, über die klassische Morphologie hinausgehend, zunehmend neue Möglichkeiten zum Studium der Physiologie, Biochemie und Funktion des Zentralen Nervensystems (Braus; Henn, 2002). Bei seelischen Störungen liegen fundamentale Dysfunktionen auf unterschiedlichen Ebenen der neuronalen Informationsverarbeitungsprozesse mit konsekutiv verändertem Verhalten vor. Die Psychopathologie kann dabei als Veränderung in der Interaktion neuronaler Netzwerke, bzw. unterschiedlicher neuronaler Subsysteme verstanden werden (Spitzer M., 1997). Mit Hilfe von MRI (MagnetresonanzImaging) und fMRI (funktionelles Magnetrestonanz-Imaging), SPECT(Single Photon Emission Computerized Tomography) und PET (Positronen-Emissions-Tomographie) konnten Struk- turänderungen, welche mit den klinischen Symptomen assoziiert werden, dargestellt werden (Schnider, Treyer, Buck, 2000). Vereinzelt gelang es auch zerebrale Strukturänderungen darzustellen, welche einem klinischen Krankheitsgeschehen vorausgehen. Diese könnten somit als Frühindikatoren für gewisse Psychosen dienen (Fannon et al. 2000a Nov.). Unter Studienverhältnissen werden funktionelle Techniken auch dazu eingesetzt, Veränderung in den Stoffwechselaktivitäten verschiedener Hirnareale unter Behandlungen zu verfolgen. Dadurch konnten wichtige Informationen aufgezeichnet werden, auf welche Weise Psychopharmaka die pathologischen Hirnfunktionen verbessern können. Funktionelle Imaging-Techniken könnten in Zukunft wertvolle Informationen liefern für die Auswahl der geeigneten Therapieverfahren. Gerade in der Erforschung der Krankheiten des schizophrenen Formenkreises konnten funktionelle MRI-Verfahren, die zentrale Rolle des Thalamus, bei der Pathogenese zeigen (Ettinger et al. 2001; Andreasen et al. 1997; Korn et al. 2000). Struktur-Imaging-Untersuchungen im Frühstadium der Psychosen, konnten die neuronale Entwicklungshypothe- 32 se der Schizophrenien unterstützen (Fannon et al. 2000b Oct.) . Die schizophrenen Störungen sind wahrscheinlich die schwersten psychiatrischen Erkrankungen. Zirka 1% der Bevölkerung erkrankt an schizophrenen Störungen Ende der Adoleszenz oder Anfangs des Erwachsenenalters. Die Erkrankungen persistieren für den Rest des Lebens und gehen mit signifikanter Morbidität und Behinderung einher. Die heute existierenden Therapien sind erst teilweise effektiv, die Entwicklung spezifisch greifender Therapiemöglichkeiten hat hohe Priorität und wird intensiv vorangetrieben. In der Schweiz findet u. a. unter der Leitung von PD F. X. Vollenweider an der Forschungsabteilung der PUK Zürich, seit Jahren, eine international mit Interesse verfolgte, psychiatrische Forschung im Bereich von schizophrenen Psychosen statt (Vollenweider 1998; 1998; 2001). Genetische Forschung Die Möglichkeit, mittels Genanalysen das Ansprechen auf Behandlungen oder das Auftreten von möglichen Nebenwirkungen spezifischer vorhersagen zu können, würde eine grosse Erleichterung für den Patienten bringen und den Ärzten effektivere und rationalere Behandlungsstrategien ermöglichen. Psychiatrische Erkrankungen haben höchst wahrscheinlich multifaktorielle Ursachen und damit auch ihr Ansprechen auf Behandlungen. Wahrscheinlich basieren sie auf Interaktionen zwischen mehreren Genen (polygenetisch) und dem sozialen Umfeld und die Analyse der Zusammenhänge gestaltet sich dementsprechend komplex. Die Pharmakogenetik untersucht diesen Einfluss des genetischen Polymorphismus auf die Pharmakodynamik und -kinetik und versucht daraus das Ansprechen auf medikamentöse Behandlung und das Nebenwirkungsprofil zu bestimmen. Als Beispiel sei hier nur das Cytochrom P450 erwähnt, welches in der Phase I der Metabolisierung von Medikamenten involviert ist und daher von nicht unwesentlichem Einfluss auf die Pharmakokinetik etlicher Substanzen ist. Das Cytochrom P450 umfasst mehr als 30 Enzyme (Weber, 2001). Die Biotransformation der meisten Psychopharmaka ist von P450 Isoenzymen abhängig (Chen et al., 1996). Unterschiedliche Enzym-Aktivität wirkt sich wesentlich auf die Pharmakokinetik der entsprechenden Medikamente aus und muss oft in der klinischen 33 Therapie Berücksichtigung finden (z. B. Dosisanpassung bei Slow- oder Ultrarapid-Metabolisierern), um überhaupt eine Arzneimittelwirkung zu erzielen oder um das Auftreten schwer wiegender Nebenwirkungen zu verhindern. Gerade bei Medikamenten mit einem schmalen therapeutischen Fenster (z. B. Lithium) könnte die Pharmakogenetik wertvolle Informationen liefern und prospektive, anstelle der heutigen reaktiven Behandlungsstrategien ermöglichen. Literatur Andreasen N. The role of the thalamus in schizophrenia. Can J Psychiatry 1997; 42: 27 – 33 Braus DF, Henn FA. Psychiatrie im Wandel: Neuronale Netzwerkstörungen lassen sich mit moderner Kernspinntomographie sichtbar machen. Schweiz Arch Neurol Psychiatr 2002; 153: 256 – 65 Brown C, Schulberg H. The efficacy of psychosocial treatments in primary care. A review of randomized clinical trials. Gen Hosp Psychiatry Nov 1995; 17(6): 414 – 24. Review Chen S, Chou WH et al. The cytochrome P4502D6 (CYP2D6) enzyme polymorphisms: screening costs and influence on clinical outcomes in psychiatry. Clin Pharmcol Ther 1996 Nov; 60(5): 522 – 534 Callicott JH, Ramsey NF, Tallent K et al. Functional magnetic resonance imaging brain mapping in psychiatry: methodological issues illustrated in a study of working memory in schizophrenia. Neuropsychopharmacology 1998; 18: 186 – 96 Ettinger U et al. Magnetic resonance imaging of the thalamus in first-episode psychosis. American Journal of Psychiatry 2001; 158: 116 – 118 34 Fannon D, Chitnis X, Doku V et al. Lauber C, Nordt C, Sartorius N, Features of structural brain abnormality detected in first-episode psychosis. Am J Psychiatry 2000a Nov. 157(II): 1829 – 34 Fannon D et al. Third ventricle enlargement and developmental delay in first-episode psychosis: preliminary findings. Br J Psychiatry. 2000b Oct; 177: 354 – 9 Hippokrates, fünf auserlesene Schriften, Capelle W, Fischer Bücherei, Januar 1959, S. 71 – 72, c.14, c.15, c.16 Hirschfeld R, Keller M et al. The National Depressive and ManicDepressive Association consensus statement on the undertreatment of depression. JAMA Jan 22 – 29 1997; 277(4): 333 – 40 Korn M. A Review of the Thalamus in Schizophrenia, Medscape, 2000 (http://www.medscape.com/meds cape/cno/2000/CINP/Story.cfm? story_id=1492) Lin KM, Poland RE et al. The evolving science of pharmacogenetics: clinical and ethnic perspectives. Psychopharm Bull 1996; 32(2): 205 – 217 Lin KM, Smith MV et al. Culture and Psychopharmacology. Psychiatr Clin North Am 2001; 24(3): 523 – 538 Falcato L, Rössler W. Public acceptance of restrictions on mentally ill people. Acta Psychiatr Scand 2000: 102 (Supplement 407): 26 – 32 Lauber C, Nordt C, Falcato L, Rössler W. Lay recommondations on how to treat mental disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol (2001) 36: 553 – 556 Lauber C, Nordt C, Falcato L, Rössler W. Public attitude to compulsory admission of mentally ill people. Acta Psychiatr Scand 2002: 105: 385 – 389 Lauber C, Nordt C, Falcato L, Rössler W. Behandlungsvorstellungen der Bevölkerung zu Depression und Schizophrenie. Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. I und II/2002, S. 93 – 96 Möller H-J, Laux G, Deister A. Psychiatrie, 1995 Hippokrates Verlag. Spitzer M. A cognitive neuroscience view of schizophrenic thought disorder. Schizophr Bull 1997; 23:29 – 50 Schnider A, Treyer V, Buck A. Selection of Currently Relevant Memories by the Human Posterior Medial Orbitofrontal Cortex. The Journal of Neuroscience. August 1, 2000, 20(15): 5880 – 5884 35 Vasquez-Barquero J et al. Mental health in primary care. An epidemiological study of morbidity and use of health resources. Br J Psychiatry Jun 1997; 170: 529 – 35 Vollenweider F. X. Neue Aspekte der PET- und SPECT-Forschung: Metabolische Korrelate psychotischer Störungen bei Schizophrenen und Modell-Psychosen, 1998, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich – Forschungsabteilung Vollenweider F. X. Advanced and Pathophysiological Models of Hallucinogenic Drug Action in Humans: A Preamble to Schizophrenia Research, Psychopharmacopsychiatr. 31 (1998) (Supplement) 1 – 12 Vollenweider F. X. Pharmacological Aspects. Brain mechanisms of hallucinogens and entactogens. Diagnoses in Clinical Neuroscience Vol 3 No 4,2001 Weber V W. The legacy of pharmacogenetics and potential applications. Mutation Research 2001; 479: 1 – 18 36 Psychische Krankheiten aus Sicht des Privatversicherers Karl Groner, Chief Underwriting & Compliance «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft, Zürich Zusammenfassung Die Häufigkeit psychischer Erkrankungen hat in den letzten Jahren überproportional zugenommen. Der Trend wird durch konjunkturelle Schwächephasen noch verstärkt. Diese Entwicklung verursacht Sozial- und Privatversicherern hohe Belastungen im Leistungsbereich. Der Artikel schildert, wie private Versicherungsgesellschaften der Problematik begegnen. Er schildert insbesondere die Aspekte der Antragsprüfung und gibt Erläuterungen zur Einschätzung des Todesfall- und Erwerbsunfähigkeitsrisikos. Einleitung Gemäss IV-Statistik bezogen auf Januar 2002 rund 73 000 Personen eine Rente wegen psychischer Krankheiten. Dies sind 33% aller Rentenbezüger und im Vergleich zu 1986 fast dreimal mehr. Im gleichen Zeitraum nahm die Gesamtzahl der wegen Krankheit (alle Ursachen) zugesprochenen Renten von rund 85 000 auf 157 000, also um «nur» zirka 85% zu. Im Privatversicherungsbereich werden nach Ursachen aufgegliederte Invaliditätsstatistiken sehr spärlich publiziert. Nach übereinstimmenden Aussagen von im Leistungsbereich tätigen Spezialisten ist aber auch bei den Privatversicherern eine ähnliche Tendenz zu beobachten. Es ist hinlänglich bekannt, dass die Belastung des sozialen und privaten Versicherungswesens in Zeiten konjunktureller Schwächephasen mit zunehmender Arbeitslosigkeit wächst. Die Gründe dafür lassen sich nicht statistisch nachweisen. Unbestritten ist aber, dass bei ungünstigen beruflichen Umständen und drohender Arbeitslosigkeit die Renten von IV, BVG und Privatversicherung attraktiver Tabelle 1 Rentnerinnen und Rentner nach Invaliditätsursache und Geschlecht in der Schweiz, Januar 2002 Invaliditätsursache Männer Geburtsgebrechen 15 000 Krankheit 93 000 – davon psychische Leiden 38 000 Unfälle 16 000 Total 123 000 Frauen 13 000 77 000 35 000 7 000 96 000 Total 27 000 170 000 73 000 23 000 220 000 Total in % 13 77 33 10 100 37 sind als die Taggelder der ALV, da damit ein höheres und länger dauerndes Ersatzeinkommen garantiert ist. Gewisse gesundheitliche Beeinträchtigungen, die lange keinen oder einen nur unwesentlichen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit hatten, werden plötzlich gravierend und beim Versicherer als Grund für die Geltendmachung von Versicherungsleistungen herangezogen. Auch in fraglichen Fällen bestehen oft gute Chancen für einen Rentenbezug, weil es für den Versicherer oft schwierig ist, die ungenügende Leistungsvoraussetzung nachzuweisen. Besondere Schwierigkeiten bestehen dabei im Zusammenhang mit Leiden, die sich objektiv schlecht nachweisen lassen. Als Paradebeispiele seien hier die Krankheiten des Bewegungsapparates, insbesondere Rückenbeschwerden, die psychischen Störungen und generell psychosomatische Beschwerdebilder genannt. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Versicherungen gemäss Versicherungsvertragsgesetz, also die freiwilligen Versicherungen auf privater Basis, im Besonderen auf Lebensversicherungen, Renten bei Erwerbsunfähigkeit und Krankentaggelder. Das Prinzip der Privatversicherung besteht darin, dass sich verschiedene Personen in einem Risikokollektiv zu- sammenschliessen, um gemeinsam mittels relativ bescheidener Beiträge den finanziellen Schaden zu decken, den Einzelne durch Eintritt des versicherten Ereignisses erleiden. Voraussetzung für das Funktionieren des Systems ist, dass die Höhe des Risikos statistisch berechenbar ist und dass die Mitglieder des Kollektivs ein einigermassen identisches Risikoprofil aufweisen. Wenn vor allem Personen ins Kollektiv einträten, die ein überdurchschnittliches Risiko aufweisen (Antiselektion genannt), würden die Prämien zur Deckung der Schäden nicht mehr ausreichen; sie müssten erhöht werden. Dies würde auf gute oder durchschnittliche Risiken abschreckend wirken. Ihr Austritt aus der freiwilligen Versicherung wäre die logische Folge, wie der über kurz oder lang folgende Ruin der Versicherung. Der Versicherungsgesellschaft kommt die Aufgabe zu, das Kollektiv zusammenzuführen, die vereinbarten Prämien zu kassieren, Schadensansprüche zu prüfen und zu befriedigen, aber auch neue Mitglieder ins Kollektiv aufzunehmen. Im Rahmen der Risikoprüfung wird dabei abgeklärt, ob der Kandidat durchschnittliche Risikomerkmale aufweist, die eine Versicherung zu normalen Prämiensätzen zulassen. 38 Bei erhöhten Risiken ist in den meisten Fällen eine Versicherung gegen Mehrprämie möglich. Die Höhe der Mehrprämie basiert ebenfalls auf statistischen Grundlagen, vor allem auf jahrzehntelangen Beobachtungen grosser Versichertenkollektive, ergänzt durch Resultate anerkannter klinischer Studien, wobei auch die vorhersehbaren Auswirkungen substanzieller medizinischer Fortschritte berücksichtigt werden. Auf dieser Basis kann ziemlich präzise festgelegt werden, wie stark die Sterblichkeit eines Kollektivs mit Hypertonie, Diabetes oder anderen, statistisch ausreichend erfassten Krankheiten, erhöht ist. Die in den später folgenden Ausführungen erwähnten Risikozuschläge sind jeweils in Prozenten der reinen Risiko-Grundprämie zu verstehen. Einiges schwieriger ist die Festlegung von Risikozuschlägen in der Arbeitsresp. Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Ursachenabhängige statistische Unterlagen sind in diesem Versicherungszweig wesentlich spärlicher vorhanden. Mehrprämien können deshalb oft nur näherungsweise festgelegt werden. Die grösste Schwierigkeit besteht aber darin, dass der Eintritt des versicherten Ereignisses sehr stark von der Persönlichkeit, der subjektiven Einstellung und dem privaten und beruflichen Umfeld der versicherten Person abhängig ist. Identische medizinische Zustände können bei zwei verschiedenen Personen, je nach deren Persönlichkeit, ihrer Einstellung und dem sozioökonomischen Umfeld, völlig unterschiedliche Auswirkungen bezüglich Arbeits- und Erwerbsfähigkeit haben. Dies führt dazu, dass in vielen Fällen eine Erwerbsunfähigkeitsdeckung zwar gewährt werden kann, bestimmte vorbestehende Gesundheitsstörungen aber von der Deckung ausgeschlossen werden müssen. Hierbei stehen Erkrankungen mit grosser subjektiver Komponente im Vordergrund. Als Beispiele stehen wiederum muskuloskelettale Erkrankungen sowie psychische und neurovegetative Störungen. Versicherungsmedizinische Ausgangslage Psychische Erkrankungen sind heutzutage für eine erhebliche Morbidität und Mortalität verantwortlich. Schätzungen zufolge sind z. B. in den USA im Laufe eines Jahres 50 Millionen Erwachsene von einer psychischen Störung betroffen. In Deutschland geht man davon aus, dass zirka 40% der Patienten, die ihren Hausarzt aufsuchen, eine wesentliche psychische Störung aufweisen. Wie auch Sozial- 39 versicherungsstatistiken zeigen, sind diese für einen beträchtlichen Teil der Erwerbsunfähigkeitsrenten und langfristigen Versorgungsansprüche verantwortlich. Einige Betroffene, die eine schwere psychische Störung durchgemacht haben, genesen und können ihre früheren Aktivitäten wieder voll aufnehmen. Andere werden bereits unter relativ geringen Belastungen für längere Zeit arbeitsunfähig. Die meisten Erwachsenen sind von ihrer Persönlichkeit her ausreichend gefestigt, um den Alltagsbelastungen standzuhalten. Allerdings reagiert der Einzelne emotional ganz unterschiedlich auf von aussen einwirkenden Stress. Es ist daher schwer, genau festzulegen, was noch als Spielart der «Norm» gilt und ab wann von einer Störung zu sprechen ist. Bei einigen Menschen kommt es jedoch zu einer klaren Persönlichkeitsstörung, die zu auffälligen Verhaltensmustern, abnormen emotionalen Reaktionen oder zu endogenen emotionalen und mentalen Funktionsstörungen führt. Die starke subjektive Komponente psychischer Störungen stellt neben der hohen Inzidenz für Rezidive eine erhebliche Herausforderung für die versicherungstechnische Risikoprüfung dar. Innerhalb von Litera F der ICD-10 Nomenklatur sind für den Privatversicherungsbereich mengenmässig vor allem die affektiven Störungen (F30 – F39) und die Belastungs-, somatoformen und neurotischen Störungen (F40 – F49) relevant. Ich werde mich deshalb in meinen Ausführungen auf diese Krankheiten beschränken und nicht auf organische psychische Krankheiten, psychische Störungen durch Drogenabusus, Persönlichkeitsund Verhaltensstörungen, Demenzerkrankungen usw. eingehen. Für letztere ist, wenn überhaupt, eine Todesfalldeckung oft nur zu stark erschwerten Bedingungen möglich. Die Versicherung der Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit muss meist abgelehnt werden. Ebenfalls nicht speziell eingehen werde ich auf «moderne» Erkrankungen wie das Chronique Fatigue Syndrom, das Fibromyalgie Syndrom usw., deren Abgrenzung zur psychischen Störung kontrovers diskutiert wird. Informationsbeschaffung Für die Aufnahme in eine Lebens-, Erwerbsunfähigkeits- oder Taggeldversicherung muss der Antragsteller in der Regel Auskunft über seinen Gesundheitszustand geben. Bei kleineren Leistungen ist ein persönlich zu beantwortender Fragebogen ausrei- 40 chend. Für höhere Summen ist eine ärztliche Untersuchung notwendig, die ebenfalls eine Befragung des Kandidaten beinhaltet. Gemäss Versicherungsvertragsgesetz ist der Antragsteller der Versicherungsgesellschaft gegenüber verpflichtet, alle «für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsachen, so weit sie ihm beim Vertragsabschluss bekannt sind oder bekannt sein müssen, schriftlich mitzuteilen» (Art. 4 VVG). Als erheblich gelten all diejenigen Informationen, nach denen der Versicherer «in bestimmter, unzweideutiger» Weise fragt. Im Falle einer Falschdeklaration hat der Versicherer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Da psychische Störungen und deren Schweregrad naturgemäss oft sehr subjektiv empfunden werden, ist eine unmissverständliche Fragestellung, die keinen Spielraum für Interpretation offen lässt, von grosser Wichtigkeit. Denkbar wäre z. B., dass die Frage «Leiden Sie gegenwärtig an einer Gesundheitsstörung?» verneint wird, wenn eine Depression vom Hausarzt gleichzeitig mit einer Hypertonie medikamentös behandelt wird. Subjektiv könnte die Depression als Begleiterscheinung und die Therapie als Zusatzmedikation zur Hypertonie empfunden werden. Obwohl objektiv eine Falschdeklaration vorliegt, schützt die Rechtsprechung oft die subjektiv als richtig empfundene Deklaration des Versicherten. Die meisten Versicherungsgesellschaften stellen daher Fragen wie «Nehmen oder nahmen Sie in den letzten 5 Jahren regelmässig Medikamente? Welche? Grund?» oder «Sind oder waren Sie in den letzten 5 Jahren in psychiatrischer oder physiotherapeutischer Behandlung?» Psychische Störungen tauchen in den Fragebogen und Attesten unter den verschiedensten Bezeichnungen auf. Neben Begriffen wie Überarbeitung, Stress, Eheprobleme usw. sind auch «ärztliche» Diagnosen wie vegetative Dystonie, larvierte Depression o. ä. anzutreffen. Der Risikoprüfer ist in solchen Fällen auf detailliertere Auskünfte angewiesen, die er – mit schriftlicher Einwilligung der zu versichernden Person – beim behandelnden Arzt anfordert. Je nach Quelle sind solche Auskünfte von unterschiedlicher Aussagekraft und gelegentlich für die Risikoeinschätzung kaum verwertbar. Wenn keine Behandlung durch einen Psychiater erfolgte, ist oft keine Diagnose gemäss ICD-10 oder DSM-IV erhältlich. In solchen Fällen ist es wichtig, eine möglichst umfassende Beschreibung des Zustandsbildes, 41 des Verlaufs und des persönlichen Umfeldes zu erhalten. Idealerweise sollte eine ärztliche Auskunft folgende Elemente umfassen: Diagnose, wenn möglich mit ICD-10oder DSM-IV-Klassifikation. Schweregrad und Dauer der Erkrankung und Angabe, ob die Episode einmalig oder wiederholt aufgetreten ist. Dauer seit letzter Episode. Perioden von Arbeitsunfähigkeit. Behandlung: Dauer der Hospitalisierung(en) und Dauer bzw. Typ der ambulanten Behandlung. Timing der medikamentösen Therapien, Compliance. Wirkung der einzelnen Therapien. Aktueller psychischer Zustand; ist/sind der/die auslösenden Faktoren noch vorhanden? Positive Familienanamnese für psychische Erkrankungen oder Selbstmord. Angaben zur beruflichen Tätigkeit, zum Anstellungsverhältnis und zur psychosozialen Funktionsfähigkeit. Persönlichkeit und Bewältigungseigenschaften. Familienstruktur und -beziehungen. Jede/r Veränderung/Rückgang der täglichen Aktivitäten in der jüngsten Vergangenheit. Verhaltensauffälligkeiten. Assoziierte Erkrankungen. Alkoholprobleme, Drogenkonsum. Suizidversuche mit Datum. Meist sind Informationen in diesem Umfang und dieser Tiefe nicht erhältlich. Dies führt dazu, dass vorsichtige Annahmen getroffen werden müssen, die naturgemäss zu einer für den Kandidaten ungünstigeren Risikoeinschätzung führen. Dies müsste nicht sein! Als Folge der verstärkten Thematisierung und Enttabuisierung psychischer Krankheiten wird heute auch bei kleineren Problemen viel schneller ein Psychiater, Psychotherapeut oder Psychologe aufgesucht als noch vor 10 oder 15 Jahren. In den Köpfen der Risikoprüfer ist aber nach wie vor die Meinung verankert, dass einer psychiatrischen Behandlung in der Regel eine gravierende Störung zugrunde liegt. Umfassende, detaillierte Informationen liegen also im Interesse des Patienten, weil sie in einer Vielzahl von Fällen einen eher günstigeren Annahmeentscheid erlauben. Einschätzung des Todesfallrisikos Das erhöhte Todesfallrisiko im Zusammenhang mit einer psychischen Grunderkrankung ist im wesentlichen auf die im Vergleich zu Gesunden 42 Tabelle 2 Suizid und psychiatrische Diagnosen Psychiatrische Diagnosen bei Suiziden Häufigkeit affektiver Störungen bei Suiziden* Häufigkeit von Sucht (Alkohol, Drogen) bei Suiziden* Häufigkeit von Persönlichkeitsstörungen bei Suiziden* Lebenszeit-Risiko für Suizid bei Vorliegen einer Major Depression Lebenszeit-Risiko für Suizid bei Vorliegen einer Schizophrenie Lebenszeit-Risiko fürSuizid beiVorliegen einer Sucht >90 % 40 – 70% 25 – 50% 30% 15% 10% 3% * Komorbidität mit mehreren psychiatrischen Diagnosen ist häufig. (Quelle: the International Handbook of Suicide and Attempted Suicide, K. Hawton, K. Van Heeringen (eds.) chichester; Wiley & Sons: 2000) erhöhte Suizid- und Unfallinzidenz zurückzuführen. In über 90% aller Suizide liegt eine psychiatrische Diagnose vor. Nach einem Suizidversuch sollte gemäss GUM 1 während eines Jahres eine Ablehnung ausgesprochen werden. Unabhängig von der separat zu tarifierenden psychiatrischen Grunderkrankung, wird während der folgenden 5 Jahren ein Risikozuschlag von 5‰ der Todesfallsumme empfohlen, d. h. man geht von der statistisch begründeten Annahme aus, dass von 1000 versicherten Personen mit identischer Anamnese pro Jahr 5 an Suizid sterben. Nach 6 Jahren ist eine Normalannahme möglich. Voraussetzung ist, dass es sich um einen einmaligen Versuch handelte und kein Kumul von ungünstigen Faktoren vorliegt (siehe Tabelle 2). In der privaten Lebensversicherung der III. Säule ist zwar der Suizid während der ersten 3 Jahre von der Versicherungsdeckung ausgeschlossen (keine entsprechende Karenzfrist gibt es in der beruflichen Vorsorge). Trotzdem werden die erwähnten Zuschläge erhoben, da Suizide oft als Unfall getarnt werden und deshalb nicht oder nur mit grossen Schwierigkeiten nachgewiesen werden können. Bei psychiatrischen Diagnosen gemäss ICD10 F3 und F4 ohne bekannten Suizidversuch empfiehlt das GUM in der Regel Normalannahme bei leichten Störungen (bestehend oder anamnetisch. 43 Bei mittelschweren, rezidivierenden und schweren Störungen gehen die Empfehlungen von der Normalannahme (nach 1 bis 2 rezidivfreien Jahren) über Risikozuschläge von 25 bis 100 % bis zur Ablehnung resp. Rückstellung. Entscheidend ist die individuelle Einschätzung, unter Berücksichtigung der prognostischen Faktoren (siehe Tabelle 3). Einschätzung des Arbeitsund Erwerbsunfähigkeitsrisikos Die Rückversicherungsgesellschaften sind bemüht, den Erstversicherern auch auf dem schwierigen Gebiet der psychischen Erkrankungen Richtlinien für die Deckung des Erwerbsunfähigkeitsrisikos zu geben. Nachstehend einige Beispiele aus dem GUM: Tabelle 3 Prognostische Faktoren Günstige Merkmale Ungünstige Merkmale Stabile private und berufliche Verhältnisse Keine offensichtlichen Ehe- oder Familienprobleme Keine bekannte Sucht Einsichtigkeit in die Erkrankung Keine körperliche Grunderkrankung Instabile berufliche Verhältnisse Blande Familienanamnese für psychische Erkrankungen Diagnosestellung liegt lange zurück Unauffällige und stabile Persönlichkeitsmerkmale Gute soziale Einbindung Auslösende Ursache bekannt und behoben Ehe- und Familienprobleme, finanzielle Probleme Alkohol-/Drogenmissbrauch Uneinsichtigkeit Körperliche Erkrankungen, insbesondere wenn sie chronische Schmerzen verursachen oder die Aktivitäten stark einschränken Positive Familienanamnese für psychische Störungen Diagnosestellung liegt erst kurz zurück Verhaltensauffälligkeiten einschliesslich Gewaltbereitschaft Beruflich bedingter Druck Frühere Suizidversuche, Aufsuchen vieler Ärzte («Doktor-Shopping») 1 GUM: Global Underwriting Manual der Schweizer Rück. Grosse Rückversicherungsgesellschaften stellen im Rahmen ihrer Dienstleistungen den Erstversicherern Richtlinien für die Risikobeurteilung der meisten in einer gewissen Häufigkeit auftretenden Krankheiten zur Verfügung. Da für die Erstellung solcher Richtlinien grosse Datenbestände ausgewertet werden müssen, wären Erstversicherer meist nicht in der Lage, selber entsprechende Einschätzungshilfen zu erstellen. Führende Rückversicherer verfügen meist über spezialisierte Teams, bestehend aus Ärzten und Statistikern, deren primäre Aufgabe es ist, Tarifierungsgrundlagen zu erarbeiten und die Erstversicherer bei ihrer Einschätzungsaufgabe zu unterstützen. 44 Belastungs- und Anpassungsstörungen (ICD F43) Einmalige, leichte Episoden: Rückstellung oder Ausschlussklausel im 1. Jahr nach Behandlungsabschluss. Normalannahme ab 4. Jahr nach Behandlungsabschluss. Dazwischen 25 – 100% Zuschlag. Mittelschwere und schwere Episode: Rückstellung 1 – 3 Jahre nach Behandlungsabschluss. Anschliessend Ausschlussklausel plus Risikozuschlag von zirka 100%. Ab 6. Jahr 50% Zuschlag, in ausgewählten Fällen Normalannahme. Bei chronischen und rezidivierenden Erkrankungen wird die Ablehnung empfohlen. Somatoforme Störungen (ICD F45) Voraussetzung für die Risikoeinschätzung somatoformer Störungen ist, dass eine organische Ursache für die vom Patienten geschilderten Beschwerden ausgeschlossen werden kann. Leichte und mittelschwere Formen: Rückstellung in den ersten 2 – 5 Jahren nach Behandlungsabschluss. Anschliessend Risikozuschlag von 50 – 100%. Bei schweren Formen ist erst zirka 10 Jahre nach Behandlungsabschluss ein Angebot mit Risikozuschlag möglich. Von der Verwendung von Ausschlussklauseln wird abgeraten, da bei einer allfälligen Anspruchsbegründung die somatischen Beschwerden in den Vordergrund gerückt werden und es dem Versicherer nicht immer möglich sein wird, ihre psychische Ursache nachzuweisen. Affektive Störungen (ICD F3) Die Minor Depression wird je nach Ausprägung 1 – 5 Jahre nach Behandlungsabschluss zurückgestellt. Anschliessend wird die Annahme mit 50 – 100% Risikozuschlag empfohlen. Bei Zyklothymien und Dysthymien sind Rückstellungsfristen von 2 – 10 Jahren angezeigt. Für Schwere Depressionen und bipolare Störungen kann erst zirka 10 Jahre nach Behandlungsabschluss an ein Angebot mit Risikozuschlag gedacht werden. Die Praxis der Versicherungsgesellschaften ist tendenziell zurückhaltender als von den Rückversicherungsgesellschaften empfohlen. Hauptgründe 45 sind die meist nicht in eindeutiger Form vorhandenen Diagnosen, von Arzt zu Arzt abweichende Diagnosen und die oft mangelhaften Informationen über die prognostischen Faktoren samt psychosozialem und sozioökonomischen Umfeld. Diese Unsicherheitsfaktoren veranlassen viele Versicherer, Antragsteller mit psychiatrischer Diagnose von der Arbeits- und Erwerbsunfähigkeitsdeckung auszuschliessen. Ein Teil der Gesellschaften verwendet Ausschlussklauseln die, angesichts der geschilderten Informationsmängel, meist sehr umfassend formuliert sind. Beispiel: Arbeits-/Erwerbsunfähigkeit, verursacht durch psychische Erkrankungen samt medizinisch nachweisbaren Folgen, ergibt kein Anrecht auf Taggelder und Renten. Es ist offensichtlich, dass eine solche Klausel in den meisten Fällen zu weit gefasst ist. In der Regel wäre eine Einschränkung im Rahmen der Ziffern F3 und F4 (ICD 10) ausreichend. Es ist fraglich, ob angesichts der steigenden Schadenzahlen und dem sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfeld eine grössere Risikobereitschaft von den Gesellschaften gefordert werden kann. Detaillierte medi- zinische Auskünfte, unter Verwendung eines der anerkannten Diagnoseschlüssel wären sicherlich ein erster Schritt zu einer differenzierten, risikogerechten Einschätzung des Einzelfalles. 46 Die Reintegration der psychisch Kranken in die Arbeitswelt Dr. Jakob Bösch, Externe Psychiatrische Dienste Baselland, Bruderholz Petra Wildemann, Aktuar SAV/DAV, Industry Service Leader Insurance and Banking, IBM Schweiz, Zürich Zusammenfassung Im Bereich der Berufs-/Arbeitsunfähigkeit sind die Langzeitkosten enorm und steigen exponential je länger eine Berentung in Anspruch genommen wird. Modelle werden notwendig sein, um den einzelnen bei der Reintegration nach aussergewöhnlichen Schicksalsschlägen, wie Unfällen, Mobbing oder Krankheit zu unterstützen, ziel- und kostengerecht Leistungen zu zahlen und zukünftige Schäden zu vermeiden. Dabei vergessen wir, dass ein Grossteil der Betroffenen durch chronische Leiden noch zusätzlich aus dem sozialen Kreislauf herausfallen kann. Medizinische und technische Möglichkeiten, verbunden mit Modellen, die Lernprogramme beinhalten, die auf Individualität unter der Nutzung der heute technischen Möglichkeiten beruhen, sind gefragt. Gerade die heutigen Möglichkeiten, Technik, Kommunikation und Individualität zu vereinen, bieten zu diesem so schwierigen und komplexen Thema eine Gesamtlösung, die Problematik anzugehen und Lösungen aufzuzeigen. 1. Einleitung Die Zahl der Menschen, die wegen chronischer Leiden berentet werden müssen, ist in der Schweiz in den letzten zwei Jahrzehnten um mehrere hundert Prozent gewachsen; besonders drastisch ist der Anstieg bei den tieferen Altersgruppen. Die psychischen Leiden und die chronischen Schmerzprobleme führen die Diagnosegruppen an. Das vorzeitige Ausscheiden aus der Arbeitswelt wegen psychischer Störungen hat inzwischen einen Anteil von fast einem Drittel aller Berentungen erreicht. Gleichzeitig nimmt die Zahl derjenigen, die wieder ins Arbeitsleben integriert werden können, kontinuierlich ab. Die Medizin und insbesondere die Psychiatrie befindet sich in einer widersprüchlichen Situation. Die Ursachen für diesen Notstand werden hauptsächlich in den Bedingungen der Wirtschaft, in den Strukturen der Versicherungssysteme und der Entwicklungen der Gesellschaft gesehen. Trotzdem ist die notwendige Partnerschaft mit Arbeitgebern, Versicherern und dem Umfeld der von Krankheit oder Behinderung Betroffenen zur Korrektur der geschilderten Entwicklung ungenügend erfolgt. Anscheinend werden die Möglichkeiten des medizinischen Systems für die Aufgaben der Arbeits- 47 platzerhaltung und der Reintegration in die Arbeitswelt überschätzt und es wird zu ausschliesslich auf die Wirkung der hauptsächlich medizinischtherapeutischen Massnahmen vertraut. Oft werden die ungünstigen Entwicklungen sogar durch eine Reihe iatrogener Faktoren unterstützt. Besonders betrüblich ist die Zunahme psychisch behinderter und berenteter Menschen trotz eines rasant ansteigenden Psychopharmakaaufwandes, beispielsweise mit Verdoppelung der Kosten für Antidepressiva innerhalb von fünf Jahren und trotz einer ständigen Zunahme des psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlungsangebotes. Neue Methoden der Behandlung und neue Modelle des Krankheits- und Behinderungsmanagements sind gefragt. Aber auch neue Wege mit Einsatz der Technologie für das Wohlbefinden der Betroffenen sind Teil des Gesundungsprozesses. Insbesondere muss erkannt werden, dass die Kranken oder die Behinderten, die Therapierenden, die Versicherer und letztlich auch die Arbeitgeber die gleichen Interessen haben, nämlich die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Hauptpersonen in diesen Dramen. Nicht arbeiten können ist bekanntlich die am meisten belastende Arbeitssituation. Und auch wenn die Krank- schreibung oder Berentung für Arbeitgeber kurzfristig finanziell entlastend erscheint, so werden sie doch in Form steigender Sozialabgaben unweigerlich wieder zur Kasse gebeten und die zukünftigen Kosten sind heute noch gar nicht abzuschätzen. Im Folgenden werden Erkenntnisse aus hoffnungsvollen und erfolgreichen Projekten zur Arbeitsplatzerhaltung und Reintegration bei chronischer Behinderung aus anderen Ländern diskutiert. Es handelt sich hauptsächlich um das St Loye’s Transformations Project aus England (1) sowie um Disability Management Programme aus Kanada (2, 3) und die schon eher bekannten Arbeiten zu einem interdisziplinären Pain Management (4). Ein eigenes Modell, das Care Network Solutions Projekt, wird vorgestellt. 2. Eine Erfolgsstory Das St Loye’s Transformation Project (UK) startete im Herbst 1998 als Pilotversuch und wurde aufgrund des Erfolges nach einem Jahr verlängert und ausgeweitet. Kernstück des Projektes war ein unentgeltlicher Beratungsservice für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Jobsuchende, wenn aufgrund von Gesundheits- oder Behinderungsproblemen von Arbeitnehmenden der Arbeitsplatz gefährdet oder schon ver- 48 loren war. Es war von Anfang an das Ziel die Synergien zwischen den bestehenden Diensten und dem St Loye’s Transformation Project voll zu nutzen. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Leistungsträgern gelegt. Bekanntlich sind dies die Schwachstellen im ganzen Servicenetz. St Loye’s Transformation Project bot einen zeitlich begrenzten, flexiblen aber umfassenden Beratungsdienst an mit dem Focus auf der Arbeitsfähigkeit. Die Auswertung der ersten 110 Beratungsfälle, 25% bei Beratungsbeginn ohne Arbeitsplatz, zeigte 59% in stabiler Arbeitssituation, 34% in laufender Beratung und nur 7% Dropouts. Eine endgültige Platzierung von etwa 90% wurde als realistisch eingeschätzt. Bei Investitionskosten von £ 400 000 wurde eine Ersparnis von mindestens 10 Mio Pfund errechnet. Dieser zunächst erstaunliche Betrag wird verständlich, wenn man bedenkt, dass auch in der Schweiz jede vorzeitige, krankheitsbedingte Berentung im Durchschnitt für Versicherer und Allgemeinheit mindestens 1 Mio Franken kostet. Die Zeit vom ersten Kontakt bis zum allseits akzeptierten Aktionsplan betrug im Schnitt einen Monat und 5,1 Monate vom Erstkontakt bis zur stabilen Arbeitssituation. Die Klienten kamen hauptsächlich durch Medienarbeit, Inserate und Mund-zu-MundPropaganda; das heisst,es waren 45% Selbstanmelder, während 35% vom Arbeitgeber gemeldet wurden. Es fanden kaum Überweisungen durch Ärzte und Gesundheitsdienste statt. Der Kontakt zu den Arbeitgebern wurde entscheidend für den Erfolg der Platzierung. Die beratenden Klienten mit erhaltenem Arbeitsplatz und kurzdauernder Behinderung waren – wie allgemein bekannt – stärker arbeitsbereit als die schon länger von der Arbeit ausgeschiedenen. Letztere benötigten grösseren beraterischen und damit finanziellen Aufwand. Von allen Klienten hatten 39% ihre Behinderung weniger als ein Jahr, 55% weniger als zwei Jahre und 77% weniger als fünf Jahre. Die Wiedereingliederung oder die Arbeitsplatzerhaltung waren bei grossen Arbeitgebern erfolgreicher als bei mittleren und kleinen. Dabei war es wichtig, dass der Kontakt nicht hauptsächlich mit den Linienverantwortlichen sondern auf der Managementstufe gepflegt wurde. Die Linienverantwortlichen sind nach den Autoren zu sehr auf Kostenersparnis und Effizienz ihres Verantwortungsbereiches konzentriert und können die Kosten 49 des Arbeitsausfalls bei Ausscheiden schlecht kalkulieren, noch weniger als die Wiederbeschaffungs- und Einarbeitungskosten für eine erfahrene Arbeitskraft und ebenso wenig die Kosten steigender Versicherungsprämien bei unaufhaltsam wachsender Berentungszahl. Aufgrund der unterschiedlichen Strukturen und Gesetzesgrundlagen im Versicherungswesen, können Modelle aus anderen Ländern nur in adaptierter Form auf die Schweiz übertragen werden. Case Management wird bereits für spezifische Krankheiten und Unfälle angewendet, insbesondere bei den Haftpflichtversicherungen, wo man nach ausländischem Vorbild das «deny and defend» durch «accept und assist» ersetzt. Man hat erkannt, dass Verunfallte, die jahrelang um Schadensanerkennung kämpfen müssen, nicht gesund und wiedereingliederungsfähig werden können, sondern meist in Frustration und Wut oder Depressionen gefangen sind. 3. Vernetzen und Zeit gewinnen im medizinischen Bereich Gemäss mehreren Studien in verschiedenen Ländern der industrialisierten Welt beträgt die Rate psychischer Störungen während eines Jahres 20 bis 30%. Die Wahrscheinlichkeit, wäh- rend des ganzen Lebens an einer psychischen Störung zu erkranken, wurde auf 40 bis 50% errechnet. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte muss man annehmen, dass der Ausbau der Versicherungen und der Ausbau der medizinischen und psychiatrischen Versorgung an der überproportionalen Steigerung der Berentungen wegen Störungen der Psyche und des Bewegungsapparates, die zusammen 70% der Renten ausmachen, mitbeteiligt sind. Dies nicht wegen schlechter Arbeit der Einzelnen, sondern wegen der fragmentierten Abläufe und der arbeitsteiligen und nicht vernetzten Bemühungen der einzelnen Akteure, die die übergeordnete Zielsetzung der Arbeitsintegration nicht genügend ins Zentrum stellen und oft aus den Augen verlieren. Beispiel 1: Ein 55-jähriger Bauzeichner mit Nachdiplomstudium, über 20 Jahre in der gleichen Firma tätig, wird mit einer Terminarbeit überfordert. Trotz grossem Mehreinsatz schafft er die Arbeit nicht zum gewünschten Termin. Es kommt zu einer gespannten Aussprache, der Patient erleidet einen «Nervenzusammenbruch» und wird krank geschrieben. Er befürchtet, die Kündigung zu bekommen, wenn er gesund an den Arbeits- 50 platz zurückkehrt. Die zugezogene Physiotherapeutin listet eine A4-Seite voll von Schmerz- und Spannungssymptomen auf. Eine depressiv gefärbte Angststörung kann unschwer festgestellt werden. Nach fünfmonatiger Arbeitsunfähigkeit, in der kein Kontakt mit dem Arbeitgeber stattgefunden hat, wird der Patient in die Psychiatrie überwiesen mit dem Wunsch nach IV-Anmeldung und Begutachtung. Die Angst vor Kündigung hindert diesen Patienten daran, gesund zu werden. Fünf Monate Entfernung von der Arbeit sind für die Wiedereingliederung bei Patienten in der Regel prognostisch nicht mehr optimal aber auch nicht schlecht. Den Arbeitgeber bringt der nicht terminierte Ausfall einer qualifizierten Kraft über Monate in vielen Fällen bereits in Schwierigkeiten, so dass seine Bereitschaft für Übergangslösungen und Eingliederungsmassnahmen vor allem bei der oft fehlenden Kommunikation sinkt. Übliche psychiatrische Behandlung hilft in solchen Fällen eher den Krankheitsprozess zu festigen und die Fokussierung auf die Symptome zu verstärken als den Patienten wieder einzugliedern. Auch wenn bezüglich Berentung ein abschlägiges Gutachten erstellt wird, bringt der Zeitbedarf für Abklärungen und Entscheide eine weitere Absenz vom Arbeitsplatz im günstigsten Falle von sechs und in weniger günstigen Fällen bis 24 Monaten, die die Wiedereingliederungsfähigkeit des Mannes derart verschlechtern, dass schliesslich tatsächlich nur noch die Berentung in Frage kommt. Der bei uns verbreitete, leider selbst in der Sozialpsychiatrie vorherrschende Grundsatz: «Erst Gesundung, dann Arbeitsaufnahme oder erst Rehabilitation, dann Platzierung» muss ersetzt werden durch die Lösung «Arbeit in der richtigen Dosierung ist die beste Therapie» oder anders gesagt, die Arbeits-Rehabilitierung kann nur am Arbeitsplatz erfolgen. Gerade psychiatrische Rehabilitationseinrichtungen sind in besonderer Gefahr das Verschwinden von Symptomen mit und ohne Behinderungswert zu sehr zu fokussieren und die vorhandenen Ressourcen zu übersehen. Beispiel 2: Ein knapp 20-jähriger Mann erleidet eine Psychose, die mit psychiatrischer Hospitalisation und hochdosierter Neuroleptikamedikation behandelt wird. Es wird eine Rehabilitation in einer sozialpsychiatrischen Tagesklinik und an einem geschützten Arbeitsplatz eingeleitet. 51 Wegen der anscheinend fehlenden Motivation werden so genannte schizophrene Negativsymptome diagnostiziert und die von Patient und Angehörigen gewünschte Medikamentenreduktion verweigert. Aufgrund der ärztlichen Berichte verliert der Patient seine Lehrstelle, ohne dass ein direkter Kontakt zwischen Arbeitgeber und Rehabilitationsverantwortlichen stattgefunden hätte. Die psychiatrische Institution drängt auf IV-Anmeldung, die schliesslich erfolgt, obwohl der Patient weiter auf die normale Absolvierung einer Lehre drängt. Schliesslich gelingt es dem Vater des Patienten, für diesen eine 14-tägige Schnupperlehre zu organisieren. Die dortige Leistungsbewertung fällt gegenüber der psychiatrischen weitaus positiver aus und der Patient kann bald mit einer neuen Lehre beginnen und die Medikamentendosis wird ohne irgendeinen Nachteil auf einen Bruchteil verringert. Beim jetzigen Stand der Ausbildung müssen sich die in der Psychiatrie Tätigen bewusst werden, dass sie Fachleute für geschützte oder beschützende Arbeitsplätze sind, nicht aber für die Wiedereingliederung und Arbeitsplatzerhaltung in der freien Wirtschaft. Art und Ausprägung von Krankheits- symptomen oder Behinderungen haben nur bedingt mit den Wiedereingliederungsmöglichkeiten zu tun. Das jahrelange intensive Training zum Erkennen und Klassifizieren von Krankheitssymptomen verschleiert oft den Blick für die gesunden Anteile der Kranken und die Distanz zu den Arbeitgebern ist üblicherweise zu gross für eine erfolgreiche Arbeitsreintegration. Dadurch entsteht ein unbewusster Trend, die Menschen an die Institutionen zu binden. Neulinge in der Rehabilitation wollen oft wieder arbeiten, wie Forschungen zeigen, aber die Betreuer sind dagegen, aus Angst, die Betreuten würden sich überfordern. 4. Je länger die Rehabilitationsdauer, umso weniger trauen sich die Betroffenen zu Je länger die Rehabilitationsdauer – fern von einem Arbeitsplatz – wird, umso weniger trauen die Betroffenen sich diesen Schritt in die Arbeit und Autonomie zu, während sie dann von Betreuern gedrängt werden. Auch nimmt während der Rehabilitation der Prozentsatz der in der freien Wirtschaft Tätigen drastisch ab und beträgt am Ende noch 5%. Für die Wiedereingliederung braucht es zusätzliche Partner, beispielsweise Case Manager, die die Erhaltung des Ar- 52 beitsplatzes zu ihrer Hauptaufgabe machen. Nochmals sei betont, wie wichtig es ist, die Symptombeseitigung und mögliche Rückfallverhütung zurückzusetzen und die Erhaltung der Arbeits- und Ausbildungsfähigkeit ganz in den Vordergrund zu stellen, was auch automatisch die Lebensqualität der Betroffenen erhöht. Dazu gehört ein vorsichtiger und sparsamer Einsatz von Psychopharmaka. Bei der heute üblichen Verschreibungspraxis können oft schon mit einer Medikamentenreduktion entscheidende Besserungen erreicht werden. Beispiel 3: Eine 58-jährige Frau war wegen paranoider Ideen, für die unterschiedliche Diagnosen herangezogen wurden, innerhalb von 17 Jahren drei Mal psychiatrisch hospitalisiert worden. Die vierte Hospitalisation erfolgte bereits 1 1/ 2 Jahre nach der dritten. Unter dem Eindruck sich häufender Krisen wurde der Einsatz eines Depotneuroleptikums beschlossen. Kurz nach der Wiederaufnahme ihrer Arbeit wurde der Patientin gekündigt. Der sozial eingestellte Arbeitgeber bemängelte bei der früher immer gepflegten Dame Verwahrlosungstendenzen, was bei dem notwendigen Kundenkontakt nicht tragbar war. Die Patientin regredierte massiv, verlor jede eigene Initiative und konnte nur noch mit intensiver Spitexhilfe zu Hause gehalten werden. Erst das Absetzen des Depotmedikamentes nach einem Jahr anlässlich eines psychiatrischen Konsiliums und der Einsatz einer geringen Dosis eines anderen Neuroleptikums veränderte die Patientin vollkommen. Sie wurde wieder aktiv, gesprächig und unternehmenslustig. Die inzwischen ausgesprochene volle IV-Rente blieb allerdings bestehen. Bei diesem Beispiel muss von einem iatrogenen Arbeitsplatzverlust ausgegangen werden. Die heutigen psychopharmakologischen Behandlungen zeichnen sich oft durch zu hohe Dosierungen, zu seltene Reduktionsversuche und – bei trotz Medikamenten erneuten Krisen – übermässige Dosissteigerungen und Mehrfachkombinationen aus und haben auf die Arbeitsund Ausbildungsfähigkeit einen ungünstigen Einfluss, wie das folgende Beispiel besonders deutlich zeigt. Beispiel 4: Ein 16-jähriger Schüler leidet an Verstimmungen und Lernblockaden. Er erhält verschiedenste Antidepressiva und schliesslich auch Gesprächspsychotherapie. In einer psychopharmakologischen Spezial- 53 sprechstunde wird ihm das zehnfache der Normaldosis eines Antidepressivums verschrieben. Ein GrandmalAnfall führt zur zusätzlichen Applikation eines Antiepileptikums und zum Verlust der Fahrtauglichkeit. Zunehmender Rückzug und Inaktivität machen schliesslich eine psychiatrische Hospitalisation notwendig. In der Privatklinik senkt man das Antidepressivum auf das 3-fache der Normaldosis. Mit Verhaltenstherapie erlernt der Patient, seinen Bewegungsspielraum wieder zu erweitern, wie alleine zu reisen, sich mit Gleichaltrigen zu treffen usw. Nach der Klinikentlassung wird «zur Stabilisierung des Erfolges» in der Spezialsprechstunde die Antidepressivadosis wieder auf das 16fache gesteigert mit geschütztem Wohnen und Arbeiten, wobei der Patient wegen Kopfdruck und ständiger Müdigkeit nur wenig einsatzfähig ist. Der inzwischen 20-jährige Patient erhält eine IV-Rente. Nach einem von den Eltern eingeleiteten Arztwechsel wird die Medikation gezielt abgebaut. Der Patient nimmt seine sportlichen Tätigkeiten inklusive Wettkampfsport und seine Hobbies wieder auf, reist alleine in die USA und kann schliesslich eine anspruchsvolle Ausbildung beginnen. Gerade die jungen Menschen haben heute einen ganz anderen Zugang zu den neuen Medien und den technischen Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Dies sollten wir bei der Gesundung effektiv einsetzen und nutzen. Schon während der Therapie können gezielte Kommunikation durch die Vernetzung mit Gleichaltrigen im Internet oder über spezifisch ausgewählte Kanäle die Gesundung erheblich verbessern. Hobbies, die unterstützt werden mit technischen Umsetzungen, können gefördert werden. Reisen in die USA können schon im Vorfeld in einem dedizierten Kommunikationsumfeld bei der Vorbereitung helfen. Ähnlich wie das Beispiel eines jungen Mannes aus Indien, der seit seiner Geburt an Erblindung leidet und mit Hilfe der IBM eine Tätigkeit als Programmierer aufnehmen konnte, können auch viele andere Jugendliche eine Chance erhalten, wenn das Umfeld diese ihnen schaffen kann (siehe Artikel in der Schweizer Versicherung vom Juni 2002, von Petra Wildemann). 5. Hauptziel ist die Erhaltung des Arbeitsplatzes Die Sozialpsychiatrie kann neue Kraft gewinnen durch den engeren Zusammenschluss mit Versicherungen und mit der Wirtschaft. Feindbilder 54 müssen dazu abgebaut werden. Nach Sokoll (5) kann das Disability Management (DM) bei Depressionen stark an das Sherbrooke Modell für die Rehabilitation bei Rückenschmerzen angelehnt werden. Bei gleichzeitiger Arbeitsplatz-Intervention neben der medizinischen Behandlung soll die Rückkehr an den Arbeitsplatz im Schnitt 2,4-mal schneller erfolgen als bei der üblichen nur medizinischen Behandlung. DM enthält Erste Hilfe und Behandlung der akuten Erkrankung aber auch einen Vernetzungsservice in der medizinischen Rehabilitation. Das Hauptziel ist die Vermeidung der Langzeitbehinderung. Die versicherte Person sollte in die Rolle geleitet werden, ihr eigener Manager zu werden, mit der entsprechenden Verantwortung für Gesundheit und Arbeitskraft. Dies kann durchaus auch Zusammenarbeit mit Patienten-Organisationen bedeuten. Die Steuerung der Rehabilitation von oben nach unten scheitert in der Regel. Die besten Prädiktoren für eine rasche und nachhaltige Rückkehr an den Arbeitsplatz sind: Anhaltende Zustandsverbesserung. Sicherheit des Arbeitsplatzes. Wahrnehmung des Arbeitsplatzes als unterstützend. das Gefühl, man werde vom Vorgesetzten gerne wieder gesehen. das Wissen, dass der Arbeitsplatz angepasst wird für eine stufenweise Rückkehr zur vollen Arbeitsleistung. Diese Adaptation des Arbeitsplatzes und die stufenweise Rückkehr zur Arbeitsleistung, die individuell angepasst ist, sobald erste Besserungen eingetreten sind, wird als Standard gefordert. Ebenso der frühe Kontakt zum behandelnden medizinischen System und die Förderung einer Arbeitsplatzkultur des Respekts und der flexiblen Anpassung der Arbeitsanforderungen sind ein Teil des Programms. Grosse Möglichkeiten werden dem Internet mit «self-screening» und Krankheitsmanagement zugesprochen, mit den Vorteilen des Datenschutzes, des Patienten-Empowerments usw. Das Programm Care Point, das in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Vertretern der Wirtschaft entwickelt wurde, bietet eine umfassende Lösung an, auch den Betroffenen zu helfen, die durch chronisches Leiden in der heutigen Sozialstruktur nur eine minimale Chance der Rückkehr erhalten (siehe Grafik: Care Point). Uniklinik Haftpflicht nach unverschuldeten Unfällen Eventuell falsche Behandlung bis zu diesem Zeitpunkt (z. B. Psychiatrie) Unverschuldete Langzeit-Arbeitslosigkeit Reintegration WiedereingliederungsProgramm Home Care Point: Iterativer Prozess bis zur Reintegration Start der Umsetzung Pflege Consulting Business Management Selektion Rehabilitation Mobbing, Stress am Arbeitsplatz Krankheit Unfall Kreisklinik Care Point Arbeit in der richtigen Dosierung ist die beste Therapie! 55 56 Ähnlich wie bei der erfolgreichen Umsetzung mit dedizierten Ausbildungsmethoden kann auch bei Patienten mit chronischen Leiden geholfen werden. Zeitgleich zu den medizinischen und therapeutischen Programmen ermöglichen in Gruppen oder individuell erstellte Weiterbildungsmassnahmen die Basis für eine Rückführung in den Arbeitsprozess. Das Ausbildungsprogramm, dass im Rahmen der Initiative Care Point (siehe Anmerkung) entwickelt wurde, umfasst Lerneinheiten, die in Gruppen, einzeln oder in einem Mix unterrichtet werden können. Je nach Ausbildungsgrad werden die Lernprogramme durch einen qualifizierten Dozenten vermittelt und/oder die Lernmodule auch per «Distance Learning» als eLearning vermittelt. Diese Lerneinheiten können mit ganz einfachen Modulen beginnen, bis hin zu komplexen Inhalten und zur Zertifizierung, die auf dem Arbeitsmarkt anerkannt sind. Damit hat der Patient nicht nur gezeigt, dass er wieder ein vollwertiges Mitglied der Sozialstruktur werden möchte, sondern dies auch bewiesen. Anmerkung zu Care Point Das Projekt Care Point ist in gemeinsamer Arbeit gegründet worden, um den Individuen, denen die heutigen Modelle kaum eine optimale Möglichkeit geben, unmittelbare und mittelbare Chancen aufzuzeigen. Ziel ist es, gemeinsam mit dem Einzelnen an der Entwicklung einer neuer Zukunftschance zu arbeiten. Nicht nur die Verrentung von Leistungen ist gefragt, sondern die effektive Hilfe für einen echten Zukunftsglauben. Care Point ist ein integrierter Ansatz, der sich aus der medizinischen und therapeutischen Begleitung gemeinsam mit den Arbeitgebern und den Versicherungen um echte Lösungen kümmert. Dazu werden Gesamtlösungen eingesetzt, die auf der heutigen technischen Entwicklung aufbauen und die Möglichkeit der Vernetzung und der Ausbildung verbinden. Im Mittelpunkt der Umsetzung Care Point steht eine Trägerschaft zur Koordination der Abläufe. Dies sind in erster Linie Versicherungen oder soziale 57 Einrichtungen, auf die der Einzelne im Laufe seiner Krankheitskarriere angewiesen ist. Das Gesamt-Konzept beinhaltet folgenden Service und Leistungen, die auch als einzelne Module angeboten werden: Consulting / Erarbeitung des Business Case. Projekt Management. Erarbeitung der Triage. Design und Durchführung von Lernprogrammen zur beruflichen Wiedereingliederung. Erstellung von Kommunikationsplattformen, Netzwerken, usw. Erarbeitung von Ausbildungsund Reintegrationsprogrammen. Durchführung von Aus- und Weiterbildung. Zertifizierung. Unterstützung bei der Reintegration. Weitere Informationen zu Care Point finden Sie im Internet www.CH21.ch. Literatur 1 Evaluation of the St Loye’s Transformations Project; St Loye’s Report, (2000) (Newman P, Bidgood I. ) 2 Code of Practice for Disability Management; National Institute of Disability Management and Research, (2000), (King A, Zimmermann W) 3 The Close-Up on Disability Costs in Canada’s Pulp and Paper Industry; National Institute of Disability Management and Research, (2000) 4 Main CJ, Spanswick CC. Pain Management, An Interdisciplinary Approach, Edinburgh 2000, Churchill Livingstone 5 Sokoll G. (2002): Global Workers Compensation Initiatives in Prevention Rehabilitation and Disability Management. Kongressband des «First International Forum On Disability Management» Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d’Assurances Associazione Svizzera d’Assicurazioni