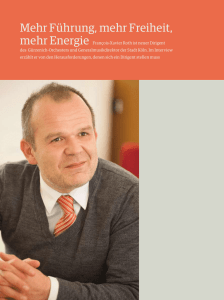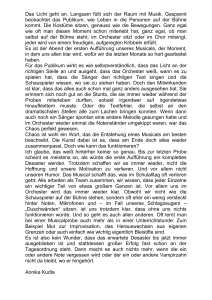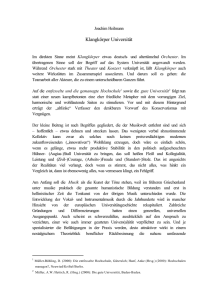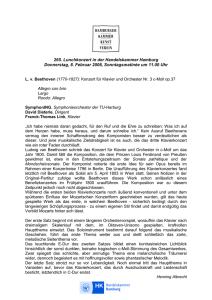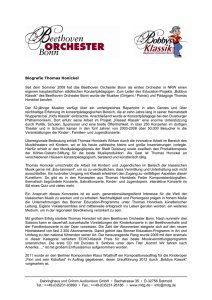Aufsätze und Fragmentarisches
Werbung

Wilhelm Furtwängler (Vermächtnis 2. Teil) Aufsätze und Fragmentarisches Zeitgemäße Betrachtungen eines Musikers, 1915.......................... S.1 Probleme des Dirigierens, 1929..................................................... S.11 Die Frage nach dem Deutschen in der Kunst, 1937....................... S.12 Vom Handwerkszeug des Dirigenten, 1937................................... S.16 Der „Geistliche Tod“, 1941............................................................ S.19 Mendelssohn, zu seinem 100 jährigen Todestag, 1947.................. S.22 Zu den Werken Hans Pfitzners, 1948............................................. S.23 Fidelio, 1948................................................................................... S.25 Salzburger Festspiele, 1949............................................................ S.26 Über das Reisen, 1952.................................................................... S.27 Chaos und Gestalt oder Der Musiker und sein Publikum, 1954.... S.28 ZEITGEMÄSSE BETRACHTUNGEN EINES MUSIKERS 1915 Die folgenden Zeilen sind vom Standpunkt des Künstlers aus geschrieben. Es ist zwar nicht Sache des Künstlers, auf gedankliche Weise Dinge allgemeinerer und gesetzlicher Art auszusprechen, und er ist sich nur zu klar, daß ein Versuch, das Leben in ein Wasserglas zu pressen, stets nach vielen Seiten hin unbefriedigend bleiben wird. Und gewiß, er hätte sich auch von Herzen gern der Mühe, die folgenden Gedanken zu entwickeln, überhoben gesehen; die Veranlassung dazu bildet einzig die gegenwärtige Situation, die vom Künstler - leider - einen Grad von Klarheit und Bewußtheit über das Wesen der Kunst verlangt, wie es in früheren glücklicheren Zeiten nicht nötig war. Bei der unglaublichen Verwirrung aller Begriffe, die die Gegenwart kennzeichnet, bildet gerade diese Klarheit und Bewußtheit ein nicht zu unterschätzendes Schutzmittel, das dem Künstler erleichtert, einer einseitig intellektualisierten Gegenwart gegenüber Künstler zu bleiben. Im ersten Moment freilich erscheint das Unternehmen, dem Phänomen der "Kunst" auf gedankliche Weise nahezukommen, in Sinn und Auftrag der Wissenschaft zu geschehen, und wenn wir sagen, daß wir als Anwalt der Kunst an diese Aufgabe herangehen, so wird sich erst in der Folge zeigen, was das zu bedeuten hat. Wenn hier Gesetze aufgezeigt, Grenzen festgesetzt werden, so geschieht es nicht, unsere Kunsterkenntnis zu erweitern, sondern zu beschränken, d. h. nicht Klarheit in das Problem der Kunst zu bringen, sondern zu zeigen, wieweit Klarheit überhaupt hineinzubringen ist. * Fassen wir den künstlerischen Schaffensprozeß ins Auge. Diesen kann man am treffendsten als einen Kampf bezeichnen. Die Widerstände, die diesen Kampf hervorrufen, ruhen im Material (im weitesten Sinne), also etwa den Formen, Farben, Harmonien. Es handelt sich dabei offenbar darum, die diesem Material innewohnenden Kräfte zu gemeinsamer Wirkung zu einigen und zu ordnen. Infolgedessen muß also dies Material, so wie der Künstler es vor Beginn seiner Arbeit, im Naturzustande, vorfindet, völlig ungestaltet, ungeordnet sein. In den tektonischen Künsten und besonders der Musik zeigt sich dies deutlicher als in den imitativen und der Poesie, obwohl es hier im Grunde natürlich ebenso ist. Der Musiker hält die Elemente seines Materials als eine unendliche Reihe von Möglichkeiten in der Hand. Sein Schaffen ist wirklich ein Kampf, die mannigfachen Strebungen und Kräfte, die im musikalischen Material mit den ihm eigenen harmonischen und rhythmischen Gesetzen ruhen, in eine einheitliche Richtung zu bringen, sie zu gemeinsamer Gesamtwirkung zu zwingen. Bei näherem Zusehen können wir innerhalb dieses Prozesses, des Ordnens, nun zweierlei Richtungen unterscheiden: einmal, indem jede kleine Einheit mit den nächstliegenden neue größere bildet, und so fort. Es ist das allmähliche Erwachsen des einen aus dem andern, die Folgerichtigkeit der Teile, vom einzelnen ausgehend ins Ganze strebend. Ein andermal umgekehrt, indem eine über allen einzelnen Teilen stehende Einheit, die Einheit des Ganzen als fest Gegebene, von ihrer Seite her wieder in die Teile wirkt. Sie stammt nicht von den Einzelheiten ab, vielmehr bestimmt sie die Teile bis ins kleinste mit. Das Wesentliche ist nun, daß in jedem wirklichen vollkräftigen Kunstwerk beide Richtungen sich derart ergänzen und durchdringen, daß eine jede nur durch die andere wirksam wird. Erst heute, nachdem in unserer eigenen Kunst die unbedingte Einheit dieser beiden Richtungen nicht mehr vorhanden ist, sind wir überhaupt imstande, diese Richtungen in ihrer Verschiedenheit wahrzunehmen. Natürlich bilden diese beiden Richtungen nur sozusagen das Knochengerüst eines Kunstwerkes; prinzipiell weiter als zu ihrer Erkenntnis zu gelangen, ist aber dem forschenden Verstande nicht vergönnt. Will man überhaupt eine Erklärung für das Phänomen der Kunst, so kann man bestenfalls bis zu einer solchen des künstlerischen Bedürfnisses zurückgehen. Da bliebe zu sagen, daß den beiden oben erwähnten Formrichtungen, die den künstlerischen Gestaltungsprozeß ausmachen, zwei verschiedene Arten des subjektiven künstlerischen Bedürfnisses entsprechen: so etwa, daß jener formenden Kraft, die vom Ganzen her in die Teile wirkt, also eine mehr oder weniger bestimmte Vorstellung des Ganzen voraussetzt, - daß dieser Formrichtung ein ursprünglicher Affekt zugrunde liegt, der dem unmittelbarsten und tiefsten Verhältnis des Künstlers zur Welt entspringt; man kann ihn Liebe, Demut, Andacht, Ehrfurcht, Bewunderung vor der Welt nennen. Jener anderen Formrichtung aber, bei der die einzelnen Teile, obwohl von der Vorstellung des Ganzen mehr oder weniger deutlich geleitet, doch erst durch ihren Verlauf das Ganze allmählich erstehen lassen - wir haben es die Folgerichtigkeit der Teile genannt -, ihr entspricht ein leidenschaftliches Erfassen und Beherrschenwollen der Welt in ihrer Erscheinung. Der wilde Drang dieses Beherrschen-GestaltenWollens ist es, der den Künstler bei der Entstehung des Werkes beseelt und ihn Schritt für Schritt, vom Kleinsten zum Größeren und immer Größeren vordringen läßt. Was ihn aber dabei leitet, ist - oft ohne sein Wissen - jenes Bild des Ganzen, das in seiner Seele schlummert. Beides gehört zusammen: das leidenschaftlichste Wollen die Welt in ihrem einzelsten unmittelbarsten Leben zu erfassen, und die Liebe zu eben dieser Welt, die sie stets als göttliches Geschenk empfindet. Wollte das doch der moderne Mensch begreifen: Es ist unmöglich, die Welt in ihrer Erscheinung wirklich fassen und gestalten zu können, ohne sie zu lieben; es ist aber auch unmöglich, sie zu lieben, ohne sie in dieser Liebe ganz erfassen zu wollen. * Was den Grund bildet für die Richtung innerhalb des künstlerischen Gestaltungsprozesses, die von der Einheit des Ganzen ausgeht, das wollen wir hier, um überhaupt einen Namen zu geben, die "Vision" nennen. Sie ist die mehr oder minder deutliche Vorstellung des Ganzen. Für den Künstler bildet sie innerhalb seiner Arbeit, die ja als solche keinerlei Zustand, sondern eine Tätigkeit mit ihrem Kampf und ihrem Sieg ist, das Ziel, das er zu erreichen strebt, den Stern, der ihn durch die nach allen Seiten führenden Verlockungen und Irrwege seines Objektes hindurchfinden läßt. Sie gibt ihm unbewußt die Anleitung in die Hand, in welcher Weise diese vielfachen Kräfte zu einigen sind. Sie wird daher nur am fertigen Werke ganz wahrnehmbar sein, und das nicht nur für den Nuraufnehmenden, sondern dies ist von großer Wichtigkeit - auch für den schaffenden Künstler selbst. Denn die Vision, vom Ganzen her wirkend, erwacht erst beim Zusammentreffen mit den einzeln aus dem Material unmittelbar entspringenden Kräften wirklich zum Leben. Erst durch das Verkörpern, Gestalten erhält sie ihre Wirklichkeit. Zwischen der Vision und den aus dem Material stammenden Kräften besteht ein Verhältnis gegenseitiger Anregung. Nur ist es nicht so, daß zuerst die Vision quasi fix und fertig da ist und dann erst ausgefüllt werden muß; denn nicht darin, daß er die Vision hat, besteht die Tätigkeit und das Glück des Künstlers, sondern gerade darin, daß er sie erfüllt, verwirklicht. (Der Zustand, der der Gestaltung der Vision im Kunstwerk vorausgeht, insbesondere die Art, wie die in der Vision liegenden und wie die aus dem Material stammenden Kräfte sich finden, ist eine Frage für sich, die uns hier nicht beschäftigt; ebenso wie die Vision vor ihrer Gestaltung zu denken ist.) Die Vision entsteht also eigentlich erst durch ihre Verkörperung; darum ist z. B. die typisch moderne Frage nach der Größe der Vision eines Künstlers - man nennt es die Größe der Idee, auch oft fälschlich die Größe des Wollens - ohne Rücksicht darauf, ob er in seinem Material die entsprechenden sie zum Ausdruck bringenden Kräfte gefunden hat, ganz müßig. Geradezu schädlich ist sie, wenn man daraus ein Werturteil ableitet. Es zeigt sich auch hier wieder: Groß ist, wer sich groß bewährt, nicht die Gesinnung, sondern die Erfüllung, nicht die Vision, sondern deren Gestaltung, und nur darin mit inbegriffen zugleich auch die Vision. Wie wenig aber gerade dies verstanden wird, wie sehr die mehr oder weniger große Trennung von Vision und Material gang und gäbe ist und bis in weiteste Kreise hinein geradezu als Tatsache, als notwendige Begleiterscheinung der Kunst angesehen wird, das zeigen die populären Ausdrücke wie "Idealismus", "Realismus", Begriffe, die vor jedem wirklichen Kunstwerk in nichts zerfallen. Demgegenüber scheint es fast sekundär, welcher dieser beiden Arten ein Künstler angehört. Das "Schicksal" des Musikers ist, dem Charakter seines Materials entsprechend, der "Idealismus". Mit der Kraft, seine Vision zu verwirklichen, ist ihm auch mehr und mehr das Gefühl für die unbedingte Notwendigkeit dieser Verwirklichung verlorengegangen. Die Folge ist nun entweder, er fügt seinem Werke die leitende Vision in Gestalt eines Textes, einer Idee, eines Programmes bei und sucht auf begriffliche Weise seinen Hörern klarzumachen, was er auf gefühlsmäßige nicht kann, oder er verzichtet auch darauf und verliert überhaupt den unmittelbaren Zusammenhang mit seinen Hörern. Seine Vision existiert dann nur noch für ihn selber, die Musik wird unklar. Sie stammelt, statt zu sprechen. Wie der naturalistische Künstler beobachtet, statt zu gestalten, so fühlt der idealistische, also in unserem Falle der Musiker, statt zu formen. Aber sind wir verpflichtet, eine Sprache mitanzuhören, die wir nur halb verstehen, ja, die überhaupt nur halb zu verstehen ist? Dies hängt mit dem Material des Musikers zusammen. Einer Art Naturalismus wie etwa der des bildenden Künstlers ist dies Material nicht zugänglich. Dadurch fallen vielerlei Irrtümer und Gefahren für den Musiker weg. Der der Musik mögliche Naturalismus ist im allgemeinen an den Rhythmus gebunden, insofern der Rhythmus imstande ist, den zeitlichen Verlauf eines wirklichen Vorgangs zu kopieren. Da das Rhythmische aber nur ein Teil der ganzen Wirklichkeit eines Vorganges ist, kann der Vorgang selber in der Musik natürlich nicht dargestellt, nur etwa vom Hörer auf assoziativem Wege vorgestellt, quasi erraten werden. Daher ist diese Art musikalischer Naturalismus zumeist an die Bühne gekettet, in deren Vorgängen und Gesten er seine Erklärung findet; oder es muß der wirkliche Vorgang, wie in der modernen Programm-Musik, vom Hörer erst in die Musik hineingedeutet werden (was, abgesehen davon, daß es nur in allgemeinen Zügen geschehen kann, immer ein etwas gewaltsamer Prozeß, eine gewisse Zumutung an den Aufnehmenden bleibt, die von ihm zumindest ein gewisses Quantum guten Willen voraussetzt). Macht der Rhythmus eine Art Naturalismus noch möglich, so schließt das andere Element der Musik, die Harmonie, ihn geradezu aus (Wie die täuschende musikalische Darstellung des Blökens der Schafe, des Schreiens eines Kindes im Bade nicht durch harmonische Wirkungen, sondern durch die absolute Tonhöhe, verbunden mit Mischung und Klangfarbe einzelner Instrumente erreicht wird.). Das Anschlagen schon einer einzigen konkreten Harmonie versetzt uns mit der denkbar größten Bestimmtheit in das Reich der Kunst, aller gegenständlichen Wirklichkeit weit entrückt. * Es kann nun hier nicht unsere Aufgabe sein, die Grundbedingungen und Möglichkeiten der Musik als Kunst zu erörtern: dazu wären bei der Situation der modernen Musik und der heutigen Begriffsverwirrung Bände nötig. Hier in größter Kürze nur soviel: die Möglichkeit der Musik als Kunst ist gebunden an ihre Fähigkeit, irgendeinen bestimmten Klang als etwas in sich Ruhendes, in sich selber Lebendes, etwas Seiendes zu empfinden; von hier aus erst ist die Möglichkeit einer objektiven künstlerischen Form gegeben; es erscheinen die musikalischen Formen, wie sie sich historisch entwickelt haben, nur wie eine reiche und immer verzweigtere Ausdeutung eines Gesetzes, dessen einfachste Formel man in der "Kadenz" sehen kann. Wir sehen hier die großen Meister in ihren Schöpfungen, die Bachsche Fuge wie die Beethovensche Symphonie im Dienste des wunderbarsten Formwillens, der ihnen sozusagen von der Natur selbst diktiert wird. Aber noch mehr: Auch was seither von Chopin und Wagner bis auf Pfitzner, Debussy und Strauß an wirklich musikalischer Erfindung geleistet wurde, stammt aus derselben Quelle, wenn auch freilich oft stückweise und in anderer Art zum Ganzen geeint (Abgesehen von jenen oben erwähnten Grenzfällen der Anähn- lichung der harmonäschen Verhältnisse an einen wirklichen Vorgang, denen an sich aber nur eine auf den absoluten Moment, ohne Folge gerichtete Wirkung, also keine formbildende Kraft innewohnt) . Alle wirkliche Entwicklung bestand und besteht bis heute einerseits auf der Erweiterung und Bereicherung der aus diesen Grundverhältnissen stammenden Beziehungen, andererseits in immer größerer Konzentrierung, immer größerer Spannung der in ihnen ruhenden Kräfte. Sie selber wurden dabei nie auch nur einen Moment in Frage gezogen, und es wäre nicht einzusehen, wie es je dazu kommen sollte, falls wir nicht etwa in einem anderen Tonsystem, etwa in Vierteltönen, fühlen und komponieren wollten; was aber keineswegs aus dem jetzt herrschenden sich entwickeln könnte, so wenig wie ein Apfelbaum aus einer Eiche wächst (Etwas anderes ist die Kirchenmusik in ihren Anfängen, wahrscheinlich auch die griechische, bei der die „Form" in unserem Sinne nicht innerhalb, sondern außerhalb des Kunstwerks selber lag; sie existierte nur als Symbol, nur in Beziehung zu den religiösen und dergleichen Inhalten, die sie nicht verkörperte, sondern nur spiegelte). Die Ursache all jener Anschauungen von der Möglichkeit des Vierteltones und ähnlichem bildet bewußt oder unbewußt der Gedanke des Fortschrittes, der wie über die Menschheit, so auch über die Kunst heute eine Tyrannei ausübt, wie sie keine Inquisition, kein religiöser Aberglaube je geübt hat. Wie kommt das? Die Verkörperung, die Gestaltung der Vision fällt für den Künstler zusammen mit einem Sichbewußtwerden derselben, denn eben durch das Zusammenhalten der nur geahnten "Vision" mit den wirklichen Kräften des Materials, so daß sich beide vollkommen decken und ausdrücken, kommt die bewußte Erkenntnis eben dieser Vision in ihrer Wirklichkeit, d. h. in ihrer Beziehung zu dem Material zustande, und um so mehr, je vollständiger dieser Verschmelzungsprozeß stattfand. Dies Bewußtsein erstreckt sich genau so weit, wie der Gestaltungsprozeß gediehen ist, und entsteht in dem Moment, wo für eine Vision die richtige, sie vollkommen ausdrückende Kraft aus dem Material heraus gefunden wird. Ist der ganze Gestaltungsprozeß zu Ende, so ist er dies eben durch das Bewußtsein; die Tätigkeit und Freude an dem betreffenden Werke hört auf, es ist "erledigt". So begreift das Bewußtsein also gerade jene Beziehungen zwischen dem Material und der zu verkörpernden Vision in sich, d. h. der Künstler hat am Schlusse durch seine eigene Arbeit erfahren, wie man dies und jenes ausdrückt. Das ist ein unveräußerliches Wissen, das ihm von nun an bei jedem neuen Werke gegenwärtig ist. Das Bewußtsein stellt so das mehr oder weniger ungewollte Ziel, den Endpunkt des Schaffens dar. Es ist nicht möglich, ein Ziel, einen Endpunkt, den man erreicht hat, nochmal zu erreichen; es ist nicht möglich, da es sinnlos ist (die Sinnlosigkeit, die darin liegt, etwa ein gelungenes Werk nochmal machen zu wollen, etwas vollständig Ausgesprochenes nochmal aussprechen zu wollen, bestätigt auch die Natur dadurch, daß wir nur da über alle uns gehörenden Kräfte verfügen, wo wir einem N euen, in irgendeiner Weise noch nicht Erlebten, d. h. eben noch nicht in unser Bewußtsein Gedrungenen gegenüberstehen). * Wenn der Künstler einmal erfahren hat, wie er dies oder jenes ausdrückt, so wird er es das nächste Mal verwenden, und zwar wie man eine fertige Tatsache, ein Wissen verwendet, nämlich als Teil eines neuen Ganzen. Was zuerst in sich selbst seinen Zweck hatte, wird als Glied einer neuen Kette, als Mittel begriffen, es verliert seinen selbständigen Wert. So entsteht alles Fortschreiten, alle Entwicklung, beim einzelnen wie bei der Gesamtheit. Dies, soweit es die aus dem Material entstehenden Ausdruckseinheiten, die im Ganzen des Kunstwerks die Einzelheiten bilden, betrifft. Denn das Ganze kann natürlich als ein Letztes, Endgültiges nicht zum Mittel gemacht, nicht als Teil eines Neuen behandelt werden. Aus dem Bewußtsein des Ganzen entsteht daher für den Künstler die Möglichkeit und Notwendigkeit, mit jedem neuen Werk ein vollständig neues Ganzes, gleichsam eine ganz neue Welt, zu verkörpern, die mit der alten nichts mehr zu tun hat. Daher die Tatsache, daß die größten Gestalter, d. h. Vollender, Verwirklicher ihrer Visionen, die in sich verschiedensten Werke geschaffen haben, daß die Größten auch die Vielseitigsten und Universalsten waren. Sie waren auch die Bewußtesten; aber das Bewußtsein bezog sich niemals auf das, was vor ihnen, sondern das, was hinter ihnen lag. Es bezog sich nicht auf ihre Tätigkeit, sondern auf das Rüstzeug, das sie zu dieser Tätigkeit mitbrachten; drum könnte man besser sagen, sie waren die Wissendsten. All dies ist die Angelegenheit des einzelnen Künstlers. Je mehr er imstande ist, den in einem Werk ruhenden Gehalt vollständig zu gestalten, seinen Inhalt vollständig auszusprechen, desto mehr wird das Werk als solches ein Eigenleben führen können, nur in sich selber ruhend, abgesehen von seinem Schöpfer. Und desto mehr wird dieser bei einem neuen Werk die Hände frei haben, es ganz aus dem Neuen, Unbekannten herauszugestalten, da in ihm von dem früheren Werke her sozusagen kein Rest bleibt, alles was zu diesem gehörte, in diesem auch vollendet wurde. Etwas anderes ist es mit den unmittelbar aus dem Material entstehenden Einzelteilen; sie erleben zwar auch innerhalb des einzelnen Künstlers eine Entwicklung, jedoch ist diese verhältnismäßig gering. Selbst bei denen, die in ihrer Laufbahn den größten Veränderungen unterworfen waren, bleibt doch von Anfang an eine gewisse Grundeinstellung gegenüber ihrem Material, gegenüber der Art ihrer Verwendung der Mittel, die sich immer gleich bleibt, mögen die dargestellten Inhalte und Welten unter sich noch so verschieden sein. * Diese Grundeinstellung zum Material ist das, was dem Laien als erstes in die Augen fällt und was er mit den entsprechenden, nach einzelnen Künstlern gebildeten Adjektiven belegt, z. B. das Michelangeleske, das Wagnerische usw. Es wird damit von der eigentlichen Individualität entgegen der heute vielfach herrschenden, durch kunsthistorische Gesichtspunkte allzusehr in Anspruch genommenen Meinung nichts Wesentliches ausgesagt. Diese Individualität offenbart sich vielmehr immer erst im einzelnen Werke selber, denn die GrundeinsteIlung zum Material ist nur die Bedingung, das Mittel, durch das er zu seinem Werk, zu seiner Welt gelangt. Sie hat mit dieser seiner Welt aber das gemeinsam, daß er als Person, als Individualität untrennbar mit ihr verbunden ist. Anders ist es, wenn man diese Einzelteile nicht auf ihre Verwandtschaft untereinander ansieht, wie sie sich unter der Hand dieses oder jenes Künstlers zu Gruppen bilden, sondern wenn man sie nur auf ihre eigene Existenz hin betrachtet, so wie sie unmittelbar aus dem Material hervorwachsen. Es gehört dazu, daß sie in sich unauflösliche Einheiten, d. h. dem Ganzen gegenüber immer nur Teile sind, da sie die unmittelbarste Beziehung zum Material, als die eigentlich materielle Seite des Kunstmittels, darstellen. Diese nun sind sehr wohl abgetrennt von der Individualität des einzelnen Künstlers zu betrachten. Sie sind als solche nicht abhängig von seinen Absichten und dem Inhalt, den er darstellen will, von diesen abhängig sind nur die Gruppen, die er aus ihnen bildet, aus denen sich dann jene vorher erwähnte GrundeinsteIlung zum Material ergibt. Diese kleinsten Einzelheiten sind es daher, durch die die Entwicklung der Kunst sozusagen über den Kopf des einzelnen hinweg stattfindet. Im Gegensatz zu jener Grundeinstellung zu seinem Material, wie es für den einzelnen Künstler die Bedingung bildet, zu seiner Welt zu gelangen, und im denkbar größten Gegensatz zu dieser Welt selber, die nur einmalig, in jedem Werk von neuem zur Erscheinung kommt, sind es diese kleinsten Einzelheiten, die einer Entwicklung in dem Sinn unterworfen sind, daß die früheren durch die späteren entwertet werden. So ist es z. B. dem modernen Musiker unmöglich, die Harmonieskala Wagners oder Schumanns oder gar Mozarts zu benützen, es ist sozusagen das Material selber, das sich entwickelt; unaufhaltsam, aus sich heraus, selbsttätig; es ist dem einzelnen unmöglich, dieser Entwicklung zu widerstehen oder ihr zu entrinnen. Es ist dies, was den "Stil" einer Zeit ausmacht und als solcher ihren größten wie ihren geringsten Leistungen gemeinsam ist. Man sieht schon daraus, daß es mit der Kunst selber fast nichts mehr zu tun hat, noch viel weniger als jene oben erwähnte "GrundeinsteIlung" des einzelnen Künstlers zu seinem Material. Dagegen ist es der wissenschaftlichen Erkenntnis am zugänglichsten. Weil diese am engsten mit dem Material selbst verbundenen Ausdruckseinheiten dem Ganzen gegenüber stets nur Teile sind, können sie in praxi nur in Beziehung zu einem Ganzen verwendet werden, und so sehr ihre Auswahl und Bildung durch den Inhalt des Ganzen bestimmt wird, so sehr bestimmen sie ihrerseits wieder den Charakter dieses Ganzen. Da nun, wie wir sahen, diesem Material (wie wir es kurz nennen wollen) eine selbsttätige, nur in ihm, ohne Beziehung auf ein Ganzes beruhende Entwicklung eigen ist, aber andererseits zwischen ihm und diesem Ganzen eine engste Wechselwirkung besteht, müssen die das Ganze bildenden Kräfte mit dem Stand des Materials innerhalb seiner Entwicklung übereinstimmen, um sich gegenseitig ausdrücken zu können. Dies ist der innere Grund für die Frage, warum z. B. diese Kunst sich gerade in jener Zeit entwickelt, d. h. der Gesamtwille des Zeitalters muß zusammenfallen mit den im Material ruhenden Möglichkeiten. Es gibt auch die Erklärung für rein historisch unerklärliche Erscheinungen, wie z. B. daß zur selben Zeit, wo in der Kunst und Architektur das Barock blühte, in der Musik bei Bach und seinen Vorgängern ein Formwille, der viel eher der Gotik verwandt ist, lebendig war. Auf jeden Fall ist es falsch, eine historische Erscheinung durch eines allein zu erklären: sei es nun die Entwicklung des Materials an sich oder der Ausdruckswille des Zeitalters. Will man aber einem die Priorität geben, so jedenfalls dem zweiten; es ist nicht undenkbar, sogar sehr wahrscheinlich, daß der Lebenswille ganzer Zeitalter nur deshalb in dieser oder jener Kunst sich nicht aussprechen konnte, weil der gerade gegenwärtige Stand der Entwicklung des Materials dem nicht entsprach. Die Entwicklung innerhalb der Zeiten, die diesen unmittelbar aus dem Material entspringenden Wirkungen an sich eigen ist, muß sich also auch im ganzen fühlbar machen. Die wirkliche historische Entwicklung zeigt uns das sehr deutlich. Sie verlief anfangs stets so, daß die Künstler die im Material ihrer Kunst liegenden Möglichkeiten erst kennenlernen mußten. Dabei fingen sie bei dem Einfachsten an, das Ganze blieb, rein aus den Kräften des Materials heraus, stets gewahrt. Es bildete den unbewußten Untergrund aller Erfindungen; trotzdem war es als solches noch nicht Gegenstand der Gestaltung, konnte es auch noch nicht sein, da ja die Einzelheiten, die gleichsam erst entdeckt werden mußten, Endpunkte, Einheiten in sich bilden und die eigentliche Erfindungskraft des Künstlers ganz in Anspruch nahmen. So kam es, daß das Ganze, obwohl es als organische Verbindung der Einzelheiten bestand, doch nicht eigentlich selbständig war. Bei Haydn und Mozart z. B. ist die Behandlung des Ganzen und seiner Form (Sonatenform usw.) das relativ Unbestimmteste, Konventionellste ihrer Kunst. Diese Form war im wesentlichen da als organische Bindung und Anordnung von Einzelheiten, und diese bildeten das eigentlich Lebendige des Werkes. Späterhin, insbesondere bei Beethoven, wurde das anders; die verschiedenen Einzelheiten, durch den Prozeß der Entwicklung nunmehr als Einheiten bewältigt und ins künstlerische Bewußtsein der Zeit getreten, wurden immer mehr zu neuen größeren Einheiten verwendet. Der Zusammenhang des Ganzen wie die Folgerichtigkeit der Teile wuchs. Die Teile verloren immer mehr ihre Selbständigkeit, so sehr, daß sie schließlich ohne die Beziehung aufs Ganze gar nicht mehr erklärbar sind, also der eine Teil ohne den vorhergehenden oder nachfolgenden gar nicht verständlich ist. In den Werken der letzten Zeit Beethovens, in denen er immer stärker die aus der Entwicklung kommenden Konsequenzen zieht, gibt es tatsächlich solche Fälle. Bis dahin verlief die Entwicklung unter der als selbstverständlich angesehenen Voraussetzung, daß das Ganze im Sinne eines Organismus unerläßlich sei. Diejenigen Kräfte des Materials, die diesem Willen aufs Ganze korrespondierten, wurden herangezogen und entwickelt. Man könnte auch sagen: man folgte ihnen. Nun aber erlagen auch sie dem andringenden Bewußtsein; auch sie erlebten ihre "Entwicklung". Während Beethoven, der Grundeinstellung zu seinem Material ebenso wie der Art seines Genius folgend, gerade das Ganze immer präziser und gewaltiger herauszubringen trachtete, wendeten sich schon seine Zeitgenossen (Weber usw.), noch mehr aber seine Nachfolger von diesen Aufgaben ab. Der Begriff des Kunstwerkes als eines organischen Ganzen zerbröckelte ihnen sozusagen unter den Händen; die Romantiker beherrschten es nur in der kleinen Form, und bald genug war die selbstverständliche und großartige Haltung der früheren Zeit verloren. Da brachte Wagner das neue Ganze, die neue Einheit in Gestalt seines Dramas und erschloß, wie wir später sehen werden, der Musik dadurch eine Menge neuer Materialeinheiten. Der Charakter seines Ganzen erlaubte eine eindringlichere, weil um die Folgerichtigkeit der Teile im rein musikalischen Sinn weniger bekümmerte Ausdeutung des Materials; dadurch wurde das Material als solches aber noch schneller erschöpft, und Wagners Nachfolger, die auch nicht seine ihm persönlich eigene "Einheit des Dramas" besitzen, stehen nun gänzlich vor dem Bankrott. Eine Einheit aus den Gesetzen des musikalischen Materials selbst heraus, wie es noch etwa Brahms in Anlehnung an die Klassiker erstrebte, wollen sie vermeiden, die Wagners ist ihnen als Nurmusikern nicht gegeben: so scheint auch von hier aus der Weg der Programmusik in jeglicher Form (die naturalistische mehr in der modernen Opernproduktion, die idealistische mehr in der absoluten Musik) der einzige, der übrig bleibt, falls nicht überhaupt die Notwendigkeit jeglicher Form geleugnet wird. Und was die unmittelbaren Materialwerte betrifft,ist es nicht besser. Es ist heute soweit gekommen, daß man sich keine einfache und eindeutige Harmonie mehr zu schreiben getraut, im Glauben, schon Gesagtes zu wiederholen. Man ist wirklich ganz und gar am Ende; ein Zeichen dafür ist die krampfhafte, immer mehr um sich greifende Sucht nach etwas ganz Neuem, etwas, was von allen mit dem alten Material verbundenen Bewußtseinsinhalten absolut unabhängig ist. Die Theorie des Vierteltonsystems ist nur ein Beispiel für viele. * Da sich nun auch die Gesamtform als Ausdruck der Vision des Künstlers heutzutage von der unaufhaltsamen Entwicklung, der das Material an sich unterliegt, mitreißen ließ, hat sie ihre zentrale und dominierende Stellung verloren. Sie scheint nicht mehr über das Material zu gebieten. Es ist nicht mehr das Ganze, das die Teile bestimmt, es ist nicht jenes Hand-in-Hand-Gehen der "Vision" mit den Kräften des Materials, sondern umgekehrt scheint dieses den ersten, den bestimmenden Platz bekommen zu haben; es bedingt die Form des Ganzen und damit geradezu die Vision selber. Das Ganze wird von den Teilen aufgefressen. Die Folge ist, es gibt nicht nur kein Ganzes mehr, sondern auch keine Teile, die ja als solche nur in Beziehung zum Ganzen existieren; man sucht in jedem Moment alles zu geben, ohne Beziehung auf das Vorhergehende oder Nachfolgende; so kommt man zu all den einzelnen, isolierten Materialwirkungen, dem Kultus des Stofflichen als solchem, im Harmonischen und Rhythmischen, der Instrumentation als Selbstzweck und so vielen kleinen Teilund Reizwirkungen. * Bisher gibt dies alles scheinbar der Idee des Fortschrittes recht. Es ist nun aber falsch, in der Geschichte der Künste nur den Moment der Entwicklung des Materials an sich und der Gesamtform zu sehen, soweit sie unmittelbar mit ihm zusammenhängt, denn diese Gesamtform ist der Ausdruck der Vision, und so sehr die Vision ihre Wirklichkeit nur in Beziehung zum Material bekommen, ja, so sehr sie durch dies Material angeregt und geweckt werden kann, so sehr stammt sie doch nicht von ihm ab. Sie ist vielmehr der allerunmittelbarste Ausdruck des Verhältnisses des Künstlers zur Welt überhaupt, sie lebt daher im Künstler ihrem eigentlichen Wesen nach ohne jede Rücksicht auf ihre Verwirklichung und Gestaltung, wenn sie auch, wie wir gesehen haben, durch diese Gestaltung erst ihre Wirklichkeit bekommt. Es ist nicht das Material, das aus sich die entsprechende Vision bildet, sondern es ist die Vision, die sich das sie vollständig zum Ausdruck bringende Material sucht, und da sie als solche, eben als unmittelbarer Ausdruck des Verhältnisses des Künstlers zur Welt, ein Letztes ist, so ist ihr auch die Art der Entwicklung, wie sie dem Material selber eignet, nicht möglich. Die grundlegenden Visionen zweier verschiedener Künstler stehen sich durchaus getrennt gegenüber. Der Eine kann dabei vom Anderen wohl angeregt werden, ja, eine Art Anähnlichung ist bis zu einem gewissen Grade möglich; dennoch wird diese nur äußerlichen Charakter tragen. Denn es macht gerade das Wesen der Vision aus, daß sie bei jedem Künstler neu, aus dem nur ihm eigentümlichen und nur ihm möglichen Verhältnis zur Welt heraus entsteht. So können die verschiedenen Visionen in ihren Verkörperungen, wie sie in der Geschichte nach und nach entstehen, vollkommen nebeneinander bestehen. Keine wird durch die andere, wie wir es etwa innerhalb der Entwicklung des Materials gesehen haben, überflüssig gemacht. So bestehen die Großen aller Zeiten vor unseren Augen, ganz unabhängig von dem Stande der Entwicklung des Materials, wie sie es vorfanden, Phidias neben Michelangelo, Bach neben Beethoven, Mozart neben Wagner. * Obwohl wir nun weder der historischen Wissenschaft noch sonst irgendeines Mittlers bedürfen, um diese Tatsachen zu sehen, so stellt sich doch die Mehrzahl der Künstler von heute blind dagegen. Soweit sie dabei das Gefühl leitet, daß der gegenwärtige Stand des Materials, auch abgesehen vom Ausdruckswillen der einzelnen Individualität, eine andere Art Kunst verlangt als die einer früheren Zeit, ist dies ja richtig. Sie gehen aber viel weiter, indem sie die Abhängigkeit und Bedingtheit des Materials durch die Vision, der Teile durch das Ganze überhaupt leugnen; so wie sie im Grunde das Ganze selber leugnen. Es bleiben ihnen so nun wirklich nur noch die Teile, d. h. das Material in seinem augenblicklichen Stand der Entwicklung in der Hand, das als solches, wie wir gesehen haben, dem Gesetze des Fortschrittes unterliegt, also mit Notwendigkeit sich erschöpfen muß. Es ist ein Prozeß der absoluten Verstofflichung der Kunst, der Reduzierung aller ihrer im Material gegebenen Elemente, und ebenso Grund wie Folge jener Idee des Fortschritts. Man sieht nun das Bezeichnende auch bei den großen Werken der Vergangenheit nur in den Mitteln, die bei ihnen verwendet wurden, z. B. in der Harmonik, der Art der formalen Struktur usw. natürlich ganz entsprechend dem, was man in der eigenen Kunst sucht und schätzt; statt aus der Vergangenheit zu lernen, daß jeder Komplex von Materialkräften letzten Endes nur Mittel zur Verwirklichung einer Vision, zur Verlebendigung einer Welt ist, die den eigentlichen Zweck der künstlerischen Tätigkeit bildet. Aber wann wird man es lernen, zu lernen ohne nachzuahmen! Wir sehen aus alledem, wie an der letzten Entwicklung der Kunst die verstandesmäßige Spekulation einen ganz anderen Anteil hat als jemals früher. Der Begriff des Fortschritts, wie er heute in der Kunst gehandhabt wird, stammt von ihr. So sind es auch nicht zum wenigsten Leute, die es selber an sich nie erlebt haben, was es. heißt, ein Kunstwerk zu schaffen und woher dazu die Kräfte zu nehmen, die die "Entwicklung" der Kunst heute am meisten "machen". Sie messen gern die Größe eines Kunstwerkes an seiner Neuheit, d. h. natürlich der Neuheit der darin verwendeten Mittel. Selbst die wirklich Produktiven vermögen nicht immer jenen oder dem Geist, der sie bildete, zu entgehen. Wie ein Damoklesschwert hängt der Wahn des Fortschreitenmüssens, des um jeden Preis Neues-bringenMüssens, über dem größten Teil der heutigen Künstler und raubt ihnen die Ruhe, die sie brauchen, um ihre innere Stimme wahrzunehmen, verwandelt die Kunst aus einer freien freudigen Tätigkeit in eine dumpfe, ehrgeizige Fronarbeit. * Daß auch die Musik, bis vor kurzem noch die lebendigste Kunst, in so wenig Zeit so vollständig in den allgemeinen Fortschrittsmechanismus eingespannt werden konnte, dazu waren besondere Umstände nötig. Sie knüpfen sich hauptsächlich an den Namen eines Einzelnen: Richard Wagner. Der ungeheure Einfluß, den er auf die moderne Musik hat - niemals hat ein Einzelner größeren Einfluß auf eine Kunst gehabt - ist zum größten Teil die Folge eines – Irrtums (Gewiß mag dieser Irrtum nötig gewesen sein, bis zu einem gewissen Grade hat er sich ja auch als produktiv erwiesen, ein Irrtum bleibt er dennoch, und es erscheint heute an der Zeit, gerade im Namen des Musikertums der Zukunft, dies festzunageln). Wagner selbst fühlte die Möglichkeit dieses Irrtums wohl; dies allein machte ihn zum Schriftsteller. Faßt man den wesentlichen immer wiederkehrenden Inhalt seiner Schriften zusammen, so besteht er in zwei Sätzen. Einmal: Ich bin ein Dichter, kein Musiker; andermal: Die Sprache, die wirklich das Tiefste der menschlichen Seele auszudrücken vermag, ist einzig die Musik. Der wirkliche oder scheinbare Widerspruch, der hierin liegt, lautet, in unsere Sprache übersetzt: Die Gesamtvision meines Werkes ist anderer Art (nämlich dichterischer) als die Mittel, durch die sie verkörpert wird (nämlich die Musik). -Für den ästhetisch Wissenden klingt dies zunächst grotesk; die gesamte Ästhetik von Aristoteles bis heute würde einer Kunst, die mit solchen Ansprüchen auftritt, von vornherein - und das mit Recht jedwede Lebensmöglichkeit absprechen. Wenn sich Wagner in seinem Werk trotzdem durchgesetzt hat, so hängt das mit Dingen zusammen, auf die wir hier nicht näher eingehen können. Der Fall Wagner wird noch geschrieben werden; er bietet den Schlüssel zur Erkenntnis der tiefsten und eigentlichsten Probleme unserer Zeit. Hier interessieren uns nur die musikalische Seite der Sache, die Folgen für die absolute Musik. Bei Betrachtung eines Wagnerschen Werkes fällt zunächst in die Augen, daß alle musikalischen Bindungen, alle Formen im alten Sinn, Sonate, Lied usw., mit all ihren Konsequenzen fehlen. Rein als Stück Musik betrachtet, ist jedes Wagnersche Werk ein Chaos, ohne Anfang, ohne Ende, ohne Mitte, nur aus kleinen, in sich abgeschlossenen nebeneinanderstehenden Einzelheiten bestehend. Wo FormElemente vorhanden sind - in den Frühwerken und im Parsifal, in den Meistersingern infolge ihrer archaisierenden Tendenz -, werden sie nicht konsequent aus sich heraus entwickelt, sondern willkürlich fragmentarisch behandelt oder auf barocke Weise gehäuft. Trotzdem ist die musikalische Gesamtwirkung einer Wagnerschen Oper nicht chaotisch, im Gegenteil durchaus präzis und eindeutig. Treten wir genug zurück, um das Ganze als Ganzes zu übersehen und auf uns wirken zu lassen, dann beginnen wir ganz von selbst die Musik als das zu begreifen, was sie ist, nämlich als ein Mittel, die dichterische Gesamtkonzeption zum Leben zu erwecken. Damit wird vieles klar, was uns anfangs, wie z. B. die Technik der Leitmotive, als einem kunstfeindlichen Rationalismus entsprungen erschien. Wir begreifen, daß es sich für Wagner nicht darum handelt, eine in sich bestehende und in sich selber ruhende Musik zu schaffen,die die fruchtbaren Momente der Handlung vollständig in sich aufsaugt und nun neu gebärend wieder ans Licht bringt wie in der alten Oper, sondern daß er mit der Musik nichts will, als die Dichtung mit Blut und Leben erfüllen. Ohne paradox zu sein, kann man sagen, der Dichter hat diese Musik erfunden und konzipiert, nicht der Musiker. Die gestaltende Arbeit dieses Dichtermusikers zeigt sich denn auch nicht bei den eigentlichen Musikern im Erfinden und Durchleben neuer musikalischer Gestalten, d. h. neuer Formen, sondern neuer musikalischer Stile. Durch den ihm eigenen Stil wird jedes Wagnersche Werk aufs präziseste in sich bestimmt und vom andern abgetrennt. Dieser Stil wirkt sich durch ein ganzes Werk bis in die kleinsten Einzelheiten hinein derart deutlich aus, daß man von zwei einander so naheliegenden Werken, wie z. B. Tristan und Meistersinger (beide wurden unmittelbar hintereinander geschaffen) nicht einen Takt vom einen in das andere versetzen könnte, ohne daß er sofort herausfiele. Die Gesamtvision, wenn sie auch im jeweiligen musikalischen Stil erst Leben und Ausdruck findet - die Todessehnsucht Tristans, die helle archaisierende Heiterkeit der Meistersinger -, ist zuerst dichterisch erlebt und geschaut. Dies mit Worten auszusprechen (wie alles, was das sogenannte "Gesamtkunstwerk" betrifft) ist leicht; es richtig zu verstehen, schwer. Es ist hier der Fall einer Ehe zwischen zwei Künsten, wie aus der gesamten Menschheitsgeschichte kein zweiter bekannt ist. Im übrigen ist es die persönliche Angelegenheit des Künstlers Wagner; hier interessieren uns nur die Folgen für die eigentliche Musik. Diese allerdings sind ungeheuer groß, und hier liegt auch die Quelle jener schon oben angedeuteten unzähligen Mißverständnisse, denen Wagner ausgesetzt war und noch immer ist. Soweit sie von Seiten des absoluten Musikers stammen, sind sie zu zerstreuen; es sind eben wirkliche Mißverständnisse, und diejenigen, die Wagner in diesem Sinn ablehnen, pflegen nicht die schlechtesten Musiker zu sein. Das sind heute nur noch wenige; im Gegenteil, das viel größere und bei weitem folgenschwerere Mißverständnis liegt in der Art der Anerkennung und Nachfolge, wie sie Wagner heute erfährt. Denn indem der Musiker Wagners Musik genauso wie die in sich selbst gegründete Musik der wirklichen Musiker anzusehen begann, nämlich als Musik kurzum, mußte sich eine wahrhafte Revolution in seinem Empfinden vollziehen. Was er früher abgelehnt hatte, beginnt er nun als Vorzug, ja als die neue Freiheit, die er gewonnen hat, zu empfinden, als die Befreiung von all den Fesseln, die bisher so schwer auf der Musik gelastet hatten, dem Zwang harmonischer und thematischer Folgerichtigkeit, dem Zwang der strengen organisch aus sich selbst gewachsenen sogenannten "Form", die früher mit so ungeheuren Ansprüchen an den Musiker herantrat. Gewiß wurde auf diese Weise auch noch nach Wagner eine Menge neuer Materialeinheiten gefunden. Man entdeckte Möglichkeiten lockerer, beweglicherer Formung; an Überraschungen und sogenannten "Kühnheiten" aller Art sind wenige Jahre der letzten Zeit reicher als die gesamte Musikentwicklung bis dahin. Aber sie erwiesen sich nur zum geringsten Teil als wirklich fortwirkend und produktiv. Das Wesentliche dabei war, daß der Sinn der Musik überhaupt ein anderer wurde. Das Gefühl für die Notwendigkeit des organisch-gewachsenen, musikalischen "Ganzen" war zerstört, und nun erst der Weg offen für die Entwicklung der letzten Zeit, die die Musik mit Haut und Haaren dem modernen Fortschritt auslieferte. * Hier noch ein paar Worte über die produktive Seite des modernen Musizierens, deren Wichtigkeit mehr und mehr erkannt wird. Denn was uns einzig helfen könnte, die lebendige Wirkung der großen Meisterwerke - (bilden sie doch, selbst wenn sie nur zum kleinsten Teil aus der Gegenwart stammen, die einzige Rechtfertigung unseres ganzen Musiklebens) -, sie wird größtenteils illusorisch gemacht durch schlechte Aufführungen. Dabei verhält sich die sogenannte Öffentlichkeit sehr sonderbar. Gegen jede technische Unzulänglichkeit auch geringer Art wendet sie sich erbarmungslos, sieht aber ruhig zu, wie die herrlichsten Werke zerrissen, verzerrt, durch frevelhafteste Gleichgültigkeit zu Tode. gemartert werden. Bei näherem Zusehen scheint freilich auch dieses, abgesehen von Gründen persönlicher Eitelkeit, Phrase und Impotenz, die hier wie überall ihre Rolle spielen, tief in der allgemeinen künstlerischen Situation der Zeit begründet. Denn auch als Darstellende sind wir dieselben wie als Schaffende, wie wir produzieren, so reproduzieren wir, dieselben Richtungen, Strömungen, Gefahren, die sich bei unseren eigenen Werken zeigen, zeigen sich in der Art, wie wir die Werke anderer sehen. Die Unfähigkeit, den elementaren Ausdruck und Verlauf eines Großen und Ganzen musikalisch wirklich durchzufühlen, macht sich gerade bei den Werken am meisten bemerkbar, deren lebendig wirkendes Vorbild wir am nötigsten hätten; weil sie am meisten beim Darstellenden voraussetzen, werden sie am schlechtesten aufgeführt. Das zeigt sich überall; am deutlichsten an der Art, wie man heute den sogenannten "klassischen" Meistern (Bach usw., am meisten Beethoven) begegnet. Man pflegt sie im allgemeinen auf zweierlei Weise aufzuführen: Einmal, indem man sie "historisch" auffaßt. Das heißt, man sagt sich, sie gehören einer in sich abgeschlossenen und vollendeten Periode an, die uns lebendige Menschen von heute unmittelbar nichts mehr angeht; daß dies wirklich so ist, daß sie uns ganz und gar nichts mehr angehen, daran zweifelt allerdings nach einer solchen Aufführung denn auch niemand mehr. Man geht an die Werke heran mit jener beweglichen Eleganz, gegen die schon Wagner protestierte und die heute eine Renaissance zu erleben scheint. Man enthält sich "geschmackloser" Eingriffe und tritt nicht mit den Ansprüchen der Menschen von heute an Ausdruck und Belebung heran; so gelingt es denn auch, jeden "Ausdruck" gründlich auszutreiben. Oder man will der eigenen "Persönlichkeit" zur Geltung verhelfen und versucht, als moderner Mensch die Werke zu modernen Werken zu machen. Hier zeigt sich, in dem für den modernen Künstler typischen Streben nach möglichst viel Ausdruck im einzelnen Moment, durch Espressivos aller Art noch krasser, wie wenig wir heute solchen Aufgaben gewachsen sind. Der Grund ist in beiden Fällen derselbe; es ist die Unfähigkeit, die eigentlichen Angelpunkte des Ausdrucks bei den großen Werken zu erkennen; eines Ausdrucks, der letzten Endes im Durchfühlen und Durchleben eines solchen Werkes als lebendigem Organismus beruht. Welch neue große Bedeutung dadurch dann nicht nur das "Ganze", sondern - in Beziehung darauf - auch die "Einzelheiten" bekommen, das gründlicher zu erörtern, wäre der Mühe wohl wert. Hier wollten wir nur kurz darauf aufmerksam machen, da diese Frage mit dem Vorhergehenden in tiefem Zusammenhang steht. PROBLEME DES DIRIGIERENS 1929 Die verhängnisvollste Folge des Mangels einheitlicher Fühlweise ist die Einengung und Be- grenzung des improvisatorischen Elementes beim Musizieren überhaupt. Je weniger der einzelne Musiker selbsttätig einheitlich mitarbeitet, desto mehr müssen die vom Dirigenten intendierten agogischen, dynamischen Nuancen usw. entweder ganz unterbleiben oder auf gleichsam rein mechanischem Wege, d. h. durch viele Proben, durch endlosen Drill erreicht werden. Gerade das Wichtigste und Beste aber, nämlich jene unmerkbare Variabilität des Tempos, der Farben, gelingt auf mechanischem Wege und durch Proben überhaupt nicht. Der Dirigent steht schließlich häufig vor dem EntwederOder des Übertreibenmüssens oder des gänzlichen Unterlassens seiner Absichten in dieser Beziehung. Entweder ohne natürliche Gliederung im Takt herunter, oder "einstudierte" absichtliche Nuancen - ein Zustand, der dann auch in hohem Maße der heutigen Wirklichkeit entspricht. Die Möglichkeit, ad infinitum zu probieren, die zum Teil als besonderer Vorzug dargestellt wird, verringert notwendig die Sensibilität und damit Qualität der Technik des Dirigenten, ebenso wie die psychische Sensibilität des Orchesters dann an typisch ungenial handwerkliches Arbeiten gewöhnt wird. Selbst gewisse, ebenfalls als "technisch" anzu- sprechende Qualitäten, z. B. ein gutes vom Blattlesen, werden durch Mangel an Übung mehr oder weniger eingebüßt. Größte technische Korrektheit und Kontrolle, die erreicht wird, ersetzt nicht den Mangel der Inspiration, hat aber die allerverhängnisvollsten Folgen für das Gesamtmusizieren. Die übermäßige technische Kontrolle, d. h. die gleichmäßig durchgeführte technische Vollendung aller Einzelheiten, die als solche einen ganz anderen Aspekt bieten, als sie von ihren Schöpfern, die stets vom Ganzen aus dachten, gemeint waren, verhindert die geistige Bindung derselben zum Ganzen. Der natürlich-produktive Weg, auf dem die Einzelheiten durch das Ganze gesehen und gedeutet werden, wird umgedreht. Das Improvisatorische geht seinem Wesen, ja seinem bloßen Begriff nach verloren; dies Improvisatorische, das nicht etwa ein bloßes Akzidens, eine Eigenschaft, die man haben kann oder nicht, darstellt, sondern schlechthin den Urquell alles großen, schöpferischen, notwendigen Musizierens. Die Bedeutung des Technischen in der Kunst, in früheren, dem Irrationalen mehr zugewandten Zeiten häufig unterschätzt - wird heute überschätzt. Demnach müßte auch mehr Einsicht in die Bedingungen des Technischen erwartet werden. Das ist bezüglich des Dirigenten nicht der Fall; ein gewisses Schema des Dirigierens, ein akademischer Begriff, wie man dirigieren soll, hat sich allerdings auch hier in letzter Zeit wie beim Geiger, Pianisten - übrigens nicht zum Vorteil der Musik herausgebildet. Es ist aber auffallend, daß gerade wirkliche Dirigenten, ein Toscanini, ein Bruno Walter, diesem Schema recht wenig entsprechen. Tatsache ist, daß diese Dirigenten es vermögen, jedem Orchester ihren eigenen Klang sofort aufzuprägen, während beim schulmäßig richtigen Dirigenten - alle Orchester gleich klingen. Die verhältnismäßig junge Kunst des Dirigierens ist selber zu wenig gefestigt, als daß sie theoretisch einigermaßen hätte erfaßt werden können. Was bisher darüber geschrieben wurde, ist, soweit es sich nicht mit Interpretationsfragen befaßt (Wagner, Weingartner), außerordentlich primitiv. Diese Interpretationsfragen sind nun freilich vom Problem des Dirigenten nicht zu trennen, und da müssen wir, um die ganze Entwicklung des Dirigierens respektive reproduzierenden Musizierens in der letzten Zeit uns überhaupt klarzumachen, etwas weiter ausholen. Seit Bestehen einer abendländischen Musik als Kunst, und insbesondere seit der Loslösung der Musik vom Kultus im 17. Jahrhundert, wurde jede Zeit durch die produktiven Genies gebildet, gestaltet, geführt, die sie hervorbrachte. In früheren Zeiten sprach sich das darin aus, daß produktiv und reproduktiv kaum zu trennen waren. Bach und Händel waren als Organisten berühmt, bei Beethoven, ja selbst bei Mendelssohn und Liszt war die freie Phantasie eines ihrer wesentlichen Ausdrucksmittel. Der schöpferische Genius bildete, bewußt und unbewußt, den Stil der Reproduktion der Zeit. Das Händelsche Oratorium, das Haydnsche Streichquartett, die Mozartsche Oper, die Beethovensche Sinfonie - jedes bedeutet eine Welt für sich, durch jedes wurde das Fühlen und Musizieren einer oder auch mehrerer Generationen geführt und ihm Gestalt gegeben. Chopins Klavier-, Brahms' Kammermusik, Verdis Gesang, Wagners, später Straußens Orchester - um nur etwas zu nennen -, diese Schöpfer bildeten den Stil ihrer Zeit, und das Heer der Reproduktiven, der Pianisten, Instrumentalisten, Sänger, Dirigenten hatte nichts zu tun, als ihnen zu folgen, ihren Intentionen zur Wirklichkeit zu verhelfen, sich von ihnen führen zu lassen. Wie hoch man auch die Versuche der heutigen Produktion, zu einem Ausdruck ihrer selbst zu gelangen, einschätzen mag, wie notwendig ihre im Vergleich mit früheren Zeiten oft undankbare Aufgabe auch ist: daß sie mit ihrem Stil des Musizierens nicht mehr den Stil von heute beherrschen und bilden, ist eine nicht zu leugnende Tatsache. Alle Förderung durch das Gewissen der Öffentlichkeit kann nicht den elementaren Mangel des Anteils des Publikums ausgleichen; die Vergangenheit in ihren bedeutendsten Erscheinungen erhält eine wachsende Macht. Die Entstehung des "historischen" Stiles kann ebensogut als Schwäche des Organisch-Produktiven wie als Stärke und Erweiterung des Blickes und Horizontes gesehen werden. Die Folge aber nun ist, daß die Menge der Reproduktiven nicht mehr wie früher durch die Produktiven geführt und geleitet wird. Und das gerade in dem Moment, als sich die Aufgabe des Reproduktiven durch die größere Bedeutung der Vergangenheit erschwert hat. Die wachsende Wichtigkeit, die man daher der Reproduktion und besonders dem Dirigenten heute beimißt, ist hierdurch vollauf erklärt. Auf seiner Schulter liegt eine Last von Verantwortung wie niemals früher; denn nicht mehr der große Schöpfer bildet den Zeitstil, sondern er hat den Stil der einzelnen Werke aus sich, d. h., aus diesen verschiedenen Werken heraus zu bilden. Nicht er wird von der Zeit getragen, sondern muß zum großen Teile die Zeit mittragen. Hierdurch entsteht eine ganze Kette neuer Probleme. Aus dieser Situation erklärt sich zur Genüge: erstens, wie wichtig der Dirigent ist, zweitens, wie selten er heute ist. Ja, dies beides hängt notwendig miteinander zusammen. Es erklären sich auch die Auswüchse: die maßlose Eitelkeit, die zahllosen krampfhaften Versuche, durch Scharlatanerie zu wirken. Der Kultus der Orchester im amerikanischen Stil, der Kultus überhaupt des Instrumentes in seiner materiellen Wesenheit, entspricht der technischen Einstellung von heute. Wenn das "Instrument" nicht mehr um der Musik willen da ist, ist sofort die Musik um des "Instrumentes" willen da. Auch hier gilt das Wort: entweder Hammer oder Amboß sein. Und damit ist das gesamte Verhältnis umgedreht. Und nun entsteht jenes Ideal des technisch "trockenen" Musizierens, das uns von Amerika als "vorbildlich" präsentiert wird. Das zeigt sich beim Orchester spiel in einer gleichmäßigen, gepflegten Klangschönheit, die niemals gewisse Grenzen überschreitet, und eine Art objektives Ideal der Klangschönheit des Instrumentes als solchem darstellt. Ob nun aber die Intention des Komponisten dahin geht, so "schön" zu klingen? Es zeigt sich im Gegenteil, daß etwa die rhythmisch-motorische Kraft ebenso wie die klangliche Keuschheit Beethovens durch ein solches Orchester und solche Dirigenten von Grund auf verfälscht werden. DIE FRAGE NACH DEM DEUTSCHEN IN DER KUNST 1937 Sonderbarerweise wußten die Deutschen nie so genau, was eigentlich das „spezifisch Deutsche“ in ihren Kunstäußerungen sei. Zwar warfen einzelne - und nicht erst seit Lessing - wiederholt diese Frage auf. Die breitere Öffentlichkeit indessen begann sich in Deutschland damit erst zu Beginn des Weltkrieges zu befassen. Damals, als wir uns - wie aus einem Traum emporgerissen - ringsum von Übelwollen, Mißverstehen und Haß umgeben sahen, zwang äußere und innere Not zur Selbstbesinnung. Wir versuchten uns klarzuwerden, was an uns sei. Der Zwang zur Selbsterhaltung nötigte uns dazu, uns unser selbst bewußt zu werden. Ich erinnere mich nun noch sehr genau meiner Verwunderung, in den vielen Artikeln, die über dieses Thema in deutschen Zeitungen zu lesen waren, so selten und flüchtig ein Gebiet erwähnt zu finden, auf dem die Deutschen anerkannt Großes geleistet hatten: das der Musik. Das war um so erstaunlicher, da gerade über diese Musik im Ausland eigentlich kaum eine Meinungsverschiedenheit herrschte. England und Amerika wußten genausogut, wer Bach und Beethoven war, wie etwa das Italien Verdis und Puccinis. Die französischen Impressionisten erklärten die klassische deutsche Musik zusammen mit der griechischen Plastik als die beiden schönsten; heiter-glanzvollsten Kapitel europäischer Kunstbetätigung überhaupt. Nur in Deutschland, ihrem Ursprungslande, wollte man nicht allzuviel von dieser Musik wissen; man erinnerte sich ihrer mehr am Rande, gleichsam mit einer gewissen Verschämtheit, falls man ihr nicht gar mit der berühmten deutschen „Objektivität“ gegenüberzutreten für gut fand. Und dies zu einer Zeit, wo man sonst doch alles tat, um jeden Aktivposten zu buchen. Nun muß freilich offen heraus gesagt werden, daß im allgemeinen kein Volk seine Großen weniger zu schätzen weiß als die Deutschen, daß keins seit jeher mehr belastet ist durch Selbstkritik am unrechten Ort, durch Minderwertigkeitsgefühle am falschen Platze, was das Gegenteil- ebenfalls oft am falschen Platze - nicht ausschließt. Das hängt mit dem deutschen Schicksal, dem durch dieses mitgeschaffenen, zwiespältigen deutschen Wesen zusammen. Mit der Musik hat es aber doch seine besondere Bewandtnis. Zwar war keine Kunst den Deutschen so vertraut und notwendig wie die Musik, die sie ja auch, ein jeder nach seinem Vermögen, in hohem Maße selber ausübten. Trotzdem, und gerade deshalb, entstand die deutsche Musik in ihrer größten und entscheidenden Zeit - von Bach bis zu Beethoven und Schubert - sozusagen unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Diese Musiker lebten und schufen fast alle nur für ihre unmittelbarste Umgebung, nur für einen kleinen verstehenden Kreis ohne jede Rücksicht auf „Wirkung“. Und als ihre Werke - in der letzten Zeit von Haydns und Beethovens Leben - anfingen, bekannter zu werden, drangen sie doch nicht entfernt so in das Bewußtsein der Nation, wie z. B. die gleichzeitige Dichtung Goethes und Schillers. Viel mitgewirkt hat dabei, daß Goethe, der große Sachwalter und Ordner deutschen Geistesgutes, der berufenste Zeitgenosse der großen Musiker, der Musik als Kunst fernstand. Zwar sind seine gelegentlichen Worte über Bach, Mozart, Beethoven aufschlußreicher als das meiste, was wir von Zeitgenossen über sie wissen. Immerhin wußte er zu wenig von Musik überhaupt, um auch nur zu ahnen, daß hier, in seiner unmittelbaren Nähe, eine Kunst entstand, wie sie in ihrem Reichtum und ihrer Wahrhaftigkeit den Deutschen weder vorher noch nachher beschieden war. Goethe aber gab seinem Jahrhundert und damit der bewußten deutschen Bildung überhaupt Richtung und Gesicht. Der einzige der Späteren, der Bescheid wußte und auf diese Bildung hätte wirken können, Richard Wagner, war zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Nietzsche war zu sehr „Wagnerianer“, um zur absoluten, insbesondere der klassischen deutschen Musik lebendige innere Beziehung zu haben. Er sprach von ihr, trotz richtig gesehener Einzelheiten, im ganzen mit der Anmaßung des Literaten und der Ahnungslosigkeit des Dilettanten. Und was schlimmer war, er machte Schule. Bis in die letzte Zeit ist die Musik verständnislosen oder gar haßerfüllten Mißdeutungen von seiten bedeutender Deutscher ausgesetzt gewesen (Stefan George u. a.). So kann man diese große Musik nicht ganz mit Unrecht als eine Art Pompeji bezeichnen, tief vergraben unter dem Schutt des Nichtwissens und der Gleichgültigkeit deutscher Durchschnittsbildung. Man sage nicht, daß Musik in erster Linie Sache tatkräftiger Pflege anstatt literarisch-bewußter Erkenntnis sei. Gewiß ist das der Fall, und gewiß sieht es mit dieser Pflege infolge vielfach falscher Tendenzen der heutigen Öffentlichkeit übel aus. Das genügt aber nicht, um das geringe Gewicht der Musik im deutschen Gesamtbewußtsein zu erklären. Für diese Musik selber hatte die Sache nun freilich auch eine andere Seite. Hier wiederholte sich in modernen Zeiten so etwas wie das Schicksal der griechischen Plastik. Denn während etwa die griechische Tragödie, im Laufe ihrer kurzen Entwicklung im Brennpunkt des öffentlichen Interesses und damit des bewußten Lebens von ganz Griechenland stehend, im Zeitraum von nur drei Generationen sich erschöpfte, dem Wandel der Anschauungen erlag, von Besserwissern und Sophisten zerschwatzt wurde, erhielt sich die bildende Kunst, die Plastik, die das ganze griechische Leben begleitete und doch von der öffentlichen Meinung Griechenlands (besonders in der Zeit der höchsten Blüte) als Selbstverständlichkeit genommen, kaum beachtet, wenn nicht gar verachtet wurde, ungeschwächt, unberührt durch Jahrhunderte im ruhigen still-organischen Wachsen, und konnte so mehr als alles andere griechisches Sein und Wesen der Nachwelt überliefern. Sie blieb gleichsam in der Region des Unterbewußten, des Unbewußten und konnte noch Götter schaffen und bilden zu einer Zeit, wo innerhalb des bewußten Denkens die Sophisten - die ihrerseits freilich auch nur wieder „Symptom“ waren - längst die Götter umgebracht hatten. Ähnliches trug sich mit der deutschen Musik zu. Auch sie schöpfte aus der stillen Geborgenheit, in der sie groß wurde, ihre Kraft. Die Atmosphäre liebevoll-enger weltferner Ruhe und Sammlung, der sie entsprang, gab ihr die Freiheit von allem Zwang des Sich-Rechtfertigen-Müssens, des Wirken-, des Effektmachen-Müssens, gab ihr die Möglichkeit, schlicht, einfach, wahrhaftig zu bleiben und so sich klar und unverfälscht auszusprechen. Nur die innere Unabhängigkeit, d. h. die Tatsache, daß sie nicht ausgesetzt war einer von außen kommenden besserwisserisch-unfruchtbaren Kritik, gab ihr die Fähigkeit, in sich selbst hineinzuhorchen und das zu werden, was sie wurde: der reinste Spiegel deutschen Wesens. Später, im neunzehnten Jahrhundert, insbesondere mit dem Auftreten der sogenannten „Zukunftsmusik“, mit Berlioz, Liszt und dem einseitigfalsch verstandenen Wagner, wurde die Sache schnell anders. Immerhin war die Tradition auch da noch so mächtig, daß ein Schumann, ein Brahms möglich war. Kehren wir zu unserem Ausgangspunkt, der Frage nach dem „Deutschen“ in der Kunst zurück. Was ist das für eine merkwürdige Frage! Welch anderes Volk käme je darauf, eine solche Frage an sich selbst zu stellen! Der Grund dafür, d. h., was diese Frage überhaupt hervorruft und ihre Beantwortung immer von neuem schwer macht, ist die - wenn man es so ausdrücken soll - DoppeIgesichtigkeit des deutschen Wesens. Immer wieder sehen wir den Deutschen bei dem Versuch, Dinge zu vereinen, die nicht vereinbar scheinen. Sein nordischer Ursprung ist nicht zu verkennen, und doch sehen wir ihn immer von neuem mit verhängnisvoller Leidenschaft sich dem Süden zuwenden. Dieser Drang nach dem Süden - wir reden hier mit Bedacht nur in ganz weiten Umrissen -, der sich seit den frühesten Zeiten der Völkerwanderung immer wieder geltend machte, sich durch zahlreiche germanische Staatengründungen am Mittelmeer das ganze Mittelalter hindurch - am symbolisch-sichtbarsten im „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“ - versinnbildlichte, ist ein nie völlig erklärbarer Zug beim Deutschen geblieben. Und dies nicht nur im Politischen, Physisch-Materiellen. Auch im Geistigen - sobald ein zusammenhängendes Geistesleben möglich war - wirkte sich diese merkwürdige Polarität aus, meistens unterirdisch, in besonderen Momenten aber, wie im Humanismus der Renaissance, in den sich immer wiederholenden Italienreisen der großen Künstler und am meisten und für uns heute am sichtbarsten im Klassizismus der Winckelmann, Goethe, Schiller deutlich an die Oberfläche tretend. Der historisch eingestellte Betrachter ist geneigt, dies für uns viel eher als ein Unglück wie als ein Glück anzusehen. Betrachtet er es vom Standpunkt der politischen Erhaltung der Nation, so sieht er in der Auseinandersetzung mit dem Fremden, besonders mit dem verführerischen Süden, die Gefahr für den deutschen Menschen überhaupt, betrachtet er alles, was den Deutschen von sich selbst - wie er meint - abzieht, als Verfall, als Dekadenz. Die Dichtung Goethes und Schillers wäre in seinen Augen ohne ihre falsche „klassische“ Tendenz anders, besser, für Deutschland ungleich verpflichtender geworden. Demgegenüber hinwiederum steht das Zeugnis großer Künstler, die vielfach in der Begegnung mit dem „Klassischen“, um einmal bei diesem viel mißbrauchten und gerade heute so viel mißverstandenen Ausdruck zu bleiben, das entscheidende Ereignis ihres Lebens erblickten. Für einen Dürer, einen Goethe hat die Berührung mit Italien dies Ereignis mit sich gebracht - und in welch großer beispielhafter Form! Für den deutsch-nordischen Künstler ist der Drang, sich mit der klaren, glückhaft-lockeren Kunst des Südens auseinanderzusetzen, in vielen Fällen geradezu ein innerer Zwang. Davon zeugen nicht nur ein Dürer, ein Goethe, sondern auch tausend und abertausend Kleinere. Diesen merkwürdigen, in solcher Weise eben nur uns eigenen Zwang als solchen nicht wahrhaben zu wollen, das deutsche Kunstwollen allein aus sich selbst und seiner rein-nordischen Erbschaft heraus erklären zu wollen, ist daher nicht nur einseitig, sondern ist Konstruktion, Unwirklichkeit - ist unhistorisch. In diesem Zusammenhang nun gewinnt die deutsche Musik eine eigentümliche Bedeutung, eben weil sie ihrem Wesen und ihrer Entstehung nach von dieser in der Geschichte der übrigen Künste immer wieder wahrnehmbaren Tendenz freiblieb, und mehr als diese aus sich selbst entstand. (Daran ändert nichts, daß der Historiker etwa bei Schütz, Bach, Händel, Mozart usw. zahlreiche Anregungen und Beeinflussungen italienischer Musik feststellen kann.) Sie ist bisher zur Beantwortung der Frage nach dem „Deutschen“ in der Kunst noch kaum herangezogen worden, wohl weil man sie nicht genug beachtete und nicht genug kannte. Und doch ist dies wiederum merkwürdig. Denn wenn sie auch dem Bildungsbewußtsein relativ fernblieb - wie wir schon erwähnten -, hat sie doch den deutschen Menschen, soweit er sich unmittelbar ansprechen ließ, im Sturme erobert. Und nicht nur diesen. Man kann sagen, nichts spezifisch Deutsches ist jemals so schnell übernational, jemals so schnell gesamteuropäisch bedeutsam geworden wie diese klassische Musik. Wie sehr sie zugleich bis ins einzelne hinein wiederum ureigenes Gewächs ist, sieht man daraus, daß sogar ihre Formen, sowohl die „Fuge“ wie die „Sonate“ - die herrschenden Formen absoluter Musik überhaupt - von Deutschen erfunden (soweit sich lebendige Formen „erfinden“ lassen), zur Entfaltung und zur höchsten Blüte gebracht wurden (was nicht im Widerspruch dazu steht, daß gewisse Anfänge und Ansätze, z. B. die der Fuge auch in den Niederlanden, zu finden waren). Was kann bessere Antwort geben auf die Frage nach dem, was „deutsch“ ist in der Kunst, als eben die Musik? Was sagt uns diese Musik über deutsches Sein und Wesen aus, wenn man ihre Sprache wirklich versteht? Vor allem eins: daß jener Gegensatz, den wir früher mit Mitteln und Worten des Historikers den von Nord und Süd nannten - mit dem Bewußtsein, damit nur einen ganz äußerlichen Hinweis auf das, was wir eigentlich meinen, gegeben zu haben -, kein Gegensatz ist, der durch geschichtliche Beeinflussung, sozusagen von außen her, in den Deutschen hineingetragen wurde, sondern aus ihm selbst, aus dem Tiefsten seines Wesens heraus stammt. Der Deutsche ist nicht der zwischen Nord und Süd, zwischen „klassischer“ und „nordischer“ Welt hin und her Geworfene, der niemals zu sich selbst kommt, sondern diese beiden Welten sind in ihm, auch wenn sie niemals von außen an ihn herangebracht worden wären. Es ist sein Wesen, in diesem Sinne zwiespältig zu sein, und er wird erst dann, wenn er zusammenzuzwingen versucht, was unvereinbar erscheint, ganz er selbst. Gewiß, er ist letztlich nordischen Ursprungs. Und nordisch bleibt auch der Grundcharakter dieser Musik, ihre dunkle, tragische Gewalt, die scheue Zartheit und Weichheit auch ihrer lichtesten und heitersten Gebilde. Und doch: Wo wiederum gibt es ein tieferes Erfassen der Gesetze organischen Werdens und Bildens - das eigentliche Signum klassischer Kunst -, als bei Bachscher Musik? Wo gibt es ein mehr Sich-Beschränken auf das Notwendige, eine größere Knappheit und Selbstzucht, verbunden mit gewaltigster Klarheit des Formens, als bei Beethoven? Was wohl ist klassischer in jenem grandiosen von Goethe konzipierten Sinne, als diese mit so hohem Rechte als „klassisch“ angesprochene deutsche Musik? Diese einfachen Musiker, diese strengen, stillen, unbeirrbaren Meister der Form wußten nichts von deutscher Geschichte, nichts von den Tendenzen der Dürer und Goethe, nichts von dem deutschen Klassizismus Winckelmanns, Schillers, Hölderlins; und doch, ist ihr Werk nicht die glänzendste Rechtfertigung dafür, daß die Instinkte jener in einem tiefen Sinne richtig, in einem tiefen Sinne deutsch waren, auch wenn sie selber nur von den Griechen zu sprechen glaubten? Gewiß, keinem wird eine gültige künstlerische Gestalt zu erreichen schwerer, als gerade dem Deutschen, keinem aber wiederum ist die Sehnsucht nach ihr tiefer eingepflanzt, keiner ist ihr auf dem Grunde seines Wesens leidenschaftlicher verfallen. Es war ein Deutscher, der schrieb: Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt. Goethe VOM HANDWERKSZEUG DES DIRIGENTEN 1937 Die Kunst der Orchesterführung spielt sich wie kaum etwas anderes innerhalb der Musik in breitester Öffentlichkeit ab. Ihre Technik ist keine Geheimwissenschaft, wie etwa die Technik verschiedener einzelner Instrumente, die eine lange Zeit der Vorbereitung - zum Teil ein ganzes Leben beanspruchen, um wirklich beherrscht zu werden. Die Öffentlichkeit hat die Möglichkeit, Zeuge zu sein aller Geheimnisse der Übertragung, wie sie zwischen Dirigent und Orchester hin und her fluktuieren. Denn das Dirigieren ist eine Kunst der "Übertragung". Durch relativ einfache Bewegungen wird hier der Rhythmus, der Klang, der Ausdruck des gesamten Ensembles bis in minutiöseste Einzelheiten bestimmt. Das Wie liegt sichtbar offen für jeden, der sich darüber Gedanken machen will. Man sieht die Musiker, wie sie auf den Dirigenten schauen (auch oftmals nicht zu schauen scheinen), man sieht die Bewegungen des Dirigenten. Diese, weil an die Durchführung des Rhythmus gebunden, haben nur wenig Möglichkeiten zu variieren. Und doch: gibt es größere Verschiedenheiten in der Wirkung auf das Orchester, als verschiedene Dirigenten? Ich rede nicht von der Interpretation, die naturgemäß je nach der Persönlichkeit des Kapellmeisters verschieden sein wird. Ich rede von "materiellen" Qualitäten des Orchesterspiels, die viel früher - und oftmals viel entscheidender - in Erscheinung treten als die interpretatorischen Absichten. Da ist als erstes: der Klang an sich. Warum klingt ein und dasselbe Orchester unter dem einen voll, rund und ausgeglichen und unter dem anderen scharf, hart und eckig? Warum spielt es - auch eine entscheidende Qualität, wenn es erfordert wird - unter dem einen legato, unter dem anderen nicht? Ist es nicht geradezu oft, als ob der rein klangliche Unterschied ein und desselben Orchesters unter zwei verschiedenen Kapellmeistern kaum geringer sei, als der zweier verschiedener Geiger oder gar zweier verschiedener Sänger? Es gibt Dirigenten, unter denen die kleinste Dorfkapelle spielt, als seien sie die Wiener Philharmoniker, und es gibt solche, unter denen selbst die Wiener Philharmoniker klingen wie eine Dorfkapelle. Man hat sich gewöhnt, in solchen Fällen von "Suggestion", "Macht der Persönlichkeit" usw. zu reden. Das ist alles Unsinn; keine Macht der Persönlichkeit vermag es zu bewirken, daß die minutiösesten Phrasen bei einem Dirigenten - dasselbe Tempo, dieselben gesamtinterpretatorischen Absichten vorausgesetzt - gesungen, abgerundet, gegliedert herauskommen, beim anderen stockig und holzig, wenn sie überhaupt zu hören sind. Nein: in Wirklichkeit - es muß gerade herausgesagt werden - gibt es keine verborgenere Kunst als die des wirklichen Dirigenten. Das gilt nicht nur für Publikum, Kritik usw., die mehr oder weniger auf den allgemeinen Eindruck angewiesen sind, sondern auch für die sogenannten "Fachleute", die Dirigenten selber. Wie lange habe ich als junger Kapellmeister, der anfing wie andere junge Dirigenten auch, gebraucht, um dahinterzukommen, warum unter den einfachen Schlägen Arthur Nikischs jedes Orchester so verändert klang, warum hier sofort die Bläser ohne die üblichen übertriebenen sforzatis, die Streicher mit klingendem legato, das Blech mit natürlicher Einbettung in die übrigen Instrumente spielten und der Gesamtklang des Orchesters eine Wärme erhielt, die er bei anderen Dirigenten nicht hatte. Ich lernte begreifen, daß dieser schöne Zusammenklang unter Nikisch kein Zufall war; daß dies Phänomen, um es genauer zu sagen, an der Art lag, wie Nikisch in den "Klang" hineinschlug. Daß es also nicht eine Folge.seiner Persönlichkeit, seiner "Suggestion" - so etwas gibt es bei nüchternen Berufsmusikern nicht -, sondern seine "Technik" war. Die Technik des Dirigenten hängt natürlich insofern mit der Person zusammen, als sie durch das Ausdrucksbedürfnis des Menschen mitgebildet wird. Einem Strawinsky etwa schwebt ein anderer Orchesterklang vor als einem Richard Strauß; unwillkürlich wird auch seine Dirigiertechnik dem Rechnung tragen. Im übrigen gibt es heute eine Technik des Dirigenten, die in Büchern gelehrt und allenthalben ausgeübt wird, eine standardisierte Technik gleichsam, die einen standardisierten Orchester klang hervorbringt. Es ist die Technik der Routine, deren Endzweck die Erreichung eines präzisen Zusammenspiels ist. Es wird hier etwas, das selbstverständliche Voraussetzung jeder Orchesterführung sein sollte, sozusagen zum End- und Selbstzweck gemacht. Den Anforderungen der Musik wird diese Art Technik niemals wirklich völlig gerecht. Etwas Summarisches, Mechanisches wird ihr immer anhaften; die Masse, der "Apparat" lastet auf dem Geist und erstickt ihn. Tolstoi sagt bekanntlich: 95 Prozent aller Kunstbetätigung ist Routine, ist erlernbar; auf sie kommt es nicht an. Worauf es ankommt, sind einzig und allein die letzten 5 Prozent. Beim Dirigieren handelt es sich in erster Linie um Übertragung des Rhythmischen. Der Dirigent gibt vor allem das Tempo an, woraus sich alles übrige, Präzision des Zusammenspiels usw., ergibt. Dieses Tempo ist zunächst etwas Abstraktes, so wie etwa der Telegraph abstrakt (durch das Morsealphabet) wiedergibt. Das Mälzeische Metronom bezeichnet ein Tempo durch abstrakte Zahlen. Bei der Musik indessen handelt es sich niemals um ein in diesem Sinne abstraktes Tempo, sondern um Verwirklichung durch Töne, durch bestimmte, immer wechselnde Melodien usw. Es kann sein, daß diese Musik gerade selber mehr abstrakter Natur - also etwas staccato mit Betonung des Rhythmischen - sich darstellt, wobei dann eine abstraktklare, auf den rhythmischen Kern konzentrierte Zeichengebung am Platze ist. Es kann aber auch sein, daß sie in breiten Melodien dahinströmt, zu denen eine abstrakt-präzise, auf die Punkte des Rhythmischen ausgerichtete Zeichengebung des Dirigenten in fühlbaren Gegensatz tritt. In diesem Falle müssen Melodien vorn Orchester als zusammenhängende Phrase, das ist eben, als Melodien gespielt werden, trotzdem die Zeichengebung des Dirigenten nur die Eckpunkte, die rhythmischen Schnittpunkte, anzugeben imstande ist. Hier nun haben wir das ganze Problem der Dirigiertechnik in nuce: Wie bringe ich als Dirigent, dem nur die Möglichkeit übrigbleibt, mit seinem Stab in der Luft herumzufahren, das Orchester dazu, eine Gesangsphrase ihrem Wesen nach - eben als Gesang - wiederzugeben? Mit anderen Worten: Wie kann ich - angesichts der lebendig auf die rhythmischen Punkte eingeteilten Ubertragungsmechanismen - ein Orchester singen machen? Bis zu gewissem Grade ist das natürlich auch mechanisch möglich; denn auch Gesang vollzieht sich in einem bestimmten Rhythmus, ist eingespannt in einen rhythmischen Gesamtverlauf. Insofern wird er auch durch einen ausschließlich rhythmisch gerichteten Kapellmeister seinen Platz angewiesen bekommen können. Aber auch nicht mehr. Denn in Wahrheit ist Gesang, ist die Gesangsphrase etwas spezifisch anderes als die nur in Rhythmus aufgelöste Musik. Sie ist nicht nur eine Verbindung von Punkten, sondern sie ist ein Ganzes, das sich als solches - auch in rhythmischer Beziehung - aus dem Rhythmus des Ganzen herauslöst respektive wieder einpaßt. Der Gesang, die Gesangsphrase ist etwas prinzipiell anderes als aller Rhythmus, aber etwas - und das muß hier ein für allemal festgestellt werden -, das für die Musik als Kunst, wie wir sie in Europa verstehen, nicht weniger ursprünglich bedeutsam ist als der Rhythmus. Hier fängt das Problem des Hörens und Musizierens und damit des Dirigierens eigentlich erst an. Die Frage der "Technik" des Dirigenten, von der wir ausgingen, heißt also in Kürze: Wie mache ich es, daß ein Orchester nicht nur rhythmisch präzis zusammenspielt, sondern auch singt, singt mit all jener Freiheit, die zur Verwirklichung jeder lebendigen Gesangsphrase gehört. Mechanisch-rhythmische Präzision und Freiheit des Singens - anscheinend unvereinbare Gegensätze -, wie sollen sie vereint werden? Oder umgekehrt: Wie bringe ich ein Orchester, das singt - mit all jenen zahllosen, unsagbar, durch Proben niemals festzulegenden rhythmischen Eigenwilligkeiten, die allem echten Singen eigen sind -, dazu, bis in alle Einzelheiten hinein rhythmisch präzis zusammenzuspielen? Hier haben wir den Grund der Wirkung des Dirigierens Arthur Nikischs, von der ich mich selber noch überzeugen konnte. Nikisch vermochte es eben, ein Orchester singen zu machen. Dies, darüber möge man sich klar sein, ist etwas höchst Seltenes. Denn mit diesem "Singen" sind ja nicht nur die relativ einfachen Stellen gemeint, wo tatsächlich die Musik in leicht übersichtlichen breiten Melodien dahinströmt, sondern jene unendlich vielfältigen Bildungen, wie sie vor allem in der klassischen Literatur vorkommen wo die Gesangslinie, das "Melos" (wie Wagner es nannte), zwar Immer vorhanden, aber beständig bis in Bruchstücke einzelner Takte hinein den Ort, die Lage, die Stimme wechselt. Es ist deshalb für das Verständnis des jeweiligen Werkes nicht weniger wichtig, aber allerdings in seinen tausend Verkleidungen schwerer zu erkennen. Die dem Rhythmus, dem Punkt entsprechende Bewegung ist naturgemäß selbst rhythmisch, selbst gleichsam ein Punkt, mit höchster Präzision gekennzeichnet. Nun ist aber - und das ist das praktische Problem alles Dirigierens - dieser Punkt, diese Präzision etwa in einem Orchester nicht zu erzielen, wenn man einen ebensolchen Punkt in die Luft macht. Denn was ein Kollektiv, eine Menge von Menschen veranlaßt zur gleichen Zeit einzusetzen, bedarf optisch einer gewissen Vorbereitung. Nicht der Moment des Niederschlags selbst, nicht die Genauigkeit und Schärfe, mit der dieser Niederschlag gegeben wird, ist ausschlaggebend für die im Orchester erzielte Präzision, sondern die Vorbereitung, die der Dirigent diesem Niederschlag gibt. Daß der Niederschlag selbst kurz und genau ist, hat höchstens eine Wirkung auf die folgenden Niederschläge, indem es den schwingenden Gesamtrhythmus markiert, ist aber für den ersten Ton, das ist für den Ton, dem dieser Niederschlag eigentlich gilt, bedeutungslos. Das wissen alle die, die nur in Punkten, das ist mit scharfem Niederschlag, dirigieren - es sind 9 0 Prozent aller Dirigenten - nicht. Der scharfe Niederschlag hat zweifellos seine Nachteile. Er bedeutet eine Festlegung der Bewegung auf den einen Punkt, die dem lebendigen Fluß der Musik gegenüber eine Reduktion der Ausdrucksmöglichkeit mit sich bringt. Ein Punkt bleibt immer ein Punkt; es ist selbstverständlich, daß ein Orchester, das in Punkten dirigiert wird, auch Punkte spielt, d. h., alles rein Rhythmische wird mit der erforderlichen Genauigkeit gebracht, alles Melodische aber, alles, was zwischen den einzelnen Schlägen liegt (und es ist das unter Umständen sehr viel: man denke nur etwa an die Fülle von Ausdruckszeichen, crescendo, decrescendo usw., die in der Musik mancher Komponisten so wichtig sind), wird davon nicht beeinflußt. Es ist für eine solche Interpretation dann charakteristisch - und dies ist heutzutage der häufigste Fall -, daß zwar der Rhythmus, der Takt zu seinem Rechte kommen, nicht aber die Musik. Die Möglichkeit, einen Ton zu beeinflussen, liegt - das kann nicht nachdrücklich genug betont werden - durchaus in der Vorbereitung des Schlages, nicht im Schlag selbst. Das ist in dem kleinen, oftmals winzig kleinen Moment des Niederschlags, bevor der Punkt des Zusammenklangs im Orchester erreicht ist. Wie dieser Niederschlag, wie diese Vorbereitung beschaffen ist, so wird der Klang kommen, und zwar mit einer absolut gesetzmäßigen Genauigkeit. Es ist auch für den erfahrensten Dirigenten immer wieder von neuem erstaunlich, mit welch unglaublicher Präzision sich in einem gut eingespielten Orchester alle, auch die kleinsten und minutiösesten Bewegungen des Dirigenten spiegeln. Gerade dies ist der Grund, weshalb der Dirigent, der wirklich einer ist, im Konzert gar nicht die Möglichkeit hat, Bewegungen "für das Publikum" zu machen. Man hat früher immer behauptet, ein Dirigent wie Arthur Nikisch wäre posiert. Nun, ich kann aus persönlicher Kenntnis dieses Dirigenten - und diese meine Kenntnis ist sehr genau - bezeugen, daß Nikisch jede Art von Pose fremd war, wogegen andere Dirigenten, die im Gegensatz zu Nikisch schulmäßig dirigierten, nicht frei von Pose waren, denn sie hatten bei relativ primitiven technischen Einstellungen Zeit dazu, nebenbei an das Publikum zu denken, etwas, was einem Dirigenten, wie Nikisch es war, nie in den Sinn kommen mochte. Er hatte schließlich mit dem Klang als solchem, der Bildung und Gestaltwerdung dieses Klanges zu tun. In der Vorbereitung des Schlages also liegt alle Möglichkeit des Dirigenten zur Beeinflussung des Charakters der Interpretation, der Spielweise des Orchesters, soweit sie im Moment und nicht auf Proben stattfindet. Hier möchte ich einschaltend bemerken: im allgemeinen wird die Probenarbeit in unserem alles Mechanische überbewertenden Zeitalter überschätzt. Was man in Proben, selbst in sehr ausgedehnten, sehr konzentrierten und sehr genauen Proben einem Orchester beibringen kann, ist wenig im Verhältnis zu dem, was man durch die Art des Schlages und der damit verbundenen instinktiven, das heißt unterbewußten Mitteilungsweise von Anfang an in wenigen Minuten einem Orchester beibringen kann. Dies ist denn auch der Grund, weshalb verschiedene Dirigenten - jedenfalls solche, die diesen Namen verdienen, und nicht die bloßen Taktschläger - einen je nach ihrer Individualität und nach ihrer Interpretation so verschiedenen Klang aus ein und demselben Orchester herausholen. Hierauf beruht die instinktive Schätzung des Publikums, die der Dirigent genießt. Wenn nun, wie ich vorher sagte, die Vorbereitung, d. h. der Schlag selber und nicht sein Endpunkt, dasjenige ist, was den Klang des Apparates am stärksten beeinflußt - ließe sich nicht da ein Dirigieren denken, das auf die Endpunkte jedes Schlages, die Knoten,die Spitzen der ,Telegraphie ähnlicher Punktzeichen, möglichst verzichtet, und nur den Schlag, nur die Vorbereitung als solche braucht? Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daß dies nicht nur eine bloße Theorie ist, sondern daß ich selber seit vielen Jahren diese Art Praxis zu handhaben mich bemühe. Dies ist der Grund, warum viele, an die übliche Dirigiertechnik, die man in den Konservatorien lernt, gewöhnte Zuschauer meine Bewegungen nicht verstehen. Sie scheinen ihnen unklar, sie gehen sogar so weit zu behaupten, ich triebe "camouflage", Noch kürzlich schrieb ein Kritiker über mein Konzert, das ich mit den Wiener Philharmonikern gab: "Bei den undeutlichen Bewegungen des Dirigenten ist es unverständlich, wieso im Orchester ein so vollendetes Ensemble zustande kommt. Eine einzige Lösung des Rätsels heißt: unendliche Proben." Nein, gerade das ist nicht die Lösung des Rätsels. Die Proben, die ich mache, gehen nicht über das übliche hinaus und beschäftigen sich mit technischen, das ist mit Präzisionsfragen, so gut wie gar nicht. Gerade die Präzision ist vielmehr die natürliche Folge meines "undeutlichen" Dirigierens. Daß dieses undeutliche Dirigieren nicht undeutlich ist, zeigt sich ja schließlich gerade daran, daß der Apparat mit vollendeter Präzision funktioniert. Dies aber ist sozusagen die Probe aufs Exempel. Ich kann nur immer wiederholen: Es gibt keinerlei Dirigierbewegungen an sich, sondern nur solche für einen praktischen Zweck, nämlich das Orchester. Von hier aus, das ist von der Musik aus, müssen Dirigierbewegungen beurteilt werden, und von der Musik aus werden auch meine Bewegungen verständlich sein, wie es schließlich die Reaktion der Orchester, die ich allerorten dirigiert habe, deutlich beweist. Große Komponisten sind nicht immer Dirigenten, sie sind aber immer große Musiker und sind als solche auch für den Dirigenten bedeutungsvoll. Ein Komponist, der mehr als die meisten anderen auch Dirigent war, Richard Strauß, erwähnte mir gegenüber einmal angesichts einer Aufführung von Nikisch: Nikisch hat die Fähigkeit, aus dem Orchester einen Klang herauszuholen, die wir anderen nicht besitzen. Ich weiß nicht, worauf es beruht, aber es ist unbezweifelbar Tatsache. Strauß rührte hier das Problem an, das ich in diesen Zeilen zu erhellen versuchte, das besonders deshalb so unzugänglich zu sein scheint, weil das Dirigieren, das sich in breitester Öffentlichkeit vollzieht, dem Anschein nach auch in seiner technischen Seite dem Verständnis und dem Urteil dieser Öffentlichkeit, den breitesten Massen, offenstehen muß. Es zeigt aber die Erfahrung, daß selbst gewiegte Fachleute, Leute, die sich seit vielen Jahren mit Dirigieren und den damit zusammenhängenden Fragen intensiv beschäftigen, vor dem Schauspiel eines wirklichen Dirigenten ratlos stehen. Wäre dem nicht so, so würden viel mehr Dirigenten jede Art des Dirigierens, als deren Exponent ich in der vergangenen Generation Nikisch genannt habe, nachzuahmen versuchen. DER „GEISTLICHE TOD“ 1941 Der kürzlich verstorbene Dichter Paul Ernst erwähnt in einem seiner Aufsätze das, was die mittelalterlich-katholische Scholastik den "geistlichen Tod" nannte, jenes merkwürdige Phänomen, daß innerhalb eines völlig gesunden, lebensfähigen Körpers die Seele stirbt. Ernst stellt dies vor allem am Schicksal des ägyptischen Volkes dar, wie ja Schicksale ganzer Völker innerhalb der Geschichte und Schicksale einzelner Menschen innerhalb ihres begrenzten Menschenlebens unendlich viel Parallelen aufweisen. Die Ägypter waren bekanntlich auch diejenigen, die Spengler zu seiner berühmt gewordenen Theorie des Anwachsens und Absterbens der Völker von höherer Kultur, aus archaischen Zuständen zu höchster kultureller Blüte und schließlich zu leerer Zivilisation, inspirierte. Spengler nannte den Endzustand eines solchen Volkes "Fellachentum". Als der berühmte Dorf-Schulze aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. in Ägypten durch Ausgrabungen aus dem Nilschlamm zu Tage kam, sagten die Ägypter sofort: "Das ist ein Dorf-Schulze", d. h., der körperliche Typus dieses Mannes war vor 5000 Jahren schon genau derselbe, wie er es noch heute wäre. Noch heute sehen die Dorf-Schulzen der Fellachen ebenso aus wie dieser Mann, und doch können die Nachfahren derselben Ägypter, die einst eine Kunst geschaffen haben, die in ihrer Großartigkeit und stilistischen Höhe niemals wieder erreicht worden ist, die eine hochstehende Religion und eigentümliche höchstproduktive Kultur ihr eigen nannten, heute nicht mehr die anspruchsloseste Handwerkerarbeit durchführen. Beim Bau des Suezkanals mußte man ausländische Arbeiter heranziehen, weil die Ägypter intellektuell nichts konnten. Dennoch aber essen sie, schlafen sie, vermehren sie sich, sind körperlich gesund und werden alt wie ihre Vorfahren vor 5000 Jahren - nur haben sie ihre Seele verloren. An der ägyptischen Geschichte ist dieses merkwürdige Phänomen deshalb besonders klar und deutlich zu sehen und zu studieren, weil die Ägypter ein Volk waren, das sich im Laufe der Geschichte ungewöhnlich wenig mit anderen Völkern vermischt hat. Die gelegentlichen Überfremdungen, die auch ihm nicht erspart blieben, wurden mit der Zeit immer wieder überwunden. Und so kann man bei ihm, wie selten bei einem Volk, innerhalb der Geschichtsüberlieferung von einem zusammenhängenden Volksschicksal sprechen. Dieses selbe Schicksal nun aber begegnet uns bei einzelnen Menschen. Rings um uns haben wir Bekannte, Freunde, mit denen wir leben, und die uns doch in Wirklichkeit aus hohlen Augen mit gestorbenen Seelen anblicken, ohne es zu wissen. Wissen oder richtiger bemerken können das natürlich nur die, die selber eine Seele haben, und nur, soweit sie eine haben; denn nur soweit sind sie imstande, die Abwesenheit einer solchen zu entbehren. Sie sind es auch, die bei hundert Anlässen des Lebens, bei den Erscheinungen der Geschichte, des öffentlichen oder privaten Wirkens der Menschen, sich das Gefühl dafür bewahrt haben, wie weit die Seele, d. h. der im höchsten Sinne ganze, runde, volle Mensch, mitspricht oder nicht. Ganz besonders aber ist der Künstler, befähigt und darauf angewiesen, die seelische Jugend und Kraft eines Menschen zu bemerken. Lebt doch die Kunst im eigentlichen Sinne von der Seelensubstanz, ist sie doch nichts anderes als deren getreuer Ausdruck. So sehen wir denn auch gerade bei Künstlern am deutlichsten, wie sich die Beziehungen zwischen Seele und Körper im Laufe eines langen Menschenlebens verändern. Es gibt Künstler, die bis zu ihrem 20. Lebensjahr eine Seele hatten und dann bis zu ihrem 80. Jahr ohne sie fortwerkelten und sich beständig selbst nachahmten. Es gibt andere, deren Seele sich bis zu ihrem letzten Atemzuge beständig erneuerte. Nicht bei allen spricht sich dieses Verhältnis so deutlich aus, wie z. B. bei Rossini, der bekanntlich nach seinem 40. Jahr mit Komponieren aufhörte und sich darauf beschränkte, zu kochen und Kuchen zu essen durch weitere dreißig Jahre hindurch. Man kann einem solchen Manne zumindest die Ehrlichkeit nicht absprechen - sehr im Gegensatz zu den meisten Erscheinungen gerade unserer Zeit. Sehr deutlich ist das Verhältnis zwischen Seele und Körper oder, besser gesagt, ist das Alter und die Lebenskraft der Seele eines Künstlers bei den sogenannten Nachschaffenden, bei Pianisten, Geigern, insbesondere Kapellmeistern, zu bemerken. Der Dirigent hat zur Materie seiner Kunst nur ein mittelbares Verhältnis. Er bildet nicht aus der Kraft seines Körpers heraus wie der Sänger die Stimme. Es ist daher bei ihm nicht möglich, daß - wie bei jenen - die schöne Stimme die Menschen noch lange betört, während die dahinterstehende Seele längst gestorben ist - so wie wir bei den Ägyptern gesehen haben, daß körperlich-biologische Gesundheit und Kraft mit Gesundheit und Kraft der Seele keineswegs identisch sind. Auch der Ton der Instrumentalisten, des Geigers, ja, des sprödesten aller Instrumente, des Klaviers, ist irgendwie durch biologische Gesundheit des Körpers mitbedingt. Er kann als isolierte Errungenschaft eines Körpers weiterbestehen, wenn auch das, was diese Errungenschaft herbeigeführt hat, die Seele, längst verschwunden ist. Beim Dirigenten aber zeigt sich ein seelisches Manko am unmittelbarsten. Dirigieren ist Ausströmen seelischer Energien auf einen Instrumentalkörper, und diese seelischen Energien bilden schließlich auch die materielle Qualität des Tons, das rhythmische, harmonische und klangliche Leben. Worin vermögen wir nun ein Absterben oder Nachlassen seelischer Kräfte bei einem Künstler wahrzunehmen? Die Kraft einer jugendlichen Seele äußert sich recht eigentlich in der Hingabe an eine große Aufgabe. Die Art dieser Aufgaben, die an den Menschen herantreten, ist unendlich verschieden; mit ihnen wollen wir uns jetzt nicht befassen, wenn es auch nicht ohne Bedeutung ist für das Wirken des Seelischen, an welchen Aufgaben es sich manifestiert. Zunächst aber ist das Wie hier besonders aufschlußreich. Die Art, wie an eine Aufgabe herangegangen wird, der Grad der wirklichen Hingabe ohne Vorbehalt, kennzeichnet die Jugendlichkeit der Seele. Je älter der Mensch seelisch wird, je mehr die allesbelebende Kraft dieses Zentrums seiner Existenz sich verflüchtet, desto stärker wird der platte Egoismus des Körpers. Wenn Spengler sagt, daß in diesem Sinne alte Völker nicht mehr kämpfen wollen - er erwähnt dabei die mohammedanischen Einwohner von Bagdad, die sich von den Mongolen alle abschlachten ließen -, so hat auch die moderne Zeit dafür Beispiele. Völker wollen nicht mehr kämpfen, weil der einzelne nicht mehr die Kraft der Hingabe, die ihn über den allzu persönlichen Egoismus, des Um-jeden-Preis- leben-Wollens; hinwegträgt, aufbringt. Beim reproduktiven Künstler zeigt sich dieser Egoismus - um bei diesem Wort zu bleiben - in der mehr und mehr nachlassenden Hingabewilligkeit an die seelischen Ursprünge des Werkes, das er unter den Händen hat. Jedes große Kunstwerk, sei es, wie es sei, wird von einem bestimmten Ausdrucksbedürfnis geschaffen; hinter ihm steht ein Lebensgefühl, und wer dieses Lebensgefühl nicht wieder und erneut zu fühlen imstande ist, wer es nicht neu erwecken kann, wird auch das Werk nicht erwecken. Man vergegenwärtige sich nur einmal die Situation eines darstellenden Künstlers, etwa eines Dirigenten - hinter sich ein Publikum, das von ihm Wirkungen erwartet (also eine Art Zwangssituation), und vor sich ein Werk, das nicht mit genügend Deutlichkeit zu sagen scheint, wie und woher er diese Wirkung nehmen soll, d. h., deutlicher gesagt, dessen inneres Lebensgefühl er nicht von neuem wieder zu erwecken vermag. Er wird Auswege suchen - ja, er muß Auswege suchen. Da ist zunächst der Ausweg, der bei der Schauspielkunst der nächstliegende ist, eben durch das Leben des Theaters. Man "macht Theater", d. h., man täuscht die Empfindung vor, die man nicht hat. Wenn nun ein Publikum vorhanden ist, das selber noch echte seelische Qualität besitzt, so fühlt das unweigerlich sofort, wo beim Künstler das "Theater" beginnt, wo er anfängt vorzutäuschen, statt wirklich zu leben, wirklich zu reproduzieren. Besteht dieses Publikum aber, wie es vielfach beim Publikum unserer Großstädte, insbesondere beim Publikum der wenigen Weltstädte, der Fall ist, selbst aus einer Majorität innerlich schon toter, ausgehöhlter, seelenloser Menschen, so wird das Gefühl für das Falsche, innerlich Verlogene an dem Vorgehen des Künstlers nicht mehr vorhanden sein. Der Künstler wird weiter wirken können; er wird vielleicht berühmt gerade durch die Eigenschaften, die ihn einem solchen Publikum empfehlen. Wir haben innerhalb der modernen Musikkultur, die nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa und Amerika, soweit es sich mit Musik befaßt, einschließt, eine Reihe solcher Fälle; und sie vermehren sich mit weiterer Verweltstädterung der Musikverhältnisse. Dennoch hat es von weiterer Sicht aus den Anschein, als ob alle diese Erscheinungen mit der Zeit in sich selbst abstürben. Und das zwar deshalb, weil die Menschen nur so lange Empfindungen vortäuschen können, solange sie diese Empfindungen noch von der Zeit her, wo sie echt waren, irgendwie in Erinnerung haben. Auf die Dauer sich gegenseitig mit vorgetäuschten Empfindungen zu ergötzen, interessiert die Menschen nicht. Seelenlose Menschen verzichten schließlich gern auf den Anschein der Seele; insbesondere, wenn sie innere Aufrichtigkeit besitzen. Innere Aufrichtigkeit, oder wenigstens das Bedürfnis danach, kann man der modernen Welt wohl am wenigsten absprechen. In der Kunst zeigt sich das in einer Reihe eigentümlicher Theorien, die gerade in den letzten Dezennien mehr und mehr an Boden gewonnen haben. Mit dem Schwinden der seelischen Beteiligung des Menschen an der Re-Produktion eines Werkes werden - rein körperlich gesehen - Geisteskräfte frei, die nach anderer Seite hin sich Bahn schaffen. Sehr charakteristisch ist bei Künstlern dafür das, was man "technische Kontrolle" nennen möchte. Das geschulte Ohr für die kleinste Unebenheit technischer Art, Unsauberkeit, Unklarheit rhythmischer Natur usw. ist eine Forderung des aus voller und gesunder Seele Reproduzierenden. Diese "Kontrolle" nimmt aber um so mehr überhand, je mehr die seelische Beteiligung nachläßt. Von einer selbstverständlichen Voraussetzung, gleichsam einer natürlichen Begleiterscheinung des ganzen Reproduktionsprozesses, rückt sie auf zu einer beherrschenden Sorge, zur schließlich entscheidenden Leistung. Die gewaltige Steigerung technischer Qualität innerhalb des modernen Instrumentalistentums, Dirigententums usw. ist nicht zu verkennen. Daß sie erkauft ist mit einem ebenso großen Verlust seelischen Wissens, seelischen Fühlenkönnens, mit einem ebenso großen Verlust von Phantasie und wirklicher Lebenskraft, wissen die wenigsten. So müssen wir Künstler von heute uns darüber klar sein, uns damit abfinden, daß die menschliche Seele, d. h., diejenige Kraft, der alle großen, wirklich lebendigen Kunstwerke entspringen und von jeher entsprungen sind, schwer erkämpft ist und immer von neuem umkämpft werden wird. Bedeutsam für heutiges Denken ist, daß jene biologische Einstellung zur Welt, die den Sinn der Welt in ihrer Gesundheit sieht - eine Gesundheit, die wesentlich an körperlichen Funktionen abgenommen ist -, der wirklichen Welt keineswegs gerecht wird. Die Kunst und die Künstler scheinen - richtig verstanden - ein ungleich zutreffenderes und getreueres Bild der wirklichen Gesundheit und des Kraftverhältnisses darzustellen, als eine rein pragmatische, von den eigentlichen Erkenntnissen der Seele absehende Biologie, wie sie heute Mode ist. MENDELSSOHN ZU SEINEM 100 JAHRIGEN TODESTAG 1947 Über die Beziehung Mendelssohns zu Leipzig ist hier genug gesagt worden. Obwohl ich, als ehemaliger Gewandhauskapellmeister, einer seiner letzten Nachfolger bin, so möchte ich darauf nicht eingehen. Es war auch nicht deswegen oder deswegen allein, daß ich es besonders begrüßt habe, diesen bedeutsamen Gedenktag hier mitfeiern zu können. Es sind tiefere Gründe, die uns veranlassen, uns heute dessen zu erinnern, was Mendelssohn gewesen ist und geleistet hat. Die Zeit ist nicht fern, wo ein engstirniger Rassenmaterialismus Mendelssohn die Zugehörigkeit zur deutschen Musik ab-sprach. Gerade diese Zugehörigkeit ist es, die, wenn man objektiv ist, außer jedem Zweifel steht. Mendelssohn ist zwar nicht, wie der ebenso sehr zum deutschen Kulturkreis gehörende Gustav Mahler, eine im engeren Sinne "deutsche" Angelegenheit geblieben. Seine Wirkung war zu seinen Lebzeiten in hohem Maße gesamteuropäisch. Dennoch sind die Einflüsse, die er erfahren und dann wiederum ausgeübt hat, sind die Vorbilder, denen er nachgestrebt hat, alle deutsch im eigentlichsten Sinne. Er gehört ganz und gar in die deutsche Musikgeschichte. Er stellt eine der überzeugendsten, weil produktivsten Beispiele jener Symbiose zwischen Deutschtum und Judentum dar und straft die Theorien, die diese Symbiose als unmöglich oder als verwerflich bezeichnen, von vornherein Lügen. Wenn als wesentlicher Teil des Programms, das anläßlich seines 100. Todestages im Gewandhaus unter meiner Leitung erklingen soll, die "Eroica", das allgemeinweltweiteste, aber doch wiederum deutsche Symbol der Heldenverehrung erklingen wird, so deshalb, weil er auf seine Weise ein Held dieser deutschen Musikgeschichte war, allerdings auf seine Weise, d. h. auf eine Weise, daran uns zu erinnern wir heute nicht nur des äußeren zufälligen Datums des Gedenktages wegen Grund haben. Der berühmte, kürzlich verstorbene Geiger Karl Flesch - selber Jude - sagte mir einmal: Mendelssohn ist der Erste der Komponisten zweiten Ranges. Er meinte damit, daß er als Schöpfer nicht den Rang der ganz Großen einnehmen kann - wenn man von diesen absieht -, aber einen allerersten Rang einnimmt. Die in diesem Urteil enthaltene Negation entspricht dem, was die Musikgeschichte, wenn wir sie heute befragen, bestätigt. Ein großer Teil seiner Werke ist verblaßt, ist Vergangenheit geworden. Nur wenige sind ganz lebendig geblieben. Diese freilich verraten eine stupende Meisterschaft durchaus einziger Art. Doch wollen wir hier nicht von dem Komponisten Mendelssohn im engeren Sinne sprechen, der für die Gegenwart immer eine begrenzte Bedeutung als Vertreter und Verwirklicher einer bestimmten Phase der deutschen Romantik haben wird. Werke etwa von der schöpferischen Unmittelbarkeit der Sommernachtstraummusik hat er nicht viele geschaffen. Dennoch ist seine Bedeutung damit keineswegs erschöpft. Größer und im gewissen Sinne weit aktueller scheint mir seine Bedeutung als Schöpfer einer Kultursphäre, als Haupt einer Schule, als Synthetiker. Es ist kein Zweifel, daß Robert Schumann, der edelste und substantiellste aller deutschen Romantiker, der Entdecker neuer Werte, der bei aller Begrenztheit der Umwelt weltoffene Geist, mit grenzenloser Verehrung zu Mendelssohn emporsah. Was Schumann in Mendelssohn sah, war vor allem der Vertreter lebendiger Tradition, und hier müssen wir etwas länger verweilen. Denn das, was Tradition ist, haben wir heute größtenteils zu verstehen verlernt. Seit Beginn der theoretischen Revolution, der Revolution in Permanenz, deren erste Anfänge bei der Zukunftsmusik von Wagner-Liszt zu suchen sind, ist das "Pathos der Tradition" immer schwächer geworden. Daß auch sie eine lebendige Macht allererster Ordnung sein kann, weiß man heute nicht mehr. Heute gilt nur das Pathos der Revolution, so sehr und so ausschließlich, daß man allmählich nicht mehr weiß, gegen was man noch revolutio- nieren soll. Diese Tradition aber, die Mendelssohn vertritt, ist in einem ganz besonderen Sinne die Tradition der deutschen Musik. Mendelssohn war es, der zuerst jene Synthese schuf, deren Eckpfeiler Bach und Beethoven, deren Grund die deutschen Klassiker bildeten. Das von ihm geschaffene Konservatorium, die Leipziger Schule, beherrschte das 19. Jahrhundert. Hinter ihr stand jene deutsche Musik, die die Welt erobert hat und auch heute noch der Welt gehört. Die Herrschaft der Mendelssohnschen Schule wurde in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts abgelöst von Joseph Joachim - der bekanntlich sogar von Richard Wagner als führender, darstellender und lehrender Musiker anerkannt wurde - und im Hintergrund Joachims Brahms. Hierher gehört auch die erste Aufführung - damals gleichsam Entdeckung - der Bachschen Matthäuspassion. Bach auf der einen Seite, der Sinfoniker Beethoven auf der anderen, das waren die Grenzen. Es war durchaus die höchste, die gültigste, die gesetzmäßigste Kunst, die Mendelssohn vorschwebte. Und das Gesetz im hohen Sinne war es, das er daraus las. Die Leipziger Schule war eine Schule der Gesetze - gewiß engster Gesetze, aber wirklicher Gesetze. Ohne zu verkennen, wie leicht diese Gesetze mißbraucht werden können - und von Schulmeistern aller Gattungen mißbraucht wurden und werden -, so haben wir doch heute ein neues Verhältnis zu diesem Gesetz. Dieses Gesetz, diese Tradition ist vor allem eine Absage gegen den Individualismus, und zwar eine, die wirklich ist. Das Gesetz Mendelssohns ist eine Konvention; und konventionell ist der Vorwurf, den man Mendelssohns Musik in erster Linie machen muß. Es ist aber nicht nur Konvention, oder vielmehr, es ist nicht Konvention. Dem Gesetz Mendelssohns nämlich eignet etwas, was heute völlig verlorengegangen ist und was ich die "Kategorie der Natürlichkeit" nennen möchte. Zur Ästhetik der Mendelssohnschen Kunst - wie übrigens auch zu der von Brahms, Smetana, Tschaikowsky, Schumann usw., ja, weiterhin sogar der von Wagner - gehört diese Natürlichkeit in erster Linie ... Mendelssohn, Joachim, Schenker, jüdisch-deutscher Nationalismus. Nach Meinung dieser Juden haben wir Deutsche allen Grund, uns als große, edelste Nation zu fühlen. Es ist traurig, daß dies heute betont werden muß. ZU DEN WERKEN HANS PFITZNERS 1948 Mit einem Werke wird der Name Hans Pfitzners für uns Deutsche immer verknüpft bleiben, mit der dramatischen Legende „Palestrina“. Kaum jemals hat ein Schaffender die Stellung des Künstlers innerhalb der Zeit, sein Wesen, Kämpfen, Leiden, ja, sich selbst, so hellsichtig-schonungslos dargestellt, wie Pfitzner es in seinem "Palestrina" getan hat. Dies Werk ist eine Autobiographie, aber eine solche, in der - anders als etwa in den Straußschen Werken, dem „Heldenleben“, dem „Intermezzo“ alles Nur-Biographische aufgesogen und auf ein dahinterliegendes Wesentlicheres rückbezogen erscheint. Es ist ein Abbild der Zeit, ein Abbild des Künstlers in der Zeit, ein Abbild der Kunst innerhalb der gegenwärtigen Weltenwende. Kaum jemals ist die Macht künstlerischer Intuition, die Einsamkeit des Schöpfers, die Kluft, Ferne und Feindseligkeit, die zwischen wirklicher Kunst und „wirklicher“ Welt herrscht, erschütternder Form geworden als in diesem Werk. An ihm scheinen - das erste und einzige Mal seit Wagner, und doch wiederum ganz anders - Dichter wie Musiker gleicherweise Anteil zu haben. „Palestrina“ ist Pfitzner, und Pfitzner ist „Palestnna“. Hier hat der Musiker dem Künstler ein Denkmal gesetzt, wie es in solch bewußter Art nur in unserer überwachen Epoche möglich war. Vor der Größe dieses künstlerischen Selbstopfers muß jeder Tageslärm verstummen. * Was unterscheidet Pfitzner von anderen führenden Musikern seiner Epoche, von Strauß, Reger, Mahler, Debussy? Daß er aus besonderem Holz geschnitzt ist, fällt sofort auf, auch wenn man dabei nicht an das ihm eigentümliche Lebensgefühl denkt, das er in seinen Schriften so oft zum Ausdruck gebracht hat - das Lebensgefühl des Einsamen, des gegen die Zeit Lebenden. Er geht auch als Musiker anders an seine Aufgabe heran als seine Zeitgenossen. Er verschmäht den Überbau eines hemmungslosen Kontrapunktierens, den Strauß und Reger zur Schaffung ihres Personalstiles heranbildeten. Er wacht eifersüchtig darüber, daß Technik nicht Geist und Sinn eines Werkes überwuchere. Er vermeidet sowohl die an Wagner anknüpfende Straußsche Leit-Thematik und deren Massenwirkungen als wie die Pseudo-Bachsche, nicht selten kontrapunktisch und harmonisch überernährte Regersche Instrumentalform. Der Versuchung des Mammutismus, der Übergröße der Form, dem die Epoche der Strauß, Reger, Mahler huldigte, erlag er niemals. Er steht zu den Themen, die er erfindet, d. h., er zeigt sich unbekümmert, wie er ist, auch auf die Gefahr hin, daß allzu kluge und blasierte Zeitgenossen ihn naiv oder unoriginell finden. Er, fast allein innerhalb seiner Generation, erhält sich ein immer waches Gefühl dafür, daß seelisches Erleben und rein musikalische Gegebenheiten zusammenfallen müssen, um ein Werk zu schaffen, daß auch edelstes Wollen des Geistes ohne dazugehörige musikalische Verwirklichung keinen Bestand hat, und daß vor allem auch glänzendste Entwicklung musikalischer „Materie“, wenn sie nicht parallel geht mit einem dahinterstehenden Ausdrucksbedürfnis, nichts bedeutet. So verzichtet Pfitzner bewußt auf das, was einen großen Teil der musikgeschichtlichen Bedeutung der anderen ausmacht: auf die Schaffung eines „Stils“. Dies war für die Wirkung seines Werkes, für das „Durchsetzen“ desselben in der heutigen Welt keineswegs vorteilhaft. Wohl hat auch er seinen Stil; aber dieser hängt aufs engste mit dem Inhalt des jeweiligen Werkes zusammen. Die Intuition, der musikalische „Einfall“ - wie er es benannt hat - spielen in seinen Werken eine verhältnismäßig größere Rolle als in denen seiner Zeitgenossen. Er stellt sich dem Hörer unverhüllter, unbekümmerter, aufrichtiger. Vor allem: Er glaubt an den Inhalt seines Werkes, an die Themen, die er erfindet. Er glaubt damit an sich selber, sei er nun, wie er sei, d. h: in diesem Fall- und dies ist bedeutsam -, er glaubt an das, was Einer ist, an den Geist, nicht an das, was Einer vorstellt, an den Stil. Dieser Geist freilich ist Geist der deutschen Musik. Wie Bruckner, wie Reger, ist und bleibt Pfitzner eine im engeren Sinne „deutsche“ Erscheinung. * Noch ein Wort über Pfitzners Alterswerk. Pfitzner selbst scheint, wenn man ihm glauben soll, von den Werken seines „Altersstils“ - wie er es nennt - nicht allzuviel zu halten und wundert sich fast, daß sie von gewissen Seiten so sehr geschätzt werden. Hier soll nicht davon die Rede sein, was diese Werke an sich bedeuten, sondern welche Lehre der greise Pfitzner mit ihnen an uns zu geben hat. Mit der Altersepoche eines Künstlers hat es seine besondere Bewandtnis; die wachsende Unabhängigkeit des Alternden von der Umwelt läßt ihn mehr sich selbst, seinen wahren inneren Bedürfnissen entsprechend leben und wirken, als ihm dies in anderen Lebensabschnitten möglich war. Dem widerspricht keineswegs, daß der Künstler im Alter oftmals wieder auf Anfänge und Ausgangspunkte seiner Jugend zurückkommt. Falsche Richtungen und Anpassungen, die nicht den wahren Anlagen entsprechen, fallen ab. Das Bedeutsame der Alterswerke Pfitzners nun scheint mir vor allem ihre vollendete „Natürlichkeit“ zu sein. Pfitzner ist der Meinung, daß eine Tonfolge, die keinen natürlichen Ablauf hat - „natürlich“ in der logischen Entwicklung des Harmonischen, natürlich im Zusammenwirken von Melodik, Harmonik, Rhythmik, natürlich in Entfaltung, Zu-Ende-Führung der Form -, keine Lebensberechtigung hat. Selbst das Abseitigste muß natürlich sein, muß vom Künstler gleichsam wiederum zur Natur gemacht worden sein, um Kunst, um allgemeingültige Gestalt zu werden. Pfitzner glaubt an die Natürlichkeit, so wie sie alle daran geglaubt haben, die Bach, Mozart, Beethoven, Wagner usw. bis herauf in unsere Zeit. Dieser Glaube als solcher wäre noch vor 50 Jahren kaum der Erwähnung wert gewesen. Heute bringt er denjenigen, der ihn vertritt, in Gegensatz zu einem großen Teil seiner Umgebung. Heute ist nichts weniger selbstverständlich als das Selbstver-ständliche, eben das „Natürliche“. Gerade, weil natürlich sein nicht mehr und nicht weniger bedeutet, als zu sein, wer man ist - was freilich das durchaus nicht Selbstverständliche voraussetzt, daß man etwas ist -, gerade deshalb scheint das Alter, das keine Rücksichten auf allzu anmaßende Forderungen der Umwelt zu nehmen braucht, die Lebensepoche der inneren und äußeren Aufrichtigkeit. Es gehört nichts dazu, zu sein und sich zu geben wie alle anderen: also als Künstler etwa fortschrittlich, klug. Es gehört aber geradezu intellektueller Mut dazu - den Pfitzner zeitlebens im hohen Maße besaß -, um als normal-gescheiter Mensch von heute auch auf Dinge Wert zu legen, die nicht nur mit Klugheit und Fortschrittlichkeit zu tun haben, "ehrlich", "aufrichtig", "liebevoll" zu sein, oder anders ausgedrückt, Echtheit, innere Wahrhaftigkeit höher zu schätzen als äußere Anpassung. FIDELIO 1948 Die Oper "Fidelio" war für ihren Schöpfer eine Schwergeburt. An keinem anderen Werk hat Beethoven so viel geändert, umgearbeitet, gebessert; kein anderes kostete ihn so viel Zeit. Fühlte er das Schicksal des Werkes voraus? Vom ersten Mißerfolg der „Leonore“ - der Erstform der Oper - bis heute hatte „Fidelio“ stets eine gewisse Mühe, sich zu behaupten. Mit scheuem Respekt sah das 19. Jahrhundert auf dies einzige Opernwerk des großen Instrumentalmusikers. Trotz der Dramatik des Vorwurfs fühlte man etwas Theaterfremdes in ihm. „Volle Häuser“ im Sinne anderer erfolgreicher Opernwerke hat „Fidelio“ denn auch nie gemacht; er ist mehr als andere Werke an besondere Aufführungsbedingungen, an eine besondere Einstellung auch von Seiten des Hörers gebunden. Die vielen, die in der Oper Entspannung durch ein mehr oder weniger romantisch-überhöhtes Abbild der wirklichen Welt suchen, kommen bei ihm kaum auf ihre Kosten. Eine reichlich unwahrscheinliche, in gewissen Punkten (z. B. der Beziehung zwischen Marzelline und Fidelio) fast das Peinliche streifende Fabel, Gefühle, die - wenn man etwa von der Figur des Pizzarro absieht - sehr edel sein mögen, aber wenig mit unserer realen Welt zu tun haben, geben dem Ganzen etwas Sentimental-Unwirkliches. Jede Äußerung der Menschen Mozarts, die extremsten Leidenschaftsausbrüche Wagners – alle stammen sie aus einer Welt, die wirklich existiert. Die Gattenliebe Leonorens aber scheint dem Realisten und Psychologen von heute irgendwie abstrakt, theoretisch. Fast fühlt man sich veranlaßt, an das böse Wort Nietzsches über Schiller als „den Moraltrompeter von Säckingen“ zu denken (Schiller und Beethoven schienen Nietzsche bekanntlich höchst verwandt), und es war kaum zu verwundern, daß eine vorwiegend mit Wagner und Puccini großgewordene Generation „FideIio“ fast durchweg gleichgültig, wenn nicht ablehnend gegenüberstand. Wagner selbst meinte einmal, daß das, was der „absolute“ Musiker Beethoven in der Ouvertüre dieses Werkes so kraftvoll zum Ausdruck gebracht habe, in der Oper nur in einer „fast widerwärtigen Abschwächung“ wiederzufinden sei. Aber dies merkwürdige Werk hat auch andere Seiten. Wie man sagen kann, daß in jeder Frau irgendwie ein Stück „Carmen“ steckt, so hat auch die Figur der Leonore auf die Frauen eine rätselhafte Anziehungs-kraft. Es gibt - wie ich oftmals beobachten konnte - kaum eine Frau, die nicht gerade in der Verkör-perung dieser Gestalt als Sängerin ihren höchsten Sehnsuchtstraum erblickte. Als im Gefolge der politischen Ereignisse die Begriffe der Menschenwürde und Freiheit in Deutschland von neuem in ihrem ursprünglichen Sinn vor die Menschen traten, war es dieses Werk, war es die Musik Beetho-vens, die ihnen half und ihnen Trost brachte. Und wenn wirklich ein moderner Musiker erklärte, daß die ergreifende Wirkung der Gefangenenchöre des „Fidelio“ auf heutige Menschen lediglich „stofflicher“ Art sei, so ist das eins jener typischen Fehlurteile solcher, denen Beethoven immer ein Buch mit sieben Siegeln bleiben wird. Es ist wahr: Beethoven hat im „Fidelio“ weder eine zeitge-rechte Oper oder eine „stilvolle“ Tragödie geschrieben, noch hat er die reale Wirklichkeit gestaltet. Er ist kein Opernmusiker und ist und will kein „Dichter“ sein. Aber er ist etwas anderes: er ist Musiker, Seher, Heiliger. Gewiß mag es unmotiviert erscheinen, wenn eine nicht einmal psychologisch fundierte, durchaus der konventionellen Biedermeierwelt des Fideliotextes entstammende Bemerkung des alten Rocco ein Stück Musik wie die des „Quartetts“ im ersten Akt „Fidelios“ auslöst. Wann aber ist jemals eine in Worten nur eben angedeutete Empfindung schlichter, tiefer erlebt worden, wann ist jemals edlere Musik geschrieben worden als dieses Quartett? Nicht die „stoffliche“ Wirkung des Gefangenseins - die in jeder Kinovorstellung sich auswirken mag -, die Musik, die Sehnsucht nach Freiheit, wie Beethoven sie erlebt und ausspricht, ist das, was uns erschüttert, zu Tränen rührt. Dieser „Fidelio“ ist wahrlich weit mehr eine Messe als eine Oper. Die Gefühle, die in ihm angerührt werden, streifen fast durchweg die religiöse Sphäre oder gehören doch einer „Religion der Menschheit“ an, die uns, nach allem, was wir erlebt haben, noch nie so groß, noch nie so nötig erschienen ist wie eben heute. Hier liegt die einzigartige Kraft dieser „Oper“. Die Musikgeschichte mag uns sagen, daß „Fidelio“ das Werk eines „Wiener Klassikers“ ist, daß es der Gattung der damals üblichen „Rettungs-“ resp. "Schreckensopern" angehört. Wir aber wissen, daß das, was in dieser Musik auszusprechen versucht wurde, weit über alle historischen Begriffe und Zielsetzungen hinaus uns alle aufs unmittelbarste angeht und die europäische Menschheit immer wieder zur Selbstbesinnung nötigen und aufrufen wird. SALZBURGER FESTSPIELE 1949 Die Salzburger Festspiele sind nicht Festspiele wie diejenigen in Luzern, Edinburgh, Venedig. Sie sind nicht von einzelnen Männern gemacht, soviel Anteil auch Männer wie Reinhardt und andere haben mögen. Wichtiger ist der Geist, der hinter ihnen steht, der sie weit über den Ehrgeiz des einzelnen hinaus zur Emanation eines bestimmten Kunstgeistes werden läßt. Man sagt sonst wohl, daß von einer bestimmten Landschaft eine bestimmende Wirkung ausgeht. Man spricht von Österreichertum, von Mozart. Das mag alles richtig sein: Aber das Österreichertum, das in eitler Selbstbespiegelung von sich redet, sich als Objekt des "Geschäftes" in die Welt hinaus projiziert, sich seiner allzu bewußt ist, hat sein Bestes verloren. Der Mozart, der als Popanz, als Gewohnheit, als Plakat erscheint, ist nicht mehr der wahre Schutzheilige. Es ist etwas Tieferes als nur Österreichertum, und man muß Mozart in seinem ganzen Wesen erfassen, um dem Werke zu geben, was die Salzburger Festspiele heute noch sind oder sein können. Sie entstehen auf dem Grunde eines bodenwurzelnden, bodenständigen Kunst- und Lebensgefühls. Jene österreichisch-deutsche Kulturatmosphäre, die in ihrer unnachahmlichen Komplexität, ihrer Mischung durch den Namen Mozart treffend gekennzeichnet ist, schafft sich in diesen Festspielen, seiner selbst unbewußt, tatsächlich seinen Ausdruck. Diese Festspiele haben der Welt etwas zu sagen, da sie von Dingen handeln - der Musik -, die tatsächlich nirgendwo in der Welt so mit dem ganzen Leben der Menschen verbunden sind, so ernst genommen, auch so lebendig sind, wie in der Landschaft, auf deren Hintergrund sie entstehen. Athen der Musik. Nicht die italienischen Festspiele wie in Venedig, nicht Vermittlung und Versuch wie in Luzern oder englische, internationale Großschau wie in Edinburgh. Hier wird Beethoven und Mozart, wird "Fidelio" und "Zauberflöte" als nicht nur perfekt Aufzuführendes, sondern als Fleisch von unserm Fleische begriffen. Hier gibt es, über alle notwendige Anpassung hinaus, noch Ursprünglichkeit. Möge die politische Entwicklung Europas es zulassen, daß Salzburg bleiben kann, was es war. ÜBER DAS REISEN 1952 Die Programmfrage bei Reisen mit Orchestern ist so entscheidend und einschneidend, daß man sie gar nicht ernst genug nehmen kann. Zunächst müssen einige praktische Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Es muß gesagt werden, daß die Reisen auch wirtschaftliche Grundlagen haben. Die Unter-nehmer, die das Orchester in den verschiedenen Städten engagieren, sind darauf angewiesen, daß die Konzerte entsprechend besucht werden; das Programm muß also, wie die Manager sagen, eine gewisse "Zugkraft" aufweisen. Mir schien die dafür in Frage kommende Musikliteratur anfangs sehr groß, ja unerschöpflich zu sein; mit der Zeit aber - ich kann es nicht leugnen - wird sie immer kleiner. Es ist nämlich ein Unterschied, ob man ein Stück auf einer Reise zwei- bis dreimal oder zehn- bis zwölfmal zu spielen hat. Je älter ich werde, desto mehr kann ich auf Reisen nur Stücke vertragen, an denen ich selber ungetrübte Freude habe, die ich selber in jeder Beziehung als Meisterwerke empfinden kann. Solche Stücke kann man oft hintereinander aufführen, ohne daran zu ermüden. Alle lediglich interessante oder problematische Musik erscheint in ihrer Wirkung bei öfterern Wiederholen abgeschwächt, z. B. ist das, was einen das erste oder zweite Mal lebhaft interessiert, schon das vierte oder fünfte Mal geradezu unerträglich. Es geht das nicht nur mir, sondern jedem einzelnen Orchestermitglied ebenso. Aber auch das Publikum scheint mir heute gegen die problematische Musik empfindlicher zu sein als vor 20 bis 30 Jahren, wo ich diese Reisen anfing. Gegen alle Versuche, ihm lediglich "interessante" und irgendwie problematische Musik vorzuführen, ist es in steigendem Maße empfindlich geworden. So habe ich ein kürzeres Stück von Boris Blacher - übrigens ein nicht nur geist- reiches, sondern auch architektonisch ausgezeichnet aufgebautes Stück mit natürlicher Wirkung - in einer Reihe von Städten vorgeschlagen und wieder zurücknehmen müssen. Mehr und mehr werden also die Programme solcher Reisen, wenn sie sich wirtschaftlich tragen, immer enger. Daß sich solche Reisen selber tragen, scheint mir selbstverständlich. Ich würde nie eine Reise unter anderen Umständen unternehmen. Das heute in weitem Maße in. Aufnahme gekommene Herumreisen von Orchestern, das in der Hauptsache von den Hörern des Rundfunks, denen diese Orchester an-gehören, oder gar von politischen Propagandastellen subventioniert werden, halte ich für einen Unfug. Es wird auch von selber wieder aufhören; denn das Publikum wird bald merken; daß die damit verbunden erwartete Sensation nicht gar so groß ist. In der Zeit des internationalen standardisierten Orchesterbetriebes wird es bemerken, daß die Unterschiede von den verschiedenen Orchestern relativ gering sind, so wie etwa zwischen verschiedenen Klaviermarken. Man hat meines Wissens noch nichts unternommen, die Klaviermar- ken im gleichen Stil in die Publikum propaganda einzube-ziehen. Was mehr auf das Publikum wirkt als das Orchester, ist der Name des Dirigenten. Aber auch dieser unterliegt der allgemeinen Tendenz zur Standardisierung - wir haben heute standardisierte Dirigenten, standardisierte Orchester, eine standardisierte Presse und schließlich bald auch noch ein standardi-siertes Publikum. Ich erwähne hiermit die eigentlichen Gefahren unserer Zeit, die mit der Kommer-zialisierung und Mechanisierung unserer Musikverhäl tnisse zusammenhängen – das Überhand-nehmen der Routine. Es ist durchaus verständlich, wenn junge Künstler, die noch an die Musik und ihre Zukunft glauben wollen, solche Reisen mit solchen Programmen, wie wir sie gegenwärtig durchführen, für eine rein virtuose Angelegenheit erklären, ohne jede tiefere Bedeutung. Der Grund, warum ich diese Reisen trotzdem weiter durchführe und warum ich glaube, daß sie in ihrer Art einen produktiven Sinn für uns Musiker haben, ist der: Ich halte, wie ich schon vorher sagte, keine Gefahr für das Musizieren von heute für größer, als die der Routine. Meine Aufgabe sehe ich darin, die von mir musizierten Werke so unmittelbar darzustellen, als ob ich ihnen selber zum erstenmal begegnete. Ich versuche nach Kräften die Spuren der Tatsache, daß diese Werke vielfach weltbekannt sind, zu verwischen, versuche, allem, was nach Gewohnheit aussieht, aus dem Wege zu gehen. Und wenn ich von der Stunde unterstützt werde, habe ich die Genugtuung, daß die Musik unter meinen Händen zu dem wird, was sie eigentlich sein soll und muß, zu einem wahrhaftigen Gemeinschaftserlebnis. CAOS UND GESTALT oder DER MUSIKER UND SEIN PUBLIKUM 1954 Charakteristisch für das Musikleben von heute ist das ungeheure Anwachsen von Theorien und ein entsprechendes Zurücktreten des eigentlichen Musizierens. Es ist schon fast so: Ohne durch irgendeine von der Zeit akzeptierte Ideologie, ohne durch ein Programm, das ihn als zeitgemäß ausweist, gleichsam gerechtfertigt zu sein, wagt bald kein Musiker mehr, eine Note zu schreiben. Das braucht noch nicht unbedingt ein Nachteil zu sein. Auch in natürlich-produktiven Zeiten verband so etwas wie eine gemeinsame Weltanschauung Schaffende und Hörer. Heute hat sich indessen das Schwergewicht verschoben; es scheint, als ob die Musik nur mehr als eine Art Illustration für den dazugehörigen weltanschaulichen Überbau gewertet wird, in diesem aber die eigentliche Leistung gesehen wird. Wieweit die Musik selber der Ideologie, von der sie getragen wird, nun wirklich entspricht - diese entscheidendste Frage wird meines Wissens kaum gestellt. Nicht die Musik, sondern ihre Richtung wird diskutiert. So kommt es, daß es heute zweierlei Musiken gibt: Eine, die in den Zeitungen diskutiert wird, und eine, die musiziert wird. Um mich verständlich zu machen,.ein Beispiel: Arthur Schnabel war nicht nur ein hervorragender Pianist, sondern auch ein bedeutender, überlegener Musiker. Er war ein leidenschaftlicher Interpret der großen Meister Mozart, Beethoven, Schubert usw. Das Repertoire, das er in der Öffentlichkeit vortrug, war aber mit Brahms zu Ende; kaum je spielte er etwas, das über Brahms hinausging, und man konnte glauben, daß er zu den vollkommen auf die Vergangenheit eingestellten Künstlern gehörte, die der modernen Welt fremd gegenüberstehen. Dieser selbe Mann war aber auch noch Komponist. Und hier war er, sobald er sich selbst gefunden hatte, durchaus fortschrittlich-radikal und gab einem Schönberg an "Atonalität" nichts nach. Nicht als ob er von der Öffentlichkeit als Komponist so gewertet worden wäre wie als Pianist. Dennoch komponierte er unentwegt, überzeugt und selbstbewusst weiter; und es muß gesagt werden, daß er auch hier sich selbst, dem Niveau seiner Persönlichkeit treu blieb. Wie man zu seinen Werken auch stehe - Werke eines Dilettanten waren sie nicht. Wie ist das nun zu vereinigen? Derselbe als Reproduktiver ein leidenschaftlicher Verfechter klassischer Musik, dann als Komponist ein radikaler Neutöner? Von mir einmal nach diesem so offenbaren Widerspruch in seiner Tätigkeit befragt, meinte er: "Ich komponiere wie Mozart." Auf mein erstauntes Gesicht fügte er sofort hinzu: "Natürlich mit weniger Talent. Ich meine aber, daß sich der kompositorische Schaffensprozeß als solcher bei mir in ähnlicher Weise vollzieht, wie er sich bei Mozart vollzogen haben mag, nämlich: Flüssig, selbstverständlich, leicht, ohne jegliche Belastung mit Reflexion. " Ist diese Antwort nicht selbst schon eine "Reflexion"? Könnte man sich denken, daß ein wirklicher Komponist sich mit einem Hinweis darauf zu rechtfertigen versucht, daß er selber seinen Schaffensprozeß als "natürlich und flüssig" empfindet? Muß er ihn überhaupt rechtfertigen? Muß nicht dies das Werk tun? Hat nicht bei einem Werk, das sich an eine Gemeinschaft wendet, auch diese Gemeinschaft ein Wort mitzureden? Oder wendet sich beim modernen Komponisten das Werk nicht mehr an eine Gemeinschaft? Wenn wir näher zusehen, fällt uns ein Umstand auf. Schnabel, der Pianist und Interpret, hat niemals eines seiner Werke selbst gespielt. Er schrieb unter anderm große Klaviersonaten, ließ sie aber durch andere spielen. Für den Komponisten Schnabel setzte er sich nicht ein; dies mußten andere tun. Man mochte zuerst vielleicht an eine übertriebene Sensibilität, an eine Scheu, sich vorzudrängen, denken. Das war es aber nicht. Er machte vielmehr einen Unterschied zwischen Interpret und Schaffendem, auch bei sich selber. So erzählte er mir einmal: In der Pause eines Klavierabends, den er in irgendeiner kleineren amerikanischen Stadt gab, kam ein Amerikaner ins Künstlerzimmer gestürzt mit dem Ausruf: "Entweder lügen Sie heute, oder Sie haben vor 14 Tagen gelogen, wo wir Ihre Kompositionen anhören mußten." - Auf meine Frage, was er darauf geantwortet hätte, erwiderte er mit einem Lächeln: "Vielleicht lüge ich beide Male." Dies ist natürlich nur eine Antwort ad personam, um sich des lästigen Fragers zu entledigen. Dennoch, wenn einer die Wahrheit spricht - und wer sollte es, wenn nicht der Produktive-, so wird er auch dafür einstehen müssen und wollen. Man verstehe mich recht: Schnabel war subjektiv alles andere als unaufrichtig. Im Gegenteil, wir müssen ihm dankbar sein, daß er so sehr den Mut zu sich selber hatte, daß er den für jedermann in die Augen springenden klaffenden Widerspruch zwischen Darstellendem und Schaffendem in sich nicht verschämt verbarg, sondern vor aller Öffentlichkeit eingestand, das heißt, daß er war, wie er war. Es wird hier am Fall eines einzelnen, aber in besonders krasser Weise ein Problem sichtbar, das mir ein Problem unserer Zeit überhaupt zu sein scheint. Gerade durch die unbezweifelbare Wahrhaftigkeit seines Verhaltens veranlaßt uns dieser Künstler zum Nachdenken. Zum Nachdenken: Zunächst in Bezug auf den Komponisten. Hier ist es charakteristisch, daß ihm die "Natürlichkeit" des Schaffensprozesses als Rechtfertigung genügt, daß er auf eine weitere Zustimmung, auf einen eigentlichen Erfolg seines Komponierens verzichtet. Gibt es nicht zahllose Komponisten heute, die es ebenso machen? Die unverdrossen weiterkomponieren, gleichgültig, was die Hörer, was das Publikum, für das sie schreiben, sagen, und die trotzdem, weil sie "leicht und flüssig schreiben wie Mozart", des Glaubens sind, produktiv zu sein? Und die Welt - natürlich nicht das naive Publikum, wohl aber ein Teil der interessierten Fachwelt - ist bei dem erschreckenden Mangel an objektiven Maßstäben gar noch geneigt, ihnen das abzunehmen und in jedem, der viel und hemmungslos komponiert, einen Mozart oder Schubert zu mutmaßen. Die meisten von ihnen sind nur nicht obendrein Interpreten vom Rang eines Schnabel, so daß der innere Widerspruch, der hier besteht, nicht zutage tritt. Wir fragen nun: Warum machte dieser unzweifelhaft bedeutende und kluge Künstler einen Unterschied zwischen dem Schaffenden und dem Darstellenden bei sich selber, warum trat der Interpret nicht ohne weiteres für den Komponisten ein, wie es natürlich gewesen wäre und wie es bisher auch immer gewesen war? Es mußte das doch wohl an der Artung des Komponisten liegen. Denn als Interpret, als Pianist musiziert er wie andere auch - das heißt, er stellt sich in Reih und Glied mitten hinein in den Strom des lebendigen Austausches zwischen Hörer und Künstler. Er musiziert - wenn auch mit der Musik anderer - für eine Gemeinschaft, unterstellt sich dieser Gemeinschaft. Als Komponist indessen sitzt er im elfenbeinernen Turm, gibt er seinem Hange - dem Hange so vieler moderner Menschen - nach Übung und Betätigung der überwachen Nerven, des geschulten Verstandes nach. Auch das macht Freude - warum nicht -, und wenn die anderen es ernst nehmen: um so besser. Aber gerade weil er ein systematischer und bewußter Interpret war, nahm er seine eigenen Werke nicht in sein Repertoire auf, genauso wie er andere zeitgenössische Werke nicht aufnahm. Der Interpret fühlte, daß vor dem wirklichen Publikum, wie er es als Interpret kannte, andere Maßstäbe gelten, denen der Komponist nicht entsprach. Wieso aber komponierte er dann überhaupt? Nun, das ist eben das Problem. Warum komponieren sie alle, die heute, so wie Schnabel, ohne sich an ein natürlich-unmittelbar mit ihnen verbundenes Publikum zu wenden, komponieren? Wenn Schnabel sich als Komponist an ein solches gewandt hätte, hätte er sicher niemals Abstand genommen, seine eigenen Werke auch selber zu spielen. Vom Künstler aus gesehen ist das Werk Zeichen der Verbundenheit in lebendiger Gemeinschaft zwischen ihm und seinen Hörern. Die Gewißheit, niemals eine Antwort vom wirklichen Hörer zu bekommen, für den man schreibt, untergräbt allmählich den Willen und damit schließlich sogar die Fähigkeit zum Schaffen. Ohne eine tragende Gemeinschaft, die dahintersteht, ist das musikalische Kunstwerk - im eigentlichen Sinne ein Gemeinschaftswerk - nicht lebensfähig. Wenn es heute Komponisten gibt - und es gibt, wie ich schon sagte, deren viele, der Fall Schnabel ist nicht vereinzelt -, die ohne Bedürfnis nach lebendigen Hörern ruhig weiter komponieren (für die Zukunft, wie sie sagen und glauben), so muß sich entweder unser Begriff von Musik und Musiker oder der Hörer, das Publikum gewandelt haben. Darüber, daß sich die Beziehung zwischen Musiker und Publikum im 20. Jahrhundert, etwa seit Beginn der atonalen Periode, geändert hat, ist jedenfalls nicht zu streiten. Dies wird nicht nur vom "großen" Publikum, sondern ebenso von den unmittelbar Betroffenen, den Musikern selber zugegeben. Fragen wir zunächst: Was und wer ist eigentlich dieses Publikum? In dem Sinne, wie die Frage hier gemeint ist, ist Publikum vor allem ein Teil des "Du", des großen Gegenüber, an das sich der Künstler mit seinem Schaffen wendet. Es ist gleichgültig, ob dies Publikum etwa ein bürgerliches oder ein Arbeiterpublikum ist. Ebenso, ob es dieser oder jener Nation angehört. Selbst ein uns blutmäßig so fremdes Volk wie die Japaner zeigt sich heute der europäischen Musik gegenüber aufgeschlossen. Was nicht gleichgültig ist: Daß es ein Publikum ist und nicht eine Menge einzelner. Es müssen vor allem Menschen sein, die als Gemeinschaft fühlen und als Gemeinschaft reagieren. Es ist dies ein Unterschied; es ist oft von Fachleuten mit Erstaunen festgestellt worden, wie falsch, ja wie dumm die bewußten Äußerungen und Meinungen des einzelnen sein können und wie verflucht konsequent, ja geradezu gescheit sich dasselbe Publikum im ganzen verhält. Daß das "große" Publikum für ein Musikleben die "wirtschaftliche" Grundlage gibt, liegt auf der Hand. Weniger machen wir uns klar, was es für die Künstler bedeutet. Für diese vertritt es gleichsam den "imaginären Hörer", an den sich der Künstler mit seiner Botschaft wendet. Für die Komponisten, etwa seit Bach, war dieses Publikum so etwas wie die "letzte Instanz"; sie sahen es schlechthin als richtunggebend, als maß- und normgebend an. Es war der Partner, das Gegenüber, an das sie sich wandten. Wenn Fachleute und Ästhetiker heute von "Kunstgesetzen" sprechen, die sie aus den Werken von Bach, Beethoven, Schubert, Brahms, Wagner usw. ausziehen, so sind alle diese Gesetze nicht ohne dies "Publikum" zu denken. Es sind Anweisungen, die die Komponisten für ihre imaginären Hörer treffen, und die davon handeln: Wie mache ich es, zu jenen in so unmißverständlicher Klarheit zu sprechen, daß sie mich wirklich und vollständig verstehen? Man kann daher zugleich sagen, daß dieses Publikum, wie es auch in Wirklichkeit sei, zu einem guten Teil von den Meistern mitgeschaffen wird. Es ist bekannt, daß Beethoven an dem realen Publikum, das ihm in Wien bei seinen Konzerten begegnete, stets viel auszusetzen hatte. Und doch war er derjenige, der durch seine Werke, besonders seine Sinfonien, das ganze öffentliche Konzertleben des 19. Jahrhunderts in entscheidendem Sinne beeinflußt, ja mitgeschaffen hat. Sicher ist nun, daß das unausgesprochene Vertrauensverhältnis, das trotz aller Kämpfe, aller Meinungsverschiedenheiten im tieferen Grunde während des 19. Jahrhunderts noch immer zwischen Publikum und Künstler geherrscht hat, heute ins Wanken geraten ist. Von jenem sich mit dem Publikum zu einer "idealen Gemeinschaft verbunden-Fühlen", sich ihm vertrauensvoll unterstellen, wie noch Wagner, ja auch noch Strauß es taten, ist heute wenig übriggeblieben. Der moderne Musiker tritt seinen Hörern von vornherein mit Anforderungen gegenüber. Er unterstellt sich ihnen nicht, sondern verlangt, daß dieses Publikum sich seinem Diktat unterwerfe. Er steht nicht mehr in der Gemeinschaft, sondern über ihr. So verhehlt er auch keineswegs, was er von dem Publikum hält - nämlich sehr wenig. Die allgemeinideal-umfassende Beziehung hat sich zu einem Zweckverhältnis umgewandelt. Er sucht es (da er es zumindest wirtschaftlich braucht) zu beeinflussen, aber im Sinne einer Bevormundung, ja Terrorisierung. Eine Flut von Propaganda - mit allen den Mitteln in Szene gesetzt, die heute zur Verfügung stehen - geht zugunsten des modernen Musikers auf das Publikum herab. Liegt diesem ganzen Geschehen nicht zumindest eine erstaunliche Anspruchslosigkeit des modernen Komponisten zugrunde? Hält er es wirklich für einen Erfolg, wenn die Propaganda funktioniert, indem sie das Publikum mundtot macht? Hält er es wirklich für wichtiger, was in den Zeitungen steht, als was in den Herzen der Menschen vor sich geht? Hat der Glaube an eine zielbewußte Propaganda überhaupt noch etwas mit Kunst zu tun? Im tiefsten Grunde, das heißt, auf die Dauer erweist sich dies Etwas: "Publikum" nämlich als geradezu unbeeinflußbar. Wohl wird es leicht kopfscheu gemacht, wohl kann man ihm sein Selbstbewußtsein nehmen; es zieht sich dann schweigend in sich selbst zurück. Es aber zu veranlassen, Dinge schön zu finden, die ihm nicht gemäß sind, ist auf die Dauer unmöglich, da es instinktiv, zwangsläufig, nach ihm selber unbewußten, aber in ihm liegenden Gesetzen urteilt. Gerade was der Künstler wünschen muß, nämlich eine erhoffte "Liebesgemeinschaft" zwischen ihm und diesem seinem Publikum, läßt sich eben nicht mit Gewalt, mit Bevormundung, mit Theorien, welcher Art sie immer seien, herstellen. Die Distanz zwischen dem avantgardistischen Musiker von heute und dem eigentlichen "großen" Publikum ist im Lauf der letzten Jahrzehnte keineswegs geringer geworden. Die wenigen Ausnahmen, die es gibt, bestätigen hier nur die Regel. Es ist kein Zufall, daß seit Beginn der atonalen Periode eine eigentliche Repertoireoper, wie es zum Beispiel noch der "Rosenkavalier" war, nicht mehr geschrieben wurde. Wenn wir diejenigen, die das ganze Geschehen betrachtend begleiten, nämlich die Musikhistoriker, darüber befragen, so erhalten wir keine Auskunft. Gewiß ist wirklich erkennende und wertende Einsicht meistens die Sache späterer Zeiten, zumal die zeitgenössische Musikgeschichte im allgemeinen immer in Gefahr ist, sich den Schlagworten des Tages nur allzu leicht anzupassen. Gehört doch die schnell-fertige "historische Betrachtungsweise" allmählich zu einem Hauptmittel der heutigen ideologischen Propaganda. Sie ist sofort bereit, über alle möglichen Unterschiede hinweg etwa Bartok und Hindemith zu "Klassikern der Moderne" zu stempeln und ihnen für unsere Zeit dieselbe Bedeutung zuzumessen wie Mozart und Beethoven für die ihre. Es wird wohl noch geraume Zeit dauern, bis die wirkliche Geschichte der Musik des letzten halben Jahrhunderts wird geschrieben werden können. Der Aufbruch der Atonalität, des Sichfreimachens von der plötzlich als Fessel empfundenen Tonalität, datiert etwa seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Das erste Signal gab Arnold Schönberg mit seiner damals durchaus neuen, höchst kühnen und konsequenten Erfindung der 12-Tönekomposition. Hier handelte es sich nicht, wie es zunächst den Anschein hatte, und wie viele - auch moderne - Musiker selbst glaubten, um eine Weiterentwicklung schon vorhandener Ansätze, sondern um etwas spezifisch Neues, was in die musikalische Welt einfloß. Dies Neue – die Auflösung von Konsonanz und Dissonanz und die konsequenterweise daraus notwendig werdende Neuordnung des Tonmaterials veränderte den musikalischen Schaffensprozeß. Dieser Prozeß, der bisher vom Gefühl unter Hinzuziehung des Verstandes getragen war - wobei das Gefühl unbedingt den Vorrang hatte -, erhält nun auf einmal darüber hinaus noch eine spekulative Note, die vor allem auf Vermeidung der bis dahin natürlichen tonalen Bindungen ausgerichtet war. Änderte sich damit auf der einen Seite die Ausdrucks- Komponente der Musik, und wurde damit zugleich der Hörer vor eine neue, völlig ungewohnte Aufgabe gestellt, so war doch anderseits eine Arbeitsmethode gewonnen, die dem Komponisten den Anschein einer neuen Freiheit, das plötzliche Gefühl der Unabhängigkeit vom "Terror" der Tonalität gab. Dies wirkte auf ihn geradezu rauschähnlich, und man kann es verstehen, daß Rücksichten auf die Aufnahmefähigkeit des Publikums einfach als unstatthafte Hindernisse betrachtet wurden, zumal man in der musikgeschichtlich unterbauten Ideologie ein wunderbares Mittel der Propaganda besaß. Vor allem aber, und dies war wohl die Hauptsache: Das Komponieren wurde - ich erinnere an Schnabel - wieder leicht wie zur Zeit Mozarts. Kein Wunder, daß die ganze Bewegung mit ungeheurer Schnelligkeit um sich griff; schon die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sehen wir mit den Anfängen Hindemiths und Kreneks die atonale Richtung auf ihrem ersten Höhepunkt. Die weitaus größte Revolution in der Musikgeschichte - hier trat tatsächlich, wie gesagt, etwas prinzipiell Neues auf den Plan - spielte sich im Zeitraum von kaum zehn Jahren ab. Es ist charakteristisch, daß die ganze Tragweite dieser Revolution nur von dem ermessen werden konnte, der die Zeitungen las. Es war eine Revolution der Öffentlichkeit. Und so änderte sich denn auch vor allem die Haltung der Öffentlichkeit gegenüber dem zeitgenössischen Komponisten. In früheren produktiven Zeiten hatte es dieser Komponist nicht leicht. Er hatte durchaus jenen "Kampf ums Dasein" mitzumachen, der in der ganzen Natur seit jeher herrschte und in dem sich nur der Stärkste bewährt und durchsetzt. Das Publikum, an sich immer dieselbe träge, schwer bewegliche Masse, war mit dem, was es kannte und liebte, beschäftigt und allem Neuen zunächst stets abgeneigt. Aber nicht nur das, auch die Fachleute, die Presse - die damals offenbar in weit höherem Maße als heute Kontakt mit dem Publikum hielt, die Stimme des Publikums wiedergab - verhielten sich ablehnend, ja vielfach noch viel ablehnender als das Publikum selber (wie die erste Aufnahme vieler der später als Meisterstücke erkannten Werke beweist). Wenn sich aber ein Werk, ein Mann dann doch durchsetzte, so war es dies Werk, dieser Mann selber. Und was ihn durchsetzte, war nicht Propaganda, sondern die Erkenntnis des Publikums, welches er, dessen sprichwörtlicher Trägheit zum Trotz, eben überzeugt hatte, mit dessen Hilfe er auf seine Weise eine neue "Gemeinschaft" gebildet hatte. An und für sich hatte ein junger Komponist damals keinerlei Kredit in der Öffentlichkeit. Man fühlte keinerlei soziales Verpflichtungs gefühl ihm gegenüber. Gefiel er nicht, das heißt, fiel sein Werk durch, so konnte er sich durchaus als auf den Misthaufen geworfen betrachten. Wie anders heute. Schon prinzipiell wird der junge Komponist in der Öffentlichkeit als "Garant" der Zukunft gehätschelt und getätschelt, ja auf Händen getragen. Freilich unter einer Voraussetzung: Daß er der Ideologie der Zeit Genüge tut, daß sein Werk als fortschrittlich anzusprechen ist, daß es "in die Zukunft weist". Aus der geistigen Bewußtseinslage der Gegenwart heraus wird er dann zu denen gerechnet, die uns weiterführen. Da es heute sehr viele von dieser Art von Komponisten gibt, so kommt dazu von seiten der breiteren Öffentlichkeit auch noch eine Art soziales Verantwortungsgefühl. Man muß der Jugend doch die Möglichkeit zu leben und zu arbeiten geben - in ihr liegt unsere Zukunft, und schon deshalb müssen wir ihr ihren schweren Weg so sehr erleichtern, wie es nur möglich ist. Es handelt sich also - gerade in der Öffentlichkeit - keineswegs um ein Parteinehmen im Interesse unserer künstlerischen Zukunft im allgemeinen, der Zukunft des "modernen Menschen" überhaupt. Nein, sondern um die Ermöglichung des Komponierenkönnens, um die Interessen einer bestimmten Gruppe von Komponisten, um eine Arbeitshypothese, eine Arbeitsmethode für Musiker. Das Publikum kommt da erst in zweiter Linie; der "moderne Mensch" im ganzen aber hat zu begreifen, daß die Musik nicht dazu da ist, um etwa seine "Seele" anzusprechen. Das war ein romantisches Vorurteil von ehemals. Wahrhaftig, welch Unterschied der Situation für den beginnenden Musiker einst und ehedem! Von dem Schicksal derer, die nicht das Glück haben, von der Öffentlichkeit als Garanten der Zukunft betrachtet zu werden, sondern die sich nur daran genügen lassen, eben Musik vielleicht recht gute Musik - zu schreiben, will ich schweigen. Sie sind heute, sie mögen sein, wie sie wollen, töter als tot; es scheint nicht notwendig, auch nur ein Wort über sie zu verlieren. Aber die anderen, die als Bestätigung der herrschenden Weltanschauung gefördert werden? Wenn wir ihre Lage nüchtern betrachten, scheint es, daß diese Förderung sich leider durchaus anders auswirkt, als diejenigen glauben mochten, die mit gutem Willen und innerer Überzeugung an diesen Zuständen teilhaben und sie aufrechterhalten. Dadurch, daß der Komponist nicht mehr sozusagen durch das Werk sich immer von neuem vor dem Publikum auszuweisen hat, dadurch, daß es genügt, einer bestimmten Richtung anzugehören, um ernst genommen zu werden, um aufgeführt zu werden, wird für die davon betroffenen Komponisten eine verweichlichende, falsche, eine"Treibhausatmosphäre" geschaffen, die, wie sich zeigt, auf die Dauer der Entwicklung ihrer Produktion keineswegs zuträglich ist. Wie man von den Hasen sagt, daß, wenn sie in Reservaten leben, wo ihre Feinde, der Adler, der Fuchs usw. weggeschossen sind, sie ihre Wachsamkeit und Elastizität im Lebenskampf mehr und mehr einbüßen und degenerieren, so ist es mit den Künstlern. Auch hier sehen wir auf der ganzen Linie, daß unter dem Einfluß der Einstellung der modernen Öffentlichkeit mit allen ihren Schutzmaßnahmen zugunsten der armen Komponisten deren Leistungen vor dem Publikum nicht besser, sondern schlechter werden. Die Gruppe sorgt für den einzelnen; es wird wichtiger für ihn, seine Zugehörigkeit zur Gruppe unter Beweis zu stellen und damit der Moral der Öffentlichkeit zu genügen, als sich vor dem Publikum auszuweisen, einem Publikum, das er ja selber nur unter größtem Vorbehalt überhaupt als seiner würdig "anerkennt". Wenn wir freilich die bisherige Geschichte betrachten, sieht es anders aus. Da waren es immer die einzelnen, die sich den Menschen gestellt, sie überwunden haben. Mozart, Beethoven, Schubert, Wagner gehörten keiner "Richtung" an. Heute sucht der einzelne den Schutz der Gruppe. Nicht ohne einen gewissen Stolz hat einmal Thomas Mann festgestellt, daß er niemals irgendeiner Clique angehörte, einer festgelegten künstlerischen "Weltanschauung" gehuldigt habe. Er legte Wert auf diese "splendid Isolation", und das mit Recht. Jedenfalls sind die Künstler, die mit ihren Werken wirklich noch unter uns leben, und soweit sie noch unter uns leben, alle solche Einzelgänger gewesen. Man kann nun gewiß allerlei Gründe für die Herrschaft solcher Gruppen, die sich allmählich herausgebildet haben, anführen. Zum Beispiel die mit allen modernen Mitteln arbeitende vorzüglich funktionierende Organisation, hinter der das Geld großer Verleger steckt, die ihre Werke absetzen wollen, und die es für nötig hält, nicht nur die wirklichen Musiker anderer Art, die heute noch tätig sind, sondern neuerdings sogar auch die große Vergangenheit, von der das Musikleben praktisch lebt und die als Konkurrenz empfunden wird, mehr oder weniger zu bagatellisieren und zu nivellieren. Ist die innere Entmachtung und Entwertung des modernen Menschen schon so weit vorgeschritten? Gibt es das Publikum, das die europäische Musik der letzten großen Jahrhunderte getragen hat, nicht mehr? Eines ist sicher: Wenn das Publikum im idealen Sinne vom Künstler nicht mehr als das Gericht Gottes, die Stimme der Natur, das Urteil der Menschheit empfunden wird, wenn es nicht mehr der gottgegebene Partner ist, wenn eine Liebesgemeinschaft zwischen Künstler und Publikum sich nicht mehr als möglich erweist, dann ist es vorbei mit dem, was bisher Kunst genannt wurde, vorbei mit jedem echten Schaffen. Es war für mich immer wahrscheinlich, daß hinter diesem ganzen merkwürdigen Geschehen ein höherer Zwang, eine Macht stehen müsse, daß dies Geschehen nur Zeichen und Ausdruck für etwas Dahinterliegendes sei, nicht aus sich selbst erklärt werden könne. Ich muß hier etwas weiter ausholen. Diejenigen, die eine Nacht im afrikanischen Urwald, etwa im Kongo mitgemacht haben, wissen zu berichten von dem ungeheuren Eindruck, den die gleichsam losgelassene Natur auf das menschliche Gemüt macht. Es ist, als ob alle Schleusen der Hölle aufgetan sind, wie ein Brüllen von tausend Stimmen, die alle lebendig sind und uns die furchtbare Urkraft der Schöpfung vor Augen führen. Es ist das Chaos, dem sich hier unmittelbar der moderne Mensch gegenübergestellt fühlt, und dessen Erlebnis für ihn - um es nüchtern auszudrücken - eine eigentümliche "Sensation" bedeutet. Einen andersartigen, aber dem inneren Wesen nach ähnlichen Eindruck soll man haben, wenn man wiederum im afrikanischen Urwald - die Sprache der zahllosen Negertrommeln vernimmt, die aus allen Richtungen, aus allen Entfernungen in ostinaten Rhythmen, ohne aufzuhören, die Nacht zum aufregendsten Erlebnis des Europäers machen können. Auch hier wird - nicht durch die Gewalt des Klanges, sondern durch seine rhythmische Unerbittlichkeit und Unaufhörlichkeit - eine akustisch vollkommen elementare Wirkung erzielt, die mit nichts anderem vergleichbar sein soll. Nun, es scheint, als ob dies Chaos, hier akustisch gleichsam im "Rohzustand" aufgerufen, auch für die Musik als Kunst des heutigen Europäers eine Rolle spielt. Ich erinnere nochmals an den Fall des Pianisten Schnabel, der einerseits der Tradition der großen Vergangenheit - als Pianist -, andererseits dem unmittelbar Irrationalen - als Komponist - sich verhaftet fühlte. Wäre, so ist weiter zu folgern, der Einbruch verstandesmäßiger Spekulation, wie er zu Beginn des 20. Jahrhunderts statthatte und an Stelle der früheren tonalen Ordnung das gehörte Chaos setzte, wirklich nur ein reiner Fremdkörper gewesen, so wäre die Kraft, beziehungsweise das Gift, das damals in die bis dahin intakte Musik eingeflossen, in den seitdem vergangenen 30 Jahren längst aufgesogen worden. Die Bewegung wäre heute zu Ende. Dies ist aber nicht der Fall. Die, heutige Menschheit - jedenfalls ein Teil von ihr - muß eine Affinität zum "Chaos" besitzen, die früher nicht vorhanden war. Dies - und nichts anderes - ist das wirklich Neue an der modernen Kunst. Wir fragen nun weiter: Was ist dafür der Grund? Warum hat dies Chaos für die Menschen früher nicht dieselbe Rolle gespielt wie offenbar heute? Haben die Menschen sich in letzter Zeit entscheidend verändert? Haben die zwei Weltkriege, durch die wir hindurchgegangen sind, damit zu tun? Wie es auch sei: Hier ist der Punkt, über den uns die Klarheit nüchtern-wirklicher Selbsterkenntnis nottut. Ich wiederhole noch einmal: Angesichts der modernen Musik muß angenommen werden, daß viele der heutigen Menschen eine nähere Beziehung zum Irrationalen in sich selber tragen als der Mensch der Vergangenheit, etwa der Mensch vor 1900. Es gehört geradezu zum Selbstbewußtsein, zum Lebensgefühl des Menschen von heute, daß seine Kunst die Beziehung zum Chaos nicht nur nicht verloren hat, sondern immer und in jedem Moment von neuem dokumentiert, daß sie vor allem nicht dem, was wir heute als das diesem Chaos zumeist Entgegengesetzte empfinden, der Ratio, dem Rechenhaften verfallen ist. Ist es doch die Ratio, wie sie im System der Tonalität verborgen liegt, die bekämpft wird, die man scheut, die man flieht, auch auf die Gefahr hin, daß damit andere an sich schätzbare Eigenschaften der Tonalität (wie zum Beispiel ihre Fähigkeit, Architektur zu bilden) mit über Bord geworfen werden müssen. Die Furcht vor der Ratio und dasVerfallensein an das Chaos hängen zusammen, ja, sind zutiefst dasselbe. Wieso kommt es, daß dies gerade im Menschen von heute so hervortritt? Die Musikgeschichte gibt uns, wie schon gesagt, darüber keinen Aufschluß. Ja, sie scheint sogar zum großen Teil Tatsachen, die gerade der geschichtlichen Betrachtung unterstellt sein sollten, bisher kaum bemerkt zu haben: Nämlich, daß sich in der Musik seit einem Menschenalter, also seit dem Ende des Ersten Weltkrieges, nichts mehr eigentlich entwickelt hat. Damals geschah der erste große Aufbruch des Atonalismus; die Theorien Schönbergs, das Schaffen von Bartok, die fortschrittlichsten Werke Strawinskys, Hindemiths usw. waren geschrieben. Weiter als damals ist die neue Freiheit in der Folge nicht mehr vorgetragen worden. Wohl hat man versucht, diese Freiheit in Systeme zu bringen; hier ging Schönberg mit seiner 12-Ton-Komposition voran, es folgten noch andere Systeme. Nicht als ob es inzwischen nicht auch bedeutende individuelle Versuche, die Situation zu meistern, zum Teil auch das Alte und das Neue zu verbinden, gegeben hätte. Das ändert alles an der Gesamtlage nichts. Die Entwicklung geht nicht mehr vorwärts; diese Entwicklung hatte sich - so wie die Menschen sich selbst und ihre Kunst heute sehen- mehr und mehr auf die "Materie" konzentriert. Was sich da zuletzt entwickelte, was fortschritt, war nicht der Mensch, der sie anwandte, sondern die Harmonik selber, die Rhythmik selber, das heißt die Methodik des musikalischen Stoffes. Mit der Seele des Menschen, der dieser Stoff zum Ausdruck dienen soll, hat das wenig mehr zu tun. So stellten etwa die Historiker haargenau fest, bis zu welchem Jahr die tonale Harmonik noch funktional angewendet werden "durfte", von wann an das nicht mehr möglich war. Je mehr diese ganze Entwicklung ersichtlich einem Ende zustrebt, desto mehr klammert sich das Denken an eine fixe Idee: Fortschritt, Fortschritt um jeden Preis, was um so sonderbarer ist, weil man sich doch sagen mußte, daß jeder Fortschritt, gerade wenn er und eben weil er auf die Materie konzentriert ist, einmal ein Ende haben muß. Und trotzdem: Der latente Kampf zwischen atonaler und tonaler Musik, zwischen neuer Musik und der europäischen Musik der vergangenen Jahrhunderte hat bis heute nichts von seiner Heftigkeit und Schärfe eingebüßt. Die Kampfmittel wechseln, die Fronten stehen sich unverändert gegenüber. Es ist trotz ungeheuren Aufwandes von Propaganda - nicht gelungen, der neuen Musik ein größeres, zuverlässigeres Publikum zu verschaffen, sie hat aber anderseits auch von dem ihr eigentümlichen moralisch-sozial-ethischen Gewicht nichts Wesentliches eingebüßt. Hier muß, so müssen wir uns sagen, ein tieferer Grund vorliegen, der diese kritische, für alle Beteiligten auf die Länge unhaltbare Situation immer weiter andauern läßt. Ist es nicht vielleicht doch so, daß sie zwangsläufig ist? Daß es sich um eine notwendige Folge der Entwicklung des modernen Lebens handelt, die je nach Einstellung von den einen im positiven Sinn, von den andern im negativen kommentiert wird? Ich glaube folgendes: Der Verstand der heutigen Menschheit, soweit er auf die technische Bewältigung der äußeren Welt gerichtet war, hat sich konsequenter und stärker entwickelt als je in einer vergangenen Zeit der Menschheitsgeschichte. Die Überwindung und Unterjochung der Welt durch die planende Ratio, den technischen Kalkül, ist heute in hohem Maße Tatsache geworden. Dies hat aber Rückwirkungen auf uns selber zur Folge. Es ist nicht möglich, einen Teil der Welt, der bisher im Dunkel lag, dem hellen Bewußtsein, wie es heute geschieht, neu zu erschließen, ohne auf der anderen Seite den angemessenen Preis dafür zu bezahlen - welchen Preis, das beginnen wir erst langsam zu begreifen ... Der Mensch lebt sein Leben zwischen Ratio und Chaos, zwischen der von ihm unterjochten Welt und dem Irrationalen, dem Unbegreiflichen, dem Unerforschlichen, dem Jenseits -"Gott. Gelingt es ihm, der Welt so mächtig zu werden wie heute, das Irrationale aus ihr weitgehend zu verbannen, erfaßt ihn der Rausch des unabhängigen Selbstseins allzusehr, so fällt ihn das Chaos, das nach vorn verdrängt wurde, von hinten an; denn dies Chaos ist ein Teil seiner selbst. Ja, wir können sagen: Gerade das überwiegen der Ratio, des berechnenden Kalküls, gibt dem heutigen Europäer in dem Moment, wo sein Sieg über die äußere Welt besiegelt zu sein scheint, plötzlich ein lähmendes Gefühl, mit dieser seiner Ratio allein zu bleiben, oder besser ausgedrückt: Sich gleichsam wie im "Gefängnis seines eigenen Verstandes" zu befinden. Und nun, von hier aus ist das Verfallensein an das Chaos zu verstehen, das der ganzen modernen Musikentwicklung zugrunde liegt; ist zu verstehen, warum das Chaos sogar in nackt-unmittelbarer Form als Befreiung, geradezu als Erlösung zu wirken vermag; ist zu verstehen die maßlose Empfindlichkeit gegen alles, was, scheinbar oder wirklich, an die eigene Ratio, von der man bis zum Rande erfüllt ist und die man, ach!, so unendlich satt hat, erinnert. Von hier aus ist die eigentümliche Erscheinung der Schönbergschen 12-Töne-Komposition zu verstehen, die einerseits - dem Eindruck auf den Hörer nach - das Heraufrufen des Chaos bedeutet, die anderseits aber - der Arbeitsmethode nach - eine Äußerung des Menschen des technischen Zeitalters in Reinkultur ist und den konsequentesten Rationalisierungsprozeß, den man sich überhaupt denken kann, darstellt. Ratio und Chaos: Das ist die Scylla und Charybdis, zwischen der der moderne Mensch hin- und hergeworfen wird. Dafür ließen sich unendliche Details aus unserem Musikleben anführen; hier, wo es sich zunächst um die großen Umrisse handelt, muß ich davon absehen. Denn eben diese großen Umrisse, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, sagen uns noch etwas anderes: Sie sagen uns, daß es sich bei all diesem nicht um eine einheitliche Gesamtentwicklung, sondern um eine Teilentwicklung handelt. Es ist nicht das "Publikum" im ganzen, es ist nicht der "moderne Mensch", der so reagiert, sondern ganz offenbar nur ein bestimmter Teil der Intelligenz von heute. Wir haben gerade im öffentlichen Musikleben, wo das Publikum dadurch eine mitentscheidende Rolle spielt, daß es kommt und "zahlt", doch irgendwie eine Möglichkeit, diesen modernen Menschen denn ihn repräsentiert schließlich das Publikum - besser kennenzulernen, präziser zu definieren, als wenn er, wie z. B. angesichts der bildenden Kunst, mehr oder weniger anonym bleibt. Und dableibt eben die nicht wegzuleugnende Tatsache, daß ein Teil der Menschen, ein Teil dieses Publikums nicht mitmacht. Man ist sich nicht einig. Mit anderen Worten: Wir leben in einer Krise.'" ٭Auf der Rückseite dieses Manuskriptblattes hat der Verfasser folgende Bemerkung angefügt: Es ist das alles sehr allgemein, sehr abstrakt ausgedrückt. Und doch aber mache ich auch im einzelnen immer wieder die Erfahrung, daß der leidige Verstand, das heißt, vorgefaßte falsche Scheu - und welche vorgefaßte Scheu wäre nicht falsch - den einzelnen, ja ganze Gruppen und Nationen hindern, zu diesem oder jenem Kunstwerk die richtige Einstellung zu haben. Diese Krise zu leugnen, die gegenwärtige Lage als normal, als natürlich, ja als gesetzmäßig zu bezeichnen und zum Beispiel zu behaupten, daß die 12-Ton-Musik die "Seele" des modernen Menschen ausspräche in demselben Sinne, wie Mozart und Beethoven die Seele ihrer eigenen Zeit in Musik setzten, ist geradezu ein schlagendes Beispiel dafür, wie sehr wir uns im "Gefängnis unseres eigenen Verstandes" befinden. Dazu gehört nämlich vor allem gerade, daß man die eigene Entwicklung im voraus zu denken und durch Denken zu beeinflussen versucht. Dazu gehört die Überzeugung, daß es wichtiger ist, die Zukunft im Auge zu halten als die Gegenwart zu erfüllen; daß die Verantwortung vor dieser Zukunft etwas zu Ernstes sei, um nicht jede Rücksicht auf die Freude an der Gegenwart in zweite Linie rücken zu lassen. Man kann geradezu sagen: Nichts ist geeigneter, die These des "sich im Gefängnis des eigenen Verstandes Befindens" zu erhärten, als die Ästhetik der neuen Musik, wie sie nun seit über einem Menschenalter einem Trommelfeuer gleich über uns hernieder geht. Das Gefühl, daß wahrhafte Entwicklung nicht gewollt, nicht gedacht, sondern nur - als Schicksal - erlebt werden könne - das Gefühl, daß man im Sinne der Zukunft nicht anders wirken kann als durch wirkliche Erfüllung der Gegenwart, daß also nur das Werk Bedeutung für die Zukunft haben kann, das eine solche für die Zeit seines Entstehens hat -, scheint weitgehend verloren zu sein. Der produktive Künstler, der sich - ist es nicht geradezu grotesk! - Vorschriften machen läßt vom Theoretiker, vom Ästhetiker, vom Historiker (daß es so ist, bestätigt jeder Blick auf das heutige Musikschrifttum, auf die Äußerungen heutiger Komponisten usw.), ist dies alles nicht der eindrücklichste Anschauungsunterricht, der zwingendste Beweis dafür, daß wir uns wirklich mit unserem gesamten Kunstdenken in einem Gefängnis befinden wie nie eine Menschheit vor uns? Wir fliehen geradezu, um der Verantwortung für die Gegenwart enthoben zu sein, in die Zukunft. Die Begriffe "Fortschritt", "Entwicklung" üben, ob bewußt oder unbewußt, einen Terror auf uns aus, der alles echte Leben zunichte zu machen imstande wäre, wenn - nun, wenn diese neue Musik das ganze europäische Musikleben von heute ausmachte. Das glaubt sie allerdings, weil sie - eben an ihr eigenes Denken gefesselt - an Ideen und Programme glaubt. Es kommt aber - das muß immer wieder gesagt werden - nicht auf Ideen und Programme an, die, je schöner sie sind, desto weniger über die Wirklichkeit auszusagen pflegen, sondern darauf, wieweit diese Ideen und Programme durch die Musik gerechtfertigt und verwirklicht werden. Die wirkliche Musik einer Zeit ist eine schöpferische Tatsache, nicht eine Angelegenheit der Ideologie. Geschaffene Musik ist das Erste, das Unmittelbarste, was da ist; erst dann kommt die theoretische Auslegung, die, um sinnvoll zu sein, sich strengstens an die Wirklichkeit halten, gleichsam ihr Abbild sein muß. Tut sie das nicht, entfernt sie sich von der Wirklichkeit, verliert sie sofort an Gültigkeit. Dies zeigt sich aber erst mit der Zeit. Im ersten Moment scheint sie eher gewichtiger und stärker zu werden; denn sie tritt kompensatorisch für die Musik selber, die entsprechend in den Hintergrund weicht, ein. Sie "denkt", sie "fordert" diese Musik im voraus. Je weiter dieser Prozeß des Vorausdenkens, des ideologischen Forderns geht, desto mehr verliert der eigentliche musikalische Schaffensprozeß an Kraft und Unmittelbarkeit. Der Musiker wendet sich nun nicht mehr direkt an sein Gegenüber, sein Publikum, sondern indirekt, das heißt, er verläßt sich unwillkürlich auf das Programm, die Ideologie, die mithelfen soll, dem Publikum sein Werk verständlich zu machen und nahe zu bringen. Es ist nicht mehr allein die unmittelbare Beziehung Künstler-Publikum, die spricht. Nun ist aber ein Gesetz, daß das Publikum nur das völlig akzeptiert, was - auch wirklich für das Publikum geschrieben ist. Die Liebesgemeinschaft Künstler-Publikum besteht durchaus wie jede echte Liebesgemeinschaft auf Gegenseitigkeit. Dies und nichts anderes bedeutet jene berühmte Anmerkung Beethovens anläßlich seines größten Werkes, der "Missa solemnis": "Von Herzen - möge es zu Herzen gehen". Was nicht fürMenschen geschrieben wird, wird auch von Menschen nicht angenommen. Wenn so viele Komponisten von heute glauben, für die Fachleute, für die Kritiker schreiben zu müssen, nicht aber für die Menschen, so werden sie wohl von den Fachleuten, der Kritik, den Dank ernten, dürfen sich aber nicht wundern, wenn die Menschen kühl bleiben. Der wirkliche Schöpfer wendet sich so unmittelbar und so ausschließlich wie möglich an den lebendigen Menschen. So hat es Bach, so haben es Mozart, Beethoven und alle Großen bis zu unseren Zeiten gemacht! Daß ausgesprochene Virtuosen, daß Liszt, Tschaikowsky usw. für das "Publikum" (wie man in diesem Fall gewöhnlich geringschätzig sagt) komponiert haben, kann man auch ihnen nicht zum Vorwurf machen. Nicht die Beziehung zum Publikum an sich, sondern die Art dieser Beziehung, das heißt die Art des Publikums, an das er sich wendet, kennzeichnet und richtet den Künstler. Jeder Künstler wendet sich kraft seiner Persönlichkeit an einen anderen Teil der Menschen; an welchen Teil, das gibt zugleich Aufschluß über ihn, genauso wie es Sache seiner Kraft, seines Vermögens ist, wenn er nicht anders als mit Zuhilfenahme verstandesmäßiger Ideologien dem Publikum gegenüberzutreten wagt. Jedenfalls stellt das heutige Arbeiten Theoretiker- Künstler, Künstler-Theoretiker ein Arbeiten auf Gegenseitigkeit, gleichsam mit verteilten Rollen, eine Art „circulus vitiosus“ dar, über den wir uns klarwerden müssen. Da der Schaffende für sich allein nicht einstehen kann und will, braucht er die ideologische Hilfe. Da der Ideologe nicht mehr nur das getreue Abbild des Schaffenden gibt, überschreitet er seine Zuständigkeit, "will" und "fordert" er und glaubt damit, dem Schaffenden Hilfe zu leisten. Der Beitrag des Ideologen gewinnt damit eine früher unbekannte Bedeutung, aber nicht so sehr als theoretische Erklärung und Unterstützung des Schaffenden (die dieser immer gebrauchen könnte), denn als - Propaganda. Nun ist es klar, daß jede musikalische Propaganda sich selbst, ihre Inhalte als das eigentliche Musikleben des modernen Menschen herauszustellen bemüht ist. Und da entsteht vor allem die Frage: Was ist eigentlich dieser "moderne Mensch", mit dem sich die heutige Propaganda so selbstbewußt und vorlaut zu identifizieren liebt? Als "modernen Menschen" betrachte ich den Menschen, den wir heute wirklich vor uns haben. Die Menschen, an die sich die Großen des 18., des 19. Jahrhunderts gewandt haben, die sie getragen haben, waren die "modernen Menschen" ihrer Zeit. Der moderne Mensch ist nur im ganzen, nur als Ganzes zu begreifen. Er ist für den Künstler von heute das, was für die früheren großen Meister ihr Publikum war, das Gegenüber, das "Du", der Partner der Liebe, der eigentliche Schoß der Fruchtbarkeit. Er ist freilich umfassender, als der durch den Glauben an eine Fortschrittsideologie gefesselte Ästhetiker von heute es wahrhaben will, der seinerseits ebenso ernsthaft-borniert wie überzeugt-alleswissend der Meinung zu sein scheint, über die Wege des Schicksals, die "Entwicklung der Zukunft" im voraus Sicheres aussagen zu können. Der moderne Mensch ist - soweit er produktiv ist - vor allem reich und vielfältig, während der Mensch der heutigen Propaganda nicht nur arm ist, sondern auch arm - sein will. Wie reich war das Musikleben etwa zu Beginn des Jahrhunderts: Strauß, Pfitzner, Reger, Mahler, Schönberg, Debussy, Ravel, Honegger, Strawinsky, Bartok, der junge Hindemith usw. So viele Namen, so viele verschiedene Arten, an das musikalische Material heranzugehen, so viele völlig verschiedene Individualitäten; man konnte wirklich sagen: Viele Wege führen nach Rom. Und heute? Werden die wenigen Namen, die auf den Musikfesten immer wieder aufscheinen in ihrer Beziehung zum musikalischen Material, nicht einander immer ähnlicher, immer gleichförmiger?" ٭Neben diesem Abschnitt steht im Manuskript eine Randbemerkung des Verfassers: "abgesehen von ... ", die auf die Absicht einer Ergänzung schließen läßt. Versuchen wir uns als Musiker nun vor allem über das, was für uns der moderne Mensch eigentlich ist, klarzuwerden. Diejenigen unter uns, die vor allem die Zukunft im Auge haben, die Menschen der Propaganda, die, wie ich schon sagte "im Gefängnis ihres eigenen Denkens Gefesselten", beanspruchen natürlich in erster Linie, den modernen Menschen zu vertreten. Dem steht entgegen, daß der moderne Mensch im umfassenden Sinne keine gewollte, keine erstrebte, mit einem Wort keine propagandistische, sondern eine wirkliche Tatsache ist. Zur runden Wirklichkeit gehört neben dem, was man sein möchte, vor allem das, was man ist. Gerade der Widerstand des Publikums, der eine beständige Propaganda, wie wir sie heute haben, ja erst notwendig macht, beweist, daß in diesem Publikum, das heißt, in diesem "modernen Menschen", noch andere Eigenschaften stecken müssen als die, die die moderne Ästhetik an ihm hervorhebt. Der Klarheit wegen umreiße ich hier verschiedene Typen. Da sind vor allem diejenigen, die über die Unsicherheit aller Zukunftsspekulationen, über die Grenzen des bloßen Verstandes ein eigenes Wissen besitzen. Dies Wissen ist angeboren, nicht erworben; es ist instinktives, ist natürliches Urwissen. Deshalb kommt dazu, daß dieser Typus Mensch wieder den Reichtum der unerschöpflichen Natur sieht und über der Leidenschaft für Doktrinen das Fühlen des Menschenherzens nicht vergißt. Zu diesen Wissenden gehören viele Musiker, vor allem die unabhängigen großen darstellenden Musiker, die schon von Berufs wegen die Lebens- und Ausdrucksseite ihrer Kunst nicht aus den Augen lassen dürfen und alle nur gedachte, nicht wirklich gehörte Musik von vornherein ablehnen. Es gehören weiter hierzu die Verantwortlichen der hohen Wissenschaft, die es ihrerseits viel zu sehr mit den Grenzen des Verstandes zu tun haben, als daß sie in Gefahr gerieten, diesen Verstand als solchen zu überschätzen. Diesem wissenden Typus möchte ich dann als weiteren noch den Menschen jenseits aller Kunst und Wissenschaft, den Menschen des einfachen, klaren Lebens, anreihen. Dieser zeigt keinerlei Neigung, irgendeine vorgestellte "Entwicklung" durch moralische Entsagung oder gar durch Denken erzwingen zu wollen, stellt aber dafür den, scheints, unausrottbaren Anspruch, die Kunst seine Kunst - zu erleben, als ein Stück von sich selbst zu erkennen und - welch ominöses Wort! - zu genießen. Er tritt ohne festgelegte Ansprüche an die Kunst heran, was aber zugleich auch heißt: ohne Vorurteile, und hat den Willen und die Kraft, auch der modernen Musik gegenüber zu allererst zu sein und zu bleiben, der er ist. So kann man also sagen, daß das Ganze: "Moderner Mensch", mit dem es der Musiker heute zu tun hat, drei in sich verschiedene Typen einschließt. Einmal den, den wir bisher den Propagandisten nannten und den wir hier den Wollenden nennen wollen; dann den, der tiefer blickt und über den Gegensätzen steht, wir nennen ihn hier den Wissenden. Und schließlich den, der durch sein unbeschwertes, klares und im letzten Grunde unbeeinflußbares Gefühl sich Geltung verschafft; wir nennen ihn hier den Fühlenden. Erst aus allen diesen dreien setzt sich der moderne Mensch zusammen, der in Wahrheit unsere musikalische Gegenwart repräsentiert, der in Wahrheit über Sein oder Nichtsein unserer Musik zu Gericht sitzt, der in Wahrheit unsere künstlerische Zukunft bestimmt und bildet. Allerdings möchte ich betonen, daß es die drei Typen, von denen ich hier gesprochen habe, in reiner Form selten gibt. In der Wirklichkeit sind es meistens Mischformen, die wir antreffen und an denen wir alle - ohne Ausnahme, der eine mehr, der andere weniger - unseren Anteil haben. Und dies offenbar fluktuierend; es scheint mir, daß ein und derselbe einmal mehr den einen, ein anderes Mal mehr den anderen Typ vertreten kann. Diese Typen enthalten aber im allgemeinen, auf eine kurze Formel gebracht, den Inhalt dessen, was das Selbstbewußtsein des modernen Menschen ausmacht. Daß nun heute der Typ, den ich als den des Wollens bezeichnet habe, im Vordergrund steht, ist verständlich, eben weil er aktiv auf die Wirklichkeit gerichtet ist. Es sind das vor allem diejenigen, die entweder mit der Feder oder auf anderem Wege (Rundfunk usw.) Musikpolitik machen zu müssen glauben. Ich erinnere mich gut an ein in meiner Gegenwart geführtes Gespräch zwischen Richard Strauß und dem nationalsozialistischen Propagandaminister Goebbels, in dem Richard Strauß, der Jahrzehnte hindurch als Mann des Fortschritts auf den Schild erhobene, leidenschaftlich den Anspruch des Publikums, selber zu hören und selber zu urteilen, verteidigte und anderen Instanzen jedes Recht, hier einzugreifen, abstritt. Nun, der Mann der modernen Propaganda von heute ist ein gelehriger Schüler nicht von Strauss, sondern - von Goebbels. Er ist ein Mann des Handelns, er ist derjenige, der in der weiten Welt keinem Gegenüber, keinem "Du" mehr begegnet, das er innerlich anerkennt, sondern immer nur seinesgleichen. So tritt er der Welt mit der Absicht konsequenter Unterjochung entgegen. Sein Lebensgefühl ist nicht gerichtet auf Fühlen oder auf Erkenntnis, sondern ausschließlich auf Erringung der Macht. Der Wille zur Macht - wie tief hat hier der späte Nietzsche gesehen -, zur Macht über die Natur und weiter zur Macht über die Menschen ist der Mittelpunkt dieser Art. Kein Wunder, daß er auch im Musikleben die Macht an sich gerissen hat mit einem Erfolg, der in früheren Zeiten, wo dieser Typ noch nicht so häufig und durchgebildet war, undenkbar gewesen wäre. Und mit welcher Zielbewußtheit, welcher Rücksichtslosigkeit weiß er diese Macht zu gebrauchen! Wie lückenlos weiß er zu organisieren! Keinerlei sachliche Zweifel können ihn berühren. Den Standpunkt künstlerischer Gerechtigkeit, Ritterlichkeit, Loyalität, den Richard Strauß vertrat - nämlich, daß auch Künstler anderer Art, die er vielleicht nicht versteht, die Möglichkeit haben müssen, sich vor dem Publikum zu bewähren -, kennt er nicht. Solche, die seinen vorgefaßten, engen Begriffen von Modernität nicht entsprechen, hört er sich überhaupt nicht an; sie werden totgeschwiegen, vernichtet, lächerlich gemacht. Die Macht - das ist wohl immer so gewesen - haben stets die, die sie haben wollen. Sie können innerhalb des Musiklebens damit im Augenblick den Prozeß der Auslese der Begabungen erschweren - die Zukunft der Musik hängt nicht von ihnen ab. Denn diese Zukunft ist zugleich die Zukunft des modernen Menschen überhaupt. Daß dieser moderne Mensch im ganzen und der Musikpolitiker von heute - der Propagandist, wie wir ihn nannten - dasselbe sei, wird zwar von diesem letzteren mit unermüdlicher Hartnäckigkeit immer wieder wiederholt. Warum? Weil die ganze Existenz dieses Propagandisten, der alles auf die Zukunft stellt, von diesem Glauben - bei sich wie bei anderen abhängt. Trotdem und gerade deshalb ist dies nicht richtig. Es ist notwendig, daß wir uns über den eigentümlichen Circulus vitiosus, der zwischen ideologischer Propaganda einerseits und dem abstrakt gedachten, nicht gehörten und nicht erlebten Musizieren anderseits besteht, endlich klarwerden. Denn wir kommen aus diesem Circulus vitiosus nie heraus, wenn wir uns nicht entschließen, wir selber zu sein und endlich, anstatt einem bloßen theoretischen Zukunftsglauben zu huldigen, uns wieder unserer eigenen Gegenwart zuwenden, wieder lebensgläubig werden. Was speziell dem Menschen des Wollens fehlt, ist das Gegenüber, das "Du". Wie schon gesagt, begegnet dieser - der Mensch uferlosen Machtstrebens auf dieser Welt - im tieferen Sinne, das heißt von innen heraus, nur noch sich selbst. Der Rausch alles vermögender Intelligenz wirft über sein ganzes Denken seinen Schatten; ein wirkliches Gegenüber, das Ehrfurcht erheischt, ist nicht mehr vorhanden. Nun ist nicht so entscheidend, wie man dies Gegenüber, dies "Du" nennt, ob Gott oder Natur, oder auch beides, als daß es überhaupt vorhanden ist. Man möge sich nur einmal ganz unmittelbar praktisch klarmachen: Durch die überhandnehmende Rechenhaftigkeit unseres Lebens treten alle die Erlebnisse und Empfindungen, die ihr nicht mehr entsprechen, mehr und mehr in den Hintergrund und fallen schließlich ganz fort. Die Natur, das große "Du" des früheren Menschen, ist nur noch zur Überwindung, zur Nutzung da, also kein "Du" mehr. Alle die Empfindungen, die notwendig im Zusammenhang mit einem "Du" entstehen, die Ehrfurcht, das Staunen, die Stille, die Kontemplation - von den unmittelbar der religiösen Sphäre zugehörigen Phänomenen wie dem Gebet usw. ganz zu schweigen - verlieren mehr und mehr an Kraft, werden nicht mehr geübt, verschwinden. Schon beginnt man Anstoß zu nehmen an der "Heldenverehrung" der Vergangenheit, zum Beispiel des 19. Jahrhunderts - im Grunde nichts weiter als eine Verehrung der Gottesnatur im Helden - und ist stolz darauf, es anstatt dessen zum historischen Verständnis gebracht zu haben, weltenfern jeder Art von Verehrung, die einer Zeit überwundener Romantik angehört. Dies Fehlen des "Du" ist nun gerade für die Musik als Kunst von verhängnisvoller Bedeutung. Es verursacht nämlich, daß eine künstlerische Form im eigentlichen Sinne sich nicht mehr entwickeln kann. Denn eine solche braucht, um überhaupt entstehen zu können, den Kampf, die Auseinandersetzung des Künstlers mit einem Gegenüber. Ich möchte mich über das, was künstlerische Form ist, hier nicht auslassen. Es ist ein Geheimnis; für diejenigen, die dieses Geheimnis aus Erfahrung kennen, ist es leicht zu enträtseln; für die anderen aber äußerst schwer mit Worten auszulegen. Hier nur soviel: Künstlerische Form entsteht aus dem Kampf des Künstlers mit seinem Gegenüber, der Gotteswelt, und wendet sich an die Gemeinschaft, die lebendigen Menschen. Ohne ein solches Gegenüber und weiterhin ohne eine solche Gemeinschaft, an die sie sich wendet, ist künstlerische Form sinn- und gegenstandslos. Vom modernen Menschen mit seiner eigentümlichen Affinität zum Chaos aus gesehen, bedeutet die künstlerische Form recht eigentlich die Bannung, die Beschwörung dieses Chaos; sie gibt ihm einen Namen, sie bindet es. In der Musik spricht sie sich in diesem Sinne, vom visionär gesehenen Ganzen angefangen, bis in die kleinsten Einzelheiten hinein, aus. Das Chaos, künstlerisch gebunden, steckt nicht weniger in der Gesamtvision eines großen sinfonischen Werkes als in jener Verdichtung auf einen Punkt, die man Melodie nennen kann. (In diesem Sinne ist in einer einzigen Melodie der Oper "Carmen" mehr wirkliches "Chaos" enthalten als in vielen ellenlangen zeitgenössischen Kompositionen.) Wenn wir nun aber versuchen, den Verwandlungs- und Gestaltungsprozeß, das Formwerden des Kunstwerkes zu umgehen, sei es, daß es uns als modernen Menschen zu sehr und zu unmittelbar darauf ankommt, das nackte Chaos zu fassen, oder weil wir, da wir kein Gegenüber, kein "Du" mehr haben, dem Chaos keinen Namen, keine Gestalt mehr geben können; wenn wir also versuchen, das Chaos direkt anzugehen, dann entsteht - und das ist das Fatale - immer wieder nur dasselbe, nämlich Chaos. Die Art Kunst, die den Formungsprozeß nicht durchgemacht hat, enthält zwar auch Chaos, aber nicht wie eine Melodie aus "Carmen", sondern in einer seltsam blassen, unverpflichtenden Form. Sie ist irrational, gewiß, aber in so weitem Maß, daß sie die schöpferische Persönlichkeit, die hinter ihr steht (im Gegensatz zu früherer Kunst), mehr verschleiert als ausspricht (übrigens einer der Gründe für das massenhafte Komponieren von heute). Aber sie ist daneben zugleich seltsam unwirklich, und das auch, wenn sie einem besonderen Menschentyp in einer bestimmten Phase der Entwicklung einen Moment lang als Erlösung erscheinen mag. Musik als Kunst setzt eine Gemeinschaft voraus. Nicht als ob die bildende Kunst, die Literatur es nicht auch täten; aber im Musikleben, zumal dem öffentlichen, spielte diese Gemeinschaft als Publikum eine unmittelbare, gleichsam personifizierte Rolle. Wenn in Kreisen bildender Künstler heute zuweilen die Unabhängigkeit des einzelnen vom Markt, das heißt dem Publikum gegenüber gepriesen und positiv bewertet wird - in der Musik ist Ähnliches undenkbar. Hier betrachtet man immer noch eine Unabhängigkeit des einzelnen vom sogenannten Publikumserfolg als auf die Spitze getriebenen Individualismus; ja, es scheint, als ob die Tatsache, daß Musik auch heute noch eine Gemeinschaft voraussetzt, uns Musiker besser als irgend etwas anderes davor bewahrt, unsere Verbindung mit den Menschen, mit der Natur, mit Gott zu verlieren. Das Bewußtsein der Bedeutung dieser Gemeinschaft ist die Grundlage aller dieser meiner Ausführungen. Das Wesentliche ist immer der Mensch, der hinter aller Kunst steht, den sie ausdrückt. Die Kunst ist der Mensch, der sie schafft. Solange ich an den heutigen Menschen glaube - freilich nicht nur an die begrenzte und verkrampfte Abart des im Gefängnis des eigenen Denkens gefesselten, sondern an den modernen Menschen im ganzen, mit seiner Breite, Tiefe, Liebe, Wärme und Erkenntnis -, solange lasse ich mir auch den Glauben und die Hoffnung an seine Kunst nicht nehmen.