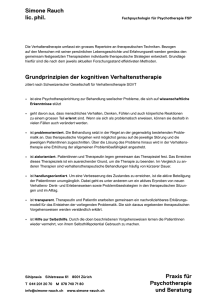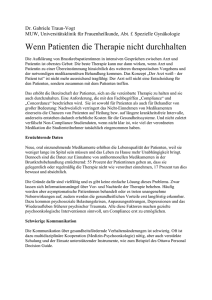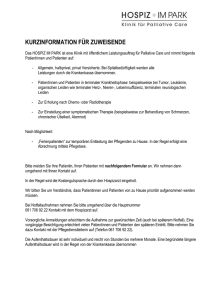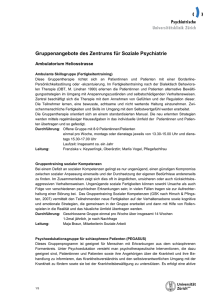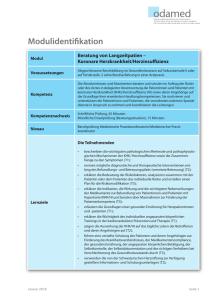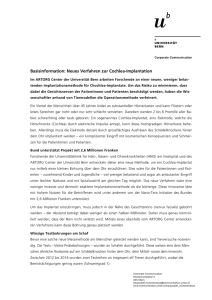DEESKALATIONSMANAGEMENT diplomierter psychiatrischer
Werbung

Masterarbeit DEESKALATIONSMANAGEMENT diplomierter psychiatrischer Pflegepersonen auf psychiatrischen Erwachsenenstationen eingereicht von Sonja Bloder, BSc 0434508 zur Erlangung des akademischen Grades Master of Science (MSc) an der Medizinischen Universität Graz ausgeführt am Institut für Pflegewissenschaft unter der Anleitung von Frau Mag. Dr. Monika Hoffberger und Herrn Univ.-Prof. DDr. Michael Franz Lehofer Graz, 21. Mai 2010 EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe, andere als die angegebenen Quellen nicht verwendet habe und die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Graz, am 21. Mai 2010 I INHALTSVERZEICHNIS EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG .............................................................................................I INHALTSVERZEICHNIS .............................................................................................................. II ABKÜRZUNGEN ........................................................................................................................... VI ABBILDUNGSVERZEICHNIS .................................................................................................. VII TABELLENVERZEICHNIS ......................................................................................................VIII ZUSAMMENFASSUNG ................................................................................................................ IX ABSTRACT ...................................................................................................................................... X 1 2 EINLEITUNG ............................................................................................................................. 1 1.1 PROBLEMSTELLUNG UND BEGRÜNDUNG DER THEMENSTELLUNG ..................................... 1 1.2 ZIELSETZUNG DER ARBEIT.................................................................................................. 2 1.3 METHODIK UND AUFBAU DER ARBEIT ............................................................................... 2 GRUNDSÄTZLICHES ZUR PFLEGE AUF PSYCHIATRISCHEN STATIONEN .......... 4 2.1 TÄTIGKEITSBEREICHE DES GEHOBENEN DIENSTES FÜR GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE ................................................................................................................ 4 2.2 2.1.1 Eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich (§ 14 GuKG) ................................................ 4 2.1.2 Mitverantwortlicher Tätigkeitsbereich (§ 15 GuKG) .................................................... 4 2.1.3 Interdisziplinärer Tätigkeitsbereich (§ 16 GuKG)......................................................... 5 KONKRETE AUFGABENBEREICHE DER PSYCHIATRISCHEN GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE (§ 19 GUKG) .......................................................................................... 5 2.3 3 SPEZIFISCHE BELASTUNGEN IN DER PSYCHIATRISCHEN PFLEGE........................................ 6 RECHTLICHE GRUNDLAGEN HINSICHTLICH DER ANWENDUNG VON ZWANG UND GEWALT IN PSYCHIATRISCHEN EINRICHTUNGEN ......................... 9 3.1 UNTERBRINGUNGEN NACH DEM UNTERBRINGUNGSGESETZ .............................................. 9 3.1.1 Arten der Unterbringung ............................................................................................... 9 3.1.2 Das gerichtliche Anhalteverfahren .............................................................................. 11 3.1.3 Häufigkeit von Unterbringungen und gerichtlichen Anhalteverfahren in Österreich . 11 II 3.2 WEITERGEHENDE BESCHRÄNKUNGEN DER BEWEGUNGSFREIHEIT UND ÄRZTLICHE BEHANDLUNGEN WÄHREND EINER UNTERBRINGUNG...................................................... 12 4 3.2.1 Beschränkungen der Bewegungsfreiheit durch äußere Mittel (§ 33 UbG) ................. 13 3.2.2 Ärztliche Behandlung (§§ 35 bis 37 UbG) .................................................................. 14 AUS- UND FORTBILDUNG IN DER PSYCHIATRISCHEN GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE ................................................................................................................ 15 5 4.1 THEORETISCHER TEIL DER AUSBILDUNG ......................................................................... 15 4.2 PRAKTISCHE AUSBILDUNG ............................................................................................... 16 4.3 FORTBILDUNG IN DER PFLEGE .......................................................................................... 17 4.3.1 Trainingsprogramme im Aggressionsmanagement ..................................................... 17 4.3.2 Aggressions- und Deeskalationsmanagement in der LSF Graz .................................. 20 DAS AGGRESSIONS- UND GEWALTPOTENZIAL PSYCHIATRISCHER PATIENTINNEN...................................................................................................................... 21 5.1 ORGANISCHE EINSCHL. SYMPTOMATISCHE PSYCHISCHE STÖRUNGEN (F00 BIS F09) ...... 22 5.2 PSYCHISCHE UND VERHALTENSSTÖRUNGEN DURCH PSYCHOTROPE SUBSTANZEN (F10 BIS F19)..................................................................................................................... 22 5.3 SCHIZOPHRENIE, SCHIZOTYPE UND WAHNHAFTE STÖRUNGEN (F20 BIS 29) .................... 23 5.4 AFFEKTIVE STÖRUNGEN (F30 BIS F39)............................................................................. 24 5.5 NEUROTISCHE, BELASTUNGS- UND SOMATOFORME STÖRUNGEN (F40 BIS F48) ............. 26 5.6 VERHALTENSAUFFÄLLIGKEITEN MIT KÖRPERLICHEN STÖRUNGEN UND FAKTOREN (F50 BIS F59)..................................................................................................................... 27 6 5.7 PERSÖNLICHKEITS- UND VERHALTENSSTÖRUNGEN (F60 BIS F69) .................................. 27 5.8 INTELLIGENZSTÖRUNG (F70 BIS F79) ............................................................................... 27 5.9 EMPFEHLUNGEN FÜR DEN UMGANG MIT AUSGEWÄHLTEN PATIENTINNENGRUPPEN ...... 28 5.9.1 Demenz ........................................................................................................................ 28 5.9.2 Alkohol- und Drogenabhängigkeit (Intoxikation) ....................................................... 28 5.9.3 Paranoide Schizophrenie ............................................................................................. 29 5.9.4 Leichte geistige Behinderung ...................................................................................... 29 DIE BEGRIFFE AGGRESSION UND GEWALT................................................................ 30 6.1 DEFINITIONEN VON AGGRESSION ..................................................................................... 30 6.2 DEFINITIONEN VON GEWALT ............................................................................................ 31 6.3 ABGRENZUNG DER BEGRIFFE AGGRESSION UND GEWALT .............................................. 32 III 7 ASPEKTE VON AGGRESSION UND GEWALT IN DER PSYCHIATRISCHEN GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE ....................................................................... 33 7.1 DIE ARBEIT MIT POTENZIELL AGGRESSIVEN MENSCHEN ................................................. 33 7.2 PATIENTINNENBEZOGENE PRÄDIKTOREN VON AGGRESSION UND GEWALT IN PSYCHIATRISCHEN KLINIKEN............................................................................................ 34 7.3 FAKTOREN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ENTSTEHUNG VON AGGRESSION UND GEWALT IM INSTITUTIONELLEN SETTING ......................................................................... 35 8 7.4 ESKALATION DER GEWALT ............................................................................................... 36 7.5 HÄUFIGKEIT AGGRESSIVER EREIGNISSE IN PSYCHIATRISCHEN EINRICHTUNGEN ............ 37 7.6 FOLGEN VON AGGRESSION UND GEWALT GEGEN PFLEGENDE......................................... 38 AGGRESSIONSMANAGEMENT ......................................................................................... 40 8.1 PRIMÄRPRÄVENTION ......................................................................................................... 40 8.2 PSYCHOLOGISCHE DEESKALATION ................................................................................... 41 8.3 8.2.1 Verständnis der Ursachen aggressiver Verhaltensweisen ........................................... 41 8.2.2 Grundregeln der Deeskalation ..................................................................................... 43 8.2.3 Verbale Deeskalation................................................................................................... 48 8.2.4 Nonverbale Deeskalation............................................................................................. 53 8.2.5 Umgang mit sexueller Belästigung und mit persönlichen Racheandrohungen ........... 55 8.2.6 Grenzen psychologischer Deeskalation ....................................................................... 55 KÖRPERLICHE INTERVENTIONSTECHNIKEN IM UMGANG MIT AGGRESSIVEN UND GEWALTTÄTIGEN PATIENTINNEN ..................................................................................... 56 8.4 9 8.3.1 Leitlinien für den Umgang mit Zwangsmaßnahmen ................................................... 57 8.3.2 Sachgerechte Durchführung von Zwangsmaßnahmen ................................................ 60 8.3.3 Überwachung von in ihrer Freiheit beschränkten PatientInnen .................................. 62 8.3.4 Häufigkeit von Zwangsmaßnahmen ............................................................................ 63 NACHBESPRECHUNG UND NACHSORGE NACH GEWALTERLEBNISSEN ............................. 64 BEFRAGUNG PSYCHIATRISCH PFLEGENDER ZUR KOMPETENZEINSCHÄTZUNG IM UMGANG MIT AGGRESSIVEN PATIENTINNEN........................... 65 9.1 ZIELSETZUNG DER UNTERSUCHUNG ................................................................................. 65 9.2 FRAGEBOGENERSTELLUNG ............................................................................................... 65 9.3 DATENERHEBUNG ............................................................................................................. 66 9.4 DATENAUSWERTUNG ........................................................................................................ 66 IV 10 ERGEBNISSE DER ERHEBUNG.......................................................................................... 68 10.1 HAUPTCHARAKTERISTIKA DER STICHPROBE .................................................................... 68 10.1.1 Geschlecht und Alter ................................................................................................... 68 10.1.2 Berufserfahrung in der psychiatrischen Pflege ............................................................ 69 10.1.3 Fortbildungsstatus........................................................................................................ 69 10.2 BEDEUTSAMKEIT VON BERUFSERFAHRUNG UND WICHTIGKEIT VON SCHULUNGEN FÜR EINEN ANGEMESSENEN UMGANG MIT AGGRESSIVEN PATIENTINNEN ....................... 72 10.3 EINSCHÄTZUNG DER KOMPETENZERWARTUNGEN UND DES SICHERHEITSGEFÜHLS IM UMGANG MIT AGGRESSIVEN PATIENTINNEN .................................................................... 72 10.4 EINFLUSS DER FAKTOREN SCHULUNGSSTATUS, GESCHLECHT UND BERUFSERFAHRUNG AUF DIE EINSCHÄTZUNG DER KOMPETENZERWARTUNGEN UND DES SICHERHEITSGEFÜHLS IM UMGANG MIT AGGRESSIVEN PATIENTINNEN .......................... 75 10.4.1 Frage 3: Wie gut sind Sie in der Lage, bei aggressiven Patienten physisch einzugreifen? ............................................................................................................... 77 10.4.2 Frage 4: Wie selbstsicher fühlen Sie sich in der Gegenwart eines aggressiven Patienten? .................................................................................................................... 79 10.4.3 Frage 6: Wie gut ist Ihr Wissensstand im Umgang mit physischer Aggression? ........ 80 10.4.4 Frage 7: Wie sicher fühlen Sie sich in der Nähe eines aggressiven Patienten? ........... 82 10.4.5 „Gesamtkompetenz“ .................................................................................................... 83 11 DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNG ..................................................................... 85 11.1 RESUMÉE UND KURZINTERPRETATION DER ZENTRALE ERGEBNISSE ............................... 85 11.2 KRITISCHE REFLEXION DER FRAGEBOGENERHEBUNG ..................................................... 87 11.3 VERGLEICHENDE ERLÄUTERUNGEN ................................................................................. 88 11.4 IMPLIKATIONEN FÜR DIE PRAXIS ...................................................................................... 89 11.5 AUSBLICK.......................................................................................................................... 89 12 LITERATURVERZEICHNIS................................................................................................. 90 13 VERZEICHNIS DER GESETZE UND VERORDNUNGEN .............................................. 98 ANHANG ......................................................................................................................................... 99 V ABKÜRZUNGEN ADE Aggressions- und Deeskalationsmanagement BVC Brøset Violence Checklist CPT European Committee for the Prevention of Torture and Inhumane or Degrading Treatment DGKP Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger DGKS Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester DPGKP Diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger DPGKS Diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenschwester gDfGuKP gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege GuKG Gesundheits- und Krankenpflegegesetz GuKG-AV Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildungsverordnung GuKP Gesundheits- und Krankenpflege ISPN International Society of Psychiatric-Mental Health Nurses KALG Krankenanstaltengesetz LSF Landesnervenklinik Sigmund Freud NICE National Institute for Clinical Excellence ÖBIG Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen ÖGKV Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband OWS Otto-Wagner-Spital PTBS Posttraumatische Belastungsstörung RCT randomized controlled trial (randomisierte kontrollierte Studie) StGB Strafgesetzbuch UbG Unterbringungsgesetz WHO World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation) ZfP Zentrum für Psychiatrie VI ABBILDUNGSVERZEICHNIS Abb. 1: Häufigkeit von Unterbringungen, Erstanhörungen und Gerichtsverfahren im Jahr 2005 ... 12 Abb. 2: Module der Seminarreihe „Gewalt – ADE“ in der LSF Graz ............................................. 20 Abb. 3: Entlassungen aus psychiatrischen Betten mit psychiatrischen Haupt- und Nebendiagnosen im Jahr 2002 (Katschnig, Denk & Scherer 2004, S. 74) ......................... 21 Abb. 4: Phasen der Gewalteskalation ............................................................................................... 37 Abb. 5: Histogramm zur Berufserfahrung der Befragten ................................................................. 69 Abb. 6: Schulungsstatus von Frauen und Männern .......................................................................... 70 Abb. 7: Anzahl der besuchten Module pro SeminarteilnehmerIn .................................................... 70 Abb. 8: Bedeutsamkeit von beruflicher Erfahrung und Wichtigkeit von Schulungen für einen angemessenen Umgang mit aggressiven PatientInnen ........................................................ 72 Abb. 9: Liniendiagramm über die Empfindungen im Umgang mit aggressiven PatientInnen ........ 73 Abb. 10: Deskriptive Darstellung des Kompetenzindexes ............................................................... 73 Abb. 11: Empfindungen im Umgang mit aggressiven PatientInnen – prozentuelle Verteilung der Antworten auf die fünf Antwortmöglichkeiten .......................................................... 74 Abb. 12: Wie gut sind Sie in der Lage, bei aggressiven Patienten physisch einzugreifen? (Frage 3)............................................................................................................................ 78 Abb. 13: Wie selbstsicher fühlen Sie sich in der Gegenwart eines aggressiven Patienten? (Frage 4)............................................................................................................................ 79 Abb. 14: Wie gut ist Ihr Wissensstand im Umgang mit physischer Aggression? (Frage 6) ............ 81 Abb. 15: Wie sicher fühlen Sie sich in der Nähe eines aggressiven Patienten? (Frage 7) ............... 82 Abb. 16: Gesamtkompetenz ............................................................................................................. 84 VII TABELLENVERZEICHNIS Tabelle 1: Unterrichtsfächer der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung ...... 16 Tabelle 2: Alter der Befragten in Jahren .......................................................................................... 68 Tabelle 3: Modulbesuche – Häufigkeitsverteilung .......................................................................... 71 Tabelle 4: Durchschnittliche Berufserfahrung der Geschulten und Ungeschulten .......................... 71 Tabelle 5: Effekt von Schulungsstatus, Geschlecht und Berufserfahrung auf die Empfindungen im Umgang mit aggressiven PatientInnen (p-Werte)...................................................... 75 Tabelle 6: Effekt von Geschlecht und Berufserfahrung auf die Empfindungen im Umgang mit PatientInnenaggression bei den geschulten und den nicht geschulten Personen (p-Werte) ......................................................................................................................... 76 Tabelle 7: Mittelwerte und adjustierte Mittelwerte – Frage 3 .......................................................... 77 Tabelle 8: Lineare Regressionsanalyse – Frage 3 ............................................................................ 78 Tabelle 9: Mittelwerte und adjustierte Mittelwerte – Frage 4 .......................................................... 79 Tabelle 10: Lineare Regressionsanalyse – Frage 4 .......................................................................... 80 Tabelle 11: Mittelwerte und adjustierte Mittelwerte – Frage 6 ........................................................ 80 Tabelle 12: Lineare Regressionsanalyse – Frage 6 .......................................................................... 81 Tabelle 13: Mittelwerte und adjustierte Mittelwerte – Frage 7 ........................................................ 82 Tabelle 14: Lineare Regressionsanalyse – Frage 7 .......................................................................... 83 Tabelle 15: Mittelwerte und adjustierte Mittelwerte – Gesamtkompetenz ...................................... 83 Tabelle 16: Lineare Regressionsanalyse – Gesamtkompetenz......................................................... 84 VIII ZUSAMMENFASSUNG Psychiatrisch Pflegende werden in ihrem Berufsalltag regelmäßig mit aggressivem und gewalttätigem Verhalten der PatientInnen konfrontiert. Eine Möglichkeit, dem wachsenden Problem der Aggression und Gewalt psychiatrischer PatientInnen zu begegnen, sind umfassende Schulungen im Aggressionsmanagement. Diese sollen das Personal zu einem professionellen, sicheren und respektvollen Umgang mit aggressiven und gewalttätigen PatientInnen befähigen. Um deeskalierend wirken zu können, benötigen Pflegende eine Vielzahl an Kenntnissen und Kompetenzen, wie gutes Wahrnehmungsvermögen, Empathie, hohe Gesprächsführungs- und Kommunikationskompetenz und Wissen über Ursachen und Auslöser aggressiven Verhaltens. Die Anwendung von körperlicher Gewalt und von Zwangsmaßnahmen sollte nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn die Eskalation so weit fortgeschritten ist, dass eine Entschärfung der Situation durch weniger eingreifende Alternativen nicht möglich ist. Im Rahmen dieser Arbeit wurde in der Landesnervenklinik Sigmund Freud Graz eine Fragebogenerhebung durchgeführt. Untersucht wurde die Selbsteinschätzung 128 diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpflegepersonen hinsichtlich ihrer Kompetenzerwartungen und ihres Sicherheitsempfindens im Umgang mit aggressiven PatientInnen. Die Befragten stuften sich auf einer fünfstufigen Skala als mittelmäßig bis gut ein. Im Besonderen wurde mittels univariater Varianzanalysen erhoben, ob der Schulungsstatus, das Geschlecht und die Berufserfahrung einen Einfluss auf die Einschätzung der Empfindungen im Umgang mit PatientInnenaggression haben. Geschlecht und Berufserfahrung erwiesen sich bei mehreren Fragen als signifikante Einflussgrößen (p < 0,05). Im Aggressionsmanagement geschulte Personen fühlen sich geringfügig kompetenter und sicherer als nicht geschulte Personen. IX ABSTRACT Nursing staff in mental health settings are confronted with aggressive behaviour in their patients on a daily basis. An accepted method of addressing the growing problem of aggression in psychiatric patients is to train clinical staff in the management of aggressive behaviour; this kind of training should teach nursing staff how to deal with aggressive patients in a professional, safe and respectful manner. In order to be able to calm an aggressive situation down, nursing staff need a variety of skills such as good perception of the aggressive patient, empathy, highly developed interpersonal and communication skills and knowledge of possible causes of aggressive behaviour. Resorting to physical violence and restraining patients by force should only be considered if the problem has escalated to such a level that there is no other option of calming the situation down. In connection with this master’s thesis a survey has been carried out in the Landesnervenklinik Sigmund Freud Graz (Psychiatric Clinic). 128 qualified psychiatric nurses were asked how they would assess their confidence in coping with patient aggression. Participants of the study assessed themselves as average to good. The survey aimed to find out if variables such as level of education, gender and work experience had any influence on the self-assessment of the participants. Gender and work experience proved to be of significant importance with regard to several questions. Staff trained in the management of aggressive behaviour feel a bit more competent and assertive than their untrained colleagues. X 1 EINLEITUNG Die gegenständliche Arbeit beschäftigt sich mit dem Deeskalationsmanagement diplomierter psychiatrischer Pflegepersonen auf psychiatrischen Erwachsenenstationen. Die Auseinandersetzung mit Aggression und Gewalt gehört unabdingbar zur Arbeit in psychiatrischen Einrichtungen. 1.1 Problemstellung und Begründung der Themenstellung Die vorliegende Arbeit entstand vor dem Hintergrund, dass psychiatrisch Pflegende in ihrem Berufsalltag immer wieder mit Aggression und Gewalt zu tun haben. Einerseits sind sie regelmäßig aggressivem und gewalttätigem Verhalten der zu betreuenden Personen ausgesetzt, andererseits üben sie auch selbst Gewalt in Form von Zwangsmaßnahmen aus (Richter & Berger 2001a; Richter & Sauter 1998, S. 7–8; Steinert 2008, S. 9–10). In den Medien finden sich von Zeit zu Zeit dramatisch anklingende Berichte über Missstände in der Pflege, über Vernachlässigung, über Misshandlungen und auch über Todesfälle. Dass auch professionell Pflegende beschimpft, bedroht, geschlagen und getreten werden, wird nur am Rande erwähnt (Lenz 2009). In psychiatrischen Institutionen, insbesondere in der Akutpsychiatrie, sind PatientInnenübergriffe das größte arbeitsplatzbezogene Risiko für das dortige Personal (Steinert 2008, S. 20). Nummerisch betrachtet entfällt ein Großteil der Übergriffe auf das Pflegepersonal (Finzel et al. 2003; ICN 1998, S. 154). Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass pflegerisches Personal auf den Stationen am stärksten repräsentiert ist und mehr Zeit mit PatientInnen verbringt als Angehörige anderer Berufsgruppen (Heinze, Gaatz & Dassen 2005; Nolan et al. 1999; Richter & Berger 2001a). Aggression und Gewalt sowie deren massive Auswirkungen auf Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden des Personals und der PatientInnen sind ernstzunehmende Belange in der psychiatrischen Pflege (Abderhalden et al. 2004, 007; Delaney et al. 2001; Nijman et al. 1999). Dem wachsenden Problem der Aggression und Gewalt psychiatrischer PatientInnen begegnen viele psychiatrische Einrichtungen mit der Implementierung von Schulungen und Trainingsprogrammen im Aggressionsmanagement (Richter & Needham 2007; Steinert & Bergk 2008; te Wildt, Hauser & Kropp 2006). Die Optimierung des Umganges mit aggressivem Verhalten ist ein wichtiges Qualitätskriterium in der Arbeit mit Menschen. 1 1.2 Zielsetzung der Arbeit Aggressives Verhalten stellt für Pflegende eine besondere Herausforderung dar. Mit dieser Arbeit soll vermittelt werden, wie Pflegende auf psychiatrischen Stationen gezielt, kompetent und professionell mit aggressiven und gewalttätigen PatientInnen umgehen können. Die Arbeit zielt darauf ab, konstruktive und konkrete Handlungsmöglichkeiten in eskalierenden Situationen zu skizzieren. Zwei zentrale Fragestellungen sollen im Rahmen dieser Arbeit geklärt werden: 1. Welche Kompetenzen benötigen diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegepersonen auf psychiatrischen Erwachsenenstationen, um im Rahmen von Aggressionsereignissen deeskalierend wirken zu können? 2. Wie schätzen diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegepersonen der Landesnervenklinik Sigmund Freud Graz ihre Kompetenzen und ihr Sicherheitsgefühl im Umgang mit aggressiven PatientInnen ein? 1.3 Methodik und Aufbau der Arbeit Im theoretischen Teil der Arbeit, welcher auf einer Literaturrecherche basiert, wird zunächst auf die psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege (GuKP) und die dabei auftretenden spezifischen Arbeitsaufgaben und Belastungen eingegangen. Thema des dritten Kapitels sind gesetzliche Rahmenbedingungen, die bei der Arbeit in psychiatrischen Behandlungseinrichtungen zu berücksichtigen sind. Im darauffolgenden Kapitel wird ein Blick auf die Ausbildung diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpflegepersonen geworfen, das Curriculum betrachtet und die Notwendigkeit umfassender Schulungs- und Trainingsprogramme im Aggressionsmanagement aufgezeigt. Das fünfte Kapitel gibt einen Einblick in das Aggressions- und Gewaltpotenzial psychiatrischer PatientInnen und beinhaltet erste Empfehlungen für den Umgang mit ausgewählten PatientInnengruppen. Es folgt ein Kapitel über die Begriffe Aggression und Gewalt. An dieses schließt ein grundlegendes Kapitel über Aggression und Gewalt in der psychiatrischen Pflege an, in dem u. a. Faktoren der Gewaltentstehung und Folgen von Aggressions- und Gewaltereignissen beleuchtet werden. 2 Das zentrale und umfangreichste Kapitel dieser Masterarbeit ist jenes über Aggressionsmanagement (Kapitel 8). Schwerpunkt dieses sehr praxisbezogenen Abschnittes sind psychologische Deeskalationstechniken. Es wird aufgezeigt, wie Pflegende durch gewaltfreie Deeskalationsstrategien eine eskalierende Situation entschärfen und dem Voranschreiten einer Eskalation entgegenwirken können. Den Deeskalationstechniken werden körperliche Interventionstechniken gegenübergestellt. Ausführlich auf Präventionsmöglichkeiten und Maßnahmen der Nachsorge nach Aggressions- und Gewaltereignissen einzugehen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Im empirischen Teil der Arbeit (Kapitel 9 und 10) wird der Frage nachgegangen, wie diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenschwestern (DPGKS) und diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenpfleger (DPGKP) ihre Kompetenzen und ihr Sicherheitsgefühl im Umgang mit aggressiven PatientInnen einschätzen. Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden DPGKS/DPGKP der Landesnervenklinik Sigmund Freud (LSF) Graz schriftlich befragt. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion, bestehend aus Schlussbetrachtung, Erkenntnisgewinn, Empfehlungen und Ausblick. 3 2 GRUNDSÄTZLICHES ZUR PFLEGE AUF PSYCHIATRISCHEN STATIONEN Zu Beginn der Arbeit werden die Tätigkeitsbereiche des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege (gDfGuKP) und die spezifischen Arbeitsaufgaben, Schwierigkeiten und Belastungen psychiatrisch Pflegender dargestellt. 2.1 Tätigkeitsbereiche des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege Die Tätigkeitsbereiche des gDfGuKP werden durch die §§ 14 bis 16 des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes 1997 (GuKG) geregelt. Diese Paragraphen gelten gleichermaßen für die allgemeine GuKP, die Kinder- und Jugendlichenpflege und die psychiatrische GuKP. Zu unterscheiden sind der eigenverantwortliche, der mitverantwortliche und der interdisziplinäre Tätigkeitsbereich. Für diese Arbeit sind die beiden erstgenannten Bereiche von Relevanz. 2.1.1 Eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich (§ 14 GuKG) Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich umfasst die Pflegeanamnese, die Pflegediagnostik, die Pflegeplanung, die Durchführung und die Evaluation der gesetzten Pflegemaßnahmen. In eigener Verantwortung sind diplomierte Gesundheits- und Krankenschwestern (DGKS) und diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger (DGKP) auch für die Dokumentation des Pflegeprozesses und die Organisation der Pflege sowie für Gesundheitsförderung, Gesundheitsberatung und psychosoziale Betreuung der PatientInnen zuständig. Die Mitwirkung an der Pflegeforschung, die Anleitung und Überwachung des Hilfspersonals sowie die Anleitung und Begleitung von SchülerInnen fallen ebenso in den eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich (§ 14 Abs. 2 Z 1–12 GuKG). 2.1.2 Mitverantwortlicher Tätigkeitsbereich (§ 15 GuKG) Durch § 15 Abs. 1 GuKG wird die Durchführung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen durch DGKS/DGKP nach ärztlicher Anordnung geregelt. Ärztinnen tragen die Verantwortung für die Anordnung der Maßnahmen, Pflegende für die Durchführung der 4 Tätigkeiten (§ 15 Abs. 2 GuKG). DGKS/DGKP sollten einer ärztlichen Anordnung nicht unreflektiert Folge leisten. Eine ärztliche Anordnung hat außer in medizinisch begründeten Ausnahmefällen schriftlich zu erfolgen (§ 15 Abs. 3–4 GuKG). Verfügt eine Pflegeperson nicht über die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten für eine fachgerechte Ausführung der Anordnung, liegt es in ihrer Verantwortung, auf diesen Umstand hinzuweisen und sich von der Durchführung (schriftlich) zu distanzieren (Berufsverband der Direktorinnen und Direktoren an Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege 2004, S. 11). In den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich fallen u. a. die Verabreichung von Arzneimitteln, Injektionen und Infusionen, das Legen von Magensonden und Blasenkathetern sowie Blutentnahmen (§ 15 Abs. 5 Z 1–7 GuKG). 2.1.3 Interdisziplinärer Tätigkeitsbereich (§ 16 GuKG) Der interdisziplinäre Tätigkeitsbereich umfasst die Zusammenarbeit von DGKS/DGKP mit anderen Berufsgruppen des Gesundheitswesens bei übergreifenden Themen (§ 16 Abs. 1 GuKG), wie z. B. Entlassungsvorbereitung, Hilfestellung bei der Weiterbetreuung, Gesundheitsberatung, Gesundheitsförderung und Prävention von Krankheiten und Unfällen (§ 16 Abs. 3 Z 1–4 GuKG). Innerhalb dieses Tätigkeitsbereiches haben Angehörige des gDfGuKP das Vorschlags- und Mitentscheidungsrecht. Sie tragen die Durchführungsverantwortung für alle von ihnen gesetzten Pflegemaßnahmen (§ 16 Abs. 2 GuKG). 2.2 Konkrete Aufgabenbereiche der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege (§ 19 GuKG) Die psychiatrische GuKP umfasst die Betreuung und Pflege von Menschen mit psychischen Störungen und neurologischen Erkrankungen und die Förderung der psychischen Gesundheit (§ 19 Abs. 1 GuKG). Gemäß § 19 Abs. 2 GuKG zählen dazu insbesondere: 1. Beobachtung, Betreuung und Pflege sowie Assistenz bei medizinischen Maßnahmen sowohl im stationären, teilstationären, ambulanten als auch im extramuralen und komplementären Bereich von Personen mit akuten und chronischen psychischen Störungen, einschließlich untergebrachten Menschen, Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen und geistig abnormen Rechtsbrechern (§ 21 StGB) sowie Menschen mit Intelligenzminderungen, 2. Beobachtung, Betreuung und Pflege von Menschen mit neurologischen Erkrankungen und sich daraus ergebenden psychischen Begleiterkrankungen, 3. Beschäftigung mit Menschen mit psychischen Störungen und neurologischen Erkrankungen, 4. Gesprächsführung mit Menschen mit psychischen Störungen und neurologischen Erkrankungen sowie deren Angehörigen, 5. psychosoziale Betreuung, 6. psychiatrische und neurologische Rehabilitation und Nachbetreuung und 7. Übergangspflege. 5 2.3 Spezifische Belastungen in der psychiatrischen Pflege Die Zufriedenheit mit dem Pflegeberuf ist generell sehr hoch, wenngleich ein Drittel der Pflegenden gelegentlich daran denkt, aus dem Pflegeberuf auszusteigen (Winkler et al. 2006, S. 103). Befragungen zeigen, dass in der Pflege sowohl Unterforderung als auch Überforderung gegenwärtig sind. Pflegende sind häufig fachlich unterfordert und gleichzeitig zeitlich, physisch und psychisch überfordert (Grond 2007, S. 27–30; Winkler et al. 2006, S. 102–103). Insbesondere durch die im GuKG (1997) geregelten Berufspflichten sind die qualitativen und quantitativen Anforderungen gestiegen. Die GuKP kann nicht (mehr) reduziert werden auf das Ausführen von einzelnen Pflegehandlungen. Sie umfasst zudem wichtige Leistungen wie Prozessplanung, Schulung, Beratung, Aufklärung, Kommunikation, Organisation, Administration, Dokumentation, Nahtstellenmanagement, Qualitätssicherung, Gesundheitsförderung und Prävention (Winkler et al. 2006, S. 38). Viele psychiatrisch Pflegende fühlen sich – bedingt durch die steigenden Anforderungen und sich verschlechternden Arbeitsbedingungen – in nicht mehr akzeptablem Ausmaß belastet. Im Zuge einer Befragung von Pflegenden in psychiatrischen Kliniken konnten von Dondalski (2003) mehrere belastende Aspekte identifiziert werden: Ansammlung von AkutpatientInnen in Behandlungseinheiten Nicht kooperationsfähige und kooperationswillige PatientInnen Bedrohliche Situationen und Gewaltsituationen Starke emotionale Einbindung in die Tätigkeit Unklares Handlungs- und Rollenfeld Mangelnde Erfolgserlebnisse Ständige Störungen im Arbeitsablauf durch PatientInnen, KollegInnen etc. Wenig Anerkennung und Unterstützung von Seiten der Vorgesetzten Belastende bzw. wenig familienfreundliche Dienstzeiten Diese Arbeitsbelastungen sind u. a. vor dem Hintergrund der sich verändernden Rahmenbedingungen innerhalb der psychiatrischen Versorgung und der Professionalisierung der psychiatrischen Pflege zu sehen. Psychiatrische Kliniken sind vom Trend der steigenden Fallzahlen und der immer kürzeren Verweildauer nicht ausgenommen. Dadurch, dass immer mehr PatientInnen in immer kürzerer Zeit behandelt und gepflegt werden müssen, verdichten sich die Anforderungen und Arbeitsaufgaben für das Personal. Im Zuge der 6 Professionalisierung der psychiatrischen Pflege sind die Anforderungen und (berechtigten) Erwartungen seitens der PatientInnen, der ArbeitgeberInnen, anderer Berufsgruppen, der Kostenträger und des Gesetzgebers an die Pflegenden gestiegen (Dondalski 2003). Von Pflegenden wird sehr hohe Fach- und Sozialkompetenz erwartet. Es wird erwartet, dass sie professionell mit anderen Menschen umgehen, einfühlsam, teamfähig, konfliktfähig und selbstsicher sind. Hinzu kommen eigene Erwartungen (genügend Zeit für Betreuung finden, fachliche Kompetenz, emotionale Stabilität, „immer freundlich sein“). Den vielen Erwartungen stehen Personalmangel und Zeitdruck gegenüber (Kienzle & Paul-Ettlinger 2001, S. 54–55 & 58). Im Berufsalltag erleben Pflegende täglich eine Konfrontation mit unendlichem Leid und Krankheit, mit Apathie und Aggression sowie mit dem Sterben und dem Tod. Damit können Gefühle der Schuld, des Versagens, der Angst, der Hilflosigkeit, der Wut und des Ekels verbunden sein. Mit diesen Gefühlen umzugehen ist eine schwierige Herausforderung im Pflegeberuf (Grond 2007, S. 86–89; Kienzle & Paul-Ettlinger 2001, S. 49; Piegler & Sefke 2001). Vor allem in der Arbeit mit chronisch kranken Menschen entstehen häufig negative Gefühle, weil der erwünschte Erfolg trotz Engagement ausbleibt (Dondalski 2003). Ein gravierender Belastungsfaktor sind die psychischen Störungen der PatientInnen und deren Aggressions- und Gewaltpotenzial. Sowohl die Gefahr eines Übergriffes als auch die unmittelbare Konfrontation mit PatientInnenaggression und das eigene Ausüben notwendiger Gewalt werden als große Belastung empfunden (Dondalski 2003). Auch suizidales und selbstverletzendes Verhalten ist ein belastender Aspekt der psychiatrischen Arbeit (te Wildt, Hauser & Kropp 2006). Ohne angemessene Ausgleichs- bzw. Bewältigungsstrategien und bewusste Selbstpflege zur Wiederherstellung des Gleichgewichts (Psychohygiene) führt die pflegerische Arbeit unmittelbar zum Burnout. Psychohygiene bedeutet, für Entspannung zu sorgen, ausgleichenden Freizeitbeschäftigungen nachzugehen, ein positives Selbstbild zu schaffen, persönliche Beziehungen zu pflegen und längere Erholungsphasen einzuplanen (Kienzle & Paul-Ettlinger 2001, S. 58–63). Gute Teamarbeit ist unabdingbar, um den beruflichen Belastungen langfristig standhalten zu können. Im Rahmen von Supervision und Fallbesprechungen im Team können belastende Arbeitssituationen bearbeitet und Gefühle der Frustration und Aggression abgebaut werden (Kienzle & Paul-Ettlinger 2001, S. 56–57; Walter 1998, S. 57). 7 Die Darstellung der verschiedenen Belastungsfaktoren verdeutlicht, dass die Arbeit in der psychiatrischen GuKP eine hohe emotionale und psychosoziale Belastung mit sich bringt. Eine in besonderem Maße bedeutende Belastung dürfte die Arbeit mit PatientInnen, die aggressives Verhalten zeigen, sein (Richter & Sauter 1998, S. 9; Walter 1998, S. 57). Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) infolge einer aggressiven Auseinandersetzung mit einer Patientin bzw. einem Patienten sind nicht unüblich. In Einzelfällen ist die psychische Belastung psychiatrisch Pflegender so groß, dass psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen werden muss (Richter & Berger 2001b). 8 3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN HINSICHTLICH DER ANWENDUNG VON ZWANG UND GEWALT IN PSYCHIATRISCHEN EIN- RICHTUNGEN Thema dieses Kapitels ist das Unterbringungsgesetz 1990 (UbG), ein Bundesgesetz über die Unterbringung psychisch Kranker in psychiatrischen Behandlungseinrichtungen. Darüber hinaus enthält das UbG nähere Bestimmungen über die Anwendung weitergehender Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und über die ärztliche Behandlung untergebrachter Personen. Das Gesetz zielt v. a. auf den besonderen Schutz der Persönlichkeitsrechte und die Achtung und Wahrung der Menschenwürde psychisch Kranker ab (§ 1 Abs. 1 UbG). 3.1 Unterbringungen nach dem Unterbringungsgesetz Unter dem Begriff Unterbringung ist zu verstehen, dass eine psychisch kranke Person in einem geschlossenen Bereich einer psychiatrischen Krankenanstalt oder Abteilung angehalten wird. Ebenfalls als untergebracht gilt eine Person, die in einem offenen Bereich durch geeignete organisatorische Maßnahmen in ihrer körperlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird (§ 2 UbG). Eine Unterbringung dient dem Schutz der untergebrachten Person und der Gesellschaft, und sie ist gemäß § 3 UbG nur möglich, wenn folgende materielle Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 1. Vorliegen einer psychischen Krankheit1 und dadurch bedingte ernstliche und erhebliche Eigen- oder Fremdgefährdung 2. Fehlen anderer ausreichender ärztlicher Behandlungs- oder Betreuungsmöglichkeiten 3.1.1 Arten der Unterbringung Bei Vorliegen der Voraussetzungen müssen PatientInnen untergebracht werden, wobei die Unterbringung „freiwillig“ (auf Verlangen) oder „unfreiwillig“ (ohne Verlangen) erfolgen kann. 1 Geistige Behinderungen, Persönlichkeitsstörungen sowie Alkoholismus und Suchtkrankheiten sind keine psychischen Krankheiten im Sinne des UbG (Kopetzki 1997, S. 26–29). 9 3.1.1.1 Unterbringung auf Verlangen Personen können auf eigenes Verlangen untergebracht werden, sofern sie den Grund und die Bedeutung der Unterbringung einzusehen vermögen, urteilsfähig sind und die Unterbringung schriftlich verlangen (§ 4 Abs. 1–2 UbG). Die Abteilungsleitung und eine weitere Fachärztin bzw. ein weiterer Facharzt für Psychiatrie und Neurologie haben die aufnahmewerbende Person unverzüglich unabhängig voneinander zu untersuchen. Sie darf nur aufgenommen werden, wenn nach übereinstimmenden ärztlichen Gutachten die Unterbringungsvoraussetzungen und die Einsichts- und Urteilsfähigkeit vorliegen (§ 6 Abs. 1 UbG). Die Unterbringung auf Verlangen darf längstens zehn Wochen dauern (§ 7 UbG). 3.1.1.2 Unterbringung ohne Verlangen Eine Person darf gegen oder ohne ihren Willen nur dann in eine Krankenanstalt gebracht werden, wenn eine im öffentlichen Sanitätsdienst stehende Ärztin oder eine Polizeiärztin (bzw. ein im öffentlichen Sanitätsdienst stehender Arzt oder ein Polizeiarzt) sie untersucht und unter Angabe der Gründe bescheinigt, dass die Voraussetzungen der Unterbringung vorliegen (§ 8 UbG). Wird das Vorliegen der Voraussetzungen der Unterbringung bescheinigt, so haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes die betroffene Person in eine Krankenanstalt zu bringen (§ 9 Abs. 1 UbG). Bei Gefahr im Verzug kann auf eine ärztliche Untersuchung und Bescheinigung verzichtet werden (§ 9 Abs. 2 UbG). Ob die betroffene Person tatsächlich aufgenommen wird, entscheidet eine wie oben beschriebene Aufnahmeuntersuchung (§ 10 Abs. 1 UbG). Eine fachärztliche Untersuchung muss auch dann stattfinden, wenn bei einer sonst aufgenommenen, in ihrer Bewegungsfreiheit nicht beschränkten Person eine Unterbringung notwendig erscheint oder wenn eine Unterbringung auf eigenes Verlangen in eine Unterbringung ohne Verlangen umgewandelt werden soll (Widerruf, Fristablauf) (§ 11 UbG). Im Falle einer Unterbringung ist die aufgenommene Person von der Abteilungsleitung über die Gründe zu informieren. Ferner sind unverzüglich die PatientInnenanwaltschaft (§ 10 Abs. 3 UbG), das Gericht (§ 17 UbG) und, wenn die kranke Person nicht widerspricht, eine Angehörige bzw. ein Angehöriger von der Unterbringung zu benachrichtigen. Auf Verlangen der kranken Person ist auch deren Rechtsbeistand von der Unterbringung zu verständigen (§ 10 Abs. 3 UbG). 10 3.1.2 Das gerichtliche Anhalteverfahren Bei unfreiwillig untergebrachten PatientInnen muss ein gerichtliches Anhalteverfahren durchgeführt werden: Innerhalb von vier Tagen ab Kenntnis von der Unterbringung hat das Gericht sich einen persönlichen Eindruck von der kranken Person zu machen, eine erste Anhörung durchzuführen (§ 19 Abs. 1 UbG) und gegebenenfalls die Unterbringung für unzulässig zu erklären (§ 20 Abs. 2 UbG). Erachtet das Gericht die Unterbringung vorläufig für zulässig, ist binnen 14 Tagen eine mündliche Verhandlung anzuberaumen (§ 20 Abs. 1 UbG), in der das Gericht über Zulässigkeit und Dauer der Unterbringung entscheidet (maximal drei Monate ab Beginn der Unterbringung) (§ 26 Abs. 1–2 UbG). Gegen den Beschluss kann Rekurs erhoben werden (§ 28 Abs. 1–2 UbG). Eine Fristverlängerung ist möglich (§ 30 Abs. 1 UbG), ebenso eine vorzeitige Aufhebung der Unterbringung (§ 31 Abs. 1 UbG). In den Jahren 2003 bis 2005 wurden österreichweit ca. zehn Prozent der Unterbringungen (Bezirksgericht Graz: 15 Prozent) im Zuge der Erstanhörungen als unzulässig befunden und jede zehnte Verhandlung führte zur Aufhebung der Unterbringung (Bezirksgericht Graz: 17,7 Prozent) (Danzer, Hagleitner & Lehner 2006, S. 20–21). 3.1.3 Häufigkeit von Unterbringungen und gerichtlichen Anhalteverfahren in Österreich Die Zahl der Unterbringungen ohne Verlangen steigt seit der Einführung des UbG im Jahr 1990 kontinuierlich an und belief sich im Jahr 2005 auf fast 18.800 Fälle (Danzer, Hagleitner & Lehner 2006, S. 18–19), das sind etwa 25 Prozent der Aufnahmen in den psychiatrischen Krankenanstalten und Abteilungen. Die Unterbringung auf Verlangen ist mit knapp zwei Prozent der Aufnahmen selten, wie eine Erhebung in den psychiatrischen Krankenanstalten und Abteilungen Österreichs ergab (Danzer, Hagleitner & Lehner 2006, S. 13). Im Jahr 2005 wurden ca. 55 Prozent der Unterbringungsfälle (n = 10.291) im Rahmen einer gerichtlichen Anhörung überprüft (s. Abb. 1); ca. 45 Prozent der Unterbringungen ohne Verlangen wurden bereits vor der Erstanhörung von der Abteilungsleitung wieder aufgehoben. Nur bei ca. 20 Prozent der Unterbringungen (n = 3.686) kam es zu einem Gerichtsverfahren (Danzer, Hagleitner & Lehner 2006, S. 18–19). 11 20.000 18.774 15.000 österreichw eit 10.291 Bezirksgericht Graz 10.000 5.000 4.498 3.686 2.337 690 0 Unterbringungen ohne Verlangen gerichtliche Anhörungen Gerichtsverfahren Abb. 1: Häufigkeit von Unterbringungen, Erstanhörungen und Gerichtsverfahren im Jahr 2005 3.2 Weitergehende Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und ärztliche Behandlungen während einer Unterbringung In der stationären psychiatrischen Versorgung gibt es eine Reihe spezifischer Problem- und Konfliktfelder. Dazu zählen typischerweise äußere Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und ärztliche Behandlungen gegen den Willen der Betroffenen (Steinert 2001a). Derartige Maßnahmen sind ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Menschen und bedürfen einer klaren Rechtsgrundlage. Denkbare Rechtfertigungsgründe für freiheitsbeschränkende Maßnahmen sind neben der (ausdrücklichen oder mutmaßlichen) Einwilligung der PatientInnen bzw. ihrer gesetzlichen Vertretung die Notwehr2 und der entschuldigende Notstand3 sowie im Besonderen das UbG (Ottermann 2003; Schanz 2004; Steinert & Bergk 2008). 2 3 Gemäß § 3 des Österreichischen Strafgesetzbuches 1974 (StGB) ist die Anwendung von Gewalt rechtmäßig, wenn sie notwendig ist, um sich oder eine andere Person gegenüber einem gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden rechtswidrigen Angriff auf Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen zu verteidigen. „Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um einen unmittelbar drohenden bedeutenden Nachteil von sich oder einem anderen abzuwenden, ist entschuldigt, wenn der aus der Tat drohende Schaden nicht unverhältnismäßig schwerer wiegt als der Nachteil, den sie abwenden soll, und in der Lage des Täters von einem mit den rechtlich geschützten Werten verbundenen Menschen kein anderes Verhalten zu erwarten war“ (§ 10 Abs. 1 StGB). 12 3.2.1 Beschränkungen der Bewegungsfreiheit durch äußere Mittel (§ 33 UbG) Beschränkungen der PatientInnen in ihrer Bewegungsfreiheit auf einen Raum (Isolierung) oder innerhalb eines Raumes (z. B. mechanische Fixierung, Netzbett) sind Bestandteil des pflegerischen Alltags (Kopetzki 1997, S. 148). Psychiatrische PatientInnen dürfen jedoch nicht willkürlich in ihrer Bewegungsfreiheit beschränkt werden. Freiheitsbeschränkende Maßnahmen müssen situationsadäquat sein und dürfen keinesfalls nur der Angst des Personals entspringen. Dem Gesetz nach sind Beschränkungen der Bewegungsfreiheit nur zulässig, wenn sie: 1. unerlässlich sind zur Abwehr einer ernstlichen Gefahr für Leben und Gesundheit der betroffenen Person oder einer anderen Person sowie zur ärztlichen Behandlung oder Betreuung und 2. verhältnismäßig sind und nicht über die Notwendigkeit hinausgehen (§ 33 Abs. 1 UbG). Paragraph 33 Abs. 3 UbG normiert, dass eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit nur nach ärztlicher Anordnung durchgeführt werden darf. Jede freiheitsbeschränkende Maßnahme ist einschl. einer Begründung zu dokumentieren und unverzüglich der Vertretung der Patientin bzw. des Patienten zu melden. Auf Verlangen der PatientInnen bzw. deren Vertretung prüft das Gericht die Zulässigkeit der Maßnahme. Nur in Notfällen (Rechtfertigungsgründe Notwehr und entschuldigender Notstand), in denen die Maßnahme zur Abwehr einer erheblichen drohenden Gefahr unmittelbar notwendig ist, dürfen DGKS/DGKP eigenständig tätig werden. Die schriftliche ärztliche Anordnung ist ohne Verzug nachträglich einzuholen (Asani, Eißmann & Danyluk 2007; Hartdegen 1996, S. 243; Ottermann 2003). Der § 33 UbG ist nur auf Bewegungsbeschränkungen durch äußere Mittel anwendbar. Beschränkungen der inneren Bewegungsfreiheit (z. B. medikamentöse Dämpfung des Bewegungsdranges) unterliegen den Bestimmungen der Paragraphen über die ärztliche Behandlung (Kopetzki 1997, S. 145). 13 3.2.2 Ärztliche Behandlung (§§ 35 bis 37 UbG) Grundsätzlich dürfen einsichts- und urteilsfähige PatientInnen nur mit ihrer Zustimmung behandelt werden (§ 36 Abs. 1 UbG). Minderjährige und besachwaltete PatientInnen, die den Grund und die Bedeutung der Behandlung nicht einsehen können, dürfen nicht gegen den Willen ihrer Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen Vertretung behandelt werden. Bei nicht einsichtsfähigen PatientInnen ohne gesetzliche Vertretung oder Erziehungsberechtigte hat auf Verlangen der PatientInnen oder deren Vertretung das Gericht unverzüglich über die Zulässigkeit der Behandlung zu entscheiden (§ 36 Abs. 2 UbG). Die Zustimmung zur ärztlichen Behandlung und die gerichtliche Genehmigung sind nicht erforderlich, wenn die Behandlung so dringend notwendig ist, dass eine durch die Einholung der Zustimmung bedingte Verzögerung das Leben oder die Gesundheit der PatientInnen ernstlich gefährden würde. Die Entscheidung über die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer ärztlichen Behandlung liegt in solchen Fällen bei der Abteilungsleitung (§ 37 UbG). Besondere Heilbehandlungen einschl. Operationen bedürfen ausnahmslos einer schriftlichen Zustimmung der PatientInnen, der gesetzlichen Vertretung oder Erziehungsberechtigten bzw. einer gerichtlichen Genehmigung im Vorhinein (§ 36 Abs. 1–2 UbG). 14 4 AUS- UND FORTBILDUNG IN DER PSYCHIATRISCHEN GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE Die spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen GuKP wird durch das GuKG und die GuKG-Ausbildungsverordnung (GuKG-AV) geregelt. Die drei Jahre dauernde Ausbildung (§ 1 Abs. 1 GuKG-AV) dient der Vermittlung der zur Ausübung des Berufes erforderlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten (§ 2 GuKG-AV). Sie umfasst insgesamt 4600 Stunden. Davon entfallen mindestens 2000 Stunden auf die theoretische Ausbildung (§ 15 Abs. 3 GuKG-AV) und mindestens 2480 Stunden auf die praktische Ausbildung (§ 18 Abs. 3 GuKG-AV). Auch allgemeine DGKS/DGKP haben die Möglichkeit, nach Absolvierung einer mindestens einjährigen aufbauenden Sonderausbildung (im Ausmaß von mindestens 1600 Stunden in Theorie und Praxis) in der psychiatrischen Pflege tätig zu werden (§ 67 Abs. 1 GuKG). 4.1 Theoretischer Teil der Ausbildung Die theoretische Ausbildung findet an einer Schule für psychiatrische GuKP statt (§ 78 Abs. 1 GuKG). Sie erfolgt nicht nach Unterrichtsfächern, sondern nach berufsspezifischen Themenstellungen und Themenbereichen. Das Curriculum der speziellen Grundausbildung in der psychiatrischen GuKP umfasst eine Vielzahl an Themenbereichen, von denen fünf exemplarisch genannt werden: „ATL4 – Kommunizieren“ (56 Unterrichtsstunden) „Begegnung mit Menschen in Krisensituationen“ (21 Stunden) „Begegnung mit schizophrenen Erwachsenen“ (46 Stunden) „Begegnung mit alten Menschen in besonderen somatischen und psychosozialen Notlagen“ (98 Stunden) „Arbeitsfeld, berufliche Routinen und charakteristische Problembereiche der psychiatrischen Pflege“ (98 Stunden) Die einzelnen Themen werden fächerübergreifend unterrichtet. Die Fächer und deren Stundenausmaß sind in umseitiger Tabelle ersichtlich (Bronneberg 2004a, 2004b, 2004c). 4 Aktivitäten des täglichen Lebens 15 Tabelle 1: Unterrichtsfächer der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung Unterrichtsfach Stunden Gesundheits- und Krankenpflege einschließlich Ernährungslehre, Erste Hilfe und Hygiene Psychiatrische und neurologische Gesundheits- und Krankenpflege Pflege von alten Menschen, Palliativpflege Medizinische Grundlagen einschließlich Psychopathologie, psychiatrische und neurologische Krankheitslehre, Pharmakologie* 300 500 90 340 Gerontologie, Geriatrie und Gerontopsychiatrie* 40 Berufsspezifische Ergonomie und Körperarbeit 90 Soziologie, Psychologie, Pädagogik und Sozialhygiene* 180 Gesprächsführung, psychosoziale Betreuung und Angehörigenarbeit* 100 Supervision 90 Kreativitätstraining 54 Strukturen und Einrichtungen der gesundheitlichen und sozialen Versorgung, Organisationslehre 30 Elektronische Datenverarbeitung, fachspezifische Informatik, Statistik und Dokumentation 40 Berufsspezifische Rechtsgrundlagen 66 Fachspezifisches Englisch 80 Gesamt 2000 Es stellt sich die Frage, ob das festgelegte Stundenausmaß adäquat ist oder ob zusätzliche Stunden notwendig wären, um die SchülerInnen besser auf ihre Arbeit in der Psychiatrie bzw. auf den Umgang mit Aggression und Gewalt vorzubereiten. Nau et al. (2009) befürworten, bereits in die Ausbildung ein mehrtägiges praxisbezogenes Seminar im Aggressionsmanagement zu integrieren, das die zukünftigen DGKS/DGKP mit Wissen, Selbstvertrauen und Handlungskompetenzen ausstattet, damit sie schwierigen Situationen im Berufsalltag besser gewachsen sind. 4.2 Praktische Ausbildung Der praktische Teil der Ausbildung in der psychiatrischen GuKP dient der Umsetzung der theoretischen Lerninhalte in die Praxis unter Anleitung und Aufsicht durch Lehr- und Fachkräfte. Die Praktika finden an einschlägigen Abteilungen einer Krankenanstalt, an Einrichtungen zur stationären Betreuung pflegebedürftiger Menschen und an Einrichtungen, die Hauskrankenpflege, andere Gesundheitsdienste oder soziale Dienste anbieten, statt (§ 18 Abs. 3 & 6 GuKG-AV). Diese Fächer sind in der psychiatrischen GuKP – im Unterschied zur allgemeinen GuKP – von besonderer Bedeutung (Katschnig et al. 2001, S. 39–40). 16 4.3 Fortbildung in der Pflege Gemäß § 63 Abs. 1 GuKG sind die Angehörigen des gDfGuKP verpflichtet, innerhalb von fünf Jahren Fortbildungen im Ausmaß von mindestens 40 Stunden zu besuchen. Die Fortbildung dient zum einen der Vertiefung der in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten, zum anderen soll sichergestellt werden, dass das Pflegepersonal auf dem neuesten Stand ist in Bezug auf die Entwicklungen und Erkenntnisse der pflegerischen und der medizinischen Wissenschaft. Die Träger von Krankenanstalten sind verpflichtet, die Fortbildung der Gesundheits- und Pflegeberufe sicherzustellen (§ 16d KALG). 4.3.1 Trainingsprogramme im Aggressionsmanagement In der vom britischen National Institute for Clinical Excellence (NICE) herausgegebenen Behandlungsleitlinie zum kurzfristigen Umgang mit Gewalt in psychiatrischen Institutionen wird die Empfehlung gegeben, dass das Personal fortlaufend umfassende Trainings besuchen sollte, um Kompetenzen für einen angemessenen Umgang mit aggressivem und gewalttätigem Verhalten psychiatrischer PatientInnen zu erwerben (NICE 2005, S. 90). Auch von vielen anderen Seiten wird explizit die Notwendigkeit und Relevanz einer umfangreichen und an die spezifischen Bedürfnisse der Organisation angepassten MitarbeiterInnenschulung zum professionellen Umgang mit schwierigen Situationen im Berufsalltag betont (McGowan et al. 1999; Needham et al. 2005; Nolan et al. 1999; Richter & Berger 2001). Angesichts der womöglich unzureichenden Ausbildung, der Zunahme von Aggression und Gewalt sowie der gravierenden Auswirkungen von Gewaltereignissen auf persönlicher, ökonomischer, organisatorischer und PatientInnenebene ist der Einsatz von Trainingsprogrammen in psychiatrischen Einrichtungen eine logische Konsequenz. Derartige Trainings können einen bedeutsamen Beitrag zur Bewältigung des Alltags leisten und dürften eine entscheidende qualitätsverbessernde Maßnahme sein (Needham et al. 2004; Steinert & Baur 2004; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 44). In manchen Einrichtungen ist es Standard, dass neue MitarbeiterInnen ein verpflichtendes Basistraining absolvieren und dass alle Beschäftigten regelmäßig an Auffrischungskursen teilnehmen (McGowan et al. 1999), um sicherzustellen, dass initiale Wirkungen nicht verblassen (Richter 2005, S. 26; Thackrey 1987). Laufende Auffrischungskurse verursachen zwar finanzielle Kosten, welche jedoch den enormen persönlichen, emotionalen und finanziellen Belastungen, die ein schwerer körperlicher Übergriff verursachen kann, gegenübergestellt werden müssen (Farrell & Cubit 2005). 17 In den Niederlanden, in Skandinavien und Großbritannien wurden bereits Anfang der neunziger Jahre spezielle Trainingsprogramme implementiert (Needham et al. 2004), und auch in Deutschland sind sie mittlerweile weit verbreitet (Richter & Needham 2007; Steinert & Bergk 2008; te Wildt, Hauser & Kropp 2006). In Österreich lassen sich allmählich erste Initiativen beobachten. Exemplarisch zu nennen wären das Otto-Wagner-Spital (OWS) in Wien und die LSF in Graz, an denen Fortbildungen im Aggressionsmanagement entwickelt wurden und durchgeführt werden. Im Sinne eines umfassenden Aggressionsmanagements sollten Kombinationsprogramme, die sowohl körperliche Abwehr- und Interventionstechniken als auch Deeskalationstechniken vermitteln, Standard sein (te Wildt, Hauser & Kropp 2006), damit je nach Eskalationsstufe auf die erforderliche Technik zurückgegriffen werden kann (Richter & Needham 2007). Manche Situationen lassen sich nur durch den Einsatz von körperlichen Mitteln und Zwangsmaßnahmen bewältigen und nicht allein durch psychologische Maßnahmen entschärfen (Richter 2005, S. 28). Die Schulung einzelner Komponenten wäre aus diesem Grund insuffizient (Steinert & Bergk 2008). Neben Deeskalations- und Interventionstechniken sollten Trainingsprogramme eine breite Palette an weiteren Themen abdecken: juristische und ethische Aspekte, Ursachen für aggressives Verhalten, Vorhersage und Ablauf von Gewaltsituationen, Konfliktlösungstechniken, Selbstsicherheitstraining, Analyse nach einem Aggressionsereignis etc. (International Council of Nurses 1999, S. 163; Oud 2006, S. 202). Die vielfach empfohlenen Schulungen im Aggressionsmanagement zielen in erster Linie auf den Erwerb von Wissen, Zuversicht und Fertigkeiten (körperliche und kommunikative Handlungskompetenzen) für den Umgang mit aggressiven PatientInnen ab (Needham et al. 2004; Richter 2005, S. 8–9; Steinert & Bergk 2008). Die in den Schulungen vermittelten Techniken sollen Angst nehmen und Sicherheit geben im Kontakt mit aggressiven PatientInnen (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 46). Indirektes Ziel der Schulungen ist es, aggressive Ereignisse und Zwangsmaßnahmen zu reduzieren und physische und psychische Verletzungen zu verhindern (Needham et al. 2004; Richter 2005, S. 8–9). Die existierenden empirischen Studien über die Effekte von mitarbeiterInnenbezogenen Trainingsprogrammen im Aggressionsmanagement sind mit Ausnahme einer randomisierten kontrollierten Studie (RCT) eher niedriger methodologischer Qualität (Kontrollgruppen-Studien und Prä-Post-Vergleiche). Wissenschaftliche Untersuchungen wurden bisher 18 überwiegend in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien durchgeführt. Im deutschsprachigen Raum wurden nur sehr vereinzelt Ergebnisse publiziert (Richter 2005, S. 12). Eine systematische Literaturübersicht von Richter und Needham (2007) lässt zwei Aussagen über die Effektivität von Trainingsprogrammen zu: 1. Trainingsprogramme führen zu vermehrtem kognitivem Wissen über Aggression, Aggressionsmanagement und Gewalt und zu mehr subjektiver Zuversicht hinsichtlich der Bewältigung schwieriger Situationen. Dieses Ergebnis ist als relativ sicher einzustufen. Es wurde unabhängig vom Studiendesign, Setting (z. B. Akutpsychiatrie, Gerontopsychiatrie) und unabhängig von der Art des Trainings wiederholt repliziert. 2. Ob sich durch Trainingsprogramme die Anzahl aggressiver Vorfälle verbaler und physischer Art und deren Folgen wie Zwangsmaßnahmen, Verletzungen und Ausfalltage tatsächlich messbar mindern lassen, konnte nicht eindeutig festgestellt werden (Richter & Needham 2007). In der eingangs erwähnten RCT zeigte sich in der Interventionsgruppe – neben der subjektiven Zunahme von Wissen und Zuversicht – ein signifikanter Rückgang von schweren Aggressionsereignissen und Zwangsmaßnahmen (Needham et al. 2004). Dass in manchen Studien der Literaturübersicht von einem Anstieg an Aggressionsereignissen nach den Trainings berichtet wird, könnte darauf zurückzuführen sein, dass Trainings einen Sensibilisierungseffekt haben und bestimmte aggressive Ereignisse erst aufgrund der Wahrnehmungsveränderung als registrierfähig bewertet werden. Da im Hinblick auf das Wissen und die Zuversicht der MitarbeiterInnen positive Trainingseffekte erwartet werden können, haben derartige Schulungen in der Praxis durchaus ihre Berechtigung, auch wenn die Resultate bez. anderer Ergebniskriterien uneinheitlich sind. Für die zukünftige Forschung bedeutet dies, dass weitere (qualitativ hochwertige) Studien erforderlich sind, um auch belastbare Evidenzen über die Auswirkung von Trainingsprogrammen auf Häufigkeit und Schweregrad aggressiver Ereignisse zu erhalten (Richter & Needham 2007). 19 4.3.2 Aggressions- und Deeskalationsmanagement in der LSF Graz Im Rahmen eines Qualitätsmanagementprojektes wurde in der LSF Graz durch eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe ein aus zehn Modulen bestehendes kontextbezogenes und praxisorientiertes Schulungsangebot (insgesamt 108 Stunden) für das Aggressions- und Deeskalationsmanagement entwickelt und im Jahr 2007 erstmals angeboten. Die einzelnen Module der Seminarreihe „Gewalt – ADE5“ können aufeinanderfolgend, aber auch einzeln (mit Ausnahme von Modul 10, welches auf Modul 9 aufbaut) besucht werden. Abb. 2 verdeutlicht, wie vielfältig und umfangreich die Seminarreihe ist. In zwei Modulen geht es um gewaltfreie Kommunikation. Modul 5 ist auf Schutz- und Abwehrtechniken ausgerichtet. Die übrigen Module beschäftigen sich mit anderen relevanten Aspekten im Zusammenhang mit Aggression und Gewalt. Vorteil dieses modularen Aufbaus ist, dass die Module nach individuellem Bedarf ausgewählt werden können. Modul 1 – Ich bin es mir (selbst)wert – Empathie für meine Persönlichkeit Modul 2 – Empathische Kommunikation zur Konfliktprophylaxe Modul 3 – Empathische Kommunikation zur Deeskalation von drohenden Gewalt- und Konfliktsituationen Modul 4 – (Konflikt)Situationen wahrnehmen und richtig einschätzen Modul 5 – Strategien bei herausforderndem Patientenverhalten – Sicherheitstechniken Modul 6 – Rechtliche Grundlagen und Rechtsfragen bei fremdaggressivem Verhalten Modul 7 – Medizinische Behandlung und Pflege im Rahmen einer fremdaggressiven Notfallsituation Modul 8 – Psychiatrische Krankheitsbilder im Kontext von Gewalt gegen sich und andere Modul 9 – Stressbewältigung während und nach fremd- und autoaggressivem Verhalten Modul 10 – Nachbetreuung und Unterstützung nach Aggressionsereignissen Abb. 2: Module der Seminarreihe „Gewalt – ADE“ in der LSF Graz Zusätzlich zur Seminarreihe wird zweimal monatlich der Übungsworkshop „Strategien in fremdaggressiven Notfallsituationen“ angeboten. Außerdem sind in der LSF alle MitarbeiterInnen im Pflegedienst, die ihre Berufsausbildung in den letzten fünf Jahren abgeschlossen haben, zum Besuch eines fünftägigen Intensivkurses, der ein Querschnitt der genannten Seminarreihe ist, verpflichtet. Dies gilt ebenso für Pflegepersonen, die im Rahmen der Berufstätigkeit Gewalterlebnisse erfahren haben (Pflegedirektion LSF 2008). 5 Aggressions- und Deeskalationsmanagement 20 5 DAS AGGRESSIONS- UND GEWALTPOTENZIAL PSYCHIATRISCHER PATIENTINNEN In diesem Kapitel werden in Anlehnung an die ICD-10-Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einige Krankheitsbilder aus dem psychiatrischen Formenkreis kurz vorgestellt. Auf den ersten Blick ähneln sich viele Krankheitsbilder. Die Kenntnis der Krankheiten und der damit verbundenen Zustände ist hilfreich für das Verstehen des kranken Menschen und seines Verhaltens (Krainz 2004, S. 29) und Voraussetzung für die Vermeidung von Übergriffen und den angemessenen Umgang mit potenziell aggressiven PatientInnen (Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 10–11). Im Kapitel V der WHO-Klassifikation wird zwischen zehn Oberkategorien von psychischen und Verhaltenstörungen (F00 bis F99) differenziert. Die drei häufigsten psychiatrischen Diagnosen sind Störungen durch psychotrope Substanzen, affektive Störungen und Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis (Katschnig, Denk & Scherer 2004, S. 73–74). Der Anteil der stationär behandelten PatientInnen der Diagnosegruppen F5 bis F9 ist gering. Aus Abb. 3 ist das exakte Diagnosespektrum für alle Entlassungen aus psychiatrischen Krankenanstalten und Abteilungen Österreichs im Jahr 2002 ersichtlich. Abb. 3: Entlassungen aus psychiatrischen Betten mit psychiatrischen Haupt- und Nebendiagnosen im Jahr 2002 (Katschnig, Denk & Scherer 2004, S. 74) 21 5.1 Organische einschl. symptomatische psychische Störungen (F00 bis F09) Einer organisch bedingten psychischen Störung liegt eine direkte oder indirekte Hirnfunktionsstörung zugrunde. Ein Beispiel für eine solche Störung sind die verschiedenen Formen der Demenz, von der in Österreich etwa 90.000 v. a. betagte und hochbetagte Menschen betroffen sind. Demenz ist gekennzeichnet durch eine Beeinträchtigung des Gedächtnisses, des Denkens, der Merkfähigkeit, der Orientierung, der Auffassung, des Lernens, der Sprache und des Urteilsvermögens. Mit diesen kognitiven Beeinträchtigungen gehen zumeist emotionale Labilität, Reizbarkeit, Apathie und/oder eine Vergröberung des Sozialverhaltens einher. Im Verlauf der Erkrankung treten sehr häufig zusätzlich nichtkognitive psychiatrische Symptome auf (in den frühen Stadien Angst und Depression, später Wahnvorstellungen und Halluzinationen), welche für die Betroffenen, deren Angehörige und Betreuungspersonen ebenso stark belastend sein können wie demenzinduzierte Verhaltensstörungen (wie Ruhelosigkeit, zielloses Umherwandern, Schreien, Fluchen und Enthemmung) (Brosch 2004, S. 58–61; Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 186–193). Demenzielle Erkrankungen werden häufig von zumeist nicht ungefährlichen aggressiven und gewalttätigen Verhaltensweisen begleitet (Steinert 2001b). Delir ist ein akut auftretender und potenziell lebensbedrohlicher Verwirrtheitszustand, der eine stationäre Aufnahme und Überwachung erfordert, u. U. unter Anwendung des UbG. Innerhalb von fünf Tagen nach Aufnahme in ein Krankenhaus entwickeln 5 bis 32 Prozent älterer Menschen ein Delir, 10 bis 14 Prozent haben es bereits bei der Aufnahme. Leitsymptom ist die Bewusstseinsstörung. Hinzu kommen Gedächtnis-, Orientierungs- und Denkstörungen, Affektlabilität, Antriebssteigerung oder Antriebsarmut, motorische Unruhe, erhöhte Reizbarkeit, Aggressivität, ängstliche Verstimmung und Halluzinationen (Brosch 2004, S. 70–71; Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 204–207 & 212). 5.2 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10 bis F19) Psychische und Verhaltensstörungen durch den Konsum von auf die Psyche wirkenden Substanzen sind sehr vielfältig, ebenso deren Schweregrad und Erscheinungsbild (akute 22 Intoxikation, schädlicher Gebrauch, Abhängigkeitssyndrom, Entzugssyndrom, psychotische und andere Störungen). Mehrfachabhängigkeit ist weit verbreitet. In fast allen Fällen erstreckt sich der Konsum auf mehrere der folgenden Substanzarten: Alkohol, Opioide, Cannabinoide, Sedativa oder Hypnotika, Kokain und andere Stimulanzien einschl. Koffein, Halluzinogenen, Nikotin und flüchtigen Lösungsmitteln (Brosch 2004, S. 72–73; Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 295). Kommen Personen in einem Zustand schwerer Berauschung (über 2,5 Promille Blutalkoholgehalt) in eine Krankenanstalt, ist mit starker Erregung und impulsiven, wesensfremden Handlungen zu rechnen, an die später meist keine Erinnerung mehr besteht. Situative Desorientierung, situative Verkennung und motivlose Angst prägen das Bild. Die Auswirkungen einer mittelschweren Berauschung (ca. 1,5 bis 2,5 Promille) sind etwas geringer: z. B. deutliche Enthemmung, aggressive Gereiztheit und explosives, zielloses, risikobereites Verhalten (Brosch 2004, S. 77–78; Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 254). Treten bei einer im nüchternen Zustand friedvollen Person im Rausch persönlichkeitsfremde Züge wie verbale oder körperliche Aggression auf, wird von einem pathologischen Rausch gesprochen (Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 254). Bei chronischem Gebrauch der meisten der oben angeführten psychotropen Substanzen tritt durch Abstinenz eine Vielzahl an mehr oder weniger bedrohlichen körperlichen und psychischen Entzugserscheinungen auf. Erhöhte Reizbarkeit, Angst und Aggressivität sind typisch beim Entzug von Alkohol, Analgetika, Opioiden, Cannabis, Kokain und Crack. Andere häufig vorkommende Entzugserscheinungen sind Unruhezustände, Erregung, Schlaflosigkeit, Krämpfe, Suchtdruck, Halluzinationen und Wahnvorstellungen (Brosch 2004, S. 79–86). 5.3 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen (F20 bis 29) Das bedeutsamste Krankheitsbild dieser Subkategorie ist die Schizophrenie. Schizophrenie, insbesondere die paranoide Schizophrenie, ist mit einer Lebenszeitprävalenz von etwa einem Prozent eine häufig auftretende psychische Krankheit (Brosch 2004, S. 86–87; Krainz 2004, S. 29; Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 304–305). Charakteristisch für schizophrene Störungen sind die Denk- und Wahrnehmungsstörung sowie inadäquate und verflachte Affekte. Zu den Symptomen einer schizophrenen Störung gehören: Gedanken23 eingebung6, Gedankenentzug7, Gedankenausbreitung8 und Gedankenlauterwerden9, Wahnwahrnehmungen, Kontroll- und Beeinflussungswahn, Stimmenhören und andere anhaltende Halluzinationen sowie katatone Symptome (wie Negativismus und körperliche Erstarrung oder Erregung) (Brosch 2004, S. 90–93; Krainz 2004, S. 29–33; Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 312–313). Die genannten Symptome können aggressives Verhalten auslösen oder verstärken (Bärsch & Rohde 2008, S. 99). Fremdaggressive Verhaltensweisen zumeist leichter Art kommen bei schizophrenen PatientInnen sehr häufig vor (Steinert, Wiebe & Gebhardt 1999), sie gehen allerdings unter neuroleptischer Behandlung meist schnell zurück (Steinert 2001b). 5.4 Affektive Störungen (F30 bis F39) Zu den affektiven Störungen zählen manische Episoden, depressive Episoden, rezidivierende depressive Störungen, die bipolare affektive Störung und anhaltende affektive Störungen. Im höheren Alter ist die rezidivierende depressive Störung, welche durch wiederholte depressive Episoden gekennzeichnet ist, die häufigste psychiatrische Erkrankung. Ihre Lebenszeitprävalenz beträgt zwischen 12 und 17 Prozent – in Verbindung mit schweren körperlichen Erkrankungen oder anderen psychischen Krankheiten sogar bis zu 50 Prozent. Allen affektiven Störungen gemeinsam ist die Veränderung der Stimmungslage und der Affektivität und die dadurch bedingte Veränderung des allgemeinen Aktivitätsniveaus (Brosch 2004, S. 96–98). Hervorstechende Merkmale der sehr selten auftretenden manischen Episode sind die anhaltend gehobene Stimmungslage und die Selbstüberschätzung sowie die teilweise extreme Steigerung von Erregung, Antrieb und körperlicher Aktivität. Oft sind die Betroffenen übermäßig gesellig, gesprächig und leistungsbereit und verlieren normale soziale Hemmungen. Hinzu kommen (Größen-)Wahn und Halluzinationen. Im Extremfall ist die Erregung so ausgeprägt, dass eine normale Kommunikation nicht mehr möglich ist. Die Eigenund Fremdgefährdung bei manischen Zuständen resultiert aus der Unterschätzung möglicher Gefahren und der abnorm gesteigerten Entschlussfreudigkeit (Brosch 2004, S. 101–102; Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 358–360). Manische PatientInnen sind 6 Gefühl, dass die Gedanken von außen gesteuert werden (Brosch 2004, S. 34) Gefühl, dass die Gedanken von außen weggenommen werden (Brosch 2004, S. 34) 8 Überzeugung, dass andere die eigenen unausgesprochenen Gedanken kennen (Brosch 2004, S. 34) 9 Empfindung, dass andere die eigenen Gedanken hören können (Brosch 2004, S. 34) 7 24 leicht reizbar und brauchen deshalb viel Geduld und Fingerspitzengefühl. Zu beachten ist, dass selbst eine alltägliche Handlung, eine Grenzsetzung oder Einbremsung der Antriebssteigerung durch andere Personen als Provokation empfunden werden kann und aggressives Verhalten auslösen kann. Die Schwierigkeit im Umgang mit diesen PatientInnen liegt darin, das richtige Maß zwischen Zugeständnissen und Grenzsetzungen zu finden. Manische Personen wirken zwar bedrohlich, allerdings gehen von ihnen nur selten wirklich gefährliche Gewalthandlungen aus (Steinert 2008, S. 51–53). Depressive Episoden und Störungen machen zwei Drittel aller affektiven Störungen aus. Eine depressive Episode wird je nach Anzahl und Schweregrad der Symptome als leicht, mittelgradig oder schwer eingestuft. Eine leichte depressive Episode bedeutet für die Betroffenen zwar eine Beeinträchtigung, jedoch können Alltagsaktivitäten zumeist weiterhin ausgeführt werden. Bei einer schweren depressiven Episode können Halluzinationen, depressive Wahnvorstellungen und Stupor (hochgradige Teilnahmslosigkeit) so stark sein, dass alltägliche Aktivitäten (wie auch die Nahrungsaufnahme) nicht mehr möglich sind und Lebensgefahr besteht. Die Liste potenzieller Symptome depressiver Episoden ist lang. Als Hauptsymptome sind zu nennen: leicht gesenkte Stimmung bis tiefe Traurigkeit, Interessen- und Freudeverlust, verminderter Antrieb und verminderte Aktivität. Eine Fremdgefährdung ist bei depressiven Verstimmungen am ehesten durch erweiterten Suizid gegeben. An die zehn Prozent der Betroffenen suizidieren sich (Brosch 2004, S. 98–101; Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 332–341). Problematisch in Bezug auf die Compliance und die Mortalität ist insbesondere die Komorbidität mit Alkohol- und Substanzabhängigkeit oder mit Persönlichkeitsstörungen (Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 337). Bei einer bipolaren affektiven Störung (knapp 30 Prozent aller affektiven Störungen) wechseln sich manische oder hypomanische Episoden10 mit depressiven Episoden ab. Auch wiederholte manische oder hypomanische Episoden sind als bipolare affektive Störung zu klassifizieren. Knapp 20 Prozent der PatientInnen sterben durch Suizid (Krainz 2004, S. 37–39; Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 356–359). 10 Unter Hypomanie ist eine abgeschwächte Form der Manie zu verstehen (Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 358). 25 5.5 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F40 bis F48) In diese Kategorie fallen neben phobischen Störungen (Agoraphobie, soziale Phobie, spezifische Phobien etc.) auch andere Angststörungen (Panikstörung, generalisierte Angststörung etc.), Zwangsstörungen, Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen, dissoziative Störungen und somatoforme Störungen. Die Lebenszeitprävalenz aller Angststörungen liegt je nach Literatur bei 15 bis 21 Prozent und somit zählen Angsterkrankungen (allen voran die spezifische und die soziale Phobie) neben unipolaren affektiven Störungen und der Substanzabhängigkeit zu den häufigsten psychischen Störungen (Brosch 2004, S. 102–104; Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 372). PatientInnen mit einer phobischen Störung leiden an einer irrationalen Angst, die durch eindeutig definierte und objektiv betrachtet ungefährliche Situationen oder Objekte hervorgerufen wird. Die Angst äußert sich z. B. in Herzklopfen, Zittern, Atemnot, Übelkeit und innerer Unruhe und kann mit Sterbensängsten oder dem Gefühl, wahnsinnig zu werden, einhergehen. Die Angst vor der Angst veranlasst die Betroffenen zu Vermeidungsverhalten und schränkt somit die Lebensführung entscheidend ein. In Verbindung mit einer phobischen Störung sind zwanghafte und depressive Symptome sowie Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit nicht ungewöhnlich (Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 375–378). Andere Angststörungen sind nicht konkret auf eine Situation oder ein Objekt bezogen: Bei einer Panikstörung treten die Angstanfälle plötzlich, unerwartet und ohne erkennbare Gefahr auf, bei einer generalisierten Angststörung ist das Angstniveau anhaltend erhöht (ohne Paniksymptome) (Brosch 2004, S. 103–104). Zwangsstörungen stellen mit einer Lebenszeitprävalenz von 2,5 Prozent die vierthäufigste psychiatrische Krankheit dar und können sich in Zwangshandlungen und/oder Zwangsvorstellungen ausdrücken. PatientInnen mit Zwangsstörungen haben meist permanent Angst, welche sich bei Unterlassung der Zwangshandlung ins Extreme steigert (Brosch 2004, S. 104–105; Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 366–368). 26 5.6 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (F50 bis F59) Zu den Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren zählen Essstörungen, nichtorganische Schlafstörungen, nichtorganische sexuelle Funktionsstörungen, Störungen im Wochenbett und der Missbrauch von nicht abhängigkeitserzeugenden Substanzen. In den industrialisierten Ländern gehören Schlafstörungen zu den häufigsten psychischen Störungen (Lebenszeitprävalenz von 25 Prozent). Kaum eine psychiatrische Erkrankung verläuft ohne das Symptom Schlafstörung (Brosch 2004, S. 111–114). 5.7 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F60 bis F69) Persönlichkeitsstörungen sind klinisch sehr bedeutsame, meist länger andauernde Krankheitsbilder. Zumeist beginnt die Störung in der Kindheit oder Adoleszenz und bleibt auch während des Erwachsenenalters bestehen. Kennzeichnendes Merkmal ist die deutliche Abweichung im Wahrnehmen, Auffassen, Interpretieren, Denken, Fühlen und sozialen Verhalten von kulturell erwarteten und akzeptierten Normen (Brosch 2004, S. 115–119). Menschen mit Persönlichkeitsstörungen sind zwar für ihre Umgebung meist eine schwere Belastung, allerdings zeigen nicht alle ein vermehrt aggressives Verhalten: Eine Neigung zu Straftaten (einschl. Gewalttaten) haben Borderline-Persönlichkeiten. Auch bei dissozialen, aggressiven, überempfindlichen und misstrauischen Persönlichkeiten ist das Risiko für Aggression und Gewalt(kriminalität) deutlich erhöht (Krainz 2004, S. 44–50). Neben Persönlichkeitsstörungen gehören in diese Kategorie abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle (pathologisches Spielen, Pyromanie, Kleptomanie, Trichotillomanie), Störungen der Sexualpräferenz (Exhibitionismus, Pädophilie, Voyeurismus) sowie Störungen der Geschlechtsidentität (wie Transsexualismus, Transvestitismus) (Brosch 2004, S. 120–122; Rothenhäusler & Täschner 2007, S. 454–461). 5.8 Intelligenzstörung (F70 bis F79) Die Intelligenzminderung ist die am häufigsten vorkommende psychische Störung im Kindes- und Jugendalter (Brosch 2004, S. 123). Abhängig vom Schweregrad ist eine Intelligenzminderung als leicht, mittelgradig, schwer oder schwerst zu klassifizieren. Hauptkomponenten sind niedrige kognitive Fähigkeiten und eine verminderte soziale Kompetenz. 27 Die Intelligenzminderung ist gekennzeichnet durch eine unvollständige oder (leicht bis erheblich) verzögerte sprachliche und motorische Entwicklung (Brosch 2004, S. 38–39). Eine aggressive Verhaltensproblematik ist bei dieser PatientInnengruppe nicht selten (Steinert 2001b). 5.9 Empfehlungen für den Umgang mit ausgewählten PatientInnengruppen Mit psychiatrischen Erkrankungen gehen häufig aggressive Verhaltensweisen einher. Nachfolgend werden Empfehlungen für den Umgang mit dementen, substanzabhängigen und schizophrenen PatientInnen und PatientInnen mit einer Intelligenzminderung abgegeben. 5.9.1 Demenz Demente Personen sind oft desorientiert und können dann selbst alltägliche Dinge des Lebens nicht verstehen. So kann bereits die Aufforderung zur Körperhygiene einen Gereiztheitszustand auslösen; eine unangekündigte Pflegeaktivität provoziert einen körperlichen Angriff geradezu. Deshalb ist es hilfreich, Demenzkranken langsam und mit einfachen Worten die Situation begreiflich zu machen und zu erklären, was man von ihnen möchte. Die Betroffenen sollten nicht bedrängt werden, v. a. dann nicht, wenn Unwille oder Widerstand erkennbar ist. Besser ist es, einer desorientierten Person Zeit zu lassen und z. B. die Körperpflege zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Person wieder friedlicher und orientierter ist, erneut zu probieren (Steinert 2008, S. 44–45). 5.9.2 Alkohol- und Drogenabhängigkeit (Intoxikation) Die meisten Menschen reagieren auf Alkoholkonsum nicht fremd- oder autoaggressiv. Anders verhält es sich bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen und Menschen, die regelmäßigem Alkohol konsumieren. Bei ihnen ist aggressives Verhalten häufig zu beobachten. Auch manche Drogen, wie Kokain oder Amphetamine, haben eine offensichtlich aggressionssteigernde Wirkung. Manche PatientInnen müssen bereits kurz nach dem Eintreffen in der psychiatrischen Klinik fixiert werden, weil sie sehr bedrohlich auftreten und um sich schlagen. Im stimmungsgeladenen Zustand sind Personen äußerst gefährlich, weil sie unberechenbar und schwer steuerbar sind. Fallweise lassen sich solche Situationen rasch 28 entspannen, wenn es einem Teammitglied gelingt, einen guten Draht zur aggressiven Person herzustellen. Andernfalls ist es ratsam, vorerst die einliefernden PolizeibeamtInnen auf der Station zu behalten bis die weiteren Vorgehensweisen bzw. Sicherungsmaßnahmen geklärt sind (Steinert 2008, S. 46–47). 5.9.3 Paranoide Schizophrenie Einen zentralen Stellenwert bei schweren psychopathologischen Störungen hat die prophylaktische, frühzeitig beginnende, richtig dosierte und überwachte Verabreichung von psychopharmakologischen Medikamenten – erst an zweiter Stelle kommt die Gestaltung der Beziehung zu den Betroffenen. Bei schizophrenen PatientInnen kann schon der normale Tagesablauf aggressive Verhaltensweisen auslösen. Angezeigt ist daher auch eine verstärkte Aufmerksamkeit des Personals (Steinert 2008, S. 47–50). 5.9.4 Leichte geistige Behinderung Menschen mit einer leichten geistigen Einschränkung möchten einerseits selbständig leben wie andere auch, andererseits sind sie in vielen Dingen überfordert und zum Scheitern (vor)verurteilt. Durch die intellektuelle Einschränkung stoßen sie oft an ihre Grenzen. Eine Überforderung sollte durch einfache und widerspruchsfreie Sätze und Anforderungen vermieden werden. Von Bedeutung ist das Aufbauen einer Vertrauensbeziehung, damit die Betroffenen das Gefühl haben, dass das Personal sie unterstützt und ihnen helfen möchte. Unter solchen Voraussetzungen ist es oftmals möglich, in einer angespannten Situation überraschend schnell eine Lösung zu finden (Steinert 2008, S. 55–56). 29 6 DIE BEGRIFFE AGGRESSION UND GEWALT Es existiert eine Vielzahl an Definitionen zu den Begriffen Aggression und Gewalt. Eine exakte wissenschaftliche Definition, die universell und für alle Fachbereiche gültig ist, gibt es nicht. Jedes Individuum hat eine eigene Vorstellung von Aggression und Gewalt (Bärsch & Rohde 2008, S. 5; Weltgesundheitsorganisation 2003, S. 5). Umgangssprachlich werden die beiden Begrifflichkeiten nahezu synonym verwendet (Steinert & Bergk 2008; Schanz & Klawe 2005). In der beruflichen Praxis ist die richtige Verwendung der Begriffe unverzichtbar. 6.1 Definitionen von Aggression Aggressives Verhalten ist ein Bestandteil des menschlichen Verhaltens. Es tritt in jedem sozialen Kontext auf und kann nicht reduziert werden auf den Bereich der (psychiatrischen) Pflege (Kienzle & Paul-Ettlinger 2001, S. 51). Es wird als normal und unproblematisch angesehen, wenn es sich in Art, Intensität, Dauer, Häufigkeit und Gefährlichkeit innerhalb sozial akzeptabler Grenzen bewegt (Heinrich 1989, S. 13 & 16–17). Petermann (1984, cited in Heinrich 1989, S. 18) definiert Aggression als … ein beobachtbares Verhalten, dessen Qualität und/oder Intensität und/oder Häufigkeit den eigenen Körper oder den anderer Personen, die dingliche oder soziale Umwelt schädigt, erheblich beeinträchtigt oder stört. Die Beeinträchtigung, Schädigung oder Störung ist Ziel und/oder Wirkung dieses Verhaltens. Für Ruthemann (1993, cited in Hartdegen 1996, S. 12) liegt aggressives Verhalten nur dann vor, wenn „eine Person absichtlich etwas macht oder unterläßt, um eine psychische oder physische Beeinträchtigung einer anderen Person herbeizuführen ...“ Auch wenn dies in den meisten Fällen so sein mag, muss nicht hinter jeder menschlichen Aggression zwingend eine Schädigungsabsicht stecken. Ein Beweis dafür ist aggressives Verhalten von Geisteskranken oder Kleinkindern (Selg, Mees & Berg 1997, S. 5). Bei Wut, Ärger, Zorn und Hass handelt es sich um sogenannte aggressionsaffine Emotionen, die häufig im Zusammenhang mit Aggression auftreten, aber auch ohne Aggression vorkommen können (Selg, Mees & Berg 1997, S. 9) und nicht zwingend zu aggressivem Verhalten führen müssen (Ruthemann 1993, cited in Hartdegen 1996, S. 12). 30 Aggressives Verhalten tritt in verschiedenen Formen in Erscheinung. Die verbale Form der Aggression in Form von Beschimpfungen, Beleidigungen, Drohungen, Brüllen, Fluchen oder böswilliger Kritik ist im stationären Alltag häufiger anzutreffen als die nonverbale, körperliche (Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 9). Sie wird mitunter gezielt und subtil eingesetzt, um andere zu verletzen und Macht auszudrücken (Hartdegen 1996, S. 167–168). Teilweise wird sie als schmerzhafter und belastender empfunden als körperliche Aggression. Körperliche Aggression kann gegen Gegenstände, die eigene Person oder andere Personen gerichtet sein. Körperliche Aggression gegen Pflegende äußert sich z. B. durch Drohgebärden, Spucken, Schubsen, Treten, Schlagen, Beißen, Zwicken, Kratzen oder Ziehen an den Haaren (Grond 2007, S. 32). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Aggression ein beobachtbares Verhalten ist, das in den meisten Fällen auf die Störung, (Be-)Schädigung oder Verletzung einer Person oder einer Sache abzielt. Die Bereitschaft eines Individuums zur Aggression wird als Aggressivität bezeichnet (Pschyrembel Pflege 2007, S. 9). 6.2 Definitionen von Gewalt Vom Begriff der Aggression ist jener der Gewalt zu unterscheiden: Es wird immer dann von Gewalt gesprochen, wenn eine Person … vorübergehend oder dauerhaft daran gehindert wird, ihrem Wunsch oder ihren Bedürfnissen entsprechend zu leben. Gewalt heißt also, daß ein ausgesprochenes oder unausgesprochenes Bedürfnis einer Person mißachtet wird. Dieses Vereiteln einer Lebensmöglichkeit kann durch eine Person verursacht sein (personale Gewalt) oder von institutionellen oder gesellschaftlichen Strukturen ausgehen (strukturelle Gewalt). Bei der personalen Gewalt erscheint darüber hinaus die Unterscheidung wichtig zwischen aktiver Gewaltanwendung im Sinne der Mißhandlung, und passiver Gewaltanwendung im Sinne der Vernachlässigung (Ruthemann 1993, cited in Hartdegen 1996, S. 13). Gewalt ist demnach ein aktives oder passives Vorgehen gegen den Willen und das Einverständnis eines Individuums. Sie sollte immer aus Sicht der geschädigten Person definiert werden. Sehr umfassend wird Gewalt von der WHO definiert: Der absichtliche Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichem Zwang oder physischer Macht gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, der entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt (WHO Global Consultation on Violence and Health 1996, cited in Weltgesundheitsorganisation 2003, S. 6). 31 Eine eigene Definition hat die WHO für Gewalt am Arbeitsplatz: Incidents where staff are abused, threatened or assaulted in circumstances related to their work, including commuting to and from work, involving an explicit or implicit challenge to their safety, well-being or health (Adapted from European Commission) (International Labour Office et al. 2002, S. 3). Schneider (2005, cited in Grond 2007, S. 31–32) differenziert zwischen physischer Gewalt (wie beißen, kratzen, zwicken, schlagen, treten, bespucken, an den Haaren ziehen und mit Gegenständen bewerfen), psychischer (emotionaler) Gewalt (wie beleidigen, beschimpfen, beschuldigen, Vorwürfe machen, Streit suchen, Gerüchte verbreiten, absichtlich einnässen, durch wiederholtes Klingeln ärgern, ständig schreien) und sexueller Gewalt (verbale Belästigung, Belästigung durch Gestik, körperliche Übergriffe) gegen Pflegende. 6.3 Abgrenzung der Begriffe Aggression und Gewalt Jede Aggression ist gleichzeitig auch Gewalt, weil durch aggressive Verhaltensweisen immer das menschliche Bedürfnis nach Unversehrtheit übergangen wird. Hingegen muss eine Gewaltanwendung nicht zwingend etwas mit Aggression zu tun haben. So stellt etwa die Anwendung legitimierter Gewalt für sich keine Aggression dar, weil sie im Interesse der PatientInnen erfolgt (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 15–16). 32 7 ASPEKTE VON AGGRESSION UND GEWALT IN DER PSYCHIATRISCHEN GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGE In diesem Kapitel werden verschiedene Aspekte von Aggression und Gewalt, wie deren Entstehung, Häufigkeit und Folgen, näher beleuchtet. 7.1 Die Arbeit mit potenziell aggressiven Menschen In der psychiatrischen Versorgung arbeiten Pflegende mit psychisch kranken Menschen. Diese Arbeit ist belastend, anstrengend und birgt ein gewisses Risiko in sich (Steinert 2008, S. 11–12). Immer wieder haben psychiatrisch Pflegende mit Aggression und Gewaltausbrüchen zu tun, die sich in Form von Beschimpfungen und Bedrohungen bis hin zu körperlichen Attacken und sexuellen Übergriffen äußern können (Richter & Berger 2001a; Steinert 2008, S. 9–10). Von über 700 befragten psychiatrisch Pflegenden aus der Schweiz berichteten 72 Prozent, dass sie im Laufe des Berufslebens mindestens einmal von PatientInnen ernsthaft bedroht worden sind, und 70 Prozent, dass sie bereits einen tätlichen Übergriff erlebt haben. Ein Viertel (die Hälfte) der Befragten gab an, täglich (wöchentlich) mit aggressivem Verhalten konfrontiert zu werden (Abderhalden et al. 2002). Eine Erhebung in den Krankenanstalten der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft ergab, dass mehr als drei Viertel aller psychiatrischen und nichtpsychiatrischen Pflegekräfte Aggressions- und Gewalterfahrungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit gemacht haben (Mattitsch 2006, S. 29). Um Aggression und Gewalt seitens der PatientInnen zu vermeiden oder zu unterbinden, müssen die betreuenden Personen z. T. selbst Gewalt und Zwang ausüben (Finzel et al. 2003; Schanz & Klawe 2005). Die äußerst schwierige Aufgabe für in der Psychiatrie Beschäftigte ist es, ein möglichst gewaltfreies Behandlungsmilieu aufzubauen und den Teufelskreis von Gewalt und institutioneller Gegengewalt so weit wie möglich zu vermeiden (Nijman et al. 1999; Steinert 2008, S. 12–13). Völlig verhindern lassen sich aggressive Verhaltensweisen und gewaltsame Gegenreaktionen nicht (Richter & Berger 2001a; Ringbeck 1998, S. 39). Eine gänzlich aggressions- und gewaltfreie Psychiatrie ist eine Utopie (Rhode 2008; Schanz 2004). 33 Bei jeder Gewaltanwendung ergibt sich das oft unlösbare psychiatrische Grundproblem, die Balance zu finden zwischen berechtigten Freiheitsansprüchen und der Autonomie eines Menschen einerseits (Selbstbestimmung) und der berechtigten Fürsorge und dem Schutz vor Eigen- und Fremdgefährdung andererseits (Fremdbestimmung) (Arolt, Reimer & Dilling 2007, S. 394; Asani, Eißmann & Danyluk 2007; Schanz & Klawe 2005; Steinert 2002a). Solche ethischen Konflikte lassen sich vermeiden, wenn es gelingt, PatientInnen zu überzeugen: Ehe freiheitsbeschränkende Maßnahmen und unter Zwang durchgeführte ärztliche Behandlungen erfolgen, sollte immer versucht werden, durch Überzeugungs- und Überredungsversuche das Einverständnis für eine Maßnahme zu bekommen (Arolt, Reimer & Dilling 2007, S. 395; Steinert & Bergk 2008). 7.2 PatientInnenbezogene Prädiktoren von Aggression und Gewalt in psychiatrischen Kliniken Weltweit hat sich gezeigt, dass im nichtinstitutionellen Setting von Männern mehr Gewalt ausgeht als von Frauen und dass Gewalt ein Phänomen der Jugend und des jungen Erwachsenenalters ist. Des Weiteren zeigen epidemiologische Studien übereinstimmend, dass auch viele psychische Erkrankungen ein im Durchschnitt leicht erhöhtes Risiko für Gewalttaten in sich bergen. Das Risiko ist vergleichbar mit dem anderer Risikogruppen wie gesunden jungen Männern (Angermeyer, Cooper & Link 1998; Steinert & Bergk 2008). Am ausgeprägtesten erhöht ist das Risiko für krankheitsassoziiertes aggressives und gewalttätiges Verhalten in der Gesellschaft bei substanzabhängigen Personen (v. a. bei Alkoholabhängigen), gefolgt von Personen mit schizophrenen Erkrankungen, affektiven Störungen und Intelligenzminderung. Eine Doppeldiagnose begünstigt das Gefahrenpotenzial noch zusätzlich (Steinert 2001b). Diese Aussagen treffen auf PatientInnen in psychiatrischen Einrichtungen nicht zu. Eine Assoziation zwischen gewalttätigem Verhalten während der Hospitalisierung und den PatientInnenmerkmalen Geschlecht, Alter und Diagnose wurde bisher nicht konsistent belegt (Steinert 2008, S. 22–23; Steinert & Bergk 2008), allerdings unterscheiden sich die bisherigen Studien über Prädiktoren und Risikofaktoren hinsichtlich Stichprobe, Setting, Gewaltdefinition und Beobachtungszeitraum wesentlich voneinander. Die widersprüchlichen Ergebnisse dürften in erster Linie die Folge unterschiedlicher Stichproben sein. Zu bedenken ist, dass es sich bei Gewalt um ein äußerst komplexes Phänomen handelt, das bez. Ur34 sache, Prädiktoren, Form, Häufigkeit, Schweregrad und Auswirkung je nach untersuchter Personengruppe sehr unterschiedlich sein kann (Steinert 2002b, 2002c; Steinert, Wölfle & Gebhardt 2000). Als bester und robustester Prädiktor für Aggression und Gewalt in der psychiatrischen Klinik erwiesen sich über zahlreiche Studien hinweg aggressive und gewaltsame Verhaltensweisen in der unmittelbaren Vorgeschichte oder in der Vergangenheit (Delaney et al. 2001; Richter & Berger 2001a; Steinert 2002c; Steinert & Bergk 2008). Da eine Aggressionsvorgeschichte den größten prognostischen Wert hat (Odds Ratio = 7,4), sind bei Personen, die in ihrer Vergangenheit bereits durch aggressive oder gewalttätige Aktionen aufgefallen sind, besondere Fürsorge und Wachsamkeit angebracht (Rüesch, Miserez & Hell 2003). Gesichert ist auch, dass Aggression und Gewalt während des stationären Aufenthalts eng mit der Schwere und Ausprägung der psychopathologischen Symptomatik korrelieren: Wiederholt mit Aggression und Gewalt assoziiert wurden feindseliges und agitiertes Verhalten sowie formale Denkstörungen – weitere empirisch gesicherte Aussagen über klinische Risikovariablen lässt die bisherige Datenlage nicht zu (Steinert 2002b, 2002c; Steinert & Bergk 2008). Auch bei bereits mehrfach und/oder unfreiwillig hospitalisierten PatientInnen sind Übergriffe wahrscheinlich (Delaney et al. 2001; Ketelsen et al. 2007; Rüesch, Miserez & Hell 2003; Steinert, Wölfle & Gebhardt 2000). 7.3 Faktoren im Zusammenhang mit der Entstehung von Aggression und Gewalt im institutionellen Setting Aggression im stationären Bereich ist auf ein multifaktorielles Geflecht zurückzuführen und darf keinesfalls nur der Individualpsychopathologie angelastet werden. Mehrere Variablen interagieren miteinander und beeinflussen so die Aggressionsentstehung und den Aggressionslevel: PatientInnencharakteristika sind ein Faktor – einer neben anderen (Nijman et al. 1999; Richter 1998, S. 123; Ringbeck 1998, S. 37; Schanz & Klawe 2005). Ein weiterer ausschlaggebender Faktor sind die Merkmale der MitarbeiterInnen (personelle Faktoren wie Alter und Berufserfahrung) (Bärsch & Rohde 2008, S. 119). Jüngere (berufsunerfahrenere) MitarbeiterInnen sind überproportional an aggressiven und gewaltsamen Auseinandersetzungen beteiligt. In vielen Fällen ist von inadäquaten Verhaltenswei35 sen und Reaktionen der beteiligten Pflegenden auszugehen (Richter 1998, S. 115; Richter & Berger 2001b; Ringbeck 1998, S. 34). Mit zunehmender Berufserfahrung verbessert sich die Fähigkeit, eine potenzielle Gefährdung wahrzunehmen und intuitiv richtig zu reagieren. Auch Umgebungsfaktoren (Situationsmerkmale wie Uhrzeit und Stationsmerkmale wie Stationsstruktur, Stationsgröße, Stationsklima, qualitative und quantitative Personalausstattung, Architektur und Einrichtung) haben einen Einfluss auf Häufigkeit und Schweregrad aggressiver Vorkommnisse. Ebenso spielt die Interaktion zwischen PatientInnen und Pflegepersonal (interpersonelle Faktoren) eine bedeutende Rolle bei der Entstehung von Aggression und Gewalt in psychiatrischen Einrichtungen (Bärsch & Rohde 2008, S. 113–118; Richter 1998, S. 119; Richter & Berger 2001b; Steinert 2002b; Steinert & Bergk 2008). 7.4 Eskalation der Gewalt Unvorhergesehene Impulsreaktionen psychisch Kranker sind ausgesprochen selten (Steinert & Bergk 2008; Whittington & Patterson 1996), ebenso gezielt geplante aggressive Handlungen (eine Ausnahme stellt die forensische Psychiatrie dar) (Steinert 2008, S. 25–27). Aggression und Gewalt gegen das Personal treten in der Psychiatrie insbesondere im Zusammenhang mit eskalierenden Konflikten im normalen Stationsalltag (Essensund Schlafenszeiten, Medikamenteneinnahme, Hygiene, Ausgang, Umsetzung von Regeln und Anordnungen) sowie im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen auf (Steinert 2008, S. 63–66; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 14–15). In mehr als 50 Prozent der Fälle sind Pflegeaktivitäten der Anlass für Übergriffe, gefolgt von der Verweigerung eines Wunsches (25 Prozent). Seltener sind Übergriffe wegen der Verweigerung einer Entlassung oder des Verweises auf Stationsregeln (Richter & Berger 2001b). Wie die umseitige Abb. zeigt, verläuft eine Eskalation in mehreren Stadien von Gereiztheit über verbale Gewalt bis zur Tätlichkeit. Körperliche Gewalt ist faktisch das Ende eines interaktiven Prozesses, auf den Pflegende Einfluss nehmen können (Delaney et al. 2001; Steinert 2008, S. 62–63; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 19). 36 erhöhte Reizbarkeit und ärgerliche Bemerkungen allmählich verbale Bedrohung, einhergehend mit zunehmender Erregung, motorischer Unruhe und lauterer Stimme tätliche Gewalt Abb. 4: Phasen der Gewalteskalation Reagieren PatientInnen z. B. auf eine pflegerische Handlung aggressiv, sollten Pflegende – um die PatientInnen zu beruhigen – klar und deutlich, aber dennoch freundlich und sachlich erklären, warum die Handlung notwendig ist und dass diese keine Böswilligkeit darstellt. Aggressives Verhalten zu übergehen (z. B. wortlos die pflegerische Tätigkeit fortsetzen), ohne auf das negative Verhalten hinzuweisen, kann eine Aggressionssteigerung bewirken und eine Eskalation begünstigen. Durch etwaiges Schweigen wird den PatientInnen signalisiert, dass ihr Verhalten akzeptiert oder nicht ernst genommen wird. Richtet sich aggressives Verhalten nur gegen eine bestimmte Pflegeperson, ist es sinnvoll, dass eine andere Person die pflegerische Handlung vornimmt bzw. übernimmt (Kienzle & PaulEttlinger 2001, S. 35–38). Pflegende müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass sie durch ihr Verhalten zu einer Eskalation (aber auch zur Deeskalation) beitragen können. Eine gute Ausbildung, Weiterbildung und Erfahrung befähigen sie, Risikosituationen, Frühwarnzeichen und (latente) Aggression bei PatientInnen frühzeitig zu erkennen und frühzeitig zu deeskalieren (Bärsch & Rohde 2008, S. 121). Das frühzeitige Erkennen und Abschwächen von Konfliktsituationen spielt eine zentrale Rolle im professionellen Umgang mit Aggression und Gewalt (Steinert 2008, S. 12–13). 7.5 Häufigkeit aggressiver Ereignisse in psychiatrischen Einrichtungen Die Häufigkeitsangaben bez. Aggressions- und Gewaltereignisse divergieren aufgrund unterschiedlicher Definitionen, Settings, Einschlusskriterien und Erhebungsmethodik in den jeweiligen Studien (Abderhalden et al. 2007; Richter 1998, S. 114; Steinert & Bergk 2008). Auch das Meldeverhalten beeinflusst die Häufigkeitsraten (Delaney et al. 2001; Irwin 2006; Zeh et al. 2009): Abderhalden et al. (2007) konnten aufzeigen, dass ein be- 37 trächtlicher Anteil leichter Aggressionsereignisse nicht gemeldet wird (Underreporting). Schätzungsweise dürften 30 Prozent dieser Ereignisse unerfasst bleiben. Aggressives Verhalten (verbale, körperliche und sachbezogene Aggression) dürfte im deutschsprachigen Raum bei etwa sieben bis acht Prozent aller PatientInnen psychiatrischer Kliniken vorkommen (Ketelsen et al. 2007; Rüesch, Miserez & Hell 2003; Steinert & Bergk 2008). Tätlich aggressives Verhalten gegen Personen zeigen etwa zwei Prozent der stationären PatientInnen, wie mehrere repräsentative Studien in Deutschland und der Schweiz belegen (Richter & Berger 2001b; Spießl 1998, cited in Richter & Berger 2001b; Steinert & Bergk 2008). Bemerkenswert ist, dass wenige aggressive PatientInnen für den Großteil aller aggressiven Ereignisse verantwortlich sind (Heinze, Gaatz & Dassen 2005; Ketelsen et al. 2007; Needham et al. 2004; Rüesch, Miserez & Hell 2003). Über das genaue Ausmaß von Aggression und Gewalt in den psychiatrischen Einrichtungen Österreichs liegen keine umfassenden Studiendaten vor. Angezeigt wäre die Durchführung einer systematischen Prävalenzerhebung, auf deren Basis über die Entwicklung und Implementierung von Interventions- und Präventionsmaßnahmen entschieden werden kann (Zeh et al. 2009). 7.6 Folgen von Aggression und Gewalt gegen Pflegende Aggression seitens der PatientInnen kann weitreichende körperliche und nichtkörperliche (emotionale, biophysiologische, kognitive und soziale) Auswirkungen auf die davon Betroffenen haben. Die Auswirkungen verbaler und körperlicher Aggression und Gewalt sind gar nicht so unähnlich wie es z. T. angenommen wird (International Council of Nurses 1998, S. 156). Körperliche Übergriffe ziehen meist nur geringfügige körperliche Folgen wie Hämatome oder Kratzspuren nach sich. Schwere Körperschäden wie tiefe Schnittverletzungen und Knochenbrüche sind selten (Needham et al. 2005; Richter & Berger 2009; Schanda & Taylor 2001). Mit Ausnahme der forensischen Psychiatrie werden bei Gewaltübergriffen in der Regel keine potenziell gefährlichen Gegenstände wie Waffen, Stühle oder Glasscherben verwendet (Steinert 2008, S. 20–21). Etwa zehn Prozent der Angegriffenen müssen ihre erlittenen Verletzungen ärztlich behandeln lassen und knapp fünf Prozent sind zumin38 dest kurzzeitig arbeitsunfähig (Richter & Berger 2001b). Weitaus schwerwiegender und langwieriger als die körperlichen Folgen dürften die nichtkörperlichen Wunden eines Angriffes sein (Needham et al. 2005; Richter & Berger 2001b, 2009; Schanda & Taylor 2001). In einer systematischen Literaturübersicht benennen Needham et al. (2005) 28 nichtkörperliche Hauptauswirkungen von PatientInnenübergriffen, allen voran Wut, Angst oder Furcht, Symptome einer PTBS sowie Selbstvorwürfe, Schuld- und Schamgefühle. In einer umfassenden Studie neueren Datums konnten Richter und Berger (2009) nachweisen, dass als Reaktion auf einen PatientInnenübergriff eine voll ausgeprägte PTBS entstehen kann: Einige Wochen nach einem Vorfall erfüllten 17 Prozent der Befragten alle Kriterien für eine PTBS, bei 32 Prozent lag eine partielle PTBS vor. Gewalt jeglicher Art wirkt sich nicht nur auf die physische und psychische Gesundheit der direkt Betroffenen aus. Die mit der Gewalt potenziell einhergehenden Erscheinungen, wie Dienstausfälle, Beratungskosten, Motivations- und Effizienzverlust, Unsicherheit, Reduktion der Arbeitsleistung, Vermeidungsverhalten und Berufsausstieg, bedeuten auch für die Einrichtung enorme ökonomische Einbußen (Lenz 2009; Stefan 2005). Diese Aufzählung macht außerdem deutlich, dass Gewalterfahrungen die Arbeitsbeziehung zu den PatientInnen negativ beeinflussen und eine Verschlechterung der Pflegequalität nach sich ziehen können (Needham et al. 2005; Richter 1998, S. 116; Richter & Berger 2009). Gewaltereignisse im Gesundheitswesen stellen eine Gefährdung der effizienten Versorgung der PatientInnen dar, denn zur Erbringung hochqualitativer Dienstleistungen ist das Vorhandensein einer sicheren Arbeitsumgebung notwendig (International Council of Nurses 1998, S. 166). 39 8 AGGRESSIONSMANAGEMENT Für Beschäftigte in Gesundheits- und Sozialinstitutionen ist die Gefahr, einen verbalen oder tätlichen Angriff zu erfahren, deutlich erhöht. Diese Tatsache erfordert einen offenen, kompetenten und professionellen Umgang mit der Thematik – mit dem Ziel, Aggression und Gewalt zu vermeiden bzw. zu minimieren (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 7–10). Das Aggressionsmanagement umfasst folgende Schwerpunkte (Duxbury 2002; Hummer et al. 2006): 1. Präventive Maßnahmen 2. Intervenierende Maßnahmen bei aggressivem Verhalten a) Psychologische Maßnahmen (verbale und nonverbale Deeskalation) b) Körperliche Methoden (wie Fixierung, Isolation und Zwangsmedikation) 3. Nachsorge 8.1 Primärprävention Der Prävention kommt ein hoher Stellenwert zu, wenngleich kein Zweifel besteht, dass Aggression und Gewalt auch trotz präventiver Vorkehrungsmaßnahmen auftreten können (Hartdegen 1996, S. 184–185) und dass bedrohliche Situationen im Pflegealltag nicht immer zu vermeiden sind (Fuchs 1998, S. 71). Durch Analyse und Veränderung von Organisation, Routineabläufen, Stationsregeln und Behandlungskonzepten sowie durch patientInnenorientiertes Denken soll die Aggressions- und Gewaltentstehung verhindert werden (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 21). Auch spezielle Fortbildungsmaßnahmen dienen der Prävention. Gewaltprävention innerhalb des psychiatrischen Teams umfasst: Beziehungs- und Behandlungskontinuität Bezugspflege Behandlungsvereinbarungen Partnerschaftliches Verhältnis zu den PatientInnen Wertschätzende Grundhaltung Alltagsnahe Gestaltung der Lebensumstände Einbeziehung der Angehörigen 40 Wirksame Medikamentenbehandlung Weitgehende Reduzierung von Zwangsmaßnahmen (Steinert 2008, S. 71–74) 8.2 Psychologische Deeskalation Deeskalation bedeutet die Entschärfung einer eskalierenden Situation (NICE 2005, S. 94). „Der Deeskalation dienen nicht-aggressive Wortwahl und Verhaltensweisen“ (Bärsch & Rohde 2008, S. 45). Durch deeskalierende Kommunikation und deeskalierendes Verhalten lassen sich viele kritische Situationen rechtzeitig entschärfen, sodass es nicht zu einem tätlichen Übergriff kommt (Grond 2007, S. 116–117; Richter & Berger 2001a). Neben der Vermeidung eines körperlichen Angriffes soll durch psychologische Deeskalation bewirkt werden, dass der innere Spannungszustand der PatientInnen möglichst schnell und ohne Gewaltanwendung abnimmt und sie zugänglich werden für ein Problemlösungsgespräch. Je früher auf Warnsignale einer Eskalation reagiert wird, desto besser stehen die Chancen einer erfolgreichen Deeskalation. Die Zeit, die zur Deeskalation zur Verfügung steht, ist nicht unbegrenzt (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 34). Bei der Deeskalation sind PatientInnen nicht als GegnerInnen zu betrachten, die es zu bekämpfen und zu besiegen gilt. Das Pflegepersonal sollte den PatientInnen möglichst entgegenkommen, ihnen Zugeständnisse machen (Bärsch & Rohde 2008, S. 122; Richter & Berger 2001a) und in bestimmten Punkten auch gegen die eigene Überzeugung Recht geben (Richter 1998, S. 128). Zugeständnisse in wesentlichen Punkten sind aber zu vermeiden (Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 29). 8.2.1 Verständnis der Ursachen aggressiver Verhaltensweisen Aggressives und gewalttätiges Verhalten hat viele verschiedene Erscheinungsformen, potenzielle Ursachen, Auslöser und Beweggründe. Ebenso vielfältig sind auch die Möglichkeiten, mit Aggression und Gewalt umzugehen. Die unterschiedlichen Ursachen und Beweggründe eröffnen eine breite Palette an Deeskalationsmöglichkeiten – ein Patentrezept gibt es nicht (Bärsch & Rohde 2008, S. 45–46; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 24–33). Folglich lassen sich nur Hinweise und Anregungen für den Umgang mit auftretender Aggression und Gewalt geben (Hartdegen 1996, S. 215). Wie tatsächlich am besten reagiert werden sollte, ist person- und situationsabhängig, denn was für eine Person oder 41 zu einem bestimmten Zeitpunkt hilfreich ist, kann für eine andere Person oder zu einem anderen Zeitpunkt kontraproduktiv sein. Dieser Umstand macht die Deeskalation so schwierig (Delaney et al. 2001; Richter & Berger 2001a). Kritische Situationen erfordern kreative und individuelle Lösungen. Von Vorteil ist die gute Kenntnis der aggressiven Person, ihrer Reaktionsweisen, ihrer Vorgeschichte und ihrer aktuellen Befindlichkeit (Richter & Berger 2001a; Walter 1998, S. 58). Gelingt es Pflegenden, Auslöser zu identifizieren und aggressives Verhalten differenziert einzuschätzen, ist es möglich, differenziert und problembezogen zu deeskalieren (Steinert 2008, S. 42; Walter 1998, S. 56). Aggressives Verhalten psychisch Kranker kann Ausdruck von Angst, Stress, Frustration, Hilflosigkeit und Überforderung sein. Es kann durch Wut, Schmerzen, Krankheitsschübe und Medikamente oder auch durch bestimmte Ereignisse, Konflikte und Krisensituationen ausgelöst werden. Genauso gut kann es eine Reaktion auf subjektiv ungerechtfertigte Zwangsmaßnahmen (Kontroll- und Autonomieverlust) sein (Hausmann 2005, S. 198; Kienzle & Paul-Ettlinger 2001, S. 28–30; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 24–33). Werden PatientInnen unfreiwillig aufgenommen, wehren sie sich naturgemäß gegen die Aufnahme. Vor allem bei fehlender Krankheitseinsicht ist eine Abwehr gegen die Psychiatrie und die Behandlung wahrscheinlich (Richter & Sauter 1998, S. 7–8). Weiters kann Aggression ein Symptom verschiedener neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen und Störungen sein. Auch im Rauschzustand ist aggressives Verhalten denkbar. Aggression ist somit überwiegend ein Symptom bzw. Ausdruck einer besonderen Lage der PatientInnen (Hausmann 2005, S. 199; Kienzle & Paul-Ettlinger 2001, S. 28–30; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 24–33). Auch Pflegende selbst können aggressionsauslösend wirken (Hektik, Ungeduld, Erschöpfungszustand, persönliche Probleme, dominantes Auftreten, Verletzung der Intimsphäre der PatientInnen, Konflikte mit PatientInnen usw.) (Kienzle & Paul-Ettlinger 2001, S. 42–43). Aggressive Verhaltensweisen werden häufig persönlich genommen. Durch Konzentration auf den momentanen Zustand und die Ängste der PatientInnen kann vermieden werden, dass aggressives Verhalten als persönliche Beleidigung, als persönlicher Angriff empfunden wird (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 22–23). 42 8.2.2 Grundregeln der Deeskalation Die im Folgenden beschriebenen Grundregeln der Deeskalation sollen die verbale und körpersprachliche Deeskalation (Kapitel 8.2.3 und 8.2.4) erleichtern. Die Berücksichtigung der Regeln ist mitentscheidend für eine erfolgreiche Deeskalation. Es ist notwendig, diese Regeln im Alltag und außerhalb von Spannungssituationen zu trainieren und zu verinnerlichen, um nicht in angespannten Situationen durch die Fülle von Regeln und das Beachten derselben überfordert zu sein (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 34–37): 1. Erste Anzeichen drohender Eskalation wahrnehmen Manchmal werden PatientInnen scheinbar aus dem Nichts heraus tätlich aggressiv, allerdings sind Übergriffe ohne Vorwarnzeichen äußerst selten. Fast ausnahmslos kündigt sich eine Gewalteskalation durch bestimmte Vorboten an. Mögliche Frühwarnzeichen drohender körperlicher Gewalt sind: Angespannter und wütender Gesichtsausdruck Körperliche Anspannung Vegetative und (psycho)motorische Erregung Gereiztheit, feindselige Grundstimmung und feindseliges Verhalten Beschimpfungen und verbale Bedrohung Drohende Körperhaltung und Gestik Gewaltankündigungen Gesteigerte Tonhöhe und Lautstärke Sachbeschädigungen (NICE 2005; Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 21; Steinert 2008, S. 64–66; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 38) Die Aussagekraft potenzieller Warnsignale ist begrenzt, weil sie auch bei Nichtvorhandensein aggressiven Verhaltens auftreten können und nicht zwingend einen körperlichen Übergriff nach sich ziehen müssen (Whittington & Patterson 1996). Im Laufe des gesamten Aufenthaltes der PatientInnen gilt es für das Personal, auf Frühwarnzeichen eines drohenden Gewaltausbruchs zu achten (Steinert 2008, S. 77–78) und auf diese Signale sofort zu reagieren. Sehr oft kommt es vor, dass Warnsignale verharmlost oder gar nicht wahrgenommen werden (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 34). In Studien von Ketelsen et 43 al. (2007) und Rüesch, Miserez und Hell (2003) kam ein Drittel der Aggressionsereignisse für die Pflegenden überraschend. Im Zusammenhang mit psychiatrischen Störungen ist die Risikobeurteilung zur Früherkennung einer Selbst- und Fremdgefährdung eine der wichtigsten und gleichzeitig schwierigsten Aufgaben (Almvik & Woods 2003; Brosch 2004, S. 47). Es sollte selbstverständlich sein, dass PatientInnen mit erhöhtem Risiko so früh wie möglich (bei der Aufnahme) identifiziert werden. Darüber hinaus sollte das Aggressions- und Gewaltpotenzial bei allen PatientInnen regelmäßig eingeschätzt werden (Irwin 2006; NICE 2005, S. 89; Steinert 2008, S. 77–78). Für unerfahrenes Personal eignen sich zur Einschätzung des Gewaltrisikos standardisierte Risiko-Checklisten wie die Brøset Violence Checklist (BVC). Bei erfahrenem Personal ist die Einschätzung mittels Checklisten nicht besser als die intuitive Vorhersage (Steinert 2008, S. 65–66; Steinert & Bergk 2008). Die BVC bewertet das Vorhandensein bzw. das Nichtvorhandensein von sechs Faktoren (Verwirrtheit, Reizbarkeit, ungestümes Verhalten, verbale Bedrohung, körperliche Bedrohung, Angriff auf Gegenstände) und ermöglicht so die kurzfristige Vorhersage körperlicher Gewalt innerhalb der folgenden 24 Stunden (Almvik, Woods & Rasmussen 2000, cited in Almvik & Woods 2003). Bei moderatem oder hohem Gewaltrisiko sind Maßnahmen zur Abwehr der Gefährdung zu ergreifen (Almvik & Woods 2003; Brosch 2004, S. 47; Whittington & Patterson 1996). Je nach Höhe des Gewaltrisikos kommen z. B. Gespräche, Spaziergänge, Entspannungsübungen, Hinweise auf Stationsregeln, eine Medikationserhöhung, eine vorübergehende 1:1-Betreuung oder auch eine präventive Isolierung und die Verabreichung von Psychopharmaka in Frage (Abderhalden et al. 2004). 2. An die eigene Sicherheit denken Pflegende begeben sich bei Kontaktaufnahme zu einer hochgradig angespannten Person in eine Gefahrensituation. Wenn sie der Ansicht sind, eine Situation nicht alleine meistern zu können, sollten sie sich nicht scheuen KollegInnen hinzuzuziehen (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 34). Auch die Sicherheit anderer nicht unmittelbar beteiligter Personen sollte nicht außer Acht gelassen werden (Hartdegen 1996, S. 221–222; NICE 2005, S. 94; Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 23). Sämtliche „Schaulustige“, die eine eskalierende Situation beobachten, sich dadurch selbst einem Angriff aussetzen und die Deeskalation erschweren, sind aus dem Gefahrenbereich zu entfernen (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 34). 44 3. Sich selbst beruhigen Hochgradig erregte PatientInnen können Angst und Anspannung auslösen. In solchen Situationen ist es notwendig, die Ruhe zu bewahren (z. B. durch bewusste Atmung und Entspannung) und sich nicht von der eigenen Angst lähmen zu lassen (te Wildt, Hauser & Kropp 2006; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 34). Nur wer ruhig bleibt und Hektik und Panik vermeidet kann die Kontrolle über sich und die Situation bewahren, sich gut konzentrieren und überlegt kommunizieren und handeln. Unter Stress ist Deeskalation schwieriger. Oftmals hat ein gelassenes Verhalten eine besänftigende und tätliche Gewalt abwendende Wirkung (Bärsch & Rohde 2008, S. 79–80). 4. Deeskalation durch eine Ansprechperson Bei der psychologischen Deeskalation ist zu beachten, dass aggressive Personen eine Ansprechperson brauchen. Unternehmen mehrere Personen gleichzeitig Deeskalationsversuche, werden die PatientInnen womöglich zusätzlich bedrängt und verunsichert. Anwesende KollegInnen halten sich am besten unauffällig im Hintergrund auf und greifen nur im Notfall ein (NICE 2005, S. 94; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 35). Durchgeführt werden sollte die Deeskalation von jenem Teammitglied, bei dem die Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz am größten ist bzw. zu dem die jeweilige Person am ehesten Vertrauen entwickeln kann (Richter 1998, S. 128; Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 24–25). 5. Auf körperliche Nähe und Distanz achten In jedem Gespräch sollte zum Gegenüber ein räumlicher Abstand von etwa einem Meter gehalten werden, weil jede Nichteinhaltung der Intimdistanz als Bedrohung empfunden werden kann (Bärsch & Rohde 2008, S. 14–16). Angespannte und aggressive PatientInnen benötigen teilweise noch mehr Raum um sich und deshalb ist im Umgang mit ihnen auf die Einhaltung einer entsprechend großen Distanz zu achten, um nicht einen Gewaltausbruch zu provozieren (Lenz 2009; NICE 2005, S. 95). Eine größere Körperdistanz dient auch der eigenen Sicherheit: Um dem Gegenüber möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten und gegebenenfalls mehr Zeit für eine Abwehrhandlung oder Fluchtreaktion zu haben, ist es in angespannten Situationen ratsam, sich außerhalb der unmittelbaren Schlagdistanz aufzuhalten (Sicherheitsabstand) (Bärsch & Rohde 2008, S. 78; Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 31; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 48). 45 6. Blickkontakt herstellen Beim Blickkontakt ist auf ein Mittelmaß zwischen ständigem Anschauen und dem völligen Verzicht auf Blickkontakt zu achten. Durch Anstarren könnte bei den PatientInnen ein Gefühl der Bedrängnis entstehen. Niemals sollten sich Pflegende von aggressiven PatientInnen völlig abwenden, weil sich dadurch das Risiko eines plötzlichen Angriffes ohne Möglichkeit der Abwehr erhöht (Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 27; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 36). 7. PatientInnen nicht beherrschen Ein sicheres und bestimmtes Auftreten ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Deeskalation (NICE 2005, S. 94). Pflegende sollten sich darauf konzentrieren, die Situation und sich selbst (Körperhaltung und Atmung) unter Kontrolle zu haben. Machtkämpfe und ständige Appelle („Setzen Sie sich! Beruhigen Sie sich!“) sind zu vermeiden. Es geht nicht ums Rechthaben. Aus diesem Grund sollten soweit wie nur möglich Zustimmungen und Zugeständnisse gemacht werden (Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 23–25; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 36); jedoch sind den PatientInnen Grenzen zu setzen (Hausmann 2005, S. 198–199; Hummer et al. 2006). Den PatientInnen muss deutlich zu verstehen gegeben werden, wenn ihr Verhalten unangemessen und inakzeptabel ist. Dabei soll erkennbar sein, dass nur das Verhalten und nicht die Person abgelehnt wird (Hartdegen 1996, S. 216–219; Kienzle & Paul-Ettlinger 2001, S. 34–35). 8. Sich nicht provozieren lassen (Verbale) Aggression sollte nie als persönliche Kränkung aufgefasst werden, weil dadurch eine Gegenaggression wahrscheinlicher wird (Hartdegen 1996, S. 221–222; Kienzle & Paul-Ettlinger 2001, S. 32). Pflegende sollten gelassen bleiben und nicht selbst laut und aggressiv werden (Hausmann 2005, S. 198–199). Reagieren sie auf Drohungen und Beschimpfungen mit ebensolchen, wird die ursprüngliche Aggression der PatientInnen eher noch verstärkt und die Situation könnte eskalieren (Bärsch & Rohde 2008, S. 78). Es empfiehlt sich, wenig Reaktion zu zeigen, gegebenenfalls auf mögliche Konsequenzen des Fehlverhaltens hinzuweisen (Steinert 2008, S. 82–83) und konsequent zu handeln (Bärsch & Rohde 2008, S. 78). 46 9. Provozierendes Verhalten, Ermahnungen und Drohungen vermeiden Provokation gilt als Aggression verstärkender Faktor (Grond 2007, S. 25–26). Sowohl eine absichtliche als auch eine unabsichtliche Provokation kann bei PatientInnen aggressive Verhaltensweisen begünstigen (Bärsch & Rohde 2008, S. 118–119; Rhode 2008). Pflegende sollten darauf achten, dass sie nicht bedrohlich und beherrschend wirken und Macht und Dominanz ausstrahlen (NICE 2005, S. 94; Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 26). Ebenso wie das Einnehmen einer arroganten Haltung eine Eskalation begünstigt, kann auch das Aussenden von Opfersignalen (wie ängstliches, unsicheres Auftreten, unsichere Stimme und Unentschlossenheit) provozierend wirken und selbstgefährdend sein (Bärsch & Rohde 2008, S. 13 & 81). Aggressionsfördernd und daher unangebracht ist auch ein Befehlston. Angespannte PatientInnen noch zusätzlich durch Worte zu provozieren, sie zur Ruhe zu ermahnen, sie zu (be)drängen oder ihnen mit Konsequenzen zu drohen erzeugt Abwehr und könnte eskalationsauslösend sein (Bärsch & Rohde 2008, S. 81; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 36). Durch Drohungen und Einschüchterung mag u. U. eine kurzfristige Unterlassung des aggressiven Verhaltens erreicht werden, allerdings machen Drohungen auch Angst, welche wiederum zu aggressivem Verhalten führen kann (Kienzle & PaulEttlinger 2001, S. 38–39). 10. Wertschätzende Haltung einnehmen Aggressive, hoch angespannte PatientInnen befinden sich in einer innerlichen Notsituation, in der sie die volle Unterstützung der betreuenden Personen brauchen (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 37). Empathisches, respektvolles, vorurteilsfreies, faires und ehrliches Verhalten allen PatientInnen gegenüber sollte nicht nur im Rahmen der Deeskalation selbstverständlich sein (Richter & Berger 2001a; Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 24–25). Pflegende, die PatientInnen nicht als autonome und vollwertige Menschen sehen (und entsprechend behandeln), tragen zu deren aggressivem Verhalten wesentlich bei. Pflegende sollten den PatientInnen grundsätzlich mit einer wertschätzenden Haltung gegenübertreten (Bärsch & Rohde 2008, S. 118–121). 11. Bedürfnisse und Gefühle herausfinden Hinter jeder Aufregung und Anspannung, hinter jedem aggressiven Verhalten steckt ein Grund bzw. ein Bedürfnis. Es gilt, den Grund und die Bedürfnisse durch Wahrnehmung und Fragen herauszufinden und weitere Handlungen auf die Bedürfnisse abzustimmen. 47 Pflegende können nicht alle Bedürfnisse und Wünsche erfüllen, aber sie können den PatientInnen zeigen, dass sie ihnen helfen möchten, und ihnen Angebote machen (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 37): Gespräch mit einer Vertrauensperson, Telefonat mit Angehörigen, Medikation, Auszeit im Zimmer, ein warmes Bad, ein Getränk, eine Zigarette, ein Spaziergang usw. (Grond 2007, S. 115–116). Das Aufzeigen von Optionen vermittelt PatientInnen das Gefühl, die Situation beeinflussen zu können. Ein häufiger Fehler ist es, PatientInnen durch das Bombardieren mit mehreren Fragen und Angeboten zu überfordern. Da angespannte PatientInnen mehr Zeit brauchen, um über eine Frage oder ein Angebot nachzudenken, ist es besser, immer nur eine Frage zu stellen und Angebote nach und nach zu äußern (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 37). Nach Vorstellung der Grundregeln der Deeskalation wird in den nächsten Unterabschnitten detailliert auf die verbale und die nonverbale Deeskalation eingegangen. Einige Aspekte wurden bereits angesprochen. 8.2.3 Verbale Deeskalation „Von besonderer Bedeutung für den Umgang mit Aggressionen ist die Kommunikationsfähigkeit bzw. die Kommunikationsbereitschaft, verbunden mit der Fähigkeit, den anderen in seiner ganzen Person wahrzunehmen“ (Kienzle & Paul-Ettlinger 2001, S. 48). Kommunikations- und Gesprächsführungskompetenz entscheiden über den Erfolg der Deeskalationsversuche (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 37). Die Sprache ist jenes wertvolle Mittel, das in schwierigen Situationen am häufigsten zur Deeskalation eingesetzt wird. Der Kommunikationsfluss sollte nach Möglichkeit nicht unterbrochen werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine Situation zu körperlicher Gewalt eskaliert, verringert ist, solange die sprachliche Kommunikation bestehen bleibt (Bärsch & Rohde 2008, S. 76–79). Zu langes Diskutieren und Verhandeln in Krisensituationen kann jedoch die Spannung zusätzlich steigern – bei weit fortgeschrittener Eskalation muss gehandelt und nicht mehr verhandelt werden (Bärsch & Rohde 2008, S. 121; Lenz 2009). 48 Die nun folgende Beschreibung von Kommunikations- und Gesprächsführungstechniken soll vermitteln, wie Pflegende gezielt auf PatientInnen und deren Aggressionslevel einwirken können: 1. Gezielte Kontaktaufnahme Die Kontaktaufnahme zu aggressiven PatientInnen kann bereits eine große Hürde darstellen. Die Vorgehensweise bei der Herstellung eines Kontaktes ist auf das Energieniveau der PatientInnen abzustimmen. Von Vorteil ist es, schimpfende Personen namentlich anzusprechen, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, und eventuell die Lautstärke kurzfristig zu erhöhen, wenn auf das erste namentliche Ansprechen keine Reaktion erfolgt. Bei erhöhtem Energieniveau (drohende oder randalierende PatientInnen) ist eine sofortige Intervention in das Geschehen (ohne vorherige Kontaktaufnahme) nötig. Mit klaren und deutlichen Appellen, wie „Stopp!“, „Halt!“, „Hören Sie auf, Sie machen mir Angst!“, ist die Chance am größten, dass PatientInnen von ihrem aggressiven Verhalten ablassen. Reagieren PatientInnen nicht auf solche Aufforderungen, ist es am besten, sofort Verstärkung zu holen (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 38–39). Unter Umständen kann ein Körperkontakt hilfreich sein, um einen Zugang zum Gegenüber zu finden. Der Einsatz von Körperkontakt muss allerdings zuvor kritisch eingeschätzt werden (Walter 1998, S. 56–58). 2. Beziehungsaufbau – Wertschätzung und Empathie Nach der Kontaktaufnahme kann mit dem Beziehungsaufbau begonnen werden. Ziel ist es, die aggressive Person durch Widerspiegelung des Zustandes und öffnende Fragen („Was ist denn gerade los mit Ihnen, was beunruhigt Sie denn?“ „Kann ich etwas für Sie tun?“) in ein Gespräch zu verwickeln (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 40). Es kann helfen, fortwährend zu reden („talk down“). Wer (ruhig und sachlich) redet, der kämpft nicht. Im Idealfall gelingt es, das Gespräch auf ein unverfängliches, vielleicht verbindendes Thema umzulenken und dadurch eine Ablenkung und Entspannung der erregten Person zu bewirken (Steinert 2008, S. 82–84). Den PatientInnen sollte nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass sie aggressiv, unkontrolliert und beleidigend sind, sondern wertfrei beschrieben werden, wie sie gerade wirken (z. B. aufgeregt, angespannt, beunruhigt). Durch empathisches Einfühlen und wertfreies Widerspiegeln des Zustandes soll den PatientInnen das Gefühl vermittelt werden, dass sie wahrgenommen und verstanden werden, sodass sie offener und kooperationsbereiter werden (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 36 & 40). 49 Eine aufgebrachte Person wird eher kooperativ sein, wenn sie sich angenommen und verstanden fühlt und respektvoll behandelt wird (Bärsch & Rohde 2008, S. 76; Hartdegen 1996, S. 216–219). Empfehlenswert ist es, PatientInnen mitzuteilen, dass man ihnen helfen möchte (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 36). Anteilnahme und Sorge sollten nicht nur verbal mitgeteilt, sondern auch nonverbal signalisiert werden. Die Sorgen der Betroffenen sollten nicht heruntergespielt werden (NICE 2005, S. 95). Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und Improvisationstalent sind wesentliche Bausteine für eine erfolgreiche Deeskalation (Steinert 2008, S. 82–84). 3. Konkretisierungsfragen zu Ursachen und Beweggründen stellen Durch offene Fragen („Was könnte Ihnen helfen?“) können aggressive PatientInnen zum Nachdenken, zum Sprechen, zum Erzählen angeregt werden. Offene Fragen halten das Gespräch in Gang, dienen somit der Zeitgewinnung und führen meist zu aufschlussreicheren Antworten als geschlossene Fragen. Aus den erhaltenen Antworten können Pflegende, die als Fragende die Gesprächsführenden bleiben, Erkenntnisse für die weitere Vorgehensweise ableiten (Bärsch & Rohde 2008, S. 77). Warum-Fragen („Warum haben Sie Angst?“) sind mit Vorsicht zu stellen, weil sie als Kritik und Provokation empfunden werden könnten. Ihnen vorzuziehen sind Konkretisierungsfragen („Wovor genau haben Sie Angst?“). Konkrete Fragestellungen zu Auslösern, Ursachen und Beweggründen führen zu präziseren Antworten und erleichtern das Finden einer Lösung für die Situation (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 40–41). 4. Aufmerksames Zuhören statt diskutieren Wie bereits gesagt, ist es wichtig, dass Pflegende auf ihre PatientInnen eingehen, deren Argumente ernst nehmen und für deren Bedürfnisse offen sind. Bedürfnisse lassen sich besonders gut durch empathisches, aktives Zuhören erkennen. Durch Zuhören, gezieltes Nachfragen und Wiederholen des Gesagten in eigenen Worten werden Interesse und Verständnis signalisiert. Außerdem werden die PatientInnen motiviert, sich weiter zu öffnen und ihre Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse mitzuteilen. Die Fragenden können die erhaltenen Informationen zur Klärung des Problems nutzen (Bärsch & Rohde 2008, S. 34–37; Hartdegen 1996, S. 216–219). 50 Anders als beim passiven Zuhören (Schweigen und evtl. minimale Gestik und Mimik) wird den PatientInnen beim aktiven Zuhören deutlich mitgeteilt, dass die Botschaft inhaltlich verstanden wurde. Eine Interpretation oder Bewertung unterbleibt (Bärsch & Rohde 2008, S. 77). In der Kommunikation mit aggressiven Personen kann aktives Zuhören eine in hohem Maße deeskalierende Methode sein. Aktives Zuhören kann auch als Methode zur Zeitgewinnung eingesetzt werden, wenn eine Situation zu eskalieren droht. Es ist nicht auszuschließen, dass aggressive Personen durch Reden und das Erfahren von Verständnis von ihren ursprünglichen Intentionen abkommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass PatientInnen körperlich gewalttätig werden, ist verringert, solange sie mit Sprechen beschäftigt sind – wie schon das Sprichwort sagt: „Bellende Hunde beißen nicht“. Daher sollte versucht werden, mit den PatientInnen in verbalem Kontakt zu bleiben und sie durch Nachfragen zum Weitersprechen zu animieren (Bärsch & Rohde 2008, S. 34–37). 5. Eingehen auf Bedürfnisse und Gefühle Im erregten Zustand sehen PatientInnen häufig keine andere Möglichkeit als gewalttätig zu werden. Aufgabe Pflegender ist das Aufzeigen möglicher Lösungen, um Handlungsalternativen zu veranschaulichen (Bärsch & Rohde 2008, S. 79; Richter 1998, S. 128; Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 29). Pflegende können deeskalierend wirken, indem sie auf Sorgen und Ängste der PatientInnen eingehen und auf deren Bedürfnisse reagieren (Bärsch & Rohde 2008, S. 36–37). Anstatt Ratschläge zu geben, sollten Pflegende Lösungsanregungsfragen stellen, mit den PatientInnen gemeinsam nach Lösungen für das Problem suchen, aktive Hilfe anbieten und eine realistische Lösung aushandeln (NICE 2005, S. 94; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 42–43). Zentral ist, dass keine Versprechen und Zusagen gemacht werden, die nicht eingehalten werden können (Richter 1998, S. 128). In aggressiv aufgeladenen Situationen fällt es den PatientInnen schwer, von ihren Ansichten und Vorstellungen abzuweichen. Sie empfinden es als Demütigung, wenn sie sich fremdem Willen unterwerfen müssen. Die hohe Kunst in einer emotional geladenen Situation ist es, eine Brücke zu den PatientInnen zu bauen und zu einer Lösung zu gelangen, die auch von den PatientInnen nicht als Erniedrigung empfunden wird. Pflegende könnten sich z. B. mit PatientInnen, die ein Medikament nicht einnehmen wollen, darauf einigen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt eingenommen wird (Steinert 2008, S. 83). 51 6. Zeigen eigener Gefühle – einfühlsame Feedbacks und Ich-Botschaften Das Senden ehrlicher und authentischer Ich-Botschaften auf der Selbstoffenbarungsebene („Ich fühle mich bedroht durch Ihre Gestik.“, „Ich kann verstehen, dass Sie das wütend macht.“, „Es tut mir weh, dass …“) kann zur Deeskalation beitragen (Bärsch & Rohde 2008, S. 34; Grond 2007, S. 95; Hartdegen 1996, S. 216–219). Ich-Botschaften stellen eine Sonderform des Feedbacks dar: Pflegende können dadurch ihre Betroffenheit ausdrücken und der aggressiven Person verdeutlichen, was als Problem gesehen wird (Bärsch & Rohde 2008, S. 77). Pflegende zeigen sich dadurch als Menschen mit Verständnis für menschliche Emotionen und lenken die Aufmerksamkeit auf sich (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 43). Gegebenenfalls ist es sinnvoll, bedrohlich wirkenden PatientInnen direkt mitzuteilen, dass sie im Moment sehr gefährlich wirken und Angst machen. Bei psychotischen PatientInnen kann durch diese Widerspiegelung oftmals bewirkt werden, dass sich ihre Wahrnehmung der Situation verbessert und sie sich vom gewalttätigen Verhalten distanzieren (Steinert 2008, S. 80). Angstäußerungen sind differenziert zu betrachten: Die meisten PatientInnen möchten niemandem Angst machen oder jemanden verletzen, und sie erschrecken, wenn sie mit ihrer Wirkung konfrontiert werden. Manche PatientInnen (z. B. alkoholisierte) empfinden ihre Angst erzeugende Wirkung jedoch als Triumph (Hartdegen 1996, S. 216–219; Steinert 2008, S. 80; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 39). Im Erregungszustand denken emotional aufgebrachte PatientInnen meist nicht daran, dass ihre Verhaltensweisen Konsequenzen haben könnten. Deswegen ist es wichtig, dass sie (bei Fortschreiten der Eskalation) auf mögliche Folgen ihres Fehlverhaltens aufmerksam gemacht werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass PatientInnen durch den Hinweis auf potenzielle Konsequenzen von ihrem Vorhaben ablassen (Bärsch & Rohde 2008, S. 77; Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 29). 7. Vorsicht vor zu hohen Erwartungen Jeder Deeskalationsversuch ist eine Herausforderung. Die deeskalierende Person muss darauf achten, dass sie sich dabei nicht selbst unter Druck setzt oder setzen lässt und realistisch bleibt. Zu viel Ehrgeiz und ein Deeskalationskampf mit den PatientInnen schaden dem Geschehen. Es hat sich bewährt, PatientInnen zu fragen, ob sie lieber alleine sein wollen, ob sie lieber mit einer anderen Person aus dem Kollegium reden möchten oder was ihnen sonst helfen könnte (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 44). 52 In machen Fällen wollen PatientInnen einfach in Ruhe gelassen werden und Kontaktversuche verschlimmern die Aggression. Besteht keine Selbstverletzungsgefahr, können diese PatientInnen alleine gelassen werden und so die Chance erhalten, sich alleine zu beruhigen (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 39). 8. Kommunikationskiller vermeiden Bei der Kommunikation können – etwa weil sich Pflegende provozieren lassen – Fehler unterlaufen, die den Kommunikationsfluss stören und zur Eskalation der Gewalt unmittelbar beitragen können. Dazu gehören Drohungen und Beleidigungen, Demütigungen und geringschätzige Äußerungen, Kritikäußerungen und Belehrungen. Es sollte vermieden werden, die PatientInnen zu unterbrechen, zu schreien und zu fluchen. Ebenso zu unterlassen sind Sarkasmus, Ironie, Zynismus, Grimassen und unangebrachtes Lachen. Andere nicht angezeigte Vorgangsweisen in der Gesprächsführung mit aggressiven Personen sind Bevormundungen, negative Bewertungen der PatientInnen, komplizierte Fragestellungen und die Verwendung von Fachvokabular. Worte sollten gut überlegt und in einer für die PatientInnen verständlichen Form ausgesprochen werden. Auch auf coole und schlagfertige Antworten ist aufgrund ihres Eskalationspotenzials zu verzichten (Bärsch & Rohde 2008, S. 32–35 & 76). Ebenso wie die richtigen Worte beruhigend und entspannend wirken, kann sich ein „falsches“ Wort, ein „falscher“ Satz oder eine „falsche“ Widerspiegelung sofort negativ auf den Spannungszustand der PatientInnen auswirken. Um einer negativen Entwicklung in der Deeskalation entgegenzuwirken, ist es in einem solchen Fall ratsam, das Gesagte zurückzunehmen, es zu korrigieren und sich zu entschuldigen (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 44). 8.2.4 Nonverbale Deeskalation Der Körpersprache kommt im Rahmen der Kommunikation eine entscheidende Funktion zu – die Wirkung einer Botschaft resultiert zu 55 Prozent aus Mimik, Gestik und Körperbewegung, zu 38 Prozent aus der Sprechweise und Betonung und nur zu sieben Prozent aus verbalen Äußerungen. Verbale und nonverbale Signale sollten sich immer decken, vielfach sind sie jedoch inkongruent (Bärsch & Rohde 2008, S. 9). Mimik und Gestik können gezielt zur Beruhigung aggressiver PatientInnen genutzt werden, vorausgesetzt sie werden sparsam eingesetzt. Ausladende Gestik kann bedrohlich und herausfordernd wirken (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 35). 53 In einem Gespräch passen die GesprächspartnerInnen ihre Körperhaltung und ihre Bewegungsmuster unbewusst aneinander an. Im Umgang mit aggressiven Menschen ist es daher wichtig, eine entspannte, unbedrohliche, aber dennoch klare Haltung einzunehmen und ihnen, wenn es möglich ist, auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Auf motorisch sehr unruhige Personen wirken Pflegende meist beruhigend, wenn sie ihren Körper leicht und langsam bewegen. Schnelle, hektische Bewegungen sind hingegen zu vermeiden, weil sie als Bedrohung verstanden werden könnten (Bärsch & Rohde 2008, S. 70; Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 26; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 35 & 39). GewalttäterInnen sind äußerst gut darin, nonverbale Botschaften richtig zu deuten. Schon nach Sekunden wissen sie, ob sie eine ängstliche, selbstbewusste oder aggressive Person vor sich haben. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffes ist für den selbstbewussten Personentyp am geringsten. Meist sind es ängstliche und in ihrer Mimik und Gestik unsicher wirkende Personen (gebückte Haltung, Beine eng beieinander, Arme schützend vor dem Körper), die Aggression und Gewalt erfahren. Angst bzw. ängstliche Passivität animiert PatientInnen dazu, sich aggressiv zu verhalten, weil nicht mit Gegenwehr zu rechnen ist. Auch eine sehr dominant auftretende und Überlegenheit ausstrahlende Person (angehobene Kopfhaltung, breitbeiniger Stand, aggressive Gesten) kann abwehrende oder kämpferische Aggression auslösen (Bärsch & Rohde 2008, S. 12–14; Steinert 2008, S. 83–84). Mit offener und aufrechter Körperhaltung strahlen Menschen Selbstsicherheit aus. In engem Zusammenhang mit der Körperhaltung steht die Stimme. Eine richtige Körperhaltung (aufrechter, hüftbreiter Stand) lässt auch die Stimme (selbst)sicher erklingen und sie ermöglicht zudem ein rasches Handeln im Falle eines tätlichen Angriffes. Stimme und Sprechweise können gezielt zur Deeskalation eingesetzt werden. Eine ruhige Sprechweise und eine tiefere, tragende und wohlklingende Stimme haben – im Gegensatz zu einer hastigen Sprechweise und schrillen, überlauten Stimme – eine potentiell entspannende und deeskalierende Wirkung. Innere Ruhe überträgt sich auf die Stimme und somit auch auf das Gegenüber. In Extremsituationen kommt der Stimme eine wesentlich wichtigere Funktion zu als dem Inhalt der Kommunikation (Bärsch & Rohde 2008, S. 70–73; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 35). 54 8.2.5 Umgang mit sexueller Belästigung und mit persönlichen Racheandrohungen Das Risiko sexueller Gewalt durch PatientInnen ist im psychiatrischen Bereich gering, weil mit den meisten psychischen Erkrankungen (v. a. in Verbindung mit Medikamenten) ein verminderter sexueller Antrieb verbunden ist (Steinert 2008, S. 26–27). Sowohl für tätliche als auch für verbale sexuelle Belästigung gilt: Sie ist inakzeptabel und darf nicht toleriert werden. Auf jede Belästigung sollten sofort eine unmissverständliche Reaktion und eine Grenzsetzung erfolgen (Steinert 2008, S. 81). Eine Verharmlosung kann von den PatientInnen als Aufforderung zu einer weiteren sexuellen Belästigung empfunden werden. Bei wiederholten Übergriffen dient es dem Selbstschutz, die Pflege prinzipiell zu zweit durchzuführen oder auf eine gleichgeschlechtliche Person zu übertragen (Kienzle & PaulEttlinger 2001, S. 39–40). Bei persönlichen Racheandrohungen, welche als äußerst problematisch anzusehen sind, sind Solidarität im Team und ein geschlossenes Auftreten besonders gefragt. Das Team sollte die PatientInnen (z. B. im Rahmen der Visite) mit dem Fehlverhalten konfrontieren und ihnen klar machen, dass dieses nicht geduldet wird (Steinert 2008, S. 80–81). 8.2.6 Grenzen psychologischer Deeskalation Wenn gewaltfreie Deeskalationsversuche nicht möglich sind oder nicht ausreichen zur Bewältigung einer Situation, ist die Anwendung von körperlichen Techniken zur Verhinderung einer Selbst- oder Fremdgefährdung der PatientInnen eine konsequente, verpflichtende und rechtmäßige Notwendigkeit (Hummer et al. 2006; Lenz 2009; NICE 2005, S. 97). Die International Society of Psychiatric-Mental Health Nurses (ISPN) räumt ein, dass Zwangsmaßnahmen als letztes Mittel in einer Reihe anderer gelinderer Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu verstehen sind. Die Möglichkeit der Anwendung von Zwangsmaßnahmen sollte nur in Notsituationen angedacht werden, in denen die Sicherheit für Personal, PatientInnen und Dritte durch weniger einschränkende Alternativen nicht mehr gewährleistet werden kann (ISPN Position Statement on the Use of Restraint and Seclusion 2001). 55 8.3 Körperliche Interventionstechniken im Umgang mit aggressiven und gewalttätigen PatientInnen Es ist weitgehend unbestritten, dass in der Arbeit mit aggressiven und erregten PatientInnen zur Abwehr, Unterbrechung oder Beendigung einer Aggressionshandlung auf effektive und körperschonende Interventionstechniken nicht völlig verzichtet werden kann (Richter & Berger 2001a; Steinert 2008, S. 103–108; Steinert & Bergk 2008). In einer systematischen Literaturübersicht von Richter (2005, S. 7) werden mehrere Körpertechniken genannt, die üblicherweise Komponenten von Trainingsprogrammen im Aggressionsmanagement sind: Abwehrtechniken Befreiungstechniken Immobilisationstechniken Haltetechniken (z. B. für Injektionen) Fixierungstechniken Isolierungstechniken Zwangsmedikation Im Falle eines körperlichen Angriffes (z. B. Greif-, Stoß-, Schlag- oder Würgeangriff) sollte die attackierte Person unverzüglich versuchen, der angreifenden Person auszuweichen, sich und nach Möglichkeit auch andere bedrohte Personen in Sicherheit zu bringen und Hilfe zu organisieren (Notruf, Schreien etc.). Ist dies nicht möglich, sind körperliche Abwehr- und Befreiungstechniken zur Abwehr des Angriffes anzuwenden. Eine Chance, einen u. U. lebensgefährlichen Angriff zu stoppen, ist nur gegeben, wenn agiert wird (Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 31–37; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 49–54). Zur Abwendung eines Übergriffes bzw. nach einem Übergriff sind körperliche Überwältigung und Zwangsmaßnahmen durch das Team nicht immer vermeidbar. Für ein sicheres Vorgehen bei der Immobilisierung und bei der Durchführung von Zwangsmaßnahmen ist eine personelle Übermacht unerlässlich (Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 51; Steinert 2008, S. 84–89). Die korrekte Anwendung und sichere Beherrschung sämtlicher körperlicher Techniken setzt voraus, dass diese im Rahmen einer professionellen Schulung erlernt 56 wurden und regelmäßig wiederholt werden (Steinert 2008, S. 84–89; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 49–53). 8.3.1 Leitlinien für den Umgang mit Zwangsmaßnahmen Im deutschsprachigen Raum sind einige Leitlinien für den Umgang mit Zwangsmaßnahmen verfügbar. Sie zielen in erster Linie auf die Reduktion von Zwangsmaßnahmen und eine Vereinheitlichung der Praxis ab (Anderl-Doliwa et al. 2005). Sie sollen Handlungssicherheit geben (Schanz 2004) und einen sorgsamen Umgang mit den PatientInnen gewährleisten (Stefan & Schrenk 2008, S. 6). Exemplarisch werden vier Leitlinien genannt: Leitlinie für den Umgang mit Zwangsmaßnahmen vom Arbeitskreis der Chefärzte und leitenden Pflegepersonen in psychiatrischen Kliniken in Rheinland-Pfalz (Anderl-Doliwa et al. 2005) Klinikinterne Leitlinie bei der Verwendung von Beschränkungsmethoden in der Psychiatrie (Fixiergurte, Netzbett) des Sozialmedizinischen Zentrums Baumgartner Höhe (OWS) (Stefan & Schrenk 2008) Leitlinie für den Umgang mit Zwangsmaßnahmen des ZfP (Zentrum für Psychiatrie) Weissenau (Steinert et al. 2006) Medizinisch-ethische Richtlinien der Schweizer Akademie der Medizinischen Wissenschaften zu Zwangsmaßnahmen in der Medizin (SAMW 2004) In den Leitlinien werden Prinzipien angeführt, die im Rahmen der Anordnung und Durchführung von Zwangsmaßnahmen zur Geltung kommen sollten: 1. In sämtlichen Leitlinien wird explizit darauf hingewiesen, dass die Anwendung von Gewalt und Zwang ausschließlich dann in Erwägung gezogen werden sollte, wenn die Eskalation so weit fortgeschritten ist, dass eine Entschärfung der Situation und Beruhigung der PatientInnen durch andere personenbezogene Strategien nicht möglich ist. Erst nach Ausschöpfung aller weniger eingreifenden Alternativen sind als Ultima Ratio Zwangsmaßnahmen anzuwenden (NICE 2005, S. 97; SAMW 2004). Als gelindere Maßnahmen, die zur Deeskalation beitragen können, werden in den Guidelines u. a. genannt: Gespräche („talking down“ im Sinne der verbalen Deeskalation), Ablenkung, das Anbieten eines Getränks, einer Zigarette, eines Entspannungsbades, körperlicher Betäti- 57 gung, einer Auszeit im Garten oder eines Gespräches mit einer anderen Person (AnderlDoliwa et al. 2005; Steinert et al. 2006), Reizabschirmung, Skill-Anwendung, Medikamente, Krisengespräche und vorübergehende Intensivbetreuung (Stefan & Schrenk 2008, S. 6–7). 2. Bei der Anordnung und Durchführung jeder Zwangsmaßnahme sollte dem Gebot der Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel besondere Beachtung zukommen. Jede Maßnahme muss angemessen, verhältnismäßig zum Risiko und so wenig einschneidend wie möglich sein. Die dabei angewandte Kraft bzw. Gewalt darf das notwendige Mindestmaß nicht überschreiten (Anderl-Doliwa et al. 2005; NICE 2005, S. 97; SAMW 2004; Stefan & Schrenk 2008, S. 11). Ist körperliche Gewaltanwendung in einer bestimmten Situation unvermeidbar, ist zumindest sicherzustellen, dass diese auf einem nicht traumatisierenden Level erfolgt und dass die beteiligten Personen dadurch zu keinem Schaden – im physischen und v. a. im seelischen Bereich – kommen (Richter & Berger 2001a, 2001b; Steinert 2008, S. 8; te Wildt, Hauser & Kropp 2006). 3. Bei der Wahl der Maßnahme sollte neben der Sicherheit für die Betroffenen und sämtliche andere Personen nach Möglichkeit auch die Präferenz der PatientInnen berücksichtigt werden (NICE 2005, S. 97; Steinert et al. 2006). Ein Netzbett eignet sich beispielsweise eher für PatientInnen mit hohem Fremdgefährdungsrisiko, bei denen eine Selbstgefährdung nicht vordergründig ist, und die Fixierung eher für PatientInnen mit Selbstverletzungsrisiko (Stefan & Schrenk 2008, S. 7–9). Aus Gründen der Sicherheit müssen alle in der körperlichen Freiheit beschränkten PatientInnen auf potenziell gefährliche Gegenstände, wie Feuerzeuge, Messer, Medikamente, Schmuck, Gürtel, Schuhbänder, Gebisse und Hörgeräte, durchsucht werden (Anderl-Doliwa et al. 2005; Asani, Eißmann & Danyluk 2007; Stefan & Schrenk 2008, S. 15). 4. Unvermeidbare Zwangsmaßnahmen sind so menschenwürdig wie möglich zu gestalten. Die Würde und die Intimsphäre der PatientInnen sind absolut zu schützen (NICE 2005, S. 97; SAMW 2004; Steinert et al. 2006). Fixierungen sollten z. B. nicht vor den Augen anderen Personen vorgenommen werden (Anderl-Doliwa et al. 2005), und isolierte PatientInnen sollten persönliche Kleidung und Gegenstände behalten dürfen, solange sich daraus keine Sicherheitsgefahr ergibt (NICE 2005, S. 99). 5. Bei frühestmöglicher Gelegenheit sollten die PatientInnen über Art, Dauer und Grund der Zwangsmaßnahme aufgeklärt werden (Asani, Eißmann & Danyluk 2007; NICE 2005, S. 97–98). Nach Anderl-Doliwa et al. (2005) sowie Steinert et al. (2006) hat die 58 Aufklärung vor und auch im Verlauf der Zwangsmaßnahme wiederholt zu erfolgen. 6. Zwangsmaßnahmen sollten nie länger als nötig aufrecht erhalten bleiben. Ihre Notwendigkeit ist immer wieder zu überprüfen. Die Empfehlungen, in welchem Intervall diese Überprüfung geschehen soll, sind je nach Leitlinie und Zwangsmaßnahme sehr unterschiedlich. In der Leitlinie des ZfP Weissenau ist die Neubeurteilung der Notwendigkeit einer Zwangsmaßnahme auf spätestens alle zwei Stunden festgelegt (Steinert et al. 2006). Gemäß anderen Leitlinien erfolgt die Überprüfung wesentlich seltener (AnderlDoliwa et al. 2005). 7. Die Überwachung von Zwangsmaßnahmen ist – wie auch deren Anordnung und Ausführung – ausführlich zu dokumentieren (Anderl-Doliwa et al. 2005; Ottermann 2003). Die Dokumentation von Aggressionsereignissen und Folgemaßnahmen dient der internen Datenerfassung und Qualitätssicherung und dem externen Benchmarking (Steinert & Baur 2004) und sie ist Voraussetzung für einen verbesserten Umgang mit Gewalt (Finzel et al. 2003). 8. Eine Zwangsmaßnahme ist für PatientInnen ein klärungs- und aufarbeitungsbedürftiges Erlebnis mit einer z. T. demütigenden und traumatisierenden Wirkung (Anderl-Doliwa et al. 2005; Steinert 2008, S. 92–93; Steinert et al. 2004). Insbesondere eine Fixierung ist häufig ein in hohem Maße traumatisierender, bleibender Einschnitt (Asani, Eißmann & Danyluk 2007; Bärsch & Rohde 2008, S. 126; Schanz 2004), gehen doch mit einer Fixierung und der Anwendung körperlicher Gewalt starke Ängste und Gefühle des Ausgeliefertseins, der Hilf- und Wehrlosigkeit einher. In Verbindung mit der Verabreichung von Medikamenten wird die Fixierung als besonders schlimme und entwürdigende Pflegesituation beschrieben (Thiele 2005). Nach jeder Zwangsmaßnahme sollte deshalb eine strukturierte Nachbesprechung mit der betroffenen Patientin bzw. dem betroffenen Patienten erfolgen (inkl. Klärung der Notwendigkeit) und die psychische Nachbetreuung sichergestellt werden (Asani, Eißmann & Danyluk 2007; NICE 2005, S. 105; Richter & Berger 2001a; Steinert & Bergk 2008). Die Nachbesprechung mit den PatientInnen zielt u. a. auf die Vermeidung weiterer Eskalationen dieser Art ab. Allerdings können auch im Nachhinein nicht alle PatientInnen die Gründe und die Notwendigkeit der gesetzten Maßnahmen nachvollziehen (Thiele 2005). Etwa ein Drittel fühlt sich falsch behandelt (Steinert 2008, S. 92–93). Im Rahmen der Nachbesprechung mit den PatientInnen sollte auch geklärt werden, wie künftig in ähnlichen Situationen vorgegangen werden soll und welche Art von Zwangsmaßnahme von der jeweiligen Person 59 grundsätzlich präferiert wird (Anderl-Doliwa et al. 2005; Stefan & Schrenk 2008, S. 7). Durch Nachsorge und Unterstützung lässt sich das Risiko negativer Auswirkungen der Maßnahme reduzieren (Irwin 2006). Einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Detailliertheitsgrad klinikinterner Leitlinien und der Häufigkeit und durchschnittlichen Dauer von Zwangsmaßnahmen aller Art konnten Martin et al. (2007a) nachweisen. 8.3.2 Sachgerechte Durchführung von Zwangsmaßnahmen Nach Vorstellung wesentlicher Prinzipien bei der Anwendung von Zwangsmaßnahmen werden in den nächsten Unterkapiteln die mechanische Fixierung von PatientInnen sowie die Medikation gegen den Willen einer Person näher erörtert. Weltweit gibt es signifikante länderübergreifende Unterschiede hinsichtlich der Handhabung von Zwangsmaßnahmen. In Österreich wird v. a. auf mechanische Fixierungen, Netzbetten und Zwangsmedikation zurückgegriffen, während Isolierungen nicht prioritär angewandt werden. Österreich ist eines der wenigen Länder weltweit, in denen Netzbetten zum Einsatz kommen (Whittington, Baskind & Paterson 2006, S. 146–149). 8.3.2.1 Immobilisierung und mechanische Fixierung von PatientInnen Fixierungen zählen zu den schlimmsten Erfahrungen eines Menschen. Aus Sicht psychiatrisch Pflegender gehören sie zu den unangenehmsten beruflichen Tätigkeiten (Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 51; Schanz 2004; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 54). Die Empfehlungen, wie viele Personen für eine professionell durchgeführte Überwältigung und Fixierung benötigt werden, gehen auseinander. Für Asani, Eißmann & Danyluk (2007) sollte das Team aus sechs bis sieben Person bestehen, anderen erscheint eine Beteiligung von vier bis fünf MitarbeiterInnen angemessen und ausreichend (Bärsch & Rohde 2008, S.125) – optimal wären zwei weitere Hintergrundreserven (Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 56–57). Tatsächlich sind in der Praxis an der Überwältigung aggressiver PatientInnen zwischen zwei und zwanzig Personen beteiligt, wie aus einer Schweizer Studie hervorgeht. (Needham et al. 2002). Jede Überwältigung, Immobilisierung und Fixierung ist für alle daran Beteiligten ein nicht ungefährliches Unterfangen, das rasches und koordiniertes Handeln durch professionell 60 geschulte Personen erfordert, weil sich die PatientInnen meist heftig wehren. Insbesondere Immobilisierungen und Fixierungen, die unstrukturiert, planlos und unsachgemäß durchgeführt werden, können folgenschwere physische und psychische Verletzungen auf beiden Seiten nach sich ziehen. Es ist daher notwendig, dass im Vorfeld des Zugriffes Absprachen im Sinne einer Fixierungsplanung getroffen werden, damit es möglichst rasch gelingt, Kontrolle über die Person zu erlangen. Neben der Überwältigungsstrategie ist außerdem zu klären, wer als SprecherIn die Aktion leitet und wer für welchen Körperteil zuständig ist. Die Vorbereitung umfasst auch das Ablegen von Stiften, Halstüchern, Namensschildern, Schlüsseln etc. (Asani, Eißmann & Danyluk 2007; Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 51 & 57; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 54–59). Bei der Immobilisierung und Fixierung ist eine Gewaltanwendung auf Finger, Kehlkopf, Brustkorb, Augen, Abdomen, Hals und Genitalbereich aufgrund erhöhter Verletzungsgefahr unbedingt zu unterlassen (Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 65–66). Bei unruhigen PatientInnen entsprechen eine 2-Punkt- und eine 3-Punkt-Fixierung nicht dem „state of the art“. Daher sind sie – außer im Falle einer 1:1-Betreuung – nicht anzuwenden. Alternativen sind 4-Punkt-Fixierungen (mit durchgängigem Seitengitter) oder 5-Punkt-Fixierungen (mit Bauchgurt oder Schulter- und Brustgurt). Eine unsachgemäße Vorgehensweise kann zu Luxationen, Dekubitalschäden, Strangulationen, zum Absterben einer Extremität und im schlimmsten Fall zu letalen Thoraxkompressionen führen (Stefan & Schrenk 2008, S. 10). Mit dem Erwerb von Handlungskompetenzen reduziert sich bei der Durchführung von sämtlichen körperlichen Techniken das Verletzungsrisiko der PatientInnen und des Personals und dadurch reduzieren sich die verletzungsbedingten Personalausfallzeiten auf ein Minimum (Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 46). 8.3.2.2 Medikation gegen den Willen einer Person Ein aggressiver Erregungszustand erfordert rasches Handeln. Ziel einer pharmakologischen Intervention ist eine rasche Sedierung und Beruhigung der PatientInnen. Aus Sicherheitsgründen ist eine orale Zwangsmedikation einer parenteralen Applikation nach Möglichkeit vorzuziehen (NICE 2005, S. 100; SAMW 2004; Steinert & Bergk 2008). Die Vorgehensweise bei einer zwangsweisen Medikation erfolgt gemäß einem Stufenplan: anbieten der Medikation – überreden – erneutes Anbieten – Ankündigung von Zwang – Medikation gegen den Willen (Anderl-Doliwa et al. 2005; Stefan & Schrenk 2008, S. 11). Für die Durchführung einer Zwangsmedikation kann eine kurzfristige Fixierung erforderlich sein. 61 Umgekehrt müssen auch Fixierungen und Isolierungen in den meisten Fällen von sedierender Medikation begleitet werden (Anderl-Doliwa et al. 2005). 8.3.3 Überwachung von in ihrer Freiheit beschränkten PatientInnen In Österreich und auch in Deutschland hat es der Gesetzgeber verabsäumt, sich zur (pflegerischen) Betreuung und zum Grad der Überwachung freiheitsbeschränkter Menschen zu äußern. Wie engmaschig hat die Überwachung dieser Menschen zu sein? Ist eine lückenlose Beobachtung durch Sichtkontakt oder Sitzwache erforderlich, um PatientInnen vor Missbrauch und Gefahren zu schützen (Lenz 2009)? Oder genügt eine viertelstündliche Kontrolle, wie von Asani, Eißmann und Danyluk (2007) empfohlen? Das CPT (European Commitee for the Prevention of Torture and Inhumane or Degrading Treatment) hat der deutschen Bundesregierung nach Visitation psychiatrischer Einrichtungen und Gefängnisse im Jahr 2005 mitgeteilt, dass bei fixierten PatientInnen eine ständige, unmittelbare und persönliche Überwachung erwartet wird (Steinert & Bergk 2008). Eine kontinuierliche Sitzwache ist bei fixierten Personen aus therapeutischer und auch aus rechtlicher Sicht wünschenswert. Einige Kliniken praktizieren dies, andere Kliniken rechtfertigen sich mit unzureichender quantitativer Personalausstattung und der Erfahrung, dass PatientInnen die permanente Anwesenheit einer Aufsichtsperson ablehnen (Schanz 2004; Steinert et al. 2002). In der Leitlinie für den Umgang mit Zwangsmaßnahmen vom Arbeitskreis der Chefärzte und leitenden Pflegepersonen in psychiatrischen Kliniken in Rheinland-Pfalz werden die unmittelbare und durchgehende Betreuung fixierter und isolierter Personen (zumindest ständiger Blick- und Hörkontakt) und eine viertelstündliche Dokumentation empfohlen (Anderl-Doliwa et al. 2005). In der Leitlinie des OWS wird zumindest festgehalten, dass bei allen PatientInnen, die einer physischen Beschränkung unterliegen, zu deren Sicherheit eine engmaschige Überwachung und eine regelmäßige Kontrolle und Dokumentation des Zustands (Vitalzeichen, Bewusstseinslage, Ein- und Ausfuhr) im Überwachungsblatt erforderlich sind, gegebenenfalls auch die Dokumentation von Videoüberwachung und von Unterbrechungszeiten für Pflegehandlungen. In welchen Intervallen die Beobachtung und die Dokumentation stattfinden, hängt vom Zustand der jeweiligen Person ab (Stefan & Schrenk 2008, S. 12–14). Gemäß der Leitlinie des britischen NICE wird bei medizierten 62 PatientInnen im multidisziplinären Team situations- und personabhängig über Häufigkeit und Intensität der Überwachung und Dokumentation entschieden (NICE 2005, S. 102). Lediglich für isolierte PatientInnen, die zusätzlich mediziert wurden, gilt, dass sie kontinuierlich per Blickkontakt überwacht werden sollten. Sobald die Medikation Wirkung zeigt, ist die Isolierung aufzuheben (NICE 2005, S. 99). 8.3.4 Häufigkeit von Zwangsmaßnahmen Auch im 21. Jahrhundert sind Zwangsmaßnahmen als Reaktion auf aggressives PatientInnenverhalten gängige Praxis in psychiatrischen Einrichtungen auf der ganzen Welt (Needham et al. 2004). Heinze, Gaatz und Dassen (2005) bzw. Ketelsen et al. (2007) kamen in ihren Studien zum Schluss, dass bei jeder zweiten bzw. jeder dritten aggressiven Handlung (verbal, nonverbal oder tätlich) mit einer „harten“ Maßnahme, wie einer Fixierung, einer Isolierung oder kraftvollem Festhalten, interveniert wird. Das bedeutet, dass Gegenmaßnahmen des Personals zu einem beträchtlichen Teil institutionelle Gegengewalt beinhalten. In zwei repräsentativen Studien von Steinert et al. (2007) bzw. Martin et al. (2007a) in jeweils zehn psychiatrischen Kliniken zeigte sich, dass 8,4 bzw. 9,5 Prozent der behandelten Fälle mindestens einmal (im Durchschnitt etwa fünf Mal) eine Zwangsmaßnahme erfahren haben – mit erheblicher Varianz der Häufigkeit und Dauer der Maßnahmen je nach diagnostischer Gruppe und Klinik(struktur). Sehr hohe Häufigkeitswerte fanden sich in beiden Studien in den Diagnosegruppen F0 (organisch bedingte psychische Störungen) und F2 (schizophrene Störungen). In Kliniken, in denen für gerontopsychiatrische PatientInnen Behandlungsalternativen, wie bodennahe Lagerung der Matratzen, realisiert wurden, war der Anteil der betroffenen Fälle in der Diagnosegruppe F0 allerdings vergleichsweise gering (Martin et al. 2007a). Initiativen zur Reduzierung von Zwangsmaßnahmen wären dringend nötig (Steinert et al. 2007). Handlungsbedarf besteht etwa hinsichtlich der weiteren Entwicklung von Leitlinien und Standards zum fachgerechten Ablauf von Immobilisation und Zwangsmaßnahmen (Schanz 2004; Steinert & Kallert 2006; Wesuls, Heinzmann & Brinker 2005, S. 55). 63 8.4 Nachbesprechung und Nachsorge nach Gewalterlebnissen Aggressive Vorfälle, Gewaltereignisse und notwendig gewordene Zwangsmaßnahmen sind einschneidende Erlebnisse, die der Aufarbeitung und formellen Nachbesprechung im interdisziplinären Team bedürfen und nicht verdrängt werden sollten (Klinikum Stadt Hanau, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2005, S. 9; Lenz 2009; Stefan, Egger & Schrenk 2008, S. 7–8). Dabei geht es nicht um Schuldzuweisungen, sondern um Reflexion und konstruktive Fehleranalyse, denn Schuldzuschreibungen und Vorwürfe sind kontraproduktiv. Auch Bagatellisierungen sollten unterbleiben (Asani, Eißmann & Danyluk 2007; Stefan, Egger & Schrenk 2008, S. 7). Neben einer möglichst zeitnah stattfindenden Nachbesprechung ist auch eine ausreichende, praktische, emotionale und soziale Unterstützung bzw. (Nach-)Betreuung durch KollegInnen und Vorgesetzte wesentlich, um negativen Entwicklungen (im schlimmsten Falle Arbeitsunfähigkeit) vorzubeugen (International Labour Office et al. 2002, S. 26–27; Stefan, Egger & Schrenk 2008, S. 6–8; Klinikum Stadt Hanau, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2005, S. 9–10). Insbesondere die Unterstützung und Entlastung durch unmittelbare KollegInnen wird als hilfreich angesehen (Richter & Berger 2009; Richter, Fuchs & Bergers 2001, S. 73; Steinert & Bergk 2008). Die Nachsorge von betroffenen MitarbeiterInnen ist eine wichtige Führungsaufgabe. Sie umfasst jedoch nicht nur unterstützende und entlastende Gespräche, sondern, wenn es nötig ist, auch weitergehende Hilfestellung und Beratung sowie die Organisation professioneller Hilfe (Steinert 2008, S. 85–87). Das Management sollte all jenen, die ein Gewalterlebnis hatten, Unterstützung zukommen lassen (International Labour Office et al. 2002, S. 27) – häufig kommt es jedoch vor, dass die Betroffenen nicht ernst genug genommen werden und sich von Vorgesetzten nicht ausreichend unterstützt fühlen (Lenz 2009; Richter & Berger 2009). Die Fürsorgepflichten der ArbeitgeberInnen sollten deshalb möglichst verbindlich geregelt sein (Steinert & Bergk 2008; Steinert et al. 2004). Wenn ein Übergriff für das gesamte Team eine große Belastung darstellt und sich Konflikte ankündigen, ist eine Supervision für alle Teammitglieder in Erwägung zu ziehen (Steinert 2008, S. 87). Auf die Nachbesprechung mit den an Gewaltereignissen beteiligten PatientInnen und deren Nachbetreuung wurde bereits im Zuge der Beschreibung der Leitlinien im Umgang mit Zwangsmaßnahmen eingegangen (s. S. 59). 64 9 BEFRAGUNG PSYCHIATRISCH PFLEGENDER ZUR KOMPETENZEINSCHÄTZUNG IM UMGANG MIT AGGRESSIVEN PATI- ENTINNEN Im Rahmen dieser Arbeit wurde in der LSF Graz eine Fragebogenerhebung zum Thema Kompetenzerwartungen und Sicherheitsgefühl im Umgang mit aggressiven PatientInnen durchgeführt. 9.1 Zielsetzung der Untersuchung Ziel der gegenständlichen Arbeit ist es zu erheben, wie kompetent und sicher sich psychiatrisch Pflegende der LSF Graz im Umgang mit PatientInnenaggression fühlen. Im Besonderen soll untersucht werden, ob sich DPGKS/DPGKP, die an der Seminarreihe „Gewalt – ADE“ teilgenommen haben, von DPGKS/DPGKP, die nicht daran teilgenommen haben, unterscheiden, wobei auch das Geschlecht und die Berufserfahrung als weitere mögliche Einflussgrößen berücksichtigt werden. Die nachfolgend formulierten Fragestellungen bildeten die Basis der Untersuchung: 1. Wie schätzen DPGKS/DPGKP in der LSF Graz ihre Kompetenzerwartungen und ihr Sicherheitsgefühl im Umgang mit aggressiven PatientInnen ein? 2. Hat der Schulungsstatus einen Einfluss auf die Einschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls im Umgang mit aggressiven PatientInnen? 3. Hat das Geschlecht einen Einfluss auf die Einschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls im Umgang mit aggressiven PatientInnen? 4. Hat die Berufserfahrung einen Einfluss auf die Einschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls im Umgang mit aggressiven PatientInnen? 9.2 Fragebogenerstellung Der für die Erhebung erstellte Fragebogen gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil werden personenbezogene Daten wie Geschlecht, Alter, Berufserfahrung und Fortbildung erhoben. Weiters sollen zwei Suggestivfragen Aufschluss darüber geben, von welcher Bedeutung Schulungen und Berufserfahrung für einen angemessenen Umgang mit aggressi- 65 ven PatientInnen sind. Eine offene Frage gibt den Befragten die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen. Im zweiten Teil des Fragebogens werden Kompetenzerwartungen und Sicherheitsgefühl im Umgang mit aggressiven PatientInnen erfragt. Dies geschieht mittels der deutschsprachigen Version des von Thackrey (1987) entwickelten „Confidence in Coping With Patient Aggression Instruments“. Das Originalinstrument ist eine aus zehn Items bestehende eindimensionale Skala mit einem hohen Grad an interner Konsistenz (Cronbach’s Alpha = 0,92) und Genauigkeit (Standardfehler = 1,5). Die deutschsprachige Version stammt von Needham et al. (2005) und wurde für diese Untersuchung von Frau Adelheid Zeller, MNS, Fachhochschule St. Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, freundlicherweise zur Verfügung gestellt (Zeller 2009, pers. Komm., 24. April). Die Fragen 1, 4, 7 und 10 beziehen sich auf das Sicherheitsgefühl, die übrigen Fragen auf die Kompetenzerwartungen. Die Antworten werden in einer 5-Punkt-Likert-Skala erfasst, wobei ein höherer Wert eine höhere Zuversicht ausdrückt (Zeller, Needham & Halfens 2006). 9.3 Datenerhebung Der erstellte Fragebogen wurde an alle DPGKS/DPGKP der Erwachsenenstationen der LSF Graz (ausgenommen neurologische Stationen) ausgeteilt. Dem Fragebogen beigefügt wurde ein Anschreiben, das Informationen über die Untersuchung und klare Instruktionen zur Handhabung des Fragebogens enthielt. Anonymität der Befragung und vertrauliche Behandlung der Daten wurden zugesichert. Der Erhebungszeitraum beschränkte sich auf vier Wochen im Mai und Juni 2009. Von den 273 ausgegebenen Fragebögen wurden 139 retourniert. Das entspricht einer Rücklaufquote von 50,9 Prozent. Fragebogen und Anschreiben sind im Anhang der Arbeit abgebildet. 9.4 Datenauswertung Die aus den Fragebögen gewonnenen Daten wurden mittels „PASW Statistics“ (Version 17.0.2) mit deskriptiver und schließender Statistik ausgewertet. Vor der Auswertung erfolgte eine Datenkontrolle. Elf Fragebögen wurden von der Auswertung ausgeschlossen, weil darin keine Angaben zur Kompetenzeinschätzung gemacht wurden. Für die Auswertung verblieben 128 Fragebögen. 66 Thackrey (1987) folgend wurde eine Faktorenanalyse durchgeführt, um die Eindimensionalität der Skala an der vorliegenden Stichprobe zu überprüfen (KMK11 = 0,882). Es wurde eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimaxrotation durchgeführt. Es konnte ein Faktor (mit einem Eigenwert > 1) extrahiert werden, welcher rund 50 Prozent der Varianz aller zehn Items erklärt (Kaiser-Kriterium). Die Eindimensionalität war demzufolge gegeben. Um die interne Konsistenz der Items zu überprüfen, wurde weiters eine Reliabilitätsanalyse durchgeführt (Cronbach’s Alpha = 0,879). Der Wert war fast ebenso hoch wie in der Originalskala. Die Merkmale der befragten DGKS/DGKP (Geschlecht, Alter, Berufserfahrung und Schulungsstatus) sowie die Fragen nach der Bedeutsamkeit von Berufserfahrung und der Wichtigkeit von Schulungen wurden in Form von Häufigkeitstabellen und Grafiken ausgewertet. Um die zehn Items zu den Empfindungen im Umgang mit PatientInnenaggression auszuwerten, wurden ein Linienprofil (Mittelwerte) und ein Diagramm, das pro Item die prozentuelle Verteilung der Antworten auf die fünf Antwortmöglichkeiten abbildet, erstellt. Im Anschluss daran wurde mittels univariater Varianzanalysen untersucht, ob der Schulungsstatus, das Geschlecht und die Berufserfahrung einen Einfluss auf die Einschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls haben. Schulungsstatus und Geschlecht wurden als Faktoren in die Analysen einbezogen, die Berufserfahrung wurde als Kovariate einbezogen. Nach dieser Gesamtanalyse wurden geschulte und nicht geschulte Personen auch getrennt voneinander analysiert, um auch in den Untergruppen einen etwaigen Einfluss des Geschlechts und der Berufserfahrung auf die Einschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls zu bestimmen (univariate Varianzanalysen mit dem Faktor Geschlecht und der Kovariate Berufserfahrung). Erwies sich die Berufserfahrung bei einer Frage als signifikante Einflussgröße, wurde zusätzlich eine lineare Regressionsanalyse durchgeführt, um die Stärke der Einflussgröße zu quantifizieren und die Richtung des Zusammenhanges zu bestimmen. Das Signifikanzniveau wurde für alle durchgeführten statistischen Tests und Analysen entsprechend den allgemein gebräuchlichen Werten auf 0,05 festgelegt. 11 Das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (KMK) zeigt an, ob eine Faktorenanalyse sinnvoll erscheint. Wünschenswert ist ein Wert ≥ 0,8. Je höher der Wert, desto besser sind die Items für eine Faktorenanalyse geeignet (Backhaus et al. 2008, S. 336–337). 67 10 ERGEBNISSE DER ERHEBUNG In den nächsten Unterkapiteln werden die Ergebnisse der Datenauswertung präsentiert. 10.1 Hauptcharakteristika der Stichprobe Nachfolgend werden die befragten DGKS/DGKP hinsichtlich der Merkmale Geschlecht, Alter, Berufserfahrung und Schulungsstatus beschrieben (N = 128). 10.1.1 Geschlecht und Alter Die Auswertung der soziodemografischen Daten ergab erwartungsgemäß eine deutliche weibliche Überrepräsentation. Den 86 Frauen (67,7 Prozent) standen 41 Männer (32,3 Prozent) gegenüber; einmal fehlte die Angabe des Geschlechts. Diese Zahlen spiegeln das Geschlechterverhältnis des psychiatrischen GuKP-Personals in der Steiermark (67,16 versus 32,84 Prozent) wider (Statistik Austria 2009, S. 112). Exakt die Hälfte der Befragten war jünger als 41. Die genaue Altersverteilung ist Tabelle 2 zu entnehmen. Tabelle 2: Alter der Befragten in Jahren 68 10.1.2 Berufserfahrung in der psychiatrischen Pflege Wie im Histogramm ersichtlich, ist die Verteilung der Berufserfahrung leicht linkslastig (Schiefe = 0,55). Die durchschnittliche Berufserfahrung betrug 15,55 Jahre. Die Frauen hatten mit 14,44 Jahren (SD = 11,46; n = 79) im Schnitt fast drei Jahre weniger Berufserfahrung als die Männer (M = 17,34; SD = 11,38; n = 39). Dieser Unterschied erwies sich in einem t-Test bei unabhängigen Stichproben als nicht signifikant (p = 0,20). Abb. 5: Histogramm zur Berufserfahrung der Befragten 10.1.3 Fortbildungsstatus 48,4 Prozent (n = 61) der befragten DGKS/DGKP haben mindestens eines der Module der Seminarreihe „Gewalt – ADE“ besucht. Sie werden im Folgenden als „Geschulte“ bezeichnet, während Personen ohne jeglichen Seminarbesuch als „Ungeschulte“ gelten. Dies traf auf 51,6 Prozent der Befragten (n = 65) zu. Zwei Personen haben keine Angabe zu ihrem Schulungsstatus gemacht. Abb. 6 zeigt einen unterschiedlichen Schulungsstatus der Frauen und Männer, der sich in einem Chi-Quadrat-Test jedoch als nicht signifikant herausstellte (p = 0,177). Bei den Frauen lag der Prozentsatz der Geschulten bei 52,9 Prozent, bei den Männern war er mit 40,0 Prozent deutlich geringer. In diese Berechnung gingen aufgrund fehlender Angaben zum Schulungsstatus bzw. zum Geschlecht nur 125 Personen ein. 69 70 61 65 Häufigkeit 60 50 45 40 40 30 24 16 20 10 0 1 0 Frauen Männer Seminarreihe besucht keine Angabe zum Geschlecht gesamt Seminarreihe nicht besucht Abb. 6: Schulungsstatus von Frauen und Männern Den Workshop „Strategien in fremdaggressiven Notfallsituationen“ haben 47,5 Prozent der Befragten (n = 58) besucht. 31,4 Prozent (n = 38) haben sowohl an der Seminarreihe als auch am Übungsworkshop teilgenommen. Zwei Drittel (65,3 Prozent, n = 81) haben zumindest eines der beiden Angebote in Anspruch genommen. 57 SeminarteilnehmerInnen haben Angaben über die besuchten Module gemacht (s. Abb. 7): Die Mehrheit der Geschulten hat ein Modul besucht. n = 57 8,8 % 3,5 % 3,5 % 8,8 % 56,1 % 19,3 % 1 Modul 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module Abb. 7: Anzahl der besuchten Module pro SeminarteilnehmerIn 70 Modul 5 („Strategien bei herausforderndem Patientenverhalten – Sicherheitstechniken“) war das am häufigsten gewählte Modul. Gut ein Drittel der SchulungsteilnehmerInnen (35,1 Prozent, n = 20) hat dieses Modul besucht. Tabelle 3 vermittelt einen Eindruck von der Häufigkeitsverteilung. Tabelle 3: Modulbesuche – Häufigkeitsverteilung Aus der folgenden Tabelle geht hervor, dass die geschulten Frauen durchschnittlich etwas mehr Berufserfahrung hatten als die ungeschulten Frauen, bei den Männern war es umgekehrt. Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen Schulungsstatus und Berufserfahrung konnte in einem t-Test bei unabhängigen Stichproben nicht festgestellt werden (p = 0,806). Tabelle 4: Durchschnittliche Berufserfahrung der Geschulten und Ungeschulten geschult ungeschult gesamt M SD n M SD n M SD n weiblich 15,41 12,29 43 13,28 10,44 36 14,44 11,46 79 männlich 17,03 10,49 16 17,85 12,38 22 17,51 11,48 38 gesamt 15,85 11,76 59 15,02 11,33 58 15,44 11,51 117 Aufgrund fehlender Angaben (Geschlecht, Schulungsstatus, Berufserfahrung) konnten in diese Berechnung nur 117 Personen einbezogen werden. 71 10.2 Bedeutsamkeit von Berufserfahrung und Wichtigkeit von Schulungen für einen angemessenen Umgang mit aggressiven PatientInnen Die berufliche Erfahrung wird von nahezu allen Befragten (96,9 Prozent) als (sehr) bedeutsam für einen angemessenen Umgang mit aggressiven PatientInnen empfunden, und auch Schulungen werden von einem beträchtlichen Anteil der Befragten (90,6 Prozent) als (sehr) wichtig erachtet (s. Abb. 8). Jede zweite Person (49,6 Prozent) empfindet sowohl die berufliche Erfahrung als auch Schulungen als sehr bedeutsam bzw. sehr wichtig. 90 n = 127 78,0 80 Schulungen 70 Prozent 60 Berufserfahrung 57,5 50 40 33,1 30 18,9 20 6,3 10 2,4 3,1 0,8 0,0 0,0 0 sehr wichtig/ sehr bedeutsam wichtig/ bedeutsam weder noch nicht wichtig/ nicht bedeutsam gar nicht wichtig/ gar nicht bedeutsam Abb. 8: Bedeutsamkeit von beruflicher Erfahrung und Wichtigkeit von Schulungen für einen angemessenen Umgang mit aggressiven PatientInnen 10.3 Einschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls im Umgang mit aggressiven PatientInnen Zur Erhebung der Selbsteinschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls im Umgang mit aggressiven PatientInnen wurden den DGKS/DGKP zehn spezifische Fragen gestellt. Das folgende Liniendiagramm bildet ab, wie die befragten DGKS/DGKP ihre Kompetenzerwartungen und ihr Sicherheitsgefühl auf der fünfstufigen Likertskala durchschnittlich eingestuft haben. Je höher der Skalenwert, desto höher ist die wahrgenommene Kompetenz und desto besser ist das Sicherheitserleben. 72 Das arithmetische Mittel bewegt sich je nach Frage zwischen 2,39 (Frage 1) und 4,13 (Frage 2). Der Mittelwert aller Fragen beträgt 3,58 und liegt demnach im „positiven“ Bereich: Die Befragten schätzen ihre Kompetenzerwartungen und ihr Sicherheitsgefühl als mittelmäßig bis gut ein. 1. Wie fühlen Sie sich in der Arbeit mit einem aggressiven Patienten? 2. Wie gut ist Ihr Wissensstand im Umgang mit verbaler Aggression? 3. Wie gut sind Sie in der Lage, bei aggressiven Patienten physisch einzugreifen? 4. Wie selbstsicher fühlen Sie sich in der Gegenwart eines aggressiven Patienten? 5. Wie gut sind Sie in der Lage, bei aggressiven Patienten psychologisch einzugreifen? 6. Wie gut ist Ihr Wissensstand im Umgang mit physischer Aggression? 7. Wie sicher fühlen Sie sich in der Nähe eines aggressiven Patienten? 8. Wie wirksam sind die Ihnen bekannten Techniken für den Umgang mit Aggression? 9. Wie gut sind Sie in der Lage, auf die Bedürfnisse eines aggressiven Patienten einzugehen? 10. Wie gut sind Sie in der Lage, sich vor aggressiven Patienten zu schützen? Gesamtkompetenz Abb. 9: Liniendiagramm über die Empfindungen im Umgang mit aggressiven PatientInnen Aus den Mittelwerten der zehn Items wurde eine neue Variable (Gesamtkompetenz) berechnet, um globale Aussagen über die Kompetenzeinschätzung treffen zu können. Aus Abb. 10 sind einige Kennwerte dieses Kompetenzindexes zu entnehmen. M SD Maximum Minimum Schiefe N 3,58 0,56 4,7 1,9 –0,349 128 Abb. 10: Deskriptive Darstellung des Kompetenzindexes 73 Das folgende Diagramm zeigt die konkrete Häufigkeitsverteilung der Antworten auf die gestellten Fragen. Bei fast allen Fragen stufte sich ein Großteil der Befragten als gut bzw. sehr gut ein. Deutlich seltener wurden die Antworten nicht gut bzw. gar nicht gut angekreuzt. Trotz dieser im Allgemeinen positiven Tendenz geht aus den Antworten zu Frage 1 unmissverständlich hervor, dass sich die Hälfte der Befragten bei der Arbeit mit aggressiven PatientInnen unwohl bis sehr unwohl fühlt und dass sich nur 3,2 Prozent wohl oder sehr wohl fühlen. Weiters gab bei Frage 7 knapp ein Drittel der Befragten (29,7 Prozent) an, sich in der Gegenwart aggressiver PatientInnen nicht sicher oder gar nicht sicher zu fühlen. Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Frage 8 Frage 9 Frage 10 Durchschnitt 0% 20 % sehr gut 40 % 60 % 80 % gut w eder noch nicht gut 100 % gar nicht gut Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7 Frage 8 Frage 9 Frage 10 Durchschnitt sehr gut12 0,8 24,4 14,1 14,8 17,2 18,8 5,5 8,6 14,1 13,3 13,2 gut 2,4 65,4 45,3 45,3 62,5 57,0 28,1 60,9 67,2 56,3 49,0 weder noch 46,8 8,7 19,5 31,3 14,8 15,6 36,7 26,6 17,2 21,1 23,8 nicht gut 34,9 1,6 17,2 7,8 5,5 8,6 25,0 3,1 0,8 7,8 11,2 gar nicht gut 15,1 0,0 3,9 0,8 0,0 0,0 4,7 0,8 0,8 1,6 2,8 Abb. 11: Empfindungen im Umgang mit aggressiven PatientInnen – prozentuelle Verteilung der Antworten auf die fünf Antwortmöglichkeiten 12 Das Wort gut ist bei den Fragen 1, 4, 7 bzw. 8 durch wohl, selbstsicher, sicher bzw. wirksam zu ersetzen. 74 10.4 Einfluss der Faktoren Schulungsstatus, Geschlecht und Berufserfahrung auf die Einschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls im Umgang mit aggressiven PatientInnen Um die Frage zu beantworten, ob Schulungsstatus, Geschlecht und Berufserfahrung einen Einfluss auf die Einschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls im Umgang mit aggressiven PatientInnen haben, wurden univariate Varianzanalysen mit zwei Faktoren (Schulungsstatus, Geschlecht) und einer Kovariate (Berufserfahrung) durchgeführt. Bei den Fragen 3 und 6 zeigte sich ein signifikanter Effekt des Geschlechts. Bei den Fragen 4 und 6 zeigte sich ein signifikanter Effekt der Berufserfahrung. Der Schulungsstatus erwies sich bei keiner Frage als signifikante Einflussgröße. Eine Interaktion zwischen Geschlecht und Schulungsstatus konnte ebenfalls nicht festgestellt werden (s. Tabelle 5). Tabelle 5: Effekt von Schulungsstatus, Geschlecht und Berufserfahrung auf die Empfindungen im Umgang mit aggressiven PatientInnen (p-Werte) Frage …………………………... n = 117 Schulungsstatus Geschlecht Berufserfahrung Schulungsstatus x Geschlecht 1. Wie fühlen Sie sich in der Arbeit mit einem W aggressiven Patienten? 0,805 …….. 0,546 …….. 0,528 ……... 0,389 ……… 2. Wie gut ist Ihr Wissensstand im Umgang mit W verbaler Aggression? 0,667 …….. 0,197 …….. 0,178 ……… 0,288 ……… 3. Wie gut sind Sie in der Lage, bei aggressiW ven Patienten physisch einzugreifen? 0,697 …….. 0,014 …….. 0,174 ……… 0,711 ……… 4. Wie selbstsicher fühlen Sie sich in der GeW genwart eines aggressiven Patienten? 0,717 …….. 0,730 …….. 0,006 ……… 0,493 ……… 5. Wie gut sind Sie in der Lage, bei aggressiW ven Patienten psychologisch einzugreifen? 0,124 …….. 0,221 …….. 0,111 ……… 0,663 ……… 6. Wie gut ist Ihr Wissensstand im Umgang mit W physischer Aggression? 0,432 …….. 0,005 …….. 0,008 ……… 0,979 ……… 7. Wie sicher fühlen Sie sich in der Nähe eines W aggressiven Patienten? 0,938 …….. 0,148 …….. 0,748 ……… 0,903 ……... 8. Wie wirksam sind die Ihnen bekannten W Techniken für den Umgang mit Aggression? 0,279 …….. 0,223 …….. 0,475 ……… 0,616 ……... 9. Wie gut sind Sie in der Lage, auf die BeW dürfnisse eines aggressiven Patienten einW zugehen? 0,982 …….. …….. 0,964 …….. …….. 0,102 ……… ……… 0,563 ……. ……. 10. Wie gut sind Sie in der Lage, sich vor agW gressiven Patienten zu schützen? 0,772 …….. 0,831 …….. 0,746 …….. 0,420 …….. Gesamtkompetenz 0,591 0,116 0,103 0,776 75 Zusätzlich zu diesen Varianzanalysen mit den Variablen Schulungsstatus, Geschlecht und Berufserfahrung wurden geschulte und ungeschulte Personen auch getrennt voneinander analysiert (Varianzanalysen mit dem Faktor Geschlecht und der Kovariate Berufserfahrung). Dabei erwies sich die Berufserfahrung ausschließlich bei den Ungeschulten als signifikante Einflussgröße (Frage 3, Frage 4, Frage 6, Frage 7, Gesamtkompetenz) (s. Tabelle 6). Das Geschlecht erwies sich in keiner der beiden Untergruppen als signifikante Einflussgröße. Dass bei den Fragen 3 und 6 nunmehr kein signifikanter Einfluss des Geschlechts festgestellt werden konnte, dürfte auf die geringeren Fallzahlen zurückzuführen sein. Tabelle 6: Effekt von Geschlecht und Berufserfahrung auf die Empfindungen im Umgang mit PatientInnenaggression bei den geschulten und den nicht geschulten Personen (p-Werte) Frage geschult (n = 59) ungeschult (n = 58) Geschlecht Erfahrung Geschlecht Erfahrung 1. Wie fühlen Sie sich in der Arbeit mit einem W aggressiven Patienten? 0,792 …….. 0,100 …….. 0,210 …….. 0,477 …….. 2. Wie gut ist Ihr Wissensstand im Umgang mit W verbaler Aggression? 0,856 …….. 0,374 …….. 0,114 …….. 0,315 …….. 3. Wie gut sind Sie in der Lage, bei aggressiW ven Patienten physisch einzugreifen? 0,111 …….. 0,838 …….. 0,080 …….. 0,037 …….. 4. Wie selbstsicher fühlen Sie sich in der GeW genwart eines aggressiven Patienten? 0,867 …….. 0,237 …….. 0,486 …….. 0,003 …….. 5. Wie gut sind Sie in der Lage, bei aggressiW ven Patienten psychologisch einzugreifen? 0,215 …….. 0,300 ……. 0,622 …….. 0,226 …….. 6. Wie gut ist Ihr Wissensstand im Umgang mit W physischer Aggression? 0,052 …….. 0,193 …….. 0,057 …….. 0,013 …….. 7. Wie sicher fühlen Sie sich in der Nähe eines W aggressiven Patienten? 0,313 …….. 0,168 …….. 0,404 …….. 0,047 …….. 8. Wie wirksam sind die Ihnen bekannten W Techniken für den Umgang mit Aggression? 0,237 …….. 0,937 …….. 0,662 …….. 0,336 …….. 9. Wie gut sind Sie in der Lage, auf die BeW dürfnisse eines aggressiven Patienten einW zugehen? 0,721 …….. …….. 0,458 …….. ……………. 0,748 …….. …….. 0,126 …….. …………. 10. Wie gut sind Sie in der Lage, sich vor agW gressiven Patienten zu schützen? 0,712 …….. 0,486 …….. 0,521 …….. 0,779 …….. Gesamtkompetenz 0,307 0,915 0,287 0,033 Nachfolgend wird auf sämtliche Fragen, bei denen sich bei den Varianzanalysen signifikante Effekte herauskristallisierten, im Detail eingegangen. 76 10.4.1 Frage 3: Wie gut sind Sie in der Lage, bei aggressiven Patienten physisch einzugreifen? Die Varianzanalyse mit den Variablen Schulungsstatus, Geschlecht und Berufserfahrung ergab einen signifikanten Einfluss des Geschlechts (p = 0,014) auf die Einschätzung der physischen Interventionsfähigkeit im Umgang mit aggressiven PatientInnen (vgl. Tabelle 5): Die befragten Männer sehen sich signifikant besser in der Lage, bei aggressiven PatientInnen physisch einzugreifen, als die befragten Frauen. Die Berufserfahrung (p = 0,174) und der Schulungsstatus (p = 0,697) haben keinen signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung: Die Geschulten schätzen sich nur wenig besser ein als die Ungeschulten (s. Tabelle 7). Sowohl in Tabelle 7 als auch in Abb. 12 werden neben den Rohmittelwerten auch die um den Effekt der Berufserfahrung adjustierten Mittelwerte abgebildet. Bei den adjustierten Werten wurde der Einfluss der Berufserfahrung statistisch herausgerechnet, d. h., die Personen wurden so verglichen, als hätten alle gleich viel Berufserfahrung. Tabelle 7: Mittelwerte und adjustierte Mittelwerte – Frage 3 Rohmittelwerte M (SD) adjustierte Mittelwerte M (SE) geschult (n = 59) ungeschult (n = 58) gesamt (n = 117) geschult (n = 59) ungeschult (n = 58) gesamt (n = 117) weiblich (n = 79) 3,35 (0,97) 3,17 (1,08) 3,27 (1,02) 3,35 (0,16) 3,19 (0,17) 3,27 (0,12) männlich (n = 38) 3,81 (0,98) 3,82 (1,14) 3,82 (1,06) 3,79 (0,26) 3,79 (0,22) 3,79 (0,17) gesamt (n = 117) 3,47 (0,99) 3,41 (1,14) 3,57 (0,15) 3,49 (0,14) In der nachfolgenden Abb. wird das Ergebnis der Varianzanalyse auch grafisch dargestellt: Neben dem Geschlechterunterschied ist zu sehen, dass geschulte Frauen tendenziell etwas höhere Mittelwerte haben als ungeschulte Frauen, während sich die Werte der geschulten und der ungeschulten Männer nahezu gar nicht unterscheiden. 77 Frage 3 4,0 geschult geschult, adjustiert nicht geschult nicht geschult, adjustiert 3,9 3,8 Mittelwert 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 weiblich männlich Abb. 12: Wie gut sind Sie in der Lage, bei aggressiven Patienten physisch einzugreifen? (Frage 3) Neben dieser Gesamtanalyse wurden geschulte und ungeschulte Personen auch getrennt voneinander analysiert (Varianzanalyse mit den Variablen Geschlecht und Berufserfahrung). Es zeigte sich, dass die Berufserfahrung bei den ungeschulten Personen einen signifikanten Einfluss auf die Einschätzung der physischen Interventionsfähigkeit im Umgang mit aggressiven PatientInnen hat (p = 0,037). Bei den geschulten Personen hat die Berufserfahrung keinen signifikanten Effekt (p = 0,838) (vgl. Tabelle 6). Zur Bestimmung der Stärke und Richtung des festgestellten Zusammenhanges zwischen Berufserfahrung und Kompetenzeinschätzung ungeschulter Personen wurde eine lineare Regressionsanalyse (mit den Variablen Geschlecht und Berufserfahrung) durchgeführt. Der positive Beta-Wert (s. Tabelle 8) bedeutet, dass sich erfahrenere DGKS/DGKP besser in der Lage sehen, bei aggressiven PatientInnen physisch einzugreifen, als weniger erfahrene DGKS/DGKP. Der Einfluss der Berufserfahrung erwies sich als moderat 13. Tabelle 8: Lineare Regressionsanalyse – Frage 3 Beta p-Wert Variable Geschlecht 0,226 0,080 Variable Berufserfahrung 0,271 0,037* R2 = 0,169 n = 58 13 p ≤ 0,05 Je größer der absolute Betrag des standardisierten Regressionskoeffizienten Beta ist, desto stärker ist der vermutete Einfluss auf die abhängige Variable (Backhaus et al. 2008, S. 18). 78 10.4.2 Frage 4: Wie selbstsicher fühlen Sie sich in der Gegenwart eines aggressiven Patienten? Die Varianzanalyse ergab, dass die Berufserfahrung einen signifikanten Einfluss auf die Einschätzung der Selbstsicherheit in der Gegenwart aggressiver PatientInnen hat (p = 0,006), während der Schulungsstatus (p = 0,717) und das Geschlecht (p = 0,730) keinen signifikanten Einfluss haben: Die Geschulten unterscheiden sich kaum von den Ungeschulten. Die Männer fühlen sich insgesamt gesehen geringfügig selbstsicherer als die Frauen (s. Tabelle 9). Tabelle 9: Mittelwerte und adjustierte Mittelwerte – Frage 4 Rohmittelwerte M (SD) adjustierte Mittelwerte M (SE) geschult (n = 59) ungeschult (n = 58) gesamt (n = 117) geschult (n = 59) ungeschult (n = 58) gesamt (n = 117) weiblich (n = 79) 3,65 (0,90) 3,56 (0,74) 3,61 (0,82) 3,65 (0,13) 3,60 (0,14) 3,62 (0,10) männlich (n = 38) 3,63 (1,09) 3,82 (0,85) 3,74 (0,95) 3,59 (0,21) 3,77 (0,18) 3,68 (0,14) gesamt (n = 117) 3,64 (0,94) 3,66 (0,79) 3,62 (0,12) 3,68 (0,11) An der folgenden Abb. fällt auf, dass sich die ungeschulten Männer etwas selbstsicherer fühlen als die geschulten Männer. Bei den Frauen fühlen sich die Geschulten geringfügig selbstsicherer als die Ungeschulten. Frage 4 4,2 4,1 4,0 geschult geschult, adjustiert nicht geschult nicht geschult, adjustiert Mittelwert 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 weiblich männlich Abb. 13: Wie selbstsicher fühlen Sie sich in der Gegenwart eines aggressiven Patienten? (Frage 4) 79 Bei Analyse getrennt nach Schulungsstatus (geschult versus ungeschult) zeigte sich, dass die Berufserfahrung nur in der Gruppe der Ungeschulten einen signifikanten Einfluss auf die Einschätzung der Selbstsicherheit in der Gegenwart aggressiver PatientInnen hat (p = 0,003). Mittels Regressionsanalyse konnte festgestellt werden, dass Berufserfahrung und Einschätzung der Selbstsicherheit bei den ungeschulten Personen positiv korrelieren. Der Einfluss der Berufserfahrung ist moderat (s. Tabelle 10). Tabelle 10: Lineare Regressionsanalyse – Frage 4 Beta p-Wert Variable Geschlecht 0,088 0,486 Variable Berufserfahrung 0,385 0,003** 2 R = 0,169 n = 58 p ≤ 0,01 10.4.3 Frage 6: Wie gut ist Ihr Wissensstand im Umgang mit physischer Aggression? Die Varianzanalyse ergab, dass der Schulungsstatus keinen Einfluss auf die Einschätzung des Wissensstandes im Umgang mit physischer Aggression hat (p = 0,432). Die Geschulten schätzen ihren Wissensstand im Umgang mit physischer Aggression geringfügig höher ein als die Ungeschulten. Als signifikante Einflussgrößen kristallisierten sich bei dieser Frage sowohl die Berufserfahrung (p = 0,008) als auch das Geschlecht (p = 0,005) heraus. Die befragten Männer schätzen ihren Wissensstand signifikant höher ein als die befragten Frauen (s. Tabelle 11). Tabelle 11: Mittelwerte und adjustierte Mittelwerte – Frage 6 Rohmittelwerte M (SD) adjustierte Mittelwerte M (SE) geschult (n = 59) ungeschult (n = 58) gesamt (n = 117) geschult (n = 59) ungeschult (n = 58) gesamt (n = 117) weiblich (n = 79) 3,77 (0,90) 3,61 (0,80) 3,70 (0,86) 3,77 (0,12) 3,65 (0,13) 3,71 (0,09) männlich (n = 38) 4,25 (0,45) 4,14 (0,83) 4,18 (0,69) 4,22 (0,20) 4,09 (0,17) 4,16 (0,13) gesamt (n = 117) 3,90 (0,82) 3,81 (0,85) 4,00 (0,12) 3,87 (0,11) 80 Das Ergebnis der Varianzanalyse wird in Abb. 14 auch grafisch dargestellt. Die Abb. zeigt den signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern und den geringfügigen Unterschied zwischen den Geschulten und den Ungeschulten. Frage 6 4,4 geschult geschult, adjustiert nicht geschult nicht geschult, adjustiert 4,3 4,2 Mittelwert 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 weiblich männlich Abb. 14: Wie gut ist Ihr Wissensstand im Umgang mit physischer Aggression? (Frage 6) Bei Analyse getrennt nach Schulungsstatus zeigte sich, dass die berufliche Erfahrung wie schon bei den Fragen 3 und 4 nur in der Gruppe der ungeschulten Personen einen signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung des Wissenstandes im Umgang mit physischer Aggression hat (p = 0,013). Mittels Regressionsanalyse konnte festgestellt werden, dass Berufserfahrung und Einschätzung des Wissenstandes im Umgang mit physischer Aggression positiv korrelieren. Der Einfluss kann als moderat bezeichnet werden (s. Tabelle 12). Tabelle 12: Lineare Regressionsanalyse – Frage 6 Beta p-Wert Variable Geschlecht 0,241 0,057 Variable Berufserfahrung 0,317 0,013* 2 R = 0,189 n = 58 p ≤ 0,05 81 10.4.4 Frage 7: Wie sicher fühlen Sie sich in der Nähe eines aggressiven Patienten? Der Schulungsstatus (p = 0,938), das Geschlecht (p = 0,148) und die Berufserfahrung (p = 0,748) haben, wie die Varianzanalyse ergab, keinen signifikanten Einfluss auf die Einschätzung des Sicherheitsgefühls in der Nähe aggressiver PatientInnen. Geschulte und Ungeschulte unterscheiden sich hinsichtlich ihres Sicherheitsempfindens in der Nähe aggressiver PatientInnen nahezu nicht; die Männer fühlen sich etwas sicherer als die Frauen (s. Tabelle 13). Tabelle 13: Mittelwerte und adjustierte Mittelwerte – Frage 7 Rohmittelwerte M (SD) adjustierte Mittelwerte M (SE) geschult (n = 59) ungeschult (n = 58) gesamt (n = 117) geschult (n = 59) ungeschult (n = 58) gesamt (n = 117) weiblich (n = 79) 2,93 (0,91) 2,92 (0,87) 2,92 (0,89) 2,93 (0,14) 2,92 (0,16) 2,93 (0,11) männlich (n = 38) 3,19 (1,05) 3,23 (1,02) 3,21 (1,02) 3,18 (0,24) 3,22 (0,20) 3,20 (0,16) gesamt (n = 117) 3,00 (0,95) 3,03 (0,94) 3,06 (0,14) 3,07 (0,13) In der Abb. wird das Ergebnis der Varianzanalyse auch grafisch veranschaulicht. Auffällig sind die im Allgemeinen recht niedrigen Mittelwerte bei dieser Frage. Frage 7 3,6 3,5 3,4 geschult geschult, adjustiert nicht geschult nicht geschult, adjustiert Mittelwert 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 weiblich männlich Abb. 15: Wie sicher fühlen Sie sich in der Nähe eines aggressiven Patienten? (Frage 7) 82 Bei Analyse getrennt nach Schulungsstatus konnte in der Gruppe der Personen ohne Schulung wiederum ein signifikanter Effekt der Berufserfahrung festgestellt werden (p = 0,047). Die nach der Varianzanalyse durchgeführte Regressionsanalyse ergab einen positiven Zusammenhang zwischen Berufserfahrung und Einschätzung des Sicherheitsgefühls in der Nähe aggressiver PatientInnen. Der Einfluss der Berufserfahrung ist moderat (s. Tabelle 14). Tabelle 14: Lineare Regressionsanalyse – Frage 7 Beta p-Wert Variable Geschlecht 0,110 0,404 Variable Berufserfahrung 0,226 0,047* R2 = 0,094 n = 58 p ≤ 0,05 10.4.5 „Gesamtkompetenz“ Die Varianzanalyse ergab, dass auf die Variable Gesamtkompetenz weder der Schulungsstatus (p = 0,591) noch das Geschlecht (p = 0,116), noch die Berufserfahrung (p = 0,103) einen signifikanten Einfluss haben. Auch wenn keine signifikanten Einflüsse ermittelt werden konnten, geht aus den Daten hervor, dass sich die Geschulten generell etwas kompetenter und sicherer fühlen als die Ungeschulten und dass sich die Männer etwas kompetenter und sicherer fühlen als die Frauen (s. Tabelle 15). Tabelle 15: Mittelwerte und adjustierte Mittelwerte – Gesamtkompetenz Rohmittelwerte M (SD) adjustierte Mittelwerte M (SE) geschult (n = 59) ungeschult (n = 58) gesamt (n = 117) geschult (n = 59) ungeschult (n = 58) gesamt (n = 117) weiblich (n = 79) 3,56 (0,49) 3,45 (0,54) 3,51 (0,51) 3,56 (0,08) 3,47 (0,09) 3,51 (0,06) männlich (n = 38) 3,71 (0,55) 3,69 (0,67) 3,70 (0,62) 3,70 (0,14) 3,67 (0,12) 3,69 (0,09) gesamt (n = 117) 3,60 (0,50) 3,54 (0,60) 3,63 (0,08) 3,57 (0,07) 83 Die folgende Abb. zeigt die beschriebenen Tendenzen. Die Aussage, dass sich die Geschulten geringfügig kompetenter und sicherer fühlen als die Ungeschulten, trifft in erster Linie auf die Frauen zu. Gesamtkompetenz 4,2 geschult geschult, adjustiert nicht geschult nicht geschult, adjustiert 4,1 4,0 Mittelwert 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 weiblich männlich Abb. 16: Gesamtkompetenz Bei Analyse getrennt nach Schulungsstatus zeigte sich, dass die Berufserfahrung in der Gruppe der ungeschulten Personen einen signifikanten Einfluss auf die Variable Gesamtkompetenz hat (p = 0,033). Ein diesbezüglicher Einfluss konnte bei den geschulten Personen nicht festgestellt werden (p = 0,915). Die Regressionsanalyse ergab, dass bei den ungeschulten Personen Berufserfahrung und Kompetenzeinschätzung positiv korrelieren. DGKS/DGKP mit mehr Berufserfahrung fühlen sich demnach kompetenter und sicherer im Umgang mit aggressiven PatientInnen als DGKS/DGKP mit weniger Berufserfahrung (s. Tabelle 16). Tabelle 16: Lineare Regressionsanalyse – Gesamtkompetenz Beta p-Wert Variable Geschlecht 0,139 0,287 Variable Berufserfahrung 0,283 0,033* R2 = 0,115 n = 58 p ≤ 0,05 84 11 DISKUSSION UND SCHLUSSFOLGERUNG Im Folgenden werden die Ergebnisse der Arbeit zusammenfassend diskutiert und interpretiert und es wird ein Fazit gezogen. 11.1 Resumée und Kurzinterpretation der zentrale Ergebnisse In der vorliegenden Arbeit wurden nach einer einführenden Beschreibung der Ausbildung, Aufgaben und Belastungen psychiatrisch Pflegender, der Illustration diverser psychiatrischer Krankheitsbilder und der Darstellung der Phänomene Aggression und Gewalt in der psychiatrischen Pflege verschiedene Techniken der Deeskalation im Rahmen von Aggressions- und Gewaltereignissen beleuchtet. Durch die Beschreibung konkreter Deeskalationsstrategien konnten wichtige Impulse für die Arbeit in der Psychiatrie gegeben werden. Es wurde deutlich, dass psychologische Deeskalationstechniken das enorme Potenzial haben, tätliche Übergriffe zu verringern. Festzuhalten ist, dass zur erfolgreichen Deeskalation eine Vielzahl an Kompetenzen und Kenntnissen (wie gutes Wahrnehmungsvermögen, Empathie, hohe Gesprächsführungs- und Kommunikationskompetenz und Wissen über potenzielle Ursachen und Auslöser aggressiven Verhaltens) erforderlich ist. Nicht immer sind gewaltfreie Deeskalationsmaßnahmen ausreichend zur Entschärfung und Bewältigung einer Situation. Ist die Eskalation bereits zu weit fortgeschritten, muss zur Gefahrenabwehr körperlich interveniert werden. Die Anwendung von Zwang und Gewalt ist oftmals eine legitime Maßnahme, die notwendig ist zum Schutz der PatientInnen vor sich selbst, zum Schutz des Personals und anderer Personen oder zur Verbesserung des Gesundheitszustandes der PatientInnen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde auch der Frage nachgegangen, wie DPGKS/DPGKP der LSF Graz ihre Kompetenzerwartungen und ihr Sicherheitsgefühl im Umgang mit aggressiven PatientInnen einschätzen. Im Besonderen wurde mittels univariater Varianzanalysen der Einfluss des Schulungsstatus, des Geschlechts und der Berufserfahrung auf die Selbsteinschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls untersucht. 85 Zusammenfassend betrachtet lassen sich einige Tendenzen erkennen: 1. Die Auswertung der Daten ergab, dass die befragten Pflegepersonen ihre Kompetenzerwartungen und ihr Sicherheitsgefühl im Umgang mit aggressiven PatientInnen als mittelmäßig bis gut einschätzen. Der Durchschnittswert auf der fünfstufigen Skala zur Einschätzung der Empfindungen im Umgang mit PatientInnenaggression liegt bei 3,6. Besonders gut schätzen die befragten DGKS/DGKP ihren Wissensstand im Umgang mit verbaler Aggression ein, hingegen wird das Sicherheitsgefühl in der Nähe aggressiver PatientInnen sowie in der Arbeit mit aggressiven PatientInnen nur als mittelmäßig bis nicht gut bezeichnet. 2. Im Aggressionsmanagement geschulte Personen (v. a. Frauen) fühlen sich im Allgemeinen geringfügig kompetenter und sicherer als Personen, die im Aggressionsmanagement nicht geschult sind (p > 0,05). Dass der Schulungsstatus keinen signifikanten Einfluss auf die Einschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls hat, dürfte daran liegen, dass ein Großteil der Geschulten (56,1 Prozent) nur ein Modul der Seminarreihe „Gewalt – ADE“ besucht hat und dass die Seminarbesuche z. T. schon etwas länger zurückliegen (58,3 Prozent der Personen haben die Schulung vor dem Jahr 2009 besucht). Möglicherweise sind deshalb positive Auswirkungen auf Wissen und Zuversicht nicht (mehr) gegeben. 3. Die Auswertung der Daten ergab, dass sich die befragten Männer tendenziell kompetenter und sicherer fühlen als die befragten Frauen. Bei zwei Fragen (3 und 6) erwies sich das Geschlecht als signifikante Einflussgröße (p < 0,05). Dass sich Männer bei Frage 3 (physische Interventionsfähigkeit im Umgang mit aggressiven PatientInnen) signifikant besser einschätzen als Frauen, dürfte durch die körperliche Überlegenheit der Männer begründet sein. Bei der Beantwortung von Frage 6 (Wissensstand im Umgang mit physischer Aggression) könnte die soziale Erwünschtheit eine Rolle spielen und einen Teil des Unterschiedes zwischen weiblichem und männlichem Personal erklären. 4. Bei getrennter Analyse der Geschulten und der Ungeschulten zeigte sich, dass die berufliche Erfahrung bei den Geschulten keinen signifikanten Einfluss auf die Selbsteinschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls im Umgang mit aggressiven PatientInnen hat. Bei den Ungeschulten erwies sich die Berufserfahrung als signifikante Einflussgröße auf die Einschätzung der physischen Interventionsfähigkeit (Frage 3), der Selbstsicherheit in der Gegenwart aggressiver PatientInnen (Frage 4), des 86 Wissensstandes im Umgang mit physischer Aggression (Frage 6), des Sicherheitsgefühls in der Nähe aggressiver PatientInnen (Frage 7) und der Gesamtkompetenz im Umgang mit PatientInnenaggression. Die Daten belegen, dass sich ungeschulte DGKS/ DGKP mit mehr Berufserfahrung kompetenter und sicherer fühlen als DGKS/DGKP mit weniger Berufserfahrung. Im Laufe des Berufslebens sind psychiatrisch Pflegende regelmäßig mit aggressiven und gewalttätigen PatientInnen konfrontiert und erleben dabei eine Vielzahl an schwierigen Situationen, die es zu bewältigen gilt. Durch die dabei gemachten Erfahrungen gewinnen sie an Kompetenz und Selbstsicherheit und haben dadurch einen Vorsprung gegenüber KollegInnen mit weniger Berufsjahren. Es stellt sich die Frage, warum bei den Geschulten die Berufserfahrung keinen signifikanten Einfluss auf die Einschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls hat. Möglich ist es, dass Geschulte mit geringer Berufserfahrung durch die Schulung auf ein höheres Kompetenzniveau gelangen und von der Berufserfahrung nicht mehr so stark profitieren wie Ungeschulte. Es ist anzunehmen, dass durch Berufserfahrung das Manko einer fehlenden Schulung ausgeglichen werden kann. Das spricht dafür, (insbesondere) bei weniger erfahrenen Personen Schulungen durchzuführen. In dieser Arbeit wurde überprüft, wie Pflegende ihre Kompetenzerwartungen und ihr Sicherheitsgefühl im Umgang mit aggressiven PatientInnen einschätzen. Die Antworten spiegeln die persönliche Einschätzung wider, die sich nicht unbedingt mit der tatsächlichen Kompetenz decken muss. Auch Schlüsse über das tatsächliche Verhalten der Pflegenden in der Praxis können aus den Antworten nicht gezogen werden. 11.2 Kritische Reflexion der Fragebogenerhebung Eine Einschränkung der Untersuchung ist die nicht allzu große Untersuchungsgruppe (N = 128). Bei der notwendigerweise durchgeführten Aufgliederung in Geschulte und Ungeschulte setzten sich die beiden Gruppen aus nur rund 60 Personen zusammen. Bei größerer Fallzahl hätten sich u. U. weitere Signifikanzen ergeben. Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass der überwiegende Teil der SchulungsteilnehmerInnen nur ein Modul der Seminarreihe „Gewalt – ADE“ besucht hat und dass die Schulungen z. T. schon im Jahr 2007 bzw. im Jahr 2008 stattfanden. Es konnte folglich nur ein Vergleich zwischen Geschulten und Ungeschulten angestellt werden, unabhängig davon, wie viele und welche Module der Seminarreihe von den Befragten besucht wurden. In vergleichbaren Untersu87 chungen zur Selbsteinschätzung der Kompetenzerwartungen und des Sicherheitsgefühls wurde die Effektivität umfassender Trainingsprogramme im Aggressionsmanagement überprüft. 11.3 Vergleichende Erläuterungen Das in dieser Arbeit verwendete Instrument wurde wiederholt in Untersuchungen zur Überprüfung der Effektivität von Trainingsprogrammen eingesetzt. Verschiedene Studien kamen allesamt zum Ergebnis, dass durch ein umfassendes Training die subjektive Zuversicht, schwierige Situationen bewältigen zu können, steigt: In einer Studie von Thackrey (1987) berichtete die Interventionsgruppe nach dem Training als auch 18 Monate später über signifikant mehr Zuversicht als die nicht geschulte Kontrollgruppe (p < 0,001). Nau et al. (2009) überprüften den Effekt eines Trainingskurses im Aggressionsmanagement bei SchülerInnen in der Pflegeausbildung in Berlin und kamen zum Ergebnis, dass der Kurs eine signifikante Steigerung der Zuversicht im Umgang mit PatientInnenaggression bewirkt. Der Durchschnittswert veränderte sich auf der fünfstufigen Skala von 2,5 (vor der Schulung) auf 3,6 (nach der Schulung) (p < 0,001). In einer in der Schweiz durchgeführten Studie von Zeller, Needham und Halfens (2006) zur Überprüfung der Wirksamkeit einer Schulung im Aggressionsmanagement fühlten sich die Auszubildenden unmittelbar nach der Schulung sowie drei Monate später kompetenter und sicherer im Umgang mit aggressiven PatientInnen als davor (p ≤ 0,001). Auch der Unterschied zwischen der Experimentalgruppe und einer Kontrollgruppe erreichte bei sieben der zehn Items statistische Signifikanz (p ≤ 0,001). Auch bei einer Untersuchung von McGowan et al. (1999) auf psychiatrischen Stationen einer Klinik in Australien zeigten sich signifikante Prä-Post-Unterschiede: Sechs Monate nach erfolgtem Training (körperliche Interventionstechniken) waren die durchschnittlichen Itemwerte signifikant höher als vor dem Training (p ≤ 0,001). Angesichts dieser Studienergebnisse können v. a. bei weniger erfahrenen Personen Schulungen im Aggressionsmanagement als ein wichtiges Instrument für die Praxis empfohlen werden. 88 11.4 Implikationen für die Praxis Empfehlenswert für psychiatrische Einrichtungen sind Schulungen bzw. Trainingsprogramme, in denen im Sinne eines umfassenden Gesamtkonzeptes sowohl Deeskalationstechniken als auch körperliche Abwehr- und Interventionstechniken vermittelt werden. In Anbetracht der bisherigen Studienlage – positive Auswirkungen auf das Wissen und die Zuversicht wurden wiederholt belegt – haben sie in der Praxis für alle MitarbeiterInnen mit PatientInnenkontakt absolute Berechtigung. 11.5 Ausblick In psychiatrischen Einrichtungen stellen PatientInnenübergriffe einen erheblichen Risikofaktor für die Sicherheit des Personals dar. In Deutschland wird auf diesen zunehmend mit der Erarbeitung konkreter Leitlinien und Standards, mit der Forschung zu Gewaltprädiktoren, mit Sicherheitsbestrebungen und der Organisation von Schulungsmaßnahmen reagiert (Steinert et al. 2004). Zu hoffen bleibt, dass analog zu den Entwicklungen in anderen Ländern auch in Österreich die Etablierung von Standards, Leitlinien und Trainingsprogrammen weiter zunehmen wird. Diese Aktivitäten sind geeignet, sich dem Ziel der Gewaltminimierung anzunähern, und sie tragen den Forderungen nach hoher (Versorgungs-)Qualität Rechnung. Mit einer Fragebogenanmerkung einer DGKS mit langjähriger Berufserfahrung in der psychiatrischen Pflege soll diese Arbeit ihren Abschluss finden: „In der Ruhe liegt die Kraft, man benötigt eine starke Persönlichkeit, ein Feingefühl für Menschen, Objektivität und einen gesunden Hausverstand.“ 89 12 LITERATURVERZEICHNIS Abderhalden, C, Needham, I, Dassen, T, Halfens, R, Fischer JE & Haug HJ 2007, „Frequency and severity of aggressive incidents in acute psychiatric wards in Switzerland“, Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, vol. 3, no. 30. Abderhalden, C, Needham, I, Miserez, B, Almvik, R, Dassen, T, Haug, HJ & Fischer, JE 2004, „Predicting inpatient violence in acute psychiatric wards using the BrøsetViolence-Checklist: a multicentre prospective cohort study“, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 11, pp. 422–427. Almvik, R & Woods, P 2003, „Short-term risk prediction: the Bröset Violence Checklist“, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 10, pp. 236–238. Anderl-Doliwa, B, Breitmaier, J, Elsner, S, Kunz-Sommer, B & Winkler, I 2005, „Leitlinien für den Umgang mit Zwangsmaßnahmen“, Psychiatrische Pflege, Jg. 11, S. 100–102. Angermeyer, MC, Cooper, B & Link, BG 1998, „Mental disorder and violence: results of epidemiological studies in the era of de-institutionalization“, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, vol. 33, pp. S1–S6. Asani, F, Eißmann, I & Danyluk, K 2007, „Fixierung von Patienten bei Eigen- und Fremdgefährdung“, Psychiatrische Pflege, Jg. 13, S. 139–142. Backhaus, K, Erichson, B, Plinke, W & Weiber, R 2008, Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung, 12. vollständig überarb. Aufl., Springer, Berlin. Bärsch, T & Rohde, M 2008, Kommunikative Deeskalation: Praxisleitfaden zum Umgang mit aggressiven Personen im privaten und beruflichen Bereich, Books on Demand, Norderstedt. Bronneberg, G 2004a, Curriculum für die spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege: Band 1: Erstes Ausbildungsjahr, Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG), Wien. Bronneberg, G 2004b, Curriculum für die spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege: Band 2: Zweites Ausbildungsjahr, Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG), Wien. Bronneberg, G 2004c, Curriculum für die spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege: Band 3: Drittes Ausbildungsjahr, Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG), Wien. Brosch, W 2004, Psychiatrie. Eine Einführung für Psychotherapeuten, Psychologen und andere professionelle Helfer, 3. überarb. Aufl., LexisNexis Verlag ARD Orac, Wien. 90 Danzer, D, Hagleitner, J & Lehner, M 2006, Statistische Information zur Vollziehung des Unterbringungsgesetzes: Teil 6: 2003–2005, ÖBIG, Wien, Zugriff am 15. Mai 2010 <http://www.vertretungsnetz.at/fileadmin/user_upload/5_Patientenanwalt/OEBIG_En dbericht_Unterbringung_2006.pdf>. Delaney, J, Cleary, M, Jordan, R & Horsfall, J 2001, „An exploratory investigation into the nursing management of aggression in acute psychiatric settings“, International Journal of Mental Health Nursing, vol. 8, pp. 77–84. Dondalski, J 2003, „Zur Arbeitsbelastung in der psychiatrischen Pflege“, Psychiatrische Pflege, Jg. 9, S. 192–197. Duxbury, J 2002, „An evaluation of staff and patient views of and strategies employed to manage inpatient aggression and violence on one mental health unit: a pluralistic design“, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 9, pp. 325–337. Farrell, G & Cubit, K 2005, „Nurses under threat: A comparison of content of 28 aggression management programs“, International Journal of Mental Health Nursing, vol. 14, pp. 44–53. Finzel, M, Schmidmeier, R, Fric, M, Widauer, M & Laux, G 2003, „Aggressionen psychiatrischer Patienten – Erste Ergebnisse einer standardisierten Dokumentation des BZK Gabersee“, Psychiatrische Praxis, Jg. 30 (Suppl. 2), S. S196–S199. Fuchs, JM 1998, „Kontrollierter Umgang mit physischer Gewalt und Aggression in der Psychiatrie? Erfahrungsbericht über ein Praxisseminar“, in D Sauter & D Richter (Hrsg.), Gewalt in der psychiatrischen Pflege, Verlag Hans Huber, Bern. Grond, E 2007, Gewalt gegen Pflegende: Altenpflegende als Opfer und Täter, Verlag Hans Huber, Bern. Hartdegen, K 1996, Aggression und Gewalt in der Pflege, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. Hausmann, C 2005, Psychologie und Kommunikation für Pflegeberufe: Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis, Facultas Universitätsverlag, Wien. Heinrich, J 1989, Aggression und Streß: Ein Therapiemodell zur Interaktion massiver Auto-, Sach-, und Fremdaggressionen geistig Behinderter mit dem Streßverhalten ihrer Bezugspersonen, Deutscher Studien Verlag, Weinheim. Heinze, C, Gaatz, S & Dassen, T 2005, „Aggression in psychiatrischen Kliniken: Eine standardisierte Erfassung aggressiven Patientenverhaltens mit der Staff Observation Scale – Revised (SOAS-R)“, Psychiatrische Pflege, Jg. 11, S. 149–153. International Council of Nurses 1998, „Leitfaden zum Umgang mit Gewaltsituationen im Pflegealltag“, in D Sauter & D Richter (Hrsg.), Gewalt in der psychiatrischen Pflege, Verlag Hans Huber, Bern. 91 International Labour Office, International Council of Nurses, World Health Organisation & Public Services International 2002, Framework Guideline for addressing workplace violence in the health sector, International Labour Office, Genf, Zugriff am 15. Mai 2010, <http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/health/guidelines.pdf>. Irwin, A 2006, „The nurse’s role in the management of aggression“, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 13, pp. 309–318. „ISPN Position Statement on the Use of Restraint and Seclusion“ 2001, Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, vol. 14, no 3, pp. 100–102. Katschnig, H, Denk, P & Scherer, M 2004, Österreichischer Psychiatriebericht 2004. Analysen und Daten zur psychiatrischen und psychosozialen Versorgung der österreichischen Bevölkerung, Ludwig Boltzmann Institut für Sozialpsychiatrie, Wien, Zugriff am 15. Mai 2010, <http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/attachments/9/9/5/CH0963/CMS1098965386003/oe sterreichischer_psychiatriebericht_2004_katschnig_et_al.pdf>. Katschnig, H, Ladinser, E, Scherer, M, Sonneck, G & Wancata, J 2001, Österreichischer Psychiatriebericht 2001. Teil 1: Daten zur psychiatrischen und psychosozialen Versorgung der österreichischen Bevölkerung, Ludwig-Boltzmann-Institut für Sozialpsychiatrie, Wien, Zugriff am 15. Mai 2010, <http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/attachments/8/5/0/CH0963/CMS1038920009809/ps ychatriebericht_teil_i1.pdf>. Ketelsen, R, Zechert, C, Driessen, M & Schulz, M 2007, „Characteristics of aggression in a German psychiatric hospital and predictors of patients at risk“, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 14, pp. 92–99. Kienzle, T & Paul-Ettlinger, B 2001, Aggression in der Pflege: Umgangsstrategien für Pflegebedürftige und Pflegepersonal, Kohlhammer, Stuttgart. Klinikum Stadt Hanau, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2005, Leitlinien zum Umgang mit aggressivem und gewalttätigem Verhalten, Hanau. Kopetzki, Ch. 1997, Grundriß des Unterbringungsrechts, Springer, Wien. Krainz, S (Hrsg.) 2004, Menschen in Krisensituationen: Ein sozial-psychiatrischer Leitfaden, Leykam, Graz. Lenz, BG 2009, „Gewalt ausüben – erfahren – vermeiden: Gewalt in der Pflege“, Die Schwester/Der Pfleger, Jg. 48, Nr. 2, S. 140–143. Martin, V, Kuster, W, Baur, W, Bohnet, U, Hermelink, G, Knopp, M, Kronstorfer, R, Martinez-Funk, B, Roser, M, Voigtländer, W, Brandecker, R & Steinert, T 2007a, „Die Inzidenz von Zwangsmaßnahmen als Qualitätsindikator in psychiatrischen Kliniken. Probleme der Datenerfassung und -verarbeitung und erste Ergebnisse“, Psychiatrische Praxis, Jg. 34, S. 26–33. 92 Martin, V, Bernhardsgrütter, R, Goebel, R & Steinert, T 2007b, „The use of mechanical restraint and seclusion in patients with schizophrenia: A comparison of the practice in Germany and Switzerland“, Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, vol. 3, no. 1. Mattitsch, E 2006, Prävalenz von Aggressions- und/oder Gewalterfahrungen von Pflegenden durch Patienten/innen und/oder Angehörige in den Steiermärkischen Krankenanstalten der KAGes, Diplomarbeit, Fachhochschule Technikum Kärnten. McGowan, S, Wynaden, D, Harding, N, Yassine, A & Parker, J 1999, „Staff confidence in dealing with aggressive patients: A benchmarking exercise“, Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing, vol. 8, pp. 104–108. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 2005, Violence: The shortterm management of disturbed/violent behaviour in in-patient psychiatric settings and emergency departments, Royal College of Nursing, London, Zugriff am 15. Mai 2010, <http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/cg025fullguideline.pdf>. Needham, I, Abderhalden, C, Dassen, T, Haug, HJ & Fischer, JE 2002, „Coercive procedures and facilities in Swiss psychiatry“, Swiss Medical Weekly, vol. 132, pp. 253–258. Needham, I, Abderhalden, C, Halfens, RJG, Fischer, JE & Dassen, D 2005, „Non-somatic effect of patient aggression on nurses: a systematic review“, Journal of Advanced Nursing, vol. 49, no. 3, pp. 283–296. Needham, I, Abderhalden, C, Meer, R, Dassen, T, Haug, HJ, Halfens, RJG & Fischer, JE 2004, „The effectiveness of two interventions in the management of patient violence in acute mental inpatient settings: report on a pilot study“, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 11, pp. 595–601. Nijman, HLI, à Campo, JMLG, Ravelli, DP & Merckelbach, HLGJ 1999, „A Tentative Model of Aggression on Inpatient Psychiatric Wards“, Psychiatric Services, vol. 50, no. 6, pp. 832–834. Nolan, P, Dallender, J, Soares, J, Thomsen, S & Arnetz, B 1999, „Violence in mental health care: the experience of mental health nurses and psychiatrists“, Journal of Advanced Nursing, vol. 30, no. 4, pp. 934–941. Ottermann, B 2003, „Leitlinien zur Einleitung von freiheitsbeschränkenden Zwangsmaßnahmen in bayerischen Bezirkskrankenhäusern“, Krankenhauspsychiatrie, Jg. 14, S. 73–75. Oud, NE 2006, „Aggression Management Training Programs: Contents, Implementation, and Organization“, in D Richter & R Whittington (eds.), Violence in Mental Health Settings: Causes, Consequences, Management, Springer, New York. Pflegedirektion LSF 2008, Innerbetriebliche Fortbildung LSF: Programm 2009, KAGes, Graz. Piegler, T & Sefke, R 2001, „Die Rolle des Pflegepersonals im Behandlerteam einer psychiatrischen Station“, Psychiatrische Pflege, Jg. 7, S. 317–322. 93 Richter, D 1998, „Gewalt und Gewaltprävention in der psychiatrischen Pflege – eine Übersicht über die Literatur“, in D Sauter & D Richter (Hrsg.), Gewalt in der psychiatrischen Pflege, Verlag Hans Huber, Bern. Richter, D 2005, Effekte von Trainingsprogrammen zum Aggressionsmanagement in Gesundheitswesen und Behindertenhilfe: Systematische Literaturübersicht, Westfälische Klinik Münster, Münster, Zugriff am 15. Mai 2010, <http://miami.unimuenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-2473/richter.pdf>. Richter, D & Berger, K 2001a, „Gewaltsituationen in der psychiatrischen Pflege: Zusammenfassende Ergebnisse einer Studie über die Häufigkeit, körperliche und psychische Folgen sowie Präventionsmöglichkeiten’, Psychiatrische Pflege, Jg. 7, S. 242–247. Richter, D & Berger, K 2001b, „Patientenübergriffe auf Mitarbeiter: Eine prospektive Untersuchung der Häufigkeit, Situationen und Folgen“, Der Nervenarzt, Jg. 72, Nr. 9, S. 693–699. Richter, D & Berger, K 2009, „Psychische Folgen von Patientenübergriffen auf Mitarbeiter: Prospektive und retrospektive Daten“, Der Nervenarzt, Jg. 80, Nr. 1, S. 68–73. Richter, D, Fuchs, JM & Bergers, KH 2001, Konfliktmanagement in psychiatrischen Einrichtungen, Prävention in NRW, Band 1, Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe, Rheinischer Unfallversicherungsverband & Landesunfallkasse Nordrhein-Westfalen, Münster, Zugriff am 15. Mai 2010, <http://www.luknrw.de/downloads/konfliktmanagement.pdf>. Richter, D & Needham, I 2007, „Effekte von mitarbeiterbezogenen Trainingsprogrammen zum Aggressionsmanagement in Einrichtungen der Psychiatrie und Behindertenhilfe – Systematische Literaturübersicht“, Psychiatrische Praxis, Jg. 34, S. 7–14. Richter, D & Sauter, D 1998, „Aspekte der Gewalt in der psychiatrischen Pflege: Anstelle einer Einleitung“, in D Sauter & D Richter (Hrsg.), Gewalt in der psychiatrischen Pflege, Verlag Hans Huber, Bern. Richter, D & Whittington, R (eds.) 2006, Violence in Mental Health Settings: Causes, Consequences, Management, Springer, New York. Ringbeck, E 1998, „Theorie und Praxis des pflegerischen Umgangs mit aggressiven und gewalttätigen Patienten“, in D Sauter & D Richter (Hrsg.), Gewalt in der psychiatrischen Pflege, Verlag Hans Huber, Bern. Rohde, M 2008, „Gewaltprävention auf psychiatrischen Akutstationen als Aufgabe der Pflege“, Psychiatrische Pflege, Jg. 14, S. 147–152. Rothenhäusler, HB & Täschner KL 2007, Kompendium Praktische Psychiatrie, SpringerVerlag, Wien. Rüesch, P, Miserez, B & Hell, D 2003, „Gibt es ein Täterprofil des aggressiven Psychiatrie-Patienten?“, Der Nervenarzt, Jg. 74, Nr. 3, S. 259–265. Sailas, EES & Fenton, M 2000, „Seclusion and restraint for people with serious mental illness (Review)“, Cochrane Database of Systematic Reviews. 94 Sauter, D & Richter, D (Hrsg.) 1998, Gewalt in der psychiatrischen Pflege, Verlag Hans Huber, Bern. Schanda, H & Taylor, P 2001, „Aggressives Verhalten psychisch Kranker im stationären Bereich: Häufigkeit, Risikofaktoren, Prävention“, Fortschritte der Neurologie – Psychiatrie, Jg. 69, S. 443–452. Schanz, B 2004, „Fixierung und Überwachung von fixierten Patienten“, Psychiatrische Pflege, Jg. 10, S. 138–143. Schanz, B & Klawe, C 2005, „Gewalt in der Psychiatrie: Teil 1“, Psychiatrische Pflege, Jg. 11, S. 264–267. Selg, H, Mees, U & Berg, D 1997, Psychologie der Aggressivität, 2. überarb. Aufl., Hogrefe Verlag für Psychologie, Göttingen. Statistik Austria 2009, Statistisches Jahrbuch Österreichs 2009, Bundesanstalt Statistik Austria, Zugriff am 15. Mai 2010, <http://www.statistik.at/web_de/services/stat_jahrbuch/index.html>. Stefan, H 2005, „aggression, gewalt im gesundheitsbereich“, Österreichische Pflegezeitschrift, Jg. 08/09, S. 15–18. Stefan, H & Schrenk, W 2008, Leitlinie bei der Verwendung von Beschränkungsmethoden in der Psychiatrie nach §33 ff UbG (sogenanntes Psychiatrisches Intensivbettes, Fixiersystemen („Fixiergurten“), Einsatz der Videoüberwachung), 8. überarbeitete Fassung, Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe, Psychiatrisches Zentrum, Wien. Stefan, H, Egger, W & Schrenk, W 2008, Traumatisierende Ereignisse: Leitlinie „Traumatisierende Ereignisse am Arbeitsplatz – Hilfe für betroffene MitarbeiterInnen, OWS, Wien. Steinert, T 2001a, „Ethische Probleme in der psychiatrischen Behandlung und Pflege“, Psychiatrische Pflege, Jg. 7, S. 32–36. Steinert, T 2001b, „Psychische Krankheit und Gewaltkriminalität: Mythen und Fakten“, Deutsche Medizinische Wochenschrift, Jg. 126, S. 378–382. Steinert, T 2002a, „Die Crux mit der Gewalt: The Dilemma of Violence in Psychiatry“, Psychiatrische Praxis, Jg. 20, S. 59–60. Steinert, T 2002b, „Gewalttätiges Verhalten von Patienten in Institutionen: Vorhersagen und ihre Grenzen“, Psychiatrische Praxis, Jg. 29, S. 61–67. Steinert, T 2002c, „Prediction of inpatient violence“, Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 106 (Suppl. 412), pp. 133–141. Steinert, T 2008, Basiswissen: Umgang mit Gewalt in der Psychiatrie, Psychiatrie-Verlag, Bonn. 95 Steinert, T & Baur, M 2004, „Erfassung und Reduktion von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Krankenhaus“, Psychiatrische Praxis, Jg. 31 (Suppl. 1), S. S18–S20. Steinert, T & Bergk, J 2008, „Aggressives und gewalttätiges Verhalten: Diagnostik, Prävention, Behandlung“, Der Nervenarzt, Jg. 79, Nr. 3, S. 359–370. Steinert, T & Kallert, TW 2006, „Medikamentöse Zwangsbehandlung in der Psychiatrie“, Psychiatrische Praxis, Jg. 33, S. e1–e12. Steinert, T, Brenner, R, Deifel, G, Koch, K, Kohler, T, Onnen, V, Schmidt-Michel, PO, Süß, C & Vollmer, E 2006, Leitlinien für den Umgang mit Zwangsmaßnahmen, 7. überarbeitete Fassung, ZfP Weissenau, Abteilung Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie, Sektor Allgäu, Ravensburg und Bodenseekreis. Steinert, T, Fischer-Erlewein, E, Kuster, W, Pape, C, Schwink, A & Stuhlinger, M 2002, „Prävention von Gewalt im psychiatrischen Krankenhaus: Erste Ergebnisse einer multizentrischen Arbeitsgemeinschaft aus Baden-Württemberg und Bayern“, Krankenhauspsychiatrie, Jg. 13, S. 132–137. Steinert, T, Martin, V, Baur, M, Bohnet, U, Goebel, R, Hermelink, G, Kronstorfer, R, Kuster, W, Martinez-Funk, B, Roser, M, Schwink, A & Voigtländer, W 2007, „Diagnosis-related frequency of compulsory measures in 10 German psychiatric hospitals and correlates with hospital characteristics“, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, vol. 42, no. 2, pp. 140–145. Steinert, T, Schmid, P, Abderhalden, C & Needham, I 2004, „Management von Aggression und Gewalt in psychiatrischen Krankenhäusern“, Krankenhauspsychiatrie, Jg. 15, S. 146–150. Steinert, T, Wiebe, C & Gebhardt, RP 1999, „Aggressive Behavior Against Self and Others Among First-Admission Patients With Schizophrenia“, Psychiatric Services, vol. 50, no. 2, pp. 85–90. Steinert, T, Wölfle, M & Gebhardt, RP 2000, „Measurement of violence during in-patient treatment and association with psychopathology“, Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 102, pp. 107–112. te Wildt, BT, Hauser, U & Kropp, S 2006, „Deeskalations- und Selbstverteidigungstraining für die Mitarbeiter einer psychiatrischen Klinik“, Krankenhauspsychiatrie, Jg. 17, S. 9–14. Thackrey, M 1987, „Clinician Confidence in Coping With Patient Aggression: Assessment and Enhancement“, Professional Psychology: Research and Practice, vol. 18, no. 1, pp. 57–60. Thiele, P 2005, „Ethische Aspekte bei der Pflege fixierter psychisch erkrankter Menschen“, Psychiatrische Pflege, Jg. 13, S. 131–137. Walter, G 1998, „Pflegerischer Umgang mit aggressiven chronischen Patienten: ein Fallbeispiel“, in D Sauter & D Richter (Hrsg.), Gewalt in der psychiatrischen Pflege, Verlag Hans Huber, Bern. 96 Weltgesundheitsorganisation 2003, Gewalt und Gesundheit: Zusammenfassung, Weltgesundheitsorganisation, Zugriff am 15. Mai 2010, http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_g e.pdf>. Wesuls, R, Heinzmann, T & Brinker, L 2005, Professionelles Deeskalationsmanagement (ProDeMa): Praxisleitfaden zum Umgang mit Gewalt und Aggression in den Gesundheitsberufen, 4. Aufl., Unfallkasse Baden-Württemberg, Stuttgart, Zugriff am 15. Mai 2010, <http://www.bag-kjp.de/fachbeitrag_professionelles-deeskalationsmanagement.pdf>. Whittington, R, Baskind, E & Paterson, B 2006, „Coercive Measures in the Management of Imminent Violence: Restraint, Seclusion and Enhanced Observation“, in D Richter & R Whittington (eds.), Violence in Mental Health Settings: Causes, Consequences, Management, Springer, New York. Whittington, R & Patterson, P 1996, „Verbal and non-verbal behaviour immediately prior to aggression by mentally disordered people: enhancing the assessment of risk“, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, vol. 3, pp. 47–54. Winkler, P, Rottenhofer, I, Pochobradsky, E & Riess, G 2006, Österreichischer Pflegebericht, Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG), Zugriff am 15. Mai 2010, <http://www.boegk.at/service/pflegebericht_2006.pdf>. Zeh, A, Schablon, A, Wohlert, D, Richter, D & Nienhaus, A 2009, „Gewalt und Aggression in Pflege- und Betreuungsberufen – Eine Literaturübersicht“, Das Gesundheitswesen. 97 13 VERZEICHNIS DER GESETZE UND VERORDNUNGEN Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 1997 (Österreich) Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildungsverordnung 1999 (Österreich) Steiermärkisches Krankenanstaltengesetz 1999 (Steiermark) Strafgesetzbuch 1974 (Österreich) Unterbringungsgesetz 1990 (Österreich) 98 ANHANG 99 Graz, 12. Mai 2009 Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen meiner Masterarbeit im Gesundheits- und Pflegewissenschaftsstudium bearbeite ich das Thema Aggression und Gewalt gegen Pflegende. Mein Ziel ist es, mittels beiliegendem Fragebogen zu erheben, welche Empfindungen diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegepersonen im Umgang mit aggressiven Patientinnen und Patienten haben. Bitte, nehmen Sie sich etwas Zeit zur Beantwortung der Fragen! Lassen Sie keine Frage aus und kreuzen Sie spontan die Antwort an, die am ehesten zutrifft. Die Fragebögen werden von mir anonym ausgewertet und selbstverständlich streng vertraulich behandelt. Bitte retournieren Sie den ausgefüllten Fragebogen im verschlossenen Kuvert bis Mittwoch, 10. Juni 2009, an Ihre Stationsleitung oder an Frau Waltraud Koller (Posteinlaufstelle). Die verschlossenen Kuverts werden in der Folge an mich weitergeleitet. Für allfällige Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung! Sonja Bloder, BSc E-Mail: [email protected] 100 FRAGEBOGEN zu Empfindungen im Umgang mit aggressiven und gewalttätigen Patientinnen und Patienten 1. Fragen zu Ihrer Person Geschlecht: weiblich männlich Wann haben Sie Ihr Diplom zur psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflegeperson erworben? Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie in der psychiatrischen Pflege? Haben Sie den Workshop „Strategien in fremdaggressiven Notfallsituationen“ besucht? Haben Sie an der Seminarreihe „Gewalt – ADE“ teilgenommen? Alter: 21 bis 30 31 bis 40 41 bis 50 51 und älter 2004 oder später 2003 oder früher …..…. Jahr(e) nein ja nein ja, im Jahr 2007 ja, im Jahr 2008 ja, im Jahr 2009 Wenn ja, welche(s) Modul(e) haben Sie besucht? fünftägiger Intensivkurs Deeskalationsmanagement Modul 1 – Ich bin es mir (selbst)wert – Empathie für meine Persönlichkeit Modul 2 – Empathische Kommunikation zur Konfliktprophylaxe Modul 3 – Empathische Kommunikation zur Deeskalation von drohenden Gewalt- und Konfliktsituationen Modul 4 – (Konflikt)Situationen wahrnehmen und richtig einschätzen Modul 5 – Strategien bei herausforderndem Patientenverhalten – Sicherheitstechniken Modul 6 – Rechtliche Grundlagen und Rechtsfragen bei fremdaggressivem Verhalten Modul 7 – Medizinische Behandlung und Pflege im Rahmen einer fremdaggressiven Notfallsituation Modul 8 – Psychiatrische Krankheitsbilder im Kontext von Gewalt gegen sich und andere Modul 9 – Stressbewältigung während und nach fremd- und autoaggressivem Verhalten Modul 10 – Nachbetreuung und Unterstützung nach Aggressionsereignissen Wie wichtig schätzen Sie Schulungen für einen angemessenen Umgang mit aggressiven und gewalttätigen Patienten ein? sehr wichtig wichtig weder noch nicht wichtig gar nicht wichtig Wie bedeutsam schätzen Sie Ihre Erfahrung für einen angemessenen Umgang mit aggressiven und gewalttätigen Patienten ein? sehr bedeutsam bedeutsam weder noch nicht bedeutsam gar nicht bedeutsam Möchten Sie dazu noch etwas sagen? ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….…….………. …………………………………………………………………………………………….…………….. …………………………………………………………………………………………………………... 2. Fragen zu Empfindungen im Umgang mit aggressiven Patientinnen und Patienten (Zeller, A 2009, pers. Komm., 27 April) 1. Wie fühlen Sie sich in der Arbeit mit einem aggressiven Patienten? sehr wohl wohl weder noch unwohl sehr unwohl 2. Wie gut ist Ihr Wissensstand im Umgang mit verbaler Aggression? (Beisp.: herablassende, beschimpfende, drohende Äußerungen) sehr gut gut weder noch nicht gut gar nicht gut 3. Wie gut sind Sie in der Lage, bei aggressiven Patienten physisch einzugreifen? (Beisp.: Einsatz von Abwehrtechniken) sehr gut gut weder noch nicht gut gar nicht gut 4. Wie selbstsicher fühlen Sie sich in der Gegenwart eines aggressiven Patienten? sehr selbstsicher selbstsicher weder noch nicht selbstsicher gar nicht selbstsicher 5. Wie gut sind Sie in der Lage, bei aggressiven Patienten psychologisch einzugreifen? (Beisp.: Einsatz von verbaler und nonverbaler Kommunikation) sehr gut gut weder noch nicht gut gar nicht gut 6. Wie gut ist Ihr Wissensstand im Umgang mit physischer Aggression? sehr gut gut weder noch nicht gut gar nicht gut 7. Wie sicher fühlen Sie sich in der Nähe eines aggressiven Patienten? sehr sicher sicher weder noch nicht sicher gar nicht sicher 8. Wie wirksam sind die Ihnen bekannten Techniken für den Umgang mit Aggression? sehr wirksam wirksam weder noch nicht wirksam gar nicht wirksam 9. Wie gut sind Sie in der Lage, auf die Bedürfnisse eines aggressiven Patienten einzugehen? sehr gut gut weder noch nicht gut gar nicht gut 10. Wie gut sind Sie in der Lage, sich vor aggressiven Patienten zu schützen? sehr gut gut weder noch nicht gut gar nicht gut Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Mithilfe!