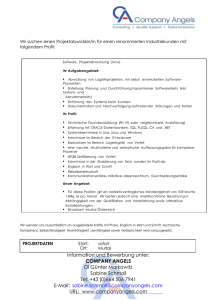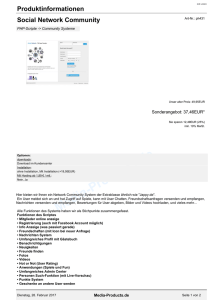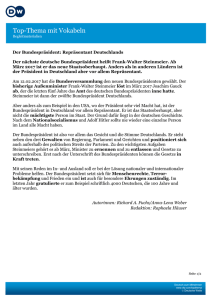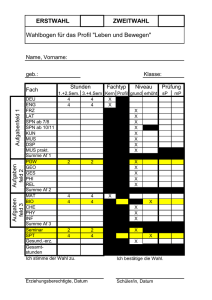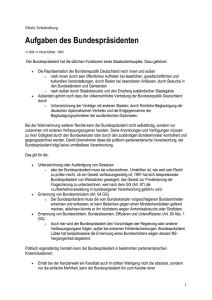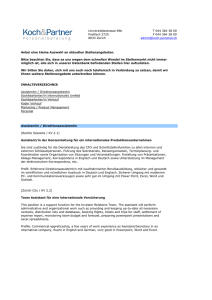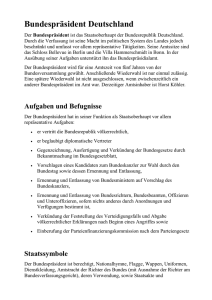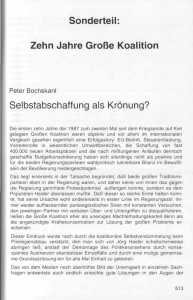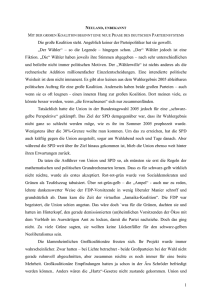Das wird eine wichtige Woche
Werbung
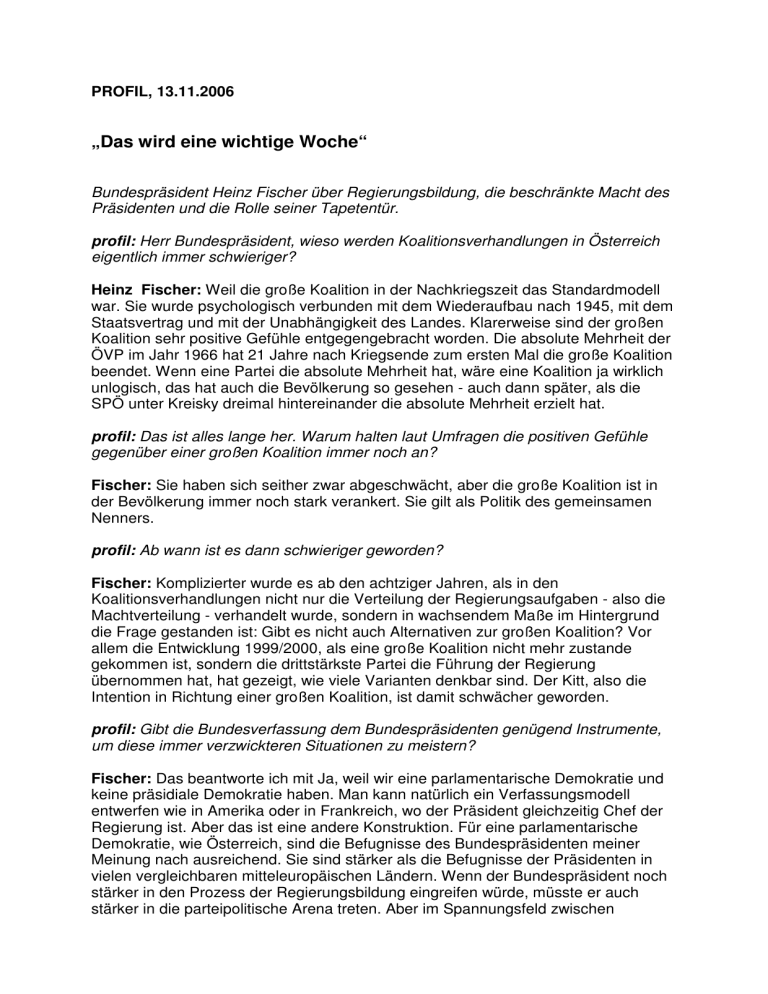
PROFIL, 13.11.2006 „Das wird eine wichtige Woche“ Bundespräsident Heinz Fischer über Regierungsbildung, die beschränkte Macht des Präsidenten und die Rolle seiner Tapetentür. profil: Herr Bundespräsident, wieso werden Koalitionsverhandlungen in Österreich eigentlich immer schwieriger? Heinz Fischer: Weil die große Koalition in der Nachkriegszeit das Standardmodell war. Sie wurde psychologisch verbunden mit dem Wiederaufbau nach 1945, mit dem Staatsvertrag und mit der Unabhängigkeit des Landes. Klarerweise sind der großen Koalition sehr positive Gefühle entgegengebracht worden. Die absolute Mehrheit der ÖVP im Jahr 1966 hat 21 Jahre nach Kriegsende zum ersten Mal die große Koalition beendet. Wenn eine Partei die absolute Mehrheit hat, wäre eine Koalition ja wirklich unlogisch, das hat auch die Bevölkerung so gesehen - auch dann später, als die SPÖ unter Kreisky dreimal hintereinander die absolute Mehrheit erzielt hat. profil: Das ist alles lange her. Warum halten laut Umfragen die positiven Gefühle gegenüber einer großen Koalition immer noch an? Fischer: Sie haben sich seither zwar abgeschwächt, aber die große Koalition ist in der Bevölkerung immer noch stark verankert. Sie gilt als Politik des gemeinsamen Nenners. profil: Ab wann ist es dann schwieriger geworden? Fischer: Komplizierter wurde es ab den achtziger Jahren, als in den Koalitionsverhandlungen nicht nur die Verteilung der Regierungsaufgaben - also die Machtverteilung - verhandelt wurde, sondern in wachsendem Maße im Hintergrund die Frage gestanden ist: Gibt es nicht auch Alternativen zur großen Koalition? Vor allem die Entwicklung 1999/2000, als eine große Koalition nicht mehr zustande gekommen ist, sondern die drittstärkste Partei die Führung der Regierung übernommen hat, hat gezeigt, wie viele Varianten denkbar sind. Der Kitt, also die Intention in Richtung einer großen Koalition, ist damit schwächer geworden. profil: Gibt die Bundesverfassung dem Bundespräsidenten genügend Instrumente, um diese immer verzwickteren Situationen zu meistern? Fischer: Das beantworte ich mit Ja, weil wir eine parlamentarische Demokratie und keine präsidiale Demokratie haben. Man kann natürlich ein Verfassungsmodell entwerfen wie in Amerika oder in Frankreich, wo der Präsident gleichzeitig Chef der Regierung ist. Aber das ist eine andere Konstruktion. Für eine parlamentarische Demokratie, wie Österreich, sind die Befugnisse des Bundespräsidenten meiner Meinung nach ausreichend. Sie sind stärker als die Befugnisse der Präsidenten in vielen vergleichbaren mitteleuropäischen Ländern. Wenn der Bundespräsident noch stärker in den Prozess der Regierungsbildung eingreifen würde, müsste er auch stärker in die parteipolitische Arena treten. Aber im Spannungsfeld zwischen Parlament und Regierung soll der Bundespräsident eine Position einnehmen, von der aus nicht mit großen Spannungen belastete Kontakte zu allen politischen Kräften möglich sind. Ich glaube, das ist der Grundgedanke unserer Bundesverfassung, und an den halte ich mich auch. Ich komme damit gut zurecht. profil: Aber viele Menschen erwarten einfach, dass Sie diese komplexen Probleme mit einem Handstreich lösen ... Fischer: ... wie Alexander der Große den Gordischen Knoten. profil: Weil eben viele an die politische Allmacht des Bundespräsidenten glauben. Fischer: Darum versuche ich auch, allen jenen, die mir schreiben: "Jetzt sprechen Sie ein Machtwort und machen Sie endlich reinen Tisch", zu erklären, dass unserer Bundesverfassung andere Gedanken zugrunde liegen. Dass der Bundespräsident zwar im Fall eines wirklichen Staatsnotstandes energisch eingreifen kann und soll. Aber ich betrachte die gegenwärtige Situation als weit von einem Staatsnotstand entfernt. Ich übersehe dabei allerdings nicht, dass die Geduld der Bevölkerung nicht unbegrenzt ist und dass wir in einem Zeitraum, den ich von Anfang an skizziert habe, zu Ergebnissen kommen müssen. Daher wird die kommende Woche eine wichtige Woche sein. profil: Die den Bundespräsidenten betreffenden Passagen der Verfassung sind ja erst auf Druck der Heimwehren bei einer Novelle im Jahr 1929 aufgenommen worden. Merkt man das der Verfassung in der Praxis an? Fischer: Die Verfassung von 1929 war ein Kompromiss. Die Philosophie der Heimwehr und anderer Kräfte, die damals schon ins faschistische Italien geblickt haben, war ein möglichst starker Staatschef. Die Sozialdemokraten haben ihre Überlegungen in Richtung parlamentarischer Strukturen eingebracht, und als Kompromiss ist ja der Bundespräsident in den meisten Entscheidungen an den Konsens mit der Bundesregierung gebunden. Ich bekenne mich zu dieser Verfassung, sie hat in der Zweiten Republik eine 60-jährige Bewährungsprobe abgelegt. Sie ist modernisierungsbedürftig, was die sozialen Grundrechte betrifft, was Verwaltungsgerichtsbarkeit betrifft, was vielleicht auch andere Bereiche des Staatsaufbaues betrifft. Aber die Position des Bundespräsidenten würde auch bei einer grundlegenden Überarbeitung der Verfassung nicht wesentlich geändert werden. profil: Viele meinen, das Land würde sich durch ein mehrheitsförderndes Wahlrecht viel ersparen. Nie mehr Koalitionsverhandlungen - klingt das nicht verlockend? Fischer: Ich befasse mich seit Jahrzehnten mit Wahlrechtsfragen und bin erst vor wenigen Tagen von einem ausländischen Gast dazu befragt worden. Ich habe gesagt: Wenn früher meine Präferenz für das Verhältniswahlrecht im Vergleich zum Mehrheitswahlrecht 90:10 war, ist sie jetzt vielleicht auf 66:34 abgesunken. Weil ich schon auch die Probleme des Verhältniswahlrechts, gerade bei der Regierungsbildung, nicht übersehe. Aber der Grundsatz der Wahlgerechtigkeit hat ebenfalls ein großes Gewicht. Das Wahlrecht hat ja wohl auch andere Aufgaben als nur jene, die Regierungsbildung zu erleichtern. Der aus dem Amt geschiedene Nationalratspräsident Andreas Khol, der etliche Verfassungsfragen anders beurteilt als ich, hat in seiner letzten Rede dem Nationalrat das Verhältniswahlrecht mit dem guten Argument ans Herz gelegt, Minderheiten sollten nicht aus dem Parlament auf die Straße gedrängt werden. Es ist besser, Konflikte im Parlament auszutragen. Da hat er Recht. profil: Aber es gibt ja auch das Modell: Die stärkste Partei hat 50 Prozent der Sitze plus einen weiteren, der Rest teilt sich auf diese anderen Parteien proportional auf. Fischer: Nehmen Sie in diesem Fall nur folgendes Beispiel: Eine Partei hat 35 Prozent, eine andere 33 und eine dritte 31 Prozent: Dann kriegt die Partei mit 35 Prozent mehr als 50 Prozent der Sitze und bildet allein die Regierung. Und die beiden anderen Parteien mit zusammen 64 Prozent der Stimmen dürfen nicht miteinander regieren. Es würden künstlich 35 Prozent zur Mehrheit gemacht und 64 Prozent zur Minderheit. Das sind Gedanken, denen ich politisch nicht folgen kann. Ich denke viel über diese Frage nach, aber wenn ich am Schluss einen Strich drunter mache, dann kommt nicht die Befürwortung des Mehrheitswahlrechts heraus. profil: Hätte Ihr Vorgänger Thomas Klestil bei der Regierungsbildung 1999/2000 etwas anders machen können? Fischer: Warum sollte ich das jetzt öffentlich erörtern? Jedenfalls darf man die Beurteilung der Vorgangsweise bei einer Regierungsbildung nicht auf den letzten Tag oder auf das Gesicht bei der Angelobung reduzieren. Da spielt der ganze vorhergehende Prozess eine große Rolle. Das ist wie bei einer Schachpartie: Wenn am Schluss die Figuren eine bestimmte Stellung haben, waren die 23 Züge vorher entscheidend dafür und nicht der allerletzte. Jede Regierungsbildung hat ihren eigenen Ablauf, ihre eigene Handschrift. Ich halte das für eine faszinierende Aufgabe. profil: In diesen Tagen spielen Optik und Symbolik eine große Rolle. Wie Sie Ihre Besucher bei der berühmten Tapetentüre hinausführen, ist wahrscheinlich gleich wichtig wie das, was Sie danach sagen. Stört Sie das? Fischer: Mir ist das bewusst. Aber wenn einen das ununterbrochen beschäftigt, wenn man sich ununterbrochen fragt: "Lass ich jetzt meinen Gast links oder rechts von mir gehen, wie schau ich drein und wo steht die ORF-Kamera?" - da hätte man ein schweres Leben. Man soll so sein, wie man ist, und nicht, wie andere wollen, dass man erscheint. Interview: Herbert Lackner