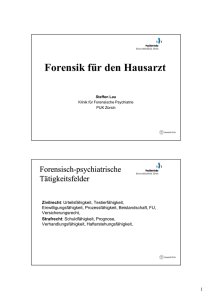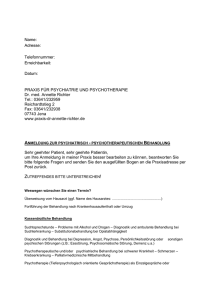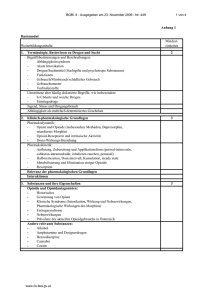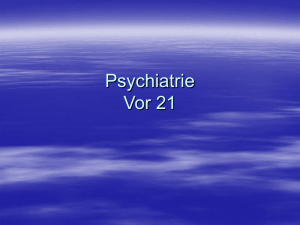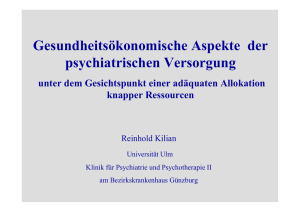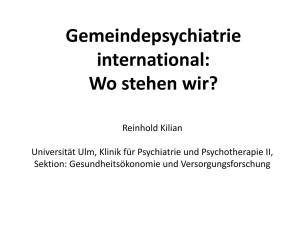Moderne Psychiatrie - Max-Planck
Werbung

Moderne Psychiatrie VON DEN GENEN ZUR THERAPIE V iele Millionen Menschen leiden unter psychiatrischen Störungen wie Schizophrenie. Ob es jemanden trifft, hängt auch von seinem Erbgut ab – genauer gesagt davon, in welcher speziellen Variante bestimmte Gene vorliegen. Daher versuchen Genetiker, die biologischen Ursachen solcher Störungen aufzudecken. Hierzu verfolgen sie vor allem zwei Ansätze1: Zum einen erfassen sie in genomweiten Assoziationsstudien das Erbgut von sehr vielen Menschen mit einer bestimmten psychiatrischen Erkrankung und vergleichen es mit jenem von Gesunden (Bild 1). Auf diese Weise identifizierten sie bereits eine Reihe von »Kandidatengenen« – relativ verbreitete Varianten von Erbfaktoren, die jeweils geringfügig zu einer Störung beitragen könnten. FORTSCHRITTE IN DER GENETIK Zum anderen suchen Wissenschaftler bei kleinen Gruppen verwandter Patienten nach seltenen genetischen Varianten, die das Erkrankungsrisiko entscheidend oder sogar allein prägen. Autismusforscher deckten so bereits Gene auf, die steuern, wie Neurone sich untereinander verknüpfen2,3. Bei Problemen wie Angst- oder Stimmungsstörungen, die stark von Umwelteinflüssen abhängen, führen diese Vorgehensweisen allerdings nicht weit. Zudem ist das Identifizieren einer Genvariante meist nur der erste Schritt. Dann müssen Forscher etwa untersuchen, inwiefern das Gen in ein Protein umgesetzt wird, wie dieses mit anderen Proteinen zusammenwirkt und welche Rolle der Stoffwechsel sowie verschiedene (Neuro-)Hormone dabei spielen. Psychiatrische Krankheiten sind komplexe Phänomene. So weisen Patienten mit derselben Störung oft unterschiedliche Symptome auf – sogar eineiige Zwillinge. Andererseits können identischen klinischen Anzeichen unter Umständen verschiedene Krankheiten zu Grunde liegen. Um psychiatrische Störungen in Zukunft zuverlässiger zu diagnostizieren, wollen Ärzte auf so genannte Biomarker zurückgreifen – beispielsweise die Konzentration bestimmter Stoffe im Blut. Neue Biomarker für psychiatrische Krankheiten werden zunehmend an Bedeutung gewinnen, nicht nur für die Diagnose sowie die Auswahl der richtigen Therapie, sondern auch, um Beginn und Verlauf der Störung, etwaige Verbesserungen sowie Rückfälle präziser zu erfassen. Bislang sind jedoch meist hochkomplexe Technologien nötig, um molekulare Unterschiede zwischen Kranken und Gesunden zu bestimmen. Bei großen Patientengruppen lassen sie sich nur schwer anwenden. Abhilfe kann hier nur der technische Fortschritt auf mehreren Fachgebieten schaffen. So dürften schnellere und präzisere Methoden zur DNA-Sequenzierung die Analyse kompletter Genome erschwinglicher machen. Aber auch die Umsetzung der genetischen Bauanleitungen in Proteine müssen Forscher näher betrachten, da sich die Proteinzusammensetzung von Kranken gegenüber Gesunden unterscheiden kann. Letzteres ist bislang schwierig, denn die derzeit gängigen Verfahren arbeiten nicht empfindlich und präzise genug. Die potenziellen Protein-Biomarker für psychiatrische Krankheiten umfassend unter die Lupe zu nehmen, ist eine Aufgabe von enormen Dimensionen. In Zukunft dürften jedoch weiterentwickelte Methoden zur Entdeckung und Analyse solcher Biomarker sowie verbesserte Massenspektrometrie-Techniken viele Hindernisse überwinden helfen. Eine große Rolle spielt auch der Stoffwechsel (Metabolismus) des Körpers, da sich in ihm widerspiegelt, wie die S chlüsselexperimente zur Frage nach den epigenetischen Signalen von Umweltfaktoren wurden am Max-Planck-Institut für Psychiatrie durchgeführt. Dabei wurden Mäuse postnatalem Trauma ausgesetzt. Dies hatte andauernde, depressionsähnliche 14 Forschungsperspektiven der Max-Planck-Gesellschaft | 2010+ Gene mit der Umwelt zusammenwirken. Das »metabolische Profil« eines Patienten – eine hochkomplexe Mischung von Molekülen – kann auf mögliche körperliche Störungen hinweisen oder die Wirkung eines Medikaments aufzeigen. Außerdem helfen neuroendokrinologische Informationen wie die Konzentration von Stresshormonen bei depressiven Patienten, den Verlauf von Erkrankungen abzuschätzen. Bei der Suche nach Biomarkern setzen Forscher auch moderne bildgebende Verfahren ein. Mittels Magnetresonanztomografie etwa lässt sich anhand der Änderungen der Struktur bestimmter Hirnareale vorhersagen, wie ein Patient auf eine Therapie ansprechen wird. Hirnstrommessungen (EEG) bei schlafenden Patienten lieferten bereits Hinweise auf Bioindikatoren, etwa verkürzte Tiefschlafphasen bei Depressiven. Doch erst wenn solche Verfahren einer größeren Anzahl Patienten zur Verfügung stehen, kann ihr Potenzial ausgeschöpft werden. Dies erfordert beträchtliche Investitionen in Geräte und qualifiziertes Personal. Eine weitere wichtige Stoßrichtung auf der Suche nach Biomarkern besteht darin, Signalwege innerhalb von Zellen aufzudecken, die als Angriffsziel für Medikamente dienen können. Danach müssen Forscher umfangreiche Bibliotheken kleiner Moleküle auf mögliche Wirkstoffe hin durchforsten. Sie benötigen dafür Methoden, mit deren Hilfe sie eine große Zahl von Substanzen in kurzer Zeit analysieren können. In den letzten Jahren wurde eine Reihe von Genen identifiziert, die vermutlich an psychiatrischen Krankheiten beteiligt sind. Jetzt gilt es herauszufinden, was eine bestimmte Genvariante beziehungsweise das entsprechende Protein im Gehirn bewirkt. Dazu müssen aber erst die Mechanismen bekannt sein, über welche die Umwelt und andere nichtgenetische Faktoren die Um- Verhaltensänderungen zur Folge, deren Ursache in der veränderten DNA-Methylierung und einem Anstieg der Vasopressin-Gen-Aktivität liegt – einem bekannten Faktor für die Entstehung einer Depression (Murgatroyd, C. et al., Nature Neurosci. 12, 1559 –1566, 2009). BIOLOGIE UND MEDIZIN Menschen mit bestimmten Genvarianten sind anfälliger für psychiatrische Störungen. Dank methodischer Fortschritte werden Ärzte psychiatrische Patienten in Zukunft individueller behandeln können als bislang. Zudem werden sich einzelne Störungen anhand von Biomarkern prognostizieren lassen, bevor klinische Symptome auftreten. Das erlaubt eine frühere und gezieltere Therapie. Bild 1 | Im Rahmen genomweiter Assoziationsstudien (GWAS) vergleichen Forscher die DNA tausender Patienten mit denen gleich großer Kontrollgruppen. Dabei suchen sie in beiden nach Unterschieden, so genannten Einzelnukleotid-Polymorphismen. Bild ganz oben: Science Photo Library / Alfred Pasieka; Kinder: Getty Images / Tosca Radigonda; Zwillinge unten: Look at Sciences / Mona Lisa / Thierry Berrod setzung von Genen in Proteine beeinflussen und wie diese unter veränderten Bedingungen variieren4. Besonders wichtig ist dabei die Frage, wie frühkindliche Erfahrungen die Anfälligkeit für psychische Störungen verändern. Um das zu erforschen, stellen Forscher in Tierversuchen widrige Einflüsse während verschiedener Lebensphasen nach. Solche Experimente zeigten etwa, dass neugeborene Mäuse, die von ihrer Mutter getrennt werden, ihr Leben lang unter Verhaltensauffälligkeiten leiden, die an Depressionen beim Menschen erinnern5. GENE, UMWELT UND VERHALTEN Genetische Untersuchungen führten bereits zu wichtigen Tiermodellen für bestimmte erbliche Formen psychiatrischer Krankheiten. Mäuse mit entsprechenden Veränderungen in ihrem Erbgut geben wertvolle Einblicke in Verhaltensstörungen, da ihre Symptome jenen menschlicher Patienten sehr ähneln6. Solche genetischen Mausmodelle für psychiatrische Störungen werden an Bedeutung gewinnen, da sie es erlauben, die jeweiligen Einflüsse des Erbguts und der Umwelt bei verschiedenen Krankheiten zu unterscheiden. In Zukunft müssen solche Modelle komplexere Genvarianten einbeziehen und zusammen mit Faktoren wie Stress, Infektionen oder psychischen Traumata untersucht werden. Allerdings lassen sich viele Verhaltensweisen, die für psychiatrische Störungen charakteristisch sind, mit Mäusen allein nicht nachbilden. Mit Hilfe neuartiger Diagnosestrategien der psychiatrischen Genomik werden Mediziner in Zukunft hoffentlich psychiatrische Erkrankungen entdecken, bevor klinische Symptome auftreten, und deren Verlauf besser verfolgen können. Zudem dürften auf Basis solcher Erkenntnisse besser abgesicherte, im Idealfall individuell angepasste Therapien entstehen7. Da psychiatrische Störungen häufig sind, dürfte dies spürbare gesellschaftliche Auswirkungen haben. ➟ Bibliographie siehe Seiten 38 und 39 Patienten Kontrollgruppe Patienten-DNA DNA der Kontrollgruppe Unterschiede weisen auf krankheitsspezifische Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNP) hin. krankheitsspezifische SNPs nicht krankheitsspezifische SNPs links Forscher wollen insbesondere wissen, inwieweit Umwelt und soziales Umfeld von Kindern deren Anfälligkeit für Krankheiten bestimmen. unten Viele psychiatrische Studien basierten bisher auf der Erforschung von Zwillingen. Ziel war die Unterscheidung zwischen genetischen und umgebungsbedingten Komponenten. 2010+ | Forschungsperspektiven der Max-Planck-Gesellschaft 15