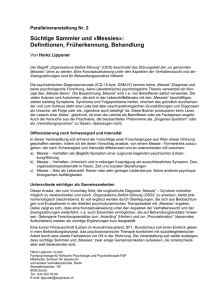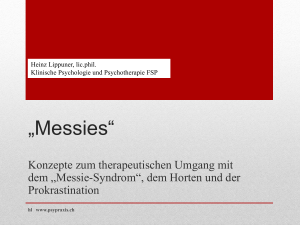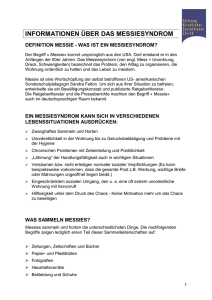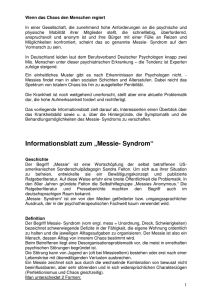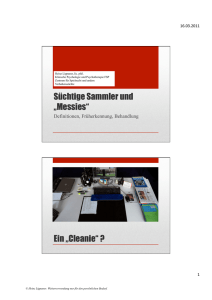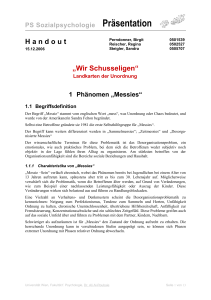Die Qual der Wahllosen - Messies
Werbung

8 Tages-Anzeiger – Donnerstag, 1. März 2012 Hintergrund Die Qual der Wahllosen Die Messies: Sie türmen auf und breiten sich aus, denn sie können nicht anders. Ein neuer Dokumentarfilm macht klar, warum uns das Chaos der anderen so fasziniert. Es ist nicht unseres. Von Jean-Martin Büttner Mit einer Stirnlampe steigt er in die Tiefe. Er dringt vor, sucht Halt, kriecht weiter, arbeitet sich vor wie ein Minenarbeiter in der Kohlengrube. Aber Karl ist kein Minenarbeiter, er ist Architekt. Und er steigt nicht in eine Grube, sondern in seinen Keller. Und er sucht nicht, er findet. Und er findet viel. Denn Karl findet sehr vieles wichtig oder zumindest brauchbar: Radios, Bücher, Schuhe, Schirme, Schlösser, Zeitschriften, Schrauben, Holz, Metall. Er stapelt die Sachen im Keller. Er türmt sie im Estrich auf. Er verteilt sie um das Haus herum. Er verstellt damit den Vorplatz. Karl hat drei Scheunen gemietet und eine Remise. Alle sind voller Sachen, die er für wertvoll hält; er allein. Der Scherbenhaufen Karl ist ein Messie. Einer von vier, die der Berner Dokumentarfilmer Ulrich Grossenbacher in seinem neuen Film porträtiert. Die vier unterscheiden sich stark voneinander. Doch sie leiden alle an einer psychischen Störung, die mangels Alternativen mit diesem verniedlichenden Wort aus Amerika versehen wird. Zwar hält sich Karl nicht für krank, dafür leiden andere umso mehr. Seine Kinder kommen nicht mehr zu Besuch, weil sie den Müll des Vaters nicht mehr ertragen. Auch seine Frau Trudi hält es nicht mehr aus. Sie werde ihn verlassen, sagt sie ihrem Mann am Anfang des Filmes. Am Ende tut sie es, in einem Akt der Verzweiflung. Allein steht sie im Wintergarten, umgeben vom Sammelgut ihres Mannes: «Vierzig Jahre Ehe und am Schluss ein Scherbenhaufen», sagt sie. Karl, allein mit seinen Sachen, wirkt erleichtert. «Jetzt habe ich dann Zeit zum Aussortieren», sagt er. Stattdessen häufe er laufend weiter auf, sagen Besucher. Der Hund habe kaum mehr Platz vor dem Haus. «Das schöne Chaos», hat der Regisseur seinen Film untertitelt; er nennt ihn eine Komödie. Aber das sagt mehr über das Marketing als über den Film. Denn Grossenbacher verharmlost weder das Thema, noch macht er die Figuren lächerlich. Es gibt auch heitere, sogar selbstironische Auftritte; dennoch werden hier Tragödien verhandelt, das permanente Scheitern beim Versuch, das Leben zu ordnen, statt in der Unordnung unterzugehen. Auf deutschen Privatsendern werden Messies als Verwahrloste, Verdreckte und Verrückte blossgestellt. Der Schweizer Filmer stellt sie dar. Er zeigt, statt zu denunzieren, er dokumentiert, statt zu erklären, er lässt reden, ohne sich einzumischen. Und kommt seinen Protagonisten dabei so nahe, wie es ihre Scham und ihr Durcheinander erlauben. Dafür hat sich der Regisseur drei Jahre Zeit genommen. Am meisten Angst haben Messies vor der Veränderung. Manchmal kommt der Impuls von aussen wie bei Arthur, einem Bauern, der verrostende Autos, Traktoren, Motoren und andere Geräte um seinen Hof streut. Erst entscheiden die Gerichte, dann kommt der Gemeindepräsident und am Ende die Polizei. Arthur sagt, man wolle ihn kastrieren. Manchmal kommt wenigstens der Wille zur Veränderung von innen. Elmira hat keinen Bauernhof, bloss eine Wohnung. Und die ist so voll wie der Estrich. Berge von Zeitungen türmen sich, Prospekte, Programmhefte und Tausende von Kassetten. Darauf hat die agile Rentnerin Kultursendungen aufgenommen, die sie irgendwann hören möchte. Sie kämpft seit Jahrzehnten gegen ihre Zwänge. Zwei messbare Erfolge kann sie vorweisen: eine Büchervitrine, die frei bleibt. Und einen Pfad, den sie zum Herd schlagen konnte, um sich etwas kochen zu können. Gegessen wird weiter auf einer Ecke des Bettes. Dauernd fällt ihnen etwas ein Elmira hat dreimal ein Studium angefangen, zuletzt Archäologie. Sie hat auch mehrere Therapien absolviert, darunter eine Analyse. Sie kann genau über ihr Problem reden. Sie kann es bloss nicht lösen. Dieses Dilemma teilt sie mit Johannes von Arx; der Fachjournalist, gilt Die Angst vor dem Vakuum: Szenenbild aus dem Dokumentarfilm von Ulrich Grossenbacher. Foto: Fair & Ugly als Pionier der Schweizer Szene. Er hat sich früh und öffentlich zu seiner Störung bekannt. Er hat die erste Selbst­ hilfegruppe koordiniert, Kontakt zu Mitleidenden gesucht. Er publiziert zum Thema, konsultiert Fachliteratur, hat den Verband Less Mess initiiert samt Website. Er entwirft Theorien, hält Vorträge. Man trifft die beiden an einem neutralen Ort, sie sitzen an einem Sitzungstisch in einem Versammlungsraum. Sie bei sich zu Hause zu besuchen, wäre nicht möglich gewesen. Und auch hier fangen sie sofort damit an, das Zimmer aufzufüllen. Nicht mit Papier oder Sperrgut. Dafür mit Wörtern. Die beiden sind intelligent und gebildet, können gut re- Messies suchen nicht, sie finden. Und sie finden alles wichtig. den. Und sie hören nicht auf damit. Der therapeutische Jargon bestimmt ihr Vokabular. Sie deuten sich selber und einander mit lückenlosen Psychologismen. Routiniert berichten sie von schrecklichen Erfahrungen aus ihrem Leben, ­Elmira von ihrer alles kontrollierenden Mutter, Johannes von Jahren der Verzweiflung und Einsamkeit. Beide wirken getrieben, reden hastig, dauernd fällt ihnen wieder etwas ein. «Wie die Natur hält der Messie das Vakuum nicht aus», sagt Johannes einmal. Das Vakuum stehe für Leere, und diese sei Ausdruck von Hilflosigkeit, Unsicherheit. «In der Fülle suchen wir Ersatz, und weil wir ihn nicht finden, schaffen wir eine Überfülle um uns herum.» Einverstanden. Aber warum Wert­ loses häufen, statt Wertvolles zu sammeln? Johannes lacht: «Ein Messie wird bei jeder Schraube und jedem Prospekt eine Erklärung dafür finden können, ­warum er es nicht wegwerfen kann. ‹Man kann es noch brauchen›: Das ist unser Mantra.» Elmira: «Was ich sammle, ist Ausdruck meiner vielen Interessen. Darum konnte ich mich auch nicht für ein Studium entscheiden. Denn Wählen heisst Auswählen, und Auswählen heisst Einschränken.» Was denn passieren würde, fragt man sie, wenn ihre Wohnung einfach geräumt würde? Das sei schon mehrmals vorgekommen, sagt Elmira, wenn gar nichts anderes geholfen habe. «Mir kam es jedes Mal so vor, als reisse mir jemand die Haut ab.» Im Kopf wisse sie ganz genau, wie absurd ihr Verhalten sei, aber der Körper wisse davon nichts. «Wenn ich Wörter wie Ordnung, Aufräumen oder Mulde nur schon höre», sagt sie, «dreht sich bei mir der Magen um.» Das lässt wenig Hoffnung zu, aber die Hoffnungslosigkeit täuscht. Elmira und Johannes finden ihre Lage aussichtslos, aber nicht mehr so ernst. Elmira empfand schon eine grosse Erleichterung, als sie vor rund zehn Jahren in der Sendung «Quer» Johannes reden hörte und merkte, dass sie nicht allein war mit ihrem Problem. Auch die Therapien hätten ihr geholfen, sagt sie. Sie sei ihre Schuldgefühle los; sie könne akzeptieren, wer sie sei. Ihr Mitmachen im Film habe viele gute Reaktionen ausgelöst. Am schönsten die Erfahrung, die sie während der Dreharbeiten gemacht habe: von ihrem Sohn erst besser verstanden und dann ganz akzeptiert zu werden. Auch Johannes sagt, dass es ihm heute deutlich besser gehe. «Ich kann an einem Flohmarkt vorbeigehen, ohne etwas zu kaufen», sagt er. «Ich kann einen Haufen Sperrgut anschauen und mir genau überlegen, ob ich dieses kaputte Velo wirklich brauche.» Beruflich gehe es vorwärts, und seit vier Jahren lebe er in einer sehr guten Beziehung. Wir sind alle überfordert Gegen zwei Prozent der Bevölkerung leidet unter dieser ungewöhnlichen, auffälligen Störung. Sie wird behelfsmässig mit «Organisations-Defizit-Syndrom» umschrieben, es gibt aber noch keinen offiziellen Krankheitsbegriff dafür. Das hat weniger damit zu tun, dass sich der Allerweltsbegriff «Messie» so schnell durchsetzte. Sondern mehr, weil die Unterschiede zwischen den Betroffenen viel grösser sind als die Gemeinsamkeiten. Der Hang zum Horten nämlich, die Unfähigkeit zum Ordnen sind eher Folge denn Ursache. «Die äussere Unordnung symbolisiert den Kampf gegen eine innere Leere, hinter der sich oft eine Depression verbirgt», sagt der Psychotherapeut Heinz Lippuner. Die Störung habe sowohl mit Zwang als auch mit Sucht zu tun. Der Psychologe hat schon Hunderte von Messies erlebt, in Selbsthilfegruppen, in seiner Praxis, an öffentlichen Debatten. Und dabei ein Paradox wahrgenommen: Viele Messies scheitern an ihrem Perfektionismus. Sie wol- Immer wieder sabotieren sie die Hilfe, die sie so nötig haben. len ihre Sachen so gut ordnen, dass sie gar nicht erst damit anfangen. Der Psychologe tut im Gespräch, was Messies gerade nicht können: Er räumt auf. Mit Vorurteilen, Verklärungen, Verallgemeinerungen. Messies hat es schon immer gegeben, erfährt man von ihm, und zwar auch in sehr armen Ländern. Es mag Gemeinsamkeiten mit der Kaufsucht geben, und man ist auch versucht, das Verhalten als Symptom einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft zu interpretieren. Von einer Zivilisationskrankheit mag Lippuner aber nicht reden. Dass man heute so viel mehr über Messies erfahre, führt der Psychologe auf die vielen Medienberichte zurück. Das enorme öffentliche Interesse deutet er als «heimlichen Protest gegen unsere eigene Ersetzbarkeit», als «Ausdruck unserer Überforderung mit den wuchernden Angeboten der Freizeitgesellschaft». Ihm ist zudem eine aufschlussreiche Parallele aufgefallen: Die Medien hätten in den Neunzigerjahren damit be- gonnen, sich für das Phänomen der Messies zu interessieren. Zur selben Zeit seien die Vorstellungen populär geworden, die das Individuum als eine Art Ich-AG begreifen – im Sinne, dass jeder ein Unternehmer seiner selbst sei und aus seinem Leben etwas machen müsse. «Der Neoliberalismus leitete daraus sein politisches Programm ab: wirtschaft­ licher Egoismus als Selbstverwirk­ lichung.» Da biete sich der Messie als ideale Pathologisierung an. «Er ist die Projektionsfigur des Gescheiterten.» Messies widerstehen Therapien Der Therapeut sieht bei Messies auch einen Hang zur Selbstverklärung. «Sie halten sich für kreativ, was sie selten sind. Sie sind oft sehr kontaktfreudig, deswegen aber noch nicht sozial begabt. Sie wähnen sich dauernd im Recht, obwohl andere ihretwegen leiden.» Dazu kommt eine destruktive Intelligenz im Umgang mit Konflikten. Davon weiss Helene Karrer-Davaz zu erzählen, die als Haushaltsmanagerin vor Ort hilft. Immer wieder erlebt sie, wie Messies Hilfe sabotieren, Termine ignorieren, Abmachungen hintertreiben und vor allem: Ämter und Helfer gegeneinander ausspielen. «Sie wollen ihr Verhalten ändern, tun sich aber unglaublich schwer damit. Dafür sind sie Meister darin, uns immer wieder hinzuhalten.» Selbsthilfegruppen und Einzeltherapie könnten die Probleme lindern, sagen die Fachleute, aber nicht lösen. Das beginnt schon damit, dass Messies mehr an den Folgen ihrer Störung leiden denn an der Störung selber. Sie fangen viel zu spät eine Therapie an, die wenigsten von ihnen freiwillig. Oft habe sich die Störung verselbstständigt, sagt Lippuner, und das Symptom versteinere. «Das Einzige, was dann noch bleibt, ist Schadensbegrenzung.» Etwa der freigelegte Pfad vom Eingang zum Bett. Und an den Herd. UIrich Grossenbacher: «Messies – das schöne Chaos», ab heute in den Kinos. Infos unter www.lessmess.ch