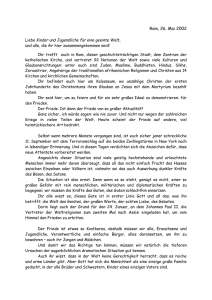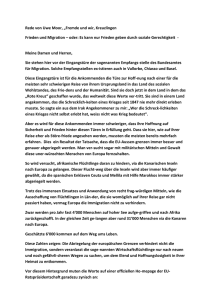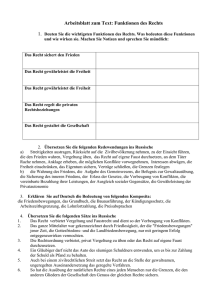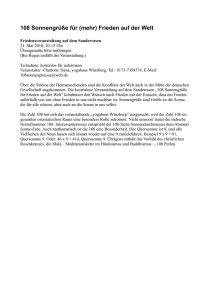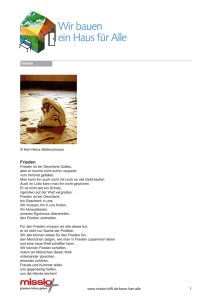Vorwort der Herausgeber
Werbung
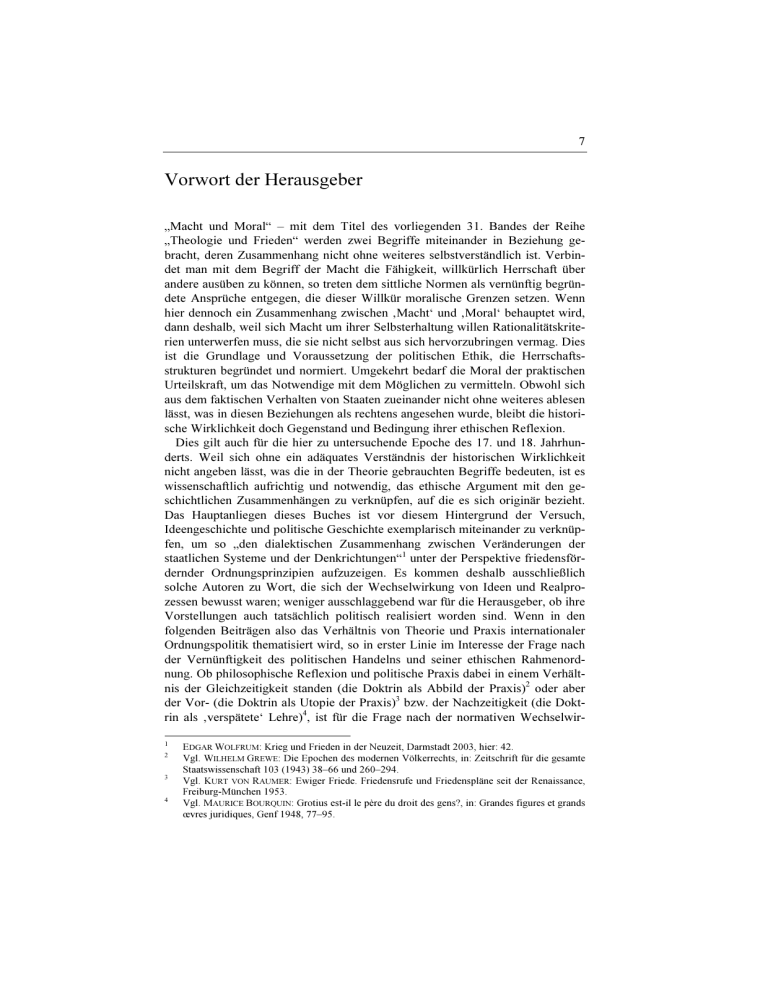
7 Vorwort der Herausgeber „Macht und Moral“ – mit dem Titel des vorliegenden 31. Bandes der Reihe „Theologie und Frieden“ werden zwei Begriffe miteinander in Beziehung gebracht, deren Zusammenhang nicht ohne weiteres selbstverständlich ist. Verbindet man mit dem Begriff der Macht die Fähigkeit, willkürlich Herrschaft über andere ausüben zu können, so treten dem sittliche Normen als vernünftig begründete Ansprüche entgegen, die dieser Willkür moralische Grenzen setzen. Wenn hier dennoch ein Zusammenhang zwischen ‚Macht‘ und ‚Moral‘ behauptet wird, dann deshalb, weil sich Macht um ihrer Selbsterhaltung willen Rationalitätskriterien unterwerfen muss, die sie nicht selbst aus sich hervorzubringen vermag. Dies ist die Grundlage und Voraussetzung der politischen Ethik, die Herrschaftsstrukturen begründet und normiert. Umgekehrt bedarf die Moral der praktischen Urteilskraft, um das Notwendige mit dem Möglichen zu vermitteln. Obwohl sich aus dem faktischen Verhalten von Staaten zueinander nicht ohne weiteres ablesen lässt, was in diesen Beziehungen als rechtens angesehen wurde, bleibt die historische Wirklichkeit doch Gegenstand und Bedingung ihrer ethischen Reflexion. Dies gilt auch für die hier zu untersuchende Epoche des 17. und 18. Jahrhunderts. Weil sich ohne ein adäquates Verständnis der historischen Wirklichkeit nicht angeben lässt, was die in der Theorie gebrauchten Begriffe bedeuten, ist es wissenschaftlich aufrichtig und notwendig, das ethische Argument mit den geschichtlichen Zusammenhängen zu verknüpfen, auf die es sich originär bezieht. Das Hauptanliegen dieses Buches ist vor diesem Hintergrund der Versuch, Ideengeschichte und politische Geschichte exemplarisch miteinander zu verknüpfen, um so „den dialektischen Zusammenhang zwischen Veränderungen der staatlichen Systeme und der Denkrichtungen“1 unter der Perspektive friedensfördernder Ordnungsprinzipien aufzuzeigen. Es kommen deshalb ausschließlich solche Autoren zu Wort, die sich der Wechselwirkung von Ideen und Realprozessen bewusst waren; weniger ausschlaggebend war für die Herausgeber, ob ihre Vorstellungen auch tatsächlich politisch realisiert worden sind. Wenn in den folgenden Beiträgen also das Verhältnis von Theorie und Praxis internationaler Ordnungspolitik thematisiert wird, so in erster Linie im Interesse der Frage nach der Vernünftigkeit des politischen Handelns und seiner ethischen Rahmenordnung. Ob philosophische Reflexion und politische Praxis dabei in einem Verhältnis der Gleichzeitigkeit standen (die Doktrin als Abbild der Praxis)2 oder aber der Vor- (die Doktrin als Utopie der Praxis)3 bzw. der Nachzeitigkeit (die Doktrin als ‚verspätete‘ Lehre)4, ist für die Frage nach der normativen Wechselwir1 2 3 4 EDGAR WOLFRUM: Krieg und Frieden in der Neuzeit, Darmstadt 2003, hier: 42. Vgl. WILHELM GREWE: Die Epochen des modernen Völkerrechts, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 103 (1943) 38–66 und 260–294. Vgl. KURT VON RAUMER: Ewiger Friede. Friedensrufe und Friedenspläne seit der Renaissance, Freiburg-München 1953. Vgl. MAURICE BOURQUIN: Grotius est-il le père du droit des gens?, in: Grandes figures et grands œvres juridiques, Genf 1948, 77–95. 8 Vorwort der Herausgeber kung zwischen beiden Größen eher zweitrangig. Vielmehr steht die friedensethische Forschung vor der Aufgabe, das beziehungslose Nebeneinander beider durch ein spannungsreiches Ineinander zu ersetzen, um (unter den Bedingungen des historischen Wandels) eine Ordnung theoretisch zu begründen, in der der politische Friede (ganz aristotelisch) als Ausdruck entsprechender innerer Einstellungen und Überzeugungen aufgefasst wird. Gleichzeitig wird sie diese Vorstellungen auf ihr inneres Begründungsverhältnis zueinander untersuchen und so den strengen Rahmen historischen Fragens hin zu einer philosophisch-systematischen Hermeneutik des Friedens überschreiten. Historisch bleibt dieser Ansatz, solange er vergangene Friedensdiskurse zum Gegenstand hat; systematisch wird er, sobald er mit ihrer Hilfe die Herkünftigkeit heutiger Ordnungen zu verstehen versucht. Die Einbeziehung der historischen Bedingungen erweist sich somit als eine heuristische Notwendigkeit, um durch die Auseinandersetzung mit den Vorgaben der Tradition die eigene moralische Urteilsfähigkeit schärfen können. Dabei verbietet es sich, historisch bedingte Lösungen eins zu eins auf die Gegenwart zu übertragen; vielmehr soll hier der Versuch einer Reflexion auf die Möglichkeitsbedingungen des Friedens in geschichtlich bedingten Kontexten unternommen werden, um zu verstehen, wie das, was ist, geworden ist. Darüber hinaus erschließt sich der Sinn einer Ideengeschichte des Friedens auch von bis heute anhaltenden Gewalterfahrungen in den sozialen menschlichen Lebensvollzügen her. Es besteht zugleich kein Zweifel darüber, dass konfliktträchtige Strukturen und Verhaltensweisen im Ringen um die Durchsetzung des Guten überwunden werden müssen. Die Friedensforschung sieht es deshalb als ihre Aufgabe an, die Ursachen gesellschaftlicher oder zwischenstaatlicher Konflikte zu benennen (deskriptive Funktion) und darüber hinaus eine Ordnung zu entwerfen, die das Prädikat ‚Friede‘ auch tatsächlich verdient (normative Funktion). Obgleich nicht immer klar angegeben werden kann, was unter Frieden im Einzelnen zu verstehen ist bzw. verstanden worden ist, erweist er sich doch stets als eine zutiefst praktische Forderung, die der ständigen gedanklichen Vergewisserung bedarf, um ihre wirklichkeitsverändernde Kraft entfalten zu können. In der vorliegenden Sammlung von Beiträgen geschieht diese Vergewisserung ausdrücklich in historischer Perspektive. Versteht man unter Frieden nämlich nicht nur eine religiöse Utopie, sondern einen vernünftig begründbaren Ordnungsbegriff politischer Praxis, so kommt man um eine kritische Evaluation seiner Geschichte nicht umhin. Für die hier ins Auge gefasste Epoche des 17. und 18. Jahrhunderts war der 1648 geschlossene Friede von Münster und Osnabrück das einschneidende historische Ereignis. Mit diesem Friedenswerk wurde in Europa eine neue politische Ordnung geschaffen, die die in der mittelalterlichen Ständegesellschaft begründeten politischen, gesellschaftlichen und religiösen Konfliktpotentiale zu begrenzen vermochte. Obgleich das Kriegsführungsrecht (ius ad bellum) als Zeichen staatlicher Souveränität erhalten blieb, wurde der Interessenausgleich zunehmend mit diplomatischen Mitteln herbeigeführt. Dies setzte die Gleichheit und gegenseitige Anerkennung zwischen den Staaten ebenso voraus wie die Einsicht in den Zusammenhang von inner- und zwischenstaatlichem Frieden. Nachdem insbe- Vorwort der Herausgeber 9 sondere durch die scholastische Moraltheologie der Friede als Inbegriff des internationalen Gemeinwohls (bonum commune universale) herausgearbeitet worden war, entstanden im Zuge der sich weitgehend säkular begründenden Naturrechtsphilosophie der Aufklärung vertragstheoretische Modelle, die sich zunehmend an den Idealen einer republikanisch verfassten Bürgergesellschaft orientierten (Rousseau). Wenngleich damit bei weitem noch keine Verdrängung des moralischen durch ein etatistisches Friedensdenken verbunden war, verloren in der Kriegslehre moralische Kriterien wie die iustitia causae oder die rectitudo intentionis an Gewicht. Ausschlaggebend für die Gerechtigkeit des Krieges wird die Einhaltung von Verfahrensregeln, „[d]ie pax als Korrelat zum ‚rechtmäßigen‘ Krieg wird zu einem vertraglich ausgehandelten Zustand“.5 Dass der Friede trotz dieser kontraktualistischen Verengung dennoch ein Grundbegriff des frühneuzeitlichen Naturrechtsuniversalismus bleiben konnte, dürfte in erster Linie am konsequenten Verzicht auf religiös-dogmatische Beschreibungen gelegen haben. Die Aufklärung setzte an die Stelle der christianitas als Prinzip der politischen Einheit Europas die humanitas und vertiefte diesen Gedanken im Hinblick auf eine natürliche Vernunftordnung. Der Friede wurde nun als Resultat einer föderativen abendländischen Kultur angesehen, die die Entstehung eines neuen europäischen Bewusstseins begünstigte. Parallel dazu behielt der Friede aber auch seine religiöse Relevanz: Als ein Begriff, der auf das Ganze der Geschichte abzielte und die Vollendung der Schöpfung durch die Gnade Gottes beinhaltete, konnte er durch die in dieser Zeit aufblühende Reich-Gottes-Theologie nicht nur als ein zukünftiges, sondern vor allem als ein präsentisches Geschehen im Sinne des Anbruchs der Gottesherrschaft in der Geschichte dargestellt werden. Auf der Grundlage des biblischen Friedenszeugnisses, welches Christus als den Frieden schlechthin bekennt, muss theologische Friedensethik daher auch heute verständlich machen, wie der Friede als Fundamentalnorm menschlicher Lebensführung wirksam in eine politische Praxis umgesetzt werden kann. Im Hinweis auf die in der Berufung durch Gott gründende Verantwortung der Christen für die friedfertige Gestaltung ihrer gemeinsamen Lebensbeziehungen bringt sie heute stärker als bisher die moralische Relevanz eines Friedens zur Geltung, der in diesem Sinn „Ausdruck einer das Leben umspannenden Vision ebenso wie Beschreibung eines politischen Zustands“ sein muss.6 Weil die im Frieden zur Sprache kommende Sehnsucht des Menschen nach Heil letztlich nur von Gott her erfüllt werden kann, führen einzelne lehramtliche Differenzen dennoch nicht zu einer grundsätzlich anderen Bestimmung des Endzieles menschlicher Existenz: Stets ist es der Heilswille Gottes, der im Mittelpunkt der Betrachtung steht und von dem her das menschliche Handeln qualifiziert ist.7 Christliche Friedensethik ist in einem solchen praktischen Sinne immer ökumenisch, wenn auch konfessionell unterschiedlich 5 6 7 WILHELM JANSSEN: Die Anfänge des modernen Völkerrechts und der neuzeitlichen Diplomatie, Stuttgart 1965, hier: 30f. WOLFGANG HUBER / HANS-RICHARD REUTER: Friedensethik, Stuttgart 1990, hier: 20. Vgl. MARKUS KREMER: Wo Frieden herrscht, wird Gerechtigkeit ausgestreut, in: Wort und Antwort 45 (2004) 172–180. 10 Vorwort der Herausgeber begründet. Wenn von daher die Geschichte des Friedensverständnisses aus einer interdisziplinären Perspektive beleuchtet wird, so geschieht dies stets vor dem Hintergrund einer solchermaßen bestimmten soteriologischen Hermeneutik. Das so beschriebene Anliegen wird im vorliegenden Band derart aufgegriffen, dass zunächst grundsätzliche Erörterungen historischer, theologischer und (rechts)philosophischer Natur in einem Grundlagenteil angestellt werden, bevor in mehreren Einzelstudien das Denken unterschiedlicher Autoren der hier behandelten Epoche in den Blick kommt: SALVADOR CASTELLOTE zeigt am Beispiel der Wirkungsgeschichte der Schule von Salamanca, dass der häufig konstruierte Gegensatz zwischen der sich säkular verstehenden Aufklärung und ihren religiös argumentierenden Vorläufern so nicht aufrechterhalten werden kann. Den Beitrag der Spanischen Scholastik (und hier insbesondere des Vitoria und Suárez) für die Geschichte Europas bestimmt er dahingehend, den vormals als rechtsfrei betrachteten überseeischen Raum dem moralischen orbis universalis eingegliedert zu haben. Aufgrund der Universalität des scholastischen Naturrechts konnte so der Grundstein für den weltweiten rechtszivilisatorischen Fortschritt gelegt werden, wenn auch um den Preis der Aufgabe der weltanschaulichen Einheit Europas. KLAUS MALETTKE charakterisiert das europäische Staatensystem im 17. und 18. Jahrhundert als eine Form der durch Recht gebändigten Machtpolitik. Indem er anschaulich die Dynamik der politischen Interaktionsprozesse zwischen den europäischen Großmächten und insbesondere der Häuser Habsburg und Bourbon aufzeigt, wird deutlich, dass Krieg und Frieden ganz im Dienste der durch die Staatsräson definierten Interessen standen und oft zur Durchsetzung individueller politischer Ziele benutzt wurden. Gleichzeitig habe sich das Konzept des Kräftegleichgewichts als funktional für den Erhalt der daraus erwachsenden multipolaren Ordnung Europas erwiesen – ein Befund der sich ideengeschichtlich im Verständnis des Friedens als Zustand vertraglich garantierter Sicherheit niederschlug. JOSEPH BERGIN erläutert die spezifische Interaktion zwischen Kirche und Staat in Frankreich. Insbesondere die Ablehnung der Beschlüsse des Trienter Konzils durch die Gallikanisten wurde zu einem Prüfstein für die eng mit den Interessen der Krone verflochtene französische Kirchenpolitik. Das fragile Gleichgewicht zwischen Kirche, König- und Papsttum konnte in Frankreich somit nur um den Preis des Staatskirchentums aufrechterhalten werden. GERHARD KRIEGER zieht philosophische Querverbindungen zwischen der spätmittelalterlichen Anthropologie und dem Freiheitspathos des deutschen Idealismus. Insbesondere der auf Aristoteles zurückgehende und bei Nikolaus Cusanus spekulativ entfaltete Gedanke der natürlichen Sozialität des Menschen sei später von Hegel wieder aufgenommen worden. Für diesen gründe Sozialität nämlich in der Erkenntnis des seiner selbst bewussten Geistes, „dass jeder im freien Anderen sich anerkannt weiß und dies weiß, insofern er das Andere anerkennt“ (90). Für Vorwort der Herausgeber 11 die politische Herrschaft bedeute dies, dass sie – unter der Voraussetzung der äußeren Bedingtheit des Daseins zustande gekommen – an den Willen der Beherrschten zurückgebunden bleibt, über die sie in Form eines Dienstes unter aus Freiheit Gleichen ausgeübt wird. MATTHIAS FRITSCH erinnert daran, dass der ursprüngliche Zusammenhang von Naturrecht und Theologie im Zeitalter der Aufklärung nicht mehr ohne weiteres gegeben war. Den Grund dafür sucht er in der Dominanz eines mechanistischen Naturbegriffs, der das Naturrecht seiner metaphysischen Grundlagen beraubt habe. Die überwiegend von Denkern des süddeutschen Raums getragene ‚katholische Aufklärung‘ stand deshalb vor der Herausforderung, die bisher durch das Naturrecht als verbindliche Norm der Interpretation der Offenbarung garantierte Einheit des Glaubens mit dem Faktum religiöser Pluralität zu vereinen, was als notwendige Voraussetzung für den gesellschaftlichen Frieden angesehen werden musste. ALFRED HABICHLER erläutert ausgehend vom biblischen basileia-Begriff die Aufnahme des Reich-Gottes-Gedankens durch die Aufklärung. Obgleich diese darunter letztlich eine anthropologische, innerweltlich erfahrbare Seite der Herrlichkeit Gottes im Sinne eines Idealzustandes der menschlichen Gesellschaft verstanden habe, sei so doch wenigstens der Gottesgedanke für die Philosophie gerettet worden. Als ‚moralisierter‘ Begriff (Reich Gottes = ethische Gemeinschaft) wird die Reich-Gottes-Idee für die Aufklärung zu einem Garanten des Gelingens der Selbstkonstitution menschlich-sittlicher Vernunft. Der innerweltliche Friede konnte sich somit auch für die zeitgenössische Theologie (Tübinger Schule) als soziale Qualität im Hinblick auf die Realisierung des Reiches Gottes erweisen. HEINZ DUCHHARDTs Überlegungen nehmen ihren Ausgang von der Paradoxie, von Friedensinstrumenten in einer Epoche sprechen zu sollen, für die der Krieg als gesellschaftlicher Normalzustand gelten musste. Dass gleichzeitig die Friedenspublizistik in dieser Zeit ihre Blüte erlebte, erscheint ihm jedoch mehr als nur ein Hinweis darauf, dass Anstrengungen in Richtung auf einen „ewigen“ europäischen Frieden allgemein für notwendig erachtet wurden. In der politischen Praxis habe sich dieser Wunsch in der Suche nach friedlichen Konfliktlösungswegen (Diplomatie, Schiedswesen, Verträge) geäußert. Dennoch bleibt Duchhardts Blick auf die Friedensfähigkeit der Epoche skeptisch, da die Machtkonkurrenz zwischen den Staaten und die Konzentration auf die innere Herrschaftskonsolidierung das Gemeinschaftsinteresse ‚Friede‘ in den Hintergrund treten ließ. GEORG CAVALLAR spürt der Entwicklung des Fremdenrechts und seiner naturrechtlichen Begründung nach. Obgleich im 17. Jahrhundert der Umgang mit Minoritäten noch ganz im Ermessen des souveränen Herrschers gelegen habe, setzte sich bald der Gedanke einer relativen Souveränität im Hinblick auf die 12 Vorwort der Herausgeber gemeinsamen Interessen der Staaten durch, wozu insbesondere Fragen der Staatsbürgerschaft und des Asylrechts gehörten. Im 18. Jahrhundert begünstigten föderative Ideen die weitere Ausbildung eines internationalen Rechts, welches auch den Umgang mit Angehörigen fremder Staaten umfasste. Dass die Diskussion um das Fremdenrecht aber auch die Entwicklung nationaler Identitäten begünstigte, zeigt der Blick auf das 19. Jahrhundert, welches erst mehrere europäische Kriege mit ansehen musste, bevor in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Fremdenrecht und Europa-Idee wieder zueinander fanden. J. WILLIAM FROST demonstriert am Beispiel Pennsylvanias, wie auf der Basis eines religiösen Pazifismus in Amerika eine Kontrastgesellschaft zur europäischen Mächtepolitik geschaffen werden konnte. Dass dem Friedenskonzept der Quaker kein naiver Biblizismus zugrunde lag, sondern eine differenzierte Auseinandersetzung mit den naturrechtlichen Argumenten der traditionellen justwar-theory, zeigt sich daran, dass die Religions- und Gewissensfreiheit als übergeordnetes Prinzip des politischen Handelns angesehen wurden. Obwohl die ‚Glorious Revolution‘ (1688) dieses pazifistische Projekt endgültig beendete, sieht Frost im praktizierten Menschenrechtsethos der Quaker einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung der amerikanischen Zivilgesellschaft. NORBERT BRIESKORN klärt über die Hintergründe des neuzeitlichen Hexenwahns auf, der noch im 17. Jahrhundert ganze Gesellschaften erfasste. Er zeigt die enge Verquickung von weltlichem und kirchlichem Recht auf und legt dar, inwiefern die Ausübung des Strafrechts eine notwendig Form der Machterhaltung darstellte. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie die Forderungen Friedrich Spees SJ in Richtung der Kontrolle von Macht durch Recht einen Weg zu einer humaneren und letztlich friedlicheren Zivilgesellschaft eröffnet hätten. DIETER JANSSEN konstatiert für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts einen Wendepunkt in den Beziehungen der europäischen Staaten, der mit dem Beginn des klassischen (positiven) Völkerrechts zusammenfalle. Vor dem Hintergrund zeitgenössischer Konzepte der Kriegslegitimation analysiert er die Völkerrechtstheorie des Briten Richard Zouchs im Hinblick auf ihre konfliktbeschränkenden Wirkungen. Im Horizont des englischen Bürgerkrieges und um der Gefahr einer internationalen Staatenanarchie zu begegnen, habe dieser eine von religiösen Prämissen losgelöste Form des Völkerrechts begründet, in dessen Rahmen dem Weg der Rechtsfindung durch Richterspruch (iudicium) eine hervorgehobene Stellung eingeräumt wird. FRANÇOISE HILDESHEIMER verdeutlicht die ideologischen Grundlagen der französischen Außenpolitik im 17. Jahrhundert und ergänzt so das bisherige Bild Richelieus als eines Architekten des europäischen Sicherheitssystems um den Aspekt des berechnenden Machtpolitikers. Indem sie dessen Friedenspropaganda als Deckmantel des französischen Machtstrebens entlarvt, plädiert sie zugleich für eine Entheroisierung Richelieus, dessen Europa-Ideen sich letztlich als Kon- Vorwort der Herausgeber 13 strukt eines hegemonialen, durch Allianzen abgesicherten Einflussstrebens erweisen lassen, welches mit dem Gedanken der europäischen Einigung wenig gemein hat. RUDOLF SCHÜßLER vertieft dies durch den Blick auf Richelieus Zeitgenossen François de la Mothe le Vayer, der mit seinen pädagogischen Schriften zur Erziehung des Dauphin großen Einfluss auf die französische Staatsideologie gewinnen konnte. Vor dem Hintergrund zeitgenössischer skeptischer Strömungen tritt mit den Gedanken Le Vayers ein pragmatisches Nutzenkalkül an die Stelle naturrechtlicher Herrschafts- und Kriegsbegründungen. Die moralische „Entwertung“ des Krieges stehe dabei letztlich im Dienst einer Apologie des Absolutismus und der Staatsräson, wonach schon eine vage Furcht vor dem Feind ausreiche, um einen Angriffskrieg zu legitimieren. Obgleich sich als unpolitischer Autor verstehend, steht Le Vayer somit in der Nähe bellizistischer Strömungen im Umkreis der frühneuzeitlichen Skepsis gegen jeden (auch politischen) Vernunftoptimismus. PETER SCHALLENBERG beschreitet in seinem Beitrag einen Seitenweg des politischen Denkens der Neuzeit, indem er über die Vereinbarkeit von religiös inspirierter Mystik und politischer Ethik bei Fénelon reflektiert. Dessen interiorisierter, in der interesselosen Gottesliebe wurzelnder Friedensbegriff sei dem in der Neuzeit vollzogenen Bruch zwischen Kirche und Kultur durchaus entgegengekommen, ohne den sich im Privaten Gott zuwendenden Menschen vom politischen Handeln zu dispensieren. Die friedensethische Bedeutung dieses Denkens liegt darin, dass es auf die Durchsetzung von persönlichen Interessen verzichtet, während Krieg nach der Auffassung Fénelons gerade im Widerstreit der Interessen gründe. Weil so aber die politische Ethik psychologisiert werde, mache sie letztlich jegliche staatliche Ordnung als äußere Organisationsform des Interessenkonflikts überflüssig. ROBERT MINER belegt am Beispiel des Italieners Giambattista Vicos, dass es durchaus möglich ist, politische Ethik auf eine Geschichtsphilosophie zu gründen. Die Einteilung der Menschheitsgeschichte in drei Phasen ermöglicht es Vico, die unterschiedlichen Kriegsgründe jeder Epoche zu systematisieren und zu bewerten. Anders als bei mittelalterlichen Modellen verläuft die Gesellschaftsentwicklung hier zyklisch von einer paternalistischen Form der Herrschaftsausübung (family monarchy) über aristokratische und demokratische Staatsformen bis zu der von Vico als ideal empfundenen, durch konstitutionelle Rechte beschränkten civil monarchy. Erst diese könne zu einem dauerhaften Frieden auf der Grundlage des Gemeinwohls führen. Friede dient somit letzten Endes nur einem Ziel: der Selbsterhaltung der Staaten. Demgegenüber bleibt die Rolle der Religion ambivalent: Sie ist einerseits Kriegsursache, andererseits aber auch das einzige Mittel, um die menschliche Zwangslage durch Tugendhaftigkeit zu überwinden. 14 Vorwort der Herausgeber MAXIMILIAN FORSCHNER sucht im Werk Jean-Jacques Rousseaus nach Hinweisen auf eine völkerrechtsethische Beurteilung von Krieg und Frieden. Ausgangspunkt ist die Frage, was grundsätzlich der Herrschaft von Menschen über Menschen Recht verleihen kann. Im Anschluss an Hobbes’ Analyse des zwischenstaatlichen Naturzustandes gehe Rousseau von einer naturwüchsigen Konkurrenz um Eigentumsverhältnisse aus. Um Krieg zu vermeiden, empfehle er kleine, autarke, selbstzufriedene Staaten, die auf Expansion, nicht aber auf ein naturrechtlich verbürgtes Verteidigungsrecht verzichten könnten. Gegenüber zeitgenössischen Friedensplänen wie denen eines Abbé de St. Pierre bleibt Rousseau skeptisch, wenn auch wohlwollend eingestellt, beschränkt sich selbst aber auf die Prinzipien des Staatsrechts und die Fortentwicklung völkerrechtlicher Institutionen. KARL-HEINZ ZIEGLER gibt einen Überblick über die Entwicklung von der naturrechtlichen zur positivistischen Völkerrechtsbegründung im 18. Jahrhundert. In diesem Zusammenhang betrachtet er den Schweizer Völkerrechtler Emer de Vattel als letzten Naturrechtssystematiker der Neuzeit, dessen Verdienst es gewesen sei, nochmals die geistige Verbindung zwischen Völkerrechtspraxis und philosophischem System geschaffen zu haben, bevor das Naturrecht als Quelle des Völkerrechts endgültig aus der Rechtstheorie verdrängt wurde. Dies zeige sich etwa in seiner Einschätzung des Krieges als erlaubtem Mittel der Rechtsverfolgung zwischen Staaten, die jedoch aufgrund ihrer Natur als souveräne Rechtssubjekte grundsätzlich eine friedliche Völkergemeinschaft (société des nations) bilden sollen. BETSY BAKER legt schließlich dar, wie sich im Denken Johann Caspar Bluntschlis der Zivilisationsgedanke mit dem Völkerrecht verbunden hat. Unter zivilisierten Staaten würden solche verstanden, die im Laufe ihrer Geschichte ein gemeinsames Rechtsbewusstsein entwickelt hätten, weshalb Bluntschli trotz seiner systematischen Trennung zwischen Recht und Religion in der Christenheit die höchste Form der Zivilisation im Sinne einer humanen, auf Gleichheit und Gegenseitigkeit aufbauenden Ordnung sehen kann. Aufgrund der Ungleichzeitigkeit in der Geschichte der Völker müsse das Völkerrecht als Bindeglied des Zivilisationsprozesses dienen. In diesem Rahmen wird der Krieg zwar als Handlungsmöglichkeit akzeptiert, bleibt aber vom Recht grundsätzlich normiert (ius in bello), sodass für Bluntschli an die Stelle zivilisatorischer Kriege zivilisierte Kriege treten – ein Zeichen dafür, dass er an eine günstige Entwicklung der Völkergemeinschaft unter dem Einfluss des positiven Rechts glaubte. Die hier publizierten Beiträge sind im Rahmen eines vom Institut für Theologie und Frieden (Hamburg) durchgeführten interdisziplinären Forschungsprojektes zur Ideengeschichte des Friedens entstanden und gehen auf wissenschaftliche Symposien der Jahre 2004 und 2005 zurück. Den Autorinnen und Autoren danken wir herzlich für Ihre Mitwirkung und die Ausarbeitung ihrer Vorträge zum Druck. Markus Kremer, Hans-Richard Reuter