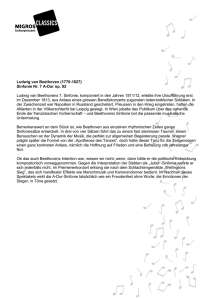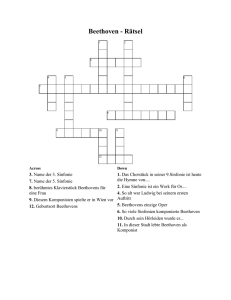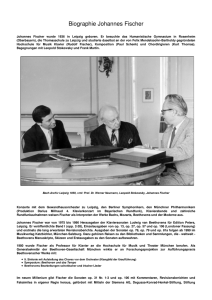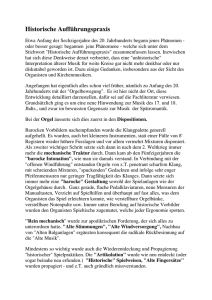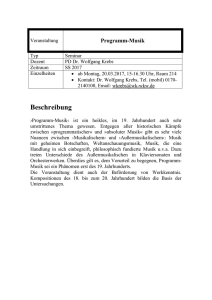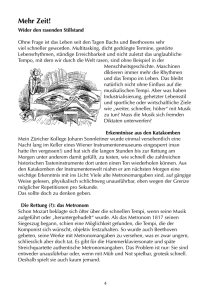Guardini Stiftung - Triangel-Kolloquium Die Zeit als erlebbares
Werbung

Guardini Stiftung - Triangel-Kolloquium Schlüsselworte der Genesis: Die Zeit 19. – 21. April 1996 in Berlin 09. – 11. Mai 1997 in Berlin Konzeption des Kolloquiums: Prof. Dr. Erwin Sedlmayr Die Zeit als erlebbares Phänomem Harke de Roos Teil 1: Die Musik: ein Gebilde aus erlebbaren Zeitproportionen A: Die Zeitproportionen des tonalen Systems B: Die Zeitproportionen des Tempos C: Die Zeitproportionen der Tonquantitäten Teil 2: Das historische Zeiterlebnis A: Das historische Empfinden des tonalen Systems B: Das historische Empfinden der Zeitmaße C: Das historische Empfinden der Tonquantitäten (Tempo Ordinario) Teil 3: Beethovens Eingriff in das musikalische Zeiterlebnis A: Die klassische Zeitstruktur in den Werken Beethovens B: Die Veränderung der Zeitmaße durch das Metronom C: Beethovens Metronomisierung: eine nach Auflösung strebende Dissonanz D: Die versäumte Auflösungspflicht E: Epilog Die Zeit als erlebbares Phänomen. Die Musik: ein Gebilde aus erlebbaren Zeitproportionen A. Die Zeitproportionen des tonalen System Mit unserer Musik haben wir eine Ausdrucksform für jeden erdenklichen Zustand unseres Gemüts geschaffen. In Prinzip gibt es keine Gefühlsregung, welche keine adäquate Darstellung in den Klängen der tonalen und atonalen Tonkunst des Abendlandes hat. Die Ausdrucksmittel der Musik beschränken sich keineswegs auf Pauschal–Stimmungen, sondern reichen für die Schilderung feinster Nuancen aus. Sie unterscheidet zwischen Jubel und stiller Freude, zwischen Trauer und Traurigkeit, zarter Melancholie und abgrundtiefem Pessimismus, sie kennt den Stolz, die Demut, den Übermut, die Pietät, die Extase, die Einsamkeit, die Frechheit, sie schildert das Wesen der Gewalt und ist zugleich wie keine andere Kunsttorm mit der Zärtlichkeit bekannt. Kurz: das Gemüt schwimmt in der Musik wie der Fisch im Wasser, sie ist das Element der Seele. Die Gefühlsebene macht leicht vergessen, daß die Musik aus lauter Zeitproportionen besteht und sonst nichts. Das Erleben aller Musik, egal wie sie beschaffen ist, ist die Erfahrung des Zeitraums. Auf drei Ebenen offenbart sich diese Raumerfahrung: in den Tönen, in den Tempi und in den Tonmengen oder Tonquantitäten. Die erste Ebene, die der Töne, wird seit den Tagen des Pythagoras unaufhörlich erforscht. Die Töne selbst stellen wie jeder weiß, Geschwindigkeiten dar: je höher die Töne klingen, um so schneller sind sie. Mit großer Präzision mißt unser Gehör die Dichte der Schwingungen und doch ist dieser Meßvorgang uns nicht bewußt. Es ist, wie Leibnitz es ausdrückte: „Unsere Seele zählt, ohne daß wir es wissen”. Allerdings interessiert das musikalische Gehör sich keineswegs für die Geschwindigkeiten selbst, sondern aus- schließlich für die dazwischenliegenden Räume. Nur wenn diese wohlproportioniert sind, kann das Bewußtsein die obengenannten Empfindungen beziehen, wenn nicht, so empfinden wir die Töne selbst, d.h. die einzelnen Geschwindigkeiten, als unerträglich. Für unser an der abendändischen Musik geschultes Ohr sind die Räume dann wohlproportioniert, wenn sie nach dem Prinzip des Gleichschritts, der Zwei-, Drei- und Funfteilung geordnet sind. Die Oktave ist das akustische Sinnbild der Zweiteilung, wobei auch die Vierteilung, die Acht- 7 Sechszehn-, Zweiunddreißigstelteilung usw. als Oktave wahrgenommen wird, d.h. als Tönenpaar mit gleicher Identität. Die Quinte ist das akustische Sinnbild der Dreiteilung, die Terz introduziert die Fünfteilung und zugleich die Proportionen des „Goldenen Schnitts”. In dem Raum mit der Proportion einer Doppeloktave liegt der Goldene Schnitt genau zwischen den beiden Dezimen, dem großen und dem kleinen. Im großen und kleinen Dreiklang sind die unterschiedlichen Teilprinzipien miteinander verbunden.. B. Die Zeitproportionen der Tempi Über die Ton-Intervalle und ihre Vielfalt ist bereits viel gesagt worden. Sehr viel weniger hat man über die Tempo-Intervalle nachgedacht, obwohl diese viel Ähnlichkeit mit den Ton-lntervallen haben und für das Erleben der Musik genauso wichtig sind. Unter die Tempi der Musik versteht man die Geschwindigkeiten der Töne in ihrer Abfolge. Genaugenommen bedeutet Tempo nicht Geschwindigkeit, sondern Zeit oder Zeitmaß. Dieses letzte Wort ist veraltet und nicht ohne Grund. Der Begriff Zeitmaß oder Maß der Zeit deutet auf abgemessene Proportionen hin, die heute weniger Bedeutung haben als in früheren Zeiten. Bekanntlich besteht eine Melodie in der Regel nicht nur aus Tönen gleicher Geschwindigkeit. Auch haben die verschiedenen Stimmen mehrstimmiger Musik nicht alle das gleiche Tempo. Dem Konzertbesucher wird diese Verschiedenheit beim Betrachten der spielenden Instrumentengruppen anschaulich vor Augen geführt, zum Beispiel wenn die ersten Violinen schnellere Töne spielen als die Kontrabässe, das Fagott langsamer spielt als die Flöte etc. etc. Damit die verschiedenen und wechselnden Geschwindigkeiten miteinander harmonieren, haben die Töne in ihrer Abfolge ganz ähnliche Proportionen wie die Tonhöhen untereinander. Auch hier dominieren Gleichschritt, Zweiteilung und Dreiteilung. Die Fünfteilung ist allerdings bei den Tempi weniger präsent als bei den Tönen. Im großen und ganzen jedoch sind die Zeitproportionen der Tempi aufs engste mit der Harmonie der Töne verwandt. Sobald die Proportionen der Tempi unsaüber werden, sagt man, daß die Musikinstrumente nicht mehr korrekt zusammenspielen. Für den Zusammenhalt der Tempovielfalt garantiert das Grundtempo, das Zeitmaß. C. Die Zeitproportionen der Tonquantitäten Neben dem Aspekt der Tonhöhen und Tongeschwindigkeiten gibt es den dritten Aspekt der Tonquantitäten, womit Tongruppen wie Takte, Perioden, Teile und Sätze gemeint sind. Auch diese sind nach den gleichen harmonischen Prinzipien geordnet. Im klassischen Aufbau eines Sonatesatzes gibt es Perioden, die exakt symmetrisch sind oder Proportionen produzieren, die nach den Relationen der Quinte, der Quarte und anderen Ton-lntervallen beschaffen sind. Die Frage ist allerdings, in wieweit unser Gehör imstande ist, diese Proportionen zu registrieren und ihre Harmonie zu genießen. Nach heutiger Auffassung sind unsere inneren Uhren nicht fähig, über längere Strecken hinweg Zeiträume zu zählen und ihre Abmessungen miteinander zu vergleichen. Es gibt aber Gründe dafür, diese Auffassung in Zweifel zu ziehen. Es ist durchaus möglich, daß dieselbe unbewußte Zähltätigkeit unseres Gehirns, die datür verantwortlich ist, daß wir Ton2 höhen registrieren können, auch auf den weiten Strecken des musikalischen Ablaufs funktioniert. Auf jeden Fall ist dieses geheimnisvolle Zählen der Schlüssel zu sämtlichen musikalischen Empfindungen. Jeder Ton, jeder Akkord, jeder Rhythmus und jedes Timbre wird durch hörbare Zeitraume vermittelt. Es handelt sich um eine Tatsache, die von niemandem bestritten wird, aber auch nicht von der Wissenschaft erklärt werden kann.. Das historische Zeiterlebnis A. Das historische Empfinden des tonalen Systems Der übergroße Teil aller Kompositionen, die heute gespielt werden, ist älter als hundert Jahre. Vor allem die Werke des 18. und des frühen 19. Jahrhunderts stehen im Brennpunkt der Öffentlichkeit. Durch die historische Aufführungspraxis versucht man ihnen so nah wie möglich zu kommen. Nahezu unmöglich ist es jedoch, die subjektiven Empfindungen aus dieser Epoche nachzuvollziehen. Trotzdem läßt sich einiges über das kollektive Empfinden von damals sagen. So ist es kein Geheimnis, daß das Empfinden der Konsonanzen und Dissonanzen sich im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt hat. Ton-Intervalle, die im 16. Jahrhundert noch als dissonant empfunden wurden, galten zwei Jahrhunderte später als Konsonanzen. Und die Dissonanz hat in unserem Jahrhundert wiederum eine grundlegend andere Funktion als in den vergangenen Jahrhunderten. Offensichtlich gewöhnt sich das kollektive Gehör an Disproportionen. Dennoch spielen wir die Töne der Musik des 18. Jahrhunderts so wie sie damals geschrieben wurden und verzichten gerne auf dissonante Zutaten. Und doch ist es sehr unwahrscheinlich, daß wir, selbst wenn wir die gleiche Musik unserer Vorfahren spielen, das Spannungsverhältnis zwischen Konsonanz und Dissonanz genauso empfinden wie sie. B. Das historische Empfinden der Tempi Etwas anders verhält es sich mit dem historischen Empfinden der Tempi. Auch in dieser Hinsicht hat sich der kollektive Geschmack selbstverständlich weiterentwickelt. Aber kein Mensch würde ernsthaft behaupten wollen, daß in der heutigen Aufführungspraxis auch historische Tempi gespielt werden, ganz egal ob es sich um die historische oder um die „normale” Aufführungspraxis handelt. Dafür gibt es zweierlei Gründe. Zum ersten verzichten die Musiker ungerne auf das Recht der freien Tempowahl und zum zweiten sind sich die Spezialisten nicht einig. Es gibt eine vielbeachtete Theorie, nach der sämtliche Tempi des 18. Jahrhundert in einem kontinuierlichen Beschleunigungsprozeß von nunmehr zwei Jahrhunderten begriffen sind. Es gibt auch andere Stimmen, welche behaupten, daß die Tempi in den letzten zweihundert Jahren gerade langsamer und zähflüssiger geworden sind. Offensichtlich haben die Vertreter beider Richtungen die klassischen Tempo-Intervalle nicht richtig studiert, sonst würden sie sich nicht auf eine Position festlegen. Auf ganz einfache Weise kann nachvollzogen werden, was wirklich mit den klassischen Tempi passiert ist. Sämtliche musikalische Tempi des 18. Jahrhunderts wurden bereits von Anfang des vorigen Jahrhunderts an von einer ständigen Zentrifugalkraft auseinandergezogen: die Andante- und Adagio-Sätze wurden in der Regel immer ausdrucksvoller und somit langsamer gespielt, die Allegro- und Presto-Sätze dagegen brillanter und somit schneller. Alle Tempo-Intervalle, die zwischen sogenannten langsamen und sogenannten schnellen Sätzen bestanden, haben sich be3 ständig ausgedehnt. Der Grad dieser Ausdehnung hängt allerdings von mehreren Faktoren ab wie die Höhe der Originalgeschwindigkeit oder die spieltechnischen Schwierigkeiten. Der ursprüngliche Zustand der Tempo-lntervalle ist im Grunde leicht zu rekonstrnieren, aber er wird von den ausführenden Musikern gemieden wie das Weihwasser vom Teufel. Wenn ich Ihnen einige Beispiele vorführen darf, werden Sie gleich verstehen, wo das Problem liegt. Ich spiele Ihnen die Anfänge von zwei Ouvertüren von Mozart vor, zunächst in der überbekannten Fassung danach mit wiederhergestellten Originalproportionen. (Zauberflöte, cosi fan tutte) C. Das historische Empfinden der Tonquantitäten (Tempo Ordinario) Wie unzählige andere Sätze gleicher Struktur hatten diese beiden Ouverturen ursprünglich ein ganz unspektakuläres 1:2 –Verhältnis zwischen den jeweiligen Notenwerten. Ein heute allgemein verbreitetes Mißverständnis ist die Deutung der Bezeichnungen Adagio und Allegro, die fälschlicherweise als „langsam” und „schnell” aufgefaßt werden. Adagio konnte zwar tatsächlich „langsam” heißen, aber die Übersetzung mit „gemächlich” war ebenfalls gültig. „Allegro” bedeutet „lustig”, wobei lustig damals nichts mit Spaß und Humor und schon gar nicht mit Geschwindigkeit zu tun hatte, sondern lediglich mit Lust, d.h. Appetit oder Begehren. Das will noch nicht sagen, daß es im 18. Jahrhundert keine schnelle Allegro-Sätze gab. Die jeweilige Ge schwindigkeit wurde jedoch von anderen Gesetzen bestimmt, die man heute nicht mehr kennt. Lediglich den Namen des Tempogesetzes des 18. Jahrhundert ist noch geblieben, er lautet „tempo ordinarioÓ. Wie es funktioniert, scheint niemand zu wissen oder wissen zu wollen. Offensichtlich befürchten die austührenden Musiker, daß es sich um ein blasses und unspektakuläres Prinzip handelt. Das Adjektiv ordlinario hat jedoch nichts mit dem deutschen ordinär zu tun, sondern bedeutet nichts weniger als ”teilhabend an einem organischen ZusammenhangÓ. Jede mehrsätzige Komposition in der Zeit vor der Französischen Revolution wurde, was ihre Zeitstruktur angeht, nicht wie eine zufällige Ansammlung von verschiedenster Teile, sondern als organische Einheit aufgefaßt. Dazu brauchten die Musiker nicht aufgefordert zu werden, weil die Zeit anscheinend als eine höhere Ordnung erlebt wurde, ganz im Gegensatz zu heute. Als Beispiel wähle ich wieder zwei Werke von Wolfgang Amadeus Mozart. Seine Jupiter-Symphonie in C-Dur, K.V. 551 fügt sich in ihrer Zeitstruktur zu einer Einheit zusammen, wenn ihre Tempi harmonische Proportionen haben. Die Formel für die ersten drei Sätze lautet: Halbe=Viertel=3/4-Takt. Zwischen den beiden letzten Sätzen gilt Viertel=Viertel. Wenn die Temporelationen eingehalten und die Wiederholungsvorschriften richtig interpretiert werden, bilden nun auch die Volumina der Sätze und der Satzpaare harmonische Proportionen. So is das Verhältnis der ersten beiden Sätze wie eine Oktave ( 870 - 435 Zähleinheiten ); die Volumina der Satzpaare sind streng symmetrisch geworden. Für die Tempowahl bedeutet dies, daß die Ecksätze nach unseren heutigen Begriffen langsam, die Mittelsätze dagegen flüssig gespielt werden müßten. (Hörbeispiel) Die g-moll-Symphonie, K.V. 550, hat die einfache Formel: Viertel=Achtel=Viertel=Halbe. Die Volumina der Sätze bilden miteinander Dissonanzen, welche sich in den Proportionen der Satzpaare auflösen. Die Tonquantitäten der beiden ersten Sätze bestehen aus 3072 Zähleinheiten, die des zweiten Satzpaares aus 1536 Einheiten, wenn die Wiederholung des zweiten Finaleteils nicht gemacht wird. Durch das Wiederholen des letzten Teils wird diese glasreine Oktavenproportion zu einem nahezu idealem „Goldenen -Schnitt” ( 30721904). Bei solchen scharfen musikalischen Großproportionen ist die Vermutung gerechtfertigt, daß diese Zeitstrukturen doch erlebbar sind oder es zumindest waren. 4 Das interessante an den Temporelationen der g-moll-Symphonie ist der große Unterschied in den Tempi der beiden Ecksätze, die auf dem ersten Blick völlig ähnliche Tempovorschriften tragen. Der letzte Satz müßte sogar doppelt so schnell wie der erste gespielt werden, was ein durchaus modernes Niveau wäre. Der erste Satz erscheint dagegen als Musterbeispiel für die fast zweihundertjährige Beschleunigung. Beethovens Eingriff in das musikalische Zeiterlebnis A. Die klassische Zeitstruktur in den Werken Beethovens Die Beschleunigung der Allegro- und Presto-Sätze und die Tempodrosselung der Adagio- und AndanteSätze begann vermutlich bereits vor der Wende zum 19. Jahrhundert. Spätestens für das erste Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts ist sie durch Berichte in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung Leipzig dokumentiert. Im gleichen Jahrzehnt begann die reichste Schaffensphase Beethovens, der von vielen in dieser Periode als Radikalerneuerer betrachtet wird, wenigstens als einer, der mit den Tempogesetzen der vergangenen Epoche gründlich aufräumte. Wendet man jedoch das Prinzip des „Tempo Ordinario” auch auf die Werke Beethovens an, so wird man entdecken, daß es gerade hier so gut funktioniert wie nirgendwo sonst. Wie kaum ein zweiter war der Musikarchitekt Beethoven um die organische Einheit seiner Werke bemüht. So herrschen in den ersten vier Symphonien klarste Verhältnisse, sowohl was die Relationen der Tempi als die Proportionen der Tonquantitäten betrifft. Zwar ist die Zeitstruktur dieser Symphonien von der unverwechselbaren Individualität ihres Verfassers geprägt, es kann dennoch kein Zweifel daran bestehen, daß die Werke in der Tradition des Goldenen Jahrzehnts der Wiener Klassik stehen. So ist es nicht schwierig, aus den Noten abzulesen, daß die Adagio-Einleitungen der Ersten, Zweiten und Vierten Symphonie das halbe Tempo der darauffolgenden Allegri haben müssen. Demzufolge gab es damals höchst unspektakuläre Geschwindigkeiten in diesen drei symphonischen Anfangssätzen. Man kann sogar beim Aufzählen der Gemeinsamkeiten noch weiter gehen. So werden die ausführenden Musiker in jenem Jahrzehnt bei der Aufführung der Werke Beethovens die gleichen Temposünden gemacht haben, die sie auch in den Werken Mozarts und den des noch lebenden, ader bereits verstummenden Haydns machten. Der einzige Unterschied zwischen Mozart und Beethoven bestand darin, daß letzgenannter noch etwas gegen die Temposünden unternehmen konnte. Wenn er es gemacht hätte, wäre es für unsere Kenntnisse von großem Vorteil gewesen, denn gerade Beethoven bildet ein wichtiges Bindeglied zwischen den Epochen. Jedoch steht der musikalischen Aufklärung ein höchstpersönlicher Charakterzug Beethovens im Wege, der nicht leicht zu erklären ist. Als die Orchestermusiker, um nur ein Beispiel zu nennen, bei einer Wiederauflage der Oper „Fidelio” nach dem Geschmack des Meisters zu wenig Unterschied zwischen laut und leise machten, schlug er vor, die dvnamischen Vortragszeichen kurzerhand zu streichen, „da diese doch nicht gemacht werden”. Offensichtlich war der Tondichter doch nicht so heroisch und kämpferisch, wie viele ihn gerne sehen. Zumindest neigte er dann und wann zu Resignation. Auf keinen Fall verstand er sich als Schulmeister. Er sah sich selbst ausschließlich als einen schaffenden Künstler. Niemals hätte er eine Gebrauchsanleitung zur Aufführung seiner Kompositionen geschrieben, obwohl er sich in extremen Maße darüber ärgerte, wenn sie nicht richtig aufgeführt wurden. So wis5 sen wir von ihm, daß er seine Tempi als „häufig verfehlt” betrachtete und doch hat er und nie verraten, welche Fehler es genau waren. B. Die Veränderung der Zeitmaße durch das Metronom Als er zum erstenmal mit einem mechanischen Geschwindigkeitsmeter namens Chronometer konfrontiert wurde, geriet Beethoven in Zorn und nannte das Gerät „Dummes Zeug”. Als Grund nannte er: „ Man muß die Tempi fühlen!”. Die Tatsache, daß am Ende des ersten Jahrzehnts mit der Entwicklung einer mechanischen Zeitmessung begonnen wurde, beruht nicht auf Zufall, sondern ist ein Zeichen dafür, daß viele mit dem Chaos auf dem Gebiet der musikalischen Tempi unzufrieden waren. An verschiedenen Orten in Europa wurde an einem musikalischen Tachometer gearbeitet. Der Mechaniker, der schließlich das Rennen machte, hieß Johann Nepomuk Mälzel, der bis 1813 in Wien wohnte. Daß er Wien verließ, war die unmittelbare Folge eines heßtigen Konflikts mit Beethoven über die Eigentumsrechte der programmatischen Schlachtsymphonie „Wellingtons Sieg”. Bis dahin hatten die beiden Männer auf verschiedenen Gebieten zusammengearbeitet, nur nicht auf dem Gebiet der Zeitmessung. Dennoch konnte Beethoven sich, als die mechanische Zeitmessung sich durchsetzte, unmöglich aus der Affäre heraushalten. Er hätte sonst seine Glaubwürdigkeit als führender Tonkünstler aufs Spiel gesetzt. Dazu kam, daß die musikalischen Behörden Wiens den Zeitmesser Mälzels massiv unterstützten. Als das Gerät 1817 in Österreich auf den Markt kam, wurde es vom Kaiser selbst patentiert. Von Beethoven, der eine Jahresgage auf Lebenszeit vom jüngsten Bruder des Kaisers erhielt, wurde die Unterstützung für Mälzels Metronom als eine Selbstverständlichkeit betrachtet. Dennoch war Beethovens Aversion gegen die mechanische Zeitmessung natürlich nicht verschwunden. Diese wurde außerdem durch die Tatsache verstärtkt, daß der Rechtsstreit mit Mälzel noch immer nicht entschieden war. Auch spielte Beethovens Abneigung gegen die österreichische Obrigkeitsgesellschaft unter Metternich eine Rolle. Mit tiefem Mißtrauen betrachtete er die Absicht der Musikbehörden, die Metronome flächendeckend unter die österreichischen Untertanen zu bringen, damit auch die Tempi der Musik nach Vorschrift geregelt werden sollten. Dieses Mißtrauen ist aus einem hochironischem Brief an Hofrath Ignaz von Mosel vom November 1817 klar erkennbar. Lange Rede, kurzer Sinn: Beethoven hätte nicht Beethoven geheißen, wenn er keine Lösung gefunden hätte, die seinem Genie entsprach. In tückischer Verstellung begab er sich unter die Vorreiter des Metronoms, beschloß aber, seine eigenen Tempi nur in verrätselter Form mitzuteilen. Die Zahlen, die er gab, waren zwar allesamt richtig, die Bezugswerte jedoch waren für den größten Teil ( in einem Verhältnis von 6: 7 ) absichtliche Irrtümer, die von seinem Interpreten erkannt und berichtigt werden mußten. So konnte er die Angaben, ganz nach seiner privaten Ideologie, „geben ohne zu geben”. Er hätte gar nicht anders handeln können, da hier die Pathologie auch ein Wörtchen mitspricht. Nur zu leicht vergißt man, daß eine so schwere Erkrankung wie Beethovens völlige Ertaubung nicht ohne psychische Folgen bleiben kann. C. Beethovens Metronomisierung: eine nach Auflösung strebende Dissonanz Die verrätselten Tempi haben eine enge Verwandtschaft mit Rätselkanons, die zum Zeitpunkt der Metronomzahlen eine Lieblingsbeschäftigung des Meisters waren. Es würde allerdings zu weit führen, die Vielschichtigkeit des metronomischen Rätsels in einem einzigen Vortrag zu erklären, aber einige praktische Beispiele möchte ich Ihnen doch nicht vorenthalten. Beethovens Siebente Symphonie in A-Dur fängt mit ei6 nem 4/4-Takt an (poco maestoso). Die metronomische Bezeichnung (M.M.) des Meisters lautet Viertelnote=69, was nichts anderes bedeutet, als daß die Viertelnote 69 mal in einer Minute erscheint. Es handelt sich hier um eine unproblematische und unverrätselte Angabe. Beim Eintritt des Hauptthemas jedoch wechselt der Komponist die Notation und aus dem 4/4-Takt wird nun ein 6/8-Takt. Nochmals: dieser Wechsel ist nur ein Notationswechsel und kein Wechsel in der Geschwindigkeit. Eine Veränderung des Grundtempos wäre ein undenkbarer Verstoß gegen die formalen Gesetze der Wiener Klassik Infolgedessen darf sich die Metronomzahl beim Notationswechsel ebenfalls nicht ändern. Richtig wäre nur die Zahl 69, bezogen auf die punktierte Viertelnote. Für das Einrennen offener Türe ist Beethoven sich aber zu schade. Er tut, als ob er sich in der Zahl verschreibt. Er verfährt mit dem 6/8-Takt so, als wäre es in Wirklichkeit ein 3/4-Takt. Bekanntlich sind der 6/8und der 3/4-Takt zwei Seiten desselben Wertstücks, wobei das Tempoverhältnis zwischen den beiden Zähleinheiten 2: 3 beträgt. Die Viertelnote im 3/4-Takt ist somit 50 % schneller als die punktierte Viertelnote im 6/8-Taktes. Das bedeutet, daß die Metronomzahl um 50 % höher sein muß, wenn sie auf die Viertelnote statt auf die punktierte Viertelnote bezogen wird. Da unsere Zahl für die Zähleinheit 69 beträgt, muß die Hälfte dieser Zahl dazugezählt werden um den Wert der Viertelnote zu berechnen. Wir kommen dann auf 103.5, was auf der Skala von Mälzl auf 104 abgerundet wird. Tatsächlich schreibt Beethoven beim Taktwechsel zum Vivace die Zahl 104. Damit täuscht er einen doppelten Irrtum vor. Zunächst hat er sich für den falschen Bezugswert entschieden, denn der 6/8-Takt ist in seiner Zweiteiligkeit nunmal grundsätzlich verschieden vom dreiteiligen 3/4-Takt. Diese Dreiteiligkeit ist nicht einmal als sekundäre Bewegung zur zweiteiligen Hauptbewegung vorhanden. Der zweite „Irrtum” ist allerdings noch tückischer als der erste. Wenn Beethoven sich schon für die Viertelnote als Bezugswert entscheidet, müßte er auch eine Viertelnote hinschreiben. Der angegebene Notenwert ist aber ein punktiertes Viertel, wodurch der Eindruck erweckt wird, daß der Komponist sich überhaupt nicht irrt und die Geschwindigkeit tatsächlich so haben will. Genauso wurde mit allen anderen Metronomangaben für die ersten acht Symphonien und die ersten elf Streichquartette verfahren. Die doppelten „Irrtümer” sind so ausgedacht, daß der Betrachter den Fehler auf dem ersten Blick übersehen muß, es sei denn, er/sie hat tatsächlich ein Fünkchen Ahnung von den klassischen Tempogesetzen. Dazu kommt noch, daß die meisten scheinbaren Mutationen der Tempi in die Richtung gegangen sind, welche bereits durch die Mode vorgeschrieben wurde. Die Sätze, die von seinen Interpreten bereits zu schnell ausgeführt worden waren, wurden in der Verrätselung beschleunigt, die zu langsam gespielten Sätze dagegen heruntergesetzt, nur fast immer in karikaturhafter Übertreibung. Auf dieser Art hat Beethovens Metronomisierung die Funktion eines musikalischen Lachspiegels: der Verfasser gibt das Porträt seines Interpreten in lachhafter Verzerrung wieder. D. Die versäumte Auflösungspflicht Der Interpret wird dadurch selbstverständlich in Zugzwang gebracht. Er darf nicht schlafen, er muß, so er die Werke Beethovens halbwegs richtig aufführen will, die Irrtümer zunächst erkennen und danach berichtigen. Diese Methode hat den großen Vorteil, daß der ausbührende Musiker die innere Logik der Angaben verstehen und nicht wie ein Automat oder willoser Befehlsempfanger bloße Zahlen in die Praxis umsetzen wird. In der Rätselform liegt die Aufforderung Beethovens zur Gleichberechtigung mit dem Verfasser selbst. An drei Beispielen möchte ich Ihnen zeigen, wie die Verrätselung die Tempi in alle Richtungen getrieben hat. In diesen drei Beispielen ist das ursprüngliche Grundtempo stets dassel7 be, da es sich um Musikteile handelt, die durch den Marsch inspiriert sind. Ein Marsch hatte zu Zeiten Beethovens immer 112 Schritte pro Minute. Hier sind die Stellen: 1. Symphonie, 1. Satz, 2. Teil des Hauptthemas 5. Symphonie, Haupthema des Finalsatzes 9. Symphonie, Alla Marcia, Variation mit Tenor+Chor im Finalsatz Und hier folgt die „irrtümliche” Modifikation der Märsche: 1. Doppeltes Tempo 2. Um die Hä.lfte heraufgesetzt 3. Um ein Viertel heruntergesetzt Die geniale Verrätselung der Beethoventempi hätte 1817 umgehend gelöst werden müssen. Die Möglichkeit, daß sie von den Fachleuten übersehen werden könnte, muß der Titan für so unwahrscheinlich gehalten haben, daß er sie vermutlich nicht einmal in Betracht gezogen hat. Als dann aber das Restrisiko zur Realität und damit zum größtmöglichen Malheur in der Musikwelt wurde, gab es für den Verfasser des Rätsels zwei Möglichkeiten: entweder, die Fachwelt über das Rätsel aufklären oder sie unter dem Motto, daß ihr nicht zu helfen ist, völlig aufgeben. In den verbleibenden neun Jahren bis zu seinem Tod gab Beethoven seinen Verlegern und anderen Interessenten wie Ferdinand Ries in fast unzweideutigen Anspielungen mehrere Hinweise auf die Rätselform seiner Metronomangaben. Außerdem wurden die fingierten Irrtümer in den zwei folgenden Metronomisierungen ( 1819 für die Hammerklaviersonate und 1826 für die Neunte Symphonie ) so dick aufgetragen, daß ihre Erkennung viel einfacher sein mußte als in den sogenannten „Steinerschen Listen” von 1817. Er ließ in beiden Fällen sogar einen Punkt bei einer punktierten Note weg, wodurch der doppelte Irrtum zu einem leichter erkennbaren Einzelirrtum wurde. Es half aber nicht. Die Fachwelt blieb stumm, weil sie sich vielleicht nicht wirklich für die Sache interessierte. Als Reaktion darauf blieb auch Beethoven stumm. Vielleicht war er der Meinung, dass die Fachwelt und damit die ganze Welt seine Werke gar nicht verdiente. Immerhin heißt es in einem Brief vom 18. Juli 1825 an seinen Sohn Karl: „... unser Zeitalter bedarf kräftiger Geister, die diese kleinsüchtigen, heimtückischen, elenden Schuften von Menschenseelen geißeln, so sehr sich auch mein Herz einem Menschen wehe zu thun dagegen sträubt...” E. Epilog Auch nach dem Tod Beethovens änderte sich an der Sachlage wenig. Man merkte sehr wohl, daß etwas an den Metronomangaben nicht stimmte, aber die Ursachen wurden anderswo gesucht. So gab es ein hartnäckiges Gerücht, daß das Metronom des Meisters defekt gewesen sein sollte. Erst in unserem Jahrhundert wurde die Forderung erhoben, die Zahlen buchstäblich zu nehmen und als bindende Vorschriften zu betrachten. Dazu muss gesagt, daß die spieltechnischen Möglichkeiten durch spezialisiertes Üben gegenüber Beethovens Zeiten so weit sehr fortgeschritten sind, dass tatsächlich daran gedacht werden kann, die karikaturhaften Geschwindigkeiten mancher Tempoverdoppelungen in die Praxis umzusetzen. Wie dem auch sei, die ungelösten Metronomzahlen haben unser kollektives Erleben der Zeit nachhaltig beeinflußt. Auch wenn sie von den meisten Musikern nicht sehr bewußt wahrgenommen worden sind, im kollektiven Unterbewußtsein sind sie immerfort präsent und verhindern den richtigen Blick auf vergangene Zeitstrukturen. Mir bleibt die unangenehme Pflicht der Auflklärung. Wie die Boten des Mittelalters, die dem König eine Niederlage melden mußten, laufe auch ich Gefahr, daß die ganze Wut der beteiligten Interpreten an mir, dem Kundschafter, ausgelassen wird. Denn daß sämtliche teure Gesamteinspielungen der Beethoven-Symphonien aus der Sicht des Verfassers wertlos sind, ist keine angenehme Nachricht, weder für die Musiker, noch für die Zuhörer. Und doch muß es einmal gesagt. Man ist ja nicht verpflichtet, zuzuhören! Womit ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanke. 8