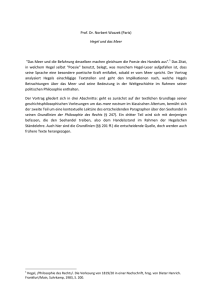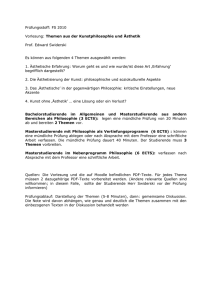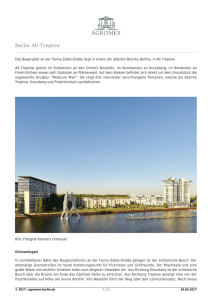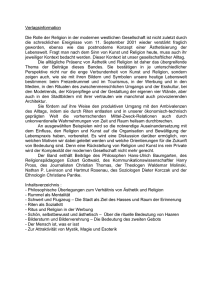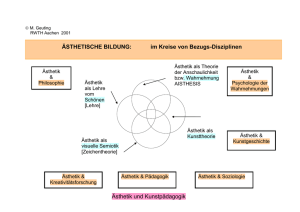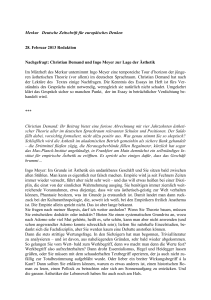Untitled - Widerspruch
Werbung

In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 7-9 AutorenInnen: Redaktion Zum Thema Zum Thema Ökologische Ästhetik Die Ökologie scheint derzeit aus dem Blickpunkt geraten zu sein. Andere Themen bestimmen die öffentliche Debatte. Im Zuge der Globalisierung und ihren Folgen sind wieder die klassischen Fragen der Wohlstandsbewahrung, der sozialen Gerechtigkeit und des Verhältnisses der Kulturen in den Vordergrund gerückt. Dennoch schwelt das Ökologieproblem unter der Oberfläche der sich vernetzenden Welt ungelöst weiter. So ist die Frage offen geblieben, ob die Lösungen der sogenannten Umweltkrisen tatsächlich auf dem Gebiet der Technologie zu finden und daher an die Wissenschaftler, Techniker und das politische Management zu delegieren sind, oder ob sie nicht vielmehr eine grundlegende Veränderung unserer Produktionsweise und damit eine Neubestimmung des Mensch-Natur-Verhältnisses erfordern. Elmar Treptow - seit der Gründung des Widerspruchs so etwas wie der geistige Mentor und das philosophische Gewissen der Redaktion - hat jüngst das Buch "Die erhabene Natur. Entwurf einer ökologischen Ästhetik" veröffentlicht. Dieses Werk kann - am Ende seiner akademischen Laufbahn - als die Summe seines philosophischen Wirkens gelten, in der er, auch selbstkritisch, liebgewonnene Ansichten und Auffassungen kritisiert. Einem fortschrittlichen, den Prinzipien des Humanismus verpflichteten, Menschen muß der Titel seines Buches als befremdend, ja bedrohlich erscheinen. Ist doch die Natur, so haben wir's gelernt, allenfalls die Bedingung und der Rohstoff, aus dem der praktisch tätige Mensch die Produkte schafft, die allein erhaben genannt zu werden verdienen. Elmar zum Thema Treptow weiß dies alles; - und gerade deshalb zielt er am Ende auf die Einsicht, daß die Natur es ist, die erhaben ist und die alles menschlich Große übergreift. Sie ist in ihrer Erhabenheit gleichgültig gegen die menschlichen Zwecke, und die Mißachtung dieser Erkenntnis kann den Menschen in die Katastrophe führen. An dieser Grundeinsicht gemessen, die Treptows Buch vermittelt, müssen all jene politisch-technischen Gegenwartsfragen und Alltagsprobleme als unangemessene Aufgeregtheiten erscheinen. Sein Buch verlangt einen Schritt zurück, um die Themen neu zu sortieren In seinem einleitenden Beitrag unterscheidet Konrad Lotter zwischen der traditionellen Naturästhetik, die die unberührte Natur aus der Distanz ästhetisch beurteilt hatte, und der ökologischen Naturästhetik, die in ihr Urteil die vom Menschen bearbeitete und geformte Natur einbezieht. Sie reflektiert die Natur im Zustand ihrer Zerstörung und Bedrohung durch die am Wachstum orientierte Ökonomie als Norm und Kriterium der Kritik. Der Artikel von Jost Hermand enthält eine polemisch gehaltene Abrechnung mit der öberflächlichen Ästhetik einer Spaß- und Erlebnisgesellschaft und hebt - fast überschwänglich - Elmars Treptows Entwurf einer ökologischen Ästhetik in den Rang eines "denkerisches Urgesteins", das aus dem "unkonkreten Geplätscher" postmoderner und ideologisch unverpflichtender Theoriebildungen herausrage. Dieser Entwurf zeige nicht nur den Ernst der Lage, sondern auch das Potential einer materialistischen Sehweise, dem ökologischen Problem in abstracto und in concreto Rechung zu tragen. Eine solche Äsdthetik fordere nicht Schönheit, sondern Schonung; nicht Lust, sondern Ehrfurcht und Respekt vor der Natur. Norbert Walz vertritt einen anderen Ansatz. Er folgt Treptows Entwurf darin, die Natur selbst in ihrer Selbständigkeit und ihren Grenzüberschreitungen als erhaben zu beurteilen; er wendet jedoch in praktischer Hinsicht ein, daß dem Menschen ein Leben gemäß der Natur nicht möglich sei. Denn, so argumentiert Walz im Rückgriff auf Sören Kierkegaard, dem Menschen sei ein Selbstverhältnis eigen, worin er sich in Distanz zum Thema sowohl zur Natur wie zu sich selbst setzt. Es bleibe die "Absurdität des Lebens", daß der Tod das sinnvolle Ende des Lebens ist, daß er aber auch das Ende meines Lebens ist. In seinem Beitrag arbeitet Wolfgang Thorwart heraus, daß schon der Streit zwischen Klassik und Romantik um die Frage der Stellung des Menschen zur Natur geführt worden ist. Während die Romantiker in der Bestimmung der modernen Subjektivität mit Kant und Fichte von der freien und naturunabhängigen Phantasiekraft des Menschen ausgegangen seien, haben Lessing und Goethe den Naturbegriff Spinozas als das produktiv All-Einen zugrundegelegt, und daher den Menschen wie Künstler als Teil der Natur betrachteten, der nachahmend zwar über, aber nicht jenseits der Natur wirke. In seinen Anmerkungen verweist Rüdiger Brede auf Bestrebungen und Revisionen im Finanz- und Wirtschaftsbereich hin, die eine rein ökonomische Pragmatik zumindest um die Dimension einer ökologischen Ästhetik ergänzen. So sei das Konzept eines "nachhaltigen Wirtschaftens" gar nicht möglich, ohne die Natur in ihren eigenen Maßen anzuerkennen. Dies spiegele sich in den Geschäftsberichten insbesondere der großen Versicherungen wider. Manuel Knolls Beitrag geht der Genealogie des modernen Subjekts in Foucaults Der Wille zum Wissen nach. Er rekonstruiert, wie sich nach Foucault das Verhältnis zum Körper und zur Sexualität im modernen Diskurs konstituiert hat, hebt allerdings kritisch hervor, daß Foucault gänzlich ausblendet, daß Wünsche und Bedürfnisse sich auch unabhängig vom Diskurs vollziehen. Neben Rezensionen zum Thema beschließt ein umfangreicher Rezensionsteil von aktuellen Neuerscheinungen den Band. Die Redaktion 9 Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002) INHALTSVERZEICHNIS Ökologische Ästhetik Zum Thema Artikel Konrad Lotter Traditionelle und ökologische Naturästhetik 10 Josef Mehringer Ästhetik und Natur: dialektische Philosophie heute 21 7 Jost Hermand Ökologiebewußte Ästhetik im Zeichen des zwanghaften Kapitalwachstums. Elmar Treptows Konzeption einer erhabenen Natur 40 Norbert Walz Die Erlösung der Natur. Existenzphilosophische Notizen anlässlich von Treptows ökologischer Ästhetik 49 Wolfgang Thorwart Der moderne Künstler als gesteigerte Organisationsform der Natur. Zum Natur-, Menschen- und Kunstbegriff Lessings, Goethes und der Romantiker 68 Manuel Knoll Ansätze zu einer Genealogie des modernen Subjekts in Michel Foucaults „Der Wille zum Wissen“ 82 Xaver Brenner Werden zu sich selbst. Ein Forschungsbericht 95 Rüdiger Brede Die dreifache Stellung zur Natur und der Finanzmarkt. Anmerkungen zur ökologischen Ästhetik 109 Münchner Philosophie Wolfgang Habermeyer Für einen Lehrer 115 Bücher zum Thema Gernot Böhme: Aisthetik Gustav Mechlenburg 120 Anne Kemper: Unverfügbare Natur Percy Turtur 121 Paul Virilio: Die Kunst des Schreckens Ignaz Knips 123 Neu- Martin Bondeli: Kantianismus und Fichteanismus in Bern erscheinungen Alexander von Pechmann Ute Daniel: Kompendium Kulturgeschichte Marianne Rosenfelder Jürgen Habermas: Die Zukunft der menschlichen Natur Karsten Weber 125 127 129 Wolfgang Kersting: Theorien der Sozialen Gerechtigkeit. Politische Philosophie des Sozialstaats Franco Zotta 130 Theo Kobusch (Hg): Philosophen des Mittelalters Martin Schraven 133 Rolf Kreibich, Udo E. Simonis: Global Change Bernd M. Malunat 136 Herbert Marcuse: Kunst und Befreiung Georg Koch 138 Herta Nagl-Docekal: Feministische Philosophie Maria Isabel Pena Aguado 140 Oskar Negt: Arbeit und menschliche Würde Thomas Wimmer 143 Henning Ottmann: Geschichte des politischen Denkens Manuell Knoll 145 Tom Rockmore: Heidegger und die französische Philosophie Reinhard Jellen 148 Gerhard Roth: Fühlen – Denken – Handeln Wolfgang Teune Christian Schwaabe: Freiheit und Vernunft in der unversöhnten Moderne Michaela Rehm 150 151 Anhang John R. Searle: Geist, Sprache und Gesellschaft Georgios Karageorgoudis 153 Werner Seppmann: Das Ende der Gesellschaftskritik Reinhard Jellen 156 Ernst Tugendhat: Aufsätze 1992-2000 Georgios Karageorgoudis 158 AutorInnen Errata/Impressum 162 163 In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 10-20 Autor: Konrad Lotter Artikel Konrad Lotter Traditionelle und ökologische Naturästhetik In Erinnerung an komfortable Gäste, eine verregnete Sommernacht in Montescudaio und die bange Frage „Wer gibt?“ Von welcher Natur handelt eigentlich die Naturästhetik? Handelt sie von nächtlichen Sternenhimmeln, von Orkanen, von Pflanzen und Tieren? Oder beschäftigt sie sich mit blühenden Landschaften (im Osten) oder dem Englischen Garten (in München)? Zwischen beiden Assoziationen besteht ein gravierender Unterschied. Denn der Sternenhimmel existiert unabhängig und losgelöst vom Menschen, als unberührte Natur; die blühenden Landschaften hingegen sind das Werk des Menschen, der Bäume pflanzt, Felder oder Weinberge anlegt, Wege befestigt, als bearbeitete oder kultivierte Natur. Freilich sind die Gegensätze durcheinander vermittelt. Orkane etwa, also unberührte Natur, hängen mit der Erwärmung der Erdatmosphäre, d.h. der vom Menschen erzeugten Veränderung des Klimas zusammen, Tiere können gezüchtet sein und daher ein „Kulturgut“ bilden. Umgekehrt behält auch die kultivierte Natur ihre Selbständigkeit und fällt, sobald die Pflege aufhört, in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Trotzdem lässt sich der Gegensatz von traditioneller und ökologischer Naturästhetik zunächst dadurch bezeichnen, dass die eine vor allem auf die unberührte, die andere auf die vom Menschen bearbeitete und geformte Natur gerichtet ist. Als Naturschönheit thematisiert die traditionelle Ästhetik etwa die „Schönheit der abstrakten Form“, d.h. die Symmetrie, Regelmäßigkeit oder Harmonie kristalliner, pflanzlicher und tierischer Körper oder die „abstrakte Konrad Lotter Einheit des sinnlichen Stoffs“ wie etwa die Reinheit des Lichts, der Farbe oder des Klangs: so Hegel, der das Naturschöne dem Kunstschönen unterordnet und aus dem engeren Bereich der Ästhetik (als Kunstphilosophie) ausklammert. Natur ist keine Vergegenständlichung menschlicher Praxis und menschlichen Geistes, kein „objektiver Geist“, daher entzieht sie sich der Wieder-Aneignung durch den „absoluten Geist“. In Hegels eigenen Worten: „Wir fühlen uns bei der Naturschönheit zu sehr im Unbestimmten“ und „ohne Kriterium“1. F.Th.Vischer, der das Naturschöne, das „objektiv Schöne“, breitester Erörterung würdigt2, systematisiert seine Darstellung nach anorganischer und organischer, pflanzlicher und tierischer Schönheit – um ihr dann noch einen Abschnitt über das „geschichtlich Schöne“, die aisthesis geschichtlicher Ereignisse, anzufügen. Dagegen hat die ökologische Ästhetik selbst dort, wo sie die unberührte Natur thematisiert, die vom Menschen bearbeitete und geformte Natur im Blick: als Norm, Orientierung oder Kriterium der Kritik. Sie reflektiert die Natur im Zustand der Bedrohung und Zerstörung durch die am Wachstum orientierte Ökonomie. ***** Aus der Verschiedenheit ihres Gegenstandes folgt unmittelbar ein zweiter Gegensatz. Die traditionelle Naturästhetik trägt nämlich einen durchwegs kontemplativen Charakter und beurteilt die Natur aus der „Distanz“; die ökologische Naturästhetik hat hingegen eine praktische Perspektive. Sie sensibilisiert für die Gewalt, die die menschliche Praxis der Natur zugefügt hat; sie lehrt, die Natur in ihren eigenen Maße und frei von kommerziellen oder anderen, der Natur fremden Perspektiven wahrzunehmen; sie ist an der Überwindung der vorherrschenden, destruktiven Praxis interessiert. Martin Seel, der die Natur als „Medium und Paradigma der Kontemplation“ und die Kontemplation als das Absehen „von allem, was kulturelle Intention an ihren Gegenständen und Umgebungen ist“3 definiert, ist dieser Unterscheidung zufolge noch der traditionellen Naturästhetik zuzurechnen. ***** 1 G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik, in: Werke, Frankfurt/Main 1970, Bd. 13, S. 15. 2 im zweiten Band seiner „Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen“ (1846 ff.). 3 M. Seel: Eine Ästhetik der Natur, Frankfurt/Main 1991, S. 66 und S. 69. Traditionelle und ökologische Naturästhetik Cornelius Mayer-Tasch, einer der Pioniere der ökologischen Naturästhetik, hat seiner Untersuchung des Zusammenhangs von Ökologie, Politik und Ästhetik den Titel „Ein Netz für Ikarus“ gegeben. Ikarus wird darin als Symbol für den homo faber bzw. den homo oeconomicus dargestellt. Die selbstgebauten Flügel aus Federn und Wachs, mit deren Hilfe er sich in die Lüfte erhebt, stehen für die Technik, durch die der moderne Mensch die Natur überwinden und sich aus seinen natürlichen Grundlagen befreien will. Ikarus will hoch hinaus, er lässt die Erde hinter sich und nähert sich der Sonne; seine Flügel aber schmelzen und er stürzt hinab ins Meer. Wie können wir dem Schicksal des Ikarus entgehen? Mayer-Taschs Antwort: wir müssen ein Netz für Ikarus knüpfen; wir müssen unsere Wahrnehmungsfähigkeit gegenüber den natürlichen Kreisläufen stärken; wir müssen gewahr werden, wie sehr sich unser Leben von der Natur entfernt hat und versuchen, den Anschluss an die kosmischen Rhythmen und Ordnungen praktisch wieder zu gewinnen. „Im Einfühlen und Ertasten, im Erspüren und Erfahren des Lebensfördernden und des Lebensfeindlichen, im Schauen und Sinnen, im Entschlüsseln der zahllosen Botschaften, die uns nicht nur aus Rundfunk, Fernsehen und Geschriebenem, sondern viel mehr noch aus dem unmittelbaren Erkennen des in und um uns herum Lebenden, Webenden und Strebenden zukommen, mag sich jene Wiedereingliederung in kosmische Rhythmen und Ordnungen vollziehen ...“4. Mayer-Tasch argumentiert in der Tradition einer christlich-esoterischen Mystik: das Gute und Wahre erscheinen im Schönen. Im Schönen und Harmonischen können das Gute und Gesunde, im Hässlichen und Disharmonischen dagegen die ökologischen Fehlentwicklungen, die Vorboten drohender Katastrophen unmittelbar wahrgenommen werden. Als Erklärung für die falsche Praxis des modernen Menschen hat er allerdings nur die hybris bereit, das überhebliche Heraustreten des Menschen aus der göttlichen Ordnung. Unbegriffen bleiben die Zwänge des verselbständigten Wirtschaftswachstums, die sich durch Konkurrenz – bei Strafe des Untergangs – dem einzelnen Agenten aufdrängen. Unbeachtet bleiben auch die Verwüstungen, die die Natur selbst in ihren Katastrophen anrichtet. MayerTasch verklärt und verfälscht die Natur zur guten, segensreichen Natur und 4 P.C.Mayer-Tasch: Ein Netz für Ikarus. Über den Zusammenhang von Ökologie, Politik und Ästhetik, München 1987, S. 12. Konrad Lotter setzt die „kosmischen Rhythmen und Ordnungen“ schlechterdings dem „Lebensfördernden“ gleich. ***** Ganz ähnlich argumentiert C.F.v.Weizsäcker, der sich ausdrücklich auf Platon beruft und die physikalische und die religiöse Welterklärung zu einer Einheit verbindet. Zum einen ist die Erklärung der Natur letztlich auf Ideen gerichtet, wobei „Idee“ als Naturgesetz und zugleich als Offenbarung der Herrlichkeit Gottes verstanden wird. Zum anderen wird die Erkenntnis der Natur als ein Aufstieg begriffen, der vom Sinnlich-Konkreten ausgeht und zum Abstrakten, Wahren und Guten fortschreitet. Die schöne Natur eröffnet so die Perspektive auf die gute oder friedliche Natur. „Wenn ich in meiner Wiese liege, was nehme ich wahr?“, fragt v.Weizsäcker und seine Antwort lautet: „ein Summen – nein, die Bienen – nein, den Frieden der Natur“. In der Harmonie von Wiesen, Blumen und dem Summen der Bienen erscheint ihm das, was „die heutige Wissenschaft das ökologische Gleichgewicht nennt“. Wenn der Mensch „dieses Gleichgewicht als schön wahrnimmt, so nimmt er die Harmonie wahr ... ohne die er nicht leben könnte“5. Mit Mayer-Tasch stimmt Weizsäcker also in der metaphysischen Annahme einer Natur überein, die an sich im Zustand des Gleichgewichts existiert und nur durch den Menschen – in diesem Fall durch seine einseitige Orientierung an der „Willens- und Verstandeskultur“ – gestört wird. Die dialektischen Ansätze der ökologischen Ästhetik teilen diese Annahme nicht. Gernot Böhme, der sich direkt (und kritisch) auf Weizsäcker bezieht, hält der guten die destruktive Natur entgegen: die „Gewalttätigkeit der Natur“ ist eine Gegebenheit, „mit der man rechnen muss“6. Noch entschiedener weist Elmar Treptow die metaphysische Naturauffassung zurück. Schon im ersten Satz seines „Entwurfs einer ökologischen Ästhetik“ grenzt er sich programmatisch gegen zwei – gleichermaßen falsche – Extreme ab: von der Verklärung der Natur zur guten Natur, zum Gleichgewichtssystem, das die „von ihr ausgehenden Gefahren und Schrecken“ verkennt7 und von der 5 C.F. v.Weizsäcker: Im Garten des Menschlichen, München 1977, S. 141. G. Böhme: Für eine ökologische Naturästhetik, Frankfurt/M. 1989, S. 39 ff. – F. Rötzer (Hg): Denken, das an der Zeit ist, Frankfurt/Main, 1987, S. 91. 7 E. Treptow: Die erhabene Natur. Entwurf einer ökologischen Ästhetik, Würzburg 2001, S. 9. 6 Traditionelle und ökologische Naturästhetik Dämonisierung der Natur, ihrer Stilisierung zur bösen und erlösungsbedürftigen Natur. ***** Ein dritter Gegensatz zwischen traditioneller und ökologischer Ästhetik ist der Gegensatz von Anthropozentrismus und Ökozentrismus. In der ökologischen Ästhetik verliert der Mensch seine herausragende, erhabene Stellung, die ihm die christliche Theologie (infolge seiner Gottes-Ebenbildlichkeit) oder die idealistische Philosophie (kraft seiner Vernunft und Freiheit) zugestanden hatten. Er wird nun selbst zum Natur- und Leibwesen. Vehement setzt sich Böhme gegen das ab, was er die „bürgerliche Naturästhetik“ nennt. Diese begreift die Natur erstens (in der Tradition von Descartes und Kant) als das „Andere“ der Vernunft, das dem Menschen, dem autonomen Vernunftwesen, als fremd gegenübersteht. Zweitens begreift sie die Natur als das „Andere“ der Gesellschaft, an das sich Utopien versöhnter Zustände anschließen. Dieser bürgerlichen Naturästhetik wird auch Adorno noch zugerechnet, der das Naturschöne als „die Spur des Nichtidentischen an den Dingen im Bann universaler Identität“ definiert8 und die Natur als eine Gegenwelt begreift, die sich der gesellschaftlichen Vereinnahmung entzieht. Durch ihre Widersetzlichkeit stellt die Natur ein „subversives Potential“ dar, das den unversöhnten Zustand des Menschen in Erinnerung hält. Dagegen besteht Böhme darauf, dass der Mensch der Natur nicht gegenübersteht, sondern – als Naturwesen – selbst angehört: Die ökologische Naturästhetik verdankt ihr Entstehen nicht (wie die bürgerliche Naturästhetik) dem Leiden an der Gesellschaft, sondern dem Leiden an der Natur; der Mensch „beginnt das, was er der Natur antut, am eigenen Leib zu spüren“9. Auch Böhme geht es darum, den Menschen zu sensibilisieren: nicht für die kosmischen Rhythmen und Ordnungen, sondern die Atmosphären ihrer Umwelt, die in der Objektivität von Landschaften, Städten oder Innenräumen begründet liegen, zugleich aber die leibliche Subjektivität und Befindlichkeit der Menschen zum Ausdruck bringen. Aufgabe der Ästhetik ist es, uns „in 8 Th.W. Adorno: Ästhetische Theorie, Frankfurt/Main 1970, S. 114. – Vgl. G. Böhme, a.a.O., S. 19-23 und S. 45. 9 G. Böhme: Für eine ökologische Naturästhetik, a.a.O., S. 24. Konrad Lotter der Erfahrung von Atmosphären und im Umgang mit ihnen kompetent zu machen“10. ***** Elmar Treptows Ausgangspunkt ist die selbständige Natur, d.h. eine Natur, die sich unabhängig vom Menschen selbst organisiert. Darin besteht ein vierter Gegensatz zwischen der traditionellen und der ökologischen Naturästhetik, der zugleich die Voraussetzung für einen fünften bildet: die enge Beziehung der ökologischen Ästhetik zur modernen (empirischen, nicht metaphysischverbrämten) Naturwissenschaft. Mayer-Tasch und Weizsäcker leugnen die Selbständigkeit der Natur, sie betrachten die Natur als eine Art Schöpfung, als Idee oder Abglanz Gottes; in der Naturwissenschaft liegen ihnen jene hybris oder Verabsolutierung der „Willens- und Verstandeskultur“ vor, die den Menschen dazu verführt hat, aus dieser göttlichen Ordnung herauszutreten. Böhme erkennt die selbständige, an sich seiende Natur höchstens in einem Kantischen Sinne an, was ihn dazu bringt, die immanente Destruktivität der Natur als eine Möglichkeit anzuerkennen. Als Ästhetiker hingegen hat er es durchwegs mit einer „humanen Natur“, d.h. „nicht mit einer Natur an und für sich ..., sondern mit einer bearbeiteten Natur“11 zu tun. Auch der Naturwissenschaft steht Böhme mit Sympathie gegenüber, auch wenn er das „Wissen der Naturwissenschaft, die die Natur als etwas Fremdes behandelt“ durch ein Wissen ergänzen und korrigieren möchte, „in dem realisiert wird, dass wir selbst Natur sind“12. Wie aber könnte eine solche „andere“ Naturwissenschaft aussehen? Erstaunlich ist, dass er sich über die von Ernst Haeckel begründeten Wissenschaft der Ökologie hinwegsetzt, auf die er sich als Ästhetiker doch programmatisch beruft. Ökologie ist die Wissenschaft von den Kreislaufsystemen der Natur, der auch der Mensch durch seine Leiblichkeit angehört. Sie behandelt, wie Treptow in einem dialektisch-systemtheoretischen Sinne konkretisiert, „komplexe Systeme der Selbstorganisation der Natur, die durch Wechselwirkungen respektive rückbezügliche Prozesse miteinander verbunden sind“; diese Systeme befinden sich in einem dynamischen Gleichgewicht, das sie unter bestimmten Bedingungen überschreiten, um „neue Systeme 10 ebd., S.15. – Vgl. G. Böhme: Atmosphären, Frankfurt/Main 1995. F. Rötzer (Hg.): Denken, das an der Zeit ist, a.a.O., S. 91 und S. 84. 12 ebd., S. 76. 11 Traditionelle und ökologische Naturästhetik hervorbringen“13. Goethes Metamorphosenlehre wird im Lichte der modernen (Evolutions-) Biologie und Kybernetik von L.v. Bertalanffy, I. Prigogine, M. Eigen, K. Lewin u.a. neu interpretiert. Auch für Treptow ist die Natur letztlich etwas Unverfügbares, Unverletzbares, Unantastbares – und deshalb Erhabenes –, aber nicht als Schöpfung Gottes oder als das nichtidentifizierbare „Andere“, sondern wegen ihrer eigenen Selbständigkeit und Dynamik. Alle theologischen Prämissen sind eliminiert. Freilich ist das Ästhetische keine Eigenschaft des Objekts, sondern ein Verhältnis, d.h. an die Wahrnehmung und Empfindung des Subjekts gebunden. An sich sind die Natursysteme immer zweckmäßig (wie die Ökologie erkennt), für den Menschen aber können sie sowohl zweckmäßig, lebensfördernd, als auch unzweckmäßig und lebensgefährdend sein. Sofern sie zweckmäßig sind, erregen sie Lust und werden als schön empfunden; sofern sie für den Menschen zweckmäßig und unzweckmäßig zugleich sind und daher sowohl Lust (Attraktion) als auch Unlust (Angst) erzeugen, sind sie erhaben. In letzterem ist Edmund Burkes Definition des Erhabenen als delightful horror aufgehoben. Im Allgemeinen ist die Natur also überhaupt, in ihrer Selbständigkeit und darin, dass sie dem menschlichen Leben vorausgesetzt ist, erhaben. Im Besonderen erscheint sie dort erhaben, wo sie – wie z.B. in Orkanen oder Erdbeben, dem dynamisch Erhabenen Kants – von einem relativen Gleichgewichtszustand in einen anderen übergeht. Da die Dynamik der natürlichen Veränderung und Umorganisierung absolut, die Ruhe und Stabilität des Gleichgewichts zeitlich begrenzt und relativ sind, ist die schöne Natur nur ein „Spezialfall“14 der erhabenen Natur. Ausschließlich unzweckmäßig ist nur das Hässliche: wenn ein Gleichgewichtszustand zerstört wird, aber kein Übergang zu einem neuen Gleichgewichtszustand stattfindet. Das kann durch Naturkatastrophen bewirkt werden, zumeist aber ist es die Folge (Nebenwirkung) menschlicher Praxis. Durch die verselbständigte, kurzfristig am ökonomischen Gewinn orientierte menschliche Praxis kann zwar die schöne, für die menschliche Existenz zweckmäßige Natur, der der Mensch selbst angehört, kaputt und hässlich gemacht werden; innerhalb der Naturgeschichte aber stellt der Mensch nur eine Episode, gewissermaßen eine zu 13 14 E. Treptow: Die erhabene Natur, a.a.O., S. 9. ebd., S. 15. Konrad Lotter vernachlässigende Größe dar. Für die Erhabenheit der Natur bleibt seine Praxis letztlich ohne Belang. ***** Ein fünfter Unterschied der ökologischen zur traditionellen Ästhetik: ihr Gegenstand ist nicht nur die Natur, sondern auch die Malerei, Musik, Lyrik etc., die diese Natur abbilden, genauer: die Perspektive, die die Kunst gegenüber der Natur einnimmt. Damit ist nicht die Projektion seelischer Zustände gemeint, der zufolge einem glücklichen Menschen oder Künstler die ihn umgebende Natur hell und fröhlich, einem unglücklichen dagegen düster und bedrohlich anmutet, sondern das Interesse, das in der künstlerischen Abbildung der Natur zum Ausdruck kommt (oder kommen sollte). Mayer-Tasch etwa greift für eine Art ökologischer Gesinnungskunst Partei. Als Beispiele führt er Bilder von K. Staeck, H. Suchlitz, B. Frahm u.a. und Romane von M. Horx oder M. Maron an, die ihren Finger auf die Schäden der ökonomisch-technischen Zivilisation richten. Kunst soll das Hässliche sichtbar machen und anklagen. Was Mayer-Tasch über das ökologische Tendenzgedicht sagt, gilt für sein Verständnis einer ökologischen Kunst insgesamt: sie hat ihren „Standpunkt neben der wissenschaftlichen Publikation, neben dem politischen Appell, neben der kirchlichen Predigt, ... neben der Protestdemonstration“15. Jost Hermands „ökologiebewusste Ästhetik“ will dagegen weniger anklagen als begreifen, wobei „Ökologie“ mit Zivilisation, mit wissenschaftlichtechnischem Fortschritt, mit Krise des ökonomischen Wachstums assoziiert wird. In scharfsichtigen Analysen und Interpretationen untersucht sie, in welcher Weise die Literatur diese Entwicklung reflektiert und bewertet. Dabei schlägt sie einen weiten Bogen: von den „Bescheidenheitspostulaten“ der jakobinisch-inspirierten, bürgerlichen Literatur (Klopstock, Herder, Fichte u.a.) über Goethes „grüne Weltfrömmigkeit“ oder die „vegetarische Botschaft“ in Wagners „Parsifal“ bis zu den ökologischen Komponenten in den Sozialutopien des ausgehenden 19.Jh.s. Auch für Hermand ist Goethe ein wichtiger Gewährsmann, nicht die Metamorphosenlehre (wie für Treptow), sondern der „Faust“, insbesondere der zweite Teil, der die Einführung des Papiergelds durch Mephisto mit der Durchführung technologischer Großprojekte (Landgewinnung, Kanalbau) und der Zerstörung 15 P.C. Mayer-Tasch: Ein Netz für Ikarus, a.a.O., S. 157. Traditionelle und ökologische Naturästhetik menschlichen Lebensraums (Vertreibung von Philemon und Baucis) in Zusammenhang bringt16. ***** Bei Elmar Treptow nimmt die Analyse der (künstlerischen) Natur-Wahrnehmungen oder Natur-Darstellungen die Form der Ideologiekritik an. Falsches Bewusstsein kommt darin insofern zum Ausdruck, als die Natur nicht in ihren eigenen Maßen erkannt, sondern durch andere, naturfremde Interessen überformt und entstellt wird. Insgesamt werden fünf solcher Interessen17 unterschieden. Erstens das theologische Interesse, das die Natur im christlichen, jüdischen oder islamischen Verständnis als Verweis (Allegorie) auf die Schönheit oder Erhabenheit eines naturtranszendenten Gottes betrachtet, nach dem Motto „die Berge sind groß, aber Gott ist größer“. Zweitens das moralische Interesse, das die Erhabenheit der Natur als „Belehrung der Menschen“ fasst, die sie zur naturtranszendenten Vernunft-Idee (Kant) hinführt oder als Zeichen seiner moralischen Freiheit (Schiller) nimmt. Drittens das nationale oder das nationalistische Interesse, das die Natur als Repräsentation nationaler Identität oder den heroischen Kampf gegen die Natur, wie er in der „Schicksalsgemeinschaft“ des Bergführers mit seinen Gefolgsleuten gegeben ist, als Vorbild nationaler Selbstbehauptung begreift. Viertens das psychische Interesse der Selbststimulierung, wobei das Naturabenteuer als eine persönliche Herausforderung gesucht wird, um die eigene Belastbarkeit zu erproben, um Gefahren zu bestehen oder sich in Grenzsituationen zu bewähren. Fünftens das kommerzielle Interesse, das die Natur aus der Perspektive der landwirtschaftlichen, industriellen oder touristischen Nutzung betrachtet. Jede dieser Interessen ist auch in künstlerischen Abbildungen zu finden. Das christliche Interesse etwa in Petrarcas Darstellung seiner Besteigung des Mont Ventoux, in Kleists „Erdbeben von Chili“, das die Naturkatastrophe als Strafgericht Gottes interpretiert, in Melvilles „Moby Dick“ (der weiße Wal als Inkarnation des Bösen) oder bei Adalbert Stifter, der Gottes Herrlichkeit „im Kleinen“ aufsucht und – Emerson oder Thoreau verwandt 16 J. Hermand: Im Wettlauf mit der Zeit. Anstöße zu einer ökologiebewussten Ästhetik, Berlin 1991. In seiner Goethe-Interpretation stützt sich Hermand auf H.Chr. Binswanger: Geld und Magie. Deutung und Kritik der modernen Wirtschaft anhand von Goethes Faust, Stuttgart 1985. 17 E. Treptow: Die erhabene Natur, a.a.O., S. 151ff. Konrad Lotter – die Natur als „ausschließlich erhaltend“18 begreift. Nationalistische Interessen liegen den Bergfilmen der Nazis zugrunde; viele davon sind schon vor 1933 entstanden (Arnold Franck, Luis Trenker) und gehören damit zur ideologischen Vorbereitung der „Machtergreifung“. Der Kampf mit der Natur als Selbststimulierung ist das Thema in Ernst Jüngers „Wüsten und Urwälder“ oder in Hemingways „Der alte Mann und das Meer“. ***** Zum Schluss noch eine Bemerkung über den (philosophie-) geschichtlichen Übergang von der traditionellen zur ökologischen Ästhetik. Übereinstimmend geht die traditionelle Theorie davon aus, dass der Mensch innerhalb der Natur eine erhabene Stellung einnimmt, gleichgültig, ob diese erhabene Stellung religiös (Mensch als Ebenbild Gottes) oder idealistisch (Mensch als Vernunftwesen oder Inkarnation der Freiheit) begründet wird. Selbst Marx weist dem Menschen eine Sonderstellung zu, da er seinen Stoffwechselprozess mit der Natur „durch seine eigne Tat vermittelt, regelt und kontrolliert“19. Für ihn ist es die Fähigkeit, Zwecke zu setzen, die den Menschen über die bloß kausal wirkende Natur hinaushebt. Versteht sich der Mensch selbst als ein erhabenes, über die Grenzen der Natur hinaus ragendes Wesen, dann kann ihm die außermenschliche Natur nicht imponieren. Sie reicht nicht an ihn heran. Fasst er die Natur (z.B. das Gebirge) bei pantheistischer Grundüberzeugung darüber hinaus nicht als Zeichen eines höheren, naturtranszendenten Gottes auf, dann kann er sich über sie genauso despektierlich äußern, wie es der junge Hegel auch getan hat: „Die Vernunft findet in dem Gedanken der Dauer dieser Berge oder in der Art von Erhabenheit, die man ihnen zuschreibt, nichts, das ihr imponiert, das ihr Staunen und Bewunderung abnötigte. Der Anblick dieser ewig toten Massen gab mir nichts als die einförmige und in die Länge langweilige Vorstellung: es ist so.“20 Begreift man den Menschen hingegen selbst als Naturwesen, d.h. als Teil oder Produkt der Natur, dann erscheinen auch Vernunft und Freiheit als untergeordnet, wenn nicht überhaupt als Illusion. Zum einen interpretiert 18 ebd., S.39. K. Marx: Das Kapital, MEW 23, S. 192. 20 G.W.F. Hegel: Tagebuch der Reise in die Berner Oberalpen (1796), in: Werke, a.a.O., Bd. 1, S. 618. Vgl. E. Treptow: Die erhabene Natur, a.a.O., S. 154. 19 Traditionelle und ökologische Naturästhetik Marx die Sonderstellung des Menschen in der Natur als etwas geschichtlich Gewordenes, er setzt sie also nicht voraus; zum anderen spricht er – an der gleichen Stelle, an der er von der planenden, zweckesetzenden Überlegenheit über die Natur spricht – auch davon, dass der Mensch selbst Natur ist und in der Arbeit „die seiner Leiblichkeit angehörenden Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand“ in Bewegung setzt (Kopf als Naturkraft!). Umgekehrt hatte er die Natur schon in den „Philosophisch-ökonomischen Manuskripten“ als den „unorganischen Leib des Menschen“21 bezeichnet. Insofern könnte man Marx als Scharnier oder Umschlag von der traditionellen zur ökologischen Ästhetik begreifen. Ob er, der keine theologischen oder kommerziellen Interessen hatte – auch von sportlichem Ehrgeiz ist nichts überliefert – , die Alpen deshalb (ästhetisch) aber wohl viel anders beurteilt hätte als Hegel? 21 MEW, EB 1, S. 516. In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 21-39 Autor: Josef Mehringer Artikel Josef Mehringer Ästhetik und Natur: dialektische Philosophie heute Im Mittelpunkt des Artikels steht das von Elmar Treptow kürzlich veröffentlichte Buch: “Die erhabene Natur. Entwurf einer ökologischen Ästhetik”1. Das besondere an dieser Schrift ist, daß es der Autor unternimmt, die Natur als ganzes darzustellen. Im Hinblick auf diesen Gegenstand wird die dialektische Philosophie mit der Systemtheorie kombiniert, um sie dann für eine ästhetische Theorie fruchtbar zu machen. Treptow stellt – unter Berücksichtigung einer enormen Vielzahl fachwissenschaftlicher Ergebnisse – eine neue Art ästhetischer Wahrnehmung und der Darstellung der selbstorganisierenden Natur vor und hebt die herausragende Stellung der Ästhetik hervor, die nicht nur wie die Theoria beansprucht, die allgemeinen Strukturen der Natur zu erfassen, sondern zudem das Einzelne und Emotionale mit aufnimmt: die Ästhetik erhält somit den Vorzug gegenüber der Theorie und Praxis. Treptow führt eine Tradition weiter, die in der ionischen Naturphilosophie ihren Ursprung hat und später von Aristoteles systematisch formuliert wurde, für den Praxis, Ästhetik und Theorie unter Berücksichtigung dialektischer Prinzipien zur Wahrheit und Selbstbestimmung führen. Bei der Lektüre ist stets zu bedenken, daß Treptow und diejenigen Philosophen, auf die er sich in erster Linie bezieht – insbesondere Goethe, HeÖkologie ist die “Lehre vom Haus” d.h. des Haushalts der Natur. “Ernst Häckel bezeichnete mit dem Begriff ‚Ökologie’, den er 1866 einführte, die ‚gesamte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Außenwelt.’ Sie umfaßt die Wechselwirkungen zwischen den Pflanzen, Tieren und Menschen sowohl untereinander wie mit der unorganischen Natur” (Treptow 2001:71). 1 Josef Mehringer gel, Lukács und Marx –, hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Arbeitsweise der Aristotelischen Philosophie verpflichtet sind. Aus diesem Grunde soll ein kurzer historischer Rückgriff auf die Anfänge und die Weiterentwicklung dieser Forschungstradition erfolgen, um einerseits wesentliche Strukturen Treptows Buch freizulegen und andererseits das Neue zu würdigen. A. Ästhetik und Natur in den Anfängen dialektischer Philosophie 1. Ästhetik und Natur in Mythos und Logos Die Natur im ganzen zu erfassen, war seit jeher ein Bedürfnis des Menschen. Im Laufe der Zeit änderten sich jedoch die Erklärungsmodelle und damit auch die verwendeten Methoden. Man denke nur an die ur- und frühgeschichtlichen Funde, insbesondere an die einzigartigen Felsbilder, die ein beredtes Zeugnis hinsichtlich der Vorstellungen über die Natur der Urmenschen im Jungpaläolithikum sind (Bosinski 1997, 1999). Die Aufzeichnungen Hesiods oder Homers spiegeln ebenfalls eine frühe mythische Version über Entstehung und Aufbau der Welt und ihrer göttlichen Vertreter wider, die hinreichend Stoff für die späteren Tragödiendichter – wie Aischylos, Sophokles und Euripides – lieferten. Erst mit der Philosophie trachtete der Mensch danach, die Natur und ihre kausalen Verhältnisse auf rationalem Wege zu verstehen und zu erklären. So entstehen bei den ionischen Naturphilosophen die ersten Schriften über die Natur, die teilweise dialektischen Charakter aufweisen; dieser befähigt sie dazu, in wissenschaftlicher Weise Schlüsse zu ziehen. Dazu zählen insbesondere die Schriften von Anaximander , Empedokles und Anaxagoras. 2. Ästhetik und Natur in Aristoteles’ Philosophie Mit Aristoteles beginnt eine neue Forschungstradition, die es sich zum Ziel machte, das Ganze in seinen allgemeinen Strukturen zu erfassen. Der griechische Philosoph ist nämlich von dem Gedanken ergriffen, daß Selbstbestimmung durch Seinsbestimmung erfolgt. Ohnehin ist es das höchste Ziel des Menschen, sein Wesen – “das Leben nach der Vernunft” (Ethik 10, 7. 1178a 5) – zu verwirklichen. Das Streben nach Wis- Natur und Ästhetik sen und Wahrheit ist demnach des Menschen Natur. Dies hebt Aristoteles gleich zu Beginn seiner Metaphysischen Schrift hervor: “Alle Menschen streben von Natur (phýsei) nach Wissen (eidénai)” (Met. 1,1. 980 a 1). Das Begreifen ist also für Aristoteles wie auch für Hegel die höchste Form der Freiheit. Der wissenschaftliche Erkenntnisprozeß, der in der Ergründung des Allgemeinen besteht2, stellt sich als eine Relation zwischen Seele und Seiendem respektive zwischen Subjekt und Objekt dar und ist nicht unmittelbar an einen praktischen Nutzen gebunden; vielmehr handelt es sich um ein Wissen als Selbstzweck: „...denn als so ziemlich alles zur Bequemlichkeit und zum Genuß des Lebens Nötige vorhanden war, da begann man diese Art der Einsicht (phrónesis) zu suchen. Daraus erhellt also, daß wir sie nicht um irgendeines anderweitigen Nutzens willen suchen, sondern, wie wir den Menschen frei nennen, der um seiner selbst, nicht um eines andern willen ist, so ist auch diese Wissenschaft allein unter allen frei; denn sie allein ist um ihrer selbst willen“ (Met. 1, 2. 982 b 23). Aristoteles setzt nun drei grundlegende Prinzipien fest, die letztendlich Antwort geben auf die Fragen: Was ist Wahrheit? Wie wird Wahrheit gewonnen? 1. principium identitatis (Wahrheit), 2. principium contradictionis (Satz des Widerspruchs), 3. principium tertii exclusii (das Dritte). Bei Aristoteles dreht sich also alles um die Wahrheit (veritas), die er als Übereinstimmung zwischen Seele und Seiendem (adäquatio rei et intellectus) definiert (Met. 4, 7.1011 b 26 ff.). Um nun zu beurteilen, ob es sich um wahre oder falsche Aussagen handelt, arbeitet Aristoteles auch mit dem Prinzip des kontradiktorischen Widerspruches (principium contradictionis), welches sozusagen kein “dazwischen” zuläßt.3 Es handelt sich hierbei um ein Verfahren, das häufig in Platons Dialogen angewandt, aber von Aristoteles zum ersten Mal als das sicherste und letzte Prinzip formuliert wird (Met. 4, 3. 1005 a 19 ff.). Es ist allerdings in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass der Satz vom Widerspruch nicht nur formallogische, sondern auch reallogische Bedeutung hat. 2 3 S. hierzu Zweite Analytik (1, 31. 87b 38). Der konträre Widerspruch lässt ein “dazwischen” zu (Met. 10, 4. 1055b 1 ff). Josef Mehringer Wenn ein Drittes (principium tertii exclusii) die gegensätzlichen Pole zu vermitteln vermag, bedeutet dies einen Übergang zum dialektischen Erkennen. Dementsprechend zielt jede Frage nach dem Mittleren. Dies legt Aristoteles in seiner zweiten Analytischen Schrift (Analitica posteriora) fest: “Daß also alles Fragen ein Fragen nach dem Mittleren ist, leuchtet ein” (2, 3. 89 b 35 f.). Im Gegensatz zu Hegel und Marx, die sich auf den historischen Prozess bzw. die Praxis beziehen, gibt Aristoteles keine Überprüfungsinstanz hinsichtlich der Wahrheit an; vielmehr rechnet er mit einem Moment der Evidenz, des unmittelbaren Erfassens (τιγγα%νειν: berühren). Interessant ist nun, daß in Aristoteles’ Philosophie klare dialektische Strukturen im Sinne von Hegel und Marx zu erkennen sind, die sein 4 Werk durchziehen . Um nun die Frage zu beantworten, was die dialekti5 sche Philosophie im klassischen Sinne kennzeichnet, können wir auf eine allgemeine Definition von Engels zurückgreifen; diese soll uns auch hier als nützliche Orientierung dienen: “Die Dialektik ist ... weiter nichts als die Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der, Natur, der Menschengesellschaft und des Denkens” (Engels 1970:131-132). Bei der Dialektik der allgemeinsten Formen, wie sie Gegenstand in Hegels ‚Logik’ sind, handelt es sich um Kategorien, die sozusagen ‚alles’ erfassen. Hierzu zählen die drei berühmten Gesetze der Dialektik: 1. das Gesetz von der Einheit und dem ‚Kampf‘ der Gegensätze (als Triebkraft jeder Entwicklung). 2. das Gesetz vom Umschlag der quantitativen in qualitative Veränderungen und 3. das Gesetz der Negation der Negation (hier handelt es sich um die Für Aristoteles stellt die Dialektik Wahrscheinlichkeitsprämissen dar, die von den besten Denkern im Staat aufgestellt werden. “... ein dialektischer Schluß [ist] ein solcher, der aus wahrscheinlichen Sätzen gezogen wird ...Wahrscheinliche Sätze aber sind diejenigen, die Allen oder den Meisten oder den Weisen wahr scheinen, und auch von den Weisen wieder entweder Allen oder den Meisten oder den Bekanntesten und Angesehensten” (Topik 1, 1. 100 a 34 ff.). 5 Der Begriff Dialektik stammt von dem griechischen Wort dialegesthai, was soviel bedeutet wie sich unterhalten, oder ein Gespräch führen, eine Polemik führen. Über Entstehung und Bedeutung der Dialektik in der Antike s. R. Schicker (1995). 4 Natur und Ästhetik Höherentwicklung durch ‚Aufhebung‘ der Widersprüche, – das dialektische ‚Aufheben‘ beinhaltet die dreifache Bewegung des ‚negare‘, des ‚conservare‘ und des ‚elevare‘) (Vgl. MEW, Bd. 20, S. 348 ff.; S. 481). Aristoteles faßt die Natur in dialektische Weise auf, in dem er sie als einen Prozeß begreift, der die Quelle der Bewegung in sich selbst hat und ein Übergang von der Möglichkeit (δυναµις) zur Wirklichkeit (ενεργεια) ist (Physik 2, 1. 192 b 13 ff.; Physik 3, 1.201 a 9 ff.; Metaphysik 11, 9. 1065 b 14 ff.). Als dialektisch lässt sich ebenfalls Aristoteles’ Konzept des gestuften Zusammenhangs des pflanzlichen, tierischen und menschlichen Lebens respektive der Seele ansehen. Allerdings verbindet er seine Naturauffassung ähnlich wie Hegel mit einer Teleologie, wobei ihn die Tätigkeit des Baumeisters als Modell dient. Infolgedessen deutet er die zweckmäßigen Strukturen in der Natur als Resultate einer Zwecktätigkeit. Diese Problematik bringt auch Helmut Seidel zum Ausdruck: “Der Widerspruch im Aristotelischen Naturbegriff, der einerseits der metaphysischen Spekulation verpflichtet ist, andererseits aber die Möglichkeit enthält, die Dinge in ihrem eigenen, ‚natürlichen‘ Zusammenhang zu erforschen, erscheint nun weiter als Widerspruch zwischen teleologischer und kausaler Naturerklärung” (Seidel 1988:55). Eine dialektische Betrachtungsweise vermag man wiederum darin erkennen, dass Aristoteles den Menschen in gegensätzlicher Einheit sowohl als Naturwesen als auch als gesellschaftliches bzw. politisches Wesen bestimmt. Die Sache und den Begriff der “dritten Natur” oder “Naturwüchsigkeit” (Marx) konnte er jedoch noch nicht kennen. Gerade dieser Aspekt erfährt in Treptows Buch in Gestalt des gesellschaftlichen Erhabenen eine besondere Behandlung. Die praktische, theoretische und ästhetische Tätigkeit begreift Aristoteles als eine unterschiedene rückbezügliche Einheit. Dabei hat die wissenschaftlich-philosophische Theoria einen gewissen Vorrang. Dabei bewertet er die Ästhetik noch höher als die wissenschaftlich philosophische Theorie, wenn gleich er in der “Poetik” nicht explizit davon spricht. Seine ästhetische Schrift hat einen konsequenten dialektischen Charakter sowie eine komplexe Struktur, in die alle andere Schriften einbezogen Josef Mehringer sind. Sie bezieht sich sowohl auf das Allgemeine als auch auf das Einzelne: Aristoteles Poetik betrifft sozusagen den ganzen Menschen mit seinem Denken, Anschauen und Fühlen. Hier setzt im Grunde genommen Treptows Philosophie neu an und greift auf der Grundlage neuer Erkenntnisse korrigierend ein: Ästhetik wird bei Treptow explizit “geadelt” (s. a. Treptow 192-193). Wenn der Autor zudem anstelle Hegels Idee bzw. absoluten Geistes die zweckmäßige Natur setzt, so vervollständigt er auch dessen Philosophie. Wenn Hegel nämlich das Theorie-Praxis-Verhältnis aufstellt (s. Enzyklopädie §225), nimmt die Theorie als absolute die höchste Position innerhalb seiner Philosophie ein, da sie aufs Ganze geht. Sie hat demnach den Vorrang gegenüber der Praxis, die das ganze ebenfalls nicht erfassen kann, und gegenüber der endlichen Theorie (Begriffsbildung, Definitionen, Urteile), welche lediglich die vorfindlichen Gegenstände aufnimmt. Treptow (2001:192) erkennt nun in diesem Zusammenhang vier wesentliche Formen der Subjekt-Objekt-Synthesen, die an Komplexität jeweils zunehmen: 1. Assimilation der Natur im Stoffwechsel, 2. Negation der Natur im Stoffwechsel in der Arbeitspraxis, 3. geistig-theoretische Aneignung der Natur, 4. ästhetisches Erleben der erhabenen Natur Während nun Aristoteles noch versuchte, alle Bereiche des Weltgeschehens in systematischer Weise zu erklären, haben die nachfolgenden, in dieser Tradition stehenden, Denker im wesentlichen zwischen zwei bestimmten Forschungsgegenständen gewählt: Natur oder Gesellschaft. 3. Natur und Gesellschaft in der Tradition dialektischer Philosophie Tatsächlich findet man später mehrere Philosophen, die sich hinsichtlich ihres Forschungsgegenstandes unterscheiden und ergänzen. Dies vermag man etwa bei Goethe und Hegel zu beobachten; denn jener ergründete insbesondere die Natur und dieser die Menschheitsgeschichte, in der sich die Vernunft mit freiheitserweiternder Wirkung verwirklicht6. Ähnlich Eine derartige Arbeitsgemeinschaft mit durchaus unterschiedlichen Standpunkten wird durchaus mit Goethes Geschenk eines Trinkglases an Hegel bei seinem Besuch in Weimar dokumentiert. Die von Goethe eingravierte Widmung “Dem Absoluten empfiehlt sich das Urphänomen” formuliert laut Treptow “ ... verbindlich-entgegen- 6 Natur und Ästhetik verhält es sich bei Alexander von Humboldt, der in seinem “Kosmos” eine philosophische Naturbetrachtung anstellt, während sein Bruder mehr die gesellschaftlichen Bildungskriterien untersucht. Noch offensichtlicher ist die Arbeitsteilung bei Marx und Engels, wobei dieser die Natur und jener die Gesellschaft mit ihren bestimmenden Faktoren analysierte. Ganz ähnlich verhält es sich mit den Freunden Lukács und Bloch. Allen gemeinsam ist ihr wissenschaftliches Vorgehen, welches in der Dialektik gipfelt. Diese Methode wird nicht zufällig herangezogen, denn es scheint, daß damit eine Kompatibilität zu erreichen ist, die eine gegenseitige Bereicherung der Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften ermöglicht: interdisziplinäres Arbeiten steht bei diesen Forschern im Mittelpunkt. Bei ihren Untersuchungen wird häufig eine Erweiterung der dialektischen Methode erreicht, die mit dem erforschbaren Gegenstand direkt zusammenhängt. Gemeinsam ist dieser Forschungstradition auch, daß sie Wissenschaft und Kunst zur Wahrheitserkennung heranziehen. Kunst ist damit in das Theorie- Praxis Verhältnis mit aufgenommen worden; ein Vorzug, welcher der Kunst nicht immer zugestanden wurde, man denke nur an die Denker, die in der Tradition Platons stehen. Inzwischen schien eine angemessene Betrachtung der Natur im ganzen als äußerst problematisch und angesichts einer immer stärker eintretenden Spezialisierung in Wissenschaft und Kunst sogar als aussichtslos. Die Natur im ganzen zu erfassen, und zwar unter Berücksichtigung aller unserer Kenntnisse aus den einzelnen Wissenschaften, stellt besondere Anforderungen an eine dafür geeignete Forschungsmethode. Selbst die seit Platon so oft hoch gepriesene Dialektik scheint hier unter Berücksichtigung der neuen Verhältnisse an ihre Grenzen zu stoßen. Ohnehin schien sie durch die politische Entwicklung der letzten Zeit diskreditiert zu sein. Es sei nicht mehr lohnenswert sich mit Dialektik auseinanderzusetzen; und tatsächlich gibt es seit Hegel und Marx keine wesentliche Entwicklung hinsichtlich dieses Methodenkonzepts. kommend den grundsätzlichen Gegensatz von Naturanschauung und Geistspekulation...” (Treptow 2001:28). Josef Mehringer Trotzdem wagte sich Treptow in seinem Buch “Die erhabene Natur” an das Unternehmen, im Stile des Aristoteles die Natur als ganzes zu behandeln. B Ästhetik und Natur in Treptows dialektischer Philosophie 1. Methodenkonzept a. Die dreifache Haltung zur Welt Elmar Treptows Vorgehen ist im Grunde genommen recht durchsichtig. Er versucht nämlich zwischen metaphysischem und empirischem Ansatz insofern zu vermitteln, als er eine kritisch dialektische Haltung gegenüber der Natur einnimmt. Dies macht er sogleich in den Eingangssätzen7 seines Buches deutlich: “Zwei Wege werden oft beschritten, führen aber in eine Sackgasse: zum einen verklärt man die Natur, übersieht die von ihr ausgehenden Gefahren und Schrecken und setzt sie als paradiesische ‚heile Natur‘ der Gesellschaft entgegen, die insgesamt als ein Prozess des Verfalls oder der zunehmenden Entfremdung von der Natur angesehen wird; zum anderen dämonisiert man die Natur, betrachtet sie als erlösungsbedürftig und sucht sie zu transzendieren. Von einer naturtranszendenten Macht erhoffen viele Menschen Halt und Rettung, weil ihnen der natürliche Tod innerhalb des Biozyklus ausschließlich Furcht bereitet, was bedrängende gesellschaftliche Umstände verstärken” (Treptow 2001:9). Der Gedanke, daß die Natur eine Unterordnung gegenüber anderen Interessen erfährt, regt Treptow also dazu an, das tatsächliche Verhältnis zwischen Natur und Gesellschaft neu zu ergründen. Im folgenden Abschnitt sind das Problemfeld, die Ursachen und die entsprechende Beschreibung hinsichtlich seiner Naturbetrachtung recht gut zusammengefaßt, so daß es sich lohnt, diesen in voller Länge wiederzugeben: “Bei den Überlegungen zum Thema ist mir immer deutlicher geworden, wie massiv die äußere und die menschliche Natur durch ein Dreier-Team herabgesetzt werden, nämlich erstens durch das 7 S. auch Treptow 2001:193 Natur und Ästhetik verselbständigte maßlose ökonomische Wachstum, dessen Mittel die sachzwanghafte Produktivitätsteigerung ist; zweitens durch die naturtranszendierenden monotheistischen Religionen, und drittens durch die idealistische Philosophie, vor allem durch Kants Konzeption der naturtranszendierenden Vernunft. Kein Wunder, dass es großer Anstrengungen und langwieriger Übungen bedarf, wenn man sich gegenüber diesem eingespielten Team die Natur wieder aneignen will, die schon entwunden zu sein schien. Dieses Dreier-Team bildete auch den unaufgehellten Hintergrund für eine vorübergehende gewisse Widerbelebung des Erhabenen. Dabei warfen sich die Vertreter der ‚Frankfurter Schule‘ und der Postmoderne‘ die Bälle zu. Doch nur scheinbar handelte es sich um das Erhabene der Natur. Der Begriff der Natur wurde zweideutig verwendet: er meinte letztlich nicht die erfahrbare Natur, sondern eine ‚andere’ ‚versönte’ Natur, die wie die monotheistische Naturtranszendenz ‚bildlos‘ und ‚nicht darstellbar‘ bleibt, also den gesetzmäßigen Selbsorganisationsprozessen mit dem Biozyklus und den anderen Kreisläufen enthoben ist. Wenn man von der Natur sprach und von der Ökologie schwieg, war das konsequent; denn von der vorausgesetzten oder utopisch anvisierten Naturtranszendenz kann ein Übergang zu der empirischen Natur in rational einsehbarer Weise nicht dargestellt werden. Ein solcher Übergang lässt sich nur phantasieren, erschleichen oder unbestimmt in Aussicht stellen. Im Gegensatz dazu ist ‚Natur‘ in den hier folgenden Ausführungen die selbständige auf sich gegründete Wirklichkeit, die weder von einer naturtranszendenten Macht noch vom Menschen abhängig ist und dem Menschen im Alltag, in der Arbeit, der Wissenschaft sowie der ästhetischen Aneignung empirisch zugänglich ist. Die erhabene selbständige unendliche Natur verflüchtigt sich nicht in eine zeit- und raumlose Transzendenz respektive in eine inhalts- und strukturlose Unbestimmtheit, sondern organisiert sich in den Kreislaufsystemen des Kosmos und der Erde. Dadurch ist das Unendliche der Natur inhaltlich bestimmt und rückbezüglich. An diesem intensiv Unendlichen der Naturkraft ist das extensiv Unendliche der räumliche-zeitlichen Unbegrenztheit nur die abstrakte Seite und Josef Mehringer somit das andere Extrem – die Antithese – zum Endlichen, wie es als isoliertes Einzelnes jeweils unmittelbar gegeben ist. In Entsprechung zu diesen drei Dimensionen der unendlichen Natur können Menschen tendenziell eine dreifache Stellung zur Natur einnehmen, nämlich erstens die unmittelbare Selbstbegrenzung im Endlichen, zweitens die extensive Entgrenzung und Öffnung ins unbestimmt Unendliche, und drittens – als konkrete Synthese – die inhaltlich bestimmte unendliche Entgrenzung und Offenheit. Diese dreifache Stellung zur Natur betrifft sowohl die individuelle Orientierung wie die allgemeine gesellschaftliche Form der Aneignung der Natur” (Treptow 2001:10-11). Treptow setzt sich mit der Natur in einer dialektischen Vorgehensweise auseinander, indem er alle bisher vorliegenden wesentlichen Argumente zunächst aufnimmt, sie dann gliedert und kritisch betrachtet. Übrigens steht Treptow auch insofern in der Tradition Aristotelischer Philosophie, als er als Hauptziel nicht praktische Bedürfnisse hinsichtlich seiner wissenschaftlichen Bemühungen voranstellt: “Verfehlt wäre es jedoch, die ökologische Ästhetik nur in den Dienst praktischer Veränderungen stellen zu wollen. Wer die Natur ausschließlich unter dem Aspekt der praktischen Veränderbarkeit behandelt und daraufhin die theoretische und ästhetische Tätigkeit betrachtet, verkennt die spezifische Fähigkeit des Menschen, zu den praktischen Bedürfnissen und Interessen sowie zu deren Gegenständen in Distanz zu gehen und die Natur in ihren eigenen Maßen aufzufassen” (Treptow 2001:12). b. Dialektisch-kritische Haltung zur Natur Treptow versucht in seinem Buch über “Die erhabene Natur” entsprechend des schwierigen Vorhabens die dialektische Philosophie zu präzisieren; denn die Methode hat sich stets nach dem Forschungsobjekt zu orientieren. Drei Punkte sind in diesem Zusammenhang zu beachten: 1. die Akzentuierung der Bedeutung des Vorzugs im dialektischen Prozess, 2. die Hervorhebung der Ästhetik als Synthese von Praxis und Theorie, 3. die Synthese der dialektischen Philosophie und der Systemtheorie. Natur und Ästhetik Der Autor geht also von einer Subjekt-Objekt-Beziehung aus, indem eine Seite den Vorrang hat. Hierbei tritt sogleich die Natur als dominierendes Moment in der vorliegenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung hervor: “In jeder dialektischen Beziehung ist eine Seite die bestimmende Seite, die übergreift. In der Mensch-Natur-Beziehung ist die übergreifende Seite die Natur” (Treptow 2001:87). Die besondere Stellung der Natur zeigt sich auch darin, dass sie Grundlage, Ziel und Überprüfungsinstanz ist: “Außer Ziel und Grundlage ist die Natur auch die Überprüfungsinstanz der menschlichen Tätigkeiten. An ihr entscheidet sich nämlich, ob diese ihr angemessen sind. Dies ist implizit schon unterstellt worden, als die unterschiedliche Angemessenheit der praktischen, der theoretischen und der ästhetischen Tätigkeit angesprochen worden ist. Als Überprüfungsinstanz ist die Natur das Kriterium, mit dem sich beurteilen lässt, ob die menschlichen Tätigkeiten wahr, nützlich, schön und erhaben sind. Solche Urteile der Angemessenheit oder Übereinstimmung haben freilich noch eine zweite Bezugsinstanz: die Natur des Menschen” (Treptow 2001:74). Außerdem wird die ästhetische Beziehung als emotionales anschauendes Denken der eigenen Maßen der Natur bestimmt. “In der ästhetischen Beziehung wird die Natur in ihren eigenen Maßen und Formen denkend angeschaut, was mit den Gefühlen der Lust oder Unlust untrennbar verbunden ist. (Sowohl das Wahrnehmen wie das Empfinden bezeichnet das griechische Wort ‚aisthesis‘.) Gefühle der Lust und Unlust begleiten zwar auch die theoretischen und die praktischen Tätigkeiten, sind für diese aber nicht bestimmend. In der ästhetisch-emotionalen Einstellung interessieren die allgemeinen Gesetze – im Unterschied zur Theorie – nur zusammen mit dem Einzelnen und Besonderen” (Treptow 2001:70). Treptow entwirft eine neue Vorgehensweise auch insofern, als er eine Synthese zwischen der dialektischen Philosophie und der Systemtheorie vornimmt; damit geht die Geisteswissenschaft ein bisher in der Philosophie ungewöhnliches Bündnis mit der Naturwissenschaft ein, welches Josef Mehringer dennoch den Blick für die Verknüpfung von Wissenschaft und Kunst befördert: Interdisziplinäres Arbeiten großen Stils wird dadurch ermöglicht. Begrifflichkeit Interessant erscheint zudem die neue Begrifflichkeit – Wörter mit dialektischer Bedeutung –, die sich aus dieser neuen Art philosophischen Vorgehens ergibt. Die Struktur ansonsten schwieriger Sachverhalte vermag man nunmehr durch präzise Termini treffender zu bestimmen, ohne den Blick für das Ganze zu verlieren. Ein zentraler Begriff stellt in dieser ökologischen Ästhetik das Erleben dar. Er gilt als Synonym für diese Theorie, denn in diesem Terminus erkennt Treptow ein großes Flexibilitätsmoment unseres Erkennungspotentials und begründet dies damit, daß gerade hier sowohl der intellectus als auch die emotio aktiviert werden: “Das Wort ‚erleben‘ – heutzutage oft anstößig und geradezu verpönt, aber hier bewusst gebraucht – drückt aus, dass wir uns in der ästhetischen Beziehung mit dem Leib und den Sinnesorganen inmitten der Natur befinden, ohne etwa unbetroffen einem Schauspiel zusehen. Die ästhetische Konstellation umfasst die Sinnlichkeit des Leibes, der Sinnesorgane und der äußeren Natur. Einbezogen sind außer dem Empfinden und Wahrnehmen auch das Denken und Wollen. Das Wort ‚erleben‘ drückt weiter aus, dass die Naturbeziehung in den gesellschaftlich-kulturellen Voraussetzungen nicht einfach verschwindet: wer etwa das Meer oder das Gebirge erlebt, dem verliert es sich nicht in diversen kommunikations-theoretischen Diskursen oder postmodernen Texten. Das Erlebte lässt sich nicht derart relativieren oder revidieren wie eine vorläufige Ansicht oder ein versuchsweise bezogener Standpunkt. Außerdem ist das ‚Erleben‘ dem Ansatz des ‚Urteilens‘ entgegengesetzt. Mit ihm geht Kant an das Ästhetische heran, wobei ihn interessiert, ob die Urteile ausnahmslos verallgemeinerungsfähig sind. – Fragt man, wie sich das ‚Erleben‘ zum ‚Leben‘ verhält, so lautet die naheliegende Antwort: das Erleben wurzelt in dem Leben als seiner Voraussetzung. Doch beides ist nicht ist nicht gleich zu setzen (wie es exemplarisch Dilthy in seiner Lebensphilosophie macht); denn umfassender als das Leben ist die anorganische Natur, aus der das Leben allererst entstand” (Treptow 2001:73). Natur und Ästhetik Ein weiterer Schlüsselbegriff stellt das Erhabene dar, welches Grenzüberschreitungen der Gleichgewichtssysteme markiert. Während das Schöne das Bestehen der Systeme der Natur bedeutet, so gilt das Wort Erhaben dem Vergehen. Damit ist ein Chaos gemeint, welches den Übergang von einer Ordnung in die andere darstellt. Die erhabene Natur umfaßt die grenzüberschreitenden Kreislaufsysteme (Treptow 2001:13). Das schöne Bestehen und das erhabene Vergehen innerhalb der Selbstorganisationsprozeß der Natur wird auf diese Weise bestimmt: “Die Natursysteme, die innerhalb des Selbsorganisationsprozesses der Natur – an sich – ein zweckmäßiges relativ stabiles Gleichgewicht bilden und zugleich für uns Menschen zweckmäßig sind, sind schön. Erhaben sind dagegen die Grenzüberschreitungen der Gleichgewichtssysteme, das heißt die Prozesse, die an sich selbst zweckmäßig, aber für Menschen sowohl zweckmäßig wie unzweckmäßig sind. Mit anderen Worten: Schön ist das Bestehen der Systeme der Natur oder ihre Ordnung; erhaben ist ihr Vergehen, also das Chaos als das Übergehen einer Ordnung in die andere. Die schöne Natur erregt Lust, die erhabene Natur erregt sowohl Lust wie Unlust. Der gesamte an sich zweckmäßige, für uns aber sowohl zweckmäßige wie unzweckmäßige Selbst- und Umorganisationsprozess der Natur bereitet Lust und Unlust. Die widersprüchliche Einheit beider Gefühle ist typisch für das Erleben der anziehenden und abstoßenden janusköpfigen Natur. Die erhabenen Gefühle der Lust und Unlust schließen sich aus, bedingen sich aber auch wechselseitig. Sie können verschiedene Formen annehmen und sich steigern zum Verhältnis von Staunen und Schaudern, Begeisterung und Entsetzen, Bewunderung und Schrecken, Ehrfurcht und Furcht ... Wenn man die erhabene Natur ‚groß‘ nennt, hat dies seinen guten Grund darin, dass die grenzüberschreitenden Kreislaufsysteme die Bedingungen des menschlichen Lebens und Todes sind und mit ihren Kräften sowie ihrer zeitlich-räumlichen Erstreckung die Kraft des Menschen sowie seine Zeit-Raum überragen, also über den Menschen ‚erhoben‘ sind” (Treptow 2001:14). 2. Metamorphosen in der Natur, Gesellschaft und Denken Josef Mehringer a. Die erhabene Natur Nach Treptows Theorie sind die grenzüberschreitende Prozesse für die Natur zweckmäßig, für den Menschen jedoch sowohl zweckmäßig wie unzweckmäßig. Dementsprechend erleben die Menschen die grenzüberschreitende erhabene Natur mit Lust und Unlust. Im Zentrum der ästhetischen Theorie Treptows steht also das Erleben der Natur im ganzen, welche die Eigenschaft der Selbstorganisation besitzt und gewaltige Grenzüberschreitungen ihrer relativen Gleichgewichtssysteme vornimmt. Die unendliche Entwicklung der Natur hat laut Treptow eine Komplexitätsteigerung der selbständigen Systeme zur Folge: “Im Kern ist die Unendlichkeit der Natur die Unerschöpfbarkeit und Unzerstörbarkeit der unvergänglichen produktiven Kraft der Selbstorganisation qualitativ bestimmter rückbezüglicher Systeme. Hiermit ist die Unendlichkeit der Natur die intensive Totalität. Sie ist durch die Grade der Komplexität bestimmt, durch die sich ihre Systeme unterscheiden und vergleichbar sind” (Treptow 2001:236). Der Grad der Komplexität erhöht sich stets dadurch, daß autonome äußere Systeme durch Umwandlung oder Konstruieren in das eigene System integriert werden und dadurch zu einer neuen Qualität führten (Treptow 2001:238). Bildung und Selbständigkeit sind darin jedem einsehbar. Mit Selbständigkeit meint Treptow keineswegs ein wie bei Luhmann angenommenes geschlossenes System; vielmehr handelt es sich hier um offene Systeme, die mit der Umgebung in ständigem Austausch stehen (Treptow 2001:33). “Tatsächlich ist die unendliche Natur kein offenes System in der Weise, dass es sich auf andere vorausgesetzte oder sozusagen vorgefundene Systeme bezieht; aber sie ist auch nicht einfach ein geschlossenes System in der üblichen Bedeutung des Wortes. Die Pointe ist der reale Widerspruch: die unendliche Natur ist das System, das sich auf umgebende Systeme bezieht, aber diese selbst produziert respektive selbst organisiert” (Treptow 2001:237). Treptow benutzt in diesem Zusammenhang den treffenden Begriff “operative Geschlossenheit”: “Integrieren durch Umwandeln – oder Konstruieren – kann das Nervensystem nur das, was unabhängig von ihm in der Umwelt wirk- Natur und Ästhetik lich vorhanden ist. Ähnlich ist es bei der Assimilation im Stoffwechsel: die Bestandteile, die vom System des Organismus resorbiert und in eigene Stoffe umgebaut werden, enthält die Nahrung objektiv (nämlich Eiweiß, Fette, Kohlehydrate, Mineralien). Folglich ist das Operieren eines Systems auf der Grundlage der eigenen Strukturen – die ‚operative Geschlossenheit‘ – nicht unvereinbar mit der inhaltlichen Reproduktion, sondern beides ergänzt sich und bildet eine Einheit (entgegen der Auffassung Luhmanns und anderer Konstruktivisten)” (Treptow 2001:238). Der Autor gibt außerdem zu bedenken, dass derjenige, der etwas anderes als die Bewusstseinsunabhängigkeit der Natur annimmt, in der Pflicht des Beweises steht: “Wir können sagen: praktisch, theoretisch und ästhetisch ist das Subjekt schon immer mit dem Objekt vermittelt oder synthetisiert. Der Mensch bedarf nämlich stets der Objekte beziehungsweise der Naturgegenstände; er ist somit darauf angewiesen, dass sie wirklich existieren. Daher liegt im praktischen, theoretischen und ästhetischen Bedürfnis der ‚Beweis‘ dafür, das die Naturgegenstände unabhängig vom Menschen – objektiv – existieren. Aus dem Bewußtsein allein beziehungsweise mit theoretischen Begründungen ist die Bewußtseinsunabhängigkeit der Naturgegenstände nicht zu beweisen. Fügen wir hinzu: die Bewusstseinsunabhängigkeit der Natur und in diesem Sinne ihre Selbständigkeit erscheinen im Bewusstsein und sind jedermanns alltäglicher Ausgangspunkt. Die Beweislast hat, wer etwas anderes annimmt. Dabei genügt keine allgemeine unbegründete Skepsis (‚es könnte doch sein‘); vielmehr müssten bestimmte Begründungen vorgebracht werden. Aber üblicher- und fälschlicherweise gründet man die Skepsis, den Zweifel, einfach auf eine andere ‚Denkmöglichkeit‘, oder man dreht die Beweislast um, und verlangt einen Beweis für die Berechtigung der Annahme der Bewusstseinsunabhängigkeit der Natur. Ein solcher Beweis kann dann theoretisch insofern nicht geführt werden, als dabei das Bewusstsein respektive das beobachtende Subjekt schon vorausgesetzt wird. Dies machen sich Idealisten in vielen einfallsreichen Varianten zunutze” (Treptow 2001:238). Josef Mehringer Der unendlichen selbstorganisierenden Natur liegt nun eine gewisse Urkraft zugrunde, aus der alles Entstehen und Vergehen ihre Ursache hat. Diese sogenannte Produktivität der Natur hat eine weitreichende Wirkung. Da sie einen weiteren guten Zugang zu Treptows ästhetischer Theorie ermöglicht, erscheint es sinnvoll, diese näher zu betrachten. b. Produktivität der Natur als Konstante (tertium comparationis) a.a. Produktivkraft der Natur Die Produktivkraft der Natur, lässt sich am besten aus dem ästhetischemotionalen Erleben innerhalb einer Subjekt-Objektrelation erschließen. Da das Wissen und die Sicherheit des Menschen in der Auseinandersetzung mit der Natur im Laufe der Zeit zunimmt, hat sich gleichzeitig die Vorstellung über diese allmählich geändert. Innerhalb der verschiedenen Auffassungen kristallisiert sich dann eine Konstante heraus, die Treptow als die Produktivkraft der Natur in den kosmischen und irdischen Kreislaufsystemen kennzeichnet. In den früheren Weltbild-Vorstellungen etwa im Alten Orient und in Griechenland erkennt man, dass die Natur Neubildungen innerhalb der großen Kreisläufe hervorbringt. In der chinesischen Kultur galt Yang und Ying (schöpferischer Himmel und empfangende Erde) etwa als die alles hervorbringenden Urkräfte. Bei den Ägyptern verkörpert Osiris eine derartige Energie, welche die Natur auf immer höherer Ebene sich erneuern läßt. Im alten Griechenland glaubte man die Schicksalsgöttinnen (Moiren) als kosmische Bewegung zu identifizieren. Auch sprach man diese Fähigkeit oft dem Gott Eros zu. Er galt ebenfalls bei den ionischen Naturphilosophen als produktive Kraft der Natur. Goethe erkannte in der “Polarität” und der “Steigerung” die “zwei großen Triebräder der Natur” (Treptow 2001:27). Die heutige Naturwissenschaft nimmt im Grunde genommen eine ähnliche Haltung ein, ohne jedoch wie Goethe die künstlerische produktive Gestaltung als Fortsetzung des produktiven Formierens der Natur zu erkennen (Treptow 2001:27). Jedenfalls werden hier kosmische und irdische Kreisläufe angenommen, die eine Komplexitätssteigerung als Auswirkung haben (Treptow 2001:29-36). Am Ende dieser Entwicklung steht der Mensch, der aufgrund seines komplizierten Nervensystems be- Natur und Ästhetik stimmte Strukturen erkennen und antizipieren kann. Das Prinzip bei der Komplexitätssteigerung sieht Treptow darin, daß das nächst höhere System immer außerhalb liegende Kreisläufe in sich aufnimmt, so daß der Mensch eine Art Synthese der vorhandenen Kreislaufsysteme in sich trägt. Folgende Zitate sollen uns den angesprochenen Sachverhalt verdeutlichen: “Je komplexer die Systeme sind, desto unabhängiger sind sie in der Regel von den Einwirkungen der anderen Systeme” (Treptow 2001:59). “In der evolutionären Selbstorganisation der Natur wurden die Organismen von der unmittelbaren Umgebung, mit der sie in Wechselwirkung stehen, zunehmend unabhängiger. Die Unabhängigkeit und Selbständigkeit der Organismen nahm dadurch zu, dass sich ihre Komplexität steigerte und die Stabilität ihres dynamischen Gleichgewichts verstärkte” (Treptow 2001:106). “Der Selbstorganisationsprozess, der sich mit seinen Kreisläufen in eine unumkehrbare Richtung bewegt, bildete immer komplexere selbständigere Systeme aus. Den höchsten Grad der Selbständigkeit und somit der Autonomie hat der Mensch. Aufgrund seiner leiblich-geistigen Organisation und des komplexen Nervensystems hat er den weitesten Spielraum, um auf die Einwirkungen der umgebenden Systeme zu reagieren und sich anzupassen. Er vermag sich derart angemessen und adäquat auf die Natur zu beziehen, dass er ästhetisch-emotional ihre eigenen Systeme respektive Formen aufnehmen sowie theoretisch ihre gesetzmäßigen Formenwandlungen erkennen und diese praktisch in Übereinstimmung mit ihren Gesetzen umformen kann” (Treptow 2001:59). b.b. Produktivkraft des Menschen als Fortsetzung der Produktivkraft der Natur a.a.a. Erste und zweite Natur: die Würde des Menschen In dieser Metamorphosenlehre spielt die Produktivität der Natur eine weitere wichtige Rolle. Sie vermittelt nämlich zwischen Natur und Mensch; sie setzt sich in der Tätigkeit des Menschen fort. Aus diesem Grunde erscheint nicht nur die Natur, sondern auch der Mensch als er- Josef Mehringer haben. Da es sich hierbei um eine Schlüsselstelle in dieser ästhetischen Theorie handelt, wird ein längeres Zitat zum Verständnis angeführt: “Der Mensch ist ein erhabenes Wesen, indem er als evolutionär entstandenes Naturwesen mit seiner spezifischen Selbständigkeit die produktive Kraft der natürlichen Selbstorganisation fortsetzt und – wie die Natur insgesamt – relativ stabile Gleichgewichtssysteme produziert, deren Grenzen er unaufhörlich überschreitet. Das bedeutet: der Mensch überschreitet die Grenzen nicht nur der äußeren Natur, sondern auch seiner eigenen Natur. Diese sind mit seiner leiblich-geistigen Organisation gegeben. Sie ist die Bedingung sowohl seines Lebens wie seines Todes. Die Individuen nutzen die sich in den dynamischen Kreisläufen organisierende Natur, um ihre Bedürfnisse zu verwirklichen, tragen aber als das Produkt der gesamten natürlichen Entwicklung notwendigerweise den Tod in sich. Die Naturkräfte, die im Menschen als Naturwesen wirksam sind und die er als Gesellschaftswesen weiterentwickelt, sind also für die Individuen sowohl praktisch zweckmäßig und nützlich als auch unzweckmäßig und zerstörerisch. So erleben die Individuen nicht nur die äußere Natur, sondern auch ihre eigene Natur mit Formen von Lust und Unlust, einschließlich Ehrfurcht und Furcht, Staunen und Schrecken. Die Kraft der Natur, die sich darin äußert, dass sie physikalische, chemische, biologische und anthropologische Strukturen aufbaut und umwandelt, setzt sich in der leiblich-geistigen Tätigkeit des Menschen so fort, dass er Arme, Beine, Hand und Kopf in Bewegung setzt und seinen Stoffwechsel mit der äußeren Natur bewußt reguliert. Dabei gebraucht er Werkzeuge, Maschinen sowie Kommunikationsmittel. Die Kraft des menschlichen Leibes ist eine geschichtlich veränderbare Größe; die Werkzeuge und auch die Waffen, die die Grenzen der Leibesorgane überschreiten, werden ja weiterentwickelt: vom Stein-, Bronze- und Eiszeitalter über die Periode der Dampfmaschine bis zur gegenwärtigen Epoche der Atomkraft und der Computer. In den Computern vergegenständlicht der Mensch nicht nur wie in den anderen Maschinen seine leibliche, sondern auch seine geistige Kraft, und zwar die Anteile der geistigen Natur und Ästhetik Tätigkeit, die immer wiederholt werden und deshalb automatisierbar sind” (Treptow 2001:106). Die Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur erforderte eine Kooperation, die sich stets in Form der Arbeitsteilung auswirkte. Er mußte sich mit seiner Naturkraft gegen die äußere Naturkraft behaupten. Die schöpferische Kraft des Menschen arbeitet Treptow als zweite menschliche Natur heraus (Treptow 2001:106-108). Diese Produktivkraft hat also für den Menschen eine herausragende Bedeutung, da sie die vorgefundenen Naturgrenzen überschreitet. Seit jeher war diese menschliche Produktivkraft von größtem Interesse. Verschiedene Mythen und Epen liefern dafür vielfältige Belege. So erscheint diese etwa bei den Griechen personifiziert in den beiden Helden Herakles und Prometheus. Diese übernatürliche Gestalten ermöglichten durch ungewöhnliche Kraftanstrengungen eine Kultivierung der ersten Natur, die letztendlich Sicherheit und Wissen für die Menschen bedeuteten. Treptow verbindet mit der Produktivkraft des Menschen seine Würde. Sie ist durch den aufrechten Gang ermöglicht: Dementsprechend erlangt der Mensch bereits aufgrund seiner biologischen Abstammung seine Würde. “Der aufrechte Gang ermöglicht es dem Menschen, mit Würde aufzutreten. Die Würde ist die eigentümliche Natur des Menschen. Sie kennzeichnet sowohl seine erste wie seine zweite Natur, also sowohl die biologische Natur mit ihrem genetischen Code wie die kulturell-gesellschaftliche Natur mit ihren Normen, die immer wieder neu gelernt werden müssen” (Treptow 2001:107-108). Die Würde des Menschen bedeutet aber noch mehr: Sie ist zudem die Quelle der Bewegung seiner Tätigkeiten. “Die Würde des Menschen ist das Zentrum, von dem seine Tätigkeiten ausgehen. Dies betrifft alle Menschen. Es sind nicht nur die Würdenträger, die die Würde des Menschen tragen” (Treptow 2001:108). Die Erkenntnis der Würde als eine Lebenskraft, die sich sowohl aus der ersten als auch aus der zweiten Natur begründet, hat nun ebenfalls unter verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen unterschiedliche Vorstellungen hervorgerufen. Josef Mehringer “Die alten Ägypter verehrten dieses Zentrum des Menschen als unvergängliche Lebenskraft, als ‚Ka‘, der im Leben der Nahrung und danach der Opferspeisen bedarf. Konfuzius sprach wie andere Chinesen von der ‚erhabenen Würde’ des Menschen in Hinblick auf die beiden natürlichen Grundkräfte Himmel und Erde, Yang und Ying. Die Griechen brachten dem selbständigen Kern des Menschen Ehrfurcht und Scheu, aidós, entgegen. Die Stoa verband die Würde des Menschen mit seinem besonderen Rang im Kosmos und diesen mit seiner Vernunftfähigkeit. Als vernünftige Selbstbestimmung charakterisierte sie auch Pico della Mirandola in der Renaissance.. Doch nach der christlichen Vorstellung ist die menschliche Würde gleichbedeutend mit der Ebenbildlichkeit zum naturtranszendenten Gott. Sie sei durch Sünde verloren gegangen und durch Christus wiederhergestellt worden. Genauer genommen, ist es seit dem Alten Testament der Mann, der als eben- oder Abbild Gottes gilt; die Frau wird als Abbild des Mannes angesehen. An die christliche Vorstellung, dass die Würde in der Naturtranszendenz wurzelt, knüpft Kant an. Er gründet sie darauf, dass der Mensch als Vernunftwesen alle natürlichen Antriebe und sinnlichen Bedürfnisse oder Neigungen sowie alle gesellschaftlichen Interessen negiere oder transzendiere und in dieser Weise reines selbstzweckhaftes Subjekt sei” (Treptow 2001:108). Die Würde des Menschen hat derartig große Bedeutung, daß sie sogar im ersten Artikel des Grundgesetzes erscheint: “Die Würde des Menschen ist unantastbar”. Allerdings wird dieser Grundsatz heute noch unterschiedlich interpretiert. Des weiteren arbeitet Treptow eine sogenannte dritte Natur des Menschen hinsichtlich seiner Produktivkraft heraus, die nun konstitutiv für die Wahrnehmung und Darstellung der erhabenen Natur ist. b.b.b. Dritte Natur des Menschen “Die menschliche Naturaneignung hat einen Doppelcharakter: sie erfolgt nicht nur in selbständiger, sondern auch in verselbständigter Form” (Treptow 2001:110). Treptow macht also den Leser darauf aufmerksam, dass die Produktivkraft des Menschen einen Doppelcharakter trägt; einerseits führt der Natur und Ästhetik Mensch als Teil der Natur diese Produktivität durch seine Tätigkeit auf gesellschaftlicher Ebene weiter, andererseits verkehrt sie sich gegen ihn in Form der Entfremdung oder Versachlichung der menschlichen Beziehungen. Die Herabsetzung der Natur schafft immer neue Abhängigkeiten, die sich schließlich in immer größeren Krisen äußern (Treptow 2001:63). Eine der größten Krisen erkennt Treptow neben der verantwortungslos betriebenen Atomtechnik in der angewandten Biotechnik; denn die gegenwärtige Gesellschaft unterwirft tendenziell die gesamte biologische Natur der gesellschaftlichen Natur. Da aber beide Naturen die Grundlage seiner Würde darstellen, wird durch einen derartigen Eingriff jede Zielsetzung willkürlich. Die Würde des Menschen wird damit nicht mehr etwa durch Aristotelische metaphysische Vorgaben greifbar. c. Das Denken und seine Metamorphosen Das Denken als Tätigkeit des Erkennens ist ein dem Essen und Trinken strukturell gleicher Aneignungsprozeß der Natur, welcher zu einem Zustand führt, den Hegel in seiner zentralen Formel als das “Beisichsein im anderen seiner selbst” kennzeichnet (Treptow 2001:192). Das denkende Anschauen als ästhetische Wahrnehmung betrifft übrigens alle unsere Sinne, wozu neben dem Sehen und Hören auch das Riechen, Tasten und Schmecken zählt. Es ist zu bedenken, dass selbst das Wort für “Wissen” und “Weisheit” sich von dem Wort für “Schmecken” und “Geschmack” ableitet. Treptow kommentiert diesen Zusammenhang folgendermaßen: “ …‚sapientia’ stammt von ‚sapor’. Der ‚homo sapiens’ ist das Lebewesen, das zu ‚schmecken’ weiß” (Treptow 2001:72). Bei der Aneignung der Natur, die stets in dreifacher Hinsicht erfolgt – praktisch, theoretisch und ästhetisch-emotional – macht der Mensch immer eine ästhetische Erfahrung von der erhabenen und der schönen Natur, unabhängig davon, ob er darüber ein Wissen hat oder nicht (Treptow 2001:87). Treptow schreibt hierzu: “Das heißt: die ästhetische Erfahrung der erhabenen und der schönen Natur gehört zum menschlichen Leben nicht anders als die praktisch-gegenständliche Aneignung der Natur (also das Bearbeiten der Natur und das Konsumieren der Arbeitsprodukte), und nicht anders als die darin stets integrierte geistige Tätigkeit respektive die Josef Mehringer Vernunft, die die angezielten Resultate der praktischen Aneignungen im Kopf vorwegnimmt. Die praktischen, die theoretischen und die ästhetischen Tätigkeiten, die zuvor schon unterschieden wurden, sind mit dem menschlichen Leben stets verbunden. Solange Menschen leben, haben sie das Bedürfnis, sich die Natur praktisch, theoretisch und ästhetisch-emotional anzueignen. Anders gesagt: die praktische, theoretische und ästhetische Aneignung der Natur sind elementare anthropologische Bedürfnisse” (Treptow 2001:85). In der Mensch-Naturbeziehung tritt dann laut Treptow die Natur doppelt auf: “Die Naturentwicklung bleibt selbständig, wenn auch die Beziehung zu ihr durch die gesellschaftlichen Verhältnisse vermittelt ist. So ergibt sich das Paradox, dass in der Beziehung Mensch-Natur die Natur doppelt auftritt, nämlich als durch den Menschen vermittelt wie auch als unvermittelt und unabhängig vom Menschen. Aber auf diese paradoxe und widersprüchliche Seinsart der Natur kommt es bei der Untersuchung ihrer Erhabenheit gerade an” (Treptow 2001:87). Die Tätigkeit ist dann die Vermittlung zwischen Natur und Gesellschaft. “Die praktischen, theoretischen und ästhetischen Tätigkeiten bilden einen rückbezüglichen Prozess und einen sich selbst regulierenden Kreis, in dem sie jeweils sowohl Voraussetzungen wie Resultate sind. So werden vermittels der praktischen Eingriffe in die Natur neue theoretische Einsichten und ästhetische Erlebnisweisen gewonnen, die ihrerseits die praktische Aneignung der Natur beeinflussen” (Treptow 2001:70). Durch die dritte Natur wird jedoch die Erkenntnis eingeschränkt. Eine ähnliche Wirkung erzielt dann eine Kunst, die nicht auf das strukturierte Unendliche, sondern auf das unstrukturierte Unendliche zielt8 (Treptow 2001:233). Es kommt zu einer “An-Ästhetisierung”: “Wenn die Natur bestimmten Interessen untergeordnet wird, die von ihren eigenen Maßen abstrahieren, kommt sie ästhetisch gar nicht oder nur verzerrt zur Geltung” (Treptow 2001:151). 8 Hegel unterscheidet das “wahre Unendliche” von dem “schlecht Unendlichen” (s. Treptow 2001:234). Natur und Ästhetik Dementsprechend spricht Treptow von symbolischer und allegorischer Auffassung (Treptow 2001:202). Während jene die bestimmten Naturproduktionen in ihren eigenen Maßen und in ihrem eigenen unendlichen Zusammenhang respektiert, sieht diese davon ab. Es treten uns also zwei verschiedene Kunstauffassungen gegenüber: die mimetischreproduzierende Kunst (Aristoteles) und die naturtranszendente Kunst, mit der die Ereigniskunst verwandt ist. Während diese eine eher Erkenntniseinschränkenden Wirkung besitzt, zielt jene auf Selbstbestimmung (Treptow 2001:218). Der exemplarische Repräsentant der symbolischen Kunst ist Goethe: “Der Mensch kennt nur sich selbst, insofern er die Welt kennt, die er nur in sich und sich nur in ihr gewahr wird. Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in uns auf”9 (Goethe in: Treptow 2001:228). Die sich daraus ergebenen gegensätzlich wirkenden ästhetischen Wahrnehmungen und Darstellungen werden von Treptow historisch bewiesen, und zwar hinsichtlich der Architektur, Musik, Malerei usw. Dabei deckt Treptow die jeweiligen philosophischen Hintergründe auf. C. Hauptpunkte der Naturästhetik Daraus ergibt sich gewissermaßen die Achse, die Treptows Theorienkonzept durchzieht und trägt. In dieser wird das Verhältnis Komplexitätssteigerung, Ästhetik und Würde historisch aufgedeckt und ihr dynamisches Wechselspiel im Hinblick auf die produktive Natur neu untersucht. Dafür hat der Autor stets neben der Natur im ganzen die drei Naturen des Menschen im Blickfeld, die ihm schließlich eine entsprechende Beurteilung ermöglichen. Aufgezeigt wird, daß sowohl die ästhetische Wahrnehmung als auch die Darstellbarkeit von den drei Naturen des Menschen abhängen: 1. Natur: Mensch als Naturwesen 2. Natur: Mensch als Gesellschaftswesen 3. Natur: Mensch als entfremdetes Wesen 9 Goethe. Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort. In: DtvGesamtausgabe, München. 1961 ff., Bd. 39, S. 187, vgl. S. 231. Josef Mehringer Wahrnehmung und Darstellung wird an praktischer Sicherheit und Wissen, welches bedingt ist durch die gesellschaftliche Entwicklung, gekoppelt. Treptow begreift die ästhetische Theorie des Erhabenen als produziert und konstituiert: “Immer wieder geht man in der Ästhetik daran vorbei, dass die Naturerlebnisse durch die natürliche Evolution und die gesellschaftliche Entwicklung vermittelt sind. Entweder man sucht den ästhetischen Zugang zur Natur direkt, so als wären die Anschauungen, Vorstellungen und Gefühle unvermittelt, selbständig und autonom; oder man sieht die Naturerlebnisse als völlig abhängig und determiniert von den Vermittlungen an, so daß die selbständige Natur darin abhanden kommt repektive nur noch als Kulisse für menschliche Veranstaltungen oder als Hintergrundrauschen vorkommt. Die meisten ästhetischen Theorien dünken sich selbständig und unabgeleitet; sie suchen den Zugang zur Natur sozusagen auf einer ‚direttissima‘ ohne zivilisatorische Aufstiegshilfen. Das betrifft die metaphysischen, transzendentalen und empiristischen Theorien, weitgehend auch die hermeneutischen und phänomenologischen Ansätze. Exemplarisch ist hierfür die Ästhetik Kants. Auf der anderen Seite ist das tendenzielle Verschwindenlassen der Natur in die Gesellschaft typisch für die Ästhetik von Lukács. Es gibt sogar Autoren, die die Natur als ‚kulturelle Erfindungen‘ sowie als Produkt von Mythen und Allegorien ansehen ... Wenn auch die Wahrnehmungs- und Erlebnisweise der erhabenen Natur nicht zu allen Zeiten gleich ist, sondern von den besonderen natürlichen und gesellschaftlich-geschichtlichen Verhältnissen abhängt, ist doch ihre allgemeine Struktur die gleiche, nämlich die gegensätzliche Einheit des für Menschen praktisch Unzweckmäßigen und des an sich selbst Zweckmäßigen, verbunden mit Formen von Unlust und Lust” (Treptow 2001:84-85). Verschiedene Positionen werden in Treptows Buch beispielhaft dargelegt, wie sie Natur zu betrachten und wie sie diese darzustellen pflegen. Dabei ist ein historisches Band zu erkennen, das die Freiheit der verschiedenen historischen Stufen ist. Die Natur wird nicht mehr in eine teleologische Geschichte eingebunden wie bei Aristoteles und Hegel, sondern stellt sich als rückbezüglicher und Natur und Ästhetik somit zweckmäßiger Prozess mit entsprechender Komplexitätssteigerung dar. Der Beurteilungsmaßstab ergibt sich aus bestimmten Fähigkeiten, die in dem ästhetischen Vermögen gipfeln. Schlußwort Die Dialektik hat sich im Laufe der Jahrtausende herausentwickelt. Als systematische Vorgehensweise beginnt ihr Weg in Aristoteles’ Philosophie, die die Natur als ganzes zum wichtigsten Forschungsgegenstand erhebt; ihre Reise führt dann über Hegel und seine Zeitgenossen Humboldt und Goethe zu Marx und Engels, welche die klassische historisch materialistische Dialektik formulierten. Aufgehoben wurde diese schließlich bei Treptow insofern, als er eine Synthese zwischen dialektischer Philosophie und Systemtheorie vornahm. In einer neuen Begrifflichkeit zielt Treptow auf das Ganze und behandelt sowohl Natur als auch Gesellschaft, und zwar mit dem Nachdruck auf der Selbstorganisation der Natur. Dabei tritt das Bündnis zwischen Geistes- und Naturwissenschaft noch deutlicher hervor. In diesem Zusammenhang ergibt sich eine neue Strukturierung der einzelnen Bereiche; die Ästhetik wird zu einer Synthese von Theorie und Praxis. Aufgrund von Treptows Verfeinerung der dialektischen Arbeitsweise treten die Schranken sowohl der metaphysischen als auch der empirischen Vorgehensweisen noch deutlicher hervor. Es gelingt dem Autor dieses Buches verschiedenste Themenbereiche zu untersuchen. Insbesondere erarbeitet er die einschränkenden Wirkungen der entfremdeten Produktion auf die erste und zweite Natur des Menschen, die im ästhetischen Wahrnehmen und Darstellen als Grundlage für Wissenschaft und Kunst fungieren. Treptow hat mit seinen wissenschaftlichen Studien über die erhabene Natur einerseits die dialektische Philosophie in ihren Strukturen zusammenfassend dargestellt und sie andererseits derart bereichert, dass sogar von einer neuen Art des Philosophierens gesprochen werden kann. Literaturverzeichnis Aristoteles Josef Mehringer 1974 Kategorien, Lehre vom Satz (Peri hermeneias) Organon I/II. Übersetzt, mit einer Einleitung und erklärenden Anmerkungen versehen von Eugen Rolfes. Unveränderte Nachdruck der 2. Auflage von 1925. Felix Meiner Verlag. Hamburg. 1982 Aristoteles Physik. Bücher I (Α)-IV (∆). Griechisch-deutsch übersetzt, mit einer Einleitung und mit Anmerkungen herausgegeben von Hans Günter Zekl. Felix Meiner Verlag. Hamburg. 1985 Nikomachische Ethik. Auf der Grundlage der Übersetzung von Eugen Rolfes herausgegeben von Günther Bien. Felix Meiner Verlag. Hamburg. 1988 Aristoteles’ Physik: Vorlesung über Natur. Zweiter Halbband: Bücher V (Ε)-VIII (Θ). Griechisch-deutsch übersetzt, mit einer Einleitung und mit Anmerkungen herausgegeben von Hans Günter Zekl. Felix Meiner Verlag. Hamburg. 1990 Lehre von Beweis oder Zweite Analytik (Organon IV). Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Eugen Rolfes. Verbesserter Nachdruck mit ergänzter Bibliographie von Otfried Höffe. Felix Meiner Verlag. Hamburg. 1992 Lehre von Schluß oder Erste Analytik (Organon III). Übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Eugen Rolfes. Mit einer Einleitung von Hans Günter Zekl. Felix Meiner Verlag. Hamburg. 1994 Metaphysik. Übersetzt von Hermann Bonitz (ed. Wellmann). Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbeck bei Hamburg. 1995 Über die Seele. Griechisch-deutsch übersetzt, mit einer Einleitung, Übersetzung (nach W. Theiler) und Kommentar herausgegeben von Horst Seidl. Felix Meiner Verlag. Hamburg. 1997 Kleine naturwissenschaftliche Schriften (parva naturalia). Übersetzt und herausgegeben von Eugen Dönt. Stuttgart. 2001 Poetik. Griechisch-deutsch übersetzt und herausgegeben von Manfred Fuhrmann. (Erste Auflage Reclam Verlag: 1982). Stuttgart. Bloch, Ernst 1972 Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main. Engels, Friedrich 1971 Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Berlin. Natur und Ästhetik Euripides 2001 Die Bakchen. Tragödie. (Erste Auflage Reclam Verlag: 1968). Stuttgart. Hegel, G. W. F. 1970 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I. Werke 8. Erster Teil: Die Wissenschaft der Logik mit den mündlichen Zusätzen. Frankfurt am Main. Schicker, Rudolf 1995 Einleitung. In: Jacopo Zabaewlla: Über die Methoden: De methodis). Über den Rückgang (De regressu). Eingeleitet, übersetzt und mit kommentierenden Fußnoten versehen von Rudolf Schicker. Wilhelm Fink Verlag. München. Seidel, Helmut 1988 Aristoteles und der Ausgang der antiken Philosophie: Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie. Dietz Verlag. Berlin. Treptow, Elmar 1978 Aspekte zu Epikur, Lukács, Habermas. München. 1979 Zur Aktualität des Aristoteles: Ein kurzer Leitfaden. München. 2001 Die erhabene Natur: Entwurf einer ökologischen Ästhetik. Königshausen & Neumann. Würzburg. In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 40-48 Autor: Jost Hermand Artikel Jost Hermand Ökologiebewußte Ästhetik im Zeichen des "zwanghaften" Kapitalwachstums Elmar Treptows Konzeption einer erhabenen Natur In Zeiten, in denen die Vertreter systemkonformer Begriffsbildungen über ihre Widersacher im Lager des „eingreifenden Denkens“ die Oberhand gewannen, kam es in Deutschland meist zu Rückzügen ins Ideologisch-Unverbindliche, die ihre inhaltliche Leere mit dem Schein des Ästhetischen zu kompensieren versuchten. So war es im Bereich der deutschen Klassik und Frühromantik, als große Teile der Intelligenz vor den gewaltsamen Ausschreitungen der Französischen Revolution zurückschreckten; so war es um 1900, als an die Stelle der sozialistisch-naturalistischen Revolte der achtziger Jahre ein mit Fin-de-siècle- und Art-nouveau-Tendenzen liebäugelnder Ästhetizismus trat; und so war es wieder in den frühen achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als der radikaldemokratisch bis links gesinnte Widerspruchsgeist der Zeit zwischen 1965 und 1975 im Bereich der Humanwissenschaften von sogenannten postmodernen Theoriekonstrukten überwuchert wurde, die auf jeden „kritischen Biß“ verzichteten und sich weitgehend auf die Beschäftigung mit minderheitsorientierten Differenzaffekten sowie sensualistisch-leibhaften „Wahrnehmungsformen“ beschränkten. Selbst im Bereich der Philosophie, wo in den späten sechziger und siebziger Jahren im Hinblick auf ästhetische Phänomene auch politische und sozioökonomische Fragestellungen eine gewisse, ja zum Teil beachtliche Rolle gespielt hatten, herrscht auf diesem Gebiet seit zwei Jahrzehnten eine Sehweise, die vornehmlich an jene seit Alexander Gottlieb Baumgarten entwickelte Ästhetik-Vorstellung anknüpft, die fast nur noch sinnliche Wahr- Jost Hermand nehmungsformen „privilegiert“ und alle inhaltlichen Bestimmungen soweit wie möglich „desavouiert“. Immer wieder ist hier hauptsächlich von dem „Wie“ des „Wahrnehmens“, aber nicht mehr von dem „Was“ des „Wahrgenommenen“ die Rede, um so einer subjektorientierten Perspektive zu frönen, mit der man allen ideologischen Entscheidungen kollektiver, das heißt gesellschaftsbezogener oder gar gesellschaftskritischer Art aus dem Wege gehen kann. Und zwar gilt das selbst im Hinblick auf die wieder en vogue gewordene Naturphilosophie, die sich streckenweise den Anschein zu geben versucht, sich auch mit jenen „Umwelt“-Fragen auseinanderzusetzen, die sogar in den herrschenden Massenmedien – wenn auch häufig in sensationalistischer Verpackung – eine nicht unbeträchtliche Rolle spielen. Während viele Aktivisten unter den „Umwelt“-Schützern dabei auch einen Katalog politisch eingreifender Parolen entwickelt haben, ist man im Bereich der akademisch-institutionalisierten Naturphilosophie lieber von vornherein ins Ideologisch-Unverbindliche ausgewichen, um sich nicht in irgendwelche karrierestörenden Engagementsformen zu verstricken. Und so blieb es hier – unter Berufung auf Kants subjektorienterte Kritik der Urteilskraft oder auf von Rudolf zur Lippe, Gernot Böhme und Martin Seel ausgegebene Formeln wie „Naturerkenntnis ist Selbsterkenntnis“, „Offensein für neue Erfahrungswelten“, „Sichbefinden in der veränderten Umwelt“, „verstärkte Sinnlichkeit“ sowie „affektives Betroffensein durch Atmosphären“ – fast immer bei egozentrischen Betrachtungsweisen. Sich auch einmal auf das Gebiet des Politischen oder gar der kapitalistischen Produktionsprozesse vorzuwagen, wurde in diesem Umkreis meist als „kunstfremd“ abgelehnt. Als ebenso „oberflächlich“ empfanden es viele Naturphilosophen oder Naturästhetiker der neunziger Jahre, eine kritische „Ökokunst“ zu fördern und sprachen statt dessen à la Böhme lieber von einem „handlungsentlastenden Umgang mit Atmosphären“, der keinerlei ethische Konsequenzen nach sich zieht. Eins der wenigen Bücher, das wie ein denkerisches Urgestein aus dem unkonkreten Geplätscher solcher „postmodernen“ und somit ideologisch unverpflichtenden Theoriebildungen herausragt, ist Elmar Treptows im Jahr 2001 erschienener Entwurf einer ökologischen Ästhetik, der den stolzen Obertitel Die erhabene Natur trägt. Dieses Buch geht von der These aus, daß man angesichts der heutigen Naturverwüstung zwischen Naturphilosophie und Ökologiebewußte Ästhetik... Ökologie überhaupt keinen klaren Trennungsstrich mehr ziehen kann. Und zwar stützt es sich dabei methodologisch auf einen materialistischen Ansatz, der – im Gegensatz zu den meisten heutigen Naturästhetiken – nie die sozioökonomischen Voraussetzungen aller Formen von Naturverwandlung und Naturbetrachtung vergißt. In ihm wird nicht einfach ins Theoretische transzendiert, sondern stets von einer Weltsicht ausgegangen, bei der es neben dem „Wie“ der menschlichen Wahrnehmung stets auch um das „Was“ der vom Menschen unabhängig existierenden Natur geht. Treptow bietet dabei – neben seinem philosophischen und literarischen Fachwissen – auch eine Fülle an Kenntnissen biologischer, geologischer, mineralogischer, meteorologischer, physikalischer, astronomischer, chemikalischer, sozioökonomischer und technologischer Art auf, die geradezu atemberaubend ist. Er tut dies, um seine vielfältigen Studien auf diesen Gebieten endlich in einem Lebenswerk zusammenzufassen, das nicht nur einen philosophisch-theoretischen Charakter hat, sondern auch eine naturwissenschaftliche und ökonomische Beweiskraft aufweist, die sich über eine bloß trendgemäße Beschäftigung mit diesem Thema erhebt. Schon nach wenigen Seiten merkt man, daß es ihm in erster Linie um den Nachweis jener im gesamten Weltall – von den Milchstraßen und Sonnensystemen über die Planeten, Gesteinsformationen, tierischen Lebewesen, Pflanzen bis zu den Einzellern und Atomen – belegbaren Kreisläufe geht, in denen sich trotz vielfacher Veränderungen und Verwerfungen ein relativ stabiles Gleichgewichtssystem manifestiert, das auf den Prinzipien einer unaufhörlichen, ja nie versiegenden Selbstorganisation beruht. Dies zu erkennen, das heißt den Prozeß des ewigen Entstehens und Vergehens sowohl mit Staunen als auch mit Erschrecken wahrzunehmen, bezeichnet Treptow als den ersten Ansatz zu einer ans „Erhabene“ grenzenden Naturbetrachtung. „Erhaben“ bedeutet daher bei ihm zweierlei: erstens die immer wieder ihre eigenen Grenzen überschreitende Natur, deren Verwandlungsprozesse sich seit Jahrmillionen völlig unabhängig vom Menschen vollziehen, sowie zweitens jene Gefühle des Staunens und der damit verbundenen respektvollen Verehrung der Natur, die sich bei all jenen Menschen einstellen, welche sich aufgrund solcher Emotionen und ihr durch ein interdisziplinäres Wissen erweitertes Erkenntnisvermögen zu einer naturschonenden Haltung durchringen. Jost Hermand Das „Erhabene“ ist also für Treptow – im Gegensatz zu fast allen früheren Definitionen dieser Art – nichts, was die Natur „transzendiert“, sondern was ihr immanent zu eigen ist. Auch der Mensch ist demnach für ihn ein „erhabenes Wesen“, da er „mit seiner spezifischen Selbsttätigkeit“, wie es an einer Stelle heißt, „als evolutionäres Naturwesen die evolutionäre Kraft der natürlichen Selbstorganisation fortsetzt und – wie die Natur insgesamt – relativ stabile Gleichgewichtssysteme produziert, deren Grenzen er unaufhörlich überschreitet“. Die einzige gefährliche Veränderung innerhalb dieser Prozesse sieht Treptow in dem „sachzwanghaften“ Anwachsen des Kapitalismus während der letzten zwei bis drei Jahrhunderte, der zwar auch als ein sich selbst organisierendes System ständig seine eigenen Grenzen überschreitet und damit ins „Erhabene“ tendiert, aber diese Grenzüberschreitung zum Teil so weit treibt, daß sie auf einen unumkehrbaren Prozeß hinausläuft, dem kein relativ stabiles Gleichgewichtssystem mehr zugrunde liegt, sondern das sich immer stärker verselbständigt. Durch diese sowohl naturwissenschaftlich als auch sozioökonomisch fundierte materialistische Sehweise, die zum Teil an beste marxistische Traditionen anknüpft, wirken die meisten Argumente dieses Buches wesentlich konkreter als all jene naturästhetischen Spekulationen, die sich im Gefolge narzißstischer Wahrnehmungsformen lediglich mit sensualistischen, ja machistisch-solipsistischen Selbstbezogenheiten beschäftigen. Bei Treptow ist das „Erhabene“ nicht jenes Undarstellbare, Unbekannte, Unaussprechbare oder Formlose, das es wie bei dem vielzitierten Lyotard nur jenseits der naturgegebenen Empirie zu geben scheint oder das im Sinne Adornos nur im Moment der religiös-theologisch „versöhnten Natur“ zum Ereignis wird, sondern bei ihm ist das „Erhabene“ etwas in dem Erstaunen erweckenden Kreisläufen der Natur stets schon Vorgegebenes, das zu seiner Rechtfertigung weder eines Gottes, einer reinen Vernunft oder eines ganz Anderen bedarf. Und eine solche Sicht gibt diesem Erhabenheitskonzept seinen nicht zu widerlegenden materialistischen Grundzug. Doch trotz dieser geradezu erkältenden Nüchternheit, mit der Treptow die vielfältigen Kreislaufsysteme des Kosmos und der Erde beschreibt, die auf einem „dynamisch relativen Gleichgewicht“ beruhen, das heißt sich ständig neu produzieren und dann wieder zerstören, steht hinter seiner Sehweise eine aus Schaudern und Staunen, Bewunderung und Schrecken sowie Begeisterung und Entsetzen gemischte „Ehrfurcht“, die jedem für Na- Ökologiebewußte Ästhetik... tureindrücke empfänglichen Menschen selbst beim Lesen dieses Buches Gefühle des „Erhabenseins“ oder zumindest des „Erhobenen“ einflößt. Das „Schöne“ – neben dem „Erhabenen“ meist die andere Seite früherer Naturästhetiken – wird dabei von Treptow lediglich als ein „Spezialfall“ innerhalb all der von ihm aufgezeigten Prozesse behandelt. Letztlich geht es ihm vornehmlich um den immer wieder beschworenen „Kreislauf des Lebens“, der auf jenen „Fließgleichgewichten“ beruht, wie es im Anklang an Bertalanffy heißt, die sich nicht nur im Kreislauf der Gestirne, der Luft und des Wassers, sondern auch im Kreislauf des menschlichen Blut- und Nervensystems, ja selbst in den Kreislaufsystemen der Moleküle, Zellen und Atome zu erkennen geben. Und aus dem erstaunenden Erschrecken und zugleich der vertieften Einsicht in das Ineinandergreifen all dieser Systeme resultiert letztlich Treptows Respekt vor der „ökologischen“ Struktur der Natur. Ihm genügt nicht eine verstärkte „Einfühlung“ in die Sonnenseite dieser Prozesse, die lediglich auf ein selbstbezogenes Wohlbefinden hinausläuft, er will zugleich erkennen, und zwar nicht nur die „kosmischen Kreisläufe, einschließlich der Klimageschichte und der Geomorphologie“, sondern auch die sozioökonomischen Implikationen der „Siedlungs-, Wirtschafts- und Technikgeschichte sowie der vielfältigen Stadt-Land-Beziehungen“. Dennoch läuft das Ganze nicht auf eine öde „Umwelt“-Geschichte hinaus. Natur ist für Treptow nicht nur Umwelt, sondern zugleich Welt an sich, mit anderen Worten: etwas nicht nur vom Menschen Auszubeutendes, sondern auch als Eigenwesen vom Menschen Unabhängiges, das jedem Naturbetrachter den nötigen Respekt abfordert. Zum Ernst dieser Gesinnung paßt, daß Treptow auf eine Auseinandersetzung mit der bestehenden Sekundärliteratur zum Begriff des „Erhabenen“ weitgehend verzichtet. Er erwähnt zwar einmal kurz, daß sich auf diesem Gebiet die Vertreter der „Frankfurter Schule“ und der „Postmoderne“ seit einiger Zeit philosophisch höchst geschickt sekundierten, aber dabei fast nie auf die „empirisch erfahrbare Natur“ eingingen und demzufolge „kaum oder keine ökologischen Einsichten“ entwickelt hätten. Was Treptow unter „Kritik“ versteht, ist weniger etwas Akademisches als etwas Konkretes. Er verzichtet daher auf alles bloße Wiederkäuen bereits vorgefaßter Meinungen, alles billige Polemisieren gegen Unwichtiges und bietet in seinen Argumentationsreihen, wenn er nicht gerade seine Ansichten mit empirischen Jost Hermand Fakten belegt, höchstens einige bedeutsame philosophische oder literarische Kronzeugen auf, deren Werke seiner Sehweise ein größeres Gewicht geben sollen. Was also „Akademiker“ an diesem Buch vermissen werden, ist der sogenannte letzte Stand der Forschung. Doch den fordern meist nur solche Theoretiker, die immer noch nicht eingesehen haben, daß es auf gewissen Gebieten – wie dem der Ökologie – wegen der Zündkraft der hier auf der Tagesordnung stehenden Themen, weniger ein gemächliches Fortschreiten als eine Zunahme ideologischer Polarisierungen gibt, die jeden ernsthaften Philosophen zu klaren Entscheidungen herausfordern. Und solchen Entscheidungen stellt sich Treptow durchaus, nur daß er seine Kritik nicht auf irgendwelche akademischen Kollegen einschränkt, sondern auf zwei wesentlich größere Phänomene konzentriert: 1. aus die naturtranszendierende Sicht der monotheistischen Religionen und ihrer Säkularisierungen ins Idealistische oder Romantische sowie 2. auf die überflüssige Produktionssteigerung im Zuge der immer hektischer akzelerierten Kapitalvermehrung. Über die verhängnisvolle Rolle der naturtranszendierenden Religionen im Bereich des Monotheismus verliert Treptow nicht viel Worte. Das ist bereits oft erörtert worden. Um so interessanter und entschiedener ist seine Kritik an der Allegorisierung und damit Verflüchtigung der Natur im Bereich der romantischen Literatur, die oft als besonders naturverpflichtet hingestellt und dementsprechend gepriesen wird. Treptow sieht in einer solchen Allegorisierung eher eine verfehlte Gleichsetzung des Unbewußten psychischer Prozesse mit dem Bewußtlosen der Natur, wie es sich bei Novalis und Schelling beobachten läßt, wo das wahrhaft „Erhabene“ meist erst das Göttliche hinter der Natur ist, während ihnen die Natur selber eher als „abgefallen“ oder „unerlöst“ erscheint, weshalb Novalis in der prosaischen Welt von Goethes Wilhelm Meister einen „künstlerischen Atheismus“ zu konstatieren glaubte. Um so ausführlicher geht Treptow dagegen auf die naturzerstörerischen Auswirkungen der durch den forcierten Hang zur Kapitalvermehrung entstandenen Ausweitung des Fabrikwesens ein. Schließlich sei es erst dadurch zu Eingriffen in jene „erhabenen“ Naturkreisläufe gekommen, die zwar schon vorher viele sich selbst korrigierende Veränderungen durchgemacht hätten, aber erst durch die mit der Industrialisierung verbundene Ausplünderung aller natürlichen Rohstoffe in Gefahr geraten seien, sich nicht wieder in dem Sinne erneuern zu können, wie es für ein Weiterbestehen des Ökologiebewußte Ästhetik... Menschen auf Erden erforderlich wäre. Treptow wird daher nicht müde, immer wieder auf jenen zerstörerischen und vergiftenden Umgang mit der Natur hinzuweisen, der lediglich von kommerziellen Interessen gelenkt werde. Sein besonderes Augenmerk gilt dabei den durch die gesteigerte Radioaktivität, die Grundwasserverseuchung, die Gentechnik, die „Eroberung des Weltalls“, die Vergroßstädterung, die Zerstörung der Gebirge sowie die ständige Vermehrung der durch die Fabriken erzeugten Schäden. Wohin man auch blicke, überall stehe die Industrie in der Natur wie „eine Besatzungsmacht im Feindeslande“, wie es schon bei Ernst Bloch heißt. Und Treptow zeigt zugleich, wie stark die heutige Meinungsindustrie diese Vorgänge im Dienst der großen Konzerne mit einem glamourösen Medienflimmer zu überblenden versuche, der sich an der Inszenierung der „Politik-Szene“, den „Reklame-Methoden der ökonomischen Werbung“ und dem „aufdringlichen Showbusiness“ orientiere, um so die Mehrheit der Bevölkerung von der eklatanten Rohstofferschöpfung, der Massenarbeitslosigkeit, der Gefahr neuer Ölkriege im Nahen Osten, der Zunahme der radioaktiven Strahlung sowie der Ausweitung des Ozonlochs abzulenken. So gesehen, korrespondierten sogar jene akademischen „Wahrnehmungs“Spekulationen, die in vielen Fällen – wie die Bilderflut der Massenmedien – einen begriffslosen Sensualismus unterstützten, durchaus mit den herrschenden Konzernideologien. In diesem „zwanghaften“ Kreislauf der ständigen Kapitalvermehrung, lesen wir immer wieder, in dem das sozialdarwinistische Prinzip des „survival of the richest“ herrsche, das heißt wo es keinen anderen Anreiz als den des „Vermarktungszwangs“ mehr gebe, komme es notwendig zu einer fortschreitenden Depravierung der Natur, der man endlich mit einer scharfen Kritik an der „Schranken- und Grenzenlosigkeit“ des heutigen Wirtschaftssystems entgegentreten müsse, in dem fast ausschließlich das Quantitative im Vordergrund stehe und das im Rahmen der damit korrespondierenden, ebenso zwanghaften Spaßkultur auf erhabene Phänomene wie „Staunen, Erschauern, Rührung oder Ehrfurcht“ nur noch negativ oder klischeehaft reagiere – oder das Erhabene in den Bereich des Horrors und Fanatismus herabziehe. Ebenso nüchtern wie diese Kritik sind alle Hinweise auf eventuelle Gegenmaßnahmen, die Treptow vorbringt. Dazu gehören vor allem seine Kritik an dem „exzessiven Konsumverhalten“ der wohlverdienenden Minderhei- Jost Hermand ten in der Ersten Welt, seine Forderung einer „nachhaltigen“ Landwirtschaft, sein Protest gegen die kommerzielle Übernutzung der Berge durch die „Sport- und Tourismusindustrie“, sein Programm des Artenschutzes sowie sein Eintreten für Ökosteuern, Tempolimits, Smogverordnungen und eine alternative Stromerzeugung. Doch Treptow weiß zugleich, daß solche Vorkehrungen die Zunahme der durch den Kapitalismus geförderten Naturzerstörungen allenfalls verlangsamen, aber nicht aufheben können. Wirklich verhindern könne man sie nur dann, wie er schreibt, „wenn an die Stelle der verselbständigten Produktivitätssteigerungen eine Naturaneignung tritt, die bewußt geplant und demokratisch organisiert wird“. Und das, wenn man es konsequent zu Ende denkt, läuft letztlich auf die „Überwindung“ des marktwirtschaftlichen Sozialgefüges durch eine kollektive Organisation der Produktionsverhältnisse und damit auf einen Ökosozialismus hinaus, wie er heute beispielsweise in den USA von Victor Wallis und John Bellamy Foster, in Indien von Saral Sakar, in Frankreich von der AttacBewegung wie auch von vielen Globalisierungsgegnern in fast allen Ländern der Erde gefordert wird. All solchen Gedankengängen werden ökologiebewußte Leser- und Leserinnen sicher mit steigender Zustimmung folgen. Erst gegen Ende seines Buches bekommt man als Grüner plötzlich Bedenken, ob Treptows Argumentationslogik nicht ein grundsätzlicher Widerspruch zugrunde liegt. Schließlich beruft er sich einerseits immer auf jene „erhabenen Kreisläufe“ innerhalb des kosmischen und des irdischen Geschehens, die er als „unverfügbar, unverletzbar und unantastbar“ hinstellt, die also trotz aller Zerstörungen dennoch die Kraft besäßen, sich „unaufhörlich zu erneuern“, während er andererseits ständig die kapitalistische Industrieausweitung angreift, deren Auswirkungen so schädlich seien, daß sie Teilen der Natur keine Chancen zu einer nachhaltigen Regeneration erlaubten. Dies sieht auf den ersten Blick wie eine Aporie aus, die manchen seiner Argumente ihre Schlagkraft raubt. Aktivistisch eingestellte Grüne werden daher für viele seiner neuen Einsichten in die universalen Kreisläufe der Natur sicher dankbar sein, aber bedauern, daß ihnen keine wirklichen Handlungsanleitungen an die Hand gegeben werden. Im Gegensatz dazu werden sich eher ästhetisch ausgerichtete Naturphilosophen und -philosophinnen, die von dem Ganzen sophistisch verfeinerte Konzepte einer neuen Ökokunst erwarten, sicher an den vielen materialistischen Ableitungstheorien stören. Ökologiebewußte Ästhetik... Aber diese scheinbare Unvereinbarkeit hat durchaus Methode. Statt die Leser und Leserinnen seines Buches lediglich zu einem verstärkten Engagement im Sinne einer größeren Naturschonung aufzufordern oder ihnen lediglich den Rat zu geben, sich in eine „erhabene Einsamkeit“ zurückzuziehen und die Kreisläufe des ewigen Entstehens und Vergehens als etwas Naturgegebenes zu akzeptieren, fordert sie Treptow letztlich zu einer Haltung auf, die in beiden dieser Einstellungen etwas Positives sieht. Dieses Buch enthält daher keine naturverklärende Utopie einer „heilen Welt“, wie es sich für einen dialektisch denkenden Materialisten ohnehin nicht geziemen würde, sondern konfrontiert uns mit dem aufrüttelnden Paradox, im Hinblick auf die Natur neben unserer direkten Anteilnahme an ihr nie die ebenso wichtige Perspektive zu vergessen, selbst unsere alltäglich vorhandene „Mitwelt“ stets sub specie aeternitatis zu betrachten, ja diese beiden Sehweisen aufs Engste miteinander in Beziehung zu setzen. Im Gegensatz zu William Morris oder anderen „grünen“ Utopikern, die ihren Ökosozialismus häufig mit der Forderung nach einer neuen, die Natur überbietenden und zugleich schönheitssüchtigen Kunst verbanden, geht es also in diesem Entwurf einer ökologischen Ästhetik eher um aus der empirisch vorgegebenen Realität abgeleitete ästhetische Konzepte. Ein einseitiges Bekenntnis zur „Schönheit“ wäre für Treptow kein revolutionäres Programm. Er fordert nicht Schönheit, sondern Schonung, und zwar eine Schonung, die nur durch die Reduzierung, wenn nicht gar Beseitigung des kapitalistischen Wirtschaftssystems zu erreichen ist. Sein Denken wendet sich daher in erster Linie gegen jenes kalte ökonomische Nutzungsinteresse an der Natur, das zu einer Respektlosigkeit gegenüber den „erhabenen Kreisläufen“ innerhalb des Kosmos sowie hier auf Erden geführt habe, welche ideologisch mit jener postmodernen Beliebigkeit korrespondiere, die keinerlei Maßstäbe für ein erhabenes Betrachten und damit eine schonende Ehrfurcht vor der Natur mehr besitze. In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 49-67 Autor: Norbert Walz Artikel Norbert Walz Die Erlösung der Natur Existenzphilosophische Notizen anlässlich von Treptows ökologischer Ästhetik Elmar Treptow hat mit Die erhabene Natur1 einen äußerst interessanten Entwurf zu einer ökologischen Ästhetik vorgelegt. Sein Buch kann als Kontrapunkt zu einem modischen Kulturalismus verstanden werden, der, wie z.B. das (post-)strukturalistische Denken, nahezu alle gesellschaftlichen und natürlichen Phänomene in sprachliche Beziehungen und Kategorien auflösen will. Demgegenüber betont es den objektiven, aller subjektiver „Brechung“ vorgelagerten Primat der Natur, der in der philosophisch-politischen Literatur unterzugehen droht. Treptows Entwurf überschneidet sich in der Problemstellung mit etlichen meiner eigenen Überlegungen zu naturphilosophischen Themen, wobei sich für mich allerdings nicht die Ästhetik, sondern die Ethik (insbesondere die ökologische Ethik) und politische Philosophie der Neuzeit als Bezugspunkt der Diskussion ergab. In meinem Beitrag möchte ich daher das Thema „Natur“ zunächst über die ethische Problematik des Umgangs mit der Natur diskutieren, um dann diesen Zugang mit Treptows Entwurf in Beziehung zu setzen. Dabei soll vor allem deutlich werden, warum für mich der Rekurs auf existenzphilosophisches Denken, das ja bekannterweise von Hegels Kritiker Sören Kierkegaard seinen Ausgang nahm, unverzichtbar erscheint und sowohl ökologische Ethik und Ästhetik auf existenzphilosophische Kategorien verwiesen bleiben. Das holistische Denken 1 E. Treptow: Die erhabene Natur. Entwurf einer ökologischen Ästhetik, Würzburg 2001. Norbert Walz In einer seiner ersten Erzählungen rollt Jostein Gaardner die Geschichte von Johnny Pedersen auf, der eines Vormittags unvermittelt die Diagnose einer unheilbaren Krebserkrankung mitgeteilt erhielt.2 Daraufhin überkam diesem Mann eine unvorstellbare Wut, die er in einem Porzellanladen, an dem er zufällig vorüberging, abreagierte: Kurzerhand schlug er alles Porzellan und Kristall, das in diesem Laden zum Verkauf auslag, in abertausende Scherben. Pedersen wurde wegen Vandalismus angeklagt und verteidigte sich vor Gericht selbst. Nach dem Motiv seiner Tat gefragt, gab er zur Antwort, dass er ein Zeichen gegen den Tod setzen wollte: Das Leben kann nicht einfach so weitergehen, wenn die brutale Kontingenz des Lebens, das den Tod billigend in Kauf nimmt, zuschlägt. Die Harmonie der Vasen in Reih und Glied, die im Porzellanladen standen, habe er mit der Disharmonie des Lebens „beantwortet“. Pedersen wurde zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, starb jedoch bereits vier Wochen nach der Verhandlung in einem Krankenhaus. Diese kleine, an sich unscheinbare Erzählung hebt die Kontingenz des Lebens, ihre Zufälligkeit und Absurdität mit dem Tod als Zentrum nachdrücklich ins Bewußtsein. Zudem verdeutlicht sie die Revolte im Sinne Albert Camus' als menschliche Reaktionsweise auf die grundlegende Erfahrung von Kontingenz und Absurdität: „Ich empöre mich, also sind wir.''3 Was sie darüber hinaus bemerkenswert macht ist, dass Gaardner der Erzählerstimme die folgenden markanten Schlussworte in den Mund legt: „Doch wenn ich daran denke. Was in Johnny Pedersen vorgegangen sein muss, als er in den Porzellanladen stürmte wird mir klar, dass ich die Natur verharmlost habe. Die Natur befindet sich nicht in göttlicher Harmonie. Die Natur liegt im Streit mit sich selbst.“4 Das ist natürlich ein Affront gegen ein religiös-(pan)theistisches Welt- und Naturverständnis, wird doch durch ein solches die Faktizität des Todes schlichtweg harmonisiert, indem man den Tod – auf welche Weise auch immer – vorschnell als „Heimkehr“, als „Wiedervereinigung mit dem Ursprung“ etc. interpretiert. Der Tod verliert hierdurch enorm an Schrecken, 2 Vgl. J. Gaardner: Der Mann, der nicht sterben wollte, in: ders.: Der seltene Vogel, München 1997. 3 A. Camus: Der Mensch in der Revolte, in: derselbe: Unter dem Zeichen der Freiheit, Reinbek 1985, S. 146. 4 J. Gaardner, ebd., S. 157. Die Erlösung der Natur da er als „sinnvoller“ Bestandteil des Lebens erscheint und ein Weiterleben nach dem Tod garantiert wird. Hand in Hand damit geht oftmals eine Verharmlosung der Natur5 – ihrer Gewalten, ihrer Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, ihrer „Launen“: Ein solches Welt- und Naturverständnis kehrt die Schatten- und Nachtseiten der Natur unter den Tisch, da die Natur unkritisch nur positiv dargestellt und als solche zum universellen Maßstab erhoben wird. Auch das holistische Denken (von griech. „holon“ = das Ganze) in der Ökologie, in der (neuen) Naturphilosophie und -ethik, in der Systemtheorie und im New Age weist eine dem religiös-(pan-)theistischen Welt- und Naturverständnis analoge Verharmlosung und Harmonisierung der Natur auf, da es dort um die Betonung der übergeordneten Zusammenhänge und Strukturen des Ganzen gegenüber dem Einzelnen bzw. dem einzelnen Organismus geht. So wahr und berechtigt diese Zusammenhänge auch sein mögen, so fällt doch das Individuum (von lat. „individuus“ = ungeteilt) als der einzelne und unteilbare Organismus der Tendenz nach aus dem holistischen Fokus heraus. Die Benachteiligung (z.B. durch eine von Geburt an bestehende Körperbehinderung) und der Tod des Individuums sind für das holistische Denken insofern kein Thema, als es das Individuum in (neuen) Ganzheiten aufgehen lässt, das Ganze (Population, Spezies, System, Volk, Geist ...) und seine Reproduktion also über das Einzelne stellt. Neben der existenzphilosophischen Betonung des Einzelnen durch Kierkegaard (auf die noch näher einzugehen sein wird) ist hier durchaus an die wichtige Kritik Poppers6 an Platons und Hegels Ganzheitsdenken zu erinnern, ohne freilich im Einzelnen Kierkegaards oder Poppers Ausführungen teilen zu müssen. 5 Unter „Natur“ soll hier in Anklang an Aristoteles' klassischer Definition (Physik 2, 1. 192 b8, 14 ff. und andere Stellen) alles verstanden werden, was „von sich aus“, d.h. ohne Wirken der Menschen, vorhanden ist und sich von selbst entwickelt und verändert. Dazu kann auch die „innere“, menschliche Natur gezählt werden, da sie wie bei den Trieben oder beim Körper ein tierisches Erbe darstellt. Der Eingriff des Menschen in die Natur in der hochtechnisierten Moderne lässt freilich eine „Natur an sich“ weitestgehend verschwinden, die noch der Hintergrund für das antike Verständnis war. Dennoch macht die aristotelische Definition bis jetzt und für heute Sinn, da die (Bio-)Technik in einer realistischen Sichtweise, an die vom Menschen physikalischen Naturgesetze gebunden ist, also zwar die „Erscheinungsformen“ von Natur verändern, aber deren gesetzmäßige „Strukturen“ nicht aufheben kann. – Vgl. E. Treptow, ebd., S.59 ff. 6 Vgl. K.R. Popper: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. 2 Bände, München 1975. Norbert Walz Die rasante Verbreitung des holistischen Denkens in der Ökologie wie in der (neuen) Naturphilosophie im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts war und ist eine sinnfällige Reaktion auf die fortlaufende Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit. Wie bereits oftmals herausgestellt wurde, erscheint Natur erst dann als Problem (auch in der Theorie), wenn sie nicht mehr „natürlich“ vorausgesetzt werden kann, wenn sie bereits mehr oder weniger zum Reservat oder zum Fragment geworden ist. Ozonloch, Klimaveränderung, Toxikation der Nahrung für Mensch und Tier, Fortschrittszweifel im ökonomischen Kontext von Neoliberalismus und Globalisierung, eine tiefgreifende Skepsis insbesondere in den Industrienationen an den „Segnungen“ der naturwissenschaftlichen Technik (Gentechnologie, Risiken der Kernenergie u.a.) sind in erster Linie als problemkatalysatorische Faktoren zu nennen, die maßgeblich zur Ausbreitung und Vertiefung der holistisch-ökologischen Ansätze geführt haben. Die Natur- und Weltsicht der Aufklärung, die einerseits eine omnipotente Beherrschbarkeit des Menschen der Natur gegenüber, die als feindliche, zu bezwingende Macht verstanden wurde, unterstellte, andererseits die Natur künstlich isolierte und segmentierte, entwickelte sich in dem Maße zunehmend zur Angriffsfläche, als die aufgeklärt- technisierte Zivilisation ihre blinden Flecken offenbarte. Insofern stellt das holistische Denken nur eine Reaktion auf die Desillusionierungen dar, die die Aufklärung (zumindest in der westlichen Welt) hinterlassen hat. Die Wiederaufnahme eines „ganzheitlichen“ Denkens kann dabei an Ergebnisse aus früheren Perioden anknüpfen, so z.B. an antike und mittelalterliche All-Einheitslehren, an die Mikrokosmos-Makrokosmos-Analogie des Paracelsus und der Alchemie wie an die Naturphilosophie der deutschen Klassik (Goethe) und Romantik (Schelling, Novalis). Insbesondere mit letzterer hat das aktuelle holistische Denken gemein, dass es um eine theoretische Einholung einer intuitiv erlebten Einheitserfahrung geht, die in Konkurrenz zur quantifizierend und isolierend vorgehenden mathematischen Naturwissenschaft (eine Schöpfung der Aufklärung!) aufgestellt wird. Sowohl das aktuelle holistische Denken wie die romantische Naturphilosophie sind beide Antworten auf ein Erstarken und Vordringen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisform und gesellschaftlichen Praxis, die nur mehr fragmentarisierte Naturerfahrung zulässt. Ökologische Ethik und die Frage nach dem Sinn Die Erlösung der Natur Es ist hier demnach eine Ambivalenz des holistisch-ökologischen Denkens festzuhalten: Einerseits ist es gegen die Zerstückelung, Isolation und Fragmentierung der Naturphänomene durch die mathematischen Naturwissenschaften gerichtet, andererseits liegt jedoch mit der Wiederbelebung der Ganzheitlichkeit eine Subsumtion des Einzelnen unter das Ganze nahe, die sich z.B. auch darin ausdrücken kann, den Wert des Individuums an seinem Beitrag für das Ganze der Gesellschaft bzw. des Staates zu bemessen. Einer solchen sozial-ökologischen Sichtweise ist nicht zu Unrecht „Ökofaschismus“ vorgeworfen worden.7 An der ökologischen Ethik (auch Naturethik genannt), die im Zuge der Rehabilitierung der praktischen Philosophie bzw. des „Ethikbooms“ der letzten Jahre, im philosophischen Diskurs der Gegenwart hervorgetreten ist, kann besonders prägnant die Ambivalenz des holistisch-ökologischen Denkens und die mit ihm verbundenen Gefahren problematisiert werden. Gefordert wurde von der ökologischen Ethik hauptsächlich ein „Paradigmenwechsel“ in unserem Verhältnis zur Natur. Ehrfurcht vor dem Eigenwert der Natur und Abkehr von der anmaßenden Haltung, sie als eine bloße Ressource zu betrachten, waren die zwei wichtigsten normativen Botschaften der ökologischen Ethiker. John Passmores Man's Resposibility for Nature (1974) und Peter Singers Animal Liberation (1975) bildeten im angloamerikanischen Sprachraum die ersten Zeugnisse dieses Perspektivenwandels. In Deutschland bestimmte Hans Jonas' Das Prinzip Verantwortung (1979) die frühe ökoethische Diskussion. Inzwischen hat sich eine Vielfalt von Positionen etabliert, die von einem gemäßigten Pathozentrismus (Singer, Regan, Birnbacher u.a.) bis zu einem radikalen Physiozentrismus (Leopold, Callicott, Naess u.a.) reichen. Geht es dem Pathozentrismus („pathos“ = Leiden) um die Einbeziehung aller empfindungsfähigen Wesen in das moralische Universum, da alle empfindungsfähigen Wesen einen eigenen moralischen Wert besitzen, so radikalisiert der Physiozentrismus („physis“ = Natur) bzw. Ökozentrismus („oikos“ = Haushalt) diese Perspektive, indem er den moralischen Eigenwert auf die Natur als Ganzes ausdehnt. Allen Strömungen der ökologischen Ethik ist jedoch gemein, dass sie sich von einem einfachen Anthropozentrismus ab- 7 Vgl. K. Ott: Moralbegründungen zur Einführung, Hamburg 2001, S. 186. Norbert Walz setzen, demzufolge nur der Mensch einen eigenen moralischen Wert hat und die Natur nur für ihn da ist. Die erste und breit diskutierte „Grenzüberschreitung“ vom Anthropozentrismus zum Pathozentrismus löste Singers Neudefinition des Personenbegriffs aus. Das „revolutionär“ Neue daran war, dass Singer die Merkmalszuschreibung „Person“ von der Spezies Mensch ablöst – Menschen sind demnach nicht „automatisch“ (von Geburt an bzw. weil sie nur der Spezies Mensch angehören) Personen. Sie sind es nur in Bezug auf die Merkmale Rationalität, Ich- und Zeitbewusstsein wie Empfindungsfähigkeit, die an das Vorhandensein eines intakten und ausgebildeten Nervensystems gekoppelt sind. Da letztere drei Kriterien auch auf bestimmte Tiere (v.a. auf höhere Säugetiere wie Menschenaffen und Delfine) zutreffen, sind deshalb alle Tiere Personen, die den drei Kriterien genügen. Nach Singer gibt es demnach Menschen, die keine Personen sind, weil ihnen z.B. bei dem Gen-Defekt Trisomie 21 Rationalität abgesprochen werden muss, wie auch Tiere existieren, die eindeutig zur Klasse der Personen zu zählen sind. Individuen teilen sich Singer zufolge auf in Personen und empfindungsfähige Wesen, d.h. Wesen, denen die personalen Merkmale fehlen, die aber Leid und Freude empfinden können. Personen haben ein Interesse am Weiterleben, da sie ein Ich- und Zeitbewusstsein besitzen und deshalb „Entwürfe“ über ihre Zukunft gestalten können – für sie besteht ein absolutes TötungsVerbot. Nur ein relatives Tötungs-Verbot gilt hingegen für empfindungsfähige Wesen: Zwar verlangt der pathozentristische Ansatz Singers die Berücksichtigung der Interessen von empfindungsfähigen Wesen am Vorhandensein von Glückszuständen in gleicher Weise wie die Berücksichtigung der Interessen von Personen, doch kann die potentielle Tötung eines empfindungsfähigen Wesens (z.B. eines schwer geistig behinderter Säuglings) dann gerechtfertigt sein, wenn sein zu erwartendes Leid sein zu erwartendes Glück übersteigt und durch das Glück eines anderen gesunden Säuglings (der noch keine Person ist!) „überkompensiert“ wird. Hier ist nicht der Ort die ganze Problematik von Singers pathozentristischen Ansatz, der überdies eine Modifikation des klassischen Utilitarismus von Bentham, Mill und Sidgwick darstellt, aufzurollen.8 Wie oft liegen Grö- 8 Singer versucht mit seinem Präferenz-Utilitarismus das Desiderat einer fehlenden Gerechtigkeitstheorie des klassischen Utilitarismus auszufüllen. Sein „Prinzip der gleichen Die Erlösung der Natur ßen und Grenzen eng beieinander. Obwohl Singer mit dem „Ersetzbarkeits-Argument“, demzufolge alle empfindungsfähigen Wesen ersetzbar seien und ihre Tötung durch „Überkompensation“ gerechtfertigt ist, seinen Vorstoß zum Pathozentrismus relativiert (als weitere Kritikpunkte lassen sich z.B. die Willkürlichkeit seiner Einteilung von Personen und empfindungsfähigen Wesen wie seine spekulative „pain-und-pleasure-Bilanzierung“ anführen), so ist es ihm dennoch als großes Verdienst anzuerkennen, mit seiner integren Einbeziehung nicht-menschlicher Lebewesen in den Kreis der moralischen Subjekte, deren Interessen zu berücksichtigen sind, eine „Revolution“ innerhalb der Ethik vollzogen zu haben. Radikale „Lebensschützer“, die Singer gerade in Deutschland immer wieder niederbrüllten bzw. seine Vorträge verunmöglichten, sollten bedenken, dass Singer sich öffentlich für Tierschutz und gegen Massentierhaltung, Tierexperimente und industrial food einsetzte, als dies allenfalls in esoterischen Zirkeln diskutiert wurde – schützenswertes Leben ist eben nicht auf menschliche Embryos beschränkt! Singers Pathozentrismus hebt die biologisch-evolutionären Zusammenhänge zwischen Tier und Mensch hervor und ist somit „ganzheitlich“ auf Gemeinsamkeiten der Lebewesen und gegen ihre artifizielle Isolierung durch die naturwissenschaftliche Erkenntnisform, der Singer „Speziezismus“ vorwirft, gerichtet, ohne dabei einen radikalen Holismus einzunehmen und die Interessen des Individuums aus dem Blick zu verlieren. Ein radikaler Holismus wiederum wird vom Physiozentrismus bzw. Ökozentrismus vertreten, demzufolge die Natur als Ganzes einen moralischen Eigenwert besitzt. Der ganze Oikos, das ganze Erdhaus ist hier zu berücksichtigen, also auch alle Pflanzen, alle Steine, die Gebirge, die Seen und der Wüstensand. So entwarf z.B. die „Land Ethic“ von Aldo Leopold als oberstes Ziel die Identifikation mit der Gemeinschaft des „lands“, des jeweiligen Ökosystems, da nach Leopold das Individuum (Boden, Wasser, Pflanzen, Tiere, Menschen) nur Teil des Ökosystems und deshalb das Ökosystem und nicht das Individuum das moralische Subjekt sei. Ähnlich holistische Sichtweisen und Argumentationen finden sich in der „Tiefenökologie“ (Naess, Sessions u.a.) und im „Ökofeminismus“ (Merchant, Mies u.a.). Der neuralgische Punkt ist hier nicht, dass der Anthropozentrismus der neuzeitInteressensabwägung“ erstreckt sich auf die Interessen aller Individuen. Vgl. P. Singer: Praktische Ethik, Stuttgart 1993. Norbert Walz lichen Aufklärung verabschiedet und der Mensch in seiner Abhängigkeit und Interdependenz mit dem jeweiligen Ökosystem bzw. der ganzen Natur verstanden wird. Problematisch und gefährlich ist vielmehr der falsche Harmonismus, der im holistisch-ökologischen Denken wirksam ist und aufgrund dessen Ökosysteme wie Symphonieorchester erscheinen: Das Einzelne und Gute der Instrumente geht im Ganzen des Orchesters auf.9 Im Kern ist dieser holistische Harmonismus faschistoid, da er sich substanziell nicht vom Leitprinzip: „Du bist nichts, dein Volk ist alles!“ unterscheidet – wobei freilich nicht Autoren und Autorinnen wie Leopold und Merchant in die Nähe einer faschistischen Ideologie gerückt werden sollen! Mit dem falschen Harmonismus geht demnach ein Positivismus der Natur einher, demzufolge die Natur in nur positivem Licht erscheint. Wie bereits erwähnt, werden nämlich bei solch einem holistisch-ökologischen Denken die Schatten- und Nachtseiten der Natur ausgeblendet, so dass z.B. der Tod des Individuums (egal ob Pflanze, Tier oder Mensch) als „sinnvoller“ Bestandteil des Lebens erscheint, da er zur Reproduktion der Ökosysteme (Gleichgewicht der Kreislaufsysteme), also zum Ganzen, beiträgt. Goethes „Stirb und werde!“ ist hier nicht ganz deplaziert, wobei die „Todesverklärung“ in Selige Sehnsucht den inneren Wandlungsprozess beschreibt und somit der „Tod“ im Sinn eines Abschlusses einer Stufe der irdischen Vervollkommnung gemeint ist.10 Alle subjektiven Schmerzen, alles Leid, welche der Tod für die Individuen auslöst, bleiben dabei unerwähnt! Für das holistisch-ökologische Denken besteht keine Absurdität des Lebens, weil es das Leben „apriori“ in einen Sinnzusammenhang einordnet, dieser Sinnzusammenhang jedoch vollständig aus der Analyse der natürlichen Kreisläufe entnommen ist. Es ist dies der einer „formalen“ Reproduktion des Ganzen: Der Teil ergibt nur Sinn im Hinblick auf den Fortbestand des Ganzen. Hier findet aber ein naturalistischer Fehlschluss11 statt, denn unbemerkt wird von der deskriptiven (wissenschaftlich-ökologischen) Ebene auf eine normative (wertend-interpretatorische) Ebene gewechselt. Die „natürliche“ Tatsache 9 Vgl. A. Krebs: Naturethik im Überblick, in: dies. (Hg): Naturethik. Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion, Frankfurt/Main 1997, S. 363. 10 Vgl. K.O. Conrady: Goethe. Leben und Werk. 2. Teil, Frankfurt/Main 1985, S. 393 ff. 11 Die Lehre vom naturalistischen Fehlschluss, also vom unzulässigen Übergang vom Sein zum Sollen geht auf Hume zurück und wurde in der angelsächsischen Meta-Ethik (Moore, Hare, Frankena u.a.) neu aufgegriffen. Die Erlösung der Natur der formalen Reproduktion wird als menschliche Sinnperspektive allein gewertet. Dies impliziert, dass der kulturellen Evolution bzw. Sphäre (alles, was der Mensch in seinem Stoffwechselprozess mit der Natur hervorgebracht hat) wenig oder gar keine Beachtung geschenkt wird. Nur von der kulturellen Sphäre aus ist aber eine Distanz zur Natur möglich, nur von der kulturellen Sphäre aus kann sich das sentiment de l'absurde (Camus) einstellen: Nicht der „sinnvolle“ Tod im Hinblick auf die natürlichen Kreisläufe steht hier zur Diskussion, sondern mein ganz individueller Tod, das Ende meines Lebens, das Ende allen Lebens, das vernunftwidrig, das absurd ist, weil es keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn gibt: „Das Absurde entsteht aus der Gegenüberstellung des Menschen, der fragt und der Welt, die vernunftwidrig schweigt.“12 Man könnte dies auch mit der folgenden Frage ausdrücken: Wenn also „zugegeben“ der Tod Sinn für die Reproduktion des Ganzen macht, was macht dann aber die Reproduktion des Ganzen für einen Sinn? Diese Frage, die unbeantwortet bleiben muss und daher das Gefühl der Absurdität hervorruft, stellt sich nur von der kulturellen Sphäre aus, sie ist für „reine“ Natursubjekte nicht formulierbar. Ein Gefühl des Absurden stellt sich zudem aus einem anderen triftigen Zusammenhang ein. In Analogie zum naturalistischen Fehlschluss besteht in der Übernahme des Sinnzusammenhangs aus den natürlichen Kreisläufen ein unzulässiger Übergang von Natur- Konstanten bzw. Faktizitäten zur Interpretation dieser Faktizitäten. Im Wesentlichen können vier für Menschen von Beginn der Anthropogenese an wahrnehmbare biologische Faktizitäten unterschieden werden, die als kultur- und zeitinvariante Konstanten die Natur durchziehen und gestalten: Geburt, Tod, Zirkel des Fressens und Gefressenwerdens und ungleiche genetische Ausstattung (physisch, mental, psychisch). Allem modischen „Interpretationismus“ zum Trotz, demzufolge es nur Interpretationen geben soll und keine sie stützenden Fakten, sind dies Faktizitäten, die durch die verschiedenen historisch-relativen Auslegungen hindurch erkennbar sind. Interpretationen als integraler Bestandteil von Religionen, Weltanschauungen, Philosophien, Wissenschaften und dem common sense sind demgemäß „Sinn-Kleider“ (Husserl), die die Faktizitäten mit einer über sie hinausweisenden, deskriptive wie normative Elemente 12 A. Camus: Der Mythos von Sisyphos, Reinbek 1959, S. 29. Norbert Walz zugleich enthaltenden Bedeutung behaften. Zwar ist die Behaftung von Bedeutungen unumgänglich mit der menschlichen Sprache verzahnt und insofern ist mit der Sprachfähigkeit des Menschen gleichursprünglich seine Bedeutungsgebung als anthropologische Konstante gesetzt. Analytisch lässt sich jedoch Bedeutung und Faktizität (oder Interpretation und Interpretandum) voneinander abtrennen, so dass z.B. im Fall des Todes auf einer analytischen Ebene zwischen der biologischen Faktizität des Todes und seiner Bedeutung (für das Leben, die Umwelt, das Individuum, die Hinterbliebenen ...) unterschieden werden muss. Religiös-(pan)theistische Welt- und Naturerklärungen interpretieren den Tod idealtypisch als Tor zu einer anderen Welt, zum Jenseits, zu Himmel und Hölle oder zu einem erneuten irdischen Leben. Dass aber der Tod ebenso ein unwiderrufliches Ende für das Individuum bedeuten kann, ist historisch gesehen eine relativ „junge“ Interpretation – sieht man vom antiken Materialismus ab. Sie ist Folge des Säkularisations-Schocks der europäischen Aufklärung: In der Aufklärungsbewegung wird erstmals von mehreren Seiten gleichzeitig (und nicht wie bisher bloß vereinzelt) die These behauptet, dass jenseitige Vorstellungen irdische Projektionen darstellen (französische Aufklärer, Feuerbach, Marx) und dass die angeblich „unsterbliche Seele“ nichts weiter als eine naturwissenschaftlich erklärbare „Funktion“ des somatischen Apparats sei. Mit dem somatischen Tod sei also auch der Tod des Seele als „psychischer Apparat“ (Freud) besiegelt. Interpretationen bzw. sich aus solchen generierende Sinn-Systeme sind jedoch historisch „gebunden“, d.h. sie verweisen auf die historische Vergesellschaftung von Menschen, weshalb es auch keine von historischer Vergesellschaftung „freie“ Wissenschaft und Philosophie geben kann. Da die verschiedenen Sinn-Systeme den Tod als Faktizität je verschieden interpretieren, es aber aufgrund des historischen Theorie-Praxis-Verhältnisses keine überhistorisch gültigen Interpretationen geben kann, ist die Bedeutung des Todes nicht bestimmbar – sie bleibt radikal offen. Diese Offenheit erscheint für ein sinnsuchendes Subjekt freilich absurd, da bei jedem seiner Versuche, Boden unter den Füßen zu erreichen, dieser Boden augenblicklich weggezogen wird. Weder positiv noch negativ, sondern neutral ist aus dieser Situation die Folgerung einer interpretativen epoché zu ziehen, d.h. eine Enthaltung über die Geltung von Ausdeutungen, die die biologischen Faktizitäten durch Interpretationen und Sinn-Systeme erfahren. Das gilt für alle Sinn-Systeme Die Erlösung der Natur gleichermaßen, bedeutet aber für das religiös- (pan)theistische wie das holistisch-ökologische Denken, dass der Sinnzusammenhang bzw. die Interpretation des Todes als „Heimkehr“ bzw. als „sinnvoller“ Beitrag zur Reproduktion des Ganzen unzulässig ist. Mit anderen Worten: Tod ist Tod – ob sich jenseitige bzw. irdisch-“ganzheitliche“ Sinnperspektiven eröffnen oder nicht, dafür kann es keine Entscheidung geben. Was vom Tod sinnvoll ausgesagt werden kann, ist seine von der Bedeutung unabhängig zu betrachtenden Wirkung auf das Individuum hier und heute – nicht nur in Bezug auf den eigenen Tod wie in der eingangs zitierten Geschichte von Jonny Pedersen (Todesbewusstsein, Todesangst, Verzweiflung), sondern auch in Bezug auf den sicheren Tod aller Individuen. Dadurch aber – und das ist entscheidend! – erhält das individuelle irdische Leben einen wesentlich höheren Status zuerkannt, denn eine „jenseitige“ oder „ganzheitliche“ Perspektive, in der das Individuum „aufgehoben“ wird, bleibt dahingestellt. Das irdische Leben impliziert damit – über alle „Freuden des Daseins“ hinaus – Leiden und Absurdität. Der Einzelne und seine Existenz Die Hypostasierung des Ganzen durch das holistische Denken rief durch die abendländische Geschichte hindurch immer wieder Gegenstimmen hervor. Für unseren Zusammenhang ist hier v.a. Kierkegaards existenzphilosophische Einklagung des Individuums im Zusammenhang seiner HegelKritik hervorzuheben. Kierkegaards Begriff der Existenz, auf den die gesamte Existenzphilosophie aufbaut und im Wesentlichen unverändert lässt, ist paradoxal angelegt. Existenz ist das Verhältnis zwischen dem faktischen Sein des Menschen und den Möglichkeiten seines Seins. Indem aber die unendlichen Möglichkeiten auf endliche Grenzen stoßen, ergibt sich für den existierenden Menschen die Aufgabe einer Synthese von Endlichkeit und Unendlichkeit, was Kierkegaard als paradox bestimmt. Weitere Aspekte dieser Paradoxie der Existenz werden sichtbar, wenn man den Menschen als selbstreflexives Wesen versteht, das sich selbst zum Gegenstand haben kann. Denn hieraus erklären sich die permanenten „Aufträge“ an den Menschen, Synthesen zwischen Leib und Seele, Ewigkeit und Zeitlichkeit, Idealität und Realität sowie zwischen Allgemeinheit und Einzelheit herzustellen. Sie alle bleiben paradox deshalb, weil sie sich nicht im Hegelschen Sinn „aufheben“ lassen, also die Norbert Walz Synthesen nur scheinbar die Gegensätze zur positiven Auflösung bringen. Hegels „welthistorische Dialektik“ intendierte zudem die Aufhebung des Widerspruchs zwischen Individuum und Gesellschaft (Staat), was jedoch Kierkegaard zufolge bei Hegel eher als Negation des Individuums – seiner konkreten Existenz – hinausläuft. So stellt Kierkegaard der Dialektik Hegels (oder dem „abstrakten Denken“) seine konkrete „Existenz-Dialektik“ entgegen, denn in der welthistorischen Dialektik „schrumpfen die Individuen in die Menschheit hinein“, so dass es für diese Dialektik unmöglich ist, den einzelnen existierenden Menschen zu erkennen, selbst wenn „Vergrößerungsgläser für das Konkrete entdeckt würden“.13 Der Kierkegaardsche Einzelne bleibt jedoch Zeit seines Lebens auf die Paradoxien der Existenz verwiesen, die er nur durch fortlaufende Synthesen „bewältigen“ kann, ohne dass diese Synthesen jemals zum Abschluss kämen. Einzig im „Sprung“ in den Glauben an Gott kann der Mensch die Synthesen „beenden“ – allerdings um den Preis, dass er sich damit dem Paradox des Glaubens (der Glaube kann nicht rational gerechtfertigt werden) überantworten muss. Existenz im Sinne Kierkegaards, also die permanente Aufforderung an den Menschen sich zu entwerfen, d.h. sein Sein selbst in die Hand zu nehmen, setzt die Selbstreflexivität des Menschen voraus. Das Vermögen der Selbstreflexivität ist an seine Rationalität bzw. an sein Ich- und Zeitbewusstsein gebunden, d.h. an Merkmale von Personen, wie Singer sie versteht. Freilich wäre es nun unsinnig, allen Personen (im Verständnis Singers) Existenz zuzubilligen. Delfine entwerfen keine Möglichkeiten ihres Seins, auch wenn sie zweifellos (die neuere Verhaltensbiologie bestätigt das) ein Ich- und Zeitbewusstsein besitzen. Allenfalls bei Menschenaffen besteht hier eine Grauzone des Übergangs vom Tier zum Mensch, eine Zone, in der die Übergänge fließend sind. Der Anstoß der ökologischen Ethik zu einem erweiterten Existenzbegriff kann nicht in der Übertragung des Existenzbegriffs auf alle Personen bestehen, auch wenn dies naheliegt; der Anstoß zu einem erweiterten Existenzbegriffs besteht im Gegenteil darin, die pathozentrische Perspektive auf den Existenzbegriff insoweit zu beziehen, dass Existenz ein Leiden impliziert, welches von den biologischen Faktizitäten des Todes, der Nahrungskette und der ungleichen genetischen Ausstattung 13 S. Kierkegaard: Abschließende Unwissenschaftliche Nachschrift, 2. Teil, Düsseldorf 1957, S. 54. Die Erlösung der Natur herrührt. Bevor dies zum Abschluss skizziert werden soll, wenden wir uns zunächst Treptows Entwurf einer ökologischen Ästhetik zu. Ökologische Ästhetik und die „Trübungen“ des Schönen durch die Existenz Auch Treptow argumentiert gegen eine Harmonisierung der Natur. Sein Naturverständnis ist am Paradigma der Selbstorganisation (Eigen, Prigogine, Haken u.a.) orientiert, nach dem die Natur das Gesamt von dynamischen Gleichgewichtssystemen darstellt. Der stetige Aufbau und die Umwandlung von Gleichgewichtssystemen, also deren „Grenzüberschreitung“, hat für Treptow einen an-sich-seienden und zweckmäßigen Charakter - es ist die erhabene Natur, da sie über die Bedingungen der einzelnen Organismen und Lebensformen „erhoben“ ist, gleichsam deren Rahmenstrukturen bildet. Naturschönheit schreibt Treptow nicht dieser zweckmäßigen Natur an sich zu, sondern sie ist eine subjektiv-menschliche „Reaktion“, genauerhin ein Gefühl der Lust gegenüber bestehenden (mehr oder weniger konstanten) Gleichgewichtssystemen, die für die Menschen zweckmäßig sind. Nur die schöne Natur erregt Lust wie die Farben- und Formenpracht der Blumen oder der Gesang der Vögel: „Zweckmäßig sind die Rufe und Lieder der Vögel, indem sie der Kommunikation ... dienen. Aber als zweckmäßig und schön erscheinen sie nicht ihnen, sondern uns. Sie singen, wir freuen uns. Sie tun es, wir erleben es.“ (16) Die erhabene Natur erregt dagegen sowohl Lust als auch Unlust, ist für die Menschen sowohl schön als auch hässlich, denkt man z.B. an das bedrohliche Chaos eines Orkans, der gleichzeitig Schrecken wie Bewunderung hervorruft. Die ökologische Ästhetik hat sowohl die erhabene wie die schöne Natur zum Gegenstand, da sie die menschlichen Reaktionsweisen auf die Gleichgewichtssysteme und deren Grenzüberschreitungen (Zerstörung, Wiederaufbau) untersucht. Durch diese Differenzierungen, die sowohl die positiven wie die negativen Seiten der Natur thematisiert und in sich aufnimmt, vermeidet Treptow einerseits eine Verklärung, andererseits auch eine Dämonisierung der Natur. Die Natur als das Gesamt der dynamischen Gleichgewichtssysteme ist an sich zweckmäßig und selbständig, ihre Zweckmäßigkeit (Teleonomie) besteht jedoch nicht für den Menschen, ist nicht für den Menschen „gemacht“. Indem der Mensch durch die Arbeit Naturgegenstände umformt, also in die selbständige Natur durch teleologisches Handeln bzw. durch seine Zwecksetzungen eingreift, schafft er eine zweite kulturelle und gesell- Norbert Walz schaftliche Sphäre, die die Kreisläufe der erhabenen Natur unterbricht und zu ihnen in einem Spannungsverhältnis steht. So stehen sich sukzessive natürliche und gesellschaftliche Sphäre gegenüber – am prägnantesten dann in der kapitalistischen Gesellschaft, in der die scheinbare „Zweckmäßigkeit“ darin besteht, die Arbeitsproduktivität permanent zu erhöhen um das Kapitalwachstum auf immer steigender Stufenleiter zu garantieren (erhabener gesellschaftlicher Prozess des Kapitalwachstums). Die ökonomischen Zwänge des Kapitalwachstums löschen dabei die sinnlichen Qualitäten der Naturgegenstände der Tendenz nach aus, so dass die Naturgegenstände nur mehr als Mittel zum Zweck der Kapitalvermehrung erscheinen. Diese Realabstraktion von der Sinnlichkeit hat jedoch nach Treptow ihre Grenze in der „Anwesenheit“ der erhabenen Natur, die sich der Subsumtion unter die Imperative des Kapitalwachstums sperrt: „... durch die zwanghaften Produktivitätssteigerungen im Interesse des Kapitalwachstums werden die Lebensgrundlagen der Menschen zunehmend vergiftet und ruiniert. In diesem krisenhaften Prozess hören die Menschen nicht auf, leiblich-sinnliche Naturwesen zu sein, die auf die Aneignung der äußeren Natur angewiesen sind“ (63). Doch bereits ein einzelner Baum, der durch die Geschichte hindurch seine Selbständigkeit bewahrt, zeigt die Beharrlichkeit der erhabenen Natur an. Treptow leitet von dieser Beharrlichkeit einen Primat der Natur ab. Die gesellschaftlich überformte, aber dennoch hervortretende Sinnlichkeit der Naturgegenstände wird in der ästhetischen Tätigkeit „in ihren eigenen Maßen und Formen denkend angeschaut, was mit den Gefühlen der Lust und Unlust untrennbar verbunden ist“ (70). Da Empfinden, Wahrnehmen und Denken Momente einer Einheit darstellen, sind Denkinhalte und -prozesse bei ästhetischen Tätigkeiten nicht ausgeblendet, im Gegensatz zur Wissenschaft aber hier untergeordnet. Mit der ästhetischen Tätigkeit geht nach Treptow zugleich eine Bewertung der Gegenstände einher. Die als schön erlebte Natur impliziert dabei die Werte des Guten und Erhaltenswerten: „Sobald wir die zweckmäßige Natur als schön erleben, erweckt sie in uns den Affekt und Impuls, sie zu erhalten und zu schützen. Was schön ist, das lieben wir.“ (101) Diese Bewertung ist objektiv, da sie mit dem Selbstorganisationsprozess der Natur in ihren Kreisläufen übereinstimmt, der seinerseits eine Wertung impliziert, da er stetig neue Kreisläufe hervorbringt bzw. alte erhält. Der Abbruch von Kreisläufen, den die Menschen als für sie Die Erlösung der Natur für sie unzweckmäßig und daher als unlustvoll bzw. als hässlich, schrecklich und schmerzlich erleben, ist jedoch ebenso Teil der gesamten Bewegungsrichtung und insofern „zweckmäßig innerhalb der produktiven, zeugenden Natur“ (40). An einer Interpretation eines Gedichts von Walt Whitman legt Treptow diese Dialektik frei, welche die Empfindungen der Trauer, der Melancholie und Einsamkeit als „Formen der Unlust versteht. die das Individuum empfindet, sobald es das Unangemessene seines Lebens im Verhältnis zu den Kreisläufen der unendlichen Natur erlebt“ (41). Doch kann aus dieser Dialektik gefolgert werden, dass sich der Mensch der objektiven Bewegungsrichtung der Natur ein- und anzupassen hat, da er nur dadurch seine „nur subjektiven“ Bewertungen und Gefühle auf eine „objektive“ und insofern unhintergehbare Grundlage stellen kann? Indem Treptow trotz der aufgezeigten Dialektik diese Folgerung zieht, begibt er sich in die Nähe eines bedenklichen Naturalismus, der das Subjekt sofort wieder entlässt, das er gerade eben in seine Reflexion mit aufgenommen hat: „Je umfassender der Mensch mit den gesamten positiv-negativen Kreisläufen der Natur übereinstimmt, ohne sich auf einen Teilaspekt zu fixieren, desto objektiver werden seine subjektiven Bewertungen... Er kann sich der gesamten Bewegungsrichtung der Natur mit ihren Kreisläufen annähern, sich somit angemessen auf sie beziehen und in dieser Weise naturgemäß leben.“ (102)14 Obwohl sich diese Passage auch positiv als ein kritisches Korrektiv zu einem (post)strukturalistischen und postmodernen Kulturalismus, dem sogar – wie bei Judith Butler – das biologische Geschlecht als „Diskursprodukt“ erscheint, verstehen lässt, sehe ich hierin die kritische Schnittstelle von Treptows Konzeption. Gleichzeitig ist sie auch der Punkt, wo die Notwendigkeit existenzphilosophischer Kategorien plastisch hervortritt. Naturgemäß zu leben ist eine Forderung, die letztlich für den Menschen nicht einlösbar ist, da der Mensch Existenz hat, d.h. ein Selbstverhältnis ihm eigen und dadurch eine Distanz zu sich selbst wie zu seiner „Umwelt“ vorgegeben ist. Erst aufgrund seiner Existenz ist der Mensch fähig, Entwürfe seines Lebens zu generieren und Sinnfragen zu stellen. Als Kulturwesen gerät er in eine Distanz zur Natur, die er niemals wieder rückgängig machen kann. Nur punktuell ist eine „Verschmelzung“ mit dem Ganzen möglich, wie 14 Treptow meint an dieser Stelle wohlgemerkt keine „wölfische“ Natur, da er die „menschlichen“ Bedürfnisse nach Kooperation und Kommunikation der Natur zuschlägt – sie sind für ihn emergente Schritte der Evolution. Norbert Walz in der Ekstase durch spirituelle Praktiken, in der sexuellen Vereinigung, in der Musik und im Tanz und auch in Gruppenerlebnissen wie dem Fest, das dem Alltag und der Routine enthoben ist.15 Punktuell ist auch das ästhetische Erleben der Natur als schön möglich und ich stimme mit Treptow darin überein, dass das ästhetische Erleben der selbständigen Natur in einer Gesellschaft, die unter dem Kommando maximaler Produktivitätssteigerung steht, mehr und mehr verunmöglicht wird (vgl. S.11). Treptow weist in sehr kenntnisreichen Kapiteln und Exkursen nach, dass die Verselbständigungen des Kapitalwachstums die ästhetischen Blicke auf das Gebirge und das Meer tendenziell versperren (142 ff., 41 ff.). „Hinter“ bzw. „unter“ den spezifisch modernen Verselbständigungen macht Treptow jedoch noch weitere historische Schichten von „An-Ästhetisierungen der Natur“ (151) aus, so z.B. die naturtranszendenten Religionen, nationale Ideologien und auch die kantische Ethik. Letztere sieht im Naturschönen eine symbolische Darstellung der Vernunftidee der Freiheit, des sittlich Guten. Ohne hier in Einzelheiten gehen zu können, halte ich aber die Sichtweise des Naturschönen bzw. Erhabenen von Kant deshalb für unverzichtbar, weil sie den ambivalenten Konflikt zwischen Schönheit und Moral ausdrückt, den ich für den hier in Rede stehenden Zusammenhang in folgende rhetorische Frage kleiden möchte: Wie kann z.B. das Meer oder der Wald über ein punktuelles ästhetisches Erlebnis hinaus als schön erfahren werden, wenn – wie beim Meer – unterhalb der wahrnehmbaren Oberfläche ein bellum omnium contra omnes stetig tobt? Wie in der Musik Mozarts, in der nicht selten euphorische Passagen plötzlich und unerwartet von melancholischen „Trübungen“ eingeholt werden, so trübt der ästhetische Blick sukzessive ein, wenn bewusst wird, dass das ganze Spiel der Farben und Formen auf einen zutiefst unmoralischen Kampf um Fortbestand und Arterhaltung gegründet ist. Treptow erwähnt zwar ebenso die schreckliche Seite der Natur, aber im Verlauf seiner Argumentation, die „objektive“ Naturschönheit von ideologischen Überlagerungen freizulegen, verliert er diese andere Seite mehr und mehr aus dem Blick. Kierkegaard freilich war es, der am ausdrücklichsten dem Ästhetiker Wasser in den Wein gegossen hat. Sein Entweder-Oder (1843) lässt kein gutes Haar 15 Freud nannte diese „Verschmelzung“ das „ozeanische Gefühl“ für das er jedoch kein Verständnis hätte. Den Himmel überließ er – wie er durch eine von ihm oft zitierte Strophe von Heine zum Ausdruck brachte – „den Engeln und den Spatzen“. Die Erlösung der Natur an der ästhetischen Existenzweise. In späteren Werken wird Kierkegaard allerdings auch kein gutes Haar an der ethischen Existenzweise lassen und im religiösen „Sprung“ in den Glauben sein Heil suchen. Kierkegaard braucht jedoch nicht religiös rezipiert zu werden – zentral bleibt seine gegen Hegels Aufhebungs-Dialektik gerichtete positive Wendung der Paradoxie. Auch Kierkegaard ist Dialektiker, doch meint er gegen Hegel immer wieder das Einzelne, Individuelle, das Nicht-Aufzuhebende einfordern zu müssen, das dieser in der Synthese, im neuen „Ganzen“ aufgehen lassen will.16 Auf diese Figur von Existenz-Dialektik möchte ich die pathozentristische Perspektive der ökologischen Ethik nun beziehen. Existenz meint dann, dass mit dem menschlichen Selbstbewusstsein ein Einblick in den Biozyklus gegeben ist und dieser paradox erscheinen muss: Leben ist paradox auf den Tod bezogen, wie der Tod paradox auf das Leben gegründet ist. Den Paradoxien der Existenz im Sinne von Kierkegaard geht somit – temporal ausgedrückt – eine fundamentale Paradoxie des Lebens voraus. Sie ist allumfassend und nicht allein auf den Menschen bzw. auf ein (rudimentäres) Selbstbewusstsein beschränkt. Nicht nur Tiere fressen sich gegenseitig, auch Pflanzen führen Kämpfe um optimale Standorte und Witterungsbedingungen und auf mikrobiologischer Grundlage toben permanente Kriege z.B. in den Immunsystemen der Säugetiere. Existenz impliziert aufgrund der Vergänglichkeit des Lebens einerseits Leiden, andererseits auch Absurdität, da die alles entscheidende Sinnfrage unbeantwortet bleibt, unbeantwortet bleiben muss. Eine Interpretation der fundamentalen Lebensparadoxie ist ja aufgrund der interpretativen epoché unzulässig, so dass nur deskriptive Aussagen über die Wirkung des Lebens-Todes-Zirkel hier und heute möglich sind. Unmittelbar damit zusammenhängend ist das ebenfalls paradoxe Verhältnis, dass die Natursubjekte einen großen verbindenden Zusammenhang bilden (great chain of being), der auf Gemeinsamkeiten und Gleichheit beruht (z.B. Stoffwechsel, Anatomie, Fortpflanzung), aber die Natur diese ihre Subjekte ungleich behandelt, indem sie sie ungleich genetisch ausstattet (z.B. genetische Defekte), also ein permanentes „Lotteriespiel der Natur“ (John Rawls) stattfindet. Eine Kritik der natürlichen Ungleichheit kann nur vom kulturellen Standpunkt aus, d.h. hier vom Gleichheitsideal erfolgen. Die normative 16 Adornos Negative Dialektik zehrt zu einem erheblichen Teil von Kierkegaards Vermächtnis. Norbert Walz Gleichheit aller Menschen (vor dem Gesetz) trotz ihrer deskriptiven Ungleichheit (Hautfarbe, Geschlecht, Intelligenz, psychische Disposition ...) ist eine nicht eingelöste Forderung der zivilisatorischen Moderne, die sich mit der natürlichen Ungleichheit nicht vermitteln lässt. Schon allein deshalb ist eine allein naturalistische Begründung der Ethik bzw. Politik verfehlt. Singers „Prinzip der gleichen Interessensabwägung“ ist relevant deswegen, weil es das Gleichheitsprinzip auch auf andere empfindende Tiere ausdehnt, also nicht bloß auf das menschliche Tier begrenzt. Die pathozentrische Haltung legt schließlich die Vorstellung einer Erlösung der Natur nahe. Der Grundgedanke von Schellings Identitätsphilosophie ist die Identitätssetzung von Natur und Geist wie die „Ableitung“ der Erscheinungsformen von Natur und Geist aus dem Absoluten.17 Schelling billigt m.a.W. allen Natursubjekten Geist zu. Dieser Geist ist aber, wie Schelling in einem unübertroffenen Gedicht feststellt, „versteinert mit seinen Sinnen,/Kann nicht aus dem engen Panzer heraus/Noch sprengen das eisern' Kerkerhaus.“18 Der Geist ist eingeschlossen in den Körpern der natürlichen Produkte wie in der Produktivität der Natur als solcher (Schelling vertieft dabei die Unterscheidung Spinozas von natura naturans und natura naturata). In diesem Sinn ergreift eine existenz-pathozentrische Ethik Partei für alle Natursubjekte, die Geist besitzen (darunter fallen alle empfindungsfähigen Wesen im Sinne von Singer) und dieser Geist dem Leiden, der Vergänglichkeit und der Ungleichheit ausgeliefert ist. Bezieht der Existenzbegriff vom Pathozentrismus eine wesentliche Erweiterung (Einblick in die fundamentale Paradoxie des Lebens), so bleibt doch der Pathozentrismus auf die Existenz insoweit gegründet, als es nur Menschen möglich ist, den Biozyklus als absurd zu empfinden und mit Maßnahmen und „Haltungen“ (z.B. vegetarische Lebensweise) ihn zumindest für alle empfindungsfähigen Wesen abzumildern. – Doch kann vielleicht durch den biotechnischen Eingriff dereinst die romantische Utopie des Novalis vom „goldenen Zeitalter“ eingelöst werden, in der die „furchtbare Mühle des Todes“ beseitigt sein wird: „Bald lernte die Natur wieder freundlichere Sitten, sie ward sanfter und erquicklicher ... Allmählich fing ihr Herz wieder an, menschlich sich zu regen, 17 Die „schwarzen Kühe“ Hegels beziehen sich auf Schellings Lieblingsmetapher für das Absolute: die Nacht. Vgl. G.F.W. Hegel: Phänomenologie des Geistes, Frankfurt 1973, S. 20. 18 F.W.J. Schelling: Epikurisch Glaubensbekenntniss Heinz Widerporstens, in: Frank/Kurz (Hg.): Materialien zu Schellings philosophischen Anfängen, Frankfurt/Main 1975, S. 149. Die Erlösung der Natur ihre Phantasien wurden heitrer, sie ward wieder umgänglich und antwortete dem freundlichen Frager gern, und so scheint allmählich die alte goldene Zeit zurückzukommen, in der sie den Menschen Freundin, Trösterin, Priesterin und Wundertäterin war, als sie unter ihnen wohnte und ein himmlischer Umgang die Menschen zu Unsterblichen machte.“19 Dem wäre dann nichts mehr hinzuzufügen. Weiterführende Literatur: Karen Gloy: Das Verständnis der Natur. Zweiter Band. Die Geschichte des ganzheitlichen Denkens, München 1996. Angelika Krebs (Hg.): Naturethik. Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion, Frankfurt/M 1997. Thomas Seibert: Existenzphilosophie, Stuttgart 1997. Dietmar von der Pfordten: Ökologische Ethik. Zur Rechtfertigung menschlichen Verhaltens gegenüber der Natur, Reinbek 1996. 19 Novalis: Die Lehrlinge zu Sais, in: ders.: Werke in einem Band, Berlin 1989, S. 81. In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 68-81 Autor: Wolfgang Thorwart Artikel Wolfgang Thorwart Der moderne Künstler als gesteigerte Organisationsform der Natur. Zum Natur-, Menschen- und Kunstbegriff Lessings, Goethes und der Romantiker Als im Jahr 1764 Johann Joachim Winckelmanns Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauer-Kunst erschienen, löste diese Schrift in Deutschland eine ungeheuere Antikenbegeisterung, eine regelrechte ‚Gräkomanie’ aus. Winckelmann knüpfte in seiner Schrift an die antiken Autoren an und bestimmte die Nachahmung der Natur als das entscheidende Grundprinzip aller Kunst. Für ihn lag der unfehlbare goldene Weg zur „Nachahmung der Natur“ in der „Nachahmung der Alten“. Diese sei der einzige Weg, so schrieb er, um selbst „groß, ja wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden“.1 Winckelmanns Ansichten sind zu seiner Zeit allgemein als klärend empfunden worden. Aber der Gegenstand seiner Untersuchungen war die Geschichte der bildenden Kunst, also der Skulptur und Malerei, nicht aber der Dichtkunst. So wünschte man sich in der Folgezeit – Herder hat es ausgesprochen – einen „Winckelmann der Poesie“. Dieser sollte nun auch für den Bereich der antiken Dichtung deren grundlegende Prinzipien, Eigentümlichkeiten und Entwicklungslinien klären. Dies vor allem deshalb, weil man sich von dieser Klärung auch einen klareren Blick auf die Prinzipien der modernen Dichtung erhoffte. So, wie sich der antike Mensch vom mo1 J.J. Winckelmann: Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst, hg. v. L. Uhlig, Stuttgart 1991 (Reclam Universal Bibliothek), S. 4. Wolfgang Thorwart dernen Menschen unterscheide, so seien auch die Prinzipien der antiken und modernen Dichtung zu unterschieden. Während die antike Dichtung vor allem die Eingebundenheit des Menschen in einen Kosmos mythologischer Göttergestalten gestaltet hatte, könne sich die moderne Dichtung demgegenüber nur auf der Grundlage der modernen Subjektivität und autonomen Sittlichkeit des Individuums erheben. Im Anschluss an Elmar Treptows Entwurf einer ökologischen Ästhetik soll im folgenden dargestellt werden, dass die Auseinandersetzung um die Eigentümlichkeit der modernen Dichtung bis hin zum Streit zwischen Klassik und Romantik im Kern um die Frage der Stellung des Menschen (und seiner Subjektivität) zur Natur geführt worden ist: Lessing und Goethe, die Protagonisten der Klassik, stellten sich dabei in die Tradition der Antike seit Aristoteles, die den Menschen als Naturkraft und den Künstler als den Nachahmer der Natur bestimmt hatte, auch und gerade wenn dieser handelnde Menschen darstellt. Im Anschluss daran war für beide, für Lessing und Goethe, auch die moderne Subjektivität mit der antiken Tradition vom übergreifenden Prinzip der Natur vereinbar. Die moderne Subjektivität wurde von ihnen als eine besondere und gesteigerte Organisationsform der Natur gefasst. Der moderne Künstler, insofern er der modernen Subjektivität zum Ausdruck verhilft, fällt dabei nicht aus dem Rahmen der Naturnachahmung; denn indem seine Kunst der modernen Subjektivität Ausdruck gibt, ahmt sie zugleich nur eine komplexe und ins höchste gesteigerte Organisationsform der produktiven Natur nach. – Die Romantiker hingegen haben das Prinzip der modernen Subjektivität anders bestimmt. Im Bruch mit der antiken Tradition und im Anschluss an die deutsche idealistische Philosophie Kants und Fichtes haben sie das Prinzip der modernen Subjektivität der Natur gerade dualistisch entgegengesetzt und hierarchisch übergeordnet. D.h.: sie verstanden die moderne Subjektivität nicht mehr als Resultat des praktischen, theoretischen und ästhetischen Austauschverhältnisses von Mensch und Natur, sondern als ein völlig neues, der Natur übergeordnetes Prinzip. Dementsprechend haben die Romantiker auch die moderne Dichtung nicht mehr an das Prinzip der Naturnachahmung gekoppelt, das seither aus dem Bereich der Kunsttheorie verschwunden ist, sondern haben es an das von der ‚Geisteswissenschaft’ des deutschen Idealismus aufgedeckte Prinzip der unbestimmt-unendlichen Formkraft des menschlichen Geistes gebunden. Der moderne Künstler ... I. Die antike Tradition: Naturnachahmung als Grundprinzip aller Künste Sowohl Platon als auch Aristoteles haben die Nachahmung der Natur als das Grundprinzip aller Kunst und damit auch der Dichtkunst bestimmt. Während jedoch Platon die Dichtung prinzipiell abgewertet hat – sie ist für ihn Nachahmung der Nachahmung von Ideen (mimesis der mimesis) und damit besonders weit von der Wahrheit entfernt –, hat Aristoteles sie ausdrücklich verteidigt. Der Trieb zur Nachahmung, so Aristoteles, ist dem Menschen angeboren. Er ist auch in der außermenschlichen Natur vorfindbar, bildet das grundlegende Prinzip allen Lebens und ist beim Menschen mit Lust verbunden. An der Nachahmung der Natur lernt der Mensch. Somit ist die Kunst für Aristoteles nicht wie bei Platon Trugbild, sondern ein Mittel der lustvollen Erkenntniserweiterung. Aristoteles hat daher der Kunst in seiner Einteilung der Wissenschaften neben der praktischen (d.h. ethischen) und theoretischen Wissenschaft einen eigenständigen Platz zugewiesen: Als poetische Wissenschaft gehört sie dem Bereich der menschlichen Hervorbringungen an und ist den handwerklichen Künsten noch übergeordnet. Auch Platons negative Beurteilung der Leidenschaften, wie sie innerhalb der Kunst vor allem durch die Musik und Dichtkunst erweckt werden, wird von Aristoteles durch das Prinzip einer „gemäßigten Leidenschaftlichkeit“ ersetzt. Leidenschaften seien, wenn sie durch Dichtung hervorgerufen würden, ähnlich einer medizinischen Droge dazu in der Lage, eine reinigende Wirkung zu entfalten, indem sie dazu beitragen, ein Übermaß von Affekten ‚auszuscheiden’. Sowohl die Musik als auch die Dichtkunst lösen die Wirkung einer Katharsis, einer Reinigung des Menschen von übermäßigen Affekten, aus, so dass der Mensch in die Lage versetzt wird, sich – von übermäßigen Affekten befreit – wieder als Bürger dem emotional aufreibenden politischen Tagesgeschäft innerhalb der Polis zuzuwenden. Im Gegensatz zur damals verbreiteten Auffassung, Dichtung sei, was der Form nach in Versen abgefasst sei, hat Aristoteles als den spezifischen Gegenstand der dichterischen Nachahmung (im Gegensatz zur Nachahmung der anderen Künste) die menschliche Handlung bestimmt. Er bestimmt die Dichtung ihrem Wesen nach inhaltlich, nicht formal. So sind für ihn z.B. die sokratischen Dialoge aufgrund ihrer handlungsabbildenden Sprache Dichtung, während er etwa die Gattung des Natur- oder Lehrgedichtes trotz ihrer Abfassung in Versen nicht zur Dichtung zählt. Wolfgang Thorwart Die aristotelische Bestimmung der menschlichen Handlung als spezifischer Gegenstand der Dichtung zieht weitreichende Konsequenzen nach sich. Denn der menschlichen Handlung ist es nach Aristoteles zu eigen, dass sie – wie die menschliche Seele – ihren Zweck in sich selbst trägt. D.h., wenn der Dichter seinen besonderen Gegenstand, die menschliche Handlung nachahmt, ahmt er automatisch auch den Übergang von einer real angelegten Möglichkeit (dynamis) zur Wirklichkeit (energeia) nach. So ist für Aristoteles z.B. das Glück und Unglück der Menschen nicht ein Bestandteil, der ihnen von vornherein einfach zukommt, sondern etwas, das im Zuge der menschlichen Handlung von der Möglichkeit zur Wirklichkeit gebracht wird. Dichtung wird damit zur Wissenschaft vom menschlichen Handeln: Die dichterische Darstellung soll an ihrem Gegenstand der menschlichen Handlung genau diesen Übergang von Möglichem zu Wirklichem aufzeigen und sich bei diesem Übergang wesentlich an den Kategorien des Möglichen, Wahrscheinlichen und Notwendigen ausrichten. Dabei gehört zu Aristoteles’ Wahrscheinlichkeitsbegriff ausdrücklich auch das Unwahrscheinliche; denn „vieles“ – so führt er aus - spielt sich auch „gegen die Wahrscheinlichkeit ab“ (Poetik, Kap. 18). Weil der Dichter nun darstellt, „was geschehen könnte, d.h. das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit Mögliche“ (Kap. 9), ist die Dichtung nach Aristoteles „philosophischer“ als die Geschichtsschreibung. Denn während die Geschichtsschreibung das Besondere darstellt, wie es einmal geschehen ist, stellt die Dichtung das Allgemeine dar, wie es nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit immer wieder geschehen könnte. Den Hauptakzent seiner Poetik aber hat Aristoteles auf die Wirkung gelegt. Sie ist eine Wirkungspoetik par excellence. Die Wirkungsmöglichkeit der Tragödie beruht nach Aristoteles erstens auf der Darstellung des Allgemeinen, das darin besteht, dass ein „Mensch von bestimmter Beschaffenheit nach der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit bestimmte Dinge sagt oder tut“ (Kap. 9), und zweitens darauf, dass dieser Mensch in seiner Beschaffenheit nicht zu weit von der des Zuschauers entfernt ist. Aus der geforderten Ähnlichkeit von Held und Zuschauer, der Zeichnung der Charaktere nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit und der wahrscheinlichen Zusammenfügung der Handlungselemente zu einer abgeschlossenen Handlung, ergibt sich schließlich die Möglichkeit der tragischen Wirkungsaffekte. [Die Tragik ergibt sich dabei aus dem Zusammenspiel von menschlichen Der moderne Künstler ... Fehlern und äußeren Ereignissen]. Die durch die Tragödie beabsichtigten Wirkungsaffekte bestimmt Aristoteles als „Jammer“ (eleos) und „Schauder“ (phobos). Eleos beschreibt dabei den Affekt der Rührung des Zuschauers, wenn jemandem, der es nicht verdient hat, auf der Bühne großes Unglück widerfährt, und phobos den Affekt, der sich daraus ergibt, dass das dargestellte Unglück einem auch selbst widerfahren könnte. Beide durch die Bühnenhandlung erzeugten Affekte erregen so eine mit Lust verbundene Erregung der Zuschauer und schließlich eine Reinigung (katharsis) vom Übermass dieser Affekte. II. Zum Streit um den Stellenwert von Begabung und Kunstfertigkeit Nach Aristoteles wird die dichterische Aktivität, die – wie wir gesehen haben – auf die Nachahmung und Vervollkommnung der Natur ausgerichtet ist, durch drei Faktoren bestimmt: durch das Wissen, durch die technische Beherrschung des künstlerischen Handwerks und durch die Begabung des Dichters. Mit seiner Berücksichtigung von Wissen, Technik und Begabung hat Aristoteles also auch dem subjektiven Vermögen des Dichters einen gewissen Stellenwert eingeräumt. Er hat jedoch das demokritisch-platonische Konzept der enthusiastischen Dichtung, nach dem sich durch den Mund des Künstlers eine Gottheit direkt ausspricht, ausgeschlossen. Der Streit um die Gewichtung der Begabung, des ingeniums, gegenüber der erlernbaren Beherrschung des technischen Handwerks wurde bereits in der Antike geführt. So verwahrte sich noch Horaz gegen die Enthusiasmuslehre Demokrits. Für ihn ist eine Begabung des Dichters ohne Kunstfertigkeit ebenso hinfällig wie eine technische Kunstfertigkeit ohne besondere Begabung. Mit dem Durchbruch des Christentums jedoch erfuhr das Konzept der enthusiastischen Dichtung eine starke Aufwertung. Allerdings ist der Enthusiasmus nun nicht mehr als ein wahnhaftes Ergriffenwerden durch die Gottheit, sondern als eine innere Nähe, ein Spüren Gottes, also als ein besonderes Vermögen des Dichters selbst, verstanden worden. Diese Aufwertung des subjektiven Vermögens fand einen ersten Höhepunkt in den Poetiken der Renaissance mit ihrer Betonung der besonderen Bedeutung des ingeniums für die Entstehung eines Kunstwerks. Demgegenüber betonten die Poetiken der Aufklärung wieder die Regel- und Vernunftgerechtheit sprachlicher Kunstwerke. Sie vernachlässigten das produktionsästhetische Wolfgang Thorwart Moment des ingeniums und überbewerteten den Anteil des technischen Handwerks am Zustandekommen eines Kunstwerks. Lessings Auffassung schließlich bildet die Synthese aus Begabung und technischer Kunstfertigkeit, aus dem Moment des ingeniums und der ‚vernünftigen’, ‚regelgerechten’ Nachahmung der Natur. Lessing, der in seiner Hamburgischen Dramaturgie (1767-69) in Anlehnung an den lateinischen Begriff des ingeniums den Begriff des Genies in die deutsche Dichtungstheorie eingeführt hat, verbindet diesen Begriff mit einem besonderen Gespür des Dichters für die Natur: Der Dichter ahmt, wenn er ein Genie ist, die innere wie äußere Natur auf eine nicht bewusste, sondern unwillkürliche und instinktiv richtige Weise nach, ohne sich an irgendwelchen äußerlich vorgeschriebenen Regeln oder Wissen orientieren zu müssen. „Dem Genie“, so Lessing, „ist es vergönnt, tausend Dinge nicht zu wissen, die jeder Schulknabe weiß; nicht der erworbene Vorrat seines Gedächtnisses, sondern das, was es aus sich selbst, aus seinem eigenen Gefühl hervorzubringen vermag, macht seinen Reichtum aus.“2 Als Beispiel für ein derartiges Genie führt Lessing Shakespeare an, der – obwohl er Aristoteles nicht gekannt habe – den Zweck der aristotelischen Poetik immer erreicht, auch wenn er dabei ganz eigene, manchmal auch sonderbare Wege beschritten habe. III. Aufwertung und Verabsolutierung der subjektiven Leidenschaft im ‚Sturm und Drang’ Auch die von Lessing initiierte literarische Geniebewegung des sog. ‚Sturm und Drang’ verehrt mit ihrem enthusiastischen Geniekult zunächst die Natur und ihre schöpferischen Kräfte. In den schöpferischen Kräften und subjektiven Leidenschaften des Genies offenbaren sich die Kräfte der Natur. Das Genie fühlt sich eins mit der Natur, ist gleichsam deren intuitiver, naiver und emotional kraftvoller Ausdruck. Damit steht die Bewegung des ‚Sturm und Drang’ zunächst in der großen aufklärerischen Tradition einer Aufwertung der subjektiven Leidenschaften gegenüber der jahrhundertelangen theologischen Verdammung aller Sinnlichkeit als Sünde. Diesem Geniegedanken mit seiner Aufwertung der subjektiven Leidenschaft huldigen zunächst auch Schiller und Goethe. Wie alle Stürmer und Dränger lehnen sie Lessings Dramentheorie als zu regelhaft ab: Das Genie 2 G.E. Lessing, Hamburgische Dramaturgie, 34. Stück vom 25. Aug. 1767. Der moderne Künstler ... kennt keine äußerlichen Regeln. Es schöpft souverän aus sich selbst, aus seiner eigenen Kraft und seinem eigenen Gefühl. In ihrem genialischen Überschwang erklären sich die Vertreter des ‚Sturm und Drang’ schließlich völlig unabhängig von aller Regel und auch von aller Natur. Im Rückgriff auf die antike Enthusiasmuslehre verabsolutieren sie die subjektiven Erregungszustände des Künstlers und vertreten die Auffassung, das Originalgenie schöpfe ursprünglich und unnachahmlich allein aus sich selbst und sei daher auf die Natur und Naturnachahmung nicht mehr angewiesen – was ihnen prompt die scharfe Kritik Lessings einbrachte. Während sich Schiller und Goethe aber schon nach kurzem von diesem übersteigerten Geniekult abwenden – wobei Goethe in einem gleichsam kathartischen Akt die subjektiven Leidenschaften in sein Konzept eines übergreifenden Bildungsund Entwicklungsgangs des modernen Individuums in Gesellschaft und Natur einordnet – ist der von der Natur und Naturnachahmung entkoppelte und verabsolutierte Geniebegriff dann zum Ausgangspunkt der romantischen Dichtungstheorie und, im Anschluss an diese, zum Ausgangspunkt aller modernen, allein von der Subjektivität des Künstlers ausgehenden Dichtungstheorien geworden. IV. Zu Lessings Natur- und Kunstbegriff Nach Lessing besteht die Kunst in der Absonderung und Fixierung einzelner Naturelemente aus dem unendlichen Strom ihrer Formen, wobei der Künstler die Naturelemente bearbeitet und anordnet, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Das nachahmende und absichtsvolle Erzielen eines bestimmten Zwecks unterscheidet das „Genie“ von den „kleinen Künstlern“, die die Natur nur „nachahmen um nachzuahmen“ . Bei der Erzielung seines Zwecks orientiert sich das „Genie“ ebenfalls an der Natur, nämlich an der äußeren wie an seiner inneren Natur. Den Zweck der Kunst insgesamt bestimmt Lessing als Erziehung des Menschengeschlechts, den besonderen Zweck der Tragödie als Erregung von Mitleid. Durch die Ausbildung und Einübung des Vermögens zu emotionaler Anteilnahme solle das Publikum insgesamt humanisiert werden. „In der Natur ist alles mit allem verbunden; alles durchkreuzt sich, alles wechselt mit allem, alles verändert sich eines in das andere. Aber nach dieser unendlichen Mannigfaltigkeit ist sie nur ein Schauspiel für einen unendlichen Geist. Um endliche Geister an dem Genusse desselben Anteil neh- Wolfgang Thorwart men zu lassen, mussten diese das Vermögen erhalten, ihr Schranken zu geben, die sie nicht hat; das Vermögen abzusondern und ihre Aufmerksamkeit nach Gutdünken lenken zu können . ... Die Bestimmung der Kunst ist, uns in dem Reiche des Schönen dieser Absonderung zu überheben, uns die Fixierung unserer Aufmerksamkeit zu erleichtern. Alles, was wir in der Natur von einem Gegenstande oder einer Verbindung verschiedner Gegenstände, es sei der Zeit oder dem Raume nach, in unsern Gedanken absondern, oder absondern zu können wünschen, sondert sie wirklich ab und gewährt uns diesen Gegenstand, oder diese Verbindung verschiedener Gegenstände so lauter und bündig, als es nur immer die Empfindung, die sie erregen sollen, verstattet.“3 „Um das höchste Genie im kleinen nachzuahmen, versetzt, vertauscht, verringert, vermehret [das Genie] die Teile der gegenwärtigen Welt, um sich ein eigenes Ganzes daraus zu machen, mit dem es seine eigenen Absichten verbindet.“4 Wenn auch kein geschlossenes System der Dichtkunst, so hat Lessing mit seiner Hamburgischen Dramaturgie (1767-69) doch die theoretischen Grundlagen für das moderne deutsche Drama geliefert. Und zwar in seiner besonderen Form als bürgerliches Trauerspiel. Lessing griff dabei ganz grundsätzlich auf die Poetik des Aristoteles zurück: Auch er sah als das Grundprinzip aller Kunst den menschliche Trieb zur Nachahmung der Natur und als den besonderen Gegenstand der Dichtkunst die Nachahmung der menschlichen Handlung. Weil der Gegenstand der dramatischen Dichtung die menschliche Handlung sei und zu einer in sich abgeschlossenen, vollständigen Handlung wesentlich auch die einer Handlung vorausgehenden Motive und handlungsmotivierenden Leidenschaften gehören, sei die dramatische Dichtung in besonderer Weise zur Erziehung des Menschen geeignet. In seiner Hamburgischen Dramaturgie bestimmt Lessing im Rückgriff auf Aristoteles den Zweck der Tragödie als die Erregung von Furcht und Mitleid. Dargestellt werden soll das Unglück eines Menschen, der es nicht verdient hat. Damit der Affekt des Mitleids seine volle Wirkung entfalten könne, fordert Lessing von den Hauptcharakteren, sie müssten „von selbem Schrot und Korn“ wie das Publikum sein. [Er verabschiedet damit die Ständeklau- 3 4 G.E. Lessing, Hamburgische Dramaturgie, 70. Stück vom 1. Jan. 1768. G.E. Lessing, Hamburgische Dramaturgie, 34. Stück vom 25. Aug. 1767. Der moderne Künstler ... sel, nach der die Tragödie adliges Personal erfordere, die Komödie niederem Personal gelte]. Durch wiederholten Theaterbesuch solle sich der Affekt des Mitleidens beim Publikum immer leichter einstellen und so schließlich zu einer Fertigkeit im Mitleiden führen. Das Genie vermag bei Lessing nicht nur, die Natur in einer unwillkürlichen und in sich stimmigen Weise nachzuahmen, sondern es ahmt die Natur zur Erzielung eines vom Genie beabsichtigten Zweckes nach. Dieser Zweck ist im Falle Lessings der pädagogische Zweck der Besserung bzw. Moralisierung des Menschengeschlechts. Der ganze Mensch soll durch das Drama gebessert werden: Die Vernunft werde geschult, indem ihr auf der Bühne moralische und unmoralische Handlungen, Richtiges und Falsches vorgestellt werden; und das Gefühl, Sitz auch der gefühlsmäßigen Vorurteile, werde durch die zielgerichtete Erregung von Mitleid und die Ausbildung eines Vermögens zu emotionaler Anteilnahme humanisiert. Der Zweck der Lessingschen Dramen war also die Bildung der Deutschen zu einem vernünftigen und humanen Publikum. [Das deutsche Theater lag zu Lessings Zeiten am Boden; das breite Publikum war ungebildet und vorurteilsbehaftet.] V. Zu Goethes Natur- und Kunstbegriff In Lessings Ausführungen zur Natur und zum Genie ist der Naturbegriff Spinozas erkennbar, der die Natur als unendlichen Strom verschiedenster Formen fasst und mit Gott gleichsetzt (deus sive natura). Diesem Naturbegriff sieht sich auch Goethe verpflichtet, – wenngleich beide sich nur in privatem Kreise zum Spinozismus bekennen konnten, der als Atheismus betrachtet und dessen öffentliche Äußerung mit Sanktionen belegt wurde. Weil Goethe, wie Lessing, der monistischen Naturauffassung Spinozas nahe steht, sind für ihn menschliche Vernunft und Neigung, Sinnlichkeit und Sittlichkeit nicht prinzipiell voneinander geschieden. Auch für Goethe stellt die Natur einen unendlichen Strom von Formen dar. Die Natur schafft in ihrem ewigen Werden immer neue Formen und entwickelt – nach den Gesetzen von Polarität und Steigerung – im Kontinuum einer unendlichen Metamorphose immer höhere bzw. komplexere Lebensformen. [Goethe schließt vom Vorhandensein des Zwischenkieferknochens bei Tieren auf dessen Existenz auch beim Menschen (!); dementsprechend beruht sein Wolfgang Thorwart Forschungsprinzip auf allen naturwissenschaftlichen Gebieten in der Suche nach Verbindungsgliedern und Übergangsformen]. Den modernen Mensch versteht Goethe als Resultat des Entwicklungskontinuums der Natur, der damit wesentlich der Naturgeschichte angehört. Diesen Standpunkt hat Goethe in direkter Erwiderung auf ein Gedicht Albrecht von Hallers („Ins Innere der Natur / dringt kein erschaffner Geist“) zum Ausdruck gebracht. Hallers Gedicht formulierte genau die Position Kants, nach der die Entwicklungsgesetze der organischen Natur der menschlichen Erkenntnis grundsätzlich nicht zugänglich seien. Kant hatte diesbezüglich ausgeführt, es werde keinen „Newton des Grashalms“ geben. Goethe hat Haller und implizit auch Kant mit folgendem Gedicht geantwortet: „‚Ins Innere der Natur’ O du Philister! – ‘Dringt kein erschaffner Geist?’ Mich und Geschwister mögt ihr an solches Wort nur nicht erinnern! Wir denken: Ort für Ort sind wir im Innern. [...]“5 Nach Goethe ist der Mensch eine Art potenzierter Natur. Er ist eine besondere Organisationsform der Natur auf höchstem Niveau und der Dichter eine Art Vorreiter der Menschheit auf dem Weg zu einem vertieften und harmonischen Verhältnis von Mensch und Natur. Als Vorreiter der Menschheit erschließt der Dichter neue Wirklichkeiten des Wahrnehmens und Empfindens, ohne dass in ihm dabei ein reflexiver Vorsatz wirksam wäre: das Kunstwerk entsteht wesentlich intuitiv oder gefühlsmäßig aus der intensiven Verbundenheit des Künstlers mit der inneren und äußeren Natur. Ähnlich wie bei Aristoteles das Drama zur Darstellung des dem Menschen möglichen Handelns dient, dient die Dichtung bei Goethe zur Darstellung des Menschen mit seinen potentiellen Anlagen und der harmonischen Realisierung und Ausbildung dessen, zu dem er fähig ist. Im dichterischen 5 J.W. Goethe, Werke, hrsg. v. E. Trunz (Hamburger Ausgabe in 14 Bdn.), Bd. 1, S. 359. Der moderne Künstler ... Werk macht der Künstler diese neuen Aspekte der Wirklichkeit für sein Publikum nachempfindbar. Goethe war sich bewusst, dass er aufgrund dieser Kunstauffassung nicht für ein breites Publikum schreibt (dies sah er mehr Schiller vorbehalten). Das Goethesche Publikum tritt daher nur individualisiert auf, als „Liebhaber“ oder „wahrer“ Liebhaber der Kunst. Indem ein ‚wahrer Kunstliebhaber’ nachempfindet, was ihm der Künstler im Kunstwerk zugänglich gemacht hat, erschließt er sich selbst neue Dimensionen der Wirklichkeit, erhebt sich nachempfindend auf das fortgeschrittene Niveau des Künstlers und gelangt so schließlich zu einer höheren Existenz. Dieser Auffassung hat Goethe in einer kurzen, in der Form eines Gesprächs gestalteten Abhandlung mit dem Titel Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke Ausdruck gegeben: „[Ein vollkommenes Kunstwerk] ist übernatürlich, aber nicht außernatürlich. [Es ist] ein Werk des menschlichen Geistes, und in diesem Sinne auch ein Werk der Natur. Aber indem die zerstreuten Gegenstände in eins gefasst, und selbst die gemeinsten in ihrer Bedeutung und Würde aufgenommen werden, so ist es über die Natur. Es will durch einen Geist, der harmonisch gebildet ist, aufgefasst sein, und dieser findet das Fürtreffliche, das in sich Vollendete auch seiner Natur gemäß. [...] der wahre Liebhaber sieht nicht nur die Wahrheit des Nachgeahmten, sondern auch die Vorzüge des ausgewählten, das Geistreiche der Zusammenstellung, das Überirdische der kleinen Kunstwelt; er fühlt, dass er sich zum Künstler erheben müsse, um das Werk zu genießen, er fühlt, dass er sich aus seinem zerstreuten Leben sammeln, mit dem Kunstwerke wohnen, es wiederholt anschauen und sich selbst dadurch eine höhere Existenz geben müsse.“6 Wie schon die Dramen Lessings, so haben sich auch die Dichtungen Goethes ein avanciertes, für diese Kunstwerke genussfähiges Publikum erst schaffen müssen, und haben sich damit die Formen gesellschaftlichen Erlebens und Verhaltens verändert und weiterentwickelt: Goethes jugendliche ‚Erlebnislyrik’ und die Leiden des jungen Werther, die dem Prinzip der subjektiven Leidenschaft zum Ausdruck verhalfen, der Bildungsroman Wilhelm Meisters Lehrjahre (das korrigierende Gegenstück zum Werther), die Tragödie 6 Hamburger Ausgabe, Bd. 12, S. 72. Wolfgang Thorwart des Faust; alle diese Werke haben sich ihr, für diese neuartigen Kunstwerke genussfähiges, Publikum von ‚Liebhabern’ erst bilden müssen. VI. Zur romantischen Dichtungstheorie und zum Unendlichkeitsbegriff Goethes, Schillers und Friedrich Schlegels Aufgrund seiner als revolutionär empfundenen neuen Darstellungs- und Erzähltechniken hat Goethes Wilhelm Meister tiefsten Eindruck auf die damals junge Generation der Romantiker ausgeübt. Sie sahen in diesem Roman einen ganz neuartigen und umfassenden Ausdruck der modernen Subjektivität – und den Anfang einer neuen Dichtung. Friedrich Schlegel hat den Wilhelm Meister neben der Philosophie Kants und der Französischen Revolution sogar zur dritten Kraft des Jahrhunderts erklärt und mit seinem Roman Lucinde (1799) versucht – wenn auch mit wenig Erfolg –, dem Beispiel Goethes nachzueifern. Novalis dagegen hat den Wilhelm Meister, weil er die äußeren Umstände des Bildungsgangs gar zu breit darstelle, kurzerhand verworfen. Für ihn war Goethes Versuch, den Bildungs- und Entwicklungsgang eines Menschen in der komplexen Wechselwirkung mit den verschiedensten gesellschaftlichen Einrichtungen und Institutionen darzustellen, nicht der geglückte Versuch einer umfassenden Darstellung der Genese moderner Individualität, sondern schlicht prosaisch, d.h. undichterisch. Für Novalis steckte im Wilhelm Meister zu viel Bezug auf die Ökonomie und zu wenig Geist der Poesie. Für die Romantiker, die den Menschen nicht als eine sich gesellschaftlich organisierende Naturkraft verstanden, sondern als ein von aller Natur getrenntes und selbständiges Principium, konnte die Nachahmung der Natur und auch die Darstellung der Genese bürgerlicher Individualität im Wechselspiel mit gesellschaftlichen Bedingungen kein Anliegen sein. Dichtung war für sie in erster Linie Ausdruck der freien, unendlichen und unbestimmten schöpferischen Phantasiekraft des Menschen. Nur im Kindheitsstadium der Menschheit habe sich diese unendliche Formkraft des menschlichen Geistes an das Naheliegende der Natur gehalten – so in der griechischen Poesie. Nachdem der Geist aber durch die deutsche idealistischen Philosophie Kants und vor allem Fichtes einmal zum Bewusstsein seiner selbst gekommen sei, dulde er nun keine Macht und keine Regel mehr über sich, sodass die moderne Dichtung nichts anderes als der naturunabhängige, selbstgesetzliche und spielerische Ausdruck der inhaltlich-unbestimmten Der moderne Künstler ... unendlichen Formkraft des menschlichen Geistes sei. Die Einheit des Kunstwerks zeige sich damit nicht mehr in der in sich abgerundeten und vollständigen Form, sondern in der „Konstruktion“ eines Ganzen, in der sich der originelle und produktive Geist des Künstlers offenbare. Die romantische Ironie wurde zum gegebenen Mittel, um vom Endlichen des künstlerisch Dargestellten auf das Unendliche des formschaffenden menschlichen Geistes zu verweisen. Das Fragment wurde zur Form, die auf das undarstellbare Ganze verweist. Schiller vertrat eine ähnliche Auffassung. Auch für ihn sollte die moderne, „sentimentalische“ Dichtung auf die Unendlichkeit verweisen: der antike, „naive“ Dichter war „mächtig durch die Kunst der Begrenzung“; der moderne, „sentimentalische“ Dichter ist es „durch die Kunst des Unendlichen.“7 Aber Schiller sah den Bezug der modernen Kunst auf die Unendlichkeit in der Reizung und Bewusstmachung des Vermögens der praktischen Vernunft (bzw. der moralischen Erhabenheit). Während das Mittel des Verweisens des Endlichen auf das Unendliche für Schlegel die romantische Ironie ist, ist es für Schiller dagegen die tragische Darstellung von übermächtigem sinnlichen Leid. Schlegel sieht daher den romantischen Bezug auf das Unendliche nicht im Bewusstmachen des Vermögens der praktischen Vernunft, sondern in der Bewusstwerdung des unendlichen Vermögens der schöpferischen Einbildungskraft. Für Goethe wiederum liegt das wesentliche Skandalon der romantischen Poesie darin, dass sie die Unendlichkeit des Stroms von Formen nicht den Gegenständen der Natur zuweist, sie also nicht (objektiv) als Tätigkeit der Natur fasst, sondern allein der (subjektiven) Tätigkeit des menschlichen Geistes zuschreibt; des weiteren, dass der unendliche Strom der Formen keinen organischen Formenwandel darstellt, dass also die Formen sich nicht organisch im Übergang hin zu immer komplexeren Formen entwickeln, sondern ein „Chaos“ bilden, das sein verbindendes Element allein in der willkürlich ‚konstruierenden’ Phantasie des Dichters besitzt. Als Resultat lässt sich damit festhalten: Goethe besondere Stellung innerhalb der deutschen Literatur- und Geistesgeschichte besteht darin, dass er das antike Prinzip der Naturnachahmung mit dem Prinzip der modernen Subjektivität vereinigt und zu einem künstlerisch vollkommenen Ausdruck 7 Fr. Schiller, Über naive und sentimentalische Dichtung, in: Werke in drei Bänden, hrsg. v. H.G. Göpfert, München 1966, Bd. II, S. 559. Wolfgang Thorwart verholfen hat. Goethe hat der Natur die moderne Subjektivität nicht dualistisch gegenübergestellt, wie dies etwa Kant und auch die Romantiker taten. Für ihn ist der moderne Mensch und insbesondere der moderne Dichter selbst eine Naturkraft, eine Art potenzierter Natur oder eine besondere Organisationsform der Natur auf höchstem Niveau. Mensch und Dichter sind Teil der Natur und gehen gleichzeitig über sie hinaus. Daher sind auch die Kunstwerke, die der Mensch als Künstler schafft, über der Natur, nicht aber außer der Natur. So bleibt für Goethe in letzter Instanz auch der Ausdruck der modernen Subjektivität des Künstlers immer mimesis, Nachahmung der Natur, – nur auf ihrer höchsten und komplexesten Stufe. Von Goethe lässt sich daher mit der größten Berechtigung sagen: „Je umfassender der Mensch mit den gesamten positiv-negativen Kreisläufen der Natur übereinstimmt, ohne sich auf einen Teilaspekt zu fixieren, desto objektiver werden seine subjektiven Bewertungen“.8 8 Elmar Treptow, Die erhabene Natur. Entwurf einer ökologischen Ästhetik, Würzburg 2001, S. 102. In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 82-94 Autor: Manuel Knoll Artikel Manuel Knoll Ansätze zu einer Genealogie des modernen Subjekts in Michel Foucaults Der Wille zum Wissen Er wußte es von Anbeginn und er sollte Recht behalten. Zweifellos war es „unvorsichtig“, „gleichsam als Leuchtbombe ein Buch vorauszuschicken, das ständig auf kommende Veröffentlichungen anspielt“ (8).1 So hatte Michel Foucault in seinem 1976 erschienenen Werk Der Wille zum Wissen (La volonté de savoir) zwar angekündigt, diese programmatische Schrift zu einer mehrbändigen Histoire de la sexualité der letzten drei Jahrhunderte auszubauen (7f.).2 Doch statt dieses Projekt zu verwirklichen, setzte er seine Untersuchungen in den erst acht Jahre später veröffentlichten Folgebänden Der Gebrauch der Lüste und Die Sorge um sich in Form einer Genealogie des Subjekts in der Antike neu an. Dabei ging es ihm darum, die „langsame Formierung einer Selbsthermeneutik“ bei den Griechen und Römern aufzuzeigen.3 Foucaults Bruch mit seinem ursprünglichen Vorhaben hat zur Konsequenz, daß die in Der Wille zum Wissen skizzierten „Hypothesen“ (8) nur unzurei1 Die in Klammern angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf folgende Ausgabe: Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1, 4. Aufl., Frankfurt am Main 1991. Der deutsche Gesamttitel Sexualität und Wahrheit statt Histoire de la sexualitité geht auf Foucaults ausdrücklichen Wunsch zurück (Hinrich Fink-Eitel: Foucault zur Einführung, Hamburg 1989, S. 79). 2 Die Angaben zu Titeln und Inhalten der fünf geplanten Werke finden sich bei FinkEitel (Ebenda, S. 97). 3 Michel Foucault: Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und Wahrheit 2, 2. Aufl., Frankfurt am Main 1991, S. 13; Michel Foucault: Die Sorge um sich. Sexualität und Wahrheit 3, 2. Aufl., Frankfurt am Main 1991. Manuel Knoll chend mit historischem und empirischem Material belegt bleiben und viele Themen und Aspekte nur kurz angesprochen und skizziert werden. Im Rückblick erklärt er seine Neuorientierung mit Problemen bei einem der Themen, die er selbst als die drei Hauptachsen von Der Wille zum Wissen ansieht: Wissen, Machtsysteme und die (An)erkennung der Individuen als Subjekte einer Sexualität.4 Zwar hätten ihn seine früheren Arbeiten für die Analyse der Achsen des Wissens und der Macht vorbereitet. Dagegen räumt er bei der „Untersuchung der Weisen, in denen die Individuen dazu gebracht werden, sich als sexuelle Subjekte anzuerkennen, viel mehr Schwierigkeiten“ ein, die mit dem mit „Begriff des Begehrens“ oder des „begehrenden Subjekts“ zusammenhängen.5 Trotzdem sind in Michel Foucaults Der Wille zum Wissen auch Ansätze zu einer Genealogie des modernen Subjekts enthalten, die im folgenden rekonstruiert und kritisiert werden sollen. 1. Foucaults Kritik der Repressionshypothese Foucault grenzt seine Untersuchungen kritisch gegenüber einem in der Moderne vorherrschenden Diskurs über die körperliche Lust ab, den er die „Repressionshypothese“ nennt (19f.). Die wichtigsten Vertreter dieser Hypothese sind für ihn Sigmund Freud und vor allem der Psychoanalytiker Wilhelm Reich, der Marx und Freud zu einem Freudomarxismus verbindet (156f.). Zugrunde liegt ihr nach Foucault die Vorstellung des Sexualtriebes als wilder und naturhafter Energie, die als etwas gedacht wird, was außerhalb und im Gegensatz zu den gesellschaftlichen Machtsystemen steht. Die Macht wirkt demnach gegenüber den Trieben negativ als Unterdrückung, Verbot und Zensur (101ff.). Aus diesen Vorstellungen leitet die Repressionshypothese auch eine Auffassung über die mögliche Befreiung des Sexes von der Macht ab. Diese besagt, daß ein Diskurs und die von ihm entworfene Wahrheit über die Sexualität der unterdrückenden Macht entgegenge4 „Von der ,Sexualität’ als einer historisch besonderen Erfahrung zu sprechen setzte auch voraus, daß man über geeignete Instrumente verfügt, um die drei Achsen dieser Erfahrung in ihrem je eigenen Charakter und in ihrem Zusammenhang zu analysieren: die Formierung der Wissen, auf die sie sich beziehen; die Machtsysteme, die ihre Ausübung regeln; und die Formen, in denen sich die Individuen als Subjekte dieser Sexualität (an)erkennen können und müssen“ (Michel Foucault: Der Gebrauch der Lüste, a.a.O., S. 10). 5 Ebenda, S. 11. Ansätze zu einer Genealogie ... setzt und ihre Artikulation ein Mittel zum Zweck der Befreiung ist. Das Zeitalter der Unterdrückung beginnt – nach Foucaults Lesart – für die Vertreter der Repressionshypothese zeitgleich mit der Entwicklung des Kapitalismus im 17. Jahrhundert, weil der Sex „mit einer allgemeinen und intensiven Arbeitsordnung unvereinbar ist“ (13f., 27). Diese Lesart wird aber weder Freud noch Reich gerecht. Die Kulturentwicklung ist nämlich für Freud schon immer mit Triebverzicht und Triebunterdrückung verknüpft.6 Reich widerspricht zwar der Allgemeinheit von Freuds Kulturtheorie und hält dagegen, daß es auch „hohe Kulturen ohne Sexualunterdrückung mit einem völlig freien Geschlechtsleben“ gibt.7 Aber auch er geht von einer jahrtausendealten „Unterjochung des Trieblebens“ aus.8 Richtig an Freuds Kulturtheorie ist für Reich allein, „daß die Sexualunterdrückung die massenpsychologische Grundlage einer bestimmten, nämlich der patriarchalischen Kultur in allen ihren Formen bildet“.9 Eine zusätzliche Schwierigkeit von Foucaults Schrift besteht darin, daß er im Vorwort zur deutschen Ausgabe von Der Wille zum Wissen die Tatsache der Unterdrückung ausdrücklich einräumt, dann aber durchweg die Repressionshypothese zurückweist und in Frage stellt. Foucaults kritische Auseinandersetzung mit der Repressionshypothese besteht weniger in einem „Widerlegungsversuch im strikten Sinne“.10 Zwar polemisiert er gegen einen „verschwommenen Energetismus“, der der Vorstellung einer aus ökonomischen Gründen unterdrückten Sexualität zugrunde läge (138). In erster Linie verfolgt seine Kritik aber das Ziel, eine Archäologie und eine Genealogie der Repressionshypothese und somit auch der Psychoanalyse zu leisten, die deren Funktion und Lokalisation in einem komplexeren Zusammenhang entlarven soll (21, 156). Eine Hauptfunktion der Repressionshypothese besteht nämlich für Foucault darin, einen beständigen Anreiz zu liefern, um über den Sex zu sprechen und so dauernd neue Diskurse über ihn hervorzubringen. Für die letzten dreihundert Jahre konstatiert er statt Sprachlosigkeit und Schweigen, wie von der 6 Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur, Frankfurt am Main 1990. Wilhelm Reich: Die sexuelle Revolution, Frankfurt am Main 1990, S. 34. 8 Ebenda, S. 21. 9 Ebenda, S. 34. 10 Rudi Visker: Foucault, München 1991, S. 92. 7 Manuel Knoll Repressionshypothese unterstellt, eine rapide Vermehrung der Diskurse über den Sex (27ff.). 2. Der Zusammenhang von Machtsystemen und diskursivem Wissen Foucaults zusammenfassender Titel für die Wissenschaften der Psychiatrie, der Pädagogik, der Psychologie und der Medizin, in denen sich seit dem 18. Jahrhundert die verschiedenen Diskurse über den Sex und die Sexualität entwickelt haben, ist der der „scientia sexualis“ (75). Obwohl es diesen hermeneutischen Wissenschaften gelungen ist, „geregelte Wahrheit“ (89) über den Sex hervorzubringen, betrachtet Foucault sie als „Pseudowissenschaften“ oder „Beinahewissenschaften“. Darin ist auch eine Neuauflage seiner Kritik an den Humanwissenschaften zu sehen, die Foucaults gesamtes Werk durchzieht.11 Foucaults Kritik stützt sich wesentlich auf Friedrich Nietzsches Reflexionen über den Zusammenhang von Macht und Interpretation, die die historischen Analysen von Der Wille zum Wissen theoretisch fundieren. Nietzsche betont bereits in Also sprach Zarathustra, daß der „Wille zur Wahrheit“ ein Wille zur Macht ist.12 Nach seiner radikalen Kritik und Verabschiedung des traditionellen Wahrheitsbegriffs verbleiben für ihn lediglich konkurrierende perspektivische und wertende Interpretationen der Welt, die Mittel und Ausdruck der Überwältigungs- und Bemächtigungsprozesse sind, die ihnen zugrunde liegen. In einem nachgelassenen Fragment bringt Nietzsche diesen Zusammenhang auf die Kurzformel „Der Wille zur Macht i n t e r p r e t i r t “.13 Demgemäß will Foucault zeigen, daß die Produktion der hermeneutischen Diskurse der scientia sexualis nicht „autonom“ stattfindet, sondern immer an bestimmte Machtmechanismen und Machtinstitutionen gebunden ist. Zudem begreift er die Diskurse und das Wissen selbst als Formen von Macht. Die „Diskurse über den Sex haben sich nicht außerhalb der Macht oder ihr zum Trotz vermehrt, sondern genau dort, wo sie sich entfaltete und als Mittel zu ihrer Entfaltung“ (46). 11 Hubert L. Dreyfus; Paul Rabinow: Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik, Frankfurt am Main 1987, S. 208f. 12 Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra I-IV, KSA, Bd. 4, Berlin/New York 1988, S. 146. 13 Friedrich Nietzsche: Nachgelassene Fragmente 1885 – 1887, KSA, Bd. 12, Berlin/New York 1988, S. 139f.; Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral, KSA, Bd. 5, Berlin/New York 1988, S. 313f. Ansätze zu einer Genealogie ... Eine weitere Grundlage von Foucaults Analysen in Der Wille zum Wissen ist die von Nietzsche übernommene Methode der Genealogie. In seinem Aufsatz Nietzsche, die Genealogie, die Historie von 1971 begreift Foucault die Genealogie als die „wirkliche Historie“, die sich geduldig mit „Dokumenten“ beschäftigt und die tatsächliche Herkunft und Geschichte ihrer Gegenstände erforscht.14 Das sind vor allem die menschlichen Körper, ihre Begierden und ihre Kräfte, denen das Ich nur als scheinbar „substantielle Einheit“ zugehört.15 Dieser ungewöhnlich anmutende Gegenstandsbereich, der Mitte der 70er Jahre im Zentrum von Foucaults Arbeiten steht, wird von der traditionellen Geschichtswissenschaft kaum beachtet. Foucaults Erkenntnisinteresse erklärt sich vor allem durch die – gegenüber der überwiegend auf das identische Ich, die Seele und das Jenseits bezogenen abendländischen Tradition - radikale Aufwertung des Körperlichen, die sich mit Nietzsche vollzieht.16 Im Anschluß an Nietzsche betont Foucault auch, daß die Genealogie das „Werden der Menschheit“ historisch als „eine Reihe von Interpretationen“ untersucht und dabei „nicht fürchtet, ein perspektivisches Wissen zu sein“.17 Zentraler Gegenstand der Genealogie sind die gesellschaftlichen „Unterwerfungssysteme“ der Körper, das „Hasardspiel der Überwältigungen“ und die Entstehung von Machtkämpfen, Kräfteverhältnissen, Machtmechanismen und Machtinstitutionen.18 Der Geschichtsbegriff, der Foucaults Genealogie als der „wirklichen Historie“ zugrunde liegt, verabschiedet alle Ursprungsmetaphysiken und alle theologischen, rationalistischen oder teleologischen Geschichtsbetrachtungen, die die vielfältigen Zufälle, Brüche und einzigartigen Ereignisse, die den Geschichtsverlauf prägen, zu einer „idealen Kontinuität“ zu verketten suchen.19 Damit stellt sich die Frage nach den Machtstrategien, die hinter der scientia sexualis stehen. Foucault betrachtet die Sexualität ihrer geschichtlichen Herkunft nach als bürgerliche „Klassensexualität“ (153). Das Interesse, wel14 Michel Foucault: Nietzsche, die Genealogie, die Historie, in: ders.: Von der Subversion des Wissens, Frankfurt am Main 1991, S. 78-82, 69. 15 Ebenda, S. 74f., 79. 16 Vgl. etwa Nietzsches Aphorismus Von den Verächtern des Leibes: Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra I-IV, KSA, Bd. 4, Berlin/New York 1988, S. 39-41. 17 Michel Foucault: Nietzsche, die Genealogie, die Historie, in: ders.: Von der Subversion des Wissens, a.a.O., S. 78, 82. 18 Ebenda, S. 76, 80. 19 Ebenda, S. 80. Manuel Knoll ches das Bürgertum mit der scientia sexualis verfolgt, ist die Steigerung und Ausweitung seiner Kräfte, seiner Macht und seiner Gesundheit. Dabei geht es vor allem um „den Körper, die Stärke, die Langlebigkeit, die Zeugungskraft und die Nachkommenschaft der ,herrschenden’ Klasse“ (148). Zudem zielt das Bürgertum für Foucault darauf ab, seine Fähigkeit zur „Selbstbehauptung“ im Klassenkampf zu steigern. Deshalb sind erst Epidemien, Geschlechtskrankheiten und ökonomische Gründe wie der „Bedarf an sicherer und qualifizierter Arbeitskraft“ erforderlich, damit das Bürgertum sein Zögern überwindet, den „von ihm ausgebeuteten Klassen einen Körper und einen Sex“ zuzuerkennen (148-152). Der bürgerliche Staat und die bürgerliche Verwaltung haben auch ein Interesse an den Körpern und den Lüsten, um die Bevölkerung regulieren zu können. Ihr Interesse leiten ökonomische Erfordernisse und politische Nützlichkeiten (36-38). Foucault charakterisiert die moderne Machtform als „Bio-Macht“, d.h. als Macht, die das Leben sichert, verteidigt, kontrolliert, verwaltet und bewirtschaftet (163f.). Dieser Macht geht es, wie er auch in Überwachen und Strafen, der Komplementäruntersuchung zur Bio-Macht, herausstellt, um die Disziplinierung und Stärkung der Körper, um Machtsteigerung und um eine „Bio-Politik der Bevölkerung. Die Disziplinen des Körpers und die Regulierungen der Bevölkerung bilden die beiden Pole, um die herum sich die Macht zum Leben organisiert hat“ (166).20 Foucault grenzt sich in seinen beiden Untersuchungen zur Bio-Macht von der traditionellen, nach seinen Worten „juridisch-diskursiven“ Vorstellung von Macht ab, nach der die Macht Gesetze und Regeln erläßt, verbietet und zensiert (102). Dagegen bemüht er sich um eine andere, an Nietzsche orientierte Konzeption von Macht21, die deren „produktive Effizienz“, ihren „strategischen Reichtum“ und ihre positive Wirkungsweise in den Blick bekommt (106). Foucaults strategisches und dezentralisiertes Modell von Macht begreift Macht als „Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen“, lokalen Beziehungen und Taktiken, die erst im nachhinein, z.B. im staatlichen Handeln, zu konsistenten Strategien verkettet werden und dort zur Wirkung gelangen (113f., 116f.). 20 Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, 9. Aufl., Frankfurt am Main 1991. 21 Vgl. zu Nietzsches Machtbegriff: Wolfgang Müller-Lauther: Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht, in: Nietzsche Studien 3, Berlin/New York 1974, S. 1-60. Ansätze zu einer Genealogie ... Unmittelbar ist das diskursive Wissen und die „Wahrheitsproduktion“ der scientia sexualis für Foucault vor allem an die Machttechnik des Geständnisses gebunden, die letztlich auf die mittelalterliche Beichtpraktik zurückgeht. Die Verpflichtung zum Geständnis stellt für Foucault die Wirkung einer zwingenden Macht dar (75-77). Bereits in der christlichen Beichte wird das Fleisch zum bevorzugten Gegenstand des Geständnisses. Durch ihre Macht und die Interpretation des Fleisches als der „Wurzel aller Sünden“ (30) gelingt es der katholischen Kirche ab dem 17. Jahrhundert, den Zwang zur dauernden Selbstbeobachtung und Selbstprüfung bei den um ihr Seelenheil bangenden Gläubigen durchzusetzen. Von da an untersteht jeder „gute Christ“ dem Imperativ, „aus seinem gesamten Begehren einen Diskurs zu machen“ (31). Das Begehren der Gläubigen nach den „Einflüsterungen des Fleisches“ (30) bildet auch die Grundlage für das später von der scientia sexualis hervorgerufene „Begehren nach Sex“ (186). Dieses erzeugt die scientia sexualis bei den Menschen, indem sie bei ihnen den Glauben verbreitet, über den Sex Zugang zur Selbsterkenntnis und zur eigenen Identität zu erlangen. Verstärkt wird es noch durch die pathogene Rolle, die sie dem Sex - etwa der Masturbation - zuschreibt (182-186). Seit dem 18. Jahrhundert wird der Zwang zum Geständnis in eine Reihe von Beziehungen und Institutionen eingesetzt. Zu nennen sind Eltern/Kinder, Pädagogen/Schüler, Ärzte und Psychiater/Patienten, Psychoanalytiker/Analysanden und Delinquenten/Experten (81). Durch die Geständnisse der begehrenden, sich selbst beobachtenden und ihre Lüste diskursivierenden Menschen wird erst die Archivierung und Kategorisierung dieser individuellen Lüste und damit die sciencia sexualis möglich. Motiviert werden die Geständnisse durch den Glauben der Menschen, von den „Experten“ die Wahrheit über sich und über ihre individuellen Probleme zu erfahren. Der die Geständnisse interpretierende Zuhörer wird somit zum „Herr der Wahrheit“, zur Instanz, die den „wahren“ Diskurs über die Sexualität produziert (86f.). An dieser Stelle drängen sich bereits einige Fragen auf. Was ist eigentlich am Willen zum Wissen der scientia sexualis auszusetzen? Ist es wirklich gerechtfertigt, die Humanwissenschaften als Pseudowissenschaften anzusehen? Etwa nur deshalb, weil Foucault ihren hermeneutischen Charakter und ihre Abhängigkeit von der Machttechnik des Geständnisses demonstrieren kann? Diese Abhängigkeit schließt doch die Möglichkeit von Erkenntnis Manuel Knoll nicht aus. Auch die Naturwissenschaften sind von Macht und Interessen abhängig. Trotzdem vermögen sie es, Erkenntnisse zu gewinnen. Doch die Abhängigkeit des Wissens von der Macht ist für Foucault nicht der zentrale Punkt seiner „Kritik“22. Genausowenig zentral ist für ihn ein weiterer Einwand, den er gegen die scientia sexualis vorbringt und der auch ein gewisses Licht auf die gerade aufgeworfenen Fragen wirft. So kontrastiert er im 19. Jahrhundert die „Biologie der Fortpflanzung“ mit der – zu ihr auch partiell komplementären – „Medizin des Sexes“. Erstere entstammt „jenem ungeheueren Willen zum Wissen, der das Aufkommen des wissenschaftlichen Diskurses im Abendland getragen hat“. Sie hat sich „durchgehend gemäß der allgemeinen wissenschaftlichen Normativität entwickelt“. Dagegen entspringt der Diskurs der scientia sexualis einem „hartnäckigen Willen zum Nichtwissen“, dem es „einzig darum“ geht, das Aufkommen der Wahrheit zu verhindern (71f.).23 Bei der „Wissenschaft über den Sex“ handelt es sich für Foucault „um eine aus nichts als Ausweichmanövern bestehende Wissenschaft, deren Unfähigkeit oder Unwillen, vom Sex selber zu sprechen, sie dahin führte, sich in erster Linie seinen Verirrungen, Perversionen, Absonderlichkeiten, pathologischen Schwunderscheinungen und krankhaften Übersteigerungen zuzuwenden“ (69). Letztlich ist die scientia sexualis, bei der Foucault „das Fehlen jeder elementaren Rationalität“ (71) konstatiert, „in ihrem Wesen den Imperativen einer Moral verpflichtet“, für die der Sex unerträglich und bedrohlich ist (69f.). Der Haupteinwand jedoch, den Foucault gegen die Form von Macht-Wissen vorbringt, die das Geständnis und die scientia sexualis darstellen, läßt sich erst im nächsten Kapitel aufzeigen. 3. Die machtgebundene Produktion der Sexualität und der Subjektivität 22 Foucaults Begriff von Kritik kann hier nicht eingehend untersucht werden. Wie bereits erwähnt, ist er als nietzscheanischer Genealoge der Überzeugung, daß sein Wissen über die Geschichte immer und unhintergehbar „perspektivisches Wissen“ ist. Seine Kritik der „Wahrheit“ der scientia sexualis kann demgemäß keine „höhere“ oder „bessere“ Wahrheit als positiven Bezugspunkt beanspruchen. Vielmehr dürfte es Foucault darum gehen, durch den Aufweis der kontingenten Entstehung und der Abhängigkeit der scientia sexualis von bestimmten Machtmechanismen auch ihre geschichtliche Hinfälligkeit aufzuweisen. 23 Foucault kontrastiert die wahrheitsscheue scientia sexualis auch mit einer – etwas verklärt dargestellten und vorwiegend in außereuropäischen Gesellschaften vorhandenen – Kunst der Erotik (ars erotica), in der „die Wahrhheit aus der Lust selber gezogen“ wird (74). Ansätze zu einer Genealogie ... Vor dem Hintergrund des Zusammenhangs von Machtsystemen und diskursivem Wissen kann Foucaults Hypothese erläutert werden, daß die Sexualität „nicht über die Unterdrückung an die Macht gebunden ist“, sondern von der scientia sexualis erst „produziert“ wird (17, 87f., 138). Diese Hypothese stößt anfangs auf Erstaunen. Man ist versucht einzuwenden, daß die Sexualität doch ein transhistorisches und transkulturelles Phänomen darstellt. Eine mögliche Erklärung dieses Erstaunens ist die, daß wir uns alle unhinterfragt als Subjekte einer Sexualität (an)erkennen. Foucault betont dagegen, daß der Begriff „Sex“ erst im 18. Jahrhundert und der Begriff „Sexualität“ sogar erst im 19. Jahrhundert entsteht.24 Die Begriffe Sex und Sexualität sind geschichtliche und hermeneutische Produkte und Konstrukte, die erst in den Diskursen der „Geständniswissenschaften“ gebildet werden. Zur Abgrenzung dieser beiden Begriffe, an die sich sein eigener Diskurs nicht immer strikt hält, äußert Foucault: Sexualität ist sowohl ein wissenschaftlicher „Erkenntnisbereich“ (7, 119) als auch eine historische „Erfahrung“ der Menschen, die sich als Subjekte einer bestimmten Sexualität (an)erkennen.25 Die „Idee des ,Sexes’“ betrachtet Foucault als „imaginäres“ und „spekulatives“ Element, das als autonome Instanz, z.B. als Trieb, vorgestellt wird und der Erfahrung der Menschen angeblich zugrunde liegt und sie konstituiert (181-185). Was sind die transhistorischen und transkulturellen Referenten, die von der scientia sexualis in dieser geschichtlich besonderen Form diskursiviert werden? Zweifellos die „Körper und ihre Lüste“ (64), die schon in der christlichen Pastoraltheologie unter dem Titel des sündigen Fleisches diskursiviert werden. Wie in Überwachen und Strafen arbeitet Foucault in Der Wille zum Wissen an einer „Geschichte der Körper“ und an einer Genealogie des modernen Subjekts (im Sinne eines Menschen, der dem Macht-Wissen unterworfen ist).26 Bereits in seinem Aufsatz Nietzsche, die Genealogie, die Historie stellt Foucault den Körper als einen zentralen Gegenstand der Genealogie heraus. Foucaults umfassendste Hypothese aus Der Wille zum Wissen könnte lauten, daß mit der machtgebundenen Produktion der „Sexualität“ auch eine machtgebundene Produktion von Subjektivität einhergeht. Wie werden die Menschen dazu gebracht, sich als die Subjekte einer Sexualität 24 Hubert L. Dreyfus; Paul Rabinow, a.a.O., S. 199. Michel Foucault: Der Gebrauch der Lüste, a.a.O., S. 9ff. 26 Michel Foucault : Überwachen und Strafen, a.a.O., S. 36-43, 166f. 25 Manuel Knoll (an)zuerkennen? Diese Bezugsform zu sich selbst hat, wie bereits erwähnt, den Körper und seine Lüste als Substrat. Eine wichtige Voraussetzung bildet das Begehren der Menschen nach den „Einflüsterungen des Fleisches“ und das „Begehren nach Sex“. Auf Grund dieser Voraussetzung und der Geständnisse gegenüber den klassifizierenden „Experten“ konstituieren sich in den Diskursen der scientia sexualis eine Vielzahl von individuellen und „peripheren Sexualitäten“ (55): Die der Perversen, wie beispielsweise der Homosexuellen, der Fetischisten, der Sadisten und Masochisten usw., die der Kinder, die der frigiden, nervösen und hysterischen Frauen. So entstehen fast alle diese und ähnliche heute verbreitete Begriffe und Kategorien der scientia sexualis zwischen dem späten 18. und dem frühen 20. Jahrhundert. Die scientia sexualis verdankt ihren erfolgreichen Aufstieg und ihre Verbreitung hauptsächlich der bürgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts. So weckt sie etwa in der Familie den Verdacht, das Kind befleißige sich der pathogenen Praktik der Onanie oder die als nervös wahrgenommene Ehefrau leide an einer Hysterie. Dies führt dazu, daß sich die immer hilfsbedürftiger fühlenden Eheleute an eine Vielzahl von „Experten“ wenden, wodurch sich die scientia sexualis im aufstrebenden Bürgertum verbreiten kann und dort an Macht und Einfluß gewinnt. Der entscheidende Punkt ist, daß die Menschen sich in der geschichtlichen Entwicklung durch den wachsenden Einfluß und die hermeneutische Macht der scientia sexualis zusehends als Subjekte einer individuellen Sexualität (an)erkennen. Wie weit diese hermeneutische Macht geht, illustriert der Gemeinplatz, daß wir heute allesamt „Freud sprechen“. Die machtgebundene Produktion von Subjektivität läßt sich an Foucaults überzeugendstem Beispiel, der Entstehung des Homosexuellen, erläutern. Noch im 18. Jahrhundert ist der gleichgeschlechtliche Verkehr lediglich eine verbotene Handlung, die unter die juristische Kategorie der Sodomie subsumiert wird. In den Diskursen der Psychologie, der Psychiatrie und der Medizin entsteht dann im 19. Jahrhundert die hermeneutische Kategorie der Homosexualität. Nach den Interpretationen der scientia sexualis stellt der Homosexuelle eine besondere „Persönlichkeit“, eine „Sondernatur“, eine „Spezies“ oder einen eigenen „Charakter“ dar, der „nach einer bestimmten Qualität sexuellen Empfindens“ und durch eine „bestimmte Weise der innerlichen Verkehrung des Männlichen und des Weiblichen charakteri- Ansätze zu einer Genealogie ... siert“ wird (58). Dadurch, daß der junge bürgerliche „Sodomit“ im Verlaufe des 19. Jahrhunderts bei der Selbstdefinition und Selbsthermeneutik seiner (Homo)Sexualität immer größeres Gewicht beimißt, „hämmert“ er sie nach Foucaults Worten seinem Körper ein und läßt sie in seine „Verhaltensweisen gleiten“. Er erkennt sich somit als Subjekt seiner Sexualität an, als jemand, dessen Empfinden und Charakter zu einem bedeutenden Teil durch seine Homosexualität bedingt ist und durch diese zu verstehen ist. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist für Foucault, daß die den verschiedenen Sexualitäten, den Homosexuellen, den Sadisten etc. zugehörigen Lüste sogar noch intensiviert, in die Körper der sich als Subjekte dieser Sexualitäten anerkennenden Menschen „eingelassen“ und zu deren „festen Charakteren“ werden (58-60). Die Subjektivitätsformen, die diesem Prozeß entspringen, sind also keineswegs frei, da sie von der Form des Macht-Wissens, die das Geständnis und die scientia sexualis darstellen, abhängen, von dieser produziert und aufgeprägt werden und somit die Menschen unterwerfen (78). Bei dieser Konstituierung der Menschen als Subjekte („l’assujettissement“27), die an eine Sexualität gebunden und damit dem MachtWissen unterworfen sind, verfallen die potentiellen Möglichkeiten von anderen, freieren Formen von Subjektivität weitgehend, bzw. die potentielle Vielfalt von möglichen Formen von Selbsthermeneutik wird zugunsten einer dominierenden und machtbedingten abgeschnitten. Foucaults kritischer Einwand gegen die scientia sexualis ist also nicht nur, daß sie eine Pseudowissenschaft ist, die von dem Machtmechanismus des Geständnisses abhängt, sondern vor allem, daß sie Macht über Menschen ausübt, indem sie ihnen eine unfreie Form von Subjektivität aufprägt.28 Ein positiver und 27 Eine zentrale Stelle zu Foucaults Subjektbegriff muß wegen ihrer mangelhaften Übersetzung (78) aus dem Original zitiert werden: „Immense ouvrage auquel l´Occident a plié des générations pour produire – pendant que d´autres formes de travail assuraient l´accumulation du capital – l´ássujettissement des hommes ; je veux dire leur constitution comme ,sujets’, aux deux sens du mot“ (Michel Foucault: La volonté de savoir, 1976, S. 81). 28 Michel Foucault: Warum ich die Macht untersuche: Die Frage des Subjekts, in: Hubert L. Dreyfus; Paul Rabinow, a.a.O., S. 243-250. Die Tatsache, daß in den Folgebänden von Der Willen zum Wissen von einer „freien Subjektivität“ die Rede ist, ist für Hinrich Fink-Eitel ein „radikaler Bruch“ (Hinrich Fink-Eitel, a.a.O., S. 98). Dieser Bruch sollte allerdings weniger in Foucaults Werk oder Denken gesucht werden, sondern muß als Folge von geschichtlichen Umbrüchen – insbesondere der Entwicklung des modernen Staats seit dem 16. Jahrhundert – begriffen werden, die beträchtliche Auswirkungen Manuel Knoll vorbildlicher Bezugspunkt von Foucaults „Kampf für eine neue Subjektivität“29 dürften auch die vorwiegend außereuropäischen Kulturen sein, die über eine Kunst der Erotik (ars erotica) verfügen und die jenseits der Selbsthermeneutik der Geständniskultur angesiedelt sind.30 Foucaults Analyse der Entstehung des Homosexuellen als neuer „Spezies“ seit dem 19. Jahrhundert ist von nicht unbeträchtlicher Plausibilität. Auch bezüglich der Menschen, die sich mit einer der anderen peripheren bzw. „perversen“ Sexualitäten identifizieren, erscheint es nicht völlig unberechtigt, von einer gewissen Unterwerfung und Gebundenheit an die Kategorien der scientia sexualis zu sprechen. Jedoch ist es höchst fraglich, ob die Subjektivität der überwiegenden Mehrheit der „normalen“ Heterosexuellen in nennenswertem Maß an ihre Sexualität und damit an die Diskurse der scientia sexualis und das Geständnis gebunden und diesen unterworfen sind. Gewiß, auch der erwachsene „Heterosexuelle“ bedient sich bei seiner Selbsthermeneutik teilweise der Begriffe und Kategorien der scientia sexualis. Zudem dürfte auch er seine Sexualität teilweise in negierender Abgrenzung zu den peripheren Sexualitäten interpretieren. Trotzdem verallgemeinert Foucault das Besondere, wenn er davon spricht, daß der moderne Mensch als Subjekt grundsätzlich seiner Sexualität, und damit dem Geständnis, der scientia sexualis und ihren Klassifikationen unterworfen ist. Diese These trifft primär für den Homosexuellen als „Spezies“, eingeschränkt auch für die anderen als „pervers“ kategorisierten Menschen zu, jedoch kaum für das Gros der Heterosexuellen. Foucaults Einsichten beziehen sich weitgehend auf eine relativ kleine Gruppe des aufstrebenden Bürgertums. Gerade deshalb fällt es schwer, ihm zuzustimmen, daß die Analyse „der Körper und ihrer Lüste“ vom „Problem der ,Arbeitskraft’“ und von dem „Gedanken einer aus ökonomischen Gründen unterdrückten Sexualität“ „abgekoppelt“ werden muß (137f.). Aus diesem Grund wird die Vorherrschaft der Unterdrückung der Körper und ihrer Lüste durch Foucaults Einsichten in Der Wille zum Wissen auch nur sehr begrenzt relativiert. Zwar ist die Perspektive der Repression zweifellos ergänzungsbedürftig. auf die geschichtlich vorherrschenden Formen von Subjektivität haben (vgl. Michel Foucault: Warum ich die Macht untersuche, a.a.O., S. 247f.).: 29 Michel Foucault: Warum ich die Macht untersuche: Die Frage des Subjekts, in: Hubert L. Dreyfus; Paul Rabinow, a.a.O., S. 247, 250. 30 Vgl. Anm. 23. Ansätze zu einer Genealogie ... Zudem findet die Unterdrückung der Körper und ihrer Lüste auch auf der Ebene der Diskurse und der Moral statt. Hauptsächlich ist sie aber bis in das 20. Jahrhundert hinein ein Resultat der konkreten Arbeitsbedingungen, die für das Gros der Bevölkerung in den kapitalistischen Staaten wenig Kraft für eine kontinuierliche Triebbefriedigung und ein ausschweifendes Liebesleben übriglassen, das primär auf die Reproduktion beschränkt bleibt. Foucault blendet zudem völlig die positiven Auswirkungen der Diskursivierung der Körper und ihrer Lüste aus, die sich unabhängig von gesellschaftlichen Machtsystemen vollziehen. Der zum Sprechen gebrachte Körper und die zum Sprechen gebrachte Lust vermag nämlich auch individuelle Wünsche und Bedürfnisse gegenüber dem Partner zu artikulieren. Die Selbstbeobachtung und das Selbsteingeständnis kann zudem häufig später zu einer positiven Luststeigerung und zu einer Lösung von individuellen Hemmungen und Problemen führen. Diese Lösung verdanken die Menschen durchaus auch der Mithilfe der Experten der sciencia sexualis. In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 95-108 Autor: Xaver Brenner Artikel Xaver Brenner Werden zu sich selbst – ein Forschungsbericht Philosophische Lehrveranstaltungen sind oft Orte der Verkündigung und damit Foren ritueller Wiederholung alter Texte. Sie können aber auch Orte offener Begegnung sein und damit Raum bieten für die dynamische Öffnung eben jener schriftlichen Erbschaft. Im besten Fall sind philosophische Foren der Raum, in dem um die Interpretation solcher Texte gestritten wird. Dazu bedarf es im traditionellen Sinn der intensiven Kommunikation zwischen dem Lehrer und seinen Schülern. Doch auch hier muss die Regel gebrochen werden, wenn die Interpretation öffnen soll, was im Text verborgen liegt. Solcher Aufbruch von alten Texten setzt die kreative Energie der Beteiligten voraus. In ihr wird der Lehrer nicht mehr Lehrer und die Schüler werden nicht mehr Schüler sein. Erst dann beginnt etwas zu werden, was noch nicht war, aber immer wird, weil der Text und der Lehrer nur noch Anlass sind. Sie sind der Anlass für die Entfaltung jener Dynamik, die philosophischen Texten eigen ist. Kierkegaard hat das so beschrieben: „Sokratisch gesehen ist jeder Ausgangspunkt in der Zeit sowieso etwas Zufälliges, Verschwindendes, ein bloßer Anlaß; mehr ist der Lehrer auch nicht, und gibt er sich und sein Wissen auf eine andere Weise hin, dann gibt er nicht, sondern nimmt, dann ist er nicht einmal des anderen Freund, geschweige denn sein Lehrer.“1 1 Søren Kierkegaard, Philosophische Brocken, Frankfurt/Main 1984, S. 13. Xaver Brenner In seinen Veranstaltungen habe ich Elmar Treptow als das positive Bild dieses Lehrers kennengelernt. Er gestaltete den Anlass für eine Dynamik des philosophischen Denkens, das sich um Einsicht bemüht. Wobei Einsicht immer mehr war als nur eine Sicht der „Dinge“. Wobei „Dinge“ mehr waren als feststehende Wahrheiten. Und wobei es ihm oft gelang, die Struktur philosophischer Gedanken, ihre Eigen-art und innere Bewegtheit zur Erscheinung zu bringen. In der Umwandlung des Satzes, das „die Form nichts ist, wenn sie nicht die Form ihres Inhalts ist“, lässt sich über diese Veranstaltungen sagen: „Die Form dieser Lern-veranstaltungen brachte einen ganz anderen Inhalt hervor.“ Es war nicht nur möglich, sondern auch gewünscht, anders über philosophische Fragen zu sprechen und ohne lähmende Hochachtung vor der Tradition dieselbe kritisch und kreativ zu befragen. Aus einer solchen Veranstaltung Treptows über die Hegelsche Logik ist meine Auseinandersetzung mit dem Thema „Werden“ entstanden. Ich habe dort gelernt zu sehen, dass ein Motiv des dialektischen Verstehens darin besteht, sich in Beziehung zum Anderen zu sehen und zu begreifen, dass in dieser Beziehung eine Wechselbeziehung geboren wird. Sie bringt ein Drittes hervor, das wir nur gewinnen, wenn wir uns durch diesen Prozess des Hindurchgehens durch Anderes jedes Mal neu schöpfen. Hier also wird von der Eigenart dieser Dialektik die Rede sein und von ihrem Herzstück, dem „Prozess des Werdens“. Die Eigenart liegt darin, dass zwar immer von „Sein“ geredet wird, aber in der denkenden Beziehung der Kategorien eben nicht von „Dingen“ die Rede ist. In ihr liegt die Schwierigkeit, welche die paradoxe Grundstruktur der Hegelschen Logik erzeugt. Zwar erscheinen die Begriffe im statischen Gewand von Kategorien, aber sie können doch immer nur im Verbund und System gedacht werden. – Es ist wie im menschlichen Leben auch: Nur der Mensch kann sich verstehen, der sich auch aus den Augen anderer betrachtet. Dieser, schwierige, Blick aus den Augen der Anderen erzeugt eine neue Sicht auf das eigene Wesen. Diese Sicht haben wir nicht automatisch. Beziehungsdenken denkt immer das Nicht-Ich des anderen Menschen mit. Hegel löst die statischen Begriffe auf. Seine Dialektik ist eine Dialektik des Anderen, der Differenz. Damit ist seine Dialektik in paradoxer Weise gerade nicht das, was „ist“, sondern immer das, was „wird“. Und so erschließt sie Werden zu sich selbst sich auch nur über das Verständnis des „Werdens“.2 Wir müssen daher ständig die doppelte Sichtweise Hegels auf die „Zeit“ und die „Dinge“ mitdenken. Zeit als geschichtliche Zeit ist Veränderung in den „Dingen“. Erst wenn man diese Form der wechselseitigen Abhängigkeit vielfältig bewegter Formen und Inhalte verstanden hat, kann man in die kritische Frage nach der Tragfähigkeit dieser Philosophie eintreten. Wie weit reicht ihre Kraft? Wo erschöpft sich ihre Analyse? Und wo muss weitergedacht werden um im „Prozess des Werdens“ zu bleiben? Von der dynamischen Philosophie Hegels gibt es eine phänomenologische und eine logische Gestalt. Die eine heißt „Phänomenologie des Geistes“, die andere „Wissenschaft der Logik“. Beide Gestalten werden durch den dialektischen Begriff der Geschichte zusammengehalten. Es ist der ihnen immanente Zeitbegriff, der diese Texte so spannend, aber auch so schwierig macht. Was ist die Zeit im Fluss? Hegels Antwort lautet mit Heraklit: „Das Werden.“ Und doch ist sein Werdebegriff nicht aus der Naturbetrachtung gewonnen, sondern entspringt dem Sozialen, dem Gesellschaftlichen3 und bildet die Grundlage des neuen historischen Bewusstseins. Aus diesem Grunde werde ich den Strukturbegriff des Werdens zuerst anhand der „Phänomenologie“ erläutern, um ihn dann in der „Hegelschen Logik“ aufsuchen. Das Werden als Geburt des Sozialen Hegels philosophische Wirkung beginnt mit diesem „seltsamen Buch“, wie er es später selbst nannte, mit der „Phänomenologie“. Und doch enthält sie, recht gelesen, die Dialektik des Werdens: „Denn die Sache ist nicht in ih2 In seiner unvergleichlichen Polemik hat Schopenhauer diesen Hauptgegensatz seiner Auffassung gegen Hegel ausgedrückt: „Eine wirkliche Philosophie der Geschichte soll also nicht, wie Jene alle thun, Das betrachten, was (in Platon’s Sprache zu reden) immer WIRD und nie IST, und Dieses für das eigentliche Wesen der Dinge halten; sondern sie soll Das, was immer ist und nie wird, noch vergeht, im Auge behalten.“ (Die Welt als Wille und Vorstellung. Bd. 2, Kap. 38, S. 518) Natürlich ist der historische Sinn Hegels gemeint, für den, wie Nietzsche einmal sagte, Schopenhauer jedes Verständnis abgeht. 3 Hegel unterscheidet wohl als erster zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Während die Urformen der Gemeinschaft das Soziale organisieren und dabei den Charakter der Konkurrenz als feindliches Element kennen, aber beherrschen und ausschalten wollen, entdeckt Hegel in der beginnenden Moderne die Konkurrenz als die neue Form des Sozialen. Die Dialektik der Konkurrenz, ihr positiver Motor im Negativen bildet für ihn den zentralen Wendepunkt zur neueren Geschichte. Er ist Gegenstand der Transformation in der Phänomenologie. Die Gemeinschaft wird durch die Gesellschaft überformt. Das wird weiter unten noch zu zeigen sein. Xaver Brenner rem Zweck erschöpft, sondern in ihrer Ausführung“, mit der Dialektik des Weges. Deshalb ist in den Erscheinungsformen der Welt nicht „das Resultat das wirkliche Ganze, sondern es zusammen mit seinem Werden“4. Der Weg braucht „Zeit“. In der Wegzeit wendet er jedes Mal seinen Charakter. Wegzeit ist Übergangszeit, geschichtliche Zeit. Das Wesen der Zeit aber ist ihr Zeitgeist, der immer „mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens“ bricht. In ihm geht das Alte in das Neue über. Hegel sagt: „Es ist übrigens nicht schwer zu sehen, dass unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode ist.“ (18) – Als Bild dieser Umgestaltung in der Zeit nimmt Hegel die „Geburt ... beim Kinde“ (ebd.). In ihr bereitet das Neue sich vor; und in der subjektiven Geburt tritt es als objektiver Existenzvorgang auf. Der „qualitative Sprung“ ist bildlich gesprochen eine Geburt: „Aber wie beim Kinde nach langer stiller Ernährung der erste Atemzug jene Allmählichkeit des nur vermehrten Fortgangs abbricht – ein qualitativer Sprung – und jetzt das Kind geboren ist, so reift der sich bildende Geist langsam und stille der neuen Gestalt entgegen“. Alles zeigt, „dass etwas anderes im Anzuge ist.“ (ebd.) Mit diesem Bild will Hegel die doppelte Wirklichkeit des subjektiven Tuns und der objektiven Wirkung darstellen. Wird ein Kind geboren, wird auch die Menschenwelt mit- und wiedergeboren. Denn für diese hat der biologische Prozess immer eine zweite, existentielle Bedeutung. Diese innere Dynamik von biologischem Sein und strukturellem Werden zeigt Hegel in folgendem Satz: „Die Wirklichkeit dieses einfachen Ganzen aber besteht darin, dass jene zu Momenten gewordenen Gestaltungen sich wieder von neuem, aber in ihrem neuen Element, in dem gewordenen Sinne entwickeln und Gestaltung geben.“ (19)5 So gelesen ergibt die Geburt des besonderen Wesens „Kind“ immer ein zweifaches Werden: Es „wird“ der besondere Inhalt geboren; doch dieser verändert sofort auch die Struktur seiner Umgebung. Und damit geschieht ein Drittes: Das Kind wiederholt in seiner besonderen Subjektivität einen objektiven Prozess, der immer gleiche Formen erzeugt und 4 Hegel: „Phänomenologie des Geistes“. In: Werke in 20 Bänden, Bd. 3, Frankfurt/Main 1970, S. 13. 5 Althaus meint, dass die Phänomenologie des Geistes „dasjenige Werk Hegels mit dem stärksten autobiographischen Unterton“ wäre. H. Althaus: Hegel und Die heroischen Jahre der Philosophie. München 1992 Werden zu sich selbst doch besondere Inhalte hervorbringt. Jede Geburt beinhaltet auch den Gesamtprozess der Wiedergeburt der Menschheit. Mit diesem Ansatz löst sich auch die Schwierigkeit jenes berühmten Satzes über die „lebendige Substanz“, der programmatisch den Inhalt der Phänomenologie zusammenfasst. Wir müssen nur verstehen, dass die „lebendige Substanz“, das Kind als „Subjekt“, gleichzeitig auch eine Wirklichkeit ist, in der sich Vater und Mutter setzen. Darin werden sie selbst auch andere. Aus Mann und Frau werden Vater und Mutter erst dann, wenn ihnen im Akt der Zeugung ein Drittes gelingt. Von der Zeugung her erschaffen sie nicht nur ein Kind. Sie erzeugen auch einen „Übergang" von sich, der nur anfänglich in ihnen liegt, dann aber aus dieser Einheit heraus tritt und selbständig wird. Vom Kinde her erscheint ihnen das Zeitzeichen ihres Anderswerdens. Der Satz lautet dann: „Die lebendige Substanz [das Kind] ist ferner das Sein [das objektive Verhältnis], welches in Wahrheit Subjekt oder, was dasselbe heißt, welches in Wahrheit wirklich ist [sich von den Eltern trennt], nur insofern sie [die lebendige Substanz] die Bewegung des Sichselbstsetzens [der vorgeburtliche Wachstumsprozess] oder die Vermittlung des Sichanderswerdens mit sich selbst ist.“ (23) Das Kind wird durch den eigenen Wachstumsprozess im Anderen, der Mutter, zum eigenen Selbst. Das geborene Kind ist „als Subjekt die einfache Negativität“, insofern es sich in der Geburt von den Eltern trennt. Es ist aber auch – aus Sicht des Kindes – die „Entzweiung der Einfachen“ dieses ursprünglichsten Verhältnisses. Aus der Perspektive der Eltern jedoch handelt es sich um eine „entgegensetzende Verdoppelung“: Jeder der Eltern sieht im Kind sein Bild, sich in diesem entgegengesetzten Winzling verdoppelt. Und doch ist dem Kind diese Verdoppelung gleichgültig. Es lebt in seiner Existenz den Gegensatz, seine Verschiedenheit zu den Eltern. Auch hier ist es auf der logischen Ebene „Negation“. Auf seine spröde Art drückt Hegel das so aus: „Sie ist als Subjekt die einfache Negativität, eben dadurch die Entzweiung des Einfachen; oder die entgegensetzende Verdoppelung, welche wieder die Negation dieser gleichgültigen Verschiedenheit und ihres Gegensatzes ist“ (23). In diesem Strukturverhältnis können die Akteure sich zunächst völlig „gleichgültig“ sein. Trotzdem werden sie durch die Verhältnisse zur „Anerkennung“ der neuen Lage gezwungen, und es tritt die Reflexion als notwendiges Moment auf: Die Eltern werden in ihre Aufgabe gezwungen. Sie nehmen in Xaver Brenner der Abtrennung des Kindes durch den Geburtsprozess die neue Gleichheit mit dem Kind in der Familie wahr. Aus diesem Vorgang leitet Hegel dann in der „Rechtsphilosophie“6 die fundamentale Bedeutung der Familie ab. Denn die „wiederhergestellte Gleichheit“ mit dem Kind erzwingt konstitutiv ein neues Bewusstseinsverhältnis. Die Eltern sind nun zu einer „Reflexion ins sich“ gezwungen, in der sie „das Andere in sich selbst“ sehen. Das aber ergibt keine „ursprüngliche Einheit“ mehr und auch keine „unmittelbare“. Das neue Beziehungsgefüge der Eltern ist immer durch das Kind vermittelt. Das ist ihre Wahrheit: „... nur diese sich wiederherstellende Gleichheit oder die Reflexion im Anderssein in sich selbst – nicht eine ursprüngliche Einheit als solche oder unmittelbare als solche – ist das Wahre.“ (23) Dieser phänomenale Vorgang der Geburt des Kindes und der Familie ist für Hegel auf der Ebene der Logik in der logischen Struktur des Werdens vorgebildet. „Es ist das Werden selbst, der Kreis, der sein Ende als seinen Zweck voraussetzt und zum Anfang hat und nur durch die Ausführung und sein Ende wirklich ist.“ (ebd.) Dieses Kreisen, das solcher Art durch sein Ende wirklich ist, nennt Hegel in der „Phänomenologie“ „ein Spielen der Liebe mit sich selbst“. Er betrachtet es als das „Leben Gottes und das göttliche Erkennen“ (ebd.). Und dies ist die Geburtsstätte des nächsten berühmten Satzes: „Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen.“ (24)7 Wie lernt der Mensch? Hegel kann beim Zwang, das Andere anzuerkennen, weil es die notwendige Fortsetzung des Eigenen darstellt, nicht stehen bleiben. Als Aufklärer verfolgt er eine Reihe programmatischer Fragestellungen. Sie lauten seit Sokrates: Wie lernt der Mensch durch seine Praxis? Oder: Wie er-lernt der Mensch sein Wissen? 6 Hegel: Rechtsphilosophie, §158. §160 stellt die drei Elemente Mann, Frau, Kind als Sorgebeziehung dar. Deren Struktur beschreibt er in §161: Es ist erstens das „unmittelbare sittliche Verhältnis ... das Moment der natürlichen Lebendigkeit“. Dieses aber wird in einem zweiten Schritt als „nur innerliche oder an sich seiende ... nur äußerliche Einheit der natürlichen Geschlechter in eine geistige, in selbstbewusste Liebe umgewandelt.“ 7 Dieser Satz hat zu Adornos Gegenthese geführt: „Das Ganze ist das Unwahre.“ (Minima Moralia, Frankfurt/Main 1980, S. 55). Wobei sich zeigt, dass Hegel – zumindest hier – den biologischen Vorgang des Ganzen und seine ersten gemeinschaftlichen Implikationen meint, während Adorno wohl rein das Gesellschaftliche als Ganzes sieht. Werden zu sich selbst Die Frage ist also: wie führt der Weg vom „unmittelbaren Geist“, vom „sinnlichen Bewusstsein“, das „das Geistlose“ ist, zur „Wissenschaft“? Programmatisch drückt das der Satz aus: „Dies Werden der Wissenschaft überhaupt oder des Wissens ist es, was diese Phänomenologie des Geistes darstellt.“ (31) Zunächst scheint es, dass Hegel diese Frage nach dem Erlernen in traditioneller Weise beantwortet. Doch dann zeigt sich, dass er einige wesentliche Schritt weiter geht. In Thesen verkürzt lautet seine Antwort: 1. Wissen ist – als das Wissen des Weltgeistes – schon immer da (alles, was geschieht, ist letztlich das Wahre). 2. Wissen erscheint als ‚Hintergrundmusik’ der großen Vernunft immer erst am Ende des Prozesses. Die Menschen erkennen erst im Nachhinein, dass sie in ihrer Praxis im Vorhinein durch die unsichtbare Vernunft geleitet wurden (Hegels Geschichtsoptimismus). 3. Die Menschen passen sich letztlich immer der Wirksamkeit des Hintergrundes an (Zwang zur Anerkennung). Die soziale Geburt des gesellschaftlichen Werdens Das Muster der Anerkennung als Strukturform des Werdens entwickelt Hegel im berühmten Abschnitt über Herr und Knecht. Sein Augenmerk richtet sich dabei auf den Werdeprozess der eigenen Person im Anderen und durch die Handlungen des Anderen. Strukturell folgt Hegel dabei dem Geburtsmuster der Vorrede. Inhaltlich aber beschreibt er einen gesellschaftlichen Geburts- und Werdeprozess, der keine biologische Grundlage hat, um daraus ein soziales Ergebnis zu erzwingen. Denn die Grundlage des HerrKnecht-Verhältnisses ist schon ein gemeinschaftliches Verhältnis. Doch der verschärfte Ton entspringt der gesellschaftlichen Realität. Und die heißt Konkurrenz. Hegel sucht hier nach dem Zwang, durch den die „Vernunft“ des Weltgeistes die kleinlichen Konkurrenzmotive nutzt, um das große Geschäft des Staatsaufbaus, die Geburt der Gesellschaft, zu bewerkstelligen. Die Rahmenhandlung entnimmt Hegel dem Roman von Diderot: Jacques der Fatalist und sein Herr. Auf der Reise durch Frankreich zeigt sich, dass der Herr nur mächtig ist, weil er auf der Kraft und der praktischen Erfahrung des Knechtes aufruht. Doch genau diese Handlungsmacht des Knechtes führt andererseits zur gesellschaftlichen Ohnmacht des Knechtes. Umgekehrt offenbart sich die gesellschaftliche Macht des Herrn auf dem praktischen Feld als Handlungsohnmacht. Im Laufe der Reise sucht sowohl der Xaver Brenner Herr, als auch der Knecht die Rolle des jeweils anderen zu übernehmen. Doch beide scheitern. – Dem Sinn des unternommenen Rollenwechsels kommt man jedoch nur auf die Spur, wenn man die Reise und ihr Gelingen als das gemeinsame „Projekt“ versteht. Wie bei der Geburt das Kind ist hier die Erzeugung des Werkes das Ziel: „Jedes [Selbstbewusstsein] sieht das Andere dasselbe tun, was es tut; jedes tut selbst, was es an das Andere fordert, ...“ D.h.: Was ich als Forderung stelle, muss ich selbst können: „... und tut darum, was es tut, auch nur insofern, als das Andere dasselbe tut [das Projekt verwirklichen]; das einseitige Tun wäre unnütz; weil, was geschehen soll, nur durch beide zustande kommen kann.“ (146 f.) Dieses „Spiel der Kräfte“ (147) durchschauen die Akteure nicht. Doch wie beim Kind wirkt hier das Werk als die notwendige „Mitte“ und ist doch auch der „absolute Übergang in das entgegengesetzte“ (147). Auf dem Weg zum gemeinsamen Werk treffen der Herr und der Knecht ihr Projekt deshalb als ein Werk der Mitte, weil jeder seinen Teil dazu tut. Ohne ihn kann es als drittes Element zwischen ihnen nicht erzeugt werden. Ihre jeweilige Macht ist deshalb auch ihre Ohnmacht, weil sie getrennt nichts erreichen. Ihr Teil ist dann nicht einmal die Hälfte. Es ist wie beim Werden des Kindes. Weder Vater noch Mutter allein können das Kind erzeugen. Ihre Hälfte ist nur wirksam, wenn sie sich in der Mitte zwischen beiden verbinden. Diese Mitte aber wird zu einem selbständigen Element, zum Kind, zum Werk. Dadurch aber hat sich das Werk auch von seinen Erzeugern verabschiedet. Doch soweit sind wir noch nicht. Denn zunächst erkennen Herr und Knecht, dass sie im jeweils Anderen die Mitte haben und in ihm etwas erzeugen, was sie sind und auch schon nicht mehr sind: „Jedes ist dem Anderen die Mitte, durch welche jedes sich selbst vermittelt und zusammenschließt, und jedes sich und dem Anderen unmittelbares für sich seiendes Wesen, welches zugleich nur durch diese Vermittlung so für sich ist. Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend.“ (147) Indem beide sich nun bekämpfen – auch bis zum „Tode“ (149) – , erzeugen sie zunächst nur ein „Ding“, sich selbst als einen anderen Menschen. Der Herr ist vom Knecht frustriert und der Knecht vom Herrn. Kurzfristig gehen beide „gleichgültig“ ihre Wege.8 Und doch sind sie – ohne es zu bemer8 Vgl. dazu auch die römische Geschichte vom Auszug der Plebejer aus der Stadt. – Die zweite Auffälligkeit liegt in der Formulierung der „gleichgültigen Verschiedenheit“ (23), die eine „einfache Negativität“ erzeugt. Werden zu sich selbst ken – durch den Anderen in sich selbst (ihren Charakter) anders geworden. Zu begreifen hätten sie, dass die „Negation“ des Anderen, die ihre Verbindung für kurze Zeit „aufhebt“, nur eine vorübergehende ist. Hinter ihrem Rücken hat der Weltgeist unsichtbar schon gewirkt und sie verändert. In der recht verstandenen „Negation des Bewusstseins“ wäre die Aufhebung ihrer Zweierbeziehung als Lernbeziehung verlaufen. Sie hätten gelernt und eingesehen, was tatsächlich stattgefunden hat. Nämlich: „... dass es das Aufgehobene aufbewahrt und erhält und hiermit sein Aufgehobenwerden überlebt.“ (150) Das Werk oder „Ding“ ist die „Arbeit“ (153). Indem der Knecht es hervorbringt, ist er nicht nur selbständig. In ihm erzeugt die Arbeit, deren Produkte er nicht konsumiert, sondern bestehen lässt, einen Bildungsprozess: „Die Arbeit hingegen ist gehemmte Begierde, aufgehaltenes Verschwinden, oder sie bildet.“ (153) In dieser Vergegenständlichung der Arbeit haben Herr und Knecht unter der Hand ihre Veränderung erfahren. In ihr hat eine Rückkoppelung auf ihr Selbstbewusstsein stattgefunden, und ihre Existenz hat eine Wandlung erfahren. Das „Produkt“ wird außer ihnen bleiben (die Reise ist geglückt, das Werk ist gelungen, das Ding hergestellt). Doch hinter ihrem Rücken haben sie sich als Personen verändert. Obwohl sie in der „Einzelheit“ ihres Bewusstseins sind, wissen sie jetzt, dass sie durch den Anderen anders geworden sind. Obwohl beide am Ende vom Produkt getrennt sind, bleibt in ihrer Erfahrung, dem „Element des Bleibens“, die Form der Reiseerfahrung erhalten. Es ist zur inneren „Form“ (154) der Erfahrung“ geworden. Auch wenn sie „hinausgesetzt wird“ und nun hinter ihnen liegt, wird sie „nicht ein Anderes als es“. Das jeweilige Bewusstsein weiß die Erfahrung der Reise als die eigene. In jedem der Teilnehmer am gemeinsamen Prozess ist ein neues Produkt geboren worden. Nicht in der Materialität, wohl aber in der Idealität des Selbstbewusstseins bleibt es bestehen. Diese Einsicht wird in Hegels Formulierung zum „reinen Fürsichsein“ (154): man kann mir den Erfolg nicht nehmen. Dieser Sinn von Selbstbewusstsein lässt die Akteure andere werden, in der Beziehung zu einer anderen Welt, in der sie ihren eigenen Sinn immer wiederfinden werden: „Es wird also durch dies Wiederfinden seiner durch sich selbst eigener Sinn, gerade in der Arbeit, worin es nur fremder Sinn zu sein schien.“ (154) Xaver Brenner Fassen wir die Strukturformen dieser Herr-Knecht-Dialektik zusammen, so zeigen sich auf der Handlungsebene die beiden Elemente des Herrn und des Knechts: die gesellschaftliche Macht als Kommando über den Knecht ist im Herrn mit der Handlungsohnmacht auf dem praktischen Feld verbunden; und die Handlungsmacht des Knechts in der Arbeit ist an dessen gesellschaftliche Ohnmacht unter dem Kommando des Herrn gebunden. Auf der Erfahrungsebene erfahren sich beide Personen als Objekt von Prozessen, wenn sie im Scheitern von Handlungen ihr Unvermögen einsehen, und begreifen sich im Erfolgsfall als Subjekt ihrer Handlungen. Auf der logischen Ebene schließlich – die Hegel ständig im Auge hat – hat die selbstbewusste Person „Sein“, und im Entwicklungsprozess des HerrKnecht-Verhältnisses steht ihr die jeweils andere Person als das „Nichts“ der eigenen Person gegenüber9. Beide Personen berühren sich in der Verneinung und sind doch über diesen scheinbar absoluten Graben hinweg aufeinander angewiesen. Das „Werden“ ihres gemeinsamen Projekts setzt paradoxer Weise ihre doppelte Andersheit (doppelte Negation) voraus. Sie sind nicht nur nicht der Andere. Ihnen fehlt auch die Fähigkeit des Anderen. Und doch wissen sie gezwungenermaßen, dass sie sich in dieser absoluten Fremdheit anerkennen müssen, damit ein Drittes, ihr gemeinsames Werk gelingt. In ihm sind sie vereinigt, obwohl ihnen das Werk selbst wieder als fremdes „Ding“ gegenüber tritt. In dieser Struktur zeigt sich das Grundmodell der Hegelschen Logik: dort wird der Gedanke des „Übergehens“ als die innere Beziehung vom „Sein“ zum „Nichts“ dargestellt. Dieses Grundmuster des Werdens leitet als zentraler Gedanke den Fortgang und die Entwicklung der Logik. Das logische Werden Das zentrale Problem einer dialektischen Logik sieht Hegel in der Verflüssigung der statischen Begriffe von Sein und Nichts. Das „Sein (als) „reines 9 Hegel geht es darum zu zeigen, dass dieses „Nichts“ des Anderen der eigenen Person nicht gleichgültig sein kann, denn diese andere Person ist zwar das Nichts der eigenen, aber für die Befindlichkeit der eigenen Person im Arbeits- und Austauschprozess eben gerade ein Seiendes und ein „Sein“. Trotzdem wird ihm das immense Schwierigkeiten machen, weil auf der formalen Ebene der Logik die Elemente der phänomenalen Welt nur unzureichend darstellbar sind. Werden zu sich selbst Sein“ und das „Nichts, das reine Nichts“ sind ihm „dasselbe“10. Diese beiden Grundkategorien sind deshalb auch statisch nebeneinander, weil sie durch ihre Selbstdefinition zwar beide rein, aber beide auch „leer“ sind.11 Die Bewegung, „das Werden“ geschieht für ihn nun durch das Paradox, das eigentlich jede dieser beiden Kategorien, eben dadurch, dass sie „absolut unterschieden“ sind, an sich eine Gleichgültigkeit mittragen, die es erlaubt auch zu sagen, dass jedes ebensogut „in sein Gegenteil verschwindet“ (83). Dies zuzugeben, zeigt sich das Paradox: Jede der beiden Kategorien ist in ihrer absoluten Identität. Doch in dieser unterschiedslosen Einheit mit sich und dem Anderen liegt auch die Differenz des anderen Etwas. Hegel selbst illustriert dies Paradox am Beispiel von „Romeo und Julia“. Aus nichtigem Anlass, der eigentlich nichts ist, kann aus der liebenden Vereinigung Eifersucht und Entzweiung werden.12 Dies soll zeigen, dass in der absoluten Identität ein „Übergang“ (97) gedacht werden muss. „Sein und Nichts“ sind gerade nicht vollständig „voneinander isoliert“ (98). Hegel will nun zeigen, „dass es gar nichts gibt, das nicht ein Mittelzustand zwischen Sein und Nichts ist.“ (111) Das allein sei „Dialektik“. Hegels zentraler Gedanke lautet also, dass jedes „Sein“ in13 sich selbst ein „Nichts“ habe, wie das „Nichts“ in sich ein „Sein“ hat, sonst wäre es nichts. Es ist jeweils das innere „Übergehen“ des Einen zum Anderen. Der entscheidende Satz lautet: 10 f. 11 Hegel: Wissenschaft der Logik I. In: Werke in 20 Bänden, Bd. 5, Frankfurt 1970, S. 82 Hegel verwendet hier den Begriff der „vollkommenen Leerheit, Bestimmungs- und Inhaltslosigkeit“. Damit wird aber etwas substantiviert, was sich nicht als Etwas darstellt. Auf dieses Problem wird der Existenzansatz Kierkegaards eingehen. Die Leerheit ist ein menschlicher Zustand und als solcher nicht abstrakt, sondern konkret, nicht "interesselos", sondern voll von interessierter "Wirklichkeit". Vgl.: Kierkegaard: Philosopische Brocken. Zweiter Teil, Kap. 3, § 1. Das Existierende; Wirklichkeit. In der Frage des inneren Übergangs treffen sich beide jedoch wieder. 12 Siehe die Entwürfe über „Religion und Liebe (1797/1798)“. In: Werke in 20 Bänden, Bd. 1, Frühe Schriften. Hier heisst es: „Julia und Romeo ... unendliche Vereinigung ... Aufhebung aller Unterscheidung; das Sterbliche hat den Charakter der Trennbarkeit abgelegt, und ein Keim der Unsterblichkeit, ... ein Lebendiges ist geworden.“ (S. 248) 13 Eigentlich lautet die Formulierung Hegels: „An-sich-sein“. Doch diese Form umschließt schon die doppelte Einheit, von der er hier spricht. Um den inneren Prozess dieser ersten logischen Einheit zu beschreiben, erscheint es mir als richtiger, die Formulierung „in sich selbst“ zu wählen und damit den Gedanken der inneren Unterschiedlichkeit und ihres Übergangs auszudrücken. Xaver Brenner "Nach dieser ihrer Unterschiedenheit sie aufgefasst, ist jedes in derselben als Einheit mit dem anderen. Das Werden enthält also Sein und Nichts als zwei solche Einheiten, deren jede selbst Einheit des Seins und Nichts ist; die eine das Sein als unmittelbar und als Beziehung auf das Nichts; die andere das Nichts als unmittelbar und als Beziehung auf das Sein: die Bestimmungen sind in ungleichem Werte in diesen Einheiten." (112) Jede dieser Einheiten hat also in sich ein ‚Gefälle’, eine qualitative Differenz. Das will Hegel mit der Formulierung vom „ungleichen Werte“ ausdrücken. Hegel will diesen Anfang14 aus dem „Nichts“ des Wortes (Logos)15 in der Logik selbstverständlich nicht theologisch setzen, sondern logisch beweisen. Dazu muss das „Unbestimmte“ des Anfangs linear zum Sein weitergeschrieben werden. Daraus ergibt sich folgendes Bild: (Nichts / Sein ) Die Doppelung im Selbstbezug als Selbstentfaltung führt zu zwei Paaren: Nichts / Sein Sein / Nichts Entstehen Vergehen In dieser Selbstbewegung und Selbstauslegung als Entstehen und Vergehen haben wir das Herzstück und den Lebensnerv der Logik vor uns, die Grundstruktur des innerlichen Selbst-werde-prozesses. „Sie [Nichts und Sein] heben sich nicht gegenseitig, nicht das eine äusserlich das andere auf, sondern jedes hebt sich an sich selbst auf und ist an ihm selbst das Gegenteil seiner." (112) Von jetzt an arbeitet Hegel mit dieser Struktur, die aus ihren gegenseitigen Beziehungen entstanden ist. Der Grundsatz, "dass die Negation der Negation Positives ist" (108), oder 'Duplex negatio est affirmatio', findet seine Anwendung in der Aufhebung der "gedoppelten Bestimmung" Nichts/Nichts in ein Sein (= Entstehen) und der Doppelung Sein/Sein in ein Nichts (= Vergehen). In dieser Grundstruktur ist sowohl die Kreisgestalt der Logik angelegt als auch der Strukturgedanke enthalten. Denn in der Kreisfigur, auf die Hegel 14 Schon aus Gründen des christlichen Schöpfungsaktes muss Hegel gegen den Satz: Ex nihilo nihil fit“ (Aus nichts entsteht nichts.) antreten. Siehe: Logik I, a.a.O., S. 85. Er schreibt über den Grund des Hervorbringens: „So in Gott selbst enthält die Qualität, Tätigkeit, Schöpfung usf. wesentlich die Bestimmung des Negativen, – sie sind die Hervorbringung eines Anderen.“ (S. 86) 15 In der Religionsphilosophie, a.a.O., Bd. 17, S. 234 heisst es: „Der Geist setzt sich voraus, ist das Anfangende, das Letzte ist das Erste.“ Werden zu sich selbst immer wieder zurückkommt, ist der Anfang nur aus dem Ende, das Ende aber nur aus dem Anfang zu erklären. Deshalb erledigt sich in diesem System auch die Frage nach dem absoluten Anfang, weil aus diesem Kreislauf nicht ausgestiegen werden kann. Daher läßt sich auch die Frage, was denn das zuerst sich Bewegende sei, erst am Ende der Logik erläutern. Der Strukturgedanke offenbart schon jetzt, dass die Summe der Teilsysteme als die innere Bewegung dieser Einheit mehr ist als ihre rechnerische Addition: 1+1 =3 (Vater + Mutter) = Kind Das „Werden“ präsentiert sich in Hegels System als ein wechselweises Vorkommen von Entstehen und Vergehen. Dabei erscheint die Ordnung, in der beide vorkommen, auf den ersten Blick noch relativ willkürlich. Denn aufgrund der Doppelung des Anfangs verläuft er in zwei Richtungen. Die eine führt zu ihm hin, die andere von ihm weg. Beide aber überkreuzen sich im Punkt des Übergangs, und für diesen Scheitelpunkt lassen sich drei Strukturmodelle angeben. Das erste versucht aus dem Vergehen, also aus dem Nichts, den Fortgang zum Sein zu erklären; das zweite nimmt dieses Sein als das Entstandene selbst zum Ausgangspunkt und erklärt daran sein Vergehen. Die dritte Möglichkeit schließlich fasst beide Seiten zusammen, wodurch ein sich selbst begründender, sich schließender Kreis entsteht. Insofern dieses dritte die beiden anderen ohne Verluste subsumiert, muss ihm der Vorzug gegeben werden. Die Bewegung der Logik beginnt also, den ersten Kreis ihrer Bestimmungen in der Aufhebung des Werdens zu vollenden: "Das Gleichgewicht, worein sich Entstehen und Vergehen setzen, ist zunächst das Werden selbst. Aber dies geht ebenso in ruhige Einheit zusammen. Sein und Nichts sind ihm nur als Verschwindende; aber das Werden als solches ist nur durch die Unterschiedenheit derselben. Ihr Verschwinden ist daher das Verschwinden des Werdens oder Verschwinden des Verschwindens selbst. Das Werden ist eine haltungslose Unruhe, die in ein ruhiges Resultat zusammensinkt." (113) Wenn Sein und Nichts verschwinden, so ist "ihr Verschwinden ... das Verschwinden des Werdens", also: das "Verschwinden des Verschwindens selbst." (113) Die Begründung für diesen zweiten Schritt des Verschwindens liegt in der Xaver Brenner Bewegung des Werdens, denn es selbst hat sowohl den Prozess als auch, im Prozess, sich selbst über sich hinausgetragen. In der „Phänomenologie“ stand an dieser Stelle als das ruhige Resultat das „Ding“, das „Werk“, die „Arbeit“. Und die Beziehung der Akteure aufeinander war ein Wissen, dass sie anders geworden sind. In der „Logik“ verschwindet die Bewegung, das Werden, und es entsteht ein „ruhiges Resultat“. Hegel nennt es „Dasein“, indem Sein und Nichts anders geworden sind. *** Mit dieser Grundstruktur der Logik bearbeitet Hegel die Formen des Wissens. Die Weltgeschichte als Prozess des Wissens hat diese ‚Hintergrundmusik’. Nach diesem Grundmuster ist sie der große Werdeprozess, dessen Handlungen durch die Hyperstruktur des Weltgeistes determiniert sind. Das Lernen ist so der ständig von diesem Modell korrigierte und bestimmte Handlungsprozess und die Erweiterung des Wissens. In dieser Form lehrt der „große Lehrmeister“ das „System“ und hält seine Schüler in Abhängigkeit. Als letzte Gestalt der griechischen Tradition von Platon und Aristoteles gelangt Hegel nicht über das Lehrmodell hinaus. Alles, was Wahrheit ist, ist darin die verborgene Wahrheit (aletheia); und der Prozess der Wissensaneignung ist nur ein Entbergen, ein Belehrtwerden. Kierkegaards tiefe Einsicht, dass der Lehrer nur der Anlass ist, und daß das Lernen wesentlich Selbstprozess ist, treffen wir hier nicht. Schon aus Platzgründen muss ich hier mit der Behauptung enden, dass Hegel nur zum logischen Begriff des Werdens kommt, nicht aber zum lebendigen Werden, der Existenz. Insofern scheitert er großartig. So ist für die Frage des Werdens Hegel selbst wiederum nur ein großer Anfang. In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 109-114 Autor: Rüdiger Brede Artikel Rüdiger Brede Die dreifache Stellung zur Natur und der Finanzmarkt. Anmerkungen zur ökologischen Ästhetik Die Bedeutung der Natur für unser Dasein und für die Möglichkeiten unserer Tätigkeiten ist unbestritten. Sie kann mit alltäglicher Evidenz nachvollzogen werden. Die Art unserer Tätigkeiten jedoch, d.h. die Regeln, die unseren praktischen Umgang mit den Naturbedingungen bestimmen, sind durch den kulturell-historischen Prozeß und die tradierten ästhetischen Anschauungen geprägt. Insbesondere können wir unsere Tätigkeit in der Anschauung der natürlichen Gegenstände und mit Freude an der Natur vollziehen oder aber von den natürlichen Grundlagen abstrahieren und die Handlungsnormen unter Absehung des systemischen Naturzusammenhangs praktizieren. Elmar Treptows Entwurf einer „ökologischen Ästhetik” ist ein Plädoyer für den ersten Weg: weil die Natur nicht nur unser Dasein bedingt und unsere Naturbeziehung nicht nur von der Gesellschaft geprägt ist, sondern weil „die Natur alle menschlichen Selbst- und Entgegensetzungen (übergreift)” und sie daher „den Vorrang vor der gesellschaftlichen Praxis”1 hat, schadet der Mensch sich selbst, wenn er die Natur in all seinen Tätigkeiten nicht zugleich in ihren eigenen Maßen denkend anschaut und mit den Gefühlen der Lust und Unlust ästhetisch erlebt. In meinem Beitrag möchte ich – vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche – enige praktische Argumente für die „ökologische Ästhetik” versammeln. Ich möchte darauf hinweisen, daß die 1 Elmar Treptow, Die erhabene Natur. Entwurf einer ökologischen Ästhetik, S. Rüdiger Brede Weiterentwicklung ökonomischen Handlungsmuster – bei aller Schwierigkeit – selbst zunehmend mehr zu einer ästhetischen Aneignung der Natur (mit Ihrer Schönheit und Erhabenheit) beitragen können. I. Dieser Beitrag läßt sich – auch als immanenter Zwang darstellbar – exemplarisch am Baum, einem ökologischen System im Kleinen wie im Großen, begreiflich machen. Der Baum kann ästhetisch angeeignet werden: als ein Beispiel natürlicher Schönheit bewundert und im Garten gehegt und gepflegt werden. Und nicht erst seit dem sog. „Waldsterben” faszinieren diese naturwüchsigen Formen unseren Geist in Kunst, Kultur und Wissenschaft. Bekannt sind Caspar-David Friedrichs Baumdarstellungen, und Josef Beuys veranlaßte zur Documenta die Pflanzung von siebentausend Bäumen (Eichen und Gingko) in und um Kassel. Zugleich aber unterliegt der Baum schon seit jeher der Nutzung durch menschliche Zwecke und Wirtschaftsweisen, die vom Ästhetischen des Baumes abstrahiert und ihn als den bloßen Rohstoff Holz genutzt haben. Heute aber hat die Holzindustrie globale Dimensionen angenommen. Große Forstunternehmen und Papierhersteller sind weltweit aktiv und einige hiervon sind durch ihre kurzsichtige Ausweitung und Steigerung der Baumvernichtungen aktiv an der Zerstörung des Waldes als Teil des gesamten Ökosystems unseres „Blauen Planeten” beteiligt. Dieser Prozeß macht nun die Fortentwicklung einer nachhaltigen Forstwirtschaft erforderlich und den internationalen Schutz der Regenwälder notwendig (wie ihn übrigens schon seit Jahren u.a. Greenpeace fordert). Eine solche nachhaltige Wertschöpfung aber kann den Baum nicht mehr nur ästhetisch betrachten oder den Wald nur praktisch nutzen, sondern muß ihn als Teil eines umfassenden kulturellen-natürlichen Systems begreifen und befördert dadurch die Möglichkeit seiner ästhetischen Anschauung. Denn eine nachhaltige Wertschöpfung wahrt zu einer andauernden Nutzbarmachung eine gewisse Distanz der Anschauung und Perspektive. Sie fördert die Bereitschaft, die Natur in ihren eigenen Maßen denkend anzuschauen; sie unterstützt die Beteiligten dazu, die Natur auch ästhetisch, in ihrer Schönheit wie Erhabenheit, zu erleben. Allgemein gesagt bedeutet dies: Die unendliche Natur – nicht als das strukturlos Unbestimmte, sondern als das „sich in den Kreislaufsystemen des Die dreifache Stellung der Natur ... Kosmos und der Erde”2 Organisierende – bringt die irdische Artenvielfalt der belebten Natur hervor. Erst diese sogenannte Biodiversität ermöglicht die Erhaltung der Lebensräume. Da nun aber diese Komplexität der natürlichen Kreislaufsysteme sich durch einen labiles Gleichgewicht von Werden und Vergehen erhält, macht sie die Respektierung durch den ökonomischen Nutzer erforderlich. Dies zeigen schlagend die zunehmend großen ‚Krisen’ in der Landwirtschaft, die, wie etwa die BSE-Gefahr, aus der Mißachtung dieses System- und Kreislaufcharakters der Natur resultieren. Die Artenvielfalt ist nicht nur eine ganz wesentliche Bestandsgröße des globalen Naturhaushalts; sie besitzt auch einen ökonomischen Wert, der sich von einem zukünftigen Nutzen für den Naturhaushalt und den Menschen ableitet. Dabei erschwert jedoch der gleichzeitig komplexe und fundamentale Charakter der Biodiversität eine umfassende Schätzung ihres Wertes; denn die Berechnung des allemal endlichen Nutzens, den die natürlichen Arten haben könnten, reicht nicht hin, das ‚Unendliche’ der Natur in ihren Kreislaufsystemen darstellen zu können. Derzeit soll nach ‚wissenschaftlichen’ Schätzungen allein der Marktwert von aus genetischen Ressourcen abgeleiteten Produkten pro Jahr 500 bis 800 Milliarden US-$ betragen3. II. Durch die breite internationale Diskussion über das Thema der „Nachhaltigkeit/Sustainability” wie auch die Debatten um deren wissenschaftliche, politische und ethische Aspekte, die u.a. im Rahmen der Initiativen zur „Lokalen Agenda 21” geführt wurden, ist bei vielen die ästhetische Wahrnehmung der Natur vertieft worden, und sie hat weltweit für den Umgang mit den natürlichen Ressourcen sensibilisiert. Ein Ergebnis dieser Änderung stellt die international diskutierte „Erd-Charta – Werte und Grundlagen für eine nachhaltige Zukunft” dar, die den Anspruch und auch die Möglichkeiten einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise in prägnanter und inspirierender Weise vorstellt. Sie bildet – nicht zuletzt wegen der vorgenommenen gründlichen Auswertung und Zusammenfassung von früheren Um2 ebd., S. Zu diesem Zusammenhang von Naturhaushalt und Finanzmarkt mit Bezug zum Portfoliomanagement siehe die innovative Studie: Frank Figge, Biodiversität richtig managen – effizientes Portfoliomanagement als effektiver Artenschutz. Hg. von CSM-Center for Sustain. Management, Lüneburg, und Gerling Versicherungen, Köln 2001. 3 Rüdiger Brede welt-Untersuchungen und der Aufnahme einer internationalen Debatte zu den Themen ‚Umwelt’ und ‚Entwicklung’ – einen tatsächlichen Wendepunkt für eine Vision der Nachhaltigkeit und einen globalen umweltethischen Werteansatz. Die in der „Erd-Charta” formulierten Prinzipien sollen nun in praktischen Projekten weiter erprobt und überarbeitet werden. (zu weiteren Information siehe: Info-Seiten im Internet.) Die Gefährdungen der grundlegenden Strukturen durch die gegenwärtige Wirtschaftsweise wird mittlerweile auch immer intensiver vom internationalen Finanzmarkt wahrgenommen und aufgearbeitet. Es ist daher auch nicht erstaunlich, daß selbst Banken und Versicherungsunternehmen mehr und mehr umweltbezogenene Aspekte ihrer eigenen Betriebsführung in ihre Managementsysteme integrieren. Im Zuge der wachsenden Risiken und der erweiterten Anforderungen des Finanzmarktes an Transparenz und Werthaltigkeit der Unternehmensberichterstattung werden sog. „Umweltberichte” verstärkt in die Geschäftsberichte aufgenommen oder zu „Nachhaltigkeitsberichten” weiterentwickelt. (Ein aktuelles Beispiel stellt die Berichterstattung der Credit Suisse-Gruppe dar, die in ihrem neuesten Nachhaltigkeitsbericht sehr umfangreich über umweltbezogene, soziale und humanitäre Aspekte der Geschäftsfelder und über das internationale Engagement der Mitarbeiter berichtet. Weitere interessante Beispiele – auch zum Thema Klimaschutz und Finanzmarkt – sind in den Internetdarstellungen der UBS, der Swiss Re und der Münchener Rück zu finden.) Parallelen zu diesen Entwicklungen auf dem Finanzmarkt gibt es auch im Bereich von Politik und Wirtschaft, in dem sich auf Initiative des UN-Generalsekretärs Kofi Annan das weltweite Bündnis „Global Compact” gebildet hat, das führende Wirtschaftsunternehmen integriert. Die Dringlichkeit, das wirtschaftliche Handeln an der Erhaltung und am Schutz der natürlichen Kreisläufe und der Artenvielfalt auszurichten, hat auch die institutionalisierten Wissenschaften erreicht. Hier sei nur auf den Aufruf zu einer neuen „Sustainability Science” verwiesen, die Ökonomie mit Ökologie, globale Trends mit lokalen Eigenarten und akademische Ausbildungsgänge mit praktischer Problemlösungkompetenz zu verbinden sucht.4 Die Schaffung einer solchen Synthese aber macht eine „ökologische Ästhetik” 4 Siehe: Kates, Clark et al: Sustainability Science. In: Science 292, 2001, S. 641 ff. – Auch: Krol, Karpe: Ökonomische Aspekte von Nachhaltigkeit. Umweltforschung Band 1, hg. vom Umweltbundesamt, Münster 1999. Die dreifache Stellung der Natur ... erforderlich, welche die sich organisierende Natur in ihrer Schönheit und Erhabenheit betrachtet, und die einer ganzheitlichen und „transdisziplinären Forschung” zugrundeliegt.5 Eine solche Forschung muß und wird den Schöpfern der globalisierten „Unternehmenswerte”, den Verfechtern des „shareholder value”, kritisch den Spiegel vorhalten. Sie wird der ökonomischen Pragmatik, die sich an nichts als den Erfordernissen des Finanzmarkts orientiert, eine ökologische Ästhetik entgegenhalten, die die Natur nach den ihr eigenen Maßen beurteilt, und daraus finanz- und wirtschaftspolitische Handlungsstrategien ableitet. III. Letztlich jedoch erfordert eine solche Überwindung der Krise der profitüberhöhenden Wertschöpfung in eine Ästhetik der Natur die „Kunst des Friedens” (H.P. Duerr) als der politischen Basis einer fruchtbaren Weiterentwicklung der globalen Gegensätze. Nur durch eine Ausdehnung der gesellschaftlichen Freiräume durch „Frieden” und eine nachhaltige Entwicklung kann die Krise der verselbständigten Nutzung der Natur (durch eine abstrahierende Wertschöpfung) positiv genutzt werden. Nur durch eine solche Entwicklung kann die Selbständigkeit der Natur mit ihren eigenen Kreisläufen und Maßen in ihrer Erhabenheit erhalten werden. Diese Kunst des Friedens bedarf jedoch ebenfalls der Anschauung des „intensiv Unendlichen”, welche die Natur nicht als den bloßen Kampfplatz der menschlichen Interessen wahrnimmt, sondern sie als das erlebbar macht, was „alle menschlichen Selbst- und Entgegensetzungen (übergreift)”. Eine solche Kunst aber macht heute das Dringlichste, den weltweiten Schutz des Klimas als das wesentliche Programm einer neuen „Welt-Innenpolitik” erforderlich; denn ohne diesen Schutz würden die Grundlagen unseres Daseins und jeder schönen Anschauung zerstört werden. Soviel Erfahrung, Lernen, Wandel und Neuschaffung Hat es noch nie vorher gegeben. Die Geschichte der Menschheit ist einzigartig, Sie in den Büchern der Geschichtsschreiber 5 vgl. dazu: Gertrude Hirsch Hadorn: Gehversuche in Sachen Ganzheitlichkeit. In: GAIA 1, 2002, S. 7 ff. Rüdiger Brede Vorbeiziehen zu sehen. Verewigt in Monumenten, Statuen, Pyramiden, Mauern, Türmen, der Natur entnommene, verfeinerte Gärten, Parks, Seen und Landschaften. So erkennt sich der Mensch wieder Auf einem Höhepunkt seiner Technik, Kunst, Kultur und Lebensart. Das ist der Moment, um innezuhalten und zu schauen, Wo er jetzt steht. Wie könnte er das besser, als sich für einen Augenblick Über die Dinge zu erheben und aus der Vogelperspektive Oder gar aus der Sicht der Sterne Alles zu betrachten.6 So möchte ich denn auch zur weiteren Auseinandersetzung mit der „ökologischen Ästhetik” anregen – ganz im Sinne von Goethes Satz: „Der Irrtum wiederholt sich immerfort in der Tat, deswegen muß man das Wahre unermüdlich in Worten wiederholen.” Infoseiten im Internet: a) zu Klimaschutz, Naturverhältnissen, Regenwald, Entwicklungsprojekten: erdcharta.de; germanwatch.org; rainforestweb.org; janusfoundation.org; oeko.de; worldwatch.org; umweltbundesamt.de; zukunftsfähigkeit.de b) zu Nachhaltiger Wirtschaftsweise, Umweltberichterstattung , Sustainability/Finanzmarkt: globalcompact.org; unep.org; unepfi.net; globalreporting.org; eurosif.info; tomorrow-web.com; csreurope.org; oekomresearch.de; ecoreporter.de; ethisches-investment.de; sustainabilityzurich.ch 6 siehe: Die Janus-Stiftung (www.janusfoundation.org) In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 115-119 Autor: Wolfgang Habermeyer Artikel Wolfgang Habermeyer Für einen Lehrer Es ist Montagnachmittag, oder Freitagnachmittag. Elmar Treptows Seminare sind seit Jahrzehnten immer entweder am Montag oder am Freitag, nachmittags. Man kann sich als Lehrer in der Philosophie entweder an das Ewige halten, an das quasi Ewige, an die Philosophia perennis, wie die Fachleute sagen. Man lehrt und unterrichtet dann sein ganzes Leben lang die Vorsokratiker bis Aristoteles und meinetwegen die Stoiker. Oder man lehrt Kant und die Neukantianer oder Hegel und Junghegelianer. Kant und Hegel lehren die wenigsten. Ein Leben reicht dafür wohl nicht aus. Elmar Treptow lehrt Marx. Am Anfang direkt: "Marxistische Ästhetik", "dialektische Logik in Marx' Kapital" oder "Marx, Die deutsche Ideologie". Aber das war nur in den Siebzigern und bis Mitte der Achtziger. Seither lehrt er auch Marx, aber anders. Seine Seminare hatten dann Titel wie "'Tugend' in der gegenwärtigen praktischen Philosophie" oder "'Freiheit' als philosophische Zentralkategorie". Über diese Themen erarbeitete er sich eine Lehrmethode, die von da an bestimmend für ihn bleiben sollte. Er greift nämlich seitdem Themen auf, die im Schwange sind, über die geredet wird, die die Leute, die uns unmittelbar beschäftigen. Dies ist selbstverständlich kein auch nur irgendwie geartetes Heranwanzen an junge Leute, um ihnen dann unter dem Deckmantel der Aktualität nur doch wieder den alten Marx unterzujubeln. Nein, er nimmt das ernst, was seit jeher junge Menschen zur Philosophie bringt: Fragen aus der eigenen Zeit, aus dem eigenen Leben so zu behandeln, dass man sie überhaupt erst mal als tatsächliche Frage begreifen kann. Als Frage an uns und unsere Geschichte und damit auch an die ganze Geschichte der Philosophie. Was denken wir, wenn wir meinetwegen über Natur oder Fortschritt nachdenken, was denken heutige Autoren, die über Rassismus Wolfgang Habermeyer oder Menschenrechte schreiben? Warum und wie spiegeln sich darin Denkund Argumentationsmuster wieder, die einige Menschen, die man Philosophen nennt, schon seit vielen Jahrhunderten beschäftigt haben? Er ließ uns damit Anschluss gewinnen an das, was bereits vor uns gedacht worden ist. Und dadurch klärte er uns auf: über uns selbst und über unsere Zeit. Und da war immer noch und immer wieder Marx: nicht als ewig wiederkehrender Besserwisser, sondern als einer, der der Menschheit ein paar Fragen gestellt hatte, die sie bis heute noch nicht beantwortet hat. So wenig Karl Marx sein eigenes Denken einfach aus dem Hut gezaubert hat, sondern dieses Denken in die Geschichte des Denkens und Handelns der Menschheit einfügte, so wenig hielt uns Elmar Treptow einfach nur Marx als den Beantworter all unserer Fragen entgegen. Hier muss nun unbedingt der Begriff des "Aufhebens" ins Spiel gebracht werden. Ein überzeugter Kantianer würde natürlich nie zugeben, dass in der Hegelschen Philosophie die Philosophie von Kant aufgehoben wäre. Er wäre dann ja kein Kantianer mehr, sondern eben Hegelianer. Dahinter steckt natürlich die Idee, dass es umfassendere Denkansätze gibt. Wer später kommt, kann, muss aber nicht, das vorherige Denken in sich aufnehmen und zu einer neuen Höhe bringen. Die Geschichte der Philosophie lehrt uns natürlich, dass das erstens nie ganz aufgeht und dass das zweitens in der Regel mit einer zeitlichen Aufeinanderfolge wenig zu tun hat. Dennoch bleibt die Vorstellung, dass sich ein Denker die erfolgreiche Mühe gemacht haben kann, sich so in das philosophische Gebäude eines anderen Denkers hineingegraben zu haben, dass in seinem eigenen Ansatz das Andere, der Andere, das Vorherige aufgehoben ist. Aufgehoben in dem Sinne, dass es gerade nicht bloß negiert, sondern zu einer neuen Höhe gebracht wird. Man könnte diese Vorstellung Fortschritt nennen und man nennt sie gewöhnlich auch Fortschritt. Wenn man also zumindest mal den Gedanken zulässt, dass mit Hegel die idealistische Philosophie ihren Höhepunkt und Abschluss gefunden hat; dass mit Feuerbach eine entscheidende Wende hin und Rückbesinnung zu materialistischer Philosophie stattfand und dass Marx diese beiden Stränge in sich aufgenommen und weiterentwickelt hat, dann könnte man immerhin abschätzen, auf welchem Terrain man sich bewegt. Das "Herr/Knecht-Kapitel" aus der "Phänomenologie des Geistes" bei Hegel wäre damit der Ausgangspunkt einer entscheidenden Wende, die in den Werken von Marx und Engels dann um viele, viele Schritte vorangetrieben wurde.1 Und eben um eine, eine entscheidende Frage: Wie geht die 1 In einer der vielen Arbeitsgruppen, die zu bilden uns Elmar in jedem Seminar zwang, sagte nach der Lektüre einer Textstelle in Lukacs 'Ästhetik" eine Kommilitonin zu mir Für einen Lehrer Menschheit mit dem entfesselten, zwanghaften und verselbständigten Wachstum im Kapitalismus um, mit dem Problem, dass der Kapitalismus als Produktionsweise uns beherrscht und nicht wir ihn? Der Generalvorwurf an bürgerliche Philosophie lautet daher, dass sie alles Mögliche kritisiert, nur genau den Punkt, der für das Wohl und Wehe der Menschheit am Entscheidensten ist, im wahrsten Sinne des Wortes links liegen lässt. In den siebziger Jahren waren die revolutionären Hitzköpfe unter seinen Studenten nicht wirklich zufrieden mit ihm: Elmar Treptow war ihnen nicht entschieden genug. Er war ihnen zu versöhnlerisch und schien in der Dialektik der herrschenden Verhältnisse nicht entschieden genug auf ihrer, der revolutionären Seite zu stehen. Denn eine Revolution stand ja kurz bevor, ganz sicher -- ihrer Ansicht nach. Dass die Verhältnisse freilich ganz andere waren, nahmen sie erst später zur Kenntnis, spätestens 1989. Dass die Ereignisse seit Mitte der achtziger Jahre, seit dem Erscheinen Gorbatschows auf der Weltbühne zu einem Desaster für den Ostblock wurden, war allerdings etwas, das auch Elmar Treptow nicht wirklich gefallen hat. Dem Kapitalismus fehlte von da an der Antipode, die Gegenkraft: Die Aussichten, das Begreifen des Kapitalismus, den Einblick in sein Wesen in ein Beherrschen dieses Tigers verwandeln zu können, sind seitdem ja nicht besser geworden. Dass sich Elmar Treptow freilich von vornherein nicht dazu eignete, von irgendeiner Seite vereinnahmt zu werden, hätten man allerdings beizeiten in seinem Seminar lernen können: Nichts war und ist nämlich allen Ideologen der Welt verhaßter als der Satz, den er uns immer wieder und wieder um die Ohren geschlagen hat: Etwas wirklich kritisieren heißt, sich zuerst einmal in den Umkreis der Stärke dessen zu stellen, was man kritisieren will. Dies geht selbstverständlich auf Hegel zurück: Von außen lässt sich alles und jedes kritisieren! Wirklich aufheben kann man einen Standpunkt aber nur dann, wenn man sich bis zu seinem wirklichen argumentativen Kern vorgearbeitet und ihn in seiner ganzen Tragweite auch verstanden hat. Eigentlich ist das ein philosophischer Allgemeinplatz und wäre daher an sich nicht weiter der Rede wert. Nur, diesen Ansatz auch in der Auseinandersetzung mit tatsächlichen, aktuellen Problemen dieser Gesellschaft durchzuhalten, schaffen eben die Wenigsten. Man muss die andere Position, die Gegenposition erst einmal völlig begriffen haben, um dann darauf den eigenen Gedankengang aufzubauen. Elmar Treptow brachte uns bei, folgenden wunderbaren Satz. Die Textstelle bei Lukacs hatte ungefähr -- wirklich nur sehr ungefähr -- so geheißen: "Marx und Engels haben mit ihrer materialistischen Philosophie die Probleme von Wiederspiegelung und Mimesis auf eine neue...Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich nun..." Also, diese Kommilitonin fragte mich: "Wieso? Ich wusste gar nicht, dass Marx und Engels Polen waren!" Wolfgang Habermeyer dass der Kapitalismus keine Angelegenheit ist, die von irgendwelchen bösen Menschen erfunden wurde, um den Rest der Menschheit in Knechtschaft zu halten. Wer den Kapitalismus wirklich kritisieren und ihn aufheben will, muss sich zuerst einmal klar machen, welchen Fortschritt er gebracht hat, welcher geschichtlichen Notwendigkeit er entsprang: Man muss verstehen, wo die wirkliche Stärke des Kapitalismus liegt. Und auch dann ist es nicht so, dass man ihn einfach qua Willensentscheidung, qua Revolution abschaffen könnte. Erst im Zerbröseln dieser Stärke und auch erst dann, wenn er aus sich selbst heraus die neue, die bessere Alternative gebiert, kann der Kapitalismus überwunden werden. Natürlich ist das simpelste -- und zugegebenermaßen verkürzte -- marxistische Klippschule. Aber wer, bitte schön, hat diese Forderung, sich wirklich in den Umkreis der Stärke des Kapitalismus zu stellen, von all den großen und kleinen Kritikern und Herolden der Revolution wirklich ernst genommen? In diesem Sinne war für uns Elmar Treptow jemand, der uns das Sektierertum mit aller Macht austreiben wollte. Noch seine nachdrückliche Aufforderung an uns, als Studenten nicht einzeln und abgekapselt zu lernen und zu arbeiten, sondern Arbeitsgruppen zu bilden und in der Zusammenarbeit mit anderen unsere Referate und Seminararbeiten hervorzubringen, zeugt davon. Hebung der Frustrationstoleranz: Diesen Begriff werden wir nie mehr vergessen. Nur wer die Nähe der Menschen sucht, sich wirklich mit ihnen auseinandersetzt und sie in ihrer manchmal vorhandenen momentanen Dummheit erträgt, hat genug Menschenliebe in sich, um sie dann auch kritisieren zu dürfen. Selbst im abseitigsten Beitrag in den Seminaren konnte er Restspuren von Vernunft ausmachen, an die angeknüpft werden musste. Er hatte wahrlich mehr Geduld als wir selbst. Er diktierte uns nicht das bessere Argument, er schlug es uns vor: Er leitete uns an und konnte noch die kompliziertesten Bücher und Textstellen so auseinanderklamüsern, dass sie für uns begreifbar wurden. Er konnte Überlegungen und Argumente aus unserem eigenen Bewusstsein hervorholen, die uns selbst bei weitem noch nicht klar gewesen waren. In den persönlichen Gesprächen in seiner Sprechstunde, vor Prüfungen und Magisterarbeiten war Zwang ein Fremdwort. Jedes dieser Gespräche brachte uns einen Schritt weiter. Von wie vielen Lehrern können wir das noch sagen? Für viele linke Denker der siebziger und frühen achtziger Jahre galt die Haltung der "produktiven Borniertheit": ein einmal gefundener und dann nicht mehr weiter hinterfragter Standpunkt diente als Basis für große und selbstverständlich nicht immer nur dumme Produktivität, als Basis für Legionen von Büchern und Karrieren. Genau das war Elmar Treptows Sache nicht. Für Borniertheit war und ist kein Platz in seinem Denken. Wenn darunter Für einen Lehrer in einem gewissen Sinne die Produktivität -- gemeint ist der Ausstoß an Büchern oder das schnelle Erklimmen der Karriereleiter -- leidet, dann ist das eben so. Daraus nun wiederum den Schluss zu ziehen, sich als Kritikaster nörgelnd ins Kämmerchen zurückziehen zu dürfen, um sich dort frei von der bösen Praxis in langen Jahrzehnten einen nicht bornierten Standpunkt erarbeiten zu wollen, ist natürlich ebenso falsch. Erst in der tätigen Auseinandersetzung, im sich Einlassen auf die Praxis erweist es sich ja, ob die eigene Kritik etwas taugt. So steht's schon in den "Thesen zu Feuerbach".2 2 It's simply Feuerbach-These, I know. Bis zur tatsächlichen Widerlegung dieser Position bleibt sie halt einfach richtig. Wolfgang Habermeyer Wir haben also bei ihm gelernt, den eigenen, kleinen, partikularen und zufälligen Standpunkt nicht aufzuspreizen, ihn nicht für das Ganze, für das Allgemeine zu halten. Dennoch war in den Seminaren von Elmar Treptow die Symphatie für die politisch aktive Linke in diesem Land stets spürbar. Symptomatisch für seine Art der Lehre ist es auch, stets konkrete, in der Praxis nachvollziehbare Beispiele zu finden statt abstrakter Problemstellungen. An sich wäre es so einfach: Ohne Marx geht nix, mit Marx alleine geht gar nix. Karl Marx für uns Studenten in die Tradition des demokratischen Humanismus gestellt zu haben, bleibt Elmar Treptows Verdienst, unser vorhandenes Interesse an Marx mit Aristoteles und Lukacs in Verbindung gebracht zu haben ebenfalls. Den marxistischen Demokraten und Humanisten Elmar Treptow wollen wir daher mit einem dreifachen "Hoch die internationale Solidarität" in seine Emeritierung verabschieden. Wir wünschen ihm alle erdenkliche produktive Muße für die Zeit danach. In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 120-124 Bücher zum Thema Besprechungen Bücher zum Thema Gernot Böhme Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre München 2001(Fink-Verlag), 200 S., 24.50 EUR. Philosophie ist für Gernot Böhme niemals akademisch-abgehobener Selbstzweck gewesen, vielmehr muss sie seiner Meinung nach immer auf den konkreten Menschen in seiner jeweiligen Umwelt reflektieren. In dem mit Hartmuth Böhme zusammen verfassten Buch „Das Andere der Vernunft“ ging es denn auch um die in Kants Philosophie vernachlässigte Leiblichkeit des Menschen. Genauso unterstreichen seine neueren Schriften, die sich vorwiegend mit ästhetischen Themen befassen, stets die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung für unser Denken und Handeln. Zur Ästhetik führte ihn sein Weg vor allem über die Beschäftigung mit den ökologischen Katastrophen, die dem Menschen ein neues Bewusstsein seiner Umwelt gegenüber abverlangen. Neben der Vermittlung moderner Kunst hat Ästhetik demnach vor allem die Aufgabe, das neue Verhältnis zu der zunehmend vom Menschen gestalteten Natur, aber auch zu der durch Design und Inszenierung durchwirkten Welt, zu beschreiben. Nur wenn die „Ästhetisierung des Realen“ begrifflich adäquat eingeholt werden kann, ist eine kritische Haltung ihr gegenüber möglich. Wie bereits in seinem Buch „Atmosphären“ versucht Böhme erneut, Ästhetik als eine allgemeine Wahrnehmungslehre zu begründen. Der Titel „Aisthetik“ stammt vom griechischen Wort Aisthesis (Wahrnehmung) und steht für die weitreichende Dimension des Unternehmens. Das Kunstwort ist unter anderem von Wolfgang Welsch verwendet worden, gegen den sich Böhme in seinem neuen Buch allerdings nicht mehr explizit abgrenzt. Sein neuer Gegner heißt Martin Seel, der in der Abhandlung „Ästhetik des Erscheinens“ Böhmes eigenem Ansatz thematisch wohl allzu nahe gekommen ist. Für Seel bedeutet Ästhetik eine Wahrnehmung um der Wahrnehmung willen, also ein Erscheinen, das als solches „auffällig“ wird. Zur Bücher zum Thema Kunst wird seiner Meinung nach atmosphärisches Erscheinen erst dadurch, dass es dargeboten wird. Darin liegt nach Böhme eine Verengung des ästhetischen Blicks: „Für die Ästhetik ist nicht eine besondere Wahrnehmungsweise, der so genannte ästhetische Blick, konstitutiv, der etwa aus der alltäglichen Dingwahrnehmung durch Abstraktion, Rahmung, Verhaltung und Zweckfreiheit oder sonstige Disziplinierung gewonnen würde, sondern umgekehrt: Grundlegend für die Ästhetik ist das Spüren von Atmosphären, und von diesem ist durch einen langen Weg von Differenzierung, Spezifizierung und Disziplinierung die alltägliche Wahrnehmung von Dingen abgeleitet.“ Im Ganzen gesehen wirkt diese Frontstellung zwischen Böhme und Seel aber eher bemüht, kommen doch beide über weite Strecken hinweg zu recht ähnlichen Ergebnissen. Anhand mehrerer Beispiele versucht Böhme zu zeigen, inwieweit der Dingwahrnehmung eine unbestimmte Erfahrung einer Erregung vorausgeht. Wenn wir etwa das Gefühl haben, dass jemand in einen Raum kommt, ist diese Stimmung noch nicht nach Sinnen ausdifferenziert. „Unbestimmt und ohne Grenzen in die Weite ergossen, ziehe ich mich durch das Spüren, dass da jemand kommt, quasi auf mich zusammen beziehungsweise zerlege den Raum dadurch, dass jetzt meine Aufmerksamkeit geweckt wird, in Richtungen und Sinndimensionen.“ Das Wahrnehmungsereignis liegt demnach vor jeder Subjekt-ObjektSpaltung. Genau diese Relation, die weder Zustand des Subjekts noch Eigenschaft des Objekts ist, nennt Böhme Atmosphäre. Im Gegensatz zur Tradition, die den ästhetischen Schein weitgehend verstand als Erscheinen von etwas, sind nach Böhme Atmosphären die erste und entscheidende Wirklichkeit für die Ästhetik. Der Ästhetik muss es darum gehen, die Erscheinungen als solche zu bestimmen, ohne sie auf etwas, das erscheint, zu überschreiten. „Die Produktion von Atmosphären ist eine wichtige, geradezu definitorische Intention für ästhetische Arbeit. Wahrnehmungserfahrung soll vermittelt und letzten Endes affektive Betroffenheit erzeugt werden.“ Aus diesem Grund gesteht Böhme der Rhetorik wieder eine herausragende Stellung innerhalb der Kunstproduktion zu. Wenn in den einzelnen Kapiteln, zumeist mit Blick auf das Theater als Musterbeispiel für institutionelle Isolation der (ästhetischen) Wirklichkeit von der Realität, mitunter eher überholte Begriffe wie Atmosphäre, Szene, Charakter, Physiognomie, Ekstase oder Erzeugende analysiert werden, so sollen diese dazu dienen, dem Unsagbaren eine Sprache zu verleihen. „Allgemeinste Funktion der Ästhetik ist die Erweiterung der Sprachfähigkeit. Die neue Ästhetik ist bemüht, die ästhetische Wirklichkeit von Irrationalismus zu befreien, das heißt wörtlich: sie sprachfähig zu machen.“ Es gelingt Böhme durch ein Vokabular, das sich auf die Erscheinungen selbst bezieht, die Ästhetik aus der Verengung auf Semiotik und Hermeneutik, also einer Suche nach einer Bedeutung hinter den Werken, zu befreien und dennoch nicht ei- Bücher zum Thema nem heideggerianischen Kitsch zu verfallen. Allerdings ist eine gewisse Ratlosigkeit nach der Lektüre nicht zu leugnen. So plausibel die Beispiele und Analysen einen auch in den Bann ziehen mögen, – letztlich bleibt offen, inwiefern uns das von Böhme zur Verfügung gestellte Vokabular tatsächlich mehr sagen lässt, als die traditionelle Ästhetik. Hier wäre eine intensivere Auseinandersetzung mit Kants „Kritik der Urteilskraft“, die Böhme an anderer Stelle nicht scheut, angemessen gewesen. Auch verlangen seine spannenden Andeutungen zur gesellschaftlich-politischen Relevanz ästhetischer Theorie nach weiterer Ausführung. Gustav Mechlenburg Anne Kemper Unverfügbare Natur. Ästhetik, Anthropologie und Ethik des Umweltschutzes, Tübingen 2000 (Campus), 179 S., br., 24.90 EUR Die Dissertation unternimmt den Versuch, aus der ästhetischen Erfahrung der Natur ethische Kategorien für den Natur- und Umweltschutz zu gewinnen. Im ersten Teil, der die „philosophischen Grundlegungen“ behandelt, geht Kemper zunächst auf verschiedene Möglichkeiten ein, Ethik und Naturschutz methodologisch zu verbinden. Man könne die Bewahrung der Natur zwar einfach aus dem menschlichen Interesse als Naturwesen selbst ableiten, dadurch aber verliere die Natur jegliche Eigenständigkeit, die so bloßes Objekt bleibt. Naturteleologische Ansätze hingegen, die vom menschlichen Interesse völlig abse- hen wollen, scheitern methodologisch daran, daß das betrachtende Subjekt notwendigerweise ein humanes ist. Ein gewisser Anthropozentrismus ist daher prinzipiell unvermeidbar. Nach Anne Kempers Ansicht lassen sich Kriterien, die eine Eigenständigkeit der Natur begründen, am ehesten aus ästhetischen Kategorien gewinnen. Naturästhetische Erfahrung unterscheidet sich von kulturell-ästhetischen Erfahrungen insofern, als die Natur – in der ästhetischen Erfahrung – nicht ein Verfügbares ist, im Gegensatz zum Kunstwerk, das ein Gemachtes darstellt. Damit ist die ästhetische Erfahrung der Natur „eine umfassende Dimension des Menschlichen“ und macht den Menschen ihre eigene Naturhaftigkeit unmittelbar begreiflich. Die zweckfreie ästhetische Naturbetrachtung korrespondiert mit der Forderung, Natur über das Lebensnotwendige hinaus zu erhalten, etwa, um künftigen Generationen sowohl die Anschauung als auch eine weitergehende Nutzung zu ermöglichen, nicht zuletzt in Hinsicht auf Möglichkeiten, die heute nicht absehbar sind. Im zweiten Teil der Abhandlung geht es um die praktische Ausgestaltung und die Konkretisierung ästhetisch und anthropologisch motivierten Naturschutzes. Oft werde der Schutz der Artenvielfalt von den Industrienationen primär unter dem Gesichtspunkt des Nutzens (Genpool) gesehen. Andererseits aber könne, so Kemper, Naturästhetik nicht nur bedeuten, die Natur unter dem Gesichtspunkt der „Schönheit“ zu betrachten. Vielmehr sei die Voraussetzung naturästhetischer Bücher zum Thema Erfahrung die Unverfügbarkeit der Natur. Damit aber werde eine bloß ästhetisierende Betrachtung der Natur ausgeschlossen, die zwischen schön und häßlich, nützlich und schädlich unterscheidet. „Natur“ als Gegenstand der Naturästhetik wird von Kemper nicht auf die „unberührte Natur“ eingeschränkt – auch eine Kulturlandschaft, die sich wildwüchsig weiterentwickelt, kann nach ihrer Vorstellung als „Natur“ schützenswert sein, wenn sie dadurch Autonomie gewinnt. Sie betrachtet die derzeitige Praxis des Umweltschutzes kritisch, weil sich auf der Basis diverser (partikularistischer) Interessen und durch deren politisches Wechselspiel kein konsistenter ökologisch-ästhetischer Handlungsrahmen entwickeln kann. Die von Anne Kemper vorgelegte Arbeit liest sich, wie sich viele Dissertationen lesen: die Argumentation wird oft durch lange Zitate unterbrochen, um flüssig verfolgt werden zu können. Das Bemühen, alles zu belegen, kommt der Lesbarkeit nicht entgegen. Inhaltlich findet sich neben einem reichen Zitatenschatz der interessante Ansatz, die Naturästhetik mit einer „Unverfügbarkeit“ der Natur zu verbinden, der Parallelen zu E. Treptows Konzept der „erhabenen Natur“ hat. Eine Reihe von Argumenten ist schlüssig und gut untermauert. Im „praktischen“ Teil erscheinen einige Ausführungen etwas willkürlich, manchmal utopisch. Was die Bewertung der Schutzwürdigkeit der Natur im Einzelfall, was also „Naturästhetik“ konkret bedeutet, bleibt trotz aller Theorie dem jeweiligen Betrachter überlassen. Percy Turtur Paul Virilio Die Kunst des Schreckens. Aus dem Französischen von Bernd Wilczek, Berlin 2001 (MerveVerlag), 79 S., 8.18 EUR. Der Band bietet zwei Vortragstexte zu Fragen einer „Krise der zeitgenössischen Kunst“: „Eine gnadenlose Kunst“ (1999) und die „Kunst des Schreckens“ (2000). In „Eine gnadenlose Kunst“ sieht Virilio die Kunst, spätestens die der klassischen Moderne und – gesteigert – die zeitgenössische, in einer untrennbaren Liaison mit den Schrecken und Katastrophen der Neuzeit bis zum beginnenden 21. Jahrhundert. Ohne die ständig größer werdenden Gefahren sei ein Drama der zeitgenössischen Bilder und der zeitgenössischen Literatur weder verständlich noch verzeihlich. Virilios Anliegen ist dabei deutlich appellativ: „Ethik oder Ästhetik?“ „Die Kunst des Schreckens“ stellt Zusammenhänge eines „Verstummens der schweigenden Mehrheit“ angesichts der Misshandlung von Körpern mit einem ebenso verantwortungslosen Schweigen angesichts einer Misshandlung von „Formen“ in der Kunst her, deren Unmittelbarkeit sich immer mehr einer Ästhetik der audiovisuellen Medien, der „Technowissenschaften“ und einem bildjournalistischen „Expressionismus“ annähere. Im Sinne eines „Lohnes der Angst“ habe sich die zeitgenössische Kunst dabei „die Erbarmungslosigkeit der Folterknechte, die Gedankenlosig- Bücher zum Thema keit der Henker zu Eigen gemacht“. Und Virilio fragt, „ob es nicht dem Universalismus der Vernichtung sowohl der Körper als auch der Umwelt von Auschwitz bis Tschernobyl gelungen ist, uns von außen zu entmenschlichen, indem er unsere ethischen und ästhetischen Orientierungspunkte genauso auf den Kopf gestellt hat wie die Wahrnehmung unserer Umwelt“ (Eine gnadenlose Kunst). Ist aber eine Urheberschaft ästhetischer Produktionen verantwortlich für dasjenige, worauf sie reagiert? Wohl nur dann, wenn sie das, worauf sie reagiert, unterstützt oder propagiert. Wie aber steht es um das Verhältnis von Wie, Darstellung und Dargestelltem? Sind z.B. die expressionistische Malerei und Graphik als affirmativ anzusehen, weil sie deformative Züge haben, wie Virilio ihnen wiederholt vorwirft? Dieselbe Frage stellt sich im Blick auf die Malerei Francis Bacons oder die Installationen Bruce Naumanns. Bedenken sind auch gegen seine Polarisierung von Ethik und Ästhetik anzubringen, die von Aristoteles’ „Poetik“ ausgehen könnten und unter anderem auch mit der Lektüre von E. Burkes „Philosophischer Untersuchung über den Ursprung des Erhabenen und des Schönen“ (1756) und von Kants „Kritik der Urteilskraft“ (1790/1793) zusammenzubringen wären. Auch Schillers Briefe „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ (1793) sind zu erwähnen. Sie alle machen darauf aufmerksam, daß sich ‚Schönes’ ‚schrecklich’ und ‚Schreckliches’ ‚schön’ darstellen läßt, und warnen auf subtile Weise davor, die Formen edukativen Zwecken zu unterwerfen. Virilio verwendet den Ausdruck einer „Zersetzung“ (der menschlichen Gestalt) durch die „Form“ und schreibt in diesem Zusammenhang vom (pathologischen) Ziel der abstrakten Kunst, jegliche „repräsentative oder darstellende Kunst“ zugunsten einer extremistischen „Gegenkultur“ zu eliminieren. Mark Rothko ist für Virilio ein „radikaler Verneiner der Kunst“, der mit seinem Suizid (1970) die „Gewalt“ seiner Malerei letztlich gegen sich selbst gerichtet habe. Überhaupt sei seit van Gogh die Suizidrate unter Kunstschaffenden höchst stabil geblieben. Virilios Kunstgeschichtsschreibung interessiert hier nicht im einzelnen. Ebenso wenig sein Anliegen, etwas retrospektiv zu inkriminieren und prospektive Verdikte auszusprechen. Interessanter sind die Hintergründe eines derartigen Ikonoklasmus, die Hintergründe des thetischen Titels „Die Kunst des Schreckens“, eines Bonmots, dessen doppelter Genitiv allzu zwingend scheint. Der Autor spricht sich für eine Ästhetik der „Repräsentation“ aus, verbunden mit „Darstellung“ und „Mittelbarkeit“. Einer solchen „Intelligenz der Repräsentation“ aber wirke „eine den Geist beleidigende“, „gottlose“ und „nihilistische“ „Präsentation“ entgegen, die mit „Unmittelbarkeit“ und Zurschaustellung verbunden sei und dem Hang, „die Präsenz des Ereignisses zu zeigen“. Völlig offen bleibt, an welche „Kunst der Repräsentation“ Virilio hierbei denkt. An eine ‚realistische’, die dann aber unmittelbar wäre? Bestimmter, aber Bücher zum Thema nicht weniger verwirrend, sind – wie oben bereits angedeutet – die Zuordnungen zu einer „Kunst der Präsentation“: Malerei seit der klassischen Moderne, Photographie, Kino und letztlich ein LifeBildjournalismus, in dem das alles kulminiere. Was aber hat letzterer zu tun z.B. mit der Malerei Bacons, über die Virilio schreibt: „... je weniger dargestellt wird, um so stärker erweckt man den Schein der Darstellung“? Ähnlich ratlos machen Virilios Äquivokationen von ‚Mittelbarem’ und ‚Unmittelbarem’ angesichts der Ausstellungspraxis digressiver Videoinstallationen, die alltäglich gewordene Schreckensbilder in einen Wahrnehmungsraum stellen, der scheinbar vertraute Wahrnehmungsgewohnheiten unvertrauter werden läßt. Hier werden nicht die Bilder zur Schau gestellt, sondern die Zurschaustellung von Bildern und die Rezeptionsgewohnheiten selber. Die Kunst von einem (funktionalen) Gebrauchswert, dem Tauschwert, fernzuhalten, darum ging es bereits in Adornos „Ästhetische Theorie“ (1970) – bis hin zur Empfehlung, in der Ästhetik den Ausdruck „Kunst“ besser zu vermeiden. Ignaz Knips In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 125-161 Neuerscheinungen Besprechungen Neuerscheinungen Martin Bondeli Kantianismus und Fichteanismus in Bern. Zur philosophischen Geistesgeschichte der Helvetik sowie zur Entstehung des nachkantischen Idealismus Basel 2001 (Schwabe & Co AG), geb., 419 S., 41.- EUR. Daß Fichte Ende der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts in Zürich war und Hegel in den 90ern in Bern, ist bekannt. Weniger bekannt ist allerdings, daß ihre Auffassungen dort nicht nur auf einen fruchtbaren Boden fielen, sondern daß sie, wie Bondeli in seinem Buch nachzeichnet, auch bedeutende Anregungen für ihre philosophischen Konzeptionen erhalten haben, die sie dort in der geistigen Auseinandersetzung schärfen mußten. „Es ist von daher“, schreibt Bondeli, „nicht übertrieben zu behaupten, daß das damalige philosophische Bern neben den philosophischen Entwicklungen in Tübingen, Jena und Frankfurt zu den wichtigen Entstehungszentren des deutschen Idealismus zählte.“ (10) Weit mehr als etwa das herzogliche Tübinger Stift oder die groß- herzogliche Universität Jena war das eidgenössische Bern gleichsam das Scharnier, aber auch das Korrektiv zwischen der politischen Revolution in Frankreich und der philosophischen Revolution in Deutschland. Hier waren „Kantische, Fichte Philosophie einerseits und republikanische Politik andererseits ... einmalig eng miteinander verbunden.“ (10) Martin Bondeli, der 1990 schon das Buch „Hegel in Bern“ veröffentlicht hat, geht in dem vorliegenden Buch detaillierter der philosophischen, vom Umbruch und Aufbruch geprägten Situation in der Schweiz, näher in Bern, nach, die ihre Höhepunkte in der Helvetischen Republik und dann in den Mediationsakten hatte. Er vollzieht nach, wie und wodurch das Berner „Politische Institut“ noch während des Ancient Régime unter der Leitung der Kantianer Johann Ith und Philipp A. Stapfer zur „heimlichen Aufklärungsstätte und Eliteschule der Helvetischen Republik“ (14) wurde. Während Ith den vorkantischen Lehraufbau einer auf die Seinserkenntnis konzentrierten Metaphysik und Ontologie verabschiedete und ins Zentrum der Lehre den Neuerscheinungen Menschen und dessen Vervollkommnung rückte und – noch vor Kant – ein nach Kantischen Prinzipien aufgebautes „System der Anthropologie“ entwickelte, ging Stapfer darin weiter, daß er diese Lehre dezidiert mit praktischen, kirchen- und staatspolitischen sowie pädagogischen Zielsetzungen verband. Stapfer wurde denn auch zu einer der maßgeblichen Figuren in der Schweizer Politik, dessen Ideen zu einer „ethischen Republik“ die Neuordnung von Kirche und Staat sowie das Bildungswesen bis in die Gegenwart prägten. In einen Exkurs versteckt, trägt Bondeli seine im Kontext der Erforschung des „deutschen Idealismus“ neue und brisante These vor, daß zumindest einer der Ursprünge des „ältesten Systemprogramms“ in Bern zu suchen sei. Er setzt dabei voraus, daß dessen Verfasser Hegel und daß Hegel in seiner Berner Zeit mit den Schriften des Leiters des „Politischen Instituts“, P.A. Stapfer, konfrontiert war. Wenngleich dieses Programm, wie Bondeli einräumt, hinsichtlich des Christentums weit kritischer und radikaler war, so sei es doch, wie der Vergleich zeige, sowohl im Systemaufbau als auch in seiner praktischen Zielsetzung der Schrift Stapfers über „Die fruchtbarste Entwicklungsmethode der Anlagen des Menschen ...“ gefolgt. „Weshalb also“, fragt der Verfasser, „sollte das Älteste Systemprogramm nicht aus dem Kontext des Berner Kantianismus entstanden sein?“ (209) Im zweiten Teil des Buches geht Bondeli dem „Berner Fichteanismus“ nach, der vor allem durch den Dichter Jens Baggesen und den Juris- ten Johann R. Steck repräsentiert war. Allerdings erscheint dieser Ausdruck wenigstens für Baggesen als merkwürdig; denn wenngleich dieser dänische Tausendsassa sich in seiner Berner Zeit „als Geburtshelfer der Fichteschen Philosophie betätigte“ (259) und Fichte als den Erneuerer der Philosophie propagierte, so stellt der Autor ihn uns doch als einen der ersten, brillantesten und einflußreichen Kritiker der Ich-Philosophie Fichtes vor. Er formulierte Einwände, die sich dann so auch bei Schelling und Hegel finden. Der junge Steck hingegen war in der Tat überzeugter Fichteaner, überdies Jakobiner und Illuminat. Er ging zum Studium zu Fichte nach Jena, zog Berner Intellektuelle nach und gründete in Bern eine fichtianische „Literarische Gesellschaft“. Bondeli zeigt aber auch Stecks Scheitern an dem alles umstürzenden Ich: „Nach einer Periode der Begeisterung für den Fichteschen Ich-Standpunkt stellt sich eine gewisse Ernüchterung ein... Der als überspannt und allzu abstrakt empfundene Subjektivismus Fichtes soll durch eine Zurückführung des Subjekts in die Objektwelt geheilt, Subjekt und Objekt sollen miteinander versöhnt werden.“ (303) Kurzzeitig besetzte Steck zwar in der Helvetischen Republik einen hohen Posten, zog sich aber bald aufs Land zurück, wo er früh starb. Mit seiner Arbeit zur philosophischen Geistesgeschichte der Helvetik hat Bondeli nicht nur ein für die Schweiz interessantes Neuland betreten, wo „nach wie vor vieles im Dunkeln (liegt)“ (10). Sie trägt auch zur Erweiterung des Blickfelds der Erforschung dieser Zeit bei, das bis- Neuerscheinungen lang doch vor allem auf Tübingen, Frankfurt und Jena eingeschränkt war, und bezieht die Berner Auseinandersetzungen in diese Konstellation mit ein. Allerdings will mir scheinen, daß der systematisch interessante Gesichtspunkt, nämlich die spezifisch bernerische Verbindung des philosophischen Entwurfs mit der politischen Tat, zugunsten der ausführlichen Analyse und des Vergleichs der Texte etwas unterbelichtet geblieben ist. Sehe ich recht, so war auch der Berner Diskurs von den historischen Umständen geprägt. Machte er in seiner Hochzeit bis in die 90er Jahre den eminent praktischen Gehalt der philosophischen Ideen – deutlicher als anderswo – sichtbar, so ist dieser Gehalt dann jedoch aufgrund der realpolitischen Anforderungen an die Protagonisten um seine Pointe gebracht worden, bis die konzeptionelle Kraft schließlich ermüdete. Alexander von Pechmann Ute Daniel Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis Schlüsselwörter, Frankfurt/Main 2001 (Suhrkamp), 475 S., 15.- EUR. Die wissenschaftstheoretischen Grundsatzfragen der Geschichtswissenschaft sind meist verwoben mit der seit dem 18. Jahrhundert praktizierten „Kulturgeschichte“. Thematisch hebt diese Disziplin sich von einer auf Staatsaktionen und ihre Akteure beschränkten politischen Historiographie ab und billigt allen Menschen – nach Goethe auch „jedem Narren“ – mitsamt den prägenden Lebensverhältnissen und Vorstellungsweisen einen Platz in der Geschichte zu. Methodisch ermöglicht der Begriff der Kultur „Anschlussmöglichkeiten für disziplinenübergreifende Fragestellungen.“ (218) Folglich setzt für Daniel die Diskussion um die Kulturgeschichte mit der Kulturdebatte um 1900 ein. Das Kompendium Kulturgeschichte versteht sich als unter fortlaufenden Fragestellungen geschriebene Monographie und als Handwörterbuch, das wie ein Nachschlagewerk benutzt werden kann. Die einzelnen Kapitel und Unterkapitel sind in sich abgeschlossen und bilden eine Einheit. Man erwarte aber keine Definition zur Kulturgeschichte: „wer sich darüber klar werden will, was sie bedeutet und beinhaltet, sollte studieren, wie über sie gestritten und wie mit ihr gearbeitet wird, und seine oder ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen.“ (9). Zu diesem Zweck bietet das Buch eine gute Handhabe. Kulturgeschichte ist, so Daniel, weder Bindestrich-Geschichte noch Ausschnitt einer allgemeinen Geschichte mit eindeutigen Grenzen und bestimmten konstitutiven Theoremen oder Methoden. Auch gibt es keinen Gegenstand, der nicht kulturgeschichtlich analysierbar wäre. Dennoch erhebt Daniel den Anspruch, „den kulturgeschichtlichen Zuständigkeitsbereich zu identifizieren“ (9), indem sie ihn auf drei Ebenen (Objekt, Subjekt, Wirkung) positioniert, die den Duktus der Auseinandersetzung mit den jeweiligen Ansätzen bestimmen. Objekt der Geschichtsschreibung ist das Ensemble all dessen, was Ge- Neuerscheinungen schichte hat. Ereignisse sind nur verstehbar in dem kulturellen Kontext von Meinen und Glauben, „in dem sie „Sinn machen“ (17). Die Geschichte schreibenden Subjekte sind Teil der von ihnen beschriebenen Ereignisse. Wissenschaftliche Analyse setzt die Unhintergehbarkeit der Zirkularität des geschichtswissenschaftlichen Arbeitens voraus. Kulturwissenschaftliche Selbstreflexion konterkariert jede „überzeitlich gültige und kontextfreie methodische Verfahrensweise“. Kulturgeschichte „macht Geschichte (wieder) spannend für alle Menschen, die über Geschichte nicht akademisch, sondern menschlich verfügen, indem sie sie erleben...“ (19) Die Wirkungsabsicht der Geschichtsschreibung sollte im Sinne Cassirers eine symbolische Form sein, „in der sich die individuelle und kollektive Selbstvergewisserung und Selbst-in-Frage-Stellung im Umgang mit Geschichte vollzieht.“ (19). Daniel siedelt die gemeinsamen Grundlagen der Kulturgeschichte auf der fundamentalen Ebene des „wissenschaftlichen Selbstverständnisses“ an. Es gehe um „Entscheidungen darüber, wie das Wissen beschaffen ist, das hier bereitgestellt wird, und anhand welcher Kriterien darüber diskutiert werden kann.“ (10) Die Form des Kompendiums ermöglicht die „Besichtigung“ einzelner Theoretiker, Ansätze oder Begriffe. Denn es gibt, so Daniel, keine Entwicklungsgeschichte der Kulturgeschichte im Sinne einer Eigenlogik, „die dann im Stil von Errungenschaften nacherzählt werden könnte“. Ziel ist nicht, wie in einer Ahnengalerie Autoritäten hochzuhalten, sondern kreative und intellektuelle Anregung zur Diskussion zu bieten. Im Kapitel „Kulturwissenschaftliches Wissen I“ wird an die Debatte um 1900 angeknüpft, die noch geprägt ist vom Kantschen Erkenntnis- und Wissenschaftsmodell, das Kulturwissenschaft bewusst ausklammerte. Vorgestellt werden Friedrich Nietzsche, John Dewey, Ernst Cassirer sowie Georg Simmel und Max Weber, „die jene wissenschaftskritischen und -theoretischen Positionen formuliert haben, die bevorzugt Eingang in die aktuellen Debatten gefunden haben.“ (20/21). „Kulturwissenschaftliches Wissen II“ umfaßt Ansätze und Theoretiker, die exemplarisch für die Zeit nach 1945 stehen und die Frage nach der Art des Wissens stellen, das die Kulturwissenschaften bereitstellen können. Daniel diskutiert hier Hans-Georg Gadamer, den Post-Strukturalismus und die Postmoderne, Michel Foucault und Pierre Bourdieu, dessen Selbstreflexionsgebot –„wissen, was man tut, wenn man Wissenschaft treibt“ (13) – die Autorin zweifellos internalisiert hat. In einem Überblick über die „klassische“ Kulturgeschichte vom 18. bis 20. Jahrhundert und die Geschichte des Kulturbegriffs werden frühe Ansätze der Kulturgeschichtsschreibung von Voltaire bis Jacob Burckhardt diskutiert sowie die Kontroverse zwischen NeuRankianern und Kulturhistorikern wie Eberhard Gotheim, Kurt Breysig oder Karl Lamprecht. In „Herleitungen“ stellt Daniel Personen und Disziplinen vor, deren Themen und Zugriffsweisen die ak- Neuerscheinungen tuellen Debatten geprägt haben, wie die französische Schule der Annales und ihre Mentalitätengeschichte, die amerikanische Historikerin Natalie Zemon Davis sowie der Mikro-Historiker Carlo Ginzburg. Daniel plädiert für Anregungen aus der Ethnologie als kulturwissenschaftlicher Leitbranche und aus dem sozialwissenschaftlichen Ansatz von Norbert Elias. Das Kapitel „Themen“ setzt Schwerpunkte, „in denen die kulturgeschichtliche Hinwendung zur historischen Symbolproduktion, zur Geschichte von Wahrnehmungen und Praktiken zum Ausdruck kam und kommt“ (21), wie in der Alltagsgeschichte, der Historischen Anthropologie, der Geschlechter-, Generationen-, Begriffs-, Diskurs-, und Wissenschaftsgeschichte. Im Abschnitt „Schlüsselwörter“ werden Begriffe und Problemzusammenhänge kulturwissenschaftlicher Grundsatzdebatten diskutiert, die den Kernbereich wissenschaftlicher Selbstreflexion betreffen, deren Selbstverständlichkeit jedoch hinterfragt werden muß, wie „Tatsache/Objekt/Wahrheit“, „objektiv/ subjektiv“, „erklären/verstehen“. Damit soll die Bedeutung ermessen werden, die Schlüsselwörtern wie Historismus/Relativismus – Kontingenz/Diskontinuität – Sprache/ Narrativität und Kultur zukommt „und dem Reflexionspotential, das mit ihren verschiedenen Verwendungsweisen verbunden ist.“ (381) Fast alle vorgestellten Theoretiker werden auch bei der „Arbeit“ gezeigt: entweder im Originaltext oder in der Zusammenfassung relevanter Werke. Epochaler Schwerpunkt ist die Neuzeit. Das Buch ist eine ideale Einführung in die Problematik einer kulturwissenschaftlich und philosophisch fundierten, methodisch kritischen Kulturgeschichte. Es bleibt an keiner Stelle hinter seinen theoretischen Vorgaben zurück und ist wie das Fach selbst facettenreich, originell und kreativ. Dennoch hätte man sich gewünscht, dass die Autorin, wenn sie durchgängig von der „Debatte der letzten Jahre“ oder den derzeitigen Diskussionen um die Kulturgeschichte spricht, diese verschiedenen aktuellen Positionen auch darlegt. Erst am Schluß geht hier der Vorhang etwas auf, wenn die Situation der deutschen, vom Primat der Politikgeschichte geprägten Historiographie und deren Immunisierungsstrategien gegen kulturgeschichtliche Anfechtungen karikiert wird und der eine oder andere Antagonist schnell noch über die Bühne gejagt wird. Dann sieht man, dass das Ganze doch kein Schattenboxen war. Aber Hedda Gabler ist zum Glück auch nicht aufgetreten. Marianne Rosenfelder Jürgen Habermas Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Frankfurt/Main 2001 (Suhrkamp), Tb., 125 S., 14.80 EUR. Jürgen Habermas bezieht in der Frage, ob es moralisch ge- oder verboten sei, die Möglichkeiten der Gentechnik und Reproduktionsmedizin wie die Klonierung oder Eingriffe in das menschliche Genom anzuwenden, eine klare Position. Neuerscheinungen Auch und gerade aus einer liberalen und dabei deontologischen Grundhaltung verwirft er die Möglichkeit einer „liberalen Eugenik“. Dabei baut Habermas im Wesentlichen auf die Überzeugungskraft der Antworten auf zwei Fragen: der nach unserem anthropologischen Selbstverständnis und jener nach dem Grad der Determinierung eines Menschen, dessen Genom gezielt verändert wurde, der als Klon zu Welt kommt oder als Embryo im Rahmen einer PID positiv selektiert wurde. In der Möglichkeit, durch Eingriffe in das menschliche Genom langfristig verschiedene Menschenarten zu produzieren und damit die Einheit der Menschheit und so die notwendige Bedingung für die Wahrnehmung des Anderen als Gleichberechtigten zu zerstören, sieht Habermas eine wesentliche Gefährdung durch die Gen- und Reproduktionstechnik. Denn dieses Band der einheitlichen und unverfügbaren „Natur“ der Menschen ist für Habermas die Grundlage moralischer Auffassungen. Doch nimmt dieses Argument nur den kleineren Raum in der Argumentation Habermas’ ein, auch wenn er damit seinen Text enden lässt. Wesentlicher ist für ihn die Frage, ob durch Eingriffe in das Genom eines Kindes oder durch die Anwendung der PID nicht eine „Programmierung“ vorgenommen wird, die einen schwerwiegenden und nicht wieder auszugleichenden Angriff auf die Autonomie des neu entstehenden Menschen darstellt. Das Sosein, das durch entsprechende medizinische Maßnahmen determiniert wurde, wäre – so Habermas – für den so manipulierten Menschen ein Käfig, der nicht durch eigene Entscheidungen im weiteren Lebensverlauf verlassen werden könne. Habermas lehnt solche Eingriffe zweifach ab: einerseits gut kantisch, weil der manipulierte Mensch nur noch Mittel für die Zwecke der Eltern wäre und nicht mehr Zweck an sich selbst; andererseits entscheidet er sich in einer liberalen Güterabwägung zwischen der reproduktiven Freiheit der Eltern und der Autonomie und Freiheit des Kindes für die letztere und gegen die erstere. Beide Argumente liegen nahe und sind doch nicht überzeugend. Denn es ist nicht einsichtig, warum die zusätzlichen Eingriffsmöglichkeiten, die Gentechnik und Reproduktionsmedizin bieten, etwas Wesentliches an der Zweckhaftigkeit der Kinder für ihre Eltern ändern. Die Zeugung von Kindern ist wohl fast nie Selbstzweck und nicht selten gar nicht. Sicherlich: das therapeutische Klonen etwa zum Zweck der Organlieferung instrumentalisiert einen Menschen völlig und ist moralisch zu verwerfen. Doch dieses Problem stellt sich nicht erst durch das Klonen, es besteht losgelöst hiervon – aktuelle Beispiele finden sich viele. Moralisch bedenklich ist die Instrumentalisierung, aber nicht das Werkzeug der Instrumentalisierung. Habermas bedient sich zudem uneingestanden eines reduktionistischen Menschenbildes, wenn er von „Programmierung“ redet – was wohl an die Determiniertheit von Computern erinnern soll. Denn er muss den Anteil von Umwelt und Erziehung gezielt gering reden, um jener Programmierung ihren herausragenden Stellenwert zu geben. Gleichzeitig berücksichtigt Haber- Neuerscheinungen mas nicht, dass auch unsere natürliche genetische Ausstattung unseren Lebensweg mitbestimmt, oftmals sogar wesentlich: eine Pollen- oder Lebensmittelallergie kann das Leben schwierig machen; manche genetische Defekte machen es fast unmöglich und wieder andere beenden es auf qualvolle Weise. In Fällen wie diesen aber stellt sich die Frage, ob es moralisch nicht sogar geboten ist, solches Leid zu vermeiden, falls es möglich ist. Hier zeigt sich, dass deontologisch zu argumentieren nicht ausreicht; es müssen die Folgen sowohl der Anwendung als auch der Nichtanwendung von Gentechnik und Reproduktionsmedizin bedacht werden. Karsten Weber Wolfgang Kersting Theorien der sozialen Gerechtigkeit, Stuttgart/Weimar 2000 (Metzler-Verlag), geb., 412 S., 39.90 EUR. Wolfgang Kersting (Hg) Politische Philosophie des Sozialstaats, Weilerswist 2000 (Velbrück Wissenschaft), br., 510 S., 29.50 EUR. Wolfgang Kersting gehört nicht zu jenen Autoren, denen die Angst vor dem leeren Blatt Papier schlaflose Nächte bereitet. Seit den 80er Jahren lässt der äußerst mitteilungsfreudige, in Kiel lehrende Philosoph kaum ein politisch-philosophisches Thema unkommentiert. Ob zu Rawls oder Hobbes, ob zu Kant, Machiavelli oder Platon, ob zur Gesundheitsreform oder zum Gesellschaftsvertrag – beinahe kein Jahr vergeht ohne eine neue, voluminöse Kersting-Monografie, flankiert von ungezählten Beiträgen in Fachzeitschriften und Tageszeitungen. Nun also ist’s der Sozialstaat, dem Kersting seit längerem in Aufsätzen und in jüngerer Zeit gleich im Doppelpack per voluminöser Studie und von ihm herausgegebenen Sammelband zu Leibe rückt. Bereits zu Beginn gibt dabei der Autor von „Theorien sozialer Gerechtigkeit“ zu verstehen, dass mit dem Erscheinen seines Werkes ein neues Kapitel in der Jahrhunderte währenden Debatte um die normativen Grundlagen des Sozialstaates aufgeschlagen wird. Denn, so Kerstings Diagnose, bislang sei das Bemühen um eine philosophische Legitimation des Sozialstaats nicht über eine „diffuse, erheblich gefühlslastige ... Gerechtigkeitspräsumtion“ (1) hinaus gekommen, die sich aus der Tradition des egalitären Liberalismus mit seiner Vorliebe für zwangssolidarische, umverteilungsverliebte – kurzum sozialistisch gefärbte – Staatsmodelle speise. Diese zurzeit von US-amerikanischen Autoren wie John Rawls, Ronald Dworkin oder Thomas Nagel vertretene Spielart des Liberalismus aber sei in ihrem Versuch, sozialstaatsbegründende Gerechtigkeitstheorien zu entwickeln, kaum über „politisch unverbindliche und begrifflich exaltierte Konstruktionsspiele“ (6) hinaus gekommen. Man ahnt früh: wieder mal tut ein „Paradigmenwechsel“ (6) Not, an dessen Ende gegen den laut Kersting hypertrophe Sozialstaatsmodelle gebärenden, egalitären Liberalismus ein von Robert Nozick inspirierter, Kersting- Neuerscheinungen scher „Liberalismus sans phrase“ mit seiner kostengünstigen Vision eines „Minimalsozialstaat(s)“ (7) ins Feld geführt wird. Kerstings bärbeißige, auf Dauer ermüdende Aversion gegen den auf egalitären Liberalismuskonzepten fussenden bundesrepublikanischen Sozialstaat kennt dabei keine Grenzen. Kaum etwas, was sich dieser nicht vorwerfen lassen muss: Im Stile eines Gefälligkeitsgutachten für die hiesigen Arbeitgeberverbände geißelt der Autor in seinen Sammelbandbeiträgen den Sozialstaat als unaufhörlich expandierende, geldgierige Versorgungsbürokratie, die mit seinem Versorgungsmaximalismus das bürgerliche Lebensethos untergrabe, die Demokratie schwäche und der Marktwirtschaft wie ein Alp auf der Brust sitze. Zudem produziere er ein „geradezu naturwüchsig“ wachsendes Klientel von Leistungsbeziehern, die sich angesichts der üppigen, unaufhörlich wachsenden Leistungsangeboten des Arbeits- und Sozialamts in „einem System umfassender Daseinswattierung“ (15; 58 f.; 248 ff.) häuslich eingerichtet haben. Bemerkenswert daran ist vor allem, dass Kersting es offensichtlich für verzichtbar hält, auch nur eine seiner Behauptungen empirisch zu belegen. Nun wird aber Falsches nicht dadurch richtiger, dass es aus der Feder eine Philosophieprofessors stammt. Ein wissbegieriger Blick in einige der in dem Sammelband über die „Politische Philosophie des Sozialstaats“ vereinigten Texte hätten daher auch Kersting gut getan. So verweist etwa Georg Lohmann zu Recht darauf, dass in von Massenarbeitslosigkeit und Globalisie- rungsdruck bestimmten nationalen Ökonomien ein ganzes Bündel sozialer und ökonomischer Gründe wirksam wird, die den Sozialstaat in eine schwere Krise gebracht haben, aber gerade nicht einem hypertrophen, institutionalisiertem Egalitarismus entspringen (353). Und auch Michael Schefczyk und Birger P. Priddat bilanzieren in ihrem sehr lesenswerten Aufsatz, dass die drohende Implosion des Sozialstaats nicht etwa der verwerflichen Neigung der Menschen zu umfassender Daseinswattierung entspringt, sondern sich vor allem dem weltweit zu beobachtenden „Jobless Growth“ bei gleichzeitig rationalisierungsbedingter wegbrechender Beschäftigungsbasis verdankt (464). Der Sozialstaat befindet sich folglich nicht in einer begründungstheoretischen Krise, sondern in einer ökonomischen, die sich wiederum nicht überzogenem Anspruchsdenken der Empfänger sozialer Leistungen verdankt, sondern in starkem Maße der offensichtlich schwindenden Fähigkeit marktwirtschaftlicher Ökonomien, genügend Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Dass darüber hinaus der Sozialstaat z. B. durch Bürokratisierung seines Verwaltungsapparats oder lobbyistischer Klientelinteressen seitens politischer Akteure auch von dieser Seite her Gefahr läuft, sein eigentliches Ziel zu verfehlen, bleibt unbestritten – wobei die ersten Opfer solcher Fehlentwicklungen nicht, wie Kersting fortlaufend behauptet, die Steuerzahler, sondern in der Regel wiederum jene sind, die die Unterstützung des Sozialstaats am dringendsten benötigen. [vgl. dazu im Sammelband den Aufsatz von Peter Koller, insb. 151 ff] Neuerscheinungen Es ist dies der eklatanteste Mangel der Kerstingschen Ausführungen, dass er mit seiner polemischen Kritik des Sozialstaats und dessen vorgeblich „perfekte(r) Versicherung gegen Daseinsrisiken und Lebensunzufriedenheit“ (252) durchgehend einen Popanz bekämpft, der primär den inbrünstig gepflegten Vorurteilen des Autors selbst entspringt. Diese Neigung, an die Stelle einer gründlichen Analyse realer Strukturzusammenhänge vor allem eigene Konstrukte zu bearbeiten, findet sich auch in Kerstings Auseinandersetzung mit den Repräsentanten des egalitären Liberalismus, die im Zentrum von „Theorien sozialer Gerechtigkeit“ steht. Ehemals selbst Parteigänger dieses Theorieprogramms (vgl. 6, Anm. 3), unterzieht er nun Rawls & Co. einer Totalkritik aus der Warte des enttäuschten Renegaten und lehnt nun egalitär-liberale Positionen in Gänze und in praktisch jedem noch so kleinen Detail ab. Dies geschieht allzu oft um den Preis der Überzeichnung des zu kritisierenden Gegenstandes: John Rawls, dessen Argumente Kersting schon mal als „grotesk unvernünftig“, „absurd“ und „Unfug“ (122) abtut, mutiert so zum Befürworter gentechnischer Manipulationen im Dienste gleicher Talentverteilung (124 ff.). Thomas Nagel gereicht schon zum Nachteil, dass er die Legitimität des Privateigentums nicht diskutiere und versäumt habe, sich des Themas Erbrecht anzunehmen (298), statt dessen aber dem „alten linken Projekt der Gesellschaftskritik rührende Treue“ (289) halte und seine distributionsfixierten egalitären Gerechtigkeitsvorstellungen unter Ausblendung eherner anthropologischer Gewissheiten über die Natur des Menschen naiv moralphilosophisch zu begründen suche (291 ff.). Ronald Dworkin schließlich muss sich – wie schon Rawls und Nagel – den Vorwurf gefallen lassen, eine sich im Idealistischen verlierende, triviale Egalitaritätstheorie ohne praxisleitende Qualitäten zu vertreten, die nichtsdestotrotz wegen ihres dickköpfigen Beharrens auf dem zentralen Primat der Gleichheit totalitaristische Züge aufweist (216 ff., 240). Dass von Kersting verwendete Interpretationsmuster ist dabei immer das gleiche: Nebenschauplätze werden zu zentralen Theoremen erklärt, es dominiert eine konsequent negative, überzogen alarmistische Lesart der kritisierten Autoren unter permanenter Ausblendung vorhandener Zwischentöne sowie eine fortwährende Missachtung methodischer Prinzipien. Allein Kerstings Auseinandersetzung mit Rawls belegt dies mustergültig: Wieder muss der ebenso alte wie fragwürdige Vorwurf herhalten, Rawls’ Urzustand, der darin wirksame Schleier des Unwissens und die daraus resultierenden Gerechtigkeitsgrundsätze seien lebensfern, um eine bewusst methodischabstraktes Gedankenexperiment als technokratisch, politikfern und subjektfeindlich zu diskreditieren (74 ff., 110 ff., 137 ff.) Dass Rawls wiederholt ausgeführt hat, seine beiden Gerechtigkeitsgrundsätze der gleichen Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit geben zunächst nur das Formprinzip ab, innerhalb dessen dann konkrete, politisch mündige Bürger über die Ausgestaltung einer Neuerscheinungen gerechten Gesellschaft streiten müssen, nimmt Kersting konsequent nicht zur Kenntnis. Bleibt zuletzt noch der kurze Blick auf den vollmundig als Paradigmenwechsel angekündigten Kerstingschen „Liberalismus sans phrase“. Auf nicht einmal fünfzig Seiten entfaltet Kersting dort eine Theorie, die doch immerhin das formulieren will, was Generationen von Philosophen vergebens versucht haben: eine zuverlässige, normative Hintergrundstheorie des Sozialstaats. Das Ergebnis ist mehr als bescheiden: Kerstings Beitrag erschöpft sich in einem nebulösen Plädoyer für einen Staat, der sich der „engagierte(n) Gewährleistung von Chancengleichheit“ (8) verbunden weiß und ein „hinreichend ausdifferenziertes Erziehungs- und Ausbildungssystem“ (372) ebenso für unerlässlich hält wie eine „aktive Arbeitsmarktpolitik“ (398). Ansonsten aber helfe der sich an „den Umrissen der allgemeinen Wertüberzeugungen“ (392) orientierende Staat Gestrauchelten nur „okkasionalistisch und situativ“, weil er sich im Gegensatz zum Staatskonzept des egalitären Liberalismus weigern müsse, „Gleichheit und Ungleichheit zu moralisieren“ (386). Das war’s. Konkreteres sucht man in dieser Trümmerlandschaft allgemeiner Wertüberzeugungen vergebens – wie aktive Arbeitsmarktpolitik aussieht und was eine differenziertes Ausbildungssystem charakterisiert, bleibt leider das Geheimnis des mit beaucoup de phrase formulierenden Kieler Paradigmenwechslers. Franco Zotta Theo Kobusch (Hg) Philosophen des Mittelalters. Eine Einführung, Darmstadt 2000 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 282 S., 22,.90 EUR. Als Kurt Flasch im Jahre 1986 seine Geschichte des mittelalterlichen Denkens1 vorgelegt hatte, wurde eine Lücke geschlossen. Denn eine moderne, das neuscholastische Korsett sprengende Darstellung der Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, gab es bis dahin nicht. Durch dieses Buch wurde zugleich einer ganzen Generation von Studierenden der Zugang zu einem bis dahin weitgehend verdrängten Abschnitt der Geschichte der Philosophie wieder eröffnet, der bis dahin allzu gerne den Theologen überlassen blieb. Trotz mancher Desiderate, auf die nicht zuletzt Flasch selbst hingewiesen und auf weitere Forschungen gedrängt hatte, kann sich das Buch von Kobusch nicht annähernd mit Flaschs Darstellung messen. Zwar stellt sich Kobusch wie auch Flasch das Problem, wie man eine Geschichte der Philosophie nach dem Ende der Dominanz der Neuscholastik schreiben müsse; während Flasch jedoch versucht hatte, die Texte der mittelalterlichen Denker als Dokumente einer immer wieder von Neuem anhebenden Auseinandersetzung mit ihren eigenen intellektuellen Erfahrungen, mit neuen Naturerkenntnissen, mit politischen und gesellschaftlichen Kurt Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustin zu Machiavelli, Stuttgart 1986 1 Neuerscheinungen Konstellationen zu sehen, vermutet hier Kobusch vulgärmarxistische Gespenster. In seiner Konzeption ist die Distanzierung zu Flaschs Ansatz so dominant, daß der Versuch eines „postneoscholastischen“ Neuansatzes kaum noch zur Geltung kommt. Obwohl Kobusch zu Recht darauf insistiert, daß man von der Philosophie des Mittelalters nichts verstehe, wenn man nicht zu fragen gelernt hat, wie sie sich selbst verstanden habe (7), gerät er doch in seiner negativen Fixierung auf Flaschs Ansatz wieder in die Nähe alter Konzeptionen. Die 17 Beiträge sind die Zusammenfassungen einer Vorlesungsreihe, die im Wintersemester 1998/99 an der Universität Bochum durchgeführt wurde; sie sind als Einführungen zu einzelnen Philosophen gedacht. Ihre Auswahl folgt der bekannten eurozentristischen Tradition, nach der „mittelalterliche Philosophie“ immer noch im wesentlichen „christliche Philosophie“ bedeutet, wobei die Berücksichtigung von Ibn Sina (Avicenna), Ibn Ruschd (Averroes) und Moses ben Maimon (Maimonides) ganz dem traditionellen Schema entspricht. Das philosophische Mittelalter anderer Kulturen wird ignoriert. Insofern ist der Titel entweder eine Irreführung oder Ausdruck christlichabendländischer Borniertheit. Die Autoren der Beiträge haben sich nur zum Teil dem Konzept des Herausgebers untergeordnet. So versucht Josep Puig Montada in dem sehr gut gelungenen Beitrag zu Ibn Ruschd die vielfältigen Traditionszusammenhänge zwischen dem arabischen und dem christlichen Denken wenigsten anzureißen. Wenn Georg Wieland in seiner Einführung zu Albertus Magnus darauf hinweist, daß die AristotelesKommentare des Thomas von Aquin just mit dem Versuch zusammenfallen, an der Pariser Artistenfakultät einen autonomen Philosophiebegriff zu entwickeln, und daß diese Versuche mit der Herausbildung der städtischen und damit einer frühbürgerlichen Kultur zusammenfallen, so hebt er sich wohltuend von der Konzeption des Herausgebers ab. Eröffnet wird die Vorlesungsreihe mit dem Beitrag Dermot Morans zu Johannes Scottus Eriugena, dieser fast einzigartigen philosophischen Gestalt der Karolingerzeit. Daß dabei das Periphyseon im Mittelpunkt der Darstellung steht, ist selbstverständlich; doch hätte man die Stellung der Philosophie jener Zeit zwischen den karolingischen Eigenkirchen, den mächtigen Klöstern und den Ansprüchen Roms sehr viel plastischer herausarbeiten können, wenn man seine Auseinandersetzung mit Gottschalk von Orbais nicht bloß nebenbei erwähnt hätte. Er referiert die gängige Deutung, daß Eriugena dessen Lehre von der „doppelten Prädestination“ zurückgewiesen habe; dies sieht die neuere Forschung differenzierter. Seine Schrift „de divina praedestinatione“ wird offiziell verurteilt, über die Gründe dazu sagt Moran nichts. Daher wird auch nicht so recht klar, weshalb Eriugena des Schutzes Karls des Kahlen bedurfte. Der „wichtigste in Latein schreibende Philosoph zwischen Boethius und Anselm“ (13) und die Philosophie dieser Zeit hätte eine größere Aufmerksamkeit verdient. Einen guten Neuerscheinungen Überblick über das philosophische Hauptwerk des Ibn Sina „Das Buch der Genesung der Seele“ gibt Dimitri Gutas. Leider kommt aber die wissenschaftliche Breite des Wirkens dieses bedeutenden Gelehrten etwas zu kurz. Der Vorlesungscharakter ist bei keinem der Beiträge erhalten geblieben, was der Absicht des Bandes, in die mittelalterliche Philosophie einzuführen, zugute gekommen wäre. Die gedrängte Darstellung herrscht vor. Markus Enders verzichtet weitgehend auf eine angemessene Darstellung der Biographie Bernhards von Clairvaux und reduziert dessen Wirken auf die Explikation der menschlichen und göttlichen Liebe. Aber gerade bei Bernhard ist Philosophie von Theologie und Politik nicht zu trennen. Seine Auseinandersetzungen mit Abaelard, die wesentlich zu dessen Verurteilung durch den Papst beitrugen, und seine fanatischen Aufrufe zum Kreuzzug werden nicht erwähnt. Einzig Klaus Jacobi beschwert sich in einer Fußnote, daß er auf Drängen des Herausgebers seinen Beitrag „um einige größere Abschnitte“ kürzen mußte. Es empfiehlt sich, sein Angebot wahrzunehmen, und sich die ungekürzte Fassung zuschicken zu lassen. Sein Beitrag zu Abaelard konzentriert sich auf den Logiker; seine Charakteristik der Logik als einer scientia discernendi wird als der eigenständige Beitrag Abaelards herausgehoben. Die Autoren haben sich, was kaum anders zu erwarten war, auf einen gemeinsamen Philosophiebegriff nicht geeinigt. Das tut dem Band aber keinen Abbruch. Mitunter wird ein moderner Philosophiebegriff ins Mittelalter projiziert. So möchte Rémi Brague Moshe ben Maimon und einige andere Scholastiker nicht unbedingt als Philosophen gelten lassen. Dagegen charakterisiert er an anderer Stelle die Gesamtstrategie des Maimonides als den Versuch, die herkömmlichen Gründe für das Bestehen und die Geltung des Judentums aufzuheben und sie durch neue, philosophische Gründe zu ersetzen. (108) Außerdem könne man seinen Einfluß auf das geistige Leben des Judentums und indirekt des Christentums kaum überschätzen. (108) Ein merkwürdiger Gegensatz. Georg Wieland hat seine Artikel zu Albertus Magnus so komprimiert, daß der Einführungscharakter verloren ging. Auch hat er sich mit seinem Thema der Herausbildung der philosophischen Autonomie bei Albert – obwohl ein wichtiges Thema – in ein Spezialgebiet so sehr eingelassen, daß er nicht mehr zu einer Gesamtwürdigung seines Schaffens kommt. Wenn Albertus z. B. selbständige naturwissenschaftliche Studien betrieb, so war ihm dies nicht bloß wegen seiner Aristoteleskenntnisse möglich gewesen, sondern weil er auch die Werke von so bedeutenden nichtchristlichen Denkern wie Ibn Sina, Al-Kindi, AlGhazali, Maimonides, Al-Farabi, Ibn Gabriol, und nicht zuletzt Ibn Ruschd kritisch durchgearbeitet hatte. Wie notwendig und fruchtbar es ist, hermeneutische Gesichtspunkte geltend zu machen, zeigt Klaus Hedwig bei der Charakterisierung von Roger Bacons scientia experimentalis. Man kann dieses Werk nicht „auf eine einzige traditionelle oder moderne Tendenz festlegen“ (149). Obwohl Neuerscheinungen er gewiß die Wissenschaft auf eine „neue, operative und inventive Perspektive“ (150) ausgerichtet hat, verließ er doch die traditionellen Voraussetzungen nicht. So ist ein Buch mit sehr unterschiedlichen Beiträgen entstanden und so spiegelt es auch die gegenwärtige Forschungssituation auf dem Gebiet der Geschichte des mittelalterlichen Denkens wider. Martin Schraven Rolf Kreibich, Udo E. Simonis (Hg) Global Change – Globaler Wandel. Ursachenkomplexe und Lösungsmöglichkeiten – Causal Structures and Indicativ Solutions; Berlin 2000 (Arno Spitz-Verlag), kart., 307 S., 25 EUR. Die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW) versteht sich als Teil der Zivilgesellschaft; sie macht ihre besondere Verantwortung darin aus, allen jenen Problemen zunächst Ohr, dann Mund zu leihen, „die sich aus der fortschreitenden Entwicklung von Wissenschaft und Technik für die Menschheit ergeben“. Dieses ebenso ambitiöse wie verdienstvolle Anliegen bildet den einen Grund, der Schrift publizistische Schützenhilfe angedeihen zu lassen. Wissenschaft findet regelmäßig nämlich bloß dann Gehör, wenn sie sich wirtschaftlich verwerten läßt. Dazu gehört mutatis mutandis, daß kritische Positionen unter den Teppich gekehrt werden, wenn sie nicht bereit sind, dem Erfolg ohne dessen Kehrseiten zu dienen. Respekt auch für die ungern vernommenen Ergebnisse der Forschung zu verlangen, gehört daher zu den vornehmen Aufgaben, die verantwortungsbewußte Wissenschaft nachhaltig zu meistern ebenso aufgefordert ist wie ihrem originären Anliegen, der Erforschung der den Menschen zuträglichsten Bedingungen eines guten Lebens – weil dies zusammengehört. Die Optionen, die wirtschaftlich verwertbare Wissenschaft bisher zur Verfügung stellte, haben die Bedingungen guten Lebens nicht nur gefördert, sie haben diese Bedingungen vielmehr zugleich aufs Äusserste gefährdet. Dieser Band, der mit einigen Zuständen globaler Umwelt konfrontiert, belegt diese Feststellung erneut aufs Nachdrücklichste. Insoweit repräsentiert die Schrift aber nur Vertrautes, das man von kritischer (Umwelt)Wissenschaft seit geraumer Zeit erwarten darf. Einige der Beiträge enthalten aber qualitativ Neues. Dieses Neue indiziert die Möglichkeit eines umweltpolitischen Paradigmenwechsels mit dem Potential, das janusköpfige Profil von Wissenschaft gewissermaßen widerspruchsfrei aufzuheben, das in der ihr beinahe naturhaft immanenten kontradiktorischen Anwendbarkeit beruht. Sollte die Vermeidung eines dual use gelingen, wäre der optimale Standpunkt gefunden, auf dem sich (Umwelt)Wissenschaft neutral positionieren könnte. Der notwendige Einfluß auf die publikumswirksame Meinungsbildung würde dadurch sozusagen selbstreferentiell; das ist der andere Grund, der Schrift gehörige Aufmerksamkeit zu widmen. War Umweltpolitik – in der ‚guten alten Zeit’ – vorwiegend konserva- Neuerscheinungen tiv auf Reparatur, besser auf vorbeugende Verminderung oder sogar Vermeidung ökologischer Schäden gerichtet, so wird sie – in der ‚schönen neuen Welt’ – an die vorderste Front einer leicht entflammbaren Fortschritts-Euphorie gedrängt. Die Fehlentwicklungen der industriellen Zivilisation sind dann nicht mehr ökologische Last, sie mutieren auf wundersame Weise zu wissenschaftlicher Lust, die der Umweltpolitik geradezu Flügel wachsen läßt. Im Beitrag von Hans-Joachim Schellnhuber wird dieser Paradigmenwechsel bereits erkennbar. Weil der Wandel der globalen Umwelt „nicht das Resultat konzertierten Planens und Handelns, sondern das Produkt einer unaufhaltsamen, wildwüchsigen Ausbreitung des technischindustriellen Zivilisationsmusters ist“, plädiert der renommierte Klimaforscher für „Geokybernetik“, also für ein systemisch betriebenes „globales Umwelt- und Entwicklungsmanagement“. Geo-Ingenieure, die über umfassende Kenntnisse des „Organismus Erde“ und über die entsprechenden technischen – sowie finanziellen! – Mittel verfügen, können damit dessen von der Zivilisation geschlagenen Wunden mit Hilfe einer Art von HightechChirurgie heilen. Auf diese Weise ließe sich, so der Autor recht zuversichtlich, zum Beispiel das ‚Ozonloch’ reparieren, der TreibhausEffekt ventilieren oder auch das süße Schmelzwasser der Eisberge mit ‚Salzstreuern’ berieseln, damit der Golf-Strom weiterhin heizt. Im Grunde bleibt es zwar noch bei der ‚schlechten alten’ Reparatur, sie wird nun aber generalisiert, auf das gesamte „Raumschiff Erde“ ausgedehnt gedacht. Während Schellnhuber seine Vorstellungen, die Verena Winiwarter in milder Euphemie als „Kolonialisierung von Natur“ charakterisiert, gleich der ‚Peinlichen Halsgerichtsordnung’ Karls V. noch mit einigen salvatorischen Klauseln versieht, zündet der Politikwissenschaftler Joseph Huber die Wunderkerze an beiden Enden gleichzeitig an – das doppelte Vergnügen in der halben Zeit. Umstandslos erklärt Huber die überkommenen umweltpolitischen Orientierungen für obsolet, weil sie zu wenig dauerhafte Entlastung bringen. Genügsamkeit, Sparsamkeit, intelligente Technik, Optimierung von Wirksamkeiten – das seinen Orientierungen, die nur von Einfaltspinseln erdacht sein können. Als wirksam anerkennt der Autor allein eine „metabolisch naturintegrierte Industrielle Ökologie“, bei der die industriegesellschaftlichen Stoffumsätze ökologisch so gestylt werden, daß sie sich in den Stoffwechsel der Natur nahezu fugenund folgenlos einpassen. Ökologie dieser Art läßt sich nur noch von den Füßen auf den Kopf gestellt denken, weil „die Gentechnik eine ökologische Frage höherer Ordnung konstituiert“, welche ökologische Probleme durch Negation von Ökologie löst; das ist ein neues Paradigma. Huber sieht dies keineswegs als „neue Hybris“, er hält vielmehr für frevelhaft, sich dieser unausweichlich gewordenen Herausforderung zu verweigern – ganz wie Erysichthon! Hubers Vorstellung erinnert an Marx’ Forderung, man müsse Natur wie boni patres familias kommenden Neuerscheinungen Generationen verbessert hinterlassen. Davon jedoch kann – hier wie dort – keine Rede sein. Huber negiert nicht nur schlicht die mannigfachen ‚ökologischen Rucksäcke’, die diese ins Maßlose ausufern könnende Produktionsweise hervorruft, er negiert vielmehr das unabwendbar werdende Ausgeliefertsein an die völlig enthemmten, weil zwanghaften Entwicklungen der Bio- und der Gentechnologien, die nach immer wagemutigeren Experimenten verlangen – obwohl wir davon nur wissen, daß wir davon fast nichts wissen! Huber spielt dabei bloß das Spiel des alten Industriekapitalismus mit etwas variierten Mitteln. Darin aber liegt die ‚Stärke’ seiner Vorstellungen. Denn kaum eingestiegen, ist der Ausstieg schon fast völlig verschlossen. Und gerade weil die Interessen des alten Industriekapitalismus auf dem Spiel stehen, sind die Aussichten gut, daß es so kommen könnte wie von Huber propagiert. Seine Forderung ist zwar ungefähr so überzeugend wie die seinerzeitige Anpreisung, bald könne sich jeder sein eigenes kleines Atomkraftwerk ins Wohnzimmer stellen, um alle Energiebedürfnisse für ewig zu lösen, aber sie ist weit gefährlicher, weil es aus einer gentechnisch veränderten Welt keine Rückkehr mehr geben wird; entsprechend wird das gentechnische Tschernobyl ausfallen! Unschwer vorhersagen läßt sich, daß der optimale Standpunkt, auf dem sich (Umwelt)Wissenschaft neutral positionieren könnte, durch derartige Würfe gentechnischer Kunst-Natur verfehlt werden dürfte; durch den Paradigmen-Wechsel wird der dual use-Konflikt verschärft. Vorhersagen läßt sich deshalb auch, daß der Anspruch der VDW, sich aus Verantwortung für die Entwicklungen in Wissenschaft und Technik einzumischen, dringender wird, aber auch aussichtsloser. Bernd M. Malunat Herbert Marcuse Kunst und Befreiung. Nachgelassene Schriften Band 2. Hg. und mit einem Vorwort von Peter Erwin Jansen. Einleitung von Gerhard Schweppenhäuser. Aus dem Amerikanischen von Michael Haupt und Stephan Bundschuh. 166 S., Hardcover, Schutzumschlag, 19.EUR. Herbert Marcuse hat im Unterschied zu Adorno und Benjamin keine explizite ästhetische Theorie vorgelegt, sich jedoch sowohl in seinen philosophischen Hauptwerken, als auch in kleineren Schriften mit der Problematik der Kunst auseinandergesetzt. Noch die letzte zu seinen Lebzeiten veröffentlichte Arbeit, der Essay „Die Permanenz der Kunst. Wider eine bestimmte marxistische Ästhetik“ zeugt von der Relevanz, die Marcuse der Kunst in seiner theoretischen Konzeption beimaß. Detailliert zeigt Gerhard Schweppenhäuser in der Einleitung des vorliegenden Bandes auf, welche Stellung der Kunst in Bezug auf die in Marcuses Hauptwerken entwickelte Begrifflichkeit zukommt – der Leser erhält so eine plausible Möglichkeit, die zwischen 1945 und 1977 entstandenen ästhetischen Essays, Entwürfe, Vorträge Neuerscheinungen und Diskussionsbeiträge den zentralen Motiven der Philosophie Marcuses zuzuordnen. Marcuses Denkansatz ist einerseits geprägt von der historischen Erfahrung der totalitären Systeme des Nationalsozialismus und Stalinismus, wie von der Erfahrung der gesellschaftlichen Totalität einer „eindimensionalen“ kapitalistischen Moderne und deren Auswirkungen über die Produktions- und Konsumtionssphäre bis in die anthropologischen Grundlagen, die Bedürfnisse und die psychische Struktur des Menschen, wie dies Marcuse in seinen theoretischen Hauptwerken, vor allem in „Der eindimensionale Mensch“, dem meistgelesenen Werk der Studentenbewegung, thematisierte. Die Attraktivität des Marcuseschen Denkens verdankte sich aber nicht zuletzt auch seiner Frage nach einer subversiven Praxis jenseits der repressiven gesellschaftlichen Integration des „revolutionären Subjekts“, des Proletariats in West und Ost. Potentiale hierfür erblickte Marcuse in der Studentenbewegung, den Aufständen in schwarzen Ghettos amerikanischer Städte etc. Unter diesen skizzierten Rahmenbedingungen ist es für Marcuse nur möglich, die Kunst dialektisch in ihrem „Doppelcharakter“ zu bestimmen. Enthält der ästhetische Schein oder – in Marcusescher Terminologie – die ästhetische Sublimierung einerseits ein affirmatives Moment „falscher“, versöhnender Aufhebung gesellschaftlicher Antagonismen, so andererseits immer auch eine transzendierende, utopische Seite. Verständlich wird so, warum Marcuse – durchgängiges Motiv der hier versammelten Texte – dezidiert die ästhetische Autonomie und die künstlerische Form, die Eigensprachlichkeit des Kunstwerks als Kraft der Negation jeglicher Form der Verdinglichung wie auch der politisch-propagandistischen Indienstnahme der Kunst verteidigt. Dies verdeutlichen schon die frühesten Aufzeichnungen des Bandes über „Kunst und Politik im totalitären Zeitalter“, in denen Marcuse in zur Zeit der Résistance verfaßten Werken Aragons, „die oppositionelle, die negierende Kraft der Kunst in der Form, dem künstlerische Apriori, das den Inhalt gestaltet,“ aufspürt. Beispielhaft auch die „Notizen zu Proust“, in denen Marcuse – ein Motiv Benjamins aufnehmend – die Erinnerung gegen das Vergessen stellt, denn „alle Verdinglichung ist Vergessen. Die Kunst kämpft gegen die Verdinglichung, in dem sie die versteinerte Welt zum Sprechen bringt“. Die Frage nach der Möglichkeit der transzendierenden Negativität ästhetischer Autonomie akzentuiert sich am schärfsten angesichts Adornos Diktum, ob nach Auschwitz Lyrik noch möglich sei. Marcuse bejaht dies unter der Voraussetzung, daß „sie mit unnachsichtiger Verfremdung den Schrecken re-präsentiert, der da war – und noch immer ist“. Marcuse sieht dies auch in einigen Prosawerken gewährleist, den Werken Kafkas, Becketts und Peter Weiss’ Ästhetik des Widerstands“. Obwohl Marcuses ästhetische Theoreme unverkennbar an traditionellen ästhetischen Kategorien ausgerichtet sind, wie sich seine Vorstellungen künstlerischer Avantgarde an der klassischen Avantgarde des Surrealismus oder des russischen For- Neuerscheinungen malismus orientieren, scheute er nicht die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen künstlerischen und kunsttheoretischen Strömungen. In diesem Spannungsfeld werden die Aporien seines Praxisansatzes vielleicht am offensichtlichsten. Wie Marcuse einerseits in Formen der Massenkultur, wie in afroamerikanischer Popmusik oder in den Songs Bob Dylans utopische Momente einer befreiten Sinnlichkeit und subversive Potentiale aufblitzen sah, so beharrte er gegenüber zeitgenössischen pseudorevolutionären Ansätzen einer Politisierung der Kunst oder einer „Aufhebung“ der Kunst in Lebenspraxis auf der Differenz und der Permanenz ästhetischer Autonomie. Die briefliche Diskussion mit der Gruppe der „Chicago Surrealists“ gibt davon beredtes Zeugnis. Daß gerade hierin die Aktualität des Marcuseschen Ansatzes liegen könnte, hat vielleicht – ein originelles Schlaglicht werfend – Samuel Beckett erkannt, der Marcuse zu dessen 80. Geburtstag ein Gedicht widmete, das dem Band, ebenso wie ein faksimilierter Briefwechsel zwischen Philosoph und Dichter, beigegeben ist: „Pas a pas / nulle part / nul seul / ne sait comment / petits pas / nulle part / obstinément (Schritt um Schritt / in keiner Richtung / weiß nicht wie / schrittchenweise / in keiner Richtung / voll Eigensinn)“. Georg Koch Oskar Negt Arbeit und menschliche Würde, Göttingen 2001 (Steidl-Verlag), geb., 752 S., 29.- EUR. In einer Fußnote seines 1794 publizierten Traktats „Das Ende aller Dinge“ befaßte sich Immanuel Kant mit der in Philosophie und Metaphysik anzutreffenden „Meinung von der verderbten Beschaffenheit des menschlichen Geschlechts“. Der Königsberger Philosoph zählte in diesem Zusammenhang vor allem vier Sinnbilder auf, mittels denen „sich dünkende Weise ... unsere Erdenwelt“ verächtlich machen wollen: die Sicht der Welt „als Wirtshaus (Karavanserai), ... wo jeder auf seiner Lebensreise Einkehrende gefaßt sein muß, von einem folgenden bald verdrängt zu werden; als Zuchthaus ... ein Ort der Züchtigung und Reinigung gefallner, aus dem Himmel verstoßner Geister; als Tollhaus: wo nicht allein jeder für sich seine eignen Absichten vernichtet, sondern einer dem anderen alles erdenkliche Herzeleid zufügt; als Kloak, wo aller Unrat aus anderen Welten hingebannt worden.“ Für Kant sind alle diese „widerwärtigen Gleichnisse“ nicht zuletzt deshalb verfehlt, ja, in einem fundamentalen Sinne, unwahr, weil sie es durchwegs unterlassen, „die Anlage zum Guten in der menschlichen Natur einiger Aufmerksamkeit zu würdigen.“ Wird hiervon aber abgesehen, geht der philosophischen Reflexion, so Kant, auch die entscheidende Bestimmung menschlicher Wesen – die jedem Menschen, ob seiner Möglichkeit zur vernünftigen und selbstbestimmten Zwecksetzung, a priori eigene und prinzipiell unveräußerliche Würde – als normativer Flucht- und Ankerpunkt verloren. Wie es nun mit der Menschenwürde in einer Epoche bestellt ist, der zwar Neuerscheinungen die Welt nicht mehr als metaphysische Latrine, sondern statt dessen als multinationale Spielbank und Börse gilt, erörtert der Philosoph und Soziologe Oskar Negt in seiner neuesten Veröffentlichung „Arbeit und menschliche Würde“. Bereits der lakonisch knappe Titel verrät, daß für den Autor die Frage nach der Würde des Menschen aufs engste mit jener nach den Artikulationsformen der „Schlüsselkategorie Arbeit“ (Negt) zusammenhängt. Und das sowohl in einer ganz unmittelbaren, konkret gesellschaftspolitischen Perspektive – die spürbare Empörung des Verfassers über den sozialen Skandal wie die menschliche Katastrophe der Arbeitslosigkeit durchzieht leitmotivisch den gesamten Text –, als auch rücksichtlich einer sozialphilosophischen Grundsatzdebatte der gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Metamorphosen, welche zeitgenössisch unter den Schlagworten: „Globalisierung“, „Flexibilisierung“, „Risikogesellschaft“ oder „zweite Moderne“ Zumal die subsumiert in den gegenwärtigen werden. gesellschaftstheoretischen Diskursen übliche Verwendung des Ausdrucks „Globalisierung“ als gleichsam unantastbarer Substanzbegriff stellt für Negt eine grobe, weil im Kern ideologische, Verschleierung der damit bezeichneten Sachverhalte dar. Wird doch dabei komplett unterschlagen, daß sich hinter den Globalisierungsprozessen primär eine an der monströsen Maßlosigkeit des Kapitalprinzips orientierte Praxis verbirgt, welche durch ihren unersättlichen Quantifizierungssog die (inter)subjektiven Maßverhältnisse zerstört, indem sie die menschliche Arbeits- und Erfahrungsfähigkeit radikalen „Entbettungsvorgängen“ aussetzt. Wohl seien, wie der Autor richtigerweise feststellt, solche Umbrüche „historisch nichts Neues. Funktionsdifferenzierungen im Verhältnis von Staat und Gesellschaft, arbeitsteilige Spezialisierungen und Herrschaftsaufteilungen, die Entstehung von Expertensystemen – das alles ist vielfach beschrieben worden, von Karl Marx über Max Weber bis Joseph Schumpeter. Was allerdings heute unter Entbettung verstanden werde kann, eine ganz andere Dimension, weil die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien bestimmte Wirklichkeitsschichten nicht nur von gesellschaftlichen Verankerungen im Territorialstaat, in den sozialstaatlichen Sicherungssystemen und den kulturellen Besonderheiten der einzelnen Länder ablöst, sondern der Realabstraktion „Geld“ ein Ansehen und eine Macht gibt, welche die Realitätsdefinitionen unserer Lebensbereiche entscheidend beeinflußt.“ Bleibt nach Negt insoweit der (64) grundsätzliche Befund der marxistischen Gesellschaftsanalyse auch weiterhin stichhaltig und aktuell, so ist andererseits die Notwendigkeit zur einschneidenden Selbstreflexion und Erweiterung der thematischen Felder ihrer Kritik unübersehbar. Verdeutlicht doch die atemberaubende Durchschlagskraft und scheinbare Alternativlosigkeit der Globalisierung auch, daß, anders als von Marx und den meisten Marxisten unterstellt, die zügellose Kapitalexpansion keineswegs automatisch ihre „immanente Schranke“ Neuerscheinungen (Marx) in Gestalt des (organisierten) Proletariats findet. Weshalb heutzutage, nach der Hinwendung der Sozialdemokratie zur „Neuen Mitte“ sowie dem zunächst blutigen, dann glanzlosen Scheitern des Marxismus-Leninismus an der Realität, jegliche antikapitalistische Gesellschaftskritik sich einer Situation gegenübersieht, in der „die Kapitalund Marktlogik von nahezu allen Barrieren, Kontrollen, Widerständen, Gegenmachtpositionen befreit ist.“ (36) Angesichts jener historisch neuartigen Problemkonstellation schlägt der Verfasser deshalb eine Art „kopernikanischer Wende“ (Kant) für die kritische Theorie und Praxis der Gegenwart vor: Statt sich ausschließlich auf eine „Kritik der politischen Ökonomie der toten Arbeit, des Kapitals“ zu beschränken, die vieles erklärt, aber kaum (mehr) etwas bewegt, ist, sozusagen als subjektive Flankierung, eine „Kritik der politischen Ökonomie des lebendigen Arbeitsvermögens der Menschen“ in Angriff zu nehmen. Daß dieser zusammen mit Alexander Kluge von Oskar Negt schon seit längerem betriebene Paradigmenwechsel tatsächlich zu einer relevanten Innovation kritischer Sozialphilosophie beiträgt, zeigen eine Reihe von Problemstellungen und Deutungsansätzen in dem hier vorgestellten Buch. So, wenn sich der Autor mit dem prekären „Zwangszusammenhang von entfremdeter Arbeit, Freizeit und Faulheit“ beschäftigt, oder, wenn er, in einem höchst lesenswerten Exkurs, die Bezüge zwischen der alten moralphilosophischen Kategorie des „Unwiederholbaren“ mit der histo- rischen Semantik des neuzeitlichen Begriffs der Menschenwürde nachzeichnet. Allerdings nützt Negt in seiner jüngsten Publikation diese erhellende Tiefenschärfe und gedankliche Beweglichkeit seiner theoretischen Konzeption nicht durchgehend auf eine derart überzeugende Weise aus. Zwar gelingt es ihm immer wieder, zahlreiche Erscheinungen, welche die soziale und kulturelle Physiognomie unserer Zeit prägen, einer insgesamt zutreffenden Kritik zu unterziehen. Doch hierbei gerät weder das an jenen Phänomenen ebenso irritierende wie interessante Ambivalenzmoment in den Blick seiner Analyse, noch wird von ihm näher ausgeführt, worauf sich, gerade in Anbetracht der vom Autor diagnostizierten „Erosionskrise“ globalisierter (Inter-) Subjektivität, seine ungebrochene Zuversicht auf den menschlichen Willen zur Mündigkeit und Selbstbestimmung faktisch stützt. Der beiläufige Verweis auf das kantische Theoriekonstrukt der „regulativen Ideen“ und das darauf gegründete Vertrauen auf „die Anlage zum Guten in der menschlichen Natur“ überzeugt jedenfalls nicht wirklich. Die skizzierten Schwachstellen des Werks ergeben sich wohl nicht zuletzt daraus, daß, wie der Verfasser im Vorwort darlegt, die in ihm präsentierten Texte ursprünglich bloß Manuskripte für öffentliche Reden und Vorträge waren. Insofern ist Oskar Negts „Arbeit und menschliche Würde“ auch eher als ein rhetorisch furioser und pointierter Aufriß zeitgenössischer Fehlentwicklungen in Gesellschaft und Kultur zu verstehen, denn als ausgereiftes sozial- Neuerscheinungen philosophisches Grundlagenwerk. Aber in einer Situation, in der die Welt sich zusehend in ein Tollhaus oder einen Schrottplatz verwandelt, ist das bereits eine ganze Menge. Thomas Wimmer Henning Ottmann Geschichte des politischen Denkens. Von den Anfängen bei den Griechen bis auf unsere Zeit, Bd. 1.: Die Griechen (2 Teilbände), Stuttgart/Weimar 2001 (Metzler), 267 und 332 S., je Teilband 19.90 EUR. Eine Geschichte der „politischen Theorie“, der „politischen Philosophie“ oder der „politischen Ideen“ wollte der in München lehrende Henning Ottmann explizit nicht schreiben. Diese gängigen Ansätze sind ihm zu einseitig. Dagegen wählte er einen deutlich umfassenderen Zugang zum Thema. So präsentiert seine Geschichte des politischen Denkens nicht nur die klassischen politischen Philosophen wie Platon und Aristoteles, denen jeweils gut 100 Seiten gewidmet sind. Sie bietet auch eine kompetente Einführung in das politische Denken von Dichtern wie Homer und Pindar, in das der Historiker Herodot und Thukydides und in die politische Bedeutung der griechischen Tragödie. Zudem bezieht Ottmanns klares und gut geschriebenes Werk ausführlich die griechische Geschichte mit ein. So gibt es ein Kapitel über die Tyrannis, über Sparta und über die athenische Demokratie. Die berühmten Redenschreiber und Redner Isokrates und Demosthenes werden genausowenig übergangen wie der Sokratesschüler Xenophon, den Ottmann gegenüber der jüngeren Rezeption aufwertet und als einen „politischen Denker par excellence“ begreift. Der erste Band dieses auf insgesamt vier Bände angelegten Mammutprojekts schließt mit dem politischen Denken im Hellenismus, im besonderen mit den Kynikern, Epikur und der Stoa. Im Vorwort charakterisiert Ottmann die normative Position, der sein Werk verpflichtet ist, primär als einen „Modernitätskonservativismus“, „wie er von Joachim Ritter und seinen Schülern entwickelt worden ist“ (VI). Als dessen Ziel versteht Ottmann sowohl die Bewahrung der modernen Freiheit, d.h. der Emanzipation des Menschen aus seinen „Bindungen der Herkunft“, als auch die Bewahrung dieser Bindungen selbst. Vermutlich ist es die hier zum Ausdruck kommende Haltung eines „sowohl – als auch“, die hinter der durchgängig sehr ausgewogenen Interpretationspraxis dieses Bandes steht, die versucht, allen Positionen des antiken politischen Denkens möglichst gerecht zu werden. Dieses Bestreben verwirklicht Ottmann auch dadurch, daß er eine enorme Menge an älterer, neuerer und neuester Forschungsliteratur mit einbezieht. Die Literaturangaben sind erfreulicherweise nicht nur den einzelnen Kapiteln, sondern auch den einzelnen Themenbereichen zugeordnet. Das leserfreundliche Anliegen dieses Bandes läuft aber Gefahr, das rechte Maß zu überschreiten und zu didaktisch zu werden. So wird der Textfluß an manchen Stellen durch zu viele Untergliederungen unter- Neuerscheinungen brochen, was dazu führt, daß zwei bis drei Überschriften pro Seite keine Seltenheit sind. Wenig hilfreich sind auch die Kästen an den Kapitelenden, in denen schulbuchartig einige Daten zu den jeweils behandelten politischen Denkern aufgelistet sind. Im Gegensatz etwa zu Sabines History of Political Theory und zu dem von Fetscher und Münkler herausgegebenen Handbuch der politischen Ideen beschränkt sich Ottmann in den Kapiteln über Platon und Aristoteles nicht darauf, nahezu ausschließlich die politikphilosophischen Hauptwerke der beiden Klassiker auszulegen. Er behandelt auch Platons politische Philosophie im Protagoras, im Gorgias und im Timaios. Von Aristoteles thematisiert er neben der Metaphysik auch die Topik, die Rhetorik und die Poetik; letztere drei Werke als „Wege zur praktischen Philosophie“. Im Kapitel über die Wirkungsgeschichte Platons und an anderen Stellen argumentiert Ottmann bündig gegen Popper, der Platon bekanntlich als Vordenker des Totalitarismus scharf kritisierte: „vieles an dieser Kritik ist offensichtlich und schlichtweg falsch“ (Bd. 1/2, 101 f., vgl. 39, 57 f., 82). Ottmanns differenzierte Auseinandersetzung verschweigt dabei keineswegs die „anstößigen Lehren“ des athenischen „Verächters der Demokratie“, wie etwa die Eugenik, die „Verstaatlichung der Körper“ und die Zensur (Bd. 1/2, 101). Auch die Demokratiekritik des Aristoteles, die die moderne Rezeption gerne etwas herunterspielt, wird von Ottmann detailliert herausgearbeitet. Diese Kritik entspricht den aristokratischen Elementen von Aristo- teles’ Denken, seiner Wertschätzung von Tüchtigkeit, Leistung und Exzellenz. Daß diese Elemente aber auch mit der Rechtfertigung einer Politik von gleichberechtigten Bürgern vereinbart ist, zeigt sich an der Wunschpolis des Aristoteles, die für Ottmann „summa summarum am ehesten einer aristokratisch gefärbten Politie zu gleichen scheint“ (Bd. 1/2, 210, 111). Selbstverständlich enthält die Geschichte des politischen Denkens auch ein Kapitel über die Sophisten, die von Ottmann treffend politisch gruppiert werden. So gehören Thrasymachos und der ein Naturrecht des Stärkeren vertretende Kallikles zur sophistischen Rechten, Protagoras und Gorgias stehen in der Mitte und die sophistische Linke bilden Alkidamas, Antiphon, Hippias und Lykophron. Letzteren gesteht Ottmann zu, daß ihre „Politik der Gleichheit“ „bemerkenswert ist“, und betont, daß sie die ersten „Kritiker der Sklaverei“ und „die ersten Lehrer der Gleichheit der Menschen von Natur“ waren. Trotz seiner differenzierten Herangehensweise ist dieses Kapitel nicht ganz frei von unangemessenen Verallgemeinerungen: „Die Sophisten sind Skeptiker, die die Welt der Meinungen nicht übersteigen wollen“ (Bd. 1/1, 216f., 223). Dabei ist es doch gerade die sophistische Linke, die in der menschlichen Natur, jenseits der Relativität von strittigen Meinungen, Bräuchen und Gesetzen einen überpositiven und notwendigen Maßstab für „das richtige Recht“ zu gewinnen sucht (vgl. Nohlens Politiklexikon, Bd. 1, 360). Insofern wäre es endlich geboten, weniger Platon und Aristoteles als die „großen Neuerscheinungen Gründer des Naturrechts“ (Bd. 1/2, 152, vgl. 98) zu begreifen, sondern Alkidamas, Antiphon und Hippias. Als innovativ ist hervorzuheben, daß Ottmann die politische Dimension der gewöhnlich primär als Naturphilosophen und höchstens noch aus juristischer Perspektive gelesenen Vorsokratiker ans Licht bringt. In diesem Kapitel wie in anderen zeigt sich die Präsenz Nietzsches in Ottmanns Perspektive auf die Griechen. Insbesondere betont er mit Burckhard und Nietzsche die zentrale Bedeutung des Agons, des Wettstreits, für die griechische Kultur seit ihren aristokratischen Anfängen. Im agonalen Prinzip erblickt er auch die Wurzel des Leistungsprinzips der heutigen westlichen Kultur. Ottmann übernimmt Nietzsches Interpretationen der Griechen aber keineswegs kritiklos (etwa: Bd. 1/1: 16, 140f., 161, 170). So bemängelt er vor allem, daß Nietzsche und Burckhardt infolge ihrer Demokratiefeindlichkeit nicht sehen konnten, daß sich in der griechischen Kultur das Agonale, das Streben nach Leistung und Exzellenz, und das Demokratische und Bürgerliche, das Bewußtsein von Gleichheit und Gemeinsamkeit, vereinen und vertragen. Gerade durch die Verbindung und Spannung dieser beiden Momente, die er auch für alle heutigen Demokratien als vorbildlich erachtet, sieht Ottmann die griechische Kultur geprägt (Bd. 1/1: VI, 16). Manuel Knoll Tom Rockmore Heidegger und die französische Philosophie, Lüneburg 2000 (zu Klampen), geb., 310 S., 29.- EUR. Tom Rockmore, Jahrgang 1942, bekleidet das Amt eines Professors für Philosophie an der Duquesne University in Pittsburgh und ist u. a. durch Veröffentlichungen über Heideggers Nazismus und Hegels Philosophie über die Grenzen Amerikas hinweg bekannt geworden. In seiner ersten deutschsprachigen Buchveröffentlichung „Heidegger und die französische Philosophie“ stellt Rockmore die These auf, dass die französischen Philosophen, von Kojève über Beaufret und Sartre bis Derrida, Heideggers Denken jeweils als Neuinterpretation der Philosophie Hegels mißdeuten, als philosophische Anthropologie, nachmetaphysischen bzw. nicht-anthropologischen Humanismus oder emanzipatorischen Anti-Humanismus. Rockmores Ansatz, die Philosophie Heideggers anhand der verschiedenen französischen Rezeptionsphasen nachzuzeichnen, verbaut ihm daher von vornherein eine tiefergehende Analyse des Heideggerschen Werks. Dafür aber gibt sein Buch wichtige und interessante Hinweise auf die Funktionsweise der Diskursideologie, nicht nur in Frankreich. Rockmore verortet die Position Heideggers als „französischer Philosoph“ in der Tradition der Geisteswissenschaften Frankreichs, sich konzentrisch um die Theorie eines „Meisterdenkers“ zu bewegen, der das begriffliche Koordinatensystem bestimmt, in dem dann die verschiedenen Theoretiker Pro oder Neuerscheinungen Contra Stellung beziehen und noch in ihrer Negation durch die (mitunter unbewußte) Übereinstimmung mit den Axiomen und Prämissen des Meisters diesen mehr bestätigen als widerlegen: „Im Anschluß an einen großen Denker tendieren die philosophischen Positionen dazu, sich in seinem Wirkungskreis zu formen und um seine Theorie zu kreisen ... Die Theorie des Meisterdenkers wirkt gewissermaßen wie die Schwerkraft auf die Anschauungen anderer, die seine Probleme aufnehmen, seine Lösungen diskutieren und generell im Schwerefeld oder im begrifflichen Horizont seines Denkens verbleiben.“ (63) „... seine Anschauungen beeinflussen nicht nur die Debatte, sie definieren auch die Grenzen, in denen sie stattfindet, geben ihr einen Brennpunkt und stecken die Positionen ab, die von den Kontrahenten aufgenommen werden können.“ (54) Über die originäre philosophische Position Heideggers erfährt man indes wenig. Vielmehr wird die französische Rezeptionsgeschichte referiert und anhand exemplarischer Fälle gezeigt, dass die französischen Philosophen, die sich im Bannkreis von Heideggers Philosophie bewegten, diesen mißverstanden, ihre jeweils eigene Position in die Theoreme Heideggers hineininterpretierten oder ihre eigene Doktrin (wie z.B. Derrida) im Sinne des Meisters entwickelten und sich eben auch da affirmativ zu ihm verhalten haben, wo sie ihn zu kritisieren gedachten: „Für Derrida gibt es nichts außerhalb der Texte, und Texte bringen andere Texte hervor. Hermeneutisch gesehen, ist dies eine Version der antikontextualischen Auffas- sung, daß philosophische Theorien getrennt und unabhängig von ihren Entstehungskontexten verstanden werden können ... Wenn dieser Schachzug erlaubt ist, bleibt eine ganze Reihe von Faktoren außer Betracht, die möglicherweise für das Studium jeder philosophischen Position relevant sind, auf jeden Fall aber für das Verständnis von Heideggers Denken und seiner Beziehung zum Nazismus.“ (260 f.) „Alles in allem verbleibt Derrida, auch wenn er sich in seiner Sicht die Ideen Heideggers in Frage stellt, ... im wesentlichen oder vielleicht gänzlich in der Heidegger-Gemeinde. Wenn er Heideggers Position gelegentlich dem Wortlaut nach verwirft, so übernimmt er doch durchweg ihren Geist.“ (236) Der Frage aber, welche strukturellen Konsequenzen sich daraus für die französische Philosophie ergeben könnten, wird kaum nachgegangen. Ebenso wird eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Dogmen des französischen Poststrukturalismus und Dekonstruktivismus, die ja nicht unbeträchtlich auf Heideggerschen Theoremen fußen, eher angerissen als ausgeführt. Und der blinde Fleck der französischen Heidegger-Rezeption und ein zentraler Einwand gegen seine Philosophie – den Heidegger allerdings mit positiven Vorzeichen teilen würde –, dass er mit dem „Sein“ eben kein menschliches oder dingliches Sein thematisiere, sondern ein Verselbständigtes, eine unabhängige, alles Seiende konstruierende, gottähnliche Entität, wird dem Leser erst gegen Ende des Buches mitgeteilt (274, 282 ff., 288 f., 290 ff.). Neuerscheinungen Hierzu stellt Rockmore resümierend fest: „Heidegger ist kein Humanist, weil er sich im Grunde nicht mit dem Menschen beschäftigt. Und auch wenn sein frühes Denken, seine Wende zum Nazismus und das spätere Denken untrennbar miteinander verbunden sind, gibt es keinen Grund, seine Theorie als Ganze zu verwerfen. Sie sollte aber auch nicht zur Gänze unkritisch rezipiert werden. Sie sollte vielmehr ... vor dem Hintergrund seines Lebens und seiner Zeit interpretiert werden.“ (292) Hierbei stört weniger, dass Rockmore Heidegger nicht vollkommen ablehnt (auch Arnold Gehlen war ein Nazi, was aber nicht bedeuten muß, seine Schriften enthielten nichts Lesenswertes), sondern dass er nicht genau expliziert, was er an dessen Philosophie für wertvoll hält. Der Grund dafür – „die aufschlußreiche Konzeption der menschlichen Subjektivität durch das Prisma ihrer Existenz“, die die „traditionelle anthropologische Auffassung des Humanismus weiterzuentwickeln“ im Stande wäre – wird zwar kurz und sibyllinisch angegeben, aber nicht näher ausgeführt. Und so beschließt der Rezensent seine Lektüre mit der Gewißheit, Maßgebliches über die Strukturen und Mechanismen der DiskursIdeologie, Lehrreiches und Interessantes über die französische Heidegger-Rezeption erfahren und einen profunden Überblick über die intellektuelle Szene Frankreichs bekommen zu haben. Aber auch mit dem Wunsch, Rockmore möge sich in einer weiteren deutschsprachigen Veröffentlichung intensiv mit Heidegger in Verbindung mit dem Zeitgeschehen auseinandersetzen und eine inhaltliche Konfrontation mit Heidegger bzw. eine Kritik des von ihm geprägten, zeitgenössischen Relativismus wagen. Denn in Zeiten, wo eine radikalkonservative Epistemologie und Theoreme der äußersten Rechten problemlos in eine nazistische Ideologie übergeführt und zur Grundlage eines (scheinbar) emanzipatorischen Denkens gemacht werden können, scheint eine direkte Konfrontation durchaus der Mühe wert zu sein. Reinhard Jellen Gerhard Roth Fühlen, Denken, Handeln. Die neurobiologischen Grundlagen des menschlichen Verhaltens, Frankfurt/Main 2002 (Suhrkamp), geb., 488 S., 29.80 EUR. Der Untertitel des Werkes lautet: ‚Wie das Gehirn unser Verhalten steuert’ und erinnert an die bekannte Frage psychoanalytischer Provenienz, ob wir „Herr im eigenen Hause“ sind. Er mutet fremd an, weil wir in unserer Alltagsmetaphysik wissen, dass es ohne Gehirn kein Bewusstsein gibt, von einem bewussten Ich nicht gesprochen werden kann. Jeder Mediziner würde den Gehirntod auch als Tod eines Menschen betrachten. Roth greift damit das Problem auf, wer oder was die Subjektivität ist, die wir Mensch, Persönlichkeit und/oder Ich nennen. Das Buch gibt zunächst eine sehr detaillierte Darstellung des Aufbaus unseres Gehirns. Die bekannten Forschungen zur Neurophysiologie Neuerscheinungen werden verwendet, um dem Laien ein Bild zu bieten, wie hormonelle und chemisch-physikalische Abläufe aussehen, wenn wir denken und fühlen. Betont werden die engen biologischen Verwandtschaftsverhältnisse zu den übrigen Primaten, ohne deshalb einem Reduktionismus zu verfallen, der mancherorts das Verhalten unserer äffischen Vorfahren als Folie für unser Selbstverständnis ausweisen will. Der Autor sieht zwar die Momente der Kontinuität des Verhaltens, diskutiert aber besonders, wie die „stammesgeschichtlichen Determinanten durch Konditionierungsvorgänge, Erziehung und Einsicht zu verändern sind“ (90). Auch die vorhandenen Forschungslücken werden benannt, wenn er etwa das vorhandene Wissen kennzeichnet, das sich um das Thema „Kreativität“ rankt. Die Diskussion erstreckt sich ferner auf Probleme der Psychoanalyse und Instinktlehren. Was das „Unbewußte“ sein kann, wird nach der Lektüre des Buches sehr viel klarer. Roth stellt klar heraus, wie unser Bewusstsein sich aus Teilleistungen zusammensetzt, die teilweise auch, z.B. durch Verletzungen, verschwinden können. Er diskutiert ebenfalls die modernen Theorien der Verhaltenssteuerung, so den Ansatz der Instinktlehren sowie die Überlegungen der Soziobiologie, bei der der sog. Gen-Egoismus im Vordergrund steht. Wichtig sind Abgrenzungen von diesen Theorien deshalb, weil in ihnen die These von der „mangelnden“ Freiheit des Ich thematisiert wird. Roths Buch ist ein in jeder Hinsicht wichtiges Buch für die Philosophie. Einerseits wird der Standpunkt, das Bewusstsein sei das Produkt der hochentwickelten und hochorganisierten Materie im Gehirn, gewürdigt. Andererseits wirft es neues Licht auf Fragen wie, was wir unter Willensfreiheit zu verstehen haben. Unser bewusster Wille ist Ausdruck der zugrundeliegenden Prozesse von Gefühl und Informationsverarbeitung, lautet die Antwort. Das bewusste Ich schreibt sich selbst die Willensentscheidung als eigene und nicht von außen erzwungene zu. „Unser Bewusstsein, unser Ich ist Erscheinungsform einer bewußtseinsunabhängigen Gehirnwelt.“ (192) Es ist ein Epiphänomen. Wenn Roth daher schreibt, dass das Phänomen ‚Willensfreiheit’ eine Täuschung sei, dann führt ihn dies nicht zu dem Bild, wir Menschen seien Maschinen. „Gründe sind Ursachen, die uns sinnvoll, d. h. im Einklang mit unseren Intentionen erscheinen, deren kausale Ursprünge uns aber nicht einsichtig sind und die wir uns deshalb selbst zuschreiben. Es ist diese Selbstzuschreibung, die uns das Gefühl, etwas frei zu wollen, vermittelt.“ (445) Zwar ist das Ich als Steuermann für Roth eine Illusion; aber er gibt dieser Illusion wichtige Funktionen, so die der Zuschreibung, der Legitimation und Interpretation. Das Handlungs-Ich als dritte Funktion betrachtet er als eine virtuelle Instanz der verschiedensten Untersysteme im Gehirn. Wenn dem so ist, dann können wir unsere eigene innere Freiheit als einen Prozess verstehen, in dem die Impulse aus der Vergangenheit und erlebten Geschichten mit denen des Wissens verglichen werden, bis sich daraus ein neuer Neuerscheinungen Handlungsimpuls ergibt. Zweifel zu haben, drückte dann eine Fülle divergierender Impulse aus; und Pläne wären demnach auf den Gegenwartszeitpunkt bezogene Phantasien und Bilder möglicher Ereignisse. Werden in ihnen Ängste mobilisiert, dann können „freie“ Denkprozesse scheitern. Kulturelle Traditionsbestände müssen von Individuen angeeignet und rekonstruiert werden, wenn sie Wirkungen in Handlungen entfalten sollen. Dabei ändert das „Ich“, wie Roth hervorhebt, sich nur durch emotional bewegende Interaktionen (453), nicht aber durch eigenen Willensentschluss oder durch bloße Einsicht. Individuen sind als Körper immer neu. Die Traditionsbestände können nicht von alleine wirksam werden. Angstbesetzte Ereignisse werden jeden freundlichen „Gedanken“ verdrängen, wenn wir uns nicht endlich als Körper akzeptieren lernen, die in einem Klima sozialer Kälte (O. Negt) gegeneinander isoliert werden können. Roths Werk kann als Grundlage einer modernen Anthropologie gelesen werden, das aber keinem Biologismus verfällt. Es sollte in jedem Proseminar zur Anthropologie Pflichtlektüre werden, um den Aufklärungsgehalt moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse gebührend zu berücksichtigen. Schließlich neigen Philosophen an den Universitäten noch immer dazu, in Begriffen zu kramen, diese historisch um und um zu wenden, statt den gegenwärtigen Forschungsstand sauber zu reflektieren. Einer nur logisch-semantischen Analyse, dies zeigt Roths Buch, ist die Erklärung von Handlungen nicht zugänglich. Wolfgang Teune Christian Schwaabe Freiheit und Vernunft in der unversöhnten Moderne. Max Webers kritischer Dezisionismus als Herausforderung des politischen Liberalismus, München 2002 (FinkVerlag), 371 S., 39.90 EUR. Max Weber hat der Moderne viele Stichwörter zu ihrer eigenen Ortsbestimmung geliefert. Er gehört zu den herausragenden geistigen Gestalten und großen politischen Denkern des 20. Jahrhunderts und wird von mehr als einer Disziplin als einer ihrer Gründerväter beansprucht, so von den Kulturwissenschaften oder der politischen Soziologie. Es gibt eine Fülle an Literatur zu Weber. Und doch herrschte bislang ein seltsamer Mangel in dieser vielfältigen Auseinandersetzung mit Webers Werk vor: Wer sich für Weber aus Sicht der praktischen bzw. politischen Philosophie interessierte, dem stand keine systematische Auseinandersetzung mit diesen Aspekten seines Denkens zur Verfügung, die über die verbreitete Fokussierung auf die Herrschaftstypologie, die Verantwortungsethik oder Webers Äußerungen zur deutschen Politik entscheidend hinausginge. Wohl gibt es u.a. bei Mommsen, Tenbruck, Peukert, Schluchter und Hennis, nicht zu vergessen den frühen Henrich, bedeutsame Studien, die v.a. für Weber-Kenner unverzichtbar sind und bleiben. Doch selbst in diesen Studien wird beim Leser letztlich vorausgesetzt, die Grundlagen des Weberschen Den- Neuerscheinungen kens und seiner philosophischen Diagnose der Moderne irgendwie (und recht mühsam) selbständig erarbeitet zu haben. Das hat endlich auch damit zu tun, daß seitens der Philosophie solch systematische Vorarbeit wohl v. a. deshalb fehlte, weil Weber mit seinem weitschweifenden Interesse keiner Disziplin verbindlich zuzuordnen ist, jedenfalls nicht als Klassiker der (praktischen) Philosophie gelten kann. Schwaabes Buch schließt diese Lücke auf eindrucksvolle Weise, indem es eine Einführung in das politische Denken Max Webers bietet, „die zugleich als Analyse des Politischen in der Moderne gelesen werden kann“. Webers Diagnose einer „unversöhnten“ Moderne wird im ersten Teil v. a. mit Blick auf ihre Konsequenzen für die praktische Philosophie rekonstruiert. Die eng gezogenen Grenzen des modernen Vernunftbegriffs lassen jenen Polytheismus der Werte sichtbar werden, der das Verhältnis von Freiheit und Vernunft so prekär und zu einer zentralen Herausforderung der Moderne macht. Schwaabe stellt zunächst klar, daß Weber hier nicht weniger als das „Ende der praktischen Philosophie“ in ihrer klassischen Gestalt postuliert, daß diese Moderne – gegen alle Hoffnungen und Relativierungen, auch gegen alle letztlich hilflose moralische Besorgnis – in ihrem Kern unversöhnt ist und bleiben muß. Man kann gerade diesem ersten Teil gewisse Längen vorwerfen. Andererseits gelingt es Schwaabe gerade so, eine wirklich fundierte Einführung in Webers Denken zu geben und zu verdeutlichen, daß letztlich alle moralphilosophischen Probleme nach Weber auf dem Boden der von ihm analysierten Problematik stehen. So gelingt es Schwaabe am Ende des ersten Teils, einen sehr interessanten Blick auf den „philosophischen Diskurs der Moderne“ (Habermas) zu werfen: nicht in Hegel (so Habermas) oder in Kant (so Schnädelbach) kommt das moderne Bewußtsein zu seinem Ausdruck, sondern – auf diese aufbauend – in Webers tragisch-ambivalenten Denken, das den Kantischen Kritizismus mit der ernüchterten Einsicht in die Unmöglichkeit einer Versöhnung der modernen „Entzweiungen“ verbindet. Dabei – und auch dies macht Schwaabe gegen manch wohlmeinende Weberianer deutlich – steht Weber ganz nah bei Nietzsche. Wie prekär dieses moderne Selbstverständnis für die menschliche Praxis ist, verdeutlicht das Buch im folgenden Teil. Weber hat sich mit seinem erkenntnistheoretischen Fundament und seiner Nähe zu Nietzsche das Problem eingehandelt, den durchaus bejahten „Irrationalismus“ und Dezisionismus zu bändigen und vernünftiger Kritik zugänglich zu halten. Weber geht es um Mündigkeit und Freiheit des Individuums wie auch um eine Politik, die diese Freiheit gegen das „Gehäuse der Hörigkeit“ verteidigen könnte. Im besonderen ist es Weber um die Rettung des genuin Politischen in einer von Versteinerung bedrohten Moderne zu tun. Ergebnis ist ein liberaler bzw. kritischer Dezisionismus, der keineswegs ohne Widersprüchlichkeiten durchzuhalten ist. Diese Widersprüche und Ambivalenzen betreffen freilich nicht nur Weber, sondern sind letztlich als Grundzug moderner Politik, Neuerscheinungen ja der conditio humana in der Moderne zu betrachten. Schwaabe zeigt in Auseinandersetzung u.a. mit Habermas, Rawls und Rorty auf, daß der politische Liberalismus in diesen Problemen noch da verfangen bleibt, wo er Weber zu recht ergänzen will, ihn aber nie wirklich überwinden kann. Die breiten Debatten der letzten Jahre über Kontingenz, Postmoderne etc. schließlich sind, so zeigt sich, bei Weber im wesentlichen bereits vorweggenommen – und haben kaum über ihn hinaus geführt. Auch deshalb lohnt eine gründliche Beschäftigung mit Weber selbst heute noch, da manche, wie z.B. Schöllgen, ihn bereits zum alten Eisen soziologischer „Klassiker“ legen wollen. Mit Schwaabes Buch ist eine Grundlage solcher Beschäftigung bereitgestellt, die sich nicht zuletzt dadurch empfiehlt, daß sie alle Widersprüchlichkeiten des Weberschen Denkens kritisch aufzeigt und diskutiert, Weber also weder vorschnell verwirft noch unangemessen glättet. Am Ende muß und kann man seine eigenen Antworten auf Webers Fragen suchen und durchdenken – gerade das hat der Aufklärer Weber wohl auch immer gewollt. Michaela Rehm John R. Searle Geist, Sprache und Gesellschaft. Frankfurt 2001 (Suhrkamp), übers. aus dem Englischen von H. P. Gavagai, 192 S., 20.80 EUR. Dieses Buch ist eine Einführung in die Philosophie anhand der Philo- sophie von J. Searle. In sechs Kapiteln werden folgende Themen behandelt: Metaphysik mit einem Anteil Erkenntnistheorie (Realismus, Idealismus, Skeptizismus), der biologische Status des Mentalen, die Struktur des Bewußtseins, das Phänomen der Intentionalität, die Struktur der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die Funktion der Sprache. Zuerst setzt sich Searle mit Ansichten auseinander, die in der Postmoderne-Debatte geläufig sind. Dabei handelt es sich um Versuche, aus einigen umstrittenen Interpretationen der neueren Wissenschaft und Wissenschaftsgeschichte oder bestimmter sprachphilosophischer oder erkenntnistheoretischer Voraussetzungen philosophisches Kapital zugunsten des Relativismus zu schlagen. Searle weist auf Fehlschlüsse und implizite Prämissen dieser Ansichten hin und stellt sich auf die Seite derjenigen, die die Möglichkeit der Philosophie anerkennen, „die“ objektive Realität zu erkennen und Wahres vom Falschen zu unterscheiden. Wie zu erwarten war, ordnet er seine Ansätze im einzelnen in den Kontext der analytischen Philosophie ein, in der „logische Analyse“ betrieben wird. Zugleich aber will er mit diesem Buch eine „Synthese“ wagen, die „Synthese eines Analytikers“, und versteht diesen Punkt als einen Unterschied zur traditionellen analytischen Philosophie. Gegen dies Wagnis Searles läßt sich freilich einwenden, daß hier nur ein relativer oder gradueller Unterschied vorliegt, da viele analytische Philosophen einen synthetischen Versuch oder jedenfalls die Mög- Neuerscheinungen lichkeit einer Synthese im Hintergrund erkennen lassen, wie schon das Beispiel der Suche nach Einheit der Wissenschaft im logischen Empirismus oder das der Einheit von Wissenschaft und Philosophie, etwa bei Quine, deutlich macht. Andererseits könnte ein Unterschied zur analytischen Philosophie durch bestimmte metaphilosophische Überlegungen Searles festgestellt werden, nämlich durch die Verbindung, die er zwischen der (von ihm zurückgewiesenen) Kritik am Realismus und einem Verständnis der Macht herstellt, oder durch seine Beurteilung der gegenwärtigen (nach ihm eher geringen) Bedeutung des Gottesproblems. Tatsächlich aber stehen solche metaphilosophischen Standpunkte, die Searle im Gegensatz zu manchen nicht-analytischen Ansätzen nicht als Möglichkeiten zur Widerlegung von Theorien betrachtet, durchaus im Kontext der analytischen Philosophie, da schon bei den Ursprüngen dieser Strömung viele ideologiekritische Elemente präsent gewesen sind (beim logischen Empirismus und zumindest stillschweigend noch bei Russell). Weitere interessante metaphilosophische Beiträge Searles sind z.B. die Analyse philosophischer Lehren zum einen als „Standardpositionen“, die im „common sense“ ihre Wurzel haben und zum anderen als direkte Infragestellungen von Standardpositionen oder als Ansätze, die aus Konflikten zwischen Standardpositionen entwickelten werden; ferner die Klassifikation einiger philosophischer Prämissen als „Hintergründe“ des Weltbildes oder eines bestimmten Gegenstandsbereichs. Die hier- mit ermöglichte Verbindung zu transzendentalen Argumentationsmustern thematisiert Searle aber nicht; genauso wenig wie den vorhin erwähnten Begriff der „logischen Analyse“ oder andere philosophische Methoden und Annäherungsweisen, die in dem Buch praktiziert werden. (Etwa einen gewissen phänomenologischen Einschlag des Abschnittes „Strukturmerkmale des Bewußtseins“ 91 ff.). Statt dessen werden philosophische Argumentationsstrukturen durch Analysen konkreter Beispiele solcher Argumente und Fehlschlüsse vermittelt. Zentrale Begriffe, sowie einige Konstruktionen und Unterscheidungen werden prägnant erklärt. Die erörterten und vor allem die vertretenen Positionen, speziell ab Kapitel 2, sind von dem Autor in seinen bisherigen – im Deutschen ebenfalls erschienenen – Veröffentlichungen ausführlicher untersucht worden. Insofern fallen einige Argumentationen hier ziemlich vereinfachend oder lückenhaft aus. Die Ausführungen zum Bewußtsein werden durch naturwissenschaftliche Beispiele und Beobachtungen untermauert. Searle betrachtet das Bewußtsein als biologisches Phänomen. Die Zustände des Bewußtseins sind innere, qualitative und subjektive Zustände, die durch eine „erste Person-Ontologie“ beschrieben werden und aus diesem Grund nicht auf physikalische Prozesse reduziert werden können. Zugleich aber ist Bewußtsein ein „höheres Merkmal des Gehirnes“, wie Flüssigkeit „ein höherstufiges Merkmal des Molekülsystems ist, das das Blut ausmacht“. Obwohl Searle diese Neuerscheinungen Position nicht für materialistisch hält, darf hier eine Parallele nicht übersehen werden, daß nämlich das Bewußtsein schon vom dialektischen Materialismus als das höchste Produkt der in besonderer Weise organisierter Materie aufgefaßt worden ist. Die besondere Funktion von Bewußtseinszuständen besteht nach Searle darin, daß sie uns in Beziehung zu etwas setzen. Diese Beziehung ist die Intentionalität, die von Searle eingehender Analyse unterzogen wird und in der Form der „kollektiven Intentionalität“ als ein Baustein der Struktur der gesellschaftlichen und institutionellen Wirklichkeit identifiziert wird (Kap. 5). Das letzte Kapitel befaßt sich mit der Sprache als Bestandteil der gesellschaftlichen Wirklichkeit und enthält eine Darstellung von Searles Sprechakttheorie. Abschließend wird das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Philosophie thematisiert. Die Achse, um die sich die von Searle angestrebte „Synthese“ dreht, ist also die Intentionalität als Phänomen des Bewußtseins. Dies legt die Priorität der Untersuchung des Bewußtseins oder des „Geistes“ im Verhältnis zur Untersuchung der Sprache und der sozialen Welt nahe (anscheinend jedoch nicht im Verhältnis zur metaphysischen Realismus-Debatte). Darin könnte in der Tat eine Abweichung von der traditionellen Linie der analytischen Philosophie vorliegen, soweit man in dieser – mit Dummett2 – als unentbehrliche Prämisse die Priorität der Sprache gegenüber dem Denken erblickt; nach anderer Ansicht ist jedoch Kennzeichen der analytischen Philosophie die Festlegung auf bestimmte Argumentationsstandards.3 Auf diese Festlegung geht Searle ein und darin dürfte eine „globale“ These seiner Synthese bestehen: Daß in der Philosophie das Argument zählt. Dieses klar geschriebene, gut übersetzte und spannende Buch ist sowohl als kompakte Darstellung von Searles Philosophie als auch als Einführung in Grundprobleme und Grundpositionen der Philosophie aus analytischer Sicht brauchbar. Es ist für diejenigen informativ, die eine Einführung in die Philosophie des Verfassers suchen oder sich für philosophische Positionen interessieren, die in nicht-physikalistischer und nicht-reduktionistischer Weise bis zu einem gewissen Grad doch zu einer Konzeption von der Einheit der Wirklichkeit gelangen. Als allgemeine Einführung in die philosophische Problematik ist das Buch ebenfalls tauglich. Nicht zuletzt dürfte dieses Buch auch denjenigen von Nutzen sein, die sich für die Auseinandersetzung mit der Postmoderne aus Sicht der analytischen Philosophie interessieren. Sowohl Searles Beurteilung neuerer wissenschaftlicher Entwicklungen ist hierfür relevant, als auch, indirekt, die gesamte in den Kapiteln 2, 3 und 4 geschilderte Theorie des Bewußtseins und die Untersuchung der Subjektivität, auf die sich in den weiteren Schritten Dummett, Origins of the Analytical Philosophy, Harvard 1994, 4. 3 Beckermann, Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes, Berlin 1999, VIII: „Argumentationskultur“. 2 Neuerscheinungen weiteren Schritten die Konstruktion des Sozialen stützt. Georgios Karageorgoudis Werner Seppmann Das Ende der Gesellschaftskritik? Die ‚Postmoderne’ als Ideologie und Realität, Köln 2000, geb., 297 S., 18.41 EUR. Werner Seppmann, Jahrgang 1950, hat auf dem zweiten Bildungsweg Philosophie und Sozialwissenschaften studiert und viele Jahre mit dem Marxisten Leo Kofler, der stets den theoretischen Ansätzen von Georg Lukács verpflichtetet blieb, zusammengearbeitet. Seit einiger Zeit ist er Mitherausgeber der „Marxistischen Blätter“ und widmet sich in seiner neuesten Publikation, nachdem er bereits dem Ideologiecharakter des Struktur-Marxismus und der realen und bewußtseinsmässigen Irrationalisierung und Brutalisierung der spätbürgerlichen Gesellschaft erfolgreich nachgegangen ist, in seinem neuen Buch dem Phänomen der Postmoderne. Seppmann findet hierbei den gesellschaftlichen Resonanzboden, als dessen Ideologie die Postmoderne fungiert, in der objektiven Realität des Spätkapitalismus, der sich als sämtliche Segmente der Gesellschaft subsumierende Teilrationalität präsentiert. Die Entfremdungszustände, Irrationalismen, Brüche und Ambivalenzen werden im regressiven Alltagsbewußtsein verankert und unreflektiert als naturläufig hingenommen: „Der entwickelte Kapitalismus als eine Vergesellschaftungsweise, die die Rationalität in den Teilbereichen extrem gesteigert hat, das Zusammenspiel der technischen wie auch der sozialen Kräfte aber dem blinden Zufall überantwortet, bringt permanent Entfremdung und verdinglichte Bewußtseinsformen hervor. Obwohl die handelnden Menschen intensiv aufeinander bezogen sind, dominiert bei ihnen der Eindruck der sozialen Isolation. Die Wahrnehmung des Anderen bleibt durch die Konkurrenzsituation geprägt, ... durch die Wirkungen des Warenfetischismus erleben die Menschen das von ihnen selbst konstituierte und reproduzierte Sozialverhältnis ‚als ein außer ihnen existierendes Verhältnis von Gegenständen’ (Marx). Die soziale Welt wird als bedrohlich und lebensfeindlich erfahren... Die gesellschaftlichen Verhältnisse im Kapitalismus erscheinen den Menschen auf der Ebene des Alltagsbewußtseins als ‚naturförmig’ und unüberwindbar.“ (157) Diese Handlungstendenzen und Bewußtseinsmechanismen werden von postmodernen Denkern nun wiederum auf der Ebene der Theorie perpetuiert und als quasi menschliche Konstanten und fundamentale Schranken verewigt, indem der gesellschaftliche Kontext ihrer Genese ignoriert wird. So schlägt die vermeintliche Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen durch die Verabsolutierung von (mitunter berechtigten) Erkenntnisschranken und Partialerkenntnissen sowie die Ontologisierung gesellschaftlichen Tendenzen in etwas um, was Lukács in seinem Werk über die Zerstörung der Vernunft „indirekte Apologetik“ genannt hätte und somit in der Tradition der anti- Neuerscheinungen aufklärerischen, ultra-konservativen bis präfaschistischen Philosophie steht. Seppmann erarbeitet diesen undialektischen Lapsus als einen zentralen Mechanismus des postmodernen Denkens und zeigt dies unter anderem an Deleuze, Derrida, Lacan, Beaudrillard und Foucault: „Weil von den Menschen ... die gesellschaftliche Realität als perspektivloser Zustand erlebt wird, sind direkte Formen der Apologie nicht mehr möglich. Das machtfunktionale Bewußtsein erfüllt seine stabilisierende Rolle ..., indem es das sozial erzeugte Mißbehagen als Konsequenz einer prinzipiellen Absurdität und Ausweglosigkeit der menschlichen Existenz verklärt und auf diesem Weg die bestehende Gesellschaftsform von ihrer Verantwortung für den agressionsgeprägten und ungerechten Zustand der Welt entlastet. Weil der Fortschritt bürgerlich nicht mehr gedacht werden kann, wird er pauschal negiert.“ (153) – „... nach dem Verständnis Foucaults [hat sich] jeder Befreiungsversuch immer als eine raffiniertere und intensivere Form der Unterdrückung und Reglementierung erwiesen.“ (227) Weiterhin setzen nach Seppmann die Postmodernen vor die aktuellen Krisenphänomene einfach nur positive Vorzeichen, indem sie zwar an reale Tendenzen anschließen, aber aufgrund ihrer Fokussierung auf die Priorität des Moments vor dem Zusammenhang und der Differenz vor der Totalität den gesellschaftlich produzierten Rahmen übersehen und die Zusammenhänge verdrängen, statt sie zu durchdringen. Ihre Beschreibung der Phänomene verläßt daher nicht die Gefühlsebene, sondern bestätigt und verabsolutiert sie und verschafft dem resignativen Alltagsbewußtsein, das die aus der sozialen und ökonomischen Ohnmacht resultierenden Ängste mit hedonistischen Freiheitsphantasien kompensieren muß, nicht nur Trost, sondern auch „wissenschaftliche“ Weihen. Damit aber wird jener disponible, fungible und regressive Subjektivitätstypus theoretisch zum Vorbild erklärt, der haargenau zur herrschenden gesellschaftlichen Situation passt. In einer verdinglichten, dem Warenfetischismus unterstehenden Welt perpetuieren also die Postmodernen diese Zustände in der Theorie und affirmieren diese als Fundament individueller Selbstbestimmung: „Den Menschen ... wird nahegelegt, zu lernen, mit den Widersprüchen zu leben, die soziale Bedrohung als etwas unveränderliches zu akzeptieren und sich den wechselnden Ansprüchen anzupassen.“ (66) „Es vollzieht sich ... die ideologische Unterwerfung in einer Form, die von der Psychoanalyse als Identifikation mit der Ursache des Leidens beschrieben wird: Um sich von der krisengeprägten Wirklichkeit zu ‚emanzipieren’, paßt sich das postmodern konditionierte Bewußtsein ihr an.“ (ebd.) Ein Plädoyer für eine dialektische Gesellschaftstheorie, welche die postmoderne Kritik aufhebt, beschließt das Buch. Schade ist, daß Seppmanns Buch eher einen allgemeinen Überblick über den gesellschaftlichen Zusammenhang und die ideologischen Fallstricke der Postmodernen gibt, daß er aber keine genaue Auseinandersetzung mit den einzelnen „Denkern“ wagt (wie dies etwa G. Lukács Neuerscheinungen Lukács in der „Zerstörung der Vernunft“ ausgiebig unternommen hat). Auch wären dem Buch Fußnoten mit präzisen Literaturangaben zu gönnen gewesen; und zudem werden kluge Gedanken nicht dadurch besser, daß man sie ständig mit Ausrufezeichen oder Anführungsstrichen versieht. Dennoch ist, wie alle Publikationen Seppmanns, auch die Lektüre dieses Buches zu empfehlen. Reinhard Jellen Ernst Tugendhat Aufsätze 1992-2000. Frankfurt/ Main 2001 (Suhrkamp), 262 S., 11.EUR. Drei Essays aus der neuen4 Aufsatzsammlung Ernst Tugendhats sind Aspekten der Moralbegründung gewidmet; drei befassen sich mit spezielleren Problemen der Ethik, den Menschenrechten, der Euthanasie und dem Nationalismus; ferner finden sich vier kritische und kenntnisreiche Aufsätze zu Heidegger und einer über den Tod, in dem zum Teil eine Auseinandersetzung auch wieder mit Heidegger (und T. Nagel) erfolgt. Die längste Studie unternimmt einen Vergleich zwischen Nietzsche und Hitler. Diese Studie ist größtenteils Erstveröffentlichung, wie auch die drei Arbeiten zum Problem der Moralbegründung in diesem Band zum ersten Mal erscheinen. Vgl. die ältere: E. Tugendhat, Philosophische Aufsätze, Frankfurt/Main 1992 (Mit Arbeiten von 1960 bis 1992). 4 Im Zentrum des Interesses des Autors steht seit einigen Jahren das Problem der Moralbegründung, auf das wir uns hier konzentrieren wollen. Tugendhat operiert mit der Formel von der Moral als „System wechselseitiger Normen“, die er im Aufsatz Wie sollen wir die Moral verstehen? (163-184) entwickelt. Er erörtert aus dieser Sicht die Begründbarkeit moralischer Urteile (Was heißt es, moralische Urteile zu begründen?, 91-108) und die evolutionstheoretischen/soziobiologischen Konzeptionen der Moral (199-224); darüber hinaus verwendet er diese Formel in einzelnen Argumentationen der anderen Aufsätze. Was bedeutet aber konkret, die Moral als ein System wechselseitiger Normen aufzufassen? Zuerst muß festgehalten werden, daß Tugendhat die Moral ausschließlich im Bereich des Verhaltens zu dem Anderen verortet; es gibt keine Moral im Verhältnis zu sich selbst (Pflichten gegenüber sich selbst), es sei denn, daß das Verhalten zu sich selbst sich auf das Verhalten zu den Anderen auswirkt (so schon in Probleme der Ethik, 1984). Zweitens: Wenn von „Moral“ die Rede ist, dann sind damit nicht Überlegungen, persönliche Lebensmaximen oder die philosophische Ethik gemeint, sondern die in einer Gesellschaft oder besser in der „moralischen Gemeinschaft“ geltenden Normen des richtigen Verhaltens (moralische Normen). Damit ist nicht gesagt, daß moralische Normen von vornherein nur innerhalb einer bestimmten Form der Vergesellschaftung (z.B. Staat oder Gemeinde) gelten und wirken (57-66; dies wäre die Position des Partikula- Neuerscheinungen rismus, dessen spezielle Form der Nationalismus ist), sondern nur, daß das gesellschaftliche Umfeld einer Person der Ort ist, in dem moralische Normen (deren Adressat oder Berechtigte diese Person ist) im Fall ihrer Anwendung oder ihrer Übertretung (in diesem Fall durch Sanktionen) wirken. Der dritte Punkt ist, daß moralische Normen begründungsbedürftig sind. Sie können aber nach Tugendhat nicht, wie deskriptive oder theoretische Aussagen, dadurch begründet werden, daß ihre Wahrheit aufgezeigt wird (wie der sog. moralische Realismus annimmt), sondern nur dadurch, daß einer Person gezeigt wird, daß sie Gründe hat, die Norm einzuhalten. Viertens: Die moralischen Normen unterscheiden sich von den Rechtsnormen oder den Regeln gesellschaftlicher Spiele oder von Sitten und Verhaltensgewohnheiten darin, daß die Verpflichtung, sie zu befolgen, ein Leben lang eingegangen wird. Ein noch wichtigeres Merkmal der moralischen Normen ist nach Tugendhat die spezifische Sanktion, die ihre Übertretung herbeiführt, nämlich die Ächtung durch die anderen Mitglieder der Gesellschaft und ihre internalisierte Form, das Schuldgefühl. Das System der moralischen Normen einer Gesellschaft wird von jeder Person in dem Sinne akzeptiert, daß sie Ächtung und gegebenenfalls Schuldgefühl bei der Übertretung der Normen dieses Systems empfindet, genau dann, wenn sie sich als Mitglied der Gesellschaft betrachtet. Jemand, der Normen des Systems kritisiert oder ablehnt und sich als Mitglied der Gesellschaft betrachtet, kann dies nur insofern tun, als er Inhalte und Anwendungsbereich der Normen, die er ablehnt, für nicht begründet hält. Daß aber die Übertretung der Normen für die Mitglieder der Gesellschaft Ächtung und Schuldgefühl zur Folge hat, ist unentbehrlich., soweit man sich auf die Moral bezieht und nicht auf persönliche Lebensmaximen. Die Frage der Moralbegründung stellt sich nun auf mehreren Ebenen: Es gibt moralische Systeme, deren Normen durch Autorität begründet werden (z.B. durch die Religion) und solche, deren Normen wechselseitig begründet werden (es finden sich auch gemischte Konstellationen, 217). Der zweite Fall liegt vor, wenn die Mitglieder der Gesellschaft die Normen einhalten, weil sie sich wechselseitig dazu verpflichten, weil jedes Mitglied an jedes Mitglied die Forderung stellt, diese Normen einzuhalten, und sie einig darüber sind, Übertretungen dieser Normen zu ächten und diese Disposition internalisieren. Wechselseitige moralische Systeme (die mehr „universalistisch oder mehr „partikularistisch“ ausgerichtet sein können) implizieren den Egalitarismus (222-223, 226) in dem Sinne, daß alle Mitglieder der moralischen Gemeinschaft die gleichen Rechte haben (also nicht unbedingt im Sinne der Verteilungsgleichheit). Daraus folgt, daß die Begründung der einzelnen Normen des Systems durch die gleichmäßige Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten erfolgen soll. Wir haben also bisher zwei Schichten der Begründung: eine, die sich auf das System bezieht und die autoritativ oder wechselseitig erfolgt; Neuerscheinungen und eine, die sich auf die Begründung einzelner Normen bezieht. Hinzu kommt die Schicht der Begründung partikulärer moralischer Urteile, die sich auf die Anwendung einer Norm auf einen Einzelfall beziehen (91-108), und natürlich die höherstufige Frage, wie man begründen kann, welche Begründungsart für moralische Systeme vorzuziehen ist und welche weitere Begründungsarten neben der autoritativen und der wechselseitigen Begründung noch in Betracht kommen können. Tugendhat kritisiert zwar utilitaristische und kantianische Begründungen von Systemen moralischer Normen, weil sie bestimmte Bedingungen für die Moral aus seiner Sicht nicht erfüllen; aber gerade deswegen gelangt diese Frage schnell an die Grenzen der von ihm entwickelten Begrifflichkeit, und seine Antwort kann von einem echten Utilitaristen oder Kantianer nie akzeptiert Tugendhats hochinteressante Mowerden. ralbetrachtung ist deutlich anders gewichtet als die meisten Zugänge, die in der philosophischen Ethik verbreitet sind. Systeme moralischer Normen und, allgemeiner, die Moral sind Produkte eines historischen Prozesses. Aus dieser Sicht schätzt Tugendhat auch die Beiträge der evolutionstheoretischen Betrachtung der Moral (11.) als eher beschränkt ein. Sie sind nämlich nur für bestimmte Begründungsweisen der Moral relevant, für die Bedeutung des altruistischen Verhaltens usw. Jedoch ist die Argumentation an manchen Stellen etwas langwierig und schwierig zu interpretieren. Für das volle Verständnis der moralphilosophischen Aufsätze wäre die Kenntnis von Tugendhats Dialog in Leticia (1997) von großem Vorteil. Die Lehre von der Moral als System wechselseitiger Forderungen spielt eine Rolle auch in anderen Essays dieses Bandes (2., 12.). Sie ist Ausgangspunkt der These, daß alle Menschen gleiche Rechte haben sollen, und bildet zugleich den Ansatzpunkt der Kritik Tugendhats an Nietzsche (beides in Macht und Antiegalitarismus bei Nietzsche und Hitler, Ess. 12). Der größere Teil dieses längeren Aufsatzes enthält eine sehr detaillierte Analyse der Spannungen, die Nietzsches Konzeption der fundamentalen und „vertikalen“ Ungleichheit zwischen Menschen aufweist und die Tugendhat zum Teil auf die Unbestimmtheit des Begriffs der Macht bei Nietzsche zurückgeführt. Die Studien über die Menschenrechte (2.) und über die Euthanasie (3.) erscheinen etwas weniger geglückt. Die der ersten Arbeit zugrundeliegende Konzeption der Menschenrechte ist ziemlich unklar. Es wird nicht erklärt, wie diese an sich „verliehenen“ (47) Rechte sich von moralischen Forderungen unterscheiden. Anscheinend wird hier dem Begriff der Menschenrechte kein eigenständiges argumentatives Gewicht beigemessen. Interessant ist dieser Aufsatz vor allem wegen seiner radikalen Kritik am Liberalismus, die bis zur Erwägung einer Abschaffung des Erbrechts reicht (37). – Im Aufsatz über die Euthanasie werden die Konsequenzen benannt, die die drei von ihm behandelten moralischen Traditionen, die christliche, die utilitaristische und die kantianische, jeweils für einige kontrovers diskutierte Proble- Neuerscheinungen me implizieren: eines moralischen Rechts auf Selbsttötung, der Beihilfe zur Selbsttötung, der Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Euthanasie, der „nicht-freiwilligen“ Euthanasie und der besonders schwierig zu beurteilenden Freigabe der Tötung von Personen, die nichts fühlen und nicht leiden. Dieser Aufsatz hat eher journalistischen Charakter; er ist zu kurz, um den besprochenen Ansichten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und Tugendhats paradoxe Folgerungen (etwa: die moralische Pflicht zur Beihilfe auf Selbsttötung) akzeptabel zu machen. Übrigens ist nach deutschem Strafrecht die Beihilfe zur Selbsttötung nicht strafbar, anders als auf S. 47 angedeutet. Und statt „unfreiwillige“ müßte auf S. 52, Z 6 „nicht freiwillige“ stehen. Die Arbeiten über Heidegger enthalten überwiegend Analysen zu Themen aus Sein und Zeit. In ihnen läßt Tugendhat sich auf Heideggers Fragen und dessen Begrifflichkeit ein und übt seine Kritik von innen heraus; eine durchaus effektive Vorgehensweise, die in der kritischen Auseinandersetzung mit Heidegger ansonsten recht selten vorkommt. Georgios Karageorgoudis In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 162 AutorenInnenverzeichnis Anhang AutorInnen RÜDIGER K. BREDE, Dr. phil., Vorstand des FNG – FORUM Nachhaltige Geldanlagen, Vorstand der Sonne + Wind Beteiligungen AG, Grevenbroich der LMU und der Hochschule für Politik, München XAVER BRENNER, Dr. phil., selbst. Bildungsreferent, München KONRAD LOTTER, Dr. phil., Privatgelehrter, München WOLFGANG HABERMEYER, Dr. phil., freier Mitarbeiter des Bayr. Rundfunks, Lehrbeauftragter für Ethnologie an der LMU, München BERND M. MALUNAT, freiberufl. Politikwissenschaftler, München JOST HERMAND, Dr. phil., Prof. für Literaturwissenschaft, University of Wisconsin, Madison REINHARD JELLEN, Doktorand der Philosophie, München GEORGIOS KARAGEORGOUDIS, Jurist, wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Philosophie (Lehrstuhl I), München IGNAZ KNIPS, Lehrbeauftragter der Uni Köln, Abt. Internationale Beziehungen, Köln MANUEL KNOLL, Dr. phil., Lehrbeauftragter am Geschwister-SchollInstitut für Politische Wissenschaft GEORG KOCH, M.A., Antiquar und freier Autor, München GUSTAV MECHLENBURG, M.A. der Philosophie, Journalist und Redakteur, Hamburg JOSEF MEHRINGER, Doktorand der Philosophie, München ALEXANDER VON PECHMANN, Dr. phil., Lehrbeauftragter für Philosophie an der LMU und VHS München MARÍA ISABELL PEÑA AGUADO, Dr. phil., Lehrbeauftragte der TU Chemnitz, Gastprofessorin für Philosophie an der Hochschule für Graphik und Buchkunst Leipzig MICHAELA REHM, M.A., Mitarbeiterin am Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der LMU, München MARIANNE ROSENFELDER, M.A. der politischen Philosophie, freie Journalistin, München MARTIN SCHRAVEN, Dr. phil. habil., Privatdozent für Philosophie, Universität Bremen, Schelling-Forschungsstelle, Ebersberg WOLFGANG TEUNE, Unternehmensberater, Monheim WOLFGANG THORWART, Dr. phil., Lehrbeauftragter für Philosophie an der VHS München PERCY TURTUR, M.A., freier Autor, München NORBERT WALZ, M.A., Dipl.-Sozialpäd. (FH), Doktorand der Philosophie, Nürnberg KARSTEN WEBER, Dr. phil., Lehrstuhl für Philosophische Grundlagen kulturwissenschaftlicher Analyse, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) THOMAS WIMMER, M.A., freier Autor und Herausgeber, München FRANCO ZOTTA, Dr. phil., Referent der Bertelsmann Stiftung und freier Journalist, Unna In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 162 Errata Errata In der letzten Nummer „Jüdisches Denken – jüdische Philosophie“ ist uns ein Mißgeschick unterlaufen, das zu korrigieren ist. Auf S. 43 heißt es, Ernst Bloch sei „Sohn einer zum Christentum konvertierten Familie“ gewesen. Die Autorin, Astrid Deuber-Mankowsky, verweist darauf, daß dies freilich nicht stimmt: Bloch entstammt einer emanzipierten jüdischen Familie. In: Widerspruch Nr. 38 Ökologische Ästhetik (2002), S. 162 Impressum Impressum Impressum Tel & Fax: (089) 2 72 04 37; e-mail: [email protected] Widerspruch Münchner Zeitschrift für Philosophie 22. Jahrgang (2002) Erscheinungsweise halbjährlich / ca. 1000 Exemplare Herausgeber Münchner Gesellschaft für dialektische Philosophie, Tengstr. 14, 80798 München Redaktion Jadwiga Adamiak, Wolfgang Habermeyer, Reinhard Jellen, Manuel Knoll, Georg Koch, Wolfgang Melchior (Internet), Konrad Lotter (verantw.), Alexander v. Pechmann, Martin Schraven, Percy Turtur Verlag Widerspruch Verlag, Tengstr. 14, 80798 München. Gestaltung: Percy Turtur, München ISSN 0722-8104 Preis Einzelheft: 6.- EUR Abonnement: 5.50 EUR ( zzgl. Versand) Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. – Für unaufgeforderte Manuskripte wird keine Haftung übernommen. – Nachdruck von Beiträgen aus Widerspruch ist nur nach Rücksprache und mit Genehmigung der Redaktion möglich.