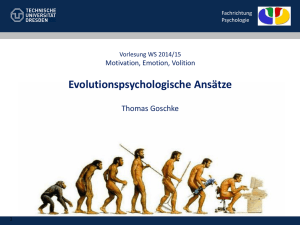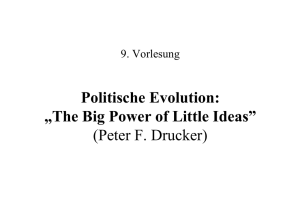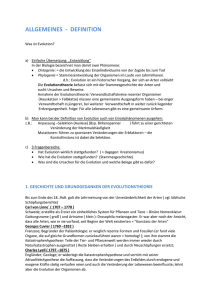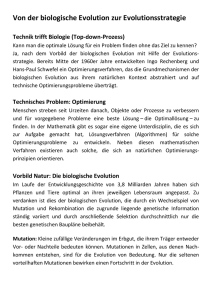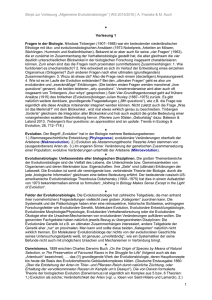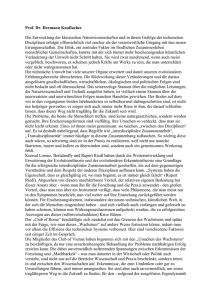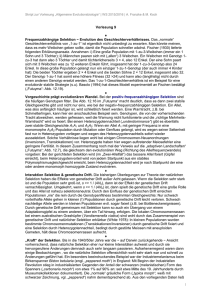Evolutionspsychologische Ansätze
Werbung
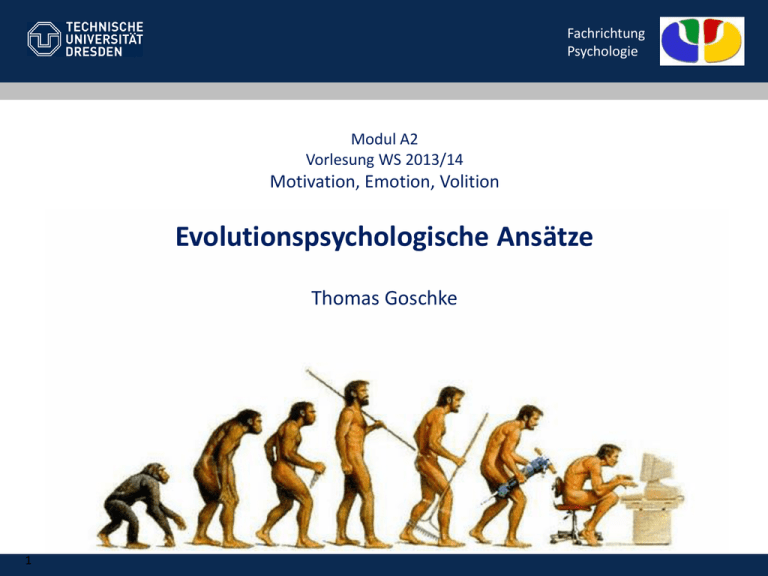
Fachrichtung Psychologie Modul A2 Vorlesung WS 2013/14 Motivation, Emotion, Volition Evolutionspsychologische Ansätze Thomas Goschke 1 Überblick und Lernziele 2 Natur-Umwelt-Kontroverse Darwins Theorie der natürlichen Selektion Vergleichende Verhaltensforschung (Ethologie) Grundannahmen der modernen Evolutionspsychologie Sexuelle Selektion: Die „sexual strategies theory“ Empirische Evidenz: Geschlechtsunterschiede in reproduktiven Strategien Kritik an evolutionspsychologischen Ansätzen Literaturempfehlungen Rudolph, U. (2003). Motivationspsychologie. Workbook (2. Auflage). Kapitel 10. Beltz PVU. Buss, D.M. (2004). Evolutionäre Psychologie (2. Auflage). München: Pearson Studium. Buss, D.M. (2011). Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind (4th Edition). Prentice Hall. Pinker, S. (2003). Das unbeschriebene Blatt. Die moderne Leugnung der menschlichen Natur. Berlin: Berlin Verlag. S.J.C. Gaulin & D.H. McBurney (2004). Evolutionary psychology (2nd Ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson. Tooby, J., & Cosmides, L. (1992). The psychological foundations of culture. In Barkow, J.H., Cosmides, L., & Tooby, J (Eds.), The Adapted Mind (pp. 19-136). 3 Hintergrund: Die Natur-Umwelt-Kontroverse 4 Der Geist als „unbeschriebenes Blatt“: Britischer Empirizismus „Nehmen wir also an, der Geist sei, wie man sagt, ein unbeschriebenes Blatt, ohne alle Schriftzeichen, frei von allen Ideen; wie werden ihm diese dann zugeführt? Wie gelangt er zu dem gewaltigen Vorrat an Ideen, womit ihn die geschäftige schrankenlose Phantasie des Menschen in nahezu unendlicher Mannigfaltigkeit beschrieben hat? Woher hat er all das Material für seine Vernunft und für seine Erkenntnis? Ich antworte darauf mit einem einzigen Wort: aus der Erfahrung.“ John Locke (1632-1704) 6 Der Geist als „unbeschriebenes Blatt“ Behaviorismus und Sozialwissenschaften Lerntheoretisch orientierte Psychologie und Teile der Sozialwissenschaften vertraten über weite Strecken des 20. Jh. die These vom menschlichen Geist als „unbeschriebenem Blatt“ • Menschliches Verhalten ist nicht durch Biologie, sondern Kultur bestimmt • Menschen kommen (abgesehen von einigen Reflexen und einer allgemeinen Lernfähigkeit) ohne angeborene Verhaltensweisen auf die Welt • Menschen verfügen über eine universelle (“general purpose”) Lernfähigkeit, die den Erwerb von Wissen und Fertigkeiten in beliebigen Domänen vermittelt 7 Der Geist als „unbeschriebenes Blatt“ Behaviorismus und Sozialwissenschaft „Gebt mir ein Dutzend gesunde, gut gebaute Kinder und meine eigene spezifizierte Welt, um sie darin großzuziehen, und ich garantiere, daß es irgendeines aufs Geratewohl herausnehme und es so erziehe, daß es irgendein beliebiger Spezialist wird, zu dem ich es erwählen kann – Arzt, Jurist, Künstler, Kaufmann, ja sogar Bettler und Dieb, ungeachtet seiner Talente, Neigungen, Absichten, Fähigkeiten und Herkunft seiner Vorfahren“ (John B. Watson, 1914) John B. Watson „Mit Ausnahme der instinktartigen Reaktionen von Säuglingen auf plötzlichen Entzug der Zuwendung oder unvermittelte laute Geräusche ist der Mensch vollkommen instinktlos… Der Mensch ist Mensch, weil er keine Instinkte hat, weil er alles, was er ist und geworden ist, aus seiner Kultur erlernt und erworben hat…“ (Ashley Montagu, 1973) 8 Die Gegenposition der evolutionären Psychologie: Universelle Merkmale menschlichen Verhaltens "In der fernen Zukunft sehe ich offene Felder für weitaus wichtigere Untersuchungen. Die Psychologie wird auf eine neue Grundlage gestellt werden, nämlich die des notwendigen Erwerbs jeder psychischen Kraft und Fähigkeit durch Abstufung [sukzessive Modifikationen über Generationen hinweg]." (Darwin, 1859, S. 458) "Nur eine vergleichende und evolutionäre Psychologie kann die notwendige Grundlage [für die Sozialwissenschaften] liefern; und diese Grundlage konnte nicht geschaffen werden, ehe die Werke Darwins zu der Überzeugung geführt hatten, dass zwischen der menschlichen und der tierlichen Evolution eine Kontinuität hinsichtlich aller körperlichen Merkmale besteht. Diese Überzeugung bereitete den Weg für die schnell darauf folgende Erkenntnis einer ähnlichen Kontinuität zwischen der psychischen [mental] Evolution des Menschen und der Tierwelt" (McDougall, 1908/1960, S. 4-5). 10 Überblick und Lernziele 14 Natur-Umwelt-Kontroverse Darwins Theorie der natürlichen Selektion Grundannahmen der Evolutionären Psychologie Sexuelle Selektion: Die „sexual strategies theory“ Empirische Evidenz: Geschlechtsunterschiede in reproduktiven Strategien Kritik an evolutionspsychologischen Ansätzen Charles Darwin (1809-1882) Studium der Theologie in Cambridge Interesse am Sammeln von Pflanzen, Insekten und geologischen Funden 1831-1837: Reisen auf der Beagle u.a. zu den Galapagos Inseln Die Fahrt der Beagle Darwin war beeindruckt von Fossilien in Patagonien und Artenreichtum auf den Galapagos Inseln Unterschiedliche Spezies von Riesenschildkröten auf verschiedenen Inseln 14 Finkenarten mit Schnabelformen und Größe, die an jeweilige Umwelt (ökologische Nische) angepasst waren Die Theorie der natürlichen Selektion Nach seiner Rückkehr Sekretär der Geologischen Gesellschaft Diverse biologische und geologische Publikationen Erst 1859 Publikation der Ideen zur natürlichen Selektion (vermutlich in Reaktion auf einen Brief von A.R. Wallace in 1858, in dem dieser ähnliche Ideen skizzierte) Zentrale Thesen: • Heutige Lebewesen stammen von früheren Arten ab • Natürliche Selektion als Mechanismus der Evolution Darwins Erklärung der Entstehung der Arten durch natürliche Auslese Induktion 1 Populationen von Lebewesen könnten exponentielles Wachstum zeigen Deduktion 1 Lebewesen haben weniger Nachkommen als möglich wäre, weil sie um knappe Ressourcen konkurrieren Induktion 2 Größe von Populationen bleibt meistens relativ stabil Induktion 3 Innerhalb einer Spezies gibt es zufällige Variabilität körperlicher und verhaltensbezogener Merkmale von Individuen Deduktion 2 Individuen mit adaptiven Merkmalen zeugen mehr Nachkommen und geben ihre Merkmale an diese weiter (= Natürliche Auslese) Induktion 4 Einige dieser Merkmale werden vererbt und verschaffen ihren Trägern einen Überlebensvorteil Deduktion 3 Evolution = Akkumulation von Veränderungen in einer Population als Folge natürlicher Selektion Evolution phänotypischer Merkmale durch natürliche Auslese Reeves (2010). Motivation. Allyn & Bacon Evolution komplexer Organe "Die Annahme, daß das Auge mit all seinen unnachahmlichen Vorrichtungen zur Anpassung der Linse an verschiedene Entfernungen, zur Zulassung wechselnder Lichtmengen und zur Korrektur sphärischer und chromatischer Abweichungen, durch natürlich Auslese entstanden sein könnte, erscheint, wie ich offen bekenne, im höchsten Grade als absurd. Der Verstand sagt mir: wenn zahlreiche Abstufungen vom einfachen, unvollkommenen Auge bis zum komplexen und vollkommenen existieren und jede Abstufung nützlich für ihren Besitzer ist, was sicher der Fall ist; wenn ferner das Auge beständig variiert und diese Variationen erblich sind, was gleichfalls sicherlich zutrifft; und wenn schließlich diese Veränderungen einem Tier unter wechselnden Lebensverhältnissen nützen, dann sollte die Schwierigkeit zu glauben, daß ein vollkommenes und komplexes Auge durch natürliche Auslese gebildet worden sein könnte (so unüberwindlich sie unserer Vorstellungskraft auch erscheinen mag), nicht als Umsturz unserer Theorie angesehen werden.“ Darwin, C. Origin of Species, Ch. VI – Difficulties of the theory. Computersimulation evolutionärer Prozesse Filmbeispiel 27 Gehirnevolution Gehirngewicht verschiedener Tierarten als Funktion des Körpergewichts Größe des Neokortex als Funktion der Gehirngröße Verhaltensspezialisierung spiegeln sich in der Hirnmorphologie: Relative Größe des superioren und inferioren Colliculus Tiere, die Schall zum Jagen und zur Navigation benutzen Tiere, die visuelle Wahrnehmung zum Jagen und zur Navigation nutzen Adaptive kognitive Spezialisierungen spiegeln sich in der Größe relevanter Gehirnregionen Korrelation zwischen Anzahl von Liedern im Repertoire von Singvögeln und dem Volumen motorischer Hirnregionen, die den Gesang kontrollieren (Hyperstriatum ventrale pars caudate) Adaptive kognitive Spezialisierungen spiegeln sich in der Größe relevanter Gehirnregionen Krähenart, die im Winter zu 90% verstecktes Futter nutzt Spezialisierung des Schnabels, so dass er Dutzende von Samenkörner tragen kann Krähenart, die kaum verstecktes Futter nutzt keine morphologische Spezialisierung für das Befördern von Futter Vogelarten (rot), die sich auf versteckte Nahrungsvorräte verlassen, haben besseres Gedächtnis für Orte und größeres relatives Hippokampus-Volumen Selektive Züchtung von „labyrinthschlauen“ und „labyrinthdummen“ Rattenstämmen Tryon (1934) Ratten wurden trainiert, in einem Labyrinth Futter zu finden Einige Ratten lernten schneller als andere Selektive Züchtung schneller und langsamer Lerner Nach wenigen Generationen zeigten sich deutliche Lernunterschiede Neuere Befunde korreliert mit Größe des Hippokampus (bei Ratten wichtige Hirnstruktur für räumliches Lernen) Verbreitete Fehlinterpretationen der Evolutionstheorie I (1) Genetisch angelegte Merkmale oder Verhaltensdispositionen seien moralisch „gut“, weil sie das Ergebnis natürlicher Evolution sind Naturalistischer Fehlschluss (2) Fälschliche Annahme eines genetischen Determinismus • Merkmale, die auf genetischen Anlagen beruhen, seien unveränderlich und können nicht durch Erfahrungen beeinflusst werden • Aber: Evolutionstheorie behauptet nicht, dass Verhalten durch Gene „determiniert“ ist oder dass Lernen und Kultur keinen Einfluss haben (3) Falsche Dichotomie von Natur und Umwelt: • „Verhalten sei entweder angeboren oder erlernt“ • Tatsächlich ist Verhalten stets Ergebnis der Interaktion von Genen und Umwelteinflüssen Gen-Umwelt-Interaktion Cooper & Zubek (1958) • “Labyrinthdumme” Ratten machten signifikant mehr Fehler als “labyrinthschlaue” Ratten, wenn sie in einer reizarmen Umwelt aufgezogen wurden • Dieser Unterschied verschwand, wenn die Tiere in einer angereicherten Umgebung aufwuchsen Gen-Umwelt-Interaktion Polymorphismus im Serotonintransporter-Gen interagiert mit Anzahl von stressreichen Lebensereignissen und Missbrauchserfahrung in Bezug auf depressive Symptome “Mischung” von genetischen und Umwelteinflüssen? Verbreitete Redeweise: • „Merkmal X ist zu 60% Ergebnis der Gene und zu 40% durch die Umwelt bedingt“ Eine Analogie: • „Der Kuchen ist zu 60% das Ergebnis der Zutaten und zu 40% durch die Hitze im Backofen bedingt“ Irreführende Metapher! Tatsächlich interagieren Gene und Umweltbedingungen • Aktivität der Gene wird durch Umwelt moduliert • Umweltwirkung hängt von Genen ab, die auf Reizbedingungen reagieren Pinel (2007). © Pearson Studium Pseudowissenschaftlicher Missbrauch der Evolutionstheorie Missbrauch einer pseudowissenschaftlichen Version der Evolutionstheorie in der Nazidiktatur • Mit Schlagworten wie „Überleben der Stärksten“ oder „Kampf ums Überleben“ sollten Zwangsterilisation, Völkermord und eine menschenverachtende rassistische Ideologie („Rassenhygiene“) gerechtfertigt werden Derartige Ideologien haben nichts mit der wissenschaftlichen Evolutionstheorie zu tun und lassen sich nicht aus der Theorie ableiten! Zentrale Annahmen der modernen evolutionären Psychologie 47 Proximate vs. ultimate Erklärungen Warum reagieren Lebewesen auf bestimmte Reize so wie sie es tun? Proximate Erklärungen Wie-Fragen: Ultimate Erklärungen Wozu-Fragen: • Welche Mechanismen liegen einem Verhalten zugrunde? • Warum haben sich bestimmte Mechanismen entwickelt? • Wie sind diese Mechanismen neuronal implementiert? • Welche adaptive Funktion erfüllen diese Mechanismen? Warum schnappten Frösche nach kleinen, dunklen, sich bewegenden Objekten in ihrem Blickfeld? Weil sie über einen neuronalen Reflexmechanismus verfügen, durch den bestimmte sensorische Muster mit bestimmten motorischen Aktionen gekoppelt sind 48 Weil es sich bei den Objekten oft um Insekten handelt, die dem Frosch als Nahrung dienen und es adaptiv für Frösche war, einen Mechanismus auszubilden, der das Einverleiben dieser Objekte vermittelt Grundannahmen der Evolutionären Psychologie Adaptive Probleme und domänenspezifische Adaptationen Reproduktionserfolg eines Individuums hängt davon ab, wie gut es adaptive Anforderungen bewältigt • Nahrung finden; Sexualpartner gewinnen; nicht gefressen werden; Krankheiten und Verletzungen vermeiden; Vertrauenswürdigkeit von Artgenossen einschätzen; etc. Wie gut Individuen adaptive Anforderungen bewältigen, hängt von körperlichen Merkmalen als auch kognitiven Fähigkeiten und Verhaltensdispositionen ab (Phänotyp) Natürliche Selektion hat zur Evolution angeborener domänenspezifischer psychischer Mechanismen zur Lösung spezifischer adaptiver Probleme geführt (Adaptationen) • Navigation im Raum; giftige Nahrung meiden; Gesichter wiedererkennen; Vertrauenswürdigkeit von Artgenossen einschätzen; etc. Der menschliche Geist besteht aus domänenspezifischen „Modulen“, die zur Lösung spezieller Probleme evolviert sind 49 Tooby, J., & Cosmides, L. (1992). The psychological foundations of culture. In Barkow et al. (Ed’s), The Adapted Mind: 19-136. Grundannahmen der Evolutionären Psychologie Adaptive Probleme und domänenspezifische Adaptationen Adaptive Anforderungen • Reproduktionserfolg eines Individuums hängt davon ab, wie gut es adaptive Anforderungen bewältigt • Z.B. Nahrung finden; Sexualpartner gewinnen; nicht gefressen werden; Krankheiten und Verletzungen vermeiden; etc. Phänotyp • Wie gut Individuen adaptive Anforderungen bewältigen, hängt von ihren körperlichen Merkmalen und ihren kognitiven Fähigkeiten und Verhaltensdispositionen ab Adaptationen • Natürliche Selektion hat zur Evolution angeborener domänenspezifischer psychischer Mechanismen zur Lösung spezifischer adaptiver Probleme geführt • 50 Z.B. Navigation im Raum; giftige Nahrung meiden; Gesichter wiedererkennen; Vertrauenswürdigkeit von Artgenossen einschätzen; etc. Modularität des Geistes • Der menschliche Geist besteht aus domänenspezifischen „Modulen“, die zur Lösung spezieller Probleme evolviert sind Grundannahmen der Evolutionären Psychologie Adaptive Probleme und domänenspezifische Adaptationen Adaptationen sind müssen keine optimalen, sondern lediglich hinreichende Lösungen für adaptive Probleme sein Adaptationen stellen oft Kompromiss zwischen gegensätzlichen adaptiven Erfordernissen dar • z.B. großer Körper Stärke, aber hoher Energieverbrauch Merkmale können ihre Funktion im Verlauf der Evolution verändern • z.B. Federn: vom Schutz vor Kälte oder sozialem Dominanzsignal zum Fliegen? Nicht jedes Merkmal ist eine Adaptation • Merkmale ohne adaptive Funktion können in Population erhalten bleiben, wenn sie Reproduktionschancen der Individuen nicht reduzieren Adaptationen sind nicht immer adaptiv in unserer modernen Welt • Verhalten, dass an eine bestimmte Umwelt adaptiert ist, muss in einer veränderten Umwelt nicht länger adaptiv sein! 52 Umwelt der evolutionären Adaptiertheit (Environment of evolutionary adaptedness) Nur in letzten 40.000 Jahren (ca. 1% unserer Stammesgeschichte) haben Menschen Landwirtschaft betrieben und in Dörfern/Städten gelebt Grundlegende psychische Mechanismen und Verhaltensdispositionen sind evolviert, um die adaptiven Probleme eines Jäger/Sammler-Daseins in den Savannen des Pleistozän zu bewältigen Umwelt der evolutionären Adaptiertheit • nomadische oder semi-nomadische Lebensweise als Jäger/Sammler • Geringe Bevölkerungsdichte, kleine auf Verwandtschaft basierende Gruppen, soziale Konkurrenz & Kooperation • Hohe Kindersterblichkeit; geringe Lebenserwartung • Einfache Technologie und Abhängigkeit von natürlicher Umwelt (Raubtiere, Krankheiten, Wetter) • Wenig Spielraum für individuellen Lebensstil 53 Tooby, J., & Cosmides, L. (1992). The psychological foundations of culture. In Barkow et al. (Ed’s), The Adapted Mind: 19-136. Ultimate adaptive Funktionen müssen nicht bewusst sein Motivationale Dispositionen beruhen auf evolvierten psychischen Mechanismen, die uns bestimmte Dinge erstrebenswert scheinen lassen Individuen müssen sich der ultimaten Funktionen dieser Mechanismen nicht bewusst sein • Präferenz für süße Speisen • Attraktivität symmetrischer Gesichter • Freude über eigene Leistung • Kooperation • Präferenzen bei der Partnerwahl • Angst vor Spinnen Um zu verstehen, warum uns Dinge erstrebenswert erscheinen, muss man die adaptiven Anforderungen („Selektionsdruck“) analysieren, die zur Evolution spezifischer Motivationssysteme geführt haben 55 Domänenspezifische Mechanismen: Sozialer Austausch Von zentraler Bedeutung für Überleben und Fortpflanzung in der EEA waren soziale Interaktionen Evolution spezifischer sozialer Verhaltensdispositionen und Motivationssysteme • Sexualpartner finden und gewinnen • Nachkommen aufziehen • Verwandte erkennen • Soziale Beziehungen aufrechterhalten • Hohen sozialen Status erringen • Lügner entlarven • Die eigene Gruppe zusammenhalten • Bei der Jagd kooperieren; Futter teilen • Allianzen bilden 56 Überblick und Lernziele Natur-Umwelt-Kontroverse Grundannahmen der Evolutionären Psychologie Die „Umwelt der evolutionären Angepasstheit“ und domänenspezifische Adaptationen Sexuelle Selektion: Die „sexual strategies theory“ Empirische Evidenz: Geschlechtsunterschiede in reproduktiven Strategien Kritik an evolutionspsychologischen Ansätzen 60 “the ultimate goal that the mind was designed to attain is maximizing the number of copies of the genes that created it” (Steven Pinker) 61 Sexuelle Selektion Evolution von Merkmalen, die ihren Trägern einen Reproduktionsvorteil verschaffen (im Unterschied zu einem Überlebensvorteil) Gene von Individuen, die Nachkommen zeugen, werden sich mit höherer Wahrscheinlichkeit reproduzieren als Gene von Individuen, die keinen Partner finden Wege zur Steigerung des Reproduktionserfolgs • Intrasexuelle Konkurrenz: Konkurrenten durch Gewalt oder Drohung ausschalten • Intersexuelle Attraktivität: Eigene Anziehungskraft für das andere Geschlecht steigern Gene, die Merkmale kodieren, die ihren Trägern in Bezug auf (1) oder (2) einen Vorteil verschaffen, werden sich häufiger reproduzieren 62 Sexuelle Selektion und Reproduktionsstrategien: Warum gibt es Geschlechtsunterschiede? Reproduktionsrate = Anzahl von Nachkommen, die innerhalb eines Zeitintervalls erzeugt werden können In Spezies, in denen sich männliche Individuen schneller und häufiger reproduzieren können als weibliche Individuen, gibt es stets mehr zeugungsfähige männliche als fruchtbare weibliche Individuen männliche Individuen konkurrieren untereinander weibliche Individuen wählen aus männlichen Individuen aus Geschlecht mit hoher Reproduktionsrate Geschlecht mit niedriger Reproduktionsrate sexuelle Selektion fördert Merkmale, die sexuelle Selektion fördert Merkmale, die die Anzahl von Partnern erhöht die Qualität der Partner erhöht Fähigkeit, Konkurrenten durch Gewalt, Drohung oder höhere Attraktivität auszustechen 63 Präferenz für Partner mit wünschenswerten Merkmalen und Fähigkeit, diese Merkmale zu erkennen Clutton-Brock, T.H. & Vincent, A.J.C. (1990). Nature, 351, 58-60. Sexuelle Selektion In vielen (aber nicht allen!) Spezies konkurrieren männliche Individuen um Zugang zu Sexualpartnern, während weibliche Individuen Auswahl aus den möglichen Partnern treffen Erzeugt Selektionsdruck auf die männlichen Individuen Erklärt auffällige körperliche Merkmale bei männlichen Tieren (die ansonsten oft nur Kosten erzeugen) Erklärt aggressive Konkurrenz zwischen Männchen 64 Elterliches Investment und sexuelle Strategien (Sexual strategies theory) Elterliches Investment = Alle Aktionen eines Elternteils, die die Überlebens- und Reproduktionschancen der eigenen Nachkommen erhöhen Minimal notwendiges elterliches Investment (Zeit, Ressourcen) ist bei weiblichen und männlichen Individuen unterschiedlich Unterschiedliche minimale elterlichen Investitionen bei Männern und Frauen Unterschiedliche adaptive Probleme, die Männer und Frauen zur Sicherung ihres Reproduktionserfolgs bewältigen mussten Evolution geschlechtsspezifischer Partnerwahlstrategien, -präferenzen und mechanismen 65 Buss, D.M., & Schmitt, D.P. (1993). Sexual strategies theory: an evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100, 204-232. Symons, D. (1979). The Evolution of Human Sexuality, Oxford University Press. Trivers, R. L. (1972). Parental investment and sexual selection. In: B.Campbell (Ed.) Sexual selection and the descent of men: 1871-1971. Chicago: Aldine Elterliches Investment und sexuelle Strategien Frauen können nur relativ wenige Kinder gebären (Schwangerschaft; Stillzeit) minimal notwendiges elterliches Investment ist sehr hoch steigern Reproduktion ihrer Gene, wenn sie Partner wählen, die (a) gesunde Kinder zeugen, (b) Zugang zu wichtigen Ressourcen haben, (c) in die Kinder investieren Intersexuelle Selektion: Evolution von psychischen Mechanismen zur Selektion optimaler Partner Männer können theoretisch sehr große Zahl von Nachkommen zeugen minimal notwendiges elterliches Investment ist gering können Reproduktion ihrer Gene steigern, indem sie möglichst viele Nachkommen zeugen Intrasexuelle Konkurrenz: Evolution von Merkmalen, die Größe, Stärke, Dominanz, Verlässlichkeit etc. signalisieren • Minimal notwendiges Investment ≠ tatsächliches Investment! • Auch für Männer kann sich elterliches Investment für Reproduktion der eigenen Gene lohnen! • Von allen Säugetieren zeigen männliche Menschen im Mittel das höchste Maß an elterlichem Investment! 67 Sexual strategies theory Adaptive Probleme für Frauen und Männer im Environment of Evolutionary Adaptedness Reproduktionserfolg von Frauen hing von Wahl des richtigen Partners ab (er sollte in Reproduktionserfolg von Männern ihr Kind investieren) wurde kaum durch größere Anzahl von Partnern gesteigert Adaptive Probleme Partner auswählen, die fähig und willens sind, Ressourcen für ihre Partnerin und die Kinder beizusteuern wurde durch größere Anzahl von Partnerinnen gesteigert hing weniger von Wahl des „richtigen“ Partners oder Investitionen in das Kind ab Adaptive Probleme sexuellen Zugang zur fruchtbaren und gesunden Frauen gewinnen sicherstellen, dass Kinder wirklich die eigenen sind Individuen, die diese Probleme besser gelöst haben, hatten Reproduktionsvorteil 68 Evolvierte Präferenz für Partner mit hohem Status u. Zugang zu Ressourcen Wählerisches Verhalten: Partner sollte verlässlich, ambitioniert und guter Vater sein Bindungsbezogene Eifersucht Evolvierte Präferenz für gesunde, junge und fruchtbare Partnerinnen Wenig wählerisches Verhalten bei kurzfristigen sexuellen Beziehungen Intersexuelle Konkurrenz und sexuelle Eifersucht Überblick und Lernziele Natur-Umwelt-Kontroverse Grundannahmen der Evolutionären Psychologie Sexual strategies theory Empirische Evidenz: Geschlechtsunterschiede in reproduktiven Strategien • I. Kurzfristige Partnerwahl • II. Langfristige Partnerwahl • III. Eifersucht Kritik an evolutionspsychologischen Ansätzen 70 Sexual strategies theory Partnerwahl: Kurzfristige Beziehungen Hypothese: Vorfahren heutiger Männer steigerten Reproduktionserfolg, wenn sie mit möglichst vielen Partnerinnen Nachkommen zeugten (Fragliche) Hintergrundannahme: Vorteile häufigen Partnerwechsels überwog die Kosten (Geschlechtskrankheiten; geringere Fürsorge und Überlebenschancen für einzelnes Kind; gewaltsame Konflikte mit anderen Männern) Folgerung: Natürliche Selektion sollte Männer favorisiert haben, die nach größerer Zahl von Sexualpartnerinnen streben wenig wählerisch bei der Wahl kurzfristiger sexueller Beziehungen sind neue (unvertraute) Partnerinnen attraktiv finden 71 Buss, D. M. & Schmidt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100, 204-232. Empirische Ergebnisse I Anzahl gewünschter Sexualpartner bei kurzfristigen Beziehungen Männer und Frauen sollten angeben, wie viele Sexualpartner sie innerhalb einer bestimmten Zeit haben möchten 75 Buss, D. M., & Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100, 204-232. Empirische Ergebnisse II Bedeutung der Vertrautheit potentieller Partner bei kurzfristigen Beziehungen Männer und Frauen sollten einschätzen, wie wahrscheinlich sie in Sex mit einer attraktiven Person des anderen Geschlechts einwilligen würden, die sie unterschiedlich lange kennen 78 Buss, D. M. & Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100, 204-232. Empirische Ergebnisse III: Bereitschaft zu Sex mit Unbekannten 79 Männer Frauen Würden Sie heute Abend mit mir ausgehen? 50% 50% Würden Sie mich heute Abend in meiner Wohnung besuchen? 69% 6% Würden Sie heute Abend mit mir ins Bett gehen? 75% 0% Clark, R. & Hatfield, E. (1989). Gender differences in receptivity to sexual offers. Journal of Psychology and Human Sexuality, 2, 39-55. Empirische Ergebnisse IV: Ansprüche an kurzfristige Partner Collegestudenten sollten angeben, welche minimale Intelligenz sie bei einem (a) gelegentlichen Sexualpartner und (b) potentiellen Ehepartner voraussetzen würden 70 60 Male Female 50 40 30 Date 80 Sexual relation Steady Marriage date partner Kenrick et al. (1994) Aber Vorsicht… EP interpretiert Geschlechtsunterschiede bei Partnerwahl als Evidenz für universelle, interkulturell invariante Verhaltensmuster Aber: Resultate basieren auf subjektiven Aussagen, die tatsächliches Verhalten spiegeln müssen: • Soziale Erwünschtheit? • Falsche Selbsteinschätzung? • Kulturelle Stereotypen? 82 Überblick und Lernziele Natur-Umwelt-Kontroverse Grundannahmen der Evolutionären Psychologie Die Theorie der sexuellen Strategien Empirische Evidenz: Geschlechtsunterschiede in reproduktiven Strategien • I. Kurzfristige Partnerwahl • II. Langfristige Partnerwahl • III. Eifersucht Kritik an evolutionspsychologischen Ansätzen 83 Geschlechtsunterschiede in Bezug auf wünschenswerte Merkmale langfristiger Partner Merkmale wie Freundlichkeit, Verständnis, Intelligenz werden von Männern und Frauen gleichermaßen wichtig für langfristige Beziehungen angesehen Unabhängig davon gibt es Unterschiede in Präferenzen für bestimmte Merkmale Hypothese: • Frauen haben Mechanismen entwickelt, die es ihnen ermöglichen herauszufinden, ob Männer über hohen Status/Ressourcen verfügen und bereit sind, ihre Ressourcen in Nachkommen zu investieren • Männer haben Mechanismen entwickelt, die es ihnen ermöglichen herauszufinden, ob Frauen fruchtbar, gesund und treu sind 84 Geschlechtsunterschiede in Bezug auf wünschenswerte Merkmale langfristiger Partner Wiederman (1993) analysierte 1000 Kontaktanzeigen Männer: bieten häufiger finanzielle Sicherheit an und suchen attraktive Frauen, die jünger sind als sie selbst Frauen: beschreiben sich häufiger als attraktiv und suchen Männe mit gesichertem Einkommen, hohem Status, die älter sind als sie 86 Geschlechtsunterschiede in Bezug auf wünschenswerte Merkmale langfristiger Partner Akzeptable Mindestverdienstfähigkeit auf verschiedenen Ebenen einer Beziehung Frauen gehen von wesentlich höheren Mindeststandards aus, die bei einer langfristigen Beziehung (Ehe) ihren Höhepunkt erreichen. 88 D. T. Kenrick, E. K. Sadalla, G. Groth, & M. R. Trost. (1990). Evolution, traits, and the stages of human courtship: Qualifying the parental investment model. Journal of Personality, 58, 97-116. Geschlechtsunterschiede in Bezug auf wünschenswerte Merkmale langfristiger Partner Buss (1989) befragte über 10000 Männer und Frauen in 37 Ländern danach, wie wichtig ihnen bestimmte Eigenschaften eines Partners sind Probanden schätzten Wichtigkeit von 18 Eigenschaften auf 4-Punkte-Skala ein 89 Buss, D. M. (1994a). The strategies of human mating. American Scientist, 82, 238-249. Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Siences, 12, 1 - 49 Interkulturell universelle Partnerwahlstrategien? Ergebnisse von Buss (1989) Wichtigkeit guter finanzieller Aussichten bei der Auswahl eines langfristigen Partners 91 Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Siences, 12, 1 - 49 Buss: Evolutionäre Psychologie Präferenz für gesellschaftlichen Status bei der Auswahl eines langfristigen Partners 92 Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Siences, 12, 1 - 49 Interkulturell universelle Partnerwahlstrategien? Ergebnisse von Buss (1989) Wunsch nach physischer Attraktivität bei einem langfristigen Partner 94 Buss, D. M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Siences, 12, 1 - 49 Interkulturell universelle Partnerwahlstrategien? Ergebnisse von Buss (1989) In 36 von 37 Kulturen präferierten Frauen ambitionierte Männer mit gutem finanziellem Einkommen In jeder der untersuchten Kulturen präferierten Männer jüngere Frauen, während Frauen etwas ältere Männer bevorzugten In 27 Ländern waren Frauen überwiegend mit Männern verheiratet, die einige Jahre älter waren In 37 Kulturen wurde physische Attraktivität von Männer als wichtiger bewertet als von Frauen Aber: generell hohe Überlappung der Präferenzen von Männern und Frauen Aber: Weder Einkommen noch physische Attraktivität wurden als die wichtigsten Merkmale betrachtet; beide Geschlechter schätzen Freundlichkeit und Intelligenz als wichtiger ein 99 Überblick und Lernziele Natur-Umwelt-Kontroverse Grundannahmen der Evolutionären Psychologie Die Theorie der sexuellen Strategien Empirische Evidenz: Geschlechtsunterschiede in reproduktiven Strategien • I. Kurzfristige Partnerwahl • II. Langfristige Partnerwahl • III. Eifersucht Kritik an evolutionspsychologischen Ansätzen 102 Sexual Strategies Theory Hypothese zur Eifersucht Frauen können sicher sein, dass ihre Kinder ihre Gene tragen; Männer nicht Für Männer ist Zeit, die sie in elterliche Pflege und Aufzucht investieren, nicht mehr für Suche nach anderen Partnerinnen verfügbar Aus Sicht der Genreproduktion wäre es eine Fehlinvestition, in Kinder zu investieren, die nicht die eigenen sind Die Evolution sollte bei Männer zur Entwicklung von Strategien geführt haben, die das Risiko weiblicher Untreue reduzieren sexuelle Eifersucht 104 Sexual Strategies Theory Hypothese zur Eifersucht Männer 106 sollten eifersüchtig bei sexueller Untreue sein und bestrebt sein, sexuell treue Partnerinnen zu wählen und Untreue zu unterbinden... Frauen sollten eifersüchtig bei emotionaler Untreue sein und Männer präferieren, die emotional verlässlich sind... weil sexuelle Untreue der Partnerin die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Mann in Kinder investiert, die nicht seine eigenen sind weil emotionale Untreue des Partners die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Frau die Investitionen und den Schutz des Partners verliert weil sexuell eifersüchtige Männer mit höherer Wahrscheinlichkeit in die eigenen Nachkommen investierten und sich ihre Gene mit höher Wahrscheinlichkeit reproduzierten weil emotional eifersüchtige Frauen mit größerer Wahrscheinlichkeit ihre Kinder groß ziehen können, bis diese sich selbst reproduzieren können Untersuchung zu Geschlechtsunterschieden bei der Eifersucht Buss et al. (1992) präsentierten Probanden folgendes Szenario: Please think of a serious committed romantic relationship that you have had in the past, that you currently have, or that you would like to have. Imagine that you discover that the person with whom you’ve been seriously involved became interested in someone else. What would distress or upset you more (please circle only one): A. Imagining your partner falling in love and forming a deep emotional attachment to that person B. Imaging your partner enjoying passionate sexual intercourse with that other person / trying different sexual positions with that other person. Buss, D. M., Larsen, R. J., Westen, D., &; Semmelroth, J. (1992). Sex differences in jealousy: Evolution, physiology, and psychology. Psychological Science, 3, 251-255. 107 Buunk, B. P., Angleitner,A., Oubaid,V., & Buss, D. M. (1996). Sex differences in jealousy in evolutionary and cultural perspective. Psychological Science, 7, 359–363. Untersuchung zu Geschlechtsunterschieden bei der Eifersucht Prozentsatz von Proband/inn/en, die stärkere negative Emotionen bei sexueller im Vergleich zu emotionaler Untreue des Partners angaben 70 60 50 40 Männer 30 Frauen 20 10 0 Sexuelle Untreue Sexuelle Untreue vs. Emotionale vs. Liebe Untreue 108 Buss et al. (1992). Psychological Science, 3, 251-255. Replikationsstudie Prozentsatz von Proband/inn/en, die stärkere negative Emotionen auf vorgestellte sexuelle im Vergleich zu emotionaler Untreue berichteten 50 40 30 Männer Frauen 20 10 0 USA 110 Deutschland Niederlande Buunk et al. (1996). Science, 7, 359–363. Physiologische Reaktionen auf vorgestellte sexuelle vs. emotionale Untreue des Partners 9 Sexuell Emotional 8 Hautleitwerte Sexuell Emotional 1,4 7 1,2 6 1 5 0,8 EDA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Mimik EMG Pulserate Pulsrate 4 3 Frauen Emotional 0,6 0,4 2 Männer Sexuell 1 0,2 0 0 Männer Frauen -0,2 Männer Frauen Einschränkungen: • Reaktionen auf vorgestellte Szenarien generalisierbar auf reale Situationen? • Befunde konnten nicht immer konsistent repliziert werden 112 Buss et al. (1992). Psychological Science, 3, 251-255. Überblick und Lernziele 115 Natur-Umwelt-Kontroverse Grundannahmen der Evolutionären Psychologie Die Theorie der sexuellen Strategien Empirische Evidenz: Geschlechtsunterschiede in reproduktiven Strategien Kritik an evolutionspsychologischen Ansätzen Kritik an der Evolutionären Psychologie und Fragen zu Nachdenken Wie plausibel sind die Prämissen der Theorie der sexuellen Strategien? Tattersall (1998): Fördert es wirklich den Reproduktionserfolg von Männern, möglichst viele Kinder mit verschiedenen Partnerinnen zu zeugen? Reproduktion eigener Gene wird auch gefördert, wenn Männer intensiv in das Überleben einiger weniger Kinder investieren, da dies die Reproduktionschancen der Nachkommen erhöht 117 Kritik an der E.P. und Fragen zum Nachdenken Hängen sexuelle Strategien von sozialen Bedingungen ab? Structural powerless hypothesis (Wiederman & Allgeier, 1992) • In vielen Gesellschaften sind für Frauen Chancen geringer, Wohlstand über eigenen Beruf zu erreichen Präferenz für Männer mit hohem Status • Je häufigen Frauen in berufliche Positionen mit gesichertem Einkommen und hohem Status gelangen, umso unwichtiger sollten Einkommen und Status des Mannes bei der Partnerwahl werden Evidenz • Contra: Einige Studien fanden keinen Zusammenhang zwischen Einkommen von Frauen und der Bedeutung, die sie dem Einkommen potentieller Partner beimaßen • Pro: Eagly & Wood (1999) reanalysierten Daten von Buss (1989) und erhoben Indikatoren für Einfluss und finanzielle Situation von Frauen je geringer Machtund Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen, umso geringer Unterschiede in Partnerwahlpräferenzen 118 Alternative Erklärungen von Geschlechtsunterschieden bei der Anzahl gewünschter Partner Pedersen et al. (2002) untersuchten, wie viele Partner sich Männer und Frauen idealerweise über bestimmten Zeitraum wünschen 98.9% der Männer und 99.2% der Frauen gaben an, innerhalb der nächsten 5 Jahre eine dauerhafte, sexuelle exklusive Partnerschaft anzustreben Innerhalb dieser Zeit strebte ein großer Teil der Probanden keine kurzfristigen Beziehungen an 119 Pedersen, W.C., Miller, L.C., Putcha-Bhagavatula, A.D., & Yang, Y. (2002). Evolved sex differences in the number of partners desired? The long and the short of it. Psychological Science, 13, 157–161.