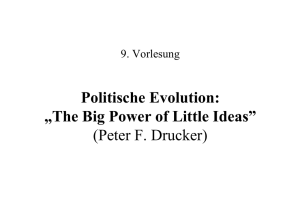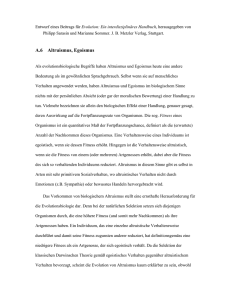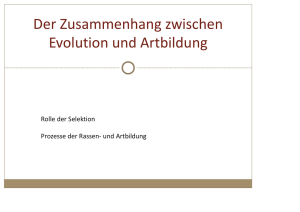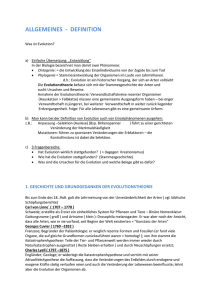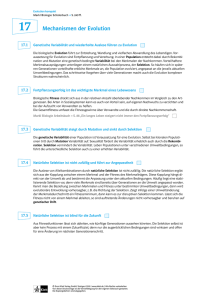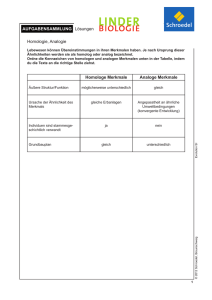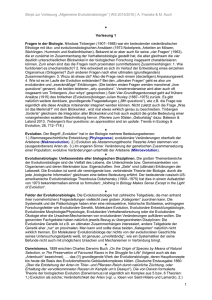Skript zur Vorlesung
Werbung
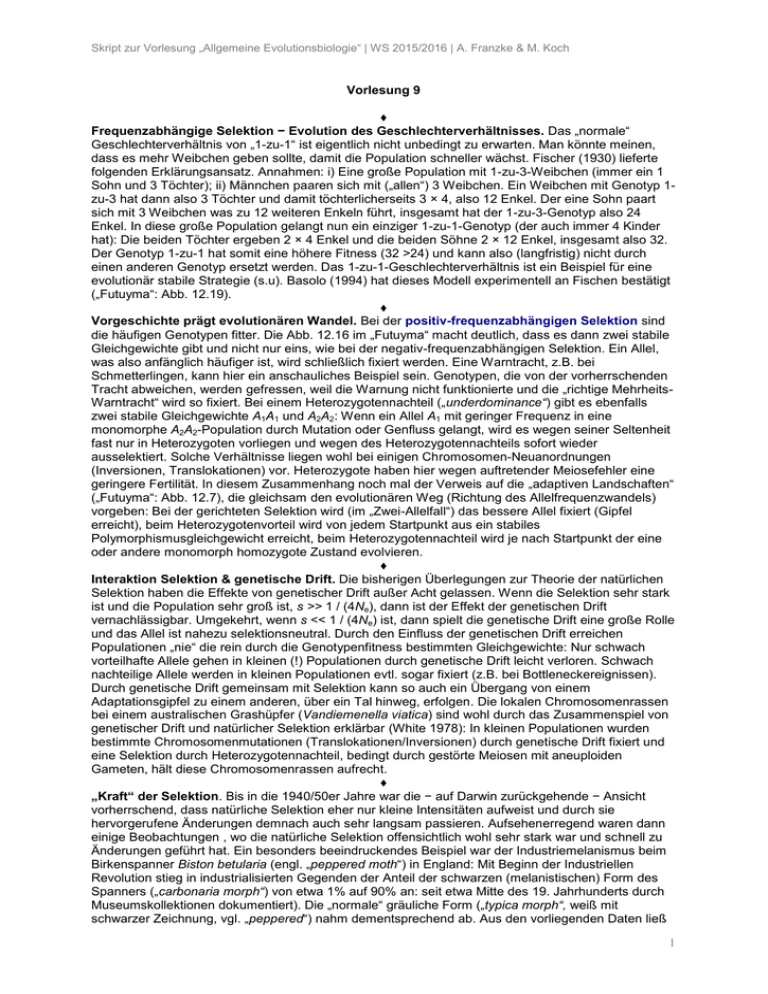
Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2015/2016 | A. Franzke & M. Koch Vorlesung 9 ♦ Frequenzabhängige Selektion − Evolution des Geschlechterverhältnisses. Das „normale“ Geschlechterverhältnis von „1-zu-1“ ist eigentlich nicht unbedingt zu erwarten. Man könnte meinen, dass es mehr Weibchen geben sollte, damit die Population schneller wächst. Fischer (1930) lieferte folgenden Erklärungsansatz. Annahmen: i) Eine große Population mit 1-zu-3-Weibchen (immer ein 1 Sohn und 3 Töchter); ii) Männchen paaren sich mit („allen“) 3 Weibchen. Ein Weibchen mit Genotyp 1zu-3 hat dann also 3 Töchter und damit töchterlicherseits 3 × 4, also 12 Enkel. Der eine Sohn paart sich mit 3 Weibchen was zu 12 weiteren Enkeln führt, insgesamt hat der 1-zu-3-Genotyp also 24 Enkel. In diese große Population gelangt nun ein einziger 1-zu-1-Genotyp (der auch immer 4 Kinder hat): Die beiden Töchter ergeben 2 × 4 Enkel und die beiden Söhne 2 × 12 Enkel, insgesamt also 32. Der Genotyp 1-zu-1 hat somit eine höhere Fitness (32 >24) und kann also (langfristig) nicht durch einen anderen Genotyp ersetzt werden. Das 1-zu-1-Geschlechterverhältnis ist ein Beispiel für eine evolutionär stabile Strategie (s.u). Basolo (1994) hat dieses Modell experimentell an Fischen bestätigt („Futuyma“: Abb. 12.19). ♦ Vorgeschichte prägt evolutionären Wandel. Bei der positiv-frequenzabhängigen Selektion sind die häufigen Genotypen fitter. Die Abb. 12.16 im „Futuyma“ macht deutlich, dass es dann zwei stabile Gleichgewichte gibt und nicht nur eins, wie bei der negativ-frequenzabhängigen Selektion. Ein Allel, was also anfänglich häufiger ist, wird schließlich fixiert werden. Eine Warntracht, z.B. bei Schmetterlingen, kann hier ein anschauliches Beispiel sein. Genotypen, die von der vorherrschenden Tracht abweichen, werden gefressen, weil die Warnung nicht funktionierte und die „richtige MehrheitsWarntracht“ wird so fixiert. Bei einem Heterozygotennachteil („underdominance“) gibt es ebenfalls zwei stabile Gleichgewichte A1A1 und A2A2: Wenn ein Allel A1 mit geringer Frequenz in eine monomorphe A2A2-Population durch Mutation oder Genfluss gelangt, wird es wegen seiner Seltenheit fast nur in Heterozygoten vorliegen und wegen des Heterozygotennachteils sofort wieder ausselektiert. Solche Verhältnisse liegen wohl bei einigen Chromosomen-Neuanordnungen (Inversionen, Translokationen) vor. Heterozygote haben hier wegen auftretender Meiosefehler eine geringere Fertilität. In diesem Zusammenhang noch mal der Verweis auf die „adaptiven Landschaften“ („Futuyma“: Abb. 12.7), die gleichsam den evolutionären Weg (Richtung des Allelfrequenzwandels) vorgeben: Bei der gerichteten Selektion wird (im „Zwei-Allelfall“) das bessere Allel fixiert (Gipfel erreicht), beim Heterozygotenvorteil wird von jedem Startpunkt aus ein stabiles Polymorphismusgleichgewicht erreicht, beim Heterozygotennachteil wird je nach Startpunkt der eine oder andere monomorph homozygote Zustand evolvieren. ♦ Interaktion Selektion & genetische Drift. Die bisherigen Überlegungen zur Theorie der natürlichen Selektion haben die Effekte von genetischer Drift außer Acht gelassen. Wenn die Selektion sehr stark ist und die Population sehr groß ist, s >> 1 / (4Ne), dann ist der Effekt der genetischen Drift vernachlässigbar. Umgekehrt, wenn s << 1 / (4Ne) ist, dann spielt die genetische Drift eine große Rolle und das Allel ist nahezu selektionsneutral. Durch den Einfluss der genetischen Drift erreichen Populationen „nie“ die rein durch die Genotypenfitness bestimmten Gleichgewichte: Nur schwach vorteilhafte Allele gehen in kleinen (!) Populationen durch genetische Drift leicht verloren. Schwach nachteilige Allele werden in kleinen Populationen evtl. sogar fixiert (z.B. bei Bottleneckereignissen). Durch genetische Drift gemeinsam mit Selektion kann so auch ein Übergang von einem Adaptationsgipfel zu einem anderen, über ein Tal hinweg, erfolgen. Die lokalen Chromosomenrassen bei einem australischen Grashüpfer (Vandiemenella viatica) sind wohl durch das Zusammenspiel von genetischer Drift und natürlicher Selektion erklärbar (White 1978): In kleinen Populationen wurden bestimmte Chromosomenmutationen (Translokationen/Inversionen) durch genetische Drift fixiert und eine Selektion durch Heterozygotennachteil, bedingt durch gestörte Meiosen mit aneuploiden Gameten, hält diese Chromosomenrassen aufrecht. ♦ „Kraft“ der Selektion. Bis in die 1940/50er Jahre war die − auf Darwin zurückgehende − Ansicht vorherrschend, dass natürliche Selektion eher nur kleine Intensitäten aufweist und durch sie hervorgerufene Änderungen demnach auch sehr langsam passieren. Aufsehenerregend waren dann einige Beobachtungen , wo die natürliche Selektion offensichtlich wohl sehr stark war und schnell zu Änderungen geführt hat. Ein besonders beeindruckendes Beispiel war der Industriemelanismus beim Birkenspanner Biston betularia (engl. „peppered moth“) in England: Mit Beginn der Industriellen Revolution stieg in industrialisierten Gegenden der Anteil der schwarzen (melanistischen) Form des Spanners („carbonaria morph“) von etwa 1% auf 90% an: seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts durch Museumskollektionen dokumentiert). Die „normale“ gräuliche Form („typica morph“, weiß mit schwarzer Zeichnung, vgl. „peppered“) nahm dementsprechend ab. Aus den vorliegenden Daten ließ 1 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2015/2016 | A. Franzke & M. Koch sich ein Selektionskoeffizient von s = 0,33 ableiten, was bedeutet, dass sich die schwarze Form schon nach etwa 100 Generationen durchsetzen kann. Bereits in den 1890er Jahren gab es folgende, gängige Hypothese dazu: Die mit der Industrialisierung einhergehende Luftverschmutzung führte zu einem Rückgang von (grauem) Flechtenbewuchs auf Baumstämmen und gleichzeitig zu einer dunklen Färbung der Stämme durch Ruß. Dadurch war die graue Form des Birkenspanners weniger getarnt und wurde dementsprechend durch Vögel gefressen, so dass die melanistische Form stark zunahm. Kritisiert wurde schon seinerzeit, dass Vögel eigentlich nicht unbedingt die Fressfeinde von Nachtfaltern sind. In 1950er Jahren führte der britische Entomologe Henry Bernard David Kettlewell (1907−1979) umfangreiche Experimente durch und bestätigte insgesamt die Hypothese. Auch hier kann man an seinen experimentellen Ansätzen Kritik üben: Die oft gezeigten Fotos mit schwarzen bzw. dunklen Spannern auf der Borke von Bäumen zeigen z.B. aufgeklebte Tiere mit ausgebreiteten Flügeln bei Fütterexperimenten. Tagsüber nimmt der Spanner aber eigentlich eine „zusammengeklappte“ Ruhehaltung und wohl auch eher in durch Blätter beschatteten Bereichen der Baumkrone ein. Durch technische Maßnahmen ist die Luftverschmutzung seit etwa1950 stark zurückgegangen und die Frequenz der schwarzen Form seitdem wieder auf wenige Prozent zurückgegangen („Futuyma“: Abb. 12.24). Der Unterschied in den beiden Formen liegt in nur einem Allelunterschied an einem Locus. Die Carbonaria-Morphe verfügt hier über ein dominantes Allel. Dieses Allel ist wohl nur einmal und erst vor evolutionär kürzerer Zeit entstanden: van’t Hof et al. 2011. Industrial Melanism in British Peppered Moths Has a Singular and Recent Mutational Origin. Science, 332, 958−960. Die Experimente von Kettlewell wurden in den 1990er Jahren vom britischen Genetiker und Evolutionsbiologen Michael Majerus (1954–2009) überprüft und wegen teilweiser (!) Nichtreproduzierbarkeit der früheren Ergebnisse methodisch kritisiert. Diese, also nicht generelle, Kritik an Kettlewells Schlussfolgerungen wurde in der Folge von „Antievolutionisten“ gleichsam als Beweis für ihren Standpunkt missbraucht. Das wurde insbesondere durch ein Buch einer Journalistin, die darin Kettlewell Wissenschaftsbetrug vorwarf, entsprechend angefeuert. (Ein Teil der Ergebnisse von Majerus wurden erst 2011, also postum, veröffentlicht.) ♦ Strategie & Stabilität. Insbesondere die Ausführungen zur sexuellen Selektion (s.o.) − vielleicht noch mal an das „abgefahrene“ Verhalten der Laubenvögel zurückdenken − machen deutlich, dass viele Merkmale/Verhaltensweisen von Organismen weniger dem „survival“ dienen, als vielmehr dazu, „Chancen“ zu erhöhen sich erfolgreich zu reproduzieren. Selektion durch abiotische Umweltfaktoren führt(e) zu (meist) nahe liegenden evolutionären Lösungen (Adaptationen). Anpassungen an die biotische Umwelt − Organismen der eigenen oder anderer Arten − sind dabei häufig nicht so einfach zu „durchschauen“. Die besondere Qualität dieser Beziehungen besteht darin, dass die „anderen“ eben auch reagierend evolvieren: Eine schwarze und eine rosa-glitzernde „Beute-Art“ konkurrieren um Nahrungsressourcen, eine lebt also auf Kosten der anderen. Ein Räuber spezialisiert sich durch Selektion und Adaptation auf die Jagd der zahlenmäßig häufiger vorkommenden „Beute-Art“. Die andere wird zahlenmäßig zunehmen und der Räuber wird sich evtl. auf die nun häufiger vorkommende Beute anpassen. Bei solchen evolutionären Spielen hängt der Erfolg der Mitspieler − wie immer bei Spielen − von der Reaktion der Mitspieler/Gegner ab. Evolutionäre Spiele sind aus der „Mitspielersicht“ oft eigentlich vielleicht eher „Selektionskriege“. ♦ Spieltheorie & evolutionäre Strategien. Die in den 1970er Jahren entstandene Soziobiologie sucht nach ultimaten Ursachen von Verhalten und verwendet dabei auch spieltheoretische Ansätze. Die Spieltheorie ist ein Teilgebiet der Mathematik, das Entscheidungssituationen modelliert, in denen mehrere Beteiligte das Ergebnis gegenseitig beeinflussen. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das sogenannte Gefangenendilemma. Zwei Komplizen werden isoliert verhört und haben folgende Möglichkeiten: 1.) Verrat des Anderen mit eigenem Freispruch plus Belohnung und fünf Jahre Haft für den Verratenen. 2.) Gegenseitiger Verrat führt für beide zu drei Jahren Haft. 3.) Schweigen führt zu Freispruch für beide, aber ohne eine Belohnung. Die Spieltheorie hat insbesondere in den Wirtschaftswissenschaften − bisher 8 Nobelpreise − für die Ableitung von Entscheidungsverhalten eine große Bedeutung. Für ein Verständnis der Evolutionären Spieltheorie ist entscheidend, dass die „Mitspieler“ hier natürlich keine (!) rationale Strategiewahl treffen oder informiert sind. Die Spieler in der Evolution suchen (aktiv) keine Lösung, sondern schlechte Strategien stehen einfach nur unter negativer Selektion. ♦ Evolutionär stabile Strategie. Ein Pionier der Evolutionären Spieltheorie war der britische, theoretische Biologe John Maynard Smith (1920−2004), auf den das (spieltheoretische) Konzept der evolutionär stabilen Strategie (ESS, “evolutionary stable strategy”) zurückgeht. Smith & Price 1973. The Logic of Animal Conflict. Nature 264, 15−18. Eine evolutionär stabile Strategie (ESS) ist eine Evolutionsstrategie, die durch keine Alternativstrategie verbessert werden kann, unter der Voraussetzung, dass genügend Mitglieder der Population diese anwenden. Smith (1982): „An ESS or 2 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2015/2016 | A. Franzke & M. Koch evolutionarily stable strategy is a strategy such that, if all the members of a population adopt it, no mutant strategy can invade.”. Adulte Nachkommen haben folgende „Möglichkeitspaare“: 1.) Elternhaus verlassen (abwandern) oder nicht und 2. sich selber fortzupflanzen oder nicht. Daraus ergeben sich folgende Kombinationen (Strategien): 1.) Abwandern und sich nicht fortpflanzen ist evolutionär gesehen „sinnlos“. 2.) Zuhause bleiben und eigene Familie gründen hat den Vorteil von Ressourcen eines etablierten Reviers und elterlicher Hilfe. Wenn alle Geschwister diese Strategie verfolgen, kommt es sicherlich zu Konkurrenz. 3.) Abwandern und eine eigene Familie zu gründen ist deshalb eine bekannte ESS bei Säugetieren. 4.) Nicht Abwandern und (zeitweilig) auf eigene Reproduktion verzichten und dafür Geschwister großziehen kann auch eine ESS sein (z.B. beim Biber s.u.). ♦ Falken & Tauben. Falke (aggressiv, riskierend) und Taube (nicht aggressiv) charakterisieren idealisierte phänotypische Grundstrategien in (Ressourcen-)Konflikten. Mal folgende Annahmen: Es gibt 50 Punkte für einen Sieg, 0 Punkte für eine Niederlage und -100 Punkte für eine ernste Verletzung und -10 Punkte für Zeitverlust bei einer langen Auseinandersetzung. Falken greifen an und siegen (Fitnessgewinn) oder werden schwer verletzt bzw. getötet (Fitnessverlust) wenn sie auf einen anderen Falken treffen und gewinnen bzw. verlieren in 50% der Fälle diesen Wettkampf (50 Punkte Gewinn bzw. 100 Punkte Verlust). Tauben greifen nicht an und fliehen, wenn sie auf einen Falken treffen (weder Gewinn noch Verlust) und der Falke gewinnt immer. Wenn zwei Tauben aufeinandertreffen, veranstalten sie einen langwierigen „Anstarrwettkampf“ mit einem beiderseitigen Zeitverlust, der 10 Punkte kostet und sie gewinnen bzw. verlieren zu 50% diesen Wettkampf. Die Gewinnertaube bekommt dann netto also nur 40 Punkte. Für die verschiedenen Kombinationen des Zusammentreffens ergibt sich dann (in etwa) folgende Auszahlungsmatrix: Gegner Falke Taube ½ Gewinn – ½ Kosten Gewinn Auszahlung für Falke Taube 0 ½ Gewinn Man kann hieraus ableiten, dass „Taube“ keine ESS ist, obwohl in unserem Beispiel jede Taube im Mittel 15 Punkte bekommt: Ein seltener Falkenmutant wird sich in einer reinen Taubenpopulation immer ausbreiten. Eine reine Falkenstrategie kann möglicherweise eine ESS sein, wenn bei einem Zusammentreffen von zwei Falken der Fitnessgewinn größer als die Fitnesskosten sind. Wenn hier allerdings die Kosten größer als der Gewinn sind – in unserem Beispiel wären der durchschnittliche „Gewinn“ für jeden Falken -25 Punkte – wird sich ein Phänotypen-Mix aus Falken und Tauben in der Population ergeben, z.B. Beispiel 5/12 Tauben zu 7/12 Falken mit 6 1/4 Punkten durchschnittlicher Prämie für jeden. Ey − immer nur arbeitsblattausteilende Biolehrer! … auch mal mit der Kollegin „Musik & Religion“ fächerübergreifend zusammenarbeiten: http://www.youtube.com/watch?v=Jl8yRhASMhA. Es gibt noch weitere Strategien: Der Vergelter „macht erst auf Taube“ und verhält sich bei Angriff doch wie ein Falke. Der „Angeber“ spielt erst den Falken und ist bei Angriff dann doch eine Taube. (Seltsamerweise ist die Taube aus den Lehrbüchern bei Smith & Price (1973, s.o.) eine „Mouse“). ♦ Rote-Königin-Hypothese. Das „Red Queen principle“ geht ursprünglich auf den, wohl etwas „schräg“ gewesenen, US-amerikanischen Evolutionsbiologen Leigh Van Valen (1935−2010) zurück: Van Valen 1973. A new evolutionary law. Evolutionary Theory 1, 1–30. Bei dieser breit angelegten Analyse von Fossilien verschiedener Organismengruppen stellte er fest, dass die Aussterbewahrscheinlichkeit nicht vom evolutionären Alter der Gruppe abhängt. Eine phylogenetisch alte Gruppe ist also trotz offensichtlich langer Erfolgsgeschichte, die durch ihre Adaptationen bedingt ist, genauso durch sich ändernde Bedingungen vom Aussterben bedroht wie eine „unerfahrene“, evolutionär junge Gruppe. Jede Gruppe muss also ständig ein evolutionäres Wettrüsten betreiben, um im Spiel zu bleiben. Das ist vielleicht besonders anschaulich, wenn man Räuber-Beute-Beziehungen betrachtet: http://www.youtube.com/watch?v=Jrm4Hc8U1rQ; ein Beispiel für Koevolution im engeren Sinne: Gemeinsame Evolution von zwei oder mehr ökologisch interagierenden Arten, wobei jede Art durch die Selektion der anderen evolviert. Koevolution im weiteren Sinne: Die (einseitige) Evolution einer Art durch Interaktion mit einer anderen Art oder einfach auch als die stammesgeschichtliche Auseinanderentwicklung ökologisch assoziierter Arten. Der Begriff „Rote Königin“ nimmt Bezug auf die 3 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2015/2016 | A. Franzke & M. Koch Schachfiguren-Königin aus dem Kinderbuch „Alice im Spiegelland“ (Lewis Carroll, 1871), die an einer Stelle sagt: „Hierzulande musst du so schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst.“. Die Rote Königin wurde später auch bemüht, um die Evolution von Sexualität bzw. Phänomene der sexuellen Selektion zu erklären: Bell 1982. The Masterpiece Of Nature: The Evolution and Genetics of Sexuality. Ridley 1993. The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature. (Nochmal kurz zu Van Valen. Hier findet man ganz erstaunliche Texte aus seiner Feder von Liedern, die er wohl zur allgemeinen Freude in seinen Vorlesungen vorgesungen hat: http://leighvanvalen.com/evolutionary-theory.) ♦ Wie Darwinisten denken – Stern von Madagaskar. Weil der Stern von Madagaskar (Angraecum sesquipedale, Orchidaceae, Epi- bzw. Lithophyt, O-Küste Madagaskar, „sesquipedale“ bedeutet „anderthalb Fuß“) gerade im Botanischen Garten blüht wurde die Pflanze mitgebracht und dann auch dieser „Klassiker“ der (Ko)Evolutionsbiologie vorgestellt: Darwin stellt 1862 in einem Orchideenbuch die These auf, dass Angraecum sesquipedale mit seinem bis zu 40 cm langen, im unteren Teil mit Nektar gefülltem Blütensporn durch einen – bis dahin unbekannten – Schmetterling mit entsprechend langem Rüssel bestäubt wird. Er wird daraufhin „natürlich“ von zeitgenössischen Entomologen verspottet. 1903 wurde dann tatsächlich ein solcher Schwärmer Xanthopan morganii praedicta – „praedictus“ bedeutet „der Vorausgesagte“ – beschrieben. Allerdings wurde erst 1997 auch ein Blütenbesuch dieses Schwärmers durch Photos dokumentiert. Durch den anthropogen bedingten Rückgang des Wirtsbaums der Xanthopan-Raupe in den letzten Jahrzehnten ist der Stern von Madagaskar stark bedroht. Messungen an einem Standort ergaben, dass hier im Jahr 1934 aus 75% der Blüten, Früchte hervorgingen, aktuell nur noch aus etwa 1%. ♦ Altruismus versus Egoismus. Altruismus bedeutet ganz allgemein, ein auf Kosten eines Gebers gehendes uneigennütziges Verhalten, von dem andere Individuen (Empfänger) profitieren. Es ist bei Verhaltensweisen zunächst nicht immer einfach zu entscheiden, ob ein Verhalten wirklich altruistisch ist. Die „edlen“ Wächter bei Erdmännchen (Suricata suricatta, südliches Afrika, insbesondere Savannen, Kolonien mit bis zu 30 Individuen), die die anderen Erdmännchen vor einem angreifenden Beutegreifer warnen, handeln wohl nicht wirklich altruistisch, sondern eher „nur“ egoistisch: Wächter fallen dem Angreifer nie zum Opfer, weil sie ihn als Erster sehen und dann in ihren nah gelegenen Bau flüchten und sie halten auch nur dann Wache, wenn sie satt sind (also ohnehin nichts anderes zu tun haben) und niemand anderes Wache „schiebt“. Durch individuelle Selektion ist hier also ein Verhalten evolviert, dass darüber hinaus evtl. auch einen Nutzen für die Gruppe hat. Auch das berühmte kooperative Graben bei den eusozialen Nacktmullen (Heterocephalus glaber, s.o.) ist wohl nur ein „Abfallprodukt“ individueller Grabtrieb-Befriedigung. In der Evolutionsbiologie sind daher insbesondere Erklärungsansätze von Verhaltensweisen interessant, die in einem engeren Sinne altruistisch sind: Individuelle Verhaltensweisen, durch die die Fitness eines anderen Individuums zu Kosten der eigenen Fitness erhöht wird. (Nochmal: Fitness bedeutet Zahl der Nachkommen, die zur eigenen Reproduktion gelangen). Solche altruistischen Verhaltensweisen sind z.B. elterliche Fürsorge, (zeitweiliger) reproduktiver Altruismus, also der Verzicht auf eigene Nachkommen oder sogar ein altruistischer Selbstmord, z.B. bei Kolonieverteidigungen. Es erscheint (zunächst) nicht möglich, dass sich durch natürliche Selektion ein Allel durchsetzt, dass altruistisches Verhalten zugunsten eines anderen Individuums fördert. Die Selektionseinheit des (Neo)Darwinismus ist ja das Individuum. Darwin sprach in diesem Zusammenhang von einer “special difficulty, which at first appeared to me insuperable, and actually fatal to my whole theory”(zentrales Darwinismus-Paradoxon). ♦ Familienprotektion & reproduktiver Altruismus − Verwandtenselektion. Im Tierreich findet man häufig elterliche Verhaltensweisen, die der Familienprotektion dienen: „Vogelmamas“ beschützen ihr Nest mit Nachkommen, aber nicht das der Nachbarin. Durch das erstgenannte Verhalten schützt die Mutter letztlich ihre eigenen Allele, die ja in ihren eigenen Nachkommen zu einem größeren Anteil vorhanden ist, als im Nachwuchs der Nachbarin. Solche Verhaltensweisen sind also durch die Verwandtenselektion („kin selection“) erklärbar: Form der natürlichen Selektion, bei der Allele unterschiedlich vermehrt werden, weil sich Individuen abhängig vom Verwandtschaftsgrad gegenseitig Hilfe leisten und dadurch den Fortpflanzungserfolg steigern (eine Form der Genselektion, s.o.). Die Verwandtenselektion kann auch reproduktiven Altruismus erklären: Individuen, die anderen Artgenossen bei der Aufzucht ihrer Jungen helfen und dafür zeitweilig oder permanent auf eine eigene Fortpflanzung verzichten. ♦ Verwandtenselektion − Hamiltons Regel. Das Konzept der Verwandtenselektion wurde insbesondere vom britischen Evolutionsbiologen William Donald Hamilton (1936−2000) theoretisch ausgearbeitet. Hamilton 1964. The genetical evolution of social behaviour. I & II. Journal of Theoretical Biology 7, 1–16 & 17–52. Für das Konzept der Verwandtenselektion ist die sogenannte 4 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2015/2016 | A. Franzke & M. Koch Gesamtfitness („inclusive fitness“) entscheidend: Summe aus direkter Fitness (Anzahl der Allele, die durch eigene Nachkommen weitergegeben werden) und der indirekten Fitness (Anzahl der Allele, die über Verwandte an die nächste Generation weitergegeben werden). Die Theorie der inklusiven Fitness ist die Basis der Hamilton-Regel: Altruismus entsteht durch natürliche Selektion nur dann, wenn der (indirekte) Fitnessgewinn b („benefit“) für den Altruisten letztlich größer ist als die Fitnesskosten c („costs“), die er dafür investieren muss. Dies ist abhängig vom Verwandtschaftsgrad zwischen Helfer und Nutznießer. Formelmäßig ausgedrückt: Altruismus evolviert nur dann, wenn c < r × b, wobei r der Verwandtschaftskoeffizient ist („relatedness“), der die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der ein Allel in zwei Individuen durch gemeinsame Abstammung vorkommt. Kinder und Eltern bzw. Geschwister teilen untereinander im Durchschnitt 50% ihrer Allele, hier ist r = 0,5. Zwischen Großeltern und Enkeln, bzw. zwischen Halbgeschwistern beträgt r = 0,25, zwischen Uroma und Urenkeln, bzw. zwischen Cousinen ist r = 0,125. (Haldane: “I would lay down my life for two brothers or eight cousins”.) Altruistischer Selbstmord (c =1) kann also dann durch Selektion evolvieren, wenn der Altruist sein Leben z.B. für mindestens 3 (b = 3) Geschwister (r = 0,5) opfert (1 < 0,5 × 3): c < r × b. Beim reproduktiven Altruismus sieht die Hamilton-Regel formelmäßig so aus: c × r0 < b × ri (c = Zahl der Nachkommen, die der Altruist nicht hat, r0 = Verwandtschaftsgrad des Altruisten zu eigenen Kindern, b = Zahl der Nachkommen, die der Nutznießer durch den Altruisten mehr hat, ri = Verwandtschaftsgrad zu den Nachkommen des Nutznießers). Wenn man auf ein eigenes Kind (c = 1, r0 = 0,5) verzichtet, muss man seiner Schwester helfen 3 (b = 3) zusätzliche Neffen (ri = 0,25) großzuziehen (1 × 0,5 = 0,5 < 3 × 0,25 = 0,75). Das Konzept der inklusiven Fitness und der Verwandtenselektion war die Basis für die Etablierung der Soziobiologie – der Begriff wurde 1975 durch ein gleichnamiges Buch des bedeutenden US-amerikanischen Evolutionsbiologen und Ameisenforschers E. O. Wilson geprägt – und insbesondere für die genozentrischen Sichtweisen à la Richard Dawkins, die er in seinem Buch „The Selfisch Gene“ von 1976 popularisierte (s.u.). Beiden Autoren ging es insbesondere auch darum die vorher vertretene Hypothese zu „widerlegen“, dass soziobiologische Phänomene wie Altruismus auf eine Gruppenselektion im Sinne eines „zum Wohle der Gruppe“ (Wynne-Edwards 1962) zurückzuführen sind (s.o.). Verwirrender- und „unglücklicherweise“ verwendete aber Wilson für seine auf Verwandtschaft basierenden Sichtweisen leider auch den Begriff „Gruppenselektion“. Etwa 30 Jahre (!) nach der sehr einflussreichen Veröffentlichung von „Sociobiology” hat E. O. Wilson (und andere) seine Ansicht zum Thema – „und das muss man erst mal bringen“ – allerdings inzwischen deutlich geändert und tritt nun „vehement“ für eine sogenannte Multilevel-Selektion (s.u.) ein, die auch eine Selektion auf der Ebene von Gruppen einschließt. Wilson & Wilson 2007. Rethinking the theoretical foundation of sociobiology. The Quarterly Review of Biology, 82, 327–48): “Multilevel selection theory (including group selection) provides an elegant theoretical foundation for sociobiology in the future, once its turbulent past is appropriately understood.”. Hier geht es allerdings nicht um eine (abzulehnende) „naïve group selection“ gleichsam in der Population „zum Wohle der Gruppe“ entstehend, sondern hier liegt der Fokus auf einer “between-group selection“. (Das Thema „Gruppenselektion“ wird aber sicherlich noch länger kontrovers diskutiert.) ♦ Verwandtenselektion & Eusozialität. Mit der Verwandtenselektion kann möglicherweise auch die evolutive Entstehung von Eusozialität erklärt werden: Der Begriff meinte ursprünglich das Sozial- und Fortpflanzungssystem staatenbildender Insekten (z.B. Termiten, Hymenopteren wie Ameisen, Bienen und Wespen). Als eusozial gelten daneben unter anderem auch die Nacktmulle. Folgende Bedingungen müssen für echte Eusozialität erfüllt sein: Nur ein Weibchen (Königin), oder wenige pflanzen sich fort, die meisten Nachkommen der Königin sind reproduktiv altruistisch, Nachkommen verlassen die Familie nicht (Multigenerationsfamilie) und häufig herrscht eine Arbeitsteilung vor (Ammen, Soldaten, Arbeiter). Bei den Arbeiterinnen der Bienen (und auch bei anderen Hymenopteren) beträgt der Verwandtschaftskoeffizient r durch Haplodiploidie 0,75: Die Arbeiterinnen haben alle einen Vater, der aus einem unbefruchteten (unreduzierten) Ei hervorgegangen ist. In dieser nahen Verwandtschaft zwischen den Arbeiterinnen sah Hamilton (1964) die Ursache für die Evolution von Eusozialität. Tatsächlich haben aber bei einigen Arten nicht immer alle Arbeiterinnen alle einen gemeinsamen Vater und sind also deutlich weniger verwandt miteinander sind da, sich die Königin auf ihrem Hochzeitsflug mit mehreren Männchen paart. Da darüber hinaus Staatenbildung auch bei diploiden Termiten vorkommt, wurde in der Folgezeit angenommen, dass die nahe Verwandtschaft für die Evolution von Eusozialität wohl keine wesentliche Rolle spielt (E. O. Wilson & Hölldobler 2005). Andere neuere Befunde sprechen allerdings evtl. auch wieder eher für Hamiltons These: Das ursprüngliche Paarungssystem der eusozialen Insekten war wohl die Monogamie: Hughes et al. 2008. Ancestral Monogamy Shows Kin Selection Is Key to the Evolution of Eusociality. Science 320, 1213−1216. Monogamie, Monogamie mit Helfern und Eusozialität können also evtl. als ein „Kontinuum“ betrachtet werden. ♦ 5 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2015/2016 | A. Franzke & M. Koch Monogamie mit Helfern. Ein monogames Paarungssystem bietet „gute Voraussetzungen“, dass eigene Nachkommen Helfer bei der elterlichen Fürsorge werden: Der Verwandtschaftskoeffizient r zu jüngeren Geschwistern beträgt hier 0,5, was ja dem Verwandtschaftskoeffizienten zu eigenen Kindern entspricht. Beim Europäischen Biber (Castor fiber) sind adulte Nachkommen (unter Einbuße direkter Fitness) eine Zeit lang Helfer. Wie schon angedeutet, kann solch ein reproduktiver Altruismus „besser“ verstanden werden, wenn man die Verhältnisse vom „Standpunkt der Allele“, statt vom Standpunkt „Individuum“ betrachtet, man also eine genozentrische Sichtweise einnimmt. ♦ Altruismus bei Pflanzen? Auch von Pflanzen wurden „Verhalten“ berichtet, bei denen Verwandtschaft anscheinend eine Rolle spielt. Bei Experimenten mit der annuellen Cakile edentula (Brassicaceae, N-Amerika) zeigte sich, dass die Pflanzen offensichtlich nah verwandte Individuen erkennen können: In einem gemeinsamen Topf mit Fremden wurde vergleichsweise mehr Wurzelmasse produziert („below-ground competitive ability“): Dudley & File 2007. Kin recognition in an annual plant. Biology Letters 3, 435−438. Bei ähnlichen Experimenten mit einem Springkraut aus NAmerika zeigte sich neben solch einer „belowground competition“, dass nah verwandte Pflanzen in einem gemeinsamen Topf vergleichsweise längere und verzweigtere Stängel angelegt haben, die zu weniger gegenseitiger Beeinträchtigung führen („cooperation“). Guillermo & Murphy 2009. Kin recognition: Competition and cooperation in Impatiens (Balsaminaceae). American Journal of Botany 96, 1990−1996. An einer Stelle formulieren die Autoren vorsichtig „Are these potentially altruistic responses?“. In einem ganz anderen Zusammenhang taucht der Begriff „Altruismus“ bei Pflanzen auch noch auf: Für den Evolutionsbiologen William E. Friedman ist das durch doppelte Befruchtung hervorgegangene Endosperm der Angiospermen gleichsam ein „altruistischer Embryo“: Friedman 1995. Organismal duplication, inclusive fitness theory, and altruism: Understanding the evolution of endosperm and the angiosperm reproductive syndrome. PNAS 92, 3913−3917. ♦ Kooperationen zwischen Unverwandten − Reziproker Altruismus. Die Theorie der inklusiven Fitness (s.o.) kann mit der Verwandtenselektion eine Reihe von Phänomenen der sozialen Evolution sehr gut erklären. Es gibt im Organismenreich aber auch Kooperationen zwischen nicht-verwandten Individuen. Die Evolution solcher Verhaltensweisen kann durch natürliche Selektion mit dem Konzept des reziproken Altruismus erklärt werden: Trivers 1971. The evolution of reciprocal altruism. Quarterly Review of Biology 46, 35–57. Abwechselnd sind die beteiligten Individuen Geber (Altruist) bzw. Empfänger (Nutznießer). Die Gesamtkosten des reziprok altruistischen Verhaltens sind kleiner als der Gesamtnutzen. Damit so eine Beziehung langfristig aufrechterhalten werden kann, müssen Mechanismen vorhanden sein um Betrüger zu erkennen. Die Evolution von Kooperationen wurden später auch mit spieltheoretischen Ansätzen im Kontext des Gefangenendilemmas (s.o.) behandelt (TIT-FOR-TAT-Strategie): Axelrod & Hamilton 1981. The Evolution of Cooperation. Science 211, 1390–96. Ein gleichnamiges Buch erschien 1984: Der Autor Robert M. Axelrod (*1943) ist ein USamerikanischer Politikwissenschaftler. Verhaltensweisen von sozialer Körperpflege („allogrooming“), die bei Primaten vorkommen, sind Beispiele für solche reziproken Altruismen. ♦ Gene & Phänotyp − Genozentrismus. Evolution kann als nie endendes Spiel betrachtet werden (s.o.). Aus klassischer (neo)darwinistischer Sicht sind die Spieler die Individuen bzw. Phänotypen mit ihren Genotypen. Die Ausführungen zur inklusiven Fitness bzw. Verwandtenselektion (s.o.) legen es nahe, die Sache evtl. andersherum zu betrachten: Spieler können ja auch die Genotypen mit ihren Phänotypen sein (Einheiten der Selektion, s.o.). Eine solche, genozentrische Sichtweise wurde stark durch den britischen Evolutionsbiologen Richard Dawkins (*1941) propagiert und vor allem popularisiert: 1976 erschien sein einflussreiches Buch „The Selfish Gene“, wirklich ein faszinierendes Buch eines jüngeren Mannes mit Witz und Leidenschaft. Pflichtlektüre! Die Spieler sind hier also „egoistische Gene“, besser gesagt Allele (!), die konkurrieren. Die Allele sind für Dawkins immaterielle Informationseinheiten („Replikatoren“) und der Körper, der diese Allele trägt, ist eine „survival machine“, der Phänotyp ist also „lediglich“ das „Vehikel“ des Genotyps. In welchem individuellen Körper die Allele „stecken“, ist dabei irrelevant. Richard Dawkins ist ein, vielleicht manchmal auch schon etwas zu aggressiv-sendungsbewusster Atheist. Auf Youtube gibt es so einige Videos, die ihn – rhetorisch „verdammt“ geschickt – in öffentlichen Diskussionen in dieser „Mission“ zeigen. ♦ Erweiterter Phänotyp. Seine „streng“ genozentrische Sicht der Dinge führte Dawkins in seinem 1982 erschienen Buch „The Extended Phenotype“ weiter aus. Zunächst lautete der Untertitel „The Gene as the Unit of Selection“, später dann “The Long Reach of the Gene” (deutsche Ausgabe 2010: „Der erweiterte Phänotyp − Der lange Arm der Gene“). Der neodarwinistische Phänotyp ist die Summe aller äußeren Merkmale eines Genotyps bzw. Individuums, der erweiterte Phänotyp umfasst die Summe aller (!) Effekte eines Allels, die auch Effekte außerhalb des eigenen Körpers sein können, die insbesondere durch Allele für bestimmte Verhaltensweisen bedingt sind. (Dawkins 1982: „All effects of 6 Skript zur Vorlesung „Allgemeine Evolutionsbiologie“ | WS 2015/2016 | A. Franzke & M. Koch a gene [im Sinne von Allel] upon the world”. Erweiterte Phänotypen sind z.B. Vogelnester, Biberdämme oder Spinnennetze. ♦ Erweiterter Phänotyp − Parasitismus. Fälle, bei denen Allele von Parasiten den Phänotyp von Wirten (Verhaltensweisen) zur eigenen Fitnesssteigerung beeinflussen, sind besonders eindrucksvolle Beispiele für erweiterte Phänotypen: Fische, deren Augenlinsen von Diplostomum-Saugwürmern parasitiert sind, halten sich in der Nähe der Wasseroberfläche auf, wo sie Beute von Wasservögeln werden, in denen der Parasit seinen Entwicklungszyklus beendet. Zerkarien (Larvenform) des kleinen Leberegels (Dicrocoelium dendriticum) manipulieren die von ihnen befallene Ameise so, dass diese auf Grashalme etc. klettern und sich dort durch einen Mandibelkrampf festbeißt und so mit größerer Wahrscheinlichkeit von Wiederkäuern (Endwirt) gefressen wird. (Vor der Ameise gibt es noch ein Stadium in Schnecken.) ♦ Aufgaben ♦ Woran starb Hamilton? ♦ Welchen Verwandtschaftsgrad hat man zu sich selbst, welchen zu einem eineiigen Zwilling? ♦ Sie haben die Wahl Ehefrau bzw. -mann und einziges Kind oder 2 Brüder zu retten. Welche Wahl sollten sie aus „evolutionärer Sicht“ treffen? ♦ Lesen Sie doch einfach mal das „Egoistische Gen“ in den Weihnachtsferien . ♦ Was versteht Dawkins unter einem „Mem“? ♦ 7