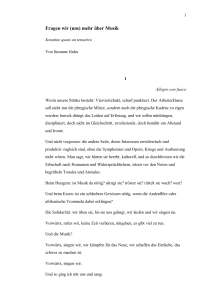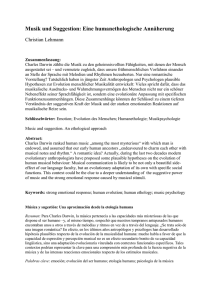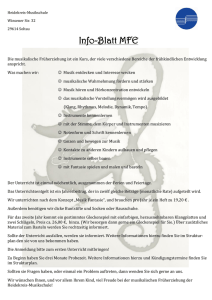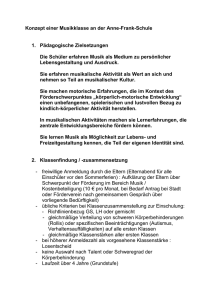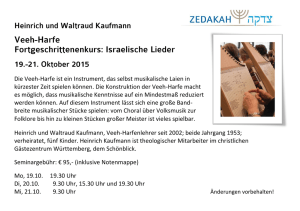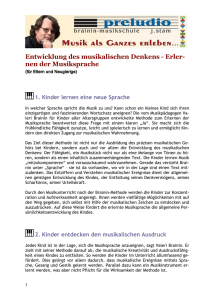Erkenntnisse der Neurowissenschaften und der Musikpsychologie
Werbung

Erkenntnisse der Neurowissenschaften und der Musikpsychologie und ihre didaktischen Implikationen für improvisatorisches Gestalten im Musikunterricht Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades „Magistra artium“ an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz vorgelegt von Christina Eckert Matrikelnummer: 0800823 Studienkennzahl: V 190 593 344 B Diese Arbeit wurde im Rahmen des Lehramtsstudiums für Musikerziehung am Institut für Musikpädagogik unter der Betreuung von Ao.Univ.Prof. Mag.art. Dr.phil. Bernhard Gritsch verfasst. Graz, Juni 2015 ng Errklärun Hiermit bestä ätige ich, dass d mir d der Leitfad den für sch hriftliche A Arbeiten an n der KUG G bekannt ist und ich h diese Ric chtlinien ein ngehalten habe. Graz, d den 10.06.2 2015 ……………… ……………… ……………… ………. ……… Untersschrift der Verfasserin V / des Verfasssers ABSTRACT Improvisatorisches Gestalten ist von entscheidender Bedeutung für den Musikunterricht und kann als Kernthema dieser Arbeit betrachtet werden. In diesem Zusammenhang sollen die folgenden Ausführungen als grundlegende methodische Anregungen für einführende Übungen in improvisatorisches Musizieren dienen. Um eine adäquate Umsetzung von improvisatorischen Aktivitäten im Unterricht zu gewährleisten, wird diese Arbeit in zwei Teilen präsentiert: Grundlegende Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der Musikpsychologie werden im ersten Abschnitt thematisiert, um daraus resultierende Schlussfolgerungen für das Unterrichten in Hinblick auf improvisatorisches Klassenmusizieren ableiten zu können. Anschließend beinhaltet der zweite Teil, ausgehend von Begründungsansätzen für die Integration von improvisatorischen Tätigkeiten im Musikunterricht, eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf allgemeine methodische Überlegungen, welche bei der Unterrichtsplanung für improvisatorische Übungen von Bedeutung sein könnten. Darauf aufbauend folgen Umsetzungsbeispiele mit weiterführenden Anregungen für das gemeinsame Musizieren. This paper focuses on improvisational techniques and the importance of their integration in music lessons in public schools. The first part should serve as a basis for designing adequately structured exercises that can be used for introducing the act of musical improvising. Therefore, this part provides an overview of scientific findings concerning neurological functions, which are essential for making music, and knowledge taken from the field of music psychology. Based on these findings, the second part comprises methodical implications relevant for planning and conducting a lesson including improvisational techniques. The following practical exercises should function as examples of the various forms of implementation of improvisation tasks in music lessons. I VORWORT Der Aufbau und der inhaltliche Bezug meiner Arbeit können als eine Widerspiegelung meiner Interessen angesehen werden: Wissenschaftliche Erkenntnisse bilden die Basis für weiterfolgende Aufgaben und Strukturierungsansätze für das Unterrichten, in diesem Fall für den Musikunterricht. Im Allgemeinen bin ich der Überzeugung, dass grundlegende Kenntnisse über neurologische und musikpsychologische Prozesse bei der Unterrichtsplanung von großem Nutzen sein können. Im Zuge der Recherchen für diese Arbeit habe ich sehr viel über hirnphysiologische Mechanismen von Lehr- und Lernvorgängen und mögliche Einflussfaktoren in Erfahrung bringen können, was ich für mich persönlich und auch für meine zukünftigen Schülerinnen und Schüler nutzen möchte. Selbst wissenschaftliche Annahmen über Verarbeitungs- und Speicherungsmechanismen mit den Lernenden auszutesten ist eines der Dinge, die ich gerne in meinen Unterricht miteinbeziehen würde. In diesem Zusammenhang möchte ich eine besonders wichtige Erkenntnis hervorheben: Auch wenn es möglich ist bestimmte Vorgänge des menschlichen Gehirns zu erklären, sind die individuellen Einflussfaktoren, welche noch nicht zur Gänze perzeptibel sind, von entscheidender Bedeutung. Grundlagenwissen über neurobiologische Vorgänge kann also von großem Vorteil für die Unterrichtsplanung sein, sollte aber dennoch selbstüberprüfend eingesetzt werden. An dieser Stelle möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die mich beim Verfassen dieser Arbeit unterstützt haben: Mein Betreuer Dr. Bernhard Gritsch war für mich eine sehr große Hilfe sowohl bei der Themenfindung, als auch bei der inhaltlichen Umsetzung meiner Arbeit. Durch seine motivierenden Worte hat er mich nicht nur inhaltlich in meinem Tun bekräftigt. Ein großer Dank gebührt auch Patrick Pucher, der mich nicht nur durch sein aufmunterndes Feedback und Korrekturlesen unterstützt, sondern sich auch als Diskussionspartner für inhaltliche Unstimmigkeiten zur Verfügung gestellt hat. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei meinen Eltern Margot und Werner Eckert, die mich in meinen Wünschen und Zielen immer tatkräftig und aufopfernd unterstützt haben. Das Studium wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Diese Arbeit ist euch gewidmet. II INHALTSVERZEICHNIS Einleitung .........................................................................................................................1 TEIL I: Grundlagen ........................................................................................................3 1. Wahrnehmung .............................................................................................................3 1.1 Neurobiologische Grundlagen ..................................................................................3 1.2 Hören und Sehen .......................................................................................................6 1.2.1 Die auditorische Wahrnehmung ..........................................................................6 1.2.1.1 Die Physiologie des Ohrs ...............................................................................6 1.2.1.2 Vom Ohr zum Gehirn: Neuronale Informationsverarbeitung ........................8 1.2.2 Die visuelle Wahrnehmung .................................................................................9 1.2.3 Allgemeine Gruppierungsvorgänge ...................................................................10 1.3 Die Wahrnehmung im musikalischen Kontext .......................................................11 1.3.1 Grundlegende Prozesse der Wahrnehmung .......................................................13 1.3.2 Musikalische Kategorien der Wahrnehmung ....................................................16 2. Gedächtnis ..................................................................................................................17 2.1 Multiple Gedächtnissysteme ...................................................................................18 2.1.1 Zeitstruktur und Gedächtnis ..............................................................................19 2.1.2 Inhaltliche Speicherung .....................................................................................20 2.2 Allgemeine Gedächtnisprozesse .............................................................................21 2.3 Musik und Gedächtnis ............................................................................................23 2.3.1 Beteiligte Hirnstrukturen ...................................................................................23 2.3.2 Mögliche Einflussfaktoren der Speicherung in musikalischer Hinsicht............25 3. Allgemeine Einflussfaktoren ....................................................................................28 3.1 Aufmerksamkeit ......................................................................................................29 3.1.1 Selektion ..................................................................................................................... 29 3.1.2 Vigilanz..............................................................................................................31 3.2 Emotionen ...............................................................................................................33 3.2.1 Neurobiologische Grundlagen ...........................................................................34 3.2.2 Emotionaler Einfluss auf kognitive Prozesse ....................................................34 3.3 Motivation ...............................................................................................................39 3.3.1 Das Belohnungssystem und Aktivierungsbeispiele ...........................................40 3.3.2 Motivationsarten ................................................................................................42 3.3.2.1 Intrinsische Motivation ................................................................................43 3.3.2.2 Extrinsische Motivation ...............................................................................43 3.3.2.3 Leistungsmotivation .....................................................................................46 3.3.3 Psychologische Grundbedürfnisse .....................................................................47 3.3.4 Fazit ...................................................................................................................48 3.4 Kreativität................................................................................................................49 3.4.1 Neurobiologische Hintergründe.........................................................................50 3.4.2 Der kreative Prozess anhand von musikalischen Beispielen .............................52 4. Motorik ................................................................................................................................. 55 III TEIL II: Interpretation .................................................................................................58 1. Einleitung ...................................................................................................................58 1.1 Begründungsaspekte ...............................................................................................60 1.2 Begriffseingrenzung ................................................................................................66 2. Didaktische Implikationen........................................................................................67 2.1 Voraussetzungen .....................................................................................................67 2.1.1 Strukturbildung von außen und innen................................................................67 2.1.2 Die Wirkung von Emotionen .............................................................................73 2.1.3 Motivation fördern .............................................................................................75 2.2 Anwendungsbeispiele .............................................................................................78 2.2.1 Aufwärmphase ...................................................................................................79 2.2.2 Kategoriale Phase ..............................................................................................85 2.2.3 Improvisatorische Phase ....................................................................................95 3. Zusammenfassung ...................................................................................................102 Resümee ........................................................................................................................105 Literaturverzeichnis ....................................................................................................107 Anhang..........................................................................................................................112 IV Einleitung Wissenschaftliche Erkenntnisse entfalten neben ihrer erkenntnistheoretischen Legitimierung dann besondere Bedeutung im musikpädagogischen Bereich, wenn sie die tägliche Vermittlungsarbeit theoriegeleitet verbessern helfen und das gewonnene Wissen somit für die Erklärung und Veränderung des Bestehenden gebraucht werden kann. Von eminenter Wichtigkeit sind die Beobachtungen hinsichtlich neurologischer Gehirnprozesse, da durch diese entscheidende Implikationen für das alltägliche Leben abgeleitet werden können. Lernen ist in diesem Zusammenhang als ein essentieller Bestandteil unseres Daseins zu betrachten, zurückzuführen auf die Tatsache, dass nur durch das Speichern von neuen Inhalten, deren Vernetzung und deren Abrufen und zielgerichteten Verwendung Weiterentwicklung in jedem Sinne ermöglicht wird. Die Konsequenzen sind zahlreiche Untersuchungen der zugrundeliegenden Abläufe von Aufnahme- und Speicherungsprozessen, um diese erklären und schlussendlich optimieren zu können. Von besonderer Wichtigkeit für mich als Pädagogin sind die resultierenden Erkenntnisse für den Unterricht: Sind sich Lehrpersonen über die neurobiologischen Grundlagen von Gehirnprozessen bewusst, können diese bestmöglich in die Unterrichtsplanung miteinbezogen werden. Generell ist allerdings zu bemerken, dass die Entschlüsselung des menschlichen Systems noch nicht vollkommen gelungen ist. Ob dieses positive oder negative Konsequenzen mit sich ziehen könnte, liegt im Auge des Betrachters. Da sich das Lernen im Unterricht nicht nur auf fächerbezogene Inhalte beschränkt, sollte dieser Aufgaben und Übungen enthalten, die auch soziale und persönliche Faktoren fördern. In Hinblick auf den Musikunterricht sind deshalb neurobiologische Erkenntnisse der Musikaufnahme und -verarbeitung als Grundlage für die Vielfältigkeit der zu integrierenden Elemente zu sehen. Improvisatorisches Gestalten bildet eine Möglichkeit nicht nur musikalische Inhalte zu vermitteln, sondern auch auf persönlichkeitsbezogene sowie soziale Merkmale und Eigenschaften einzugehen. Freies Musizieren beinhaltet unzählige positive Auswirkungen auf die Lernenden und wird deshalb Thema der folgenden Abhandlungen sein. Zu Beginn werden grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse hinsichtlich der Musikaufnahme, -verarbeitung und -produktion erläutert, um auf die resultierenden didaktischen Implikationen für improvisatorisches Gestalten eingehen zu können. Die Vielfältigkeit des Improvisationsbegriffs erfordert in diesem Zusammenhang eine 1 Eingrenzung, welche zu Beginn des zweiten Teils den Integrationsbegründungen für den Musikunterricht folgen wird. Sowohl der wissenschaftliche als auch der interpretatorische Teil dieser Arbeit beinhalten jeweils eine Einleitung, welche Aufschluss über die darauffolgenden Inhalte und deren Strukturierung geben soll. Ein Vermerk zur Schreibweise: Es wurde im Sinne einer besseren Lesbarkeit des Textes darauf verzichtet, männliche und weibliche Formen (z. B. Lehrer/in, Schüler/in) zu verwenden. Im Folgenden wird von der gängigen Variante, sich auf die kürzere und scheinbar prägnante männliche Form zu beschränken, abgesehen. Zum Zwecke der Abwechslung werden in dieser Arbeit mit der weiblichen Form sowohl Frauen als auch Männer angesprochen, was in keiner Weise diskriminierend oder wertend für ein Geschlecht gesehen werden soll. 2 TEIL I: Grundlagen Der folgende Überblick hinsichtlich der wissenschaftlichen Grundlagen für improvisatorisches Gestalten ist in unterschiedliche Abschnitte geteilt, bestehend aus allgemeinen und musikbezogenen Erkenntnissen der Wissenschaft in Hinblick auf verarbeitende neuronale Strukturen und mögliche Einflussfaktoren. Begonnen wird mit einer einleitenden Erläuterung der neurobiologischen Grundlagen, um die wahrnehmungsbezogenen Hirnstrukturen, wie die Hör- und Sehvorgänge, entschlüsseln zu können. Die bedeutende Verbindung zu Gedächtnisprozessen wird im darauffolgenden Kapitel, welches eine Beschreibung der Speicherungsvorgänge beinhaltet, gezeigt. Im Anschluss folgen mögliche Einflussfaktoren in Bezug auf die zuvor beschriebenen Prozesse. Neben Wahrnehmungs- und Gedächtnisvorgängen ist die motorische Umsetzung auch ein wichtiger Faktor, da improvisatorisches Gestalten auch das Musizieren mit Instrumenten beinhalten sollte. Als Abschluss wird deshalb auf die Motorik und dessen Verarbeitungsmechanismen eingegangen, bevor im zweiten Teil die daraus resultierenden didaktischen Implikationen behandelt werden können. 1. Wahrnehmung 1.1 Neurobiologische Grundlagen Nervensystem Das Nervensystem ist die übergeordnete Steuerzentrale im menschlichen Körper und kontrolliert somit die Aufnahme, Verarbeitung, Weiterleitung und Speicherung von eintreffenden Reizen und Informationen. Anatomisch lässt sich dieses in das Zentralnervensystem, bestehend aus Gehirn und Rückenmark, und das periphere Nervensystem, dem Gehirn und Rückenmark entspringenden Nerven, einteilen. Funktionell sind beide Systeme miteinander verbunden, lassen sich aber wieder in unterschiedliche Zusammensetzungen aufteilen. Das Somatische Nervensystem verarbeitet eintreffende Reize, sowohl von außen als auch von innen, und bildet die Verbindung von Reizentschlüsselung im Zentralnervensystem zu den einzelnen Körperregionen und Organen. Die Steuerung der körperinternen Organvorgänge wie Kontrolle über Herz-, Kreislauf- und Atemfunktionen werden durch das vegetative Nervensystem unbewusst an die Umwelterfordernisse angepasst.1 1 Vgl. Faller/Schünke (2012), S. 604-611 und Lucius/Schwegler (2011), S. 90-105. 3 Da das Nervensystem Informationen in Form von elektrischen Potentialen verarbeitet, müssen eintreffende Reize, die entweder mechanischer, thermischer oder chemischer Natur sind, umgewandelt werden. Nach der Reiztransformation durch die Sinneszellen werden diese mit Hilfe von Nervenfasern zum nächsten Neuron weitergeleitet. Diese Informationsübertragung ist nur möglich durch das Entstehen eines Aktionspotentials im Zellkern, ausgelöst durch ein sich änderndes Zellmembranpotential, was elektrische Spannung zur Folge hat. Das Aktionspotential einer Zelle setzt sich entlang des Zellfortsatzes (Axon) fort und wird über einen hauptsächlich chemo-elektrischen Prozess der angrenzenden Synapsen weitergeleitet. Dieser chemische Prozess wird durch die Weitergabe von Botenstoffen, so-genannten Neurotransmittern, durchgeführt. Die Transmittermoleküle heften sich dabei an die darauffolgende Zellmembran und erzeugen abhängig vom Molekül ein positives oder negatives Potential in der Zielzelle. Das Resultat dieser elektrischen Entladung ist ein „[…] neuronales Aktivitätsmuster, das Millionen von Nervenzellen miteinander koordiniert.“2 Entscheidend dabei ist, dass die Vielfalt an Reizen durch diese hochkomplexen Erregungsmuster in eine einheitlich neuronale Sprache übersetzt wird.3 Großhirnrinde Die Großhirnrinde ist die kognitive Schaltzentrale des Gehirns und kontrolliert somit die Wahrnehmung, das Denken, das Sprechen und das Verhalten. Sie macht etwa die Hälfte des gesamten Hirnvolumens aus und wird in zwei annähernd symmetrische Hirnhälften, die über den Balken verbunden sind, gegliedert. Jede dieser Hemisphären kann wiederum in vier Lappen unterteil werden, die ihren Namen den darunter liegenden Schädelknochen zu verdanken haben.4 Die sich an der Oberfläche befindlichen Lappen gliedern sich in Stirnlappen (Frontalkortex), Schläfenlappen (Temporalkortex), Scheitellappen (Parietalkortex) und Hinterhauptslappen (Okzipitalkortex). Diese beinhalten unterschiedlichste Funktionen: der Frontalkortex ist das Zentrum der Handlungsplanung und verantwortlich für sprachliche und gestische Ausdrucksformen, Bewegungsabläufe und die Lenkung der Aufmerksamkeit. Dahinter befindet sich der Parietalkortex, der die sensorische Informationsintegration zugunsten der räumlichen Orientierung steuert. Die primären 2 Brandstätter (2004), S. 140. Vgl. Brandstätter (2004), S. 143. 4 Vgl. Altenmüller (2006), S. 50. 3 4 und sekundären Verarbeitungszentren visueller Informationen befinden sich im Okzipitalkortex, der über dem Kleinhirn und hinter dem Parietalkortex zu finden ist. Die auditiven Zentren befinden sich unter dem Frontal- und Parietallappen und somit im Temporalkortex, welcher nicht nur für die Verarbeitung von Emotionen zuständig ist, sondern auch den Hippocampus, der die Verantwortung für Gedächtnisprozesse trägt, beinhaltet.5 Funktionell betrachtet kann die Großhirnrinde in sensorische- und Assoziationsareale gegliedert werden, welche sich in jedem Lappen des Neokortexes wiederfinden. Die sensorischen Felder, auch primäre Rindenfelder genannt, werden wiederum in den visuellen, den auditorischen, den somatosensorischen und den motorischen Kortex untergliedert. Wenn Sinneseindrücke von den Sinnesorganen in die jeweiligen zuständigen Felder weitergeleitet werden, aktivieren diese ganz bestimmte Teile des jeweiligen Kortex. Das resultiert aus der Tatsache, dass jede Körperregion auf einem bestimmen Kortexareal repräsentiert wird. Die Teile der Großhirnrinde, die die Informationen aus den primären Rindenfeldern oder aus sensorischen und motorischen Regionen abstrahieren und weiter verwalten sind die Assoziationsfelder. Diese als sekundäre oder tertiäre Kortexfelder bezeichneten Areale nehmen achtzig Prozent des Neokortex ein und sind für die sinnvolle Koordination von bereits encodierten Reizen zuständig.6 Das Großhirn ist im Allgemeinen ein mehrdimensionales Verarbeitungssystem, welches sich durch die sowohl parallelen und vielfach verschalteten, aber auch rückläufigen Verbindungen zwischen Rezeptoren und Sinnesorganen auszeichnet. Dieses System ist keineswegs von Geburt an festgelegt; im Gegenteil, seine Anpassungsfähigkeit oder Plastizität ermöglicht es dem Organismus, auf Veränderungen in seiner Umgebung zu reagieren. Es kann sich dabei eine Modifikationvon Nervenzellen bis zu ganzen Gehirnarealen ereignen, um so entweder Verletzungen des Gewebes auszugleichen oder einzelne Areale zu erweitern. Altenmüller beschreibt das mit einem idealen Beispiel: „Wenn musikalisches Üben in früher Jugend beginnt und konsequent fortgesetzt wird, sind beispielweise die beteiligten sensomotorischen und auditiven Hirnregionen vergrößert.“ 7 Die Tatsache, dass eine Erweiterung von Gehirnarealen durch 5 Vgl. Altenmüller (2006), S. 50. Vgl. Behrends/Bischofberger/Deutzmann (2012), S. 755-757. 7 Altenmüller (2006), S. 52. 6 5 entsprechende Reizung und Übung erzielt werden kann, zeigt, dass die Plastizität des Großhirns die Grundlage aller Lernprozesse ist.8 1.2 Hören und Sehen Ein entscheidender Faktor für die Wahrnehmung von Musik im Allgemeinen ist das Hörorgan. So trivial wie diese Feststellung auch scheinen mag, sind die Prozesse die von einem gesunden, funktionsfähigen Hörorgan initiiert werden, nicht bloß auf akustische Reizverarbeitung reduziert. Musikhören als solches ist ein aktiver Prozess, der mehrere Areale und Schichten des Gehirns miteinbezieht und weit über die Entschlüsselung von akustischen Stimuli hinausgeht.9 Was der Mensch aus dem Gehörten macht, wie Musik entsteht, ist durchaus auch von anderen Faktoren abhängig. Wichtig dabei ist nicht nur der soziale Kontext und das dadurch erworbene Wissen, sondern auch subjektive Empfindungen, die sowohl Interesse als auch Aufmerksamkeit steuern und den „akustischen Wahrnehmungen eine Bedeutung geben.“10 Daher hört zwar jeder physiologisch dasselbe, verarbeitet dieses allerdings anders, beeinflusst durch individuelle Erfahrungen und dadurch entstandenes Vorwissen. Um nun die weiteren Einflussfaktoren in Bezug auf Musikhören und Musikverarbeitung erfassen zu können, sollten die physiologischen Grundlagen neuronaler Prozesse des tatsächlichen Hörvorgangs und als Ergänzung des Sehvorgangs aufgeschlüsselt und dargelegt werden. 1.2.1 Die auditorische Wahrnehmung 1.2.1.1 Die Physiologie des Ohrs Das Ohr ist ein hochkomplexes Organ, das sich in drei große Teile gliedern lässt: das äußere Ohr, das Mittelohr und das Innenohr. Im Allgemeinen werden Schallwellen empfangen, verstärkt und dann in elektrische Impulse umgewandelt und somit als Reiz im Gehirn verarbeitet.11 8 Vgl. ebd. und Brandstätter (2004), S. 143. Vgl. Gruhn (2005), S. 9. 10 Gruhn (2005), S. 12. 11 Vgl. Spitzer (2002), S. 56. 9 6 Die äußersten Teile des Ohres bilden Ohrmuschel und Gehörgang. Beim Hörvorgang treffen Schallwellen entweder direkt oder indirekt auf die speziell geformte Ohrmuschel und werden in den Gehörgang weitergeleitet. Diese Formung bewirkt, dass bereits zu Beginn der Schall räumlich loziert werden kann, abhängig davon, wie die Frequenzen auf die Ohrmuschel treffen. Zusätzlich kann durch die unterschiedliche Amplitudenstärke, ebenfalls beeinflusst von der Form der Ohrmuschel, der räumliche Ursprung der Schallwellen festgestellt werden. Dies kann damit erklärt werden, dass hohe Frequenzen abgeschwächt werden, wenn sie von hinten auf das äußere Ohr auftreffen. Demnach bewirkt dieses eine Veränderung der Amplitudenstärke und ermöglicht somit im Vergleich die Lokalisierung des Schallweges.12 Der Übergang vom äußeren Gehörgang zum Mittelohr bildet das Trommelfell. Wenn also Schall in den Gehörgang geleitet wird, trifft dieser auf das Trommelfell und wird durch dessen Schwingung mit Hilfe der drei Gehörknöchelchen an das ovale Fenster des Innenohrs weitergeleitet. Hammer, Amboss und Steigbügel bilden somit das Mittelohr und dienen sowohl zur mechanischen Verstärkung des Schalldrucks als auch als Schallschutz für das Innenohr. Zum einen wirken diese wie ein „Hebel: […] Relativ große kraftarme Schwingungen am Trommelfell werden in vergleichbare kleinere Schwingungen mit größerer Kraft umgewandelt“ 13 und zum anderen wie ein Schalldämpfer, wenn bei großer Schallbelastung die Muskeln an den Gehörknöchelchen angespannt werden und somit die Schallenergie abgedämpft wird. Nachweisbar ist, dass manche Menschen diese Muskelaktivität aktiv steuern und dabei die Lautstärke der Töne in beide Richtungen beeinflussen können. Das eigentliche Hörorgan befindet sich im Innenohr. Dieses beinhaltet die sogenannte Cochlea (dt. Schnecke) und die Bogengänge, aus welchen das Gleichgewichtsorgan besteht. Wenn Schall am Innenohr angelangt ist, wird er durch das ovale Fenster in einen der drei mit Wasser gefüllten Kanäle, den Scala vestibuli, weitergeleitet. Beeinflusst durch Amplituden und Frequenzen der Schallschwingungen bewirkt eine Flüssigkeitsverschiebung in der Schnecke, auch Wanderwelle genannt,eine Stimulation derinneren Haarzellen an der Basilarmembran in unterschiedlicher Weise und bildet somit die „Grundlage der gesamten Schallanalyse im auditorischen System.“ 14 Diese Stimulation bewirkt eine Veränderung in der Freisetzung von Ionen in der Haarzelle, 12 Ebd. Spitzer (2002), S. 57. 14 Spitzer (2002), S. 58. 13 7 was eine unterschiedliche Ionenkonzentration im Vergleich zum Äußeren der Zelle bewirkt. Die dadurch entstehende elektrische Spannung erzeugt in Verbindung mit den Bewegungen der Basilarmembran elektrische Impulse, die dann über die Hörnerven weitergeleitet werden.15 1.2.1.2 Vom Ohr zum Gehirn: Neuronale Informationsverarbeitung In Nervenimpulseumgewandelte Druckschwankungen gelangen in der Hörbahn durch Weiterleitung von Nervenfasern zur ersten Umschaltstation im Hirnstamm, dem Nucleus cochliaris.16 Die chemischen Impulse werden von Nervenzelle zu Nervenzelle über Synapsen weitergeleitet und durch die steigende Anzahl an Neuronen anhand der Hörbahn werden pro Station mehr Informationen extrahiert. Bis zum auditorischen Kortex in der Gehirnrinde werden also pro Teilbereich (Nucleus cochliaris, Olivenkern, Kniehöcker) in der Hörbahn mehr Schalleigenschaften wie Dauer, Tonhöhe und räumliche Herkunft definiert. Die Hörbahn ist also als solche keine simple Weiterleitung von Reizen, sondern durch ihren komplexen Aufbau mit Fasern und Nervenzellen aktiv an der tatsächlichen Informationsverarbeitung beteiligt.17 Angelangt in der primären Hörrinde, welche sich im Temporallappen befindet, werden nun die eingegangenen Impulse in Laute und Lautmuster genauer aufgeschlüsselt. Diese werden in die sekundäre Hörrinde weitergeleitet und dort zu sinnvollen Einheiten wie Wörtern oder Melodien zusammengefasst. Bei diesem Prozess werden sowohl auf die bereits im Hirnstamm gewonnenen Informationen als auch auf schon bekannte Sinneseindrücke zurückgegriffen. Der auf beiden Gehirnhälften gelegene auditorische Kortex beinhaltet somit mit der sekundären Hörrinde einen Assoziationskortex. 18 Entscheidende Aufgaben eines solchen Kortex werden von Reichert beschrieben als „selektive Aufmerksamkeit auf komplexe Reizkonfigurationen in der externen und internen Umwelt zu lenken, die Erkennung und Identifizierung dieser […] durchzuführen und die Planung von angemessenen Verhaltensreaktionen zu ermöglichen.“ 19 Um dieses tun zu können, wird auf andere assoziative Areale zugegriffen, um auch zusätzlich höhere Sinneseindrücke in die Interpretation einzubeziehen. 15 Vgl. ebd. Vgl. http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/cochleariskern/2288, 26.04.2015. 17 Vgl. Spitzer (2002), S .78. 18 Vgl. http://www.gehirnlernen.de/gehirn/das-gro%C3%9Fhirn/die-gro%C3%9Fhirnrinde-neo-oderisocortex/, 26.04.2015. 19 Reichert (2000), S. 168. 16 8 In Bezug auf die Verarbeitung der eingegangen Sinneseindrücke ist ein Unterschied hinsichtlich der beiden Gehirnhälften zu bemerken. Die sekundäre Hörrinde befindet sich sowohl auf der linken als auch auf der rechten Gehirnhälfte und obwohl immer beide an der Verarbeitung beteiligt sind, kann man doch eine gewisse Lateralisation feststellen. Diese manifestiert sich in den unterschiedlichen Verarbeitungsmustern und Funktionen der zwei Hemisphären. Die rationalen und analytischen Vorgänge sind eher der linken Gehirnhälfte zugeteilt, in welcher sich auch das sensorische Sprachzentrum befindet. Für die Empfindung von Musik ist somit eher die rechte Hälfte verantwortlich, in welcher die ganzheitliche und emotionale Analyse stattfindet.20 Obwohl eine große Tendenz einer links-lateralen Dominanz hinsichtlich Sprach- und Rechenaufgaben festgestellt werden kann, ist eine konstante Dominanzfunktion für Musikverarbeitung nicht vollständig nachweisbar. Dennoch konnte Altenmüller (1986) in einer Studie feststellen, dass Laien ohne musikalische Vorbildung eher zu einer Rechtslateralisation tendierten als professionelle Musiker. Dieses Phänomen könnte durch die Unterschiede in der Art der musikalischen Repräsentation erklärt werden. Dadurch dass professionelle Musiker das Gehörte durch Namen und Begriffe definieren können, liegt deren Analyse eher in der linken Gehirnhälfte im Gegensatz zu Laien, die die Eindrücke noch nicht formal aufschlüsseln können.21 1.2.2 Die visuelle Wahrnehmung Der Sehvorgang ist ein weiterer Teil der sensorischen Systeme, was die starke Ähnlichkeit der Verarbeitungsprozesse im Vergleich zum auditorischen System erklärt. In diesem Falle sind die Sehrezeptoren der erste Anlaufpunkt für die eintreffenden Reize: Licht wird durch die Linse nach dem Durchdringen der Hornhaut auf die Netzhaut projiziert und dort mithilfe von Photorezeptoren (Stäbchen und Zäpfchen) in neuronale Energie umgewandelt. Wieder werden Aktionspotentiale über die für den Sehsinn spezifischen Nervenfasern, den Ganglienzellen, zum zentralen Nervensystem transportiert. Der Transport erfolgt über drei verschiedene Nervenstränge, von welchen jeder eine andere Verarbeitungsweise aufzeigt. Die je nach Form, Bewegung und Farbe getrennten Systeme versorgen den visuellen Kortex mit der nötigen Information. Im Kortex angelangt werden die unterschiedlichen Reizinformationen in den entsprechenden rezeptiven Arealen verarbeitet. Die Neuronen in den Arealen sind in 20 21 Vgl. Brandstätter (2004), S. 143f. Vgl. Altenmüller (1986), S. 342-354. 9 Säulen, so-genannten Kolumnen, angeordnet. Nach dem die Reizeindrücke in diesen entschlüsselt wurden, können sie erst in übergeordneten Arealen mit einander in Verbindung gebracht werden.22 Die Art der Reizverarbeitung im visuellen Kortex, gleichzusetzen mit der des auditorischen Kortex, findet also in unterschiedlichen Subarealen statt, bevor die Ergebnisse dann effektiv koordiniert und gruppiert werden können. Dieser Vorgang erfolgt parallel: Die eintreffenden Reize werden bereits bei der Aufnahme gefiltert, im visuellen Kortex durch die Photorezeptoren, anschließend durch die spezifischen Nervenbahnen weiter zum Gehirn und zur Verarbeitung geleitet. Im Unterschied zu der sequenziellen Datenverarbeitung von Computern ist das menschliche Gehirn tatsächlich in der Lage, eine Fülle von Information parallel zu bearbeiten. Die Daten sind nun über Rezeptoren in das System aufgenommen und in den Subarealen analysiert worden. Um den Erkenntnissen daraus Bedeutung zu geben werden diese zu komplexeren Konfigurationen zusammengefasst. Dies geschieht nicht parallel, sondern in einem hierarchisch-sequentiellen Verarbeitungsprozess. Brandstätter beschreibt das anhand eines musikalischen Beispiels: „Elementare sensorische Informationen (wie z. B. einzelne Töne unterschiedlicher Tonhöhen) werden zu immer komplexeren Mustern zusammengefasst (die musikalische Wahrnehmung erfasst Motive und Themen und schreitet zu größeren musikalischen Zusammenhängen fort).“23 Dieser Vorgang der Organisation und Interpretation ist nicht nur auf den visuellen und auditorischen Kortex beschränkt, sondern findet auch in den zwei anderen sensorischen Systemen (olfaktorisch und somatosensorisch) statt.24 1.2.3 Allgemeine Gruppierungsvorgänge Wenn die von außen eintreffenden Reize in ihren Einzelheiten die Analyse durchlaufen haben, besteht die Notwendigkeit der Gruppierung, um ihnen Gestalt zu geben und weitere Interpretation zu ermöglichen. Erst dann entstehen Eindrücke, die mit Informationen aus den anderen Sinnesarealen ergänzt werden können. Obwohl der Vorgang der Gruppierung in den auditorischen und visuellen Wahrnehmungsprozessen 22 Vgl. Steiner-Welz (2005), S. 87. Brandstätter (2004), S. 149. 24 Vgl. Salzmann (2007), S. 319. 23 10 eingebettet ist, wurden die drei Grundprinzipien Nähe, Kontinuität und Ähnlichkeit noch nicht erwähnt.25 Die Gruppierung, die unser Wahrnehmungsapparat vollzieht, passiert unbewusst. Dinge, die anhand ihrer Entfernung gruppiert werden, unterliegen dem Prinzip der Nähe. Objekte mit gleicher beziehungsweise vergleichbarer Beschaffenheit werden dem Gesetz der Ähnlichkeit zugeschrieben und Koordination anhand von ununterbrochenen, kontinuierlichen Figuren und Begebenheiten beschreibt das Prinzip der Kontinuität. Diese drei Gesetzmäßigkeiten treffen sowohl auf das Sehen, abhängig von räumlichen Begebenheiten, als auch auf das Hören, abhängig von der zeitlichen Struktur, zu.26 1.3 Die Wahrnehmung im musikalischen Kontext Wahrnehmung ist im Allgemeinen abhängig von der Art der Repräsentation der Inhalte. Allgemeine Strukturen und Bilder, aber auch musikbezogene Inhalte wie Melodien werden in ähnlicher Weise in der Großhirnrinde repräsentiert. Wie bei der genaueren Erläuterung dieser festgestellt wurde, sind nicht nur die Verbindungsstrukturen zwischen den Neuronen der Erweiterung unterzogen. Ganze Netzwerke der Großhirnrinde können durch Verarbeitungsprozesse erweitert und ergänzt werden In musikalischer Hinsicht kann das gleiche Phänomen bemerkt werden. Vergleichbar mit anderen neuronalen Netzwerken existieren zum Beispiel eigene Aktivitätsfelder für die Repräsentation von Tönen. Dabei existieren Neuronen mit den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen. Einzelne sind nur für bestimmte Frequenzen verantwortlich, andere für deren Länge und weitere feuern nur, wenn bestimmte Töne eintreffen oder sich etwas ändert.27 In Hinblick auf die Wahrnehmung stellt sich dann die Frage, ob die musikalischen Neuronennetzwerkeeinem eigenen neuronalen Musikzentrum zugeordnet sind. Betrachtet man die Erkenntnisse der Forschung, kann man keine beständigen Resultate hinsichtlich eines eigenen Musikareals feststellen. Obwohl sich eine Tendenz hinsichtlich eines unterschiedlichen Verarbeitungsorts (linke oder rechte Hemisphäre) bei professionellen Musikern und Laien feststellen lässt, widersprechen einander die Erkenntnisse über Melodie- und Rhythmusverarbeitung. Ähnlich der Sprachverarbeitung, nimmt man an, dass Melodie eher links und Rhythmus eher rechts 25 Vgl. Spitzer (2002), S. 126-130 und Brach (2004), S. 4-9. Ebd. 27 Vgl. Spitzer (2002), S. 211f. 26 11 verarbeitet wird, was durch Fälle von Patienten mit spezifischen Hirnverletzungen versucht wird zu erklären. Obwohl Patienten mit einem isolierten rhythmischen oder melodischen Defizit beschrieben werden, gibt es auch einseitige Gehirnverletzungen, die Einfluss auf beide Parameter haben.28 Hinsichtlich dieser Erkenntnisse kann also auf kein spezifisches musikalisches Hirnareal geschlossen werden. Spitzer liefert dafür eine umfassende Erklärung: Ohne jegliche bewusste Anstrengung kann fast jeder beim Hören von Musik die räumlich-zeitlichen Muster von an das Ohr dringender mechanischer Energie in Melodien, Harmonien und Rhythmen übersetzen. Er benutzt hierfür ein hohes Maß an gespeicherten Informationen über harmonisch schwingende Körper, Tonverhältnisse, Tonalität und wird zudem an frühere Erlebnisse erinnert sowie in eine bestimmte Stimmung versetzt. Macht jemand Musik, so ist […] oft sein ganzer Körper „dabei“.29 Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Art und Weise, wie Musik in unseren Köpfen aufgenommen, entschlüsselt und repräsentiert wird, Einfluss auf weitere Reaktionen und Sinneseindrücke ausübt. Musik ist also in ihrer Verarbeitung und Repräsentation ganzheitlich.30 Ausgehend von dieser musikalischen Ganzheitlichkeit kann nun angenommen werden, dass die Wahrnehmung von Musik nicht nur auf Reizaufschlüsselung beruht. So komplex wie sich die nicht-musikalische Informationsverarbeitung zeigt, beruht auch die Wahrnehmung von musikalischen Inhalten sowohl auf den Prozessen des auditorischen Kortex als auch auf Assoziationen und Vorstellungen aus anderen Sinnesbereichen. Auch wenn viele Verarbeitungsvorgänge nicht bewusst ablaufen, kann man doch bemerken, wie musikalische Eindrücke mit Informationen aus anderen Arealen im Gehirn verknüpft werden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Assoziation von Musik mit Farben oder die Erinnerung an bestimmte Gerüche oder Orte bei musikalischenPhrasen. Diese Verknüpfungen zeigen, dass nur die Korrelation der Sinneseindrücke eine Gesamtheit in der Wahrnehmung der Wirklichkeit ermöglicht.31 Die Komplexität außergewöhnlich Bewusstsein zu und Unbewusstheit schwierig, holen. die Um der Verarbeitungsprozesse Leistungen allerdings des einen macht Wahrnehmungsapparats Einblick in die es ins internen Verarbeitungsmechanismen zu bekommen, werden die erforschten grundlegenden 28 Vgl. Spitzer (2002), S. 211f. Spitzer (2002), S. 212. 30 Vgl. Spitzer (2002), S. 169-209. 31 Vgl. Brandstätter (2004), S. 148f und Gruhn (2005), S. 13f. 29 12 Prozesse der Wahrnehmung aufgeschlüsselt. Hinsichtlich der Frage nach spezifischen musikalischen Mechanismen ist nochmals zu erwähnen, dass Musik als Kunst im Allgemeinen als eine Darstellung der Wirklichkeit beschrieben werden kann, die durch unsere Sinnesorgane genauso wie andere Reize aus der Umgebung wahrgenommen und verarbeitet wird. 32 In diesem Sinne ist die Darlegung der grundlegenden Wahrnehmungsmechanismen als eine Voraussetzung weiterer Erläuterungen zu sehen. 1.3.1 Grundlegende Prozesse der Wahrnehmung Wie sich schon bei der Aufschlüsselung des Hörprozesses gezeigt hat, kann man „die Wahrnehmung durch die Sinne als eine Konstruktionsleistung mit aktivem Charakter“33 beschreiben. Als Beispiel dient die Art und Weise wie Schall vom Ohr aufgenommen wird: Wie bei den Augen sind dabei Orientierungsbewegungen zu bemerken. Somit beginnt der Wahrnehmungsprozess bereits mit einer aktiven Selektion der zur Verfügung stehenden Reize. Entscheidend dabei ist, dass bei diesem Vorgang nicht nur Reize verarbeitet werden, sondern dass eine „Informationsgenerierung“ 34 stattfindet. Dadurch dass die Informationsaufnahme bereits durch die Sinnesorgane gelenkt wird, also ein Selektionsprozess hinsichtlich Relevanz und Wichtigkeit vollzogen wird, werden Daten bereits generiert. Die gefilterten Reize werden dann, bevor sie gespeichert werden können, einer Analyse unterzogen. Diese landen zunächst im sensorischen Speicher, dessen Kapazität zwar sehr groß, aber dessen Dauer sehr kurz ist. Dieses sensorische Gedächtnis ist nicht bewusst zugänglich und steuert die Analyse. Generell benötigt man Vergleichsparameter, um etwas auf seine Relevanz überprüfen zu können. Die Tatsache kommt auch in dieser Phase der Wahrnehmung zu tragen, was die Kenntnis von bereits existierenden Kategorien voraussetzt: Der Filter des Wahrnehmungsapparats kann nur funktionieren, wenn die Reize mit bereits vorhandenen Parametern und Strukturen verglichen werden können.35 Voraussetzung dafür ist der Speicher, der diese Kategorien beinhaltet: das Gedächtnis.36 Der letzte Schritt des Wahrnehmungsprozesses ist die Synthese. Bereits encodierte Reize werden nun anhand ihrer ähnlichen Beschaffenheit zu Merkmalskombinationen 32 Vgl. Brandstätter (2004), S. 155f. Brandstätter (2004), S. 150. 34 Ebd. 35 Vgl. Brandstätter (2004), S. 150. 36 Vgl. Tücke (2003), S. 141. 33 13 zusammengefasst. Dabei ist essenziell, dass in dieser Phase genau wie bei der Vorangegangenen kategorial gearbeitet wird. Wieder sind die Voraussetzungen bereits gespeicherte Strukturen, welche zur Identifikation der zusammenhängenden Elemente entscheidend sind. Brandstätter formuliert es so: „Wahrnehmung setzt […] Gedächtnis voraus. […] Erst der Vergleich ermöglicht die wahrnehmende Erkenntnis.“37 Nur durch bereits vorhandene Muster können die aktuellen Reize zu Merkmalskonfigurationen zusammengefasst werden. Strukturbildungsprozesse Die Voraussetzung für diesen dreiphasigen Wahrnehmungsprozess liegt somit in der Strukturbildung. Wie dargelegt, werden Reize schon zu Beginn vorgefiltert, bevor sie überhaupt im System einer Analyse unterzogen werden können. Dieser Filter sowie die Parameter für die Analyse sind abhängig von der Struktur- oder Musterbildung, die wiederum in unterschiedliche Vorgänge gegliedert werden kann.38 Der Kernpunkt der Strukturbildung liegt im Erfassen von Reizkonstanten, den Invarianten. Wenn ein Objekt in seiner raumzeitlichen Umgebung wahrgenommen wird, treffen unzählige und sich ändernde Sinneseindrücke ein, abhängig von Raum und Zeit. Vereinfacht gesagt: Je nachdem von welcher Entfernung oder zu welcher Tageszeit das Objekt betrachtet wird, werden unterschiedliche Reize aufgenommen. Trotzdem schafft es der Mensch „aus raumzeitlichen Veränderung Parameter einer höheren Ordnung zu abstrahieren, wie z. B. Reizproportionen, die konstant bleiben.“39 Parameter ergeben dann ein Muster, ein Konzept von dem Objekt, unabhängig von Einzelerfahrungen und unmaßgeblichen Reizen.40 Der Gegenpol zur Invariantenbildung, der Wahrnehmung von übergeordneten Konstanten, liegt in der Erkenntnis der Differenzen oder Varianzbildung. 41 Dieser Prozess hat das Ziel, einmalige Reizeindrücke in ihrer Gesamtheit zu erfassen und abzuspeichern. Während Invarianzen dazu dienen, Gesetzmäßigkeiten aufzustellen und die Konzeptbildung durch Abstraktion herbeizuführen, liegt die Aufgabe der Differenzierung beim Erfassen von Außergewöhnlichem in einer bestimmten Situation. 37 Brandstätter (2004), S. 151. Vgl. Brandstätter (2004), S. 150. 39 Brandstätter (2004), S. 152. 40 Vgl. Brandstätter (2004), S. 152f und de la Motte-Haber (2005), S. 61-64. 41 Vgl. Brandstätter (2004), S. 151f. 38 14 Die Folge daraus ist das Erkennen von neuen Strukturen und Aspekten. Brandstätter (2004) bringt das Beispiel von einem Baum, um dieses Konzept zu beschreiben: Wenn wir z.B. das abstrakte Muster „Baum“ […] auf eine konkrete Wahrnehmungssituation anwenden, erfährt[…] [es] nicht nur durch die Zuordnung zu einem bestimmten Baumtyp (Fichte, Pappel, Birke) eine Konkretion, sondern darüber hinaus wird in der einmaligen Erfahrung das Muster auf eine unwiederholbare Weise differenziert (dieser Baum hier an diesem Ort).42 Daraus resultiert ein Spannungsfeld zwischen dem Erkennen von übergeordneten Merkmalen und abstrahierten Parametern und der Registrierung von einmaligen Erfahrungen mit ihren konkreten Begebenheiten. Beide Konzepte stehen in Wechselbeziehung zueinander und ebnen somit den Weg für die Bildung eines opportunen Mustergefüges.43 Der Kernpunkt dieser Theorie zeigt sich in dessen Dynamik, im Gegensatz zum vorangegangen Schablonenmodell. Diesem lag die Annahme zugrunde, dass neue Reize mit angelernten Mustern, die sich als fixe Schablone manifestiert haben, in Relation gestellt werden. Wenn eine Schablone abgespeichert war, konnte diese nicht mehr verändert werden, was eine Fülle an diesen mit nur minimalen Unterschieden hinsichtlich des Speicherns zur Folge hatte. Im Vergleich dazu stützt sich die Theorie von Abstraktion und Differenzierung auf die Vorstellung, dass die vorhanden Muster niemals konstant bleiben können und im Laufe der Zeit durch weitere Eindrücke ergänzt und modifiziert werden müssen. 44 Die Erklärung dafür liegt in der Tatsache, dass zunehmende Erfahrung und die Weiterentwicklung von kognitiven Fähigkeiten immer mit einer Veränderung der erworbenen Konzepte einhergeht und fixe Schablonen für Weiterentwicklungen inadäquat wären. Die Wechselwirkung zwischen Invarianz und Varianz ermöglicht die stetige Anpassung der Muster an die wahrgenommene Wirklichkeit. In diesem Zusammenhang spricht Neisser 45 über Schemata, die sich im Aufnehmenden manifestieren und anhand der Interaktion während des Wahrnehmungsprozesses assimilieren und sich an dadurch weiter angeforderte Information anpassen. Die Quintessenz von Neissers Schematatheorie ist der „[…] zyklische Charakter der Wahrnehmungsaktivität: Schema 42 Brandstätter (2004), S. 152. Vgl. ebd. 44 Vgl. de la Motte-Haber (2005), S. 63f. 45 Vgl. Neisser (1979), S. 50. 43 15 und Informationsaufnahme […] sind in einem Kreisprozess miteinander verbunden.“46 Die Essenz dessen zeigt sich in der Tatsache, dass Muster wie Prototypen durch Erfahrung und Lernen erschaffen werden und sich durch ihre Flexibilität in ihrer Repräsentation auszeichnen.47 Eine weitere Beschreibung der Korrelation zwischen abstrakten Schemata und konkreten Informationen liefern Piagets Klassifikationsprozesse: Akkommodation und Assimilation.48 Wird Information von außen praktisch ungefiltert aufgenommen und in das Muster eingepasst findet ein Prozess der Akkommodation statt. Die sensorischen Reize werden dabei als Bildungselement für die Repräsentation von Empfindungen oder Objekten verwendet. Umgekehrt wird bei der Assimilation die Merkmalsfülle anhand eines bereits existierenden Musters kontrolliert und aussortiert, sodass die Aufnahme durch bereits existente Sinnesdaten beeinflusst wird. Die Gegenläufigkeit der beiden Prozesse wird auch hinsichtlich ihrer Richtung beschrieben: Die Akkommodation wird als bottom-up Vorgang beschrieben. Sensorische Information von außen regt diesen Prozess an und resultiert in einer Anpassung des Musters. Der somit gegensätzliche topdown Prozess der Assimilation beruht auf bereits gespeichertem Wissen und Erkenntnissen, was den Filter für die aktuellen Reize bereitstellt. Beiden Prozessen liegt wieder eine Wechselwirkung zugrunde, welche Ausgewogenheit anstrebt: Bearbeitungsprozesse Abstraktionsebenen Voraussetzung halten befinden dafür ist „Aufwärtsgerichtete einander sich die in die einem Möglichkeit und Waage, regen der abwärtsgerichtete die verschiedenen Austauschverhältnis.“ Wechselwirkungen 49 und Rückkopplungsschleifen zwischen den sensorischen Arealen im Gehirn. 1.3.2 Musikalische Kategorien der Wahrnehmung Musik als Kunst kann in gewisser Weise immer als Widerspiegelung der Wirklichkeit gesehen werden, egal ob man davon ausgeht, dass sie wie eine eigene Sprache fungiert oder in sich selbst geschlossen die Kunst an sich repräsentiert. Wahrgenommen wird sie durch unsere Sinnesorgane und somit von denselben Prozessen geleitet, welche die Verarbeitung von Alltagsobjekten bestimmen. Bei der Einbettung in das System, der Analyse, findet genauso die Identifikation anhand von Kategorien und Strukturen statt. 46 Brandstätter (2004), S. 153. Vgl. de la Motte-Haber (2005), S. 63. 48 Vgl. Piaget (1969) in Brandstätter (2004), S. 152f. 49 Brandstätter (2004), S. 154. 47 16 Entscheidend dabei ist, dass diese Kategorien und Abläufe nicht unbedingt bewusst ablaufen müssen, vergleichbar mit den bereits beschriebenen grundlegenden Organisationsprozessen der Wahrnehmung. Musikalische Kategorien wie Melodie und Rhythmus, Satzstruktur (Einstimmigkeit, Mehrstimmigkeit) und musikalische Formen (Liedform, Sonatenform) sind unter anderem Begriffe, die man als Grundmuster im Wahrnehmungsprozess vermuten würde. Zusätzlich kann man annehmen, dass auch Konzepte aus anderen Bereichen in diesem Vorgang tragend werden. Kategorien aus anderen sinnlichen Bereichen wie Bewegung (Ruhe, Statik, Dynamik) oder Visuelles (Punkt, Line, Symmetrie) spielen genauso eine Rolle wie übergeordnete, abstrakte Kategorien (Ausdehnung und Verkürzung, Enge und Weite, Steigerung und Verdichtung, etc.).50 Vergleichbar mit der Abstraktheit der Musik, sind auch die letzten Kategorien von Brandstätter (2004) beschrieben worden. Diese übergeordneten Strukturparameter sind entscheidend, da sie nicht nur mit dem Charakter der Musik in Verbindung stehen, sondern gleichzeitig von ihr dargestellt werden: „Musik verweist als Zeichensystem weniger auf die konkrete äußere Umwelt, vielmehr verkörpert sie – gleichsam auf einer übergeordneten Ebene – allgemeine Kategorien des Umgangs mit der Welt.“51 Folglich ereignen sich die Strukturbildungsprozesse von Musik nicht nur anhand der bereits beschriebenen grundlegenden Wahrnehmungsabläufe, da Musik in ihrer Ausführung die Wahrnehmungskategorien an sich beinhaltet und sinnlich erfassbar macht. Zum einen werden dabei Reizeindrücke auf die übliche Weise aufgenommen und verarbeitet und zum anderen manifestieren sich Kategorien bereits bei der „Ausführung“ von Musik. Musik aktiviert folglich zwei Ebenen durch das Durchlaufen des „üblichen“ Wahrnehmungsprozesses und das gleichzeitige aktive Darstellen der allgemeinen Ordnungsprozesse beim Akt des Musizierens.52 2. Gedächtnis Die Voraussetzung für die Wahrnehmung von Musik im Allgemeinen ist das Gedächtnis. Das grundlegende Konzept der Reizverarbeitung könnte nicht funktionieren, da es keine Vergleichsparameter gäbe. Obwohl eine Stimulirezeption möglich wäre, wäre das Stadium der Analyse ohne bereits existierende Information sehr 50 Für eine ausführliche Auflistung siehe Brandstätter (2004), S. 161-164. Brandstätter (2004), S. 164. 52 Vgl. Brandstätter (2004), S. 164. 51 17 schwer zu bewerkstelligen. Man stelle sich vor wie es wäre, wenn eintreffende Reize von außen zwar verarbeitet, aber im gleichen Moment wieder vergessen würden. Man könnte Vergangenes mit Gegenwärtigem nicht in Beziehung bringen und das Hören von Melodien wäre somit eine Unmöglichkeit; man würde ja Ton für Ton vergessen. Nur dadurch, dass das Gehirn über einen Speicher verfügt, kann Gehörtes erst zusammengesetzt und interpretiert werden. Erst durch die Gedächtnisleistung kann Musik entstehen. 2.1 Multiple Gedächtnissysteme Die Vielfältigkeit von Gedächtnisprozessen kann man erahnen, wenn man sich nur am eigenen Erinnerungsvermögen orientiert. Manche Dinge muss man lange üben, damit man sie langzeitig wiedergeben kann, im Gegensatz zu anderen, die man nur kurz und zufällig gehört oder gesehen hat und noch Jahre später im Detail weiß. Musikalisch gesehen fällt uns manchmal im Hintergrund gespielte Musik gar nicht auf, wobei man sich meistens sehr gut an selbst erlernte Stücke erinnern kann. Die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann, ist die Annahme, dass es verschiedene Möglichkeiten einer Speicherung von Inhalten geben muss, welchen adäquate Abläufe zugrunde liegen müssen. Die Art und Weise wie Informationen in das Gedächtnis gelangen und wo sie gespeichert sein müssen damit man auf diese wieder zugreifen kann, ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Obwohl es sehr schwierig bis unmöglich zu sein scheint, alle auf uns einwirkenden Einflüsse und innerlichen Verarbeitungsmechanismen zu definieren, nimmt man doch an, dass die folgenden eine wichtige Rolle in Bezug auf unsere Behaltensleistung spielen könnten: die vergangene Zeit hinsichtlich der Reizaufnahme und Analyse, die Verarbeitungstiefe der Information, die Ähnlichkeit der Inhalte der gespeicherten und zu speichernden Information und die zur Verfügung stehende Kapazität unseres Speichers. 53 Bevor allerdings auf die unterschiedlichsten Einflussfaktoren eingegangen werden kann, müssten die unterschiedlichen Speicherarten genauer betrachtet werden. Generell kann die Speicherung anhand von zeitlichen oder inhaltlichen Parametern geprägt sein. 53 Vgl. Lange (2005), S. 74. 18 2.1.1. Zeitstruktur und Gedächtnis Hinsichtlich des zeitlichen Gesichtspunkts kann man drei Gedächtnistypen unterscheiden. Die eintreffenden Reize gelangen je nach Dauer der Verarbeitung in das Ultrakurzzeit-, Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnis. Die Erstspeicherung einer Information kann eher als eine verlängerte Wahrnehmung beschrieben werden und findet im sensorischen oder Ultrakurzzeitspeicher statt. Die unbewusste Vorverarbeitung vonvisuellen Reizen, die unter einer Sekunde dauert, platzierte Neisser in das ikonische Gedächtnis und die von auditorischen Reizen in das Echogedächtnis.54 Visuelle Informationen werden somit zu Beginn der Verarbeitung wie eine auf der Netzhaut entstandene Kopie im sensorischen Speicher repräsentiert, genauso wie akustische Reize noch für die gleich kurze Zeit als Echo nachklingen können. Das Ultrakurzzeitgedächtnis ist folglich der erste Anlaufpunkt für die eintreffenden Sinneseindrücke und beinhaltet noch für eine minimale Zeitspanne das ganze Informationsspektrum eines Reizes. Nach ein paar hundert Millisekunden minimiert sich die Fülle der Information durch die Herausfilterung der relevanten Eindrücke, die dann weiter in das Kurzzeitgedächtnis eingelesen werden.55 Der Prozess der Selektion ist in diesem Falle sehr wichtig, da der Kurzzeitspeicher (KZS) über eine begrenzte Kapazität verfügt. Die zeitliche Dauer der Informationsspeicherung beträgt in diesem Speicher gerade so viel, dass mit momentaner Information gearbeitet werden kann; in der Regel sind das 7 +/-2 Elemente. Diese Gedächtnisspanne ist allerdings nicht unveränderbar wie beim sensorischen Gedächtnis, sondern kann durch unterschiedliche Strategien verlängert werden. Gruppiert man einzelne Elemente zu Einheiten, kann man eine größere Anzahl von Elementen repräsentieren. Durch dieses so-genannte Chunking ermöglicht man eine kurzfristige Ausdehnung des Kurzzeitspeichers, welcher folglich Arbeitsspeicher genannt wird. Das übergeordnete Ziel beim Speichern eines Inhaltes sollte die Ausdehnung der Speicherung im Kurzzeitgedächtnis sein, denn umso länger man Dinge im KZS behält, umso wahrscheinlicher ist der Transfer in das Langzeitgedächtnis. 56 Eine weitere Strategie neben dem Chunking ist dabei die andauernde Wiederholung der Inhalte. Zu erwähnen ist, dass dieses Maintenance Rehearsal anhand von verbalem Material untersucht worden ist. Da aber musikalische Abläufe wie sprachliche auf 54 Vgl. Neisser (1979), S. 45-50. Vgl. Spitzer (2002), S. 116f. 56 Vgl. Spitzer (2002), S. 116-118. 55 19 aufeinander konstituierenden Elementen aufgebaut sind, kann man dabei similäre Verarbeitungsprozesse konjizieren.57 Wenn man eine Information lange genug im KZS behalten konnte, gelangt sie in den Langzeitspeicher. Dieser enthält nicht nur Erinnerungen von Ereignissen inklusive den dazugehörigen Emotionen, er ist auch unsere Zentrale für Sprache, Fähigkeiten und generell das Wissen, das wir uns angeeignet haben. Obwohl das Langzeitgedächtnis ein immenser Speicher ist und an und für sich nicht unlimitiert, kann man doch nicht auf alles, was man je dorthin transferiert hat, zugreifen. Das liegt an der Tatsache, dass manche Dinge nicht mehrvom Arbeitsgedächtnis gefunden werden; denn dieses ist, trotz Speicherung im LZS, die Verarbeitungszentrale.58 2.1.2. Inhaltliche Speicherung Im Rahmen der Gedächtnisinhalte kann sowohl anhand der zeitlichen Abfolgen, aber auch in Bezug auf inhaltliche Bedeutungen eine Einteilung vorgenommen werden. So bezeichnet man nicht zugängliches Wissen als Verhaltensgedächtnis, welches implizit ist, und aktiv Beinflussbares als Wissensgedächtnis und explizit. Die Grenzen zwischen den beiden sind allerdings nicht immer deutlich zu erkennen.59 Wie bei den Wahrnehmungsvorgängen deutlich wird, geschehen sehr viele Prozesse unbewusst. Das implizite Verhaltensgedächtnis beinhaltet eine ähnliche unbewusste Speicherung, diese kann aber sowohl durch unbewusste, aber auch durch bewusste Lernvorgänge durchgeführt werden. Das prozedurale Gedächtnis beschreibt dabei die komplexen motorischen Bewegungsabläufe, die automatisch, also unbewusst, ausgeführt werden. Die alltäglichen Handlungsprozesse sind im zuständigen Kortex gespeichert und werden durch die Subkortikalen Areale zu sinnvollen Einheiten zusammengestellt und führen wenn es notwendig ist eine zusätzliche Adaption an die jeweilige Situation durch. Ergänzend zu diesen prozeduralen Abläufen werden die Wahrnehmungsprozesse, die ebenfalls teilweise implizit arbeiten, immer wieder optimiert, was die Grundlagen für eine schnellere Verarbeitung von wieder eintreffenden Mustern legt. Diese unbewusst arbeitende Weiterentwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit wird Priming genannt.60 57 Vgl. Lange (2005), S. 76. Ebd. 59 Vgl. Behrends/Bischofberger/Deutzmann (2012), S. 781. 60 Vgl. Behrends/Bischofberger/Deutzmann (2012), S. 781f. 58 20 Im Vergleich zu den impliziten Vorgängen beinhaltet das explizite oder deklarative Wissen ein episodisches Gedächtnis, in welchem persönliche Erlebnisse abgelegt werden, und den semantischen Speicher, welcher aus allgemeinen Fakten und Tatsachen besteht. Die beiden Gedächtnisarten erlauben uns das Zurückgreifen auf sowohl konkrete, objektbezogene und abstrakte Inhalte, aber auch auf Erinnerungen, die von persönlichen Empfindungen und individueller Bedeutung geprägt sind. Kurz gesagt wird also im episodischen Speicher nur Information gespeichert, die von unterschiedlichen Personen ident wiedergegeben werden könnte. Die semantischen Inhalte können nur durch die einzelnen Individuen artikuliert werden.61 Weitere Gedächtniskonzepte wären das Quellengedächtnis, welches die Herkunft des Inhaltes in dessen Speicherungsprozess inkludiert, und das Blitzgedächtnis durch die sofortige und nicht subjektiv beeinflussbare Einprägung eines Reizes. Zusätzlich spricht man von einem prospektiven Gedächtnis, wenn Handlungsvorgänge anhand von kognitiven Fähigkeiten geplant werden und nach zeitlicher Verzögerung durchgeführt werden sollen. Diese Art des Gedächtnisses ist somit verantwortlich für das Einhalten von Terminen durch die Verknüpfung von vergangenen Erfahrungen mit zukünftigen Vorstellungen.62 2.2 Allgemeine Gedächtnisprozesse Ein wesentlicher Faktor hinsichtlich des Erforschens von Gedächtnistypen sind die Gehirnprozesse, die die Aufnahme von Informationen, deren Verarbeitung und das spätere Abrufen ermöglichen. Begonnen wird bei auditiven Reizen im Echogedächtnis mit der Reizaufnahme und Verarbeitung durch die Interaktion mit anderen Sinneseindrücken. In dieser ersten Phase der Informationsaufbereitung werden die Reize noch nicht der Analyse freigegeben, sondern nur für die Weiterverarbeitung entschlüsselt und bereitgestellt. Nach der Aufnahme und Erstfilterung durch den präfrontalen Kortex kann die Information codiert, also für die Einbettung vorgespeichert werden. Wenn dieser Input für uns von Bedeutung ist, muss er aktiv im Kurzzeitgedächtnis gehalten werden, um weiterverarbeitet werden zu können. Dieser Vorgang der Konsolidierung wird durch Assoziationen und Vergleiche von bereits existierenden Inhalten geprägt. Das limbische System und somit auch der Hippocampus und der Mandelkern (Amygdala) sind daran beteiligt. Tief an der Innenseite des 61 62 Vgl. Schiepek (2003), S. 186-189. Vgl. Förstl/Hautzinger/Roth (2006), S. 225-229. 21 Temporallappen liegt der Hippocampus, welcher als das organisatorische Zentrum aller Gedächtnisinhalte bezeichnet wird.63 Bei der Weiterverarbeitung werden in den spezifischen Hirnarealen die unterschiedlichsten informationsverarbeitenden Neuronen und deren Synapsen aktiviert. Umso häufiger Neuronen gleichzeitig arbeiten, umso dicker werden die interneuronalen Verbindungen und umso stärker ist die Informationsrepräsentation in unserem Langzeitspeicher. Durch die Vorgänge der Encodierung und Konsolidierung gelangen also Inhalte in den Langzeitspeicher. Dieser Übergang kann nur erfolgen, wenn der Temporallappen vollständig intakt ist; ansonsten ist eine Langzeitspeicherung nicht möglich.64 Der eigentliche Ort des Gedächtnisses, also der fest gespeicherten Inhalte, befindet sich in der Großhirnrinde. Das Langzeitgedächtnis ist als solches in keinem fixen Areal unseres Gehirns zu finden, sondern könnte eher als eine netzwertartige Organisationsstruktur beschrieben werden. Inhalte werden nicht nach Eintreffen und Ort nebeneinander eingeschrieben, sondern netzwerkartig in das bereits existierende Verbindungssystem integriert. Die Organisation der deklarativen Speicherinhalte wird vom Hippocampus durchgeführt, welcher bestimmt, in welchem Areal und somit Gedächtnistyp die bereits entschlüsselte Information festgehalten wird.65 Bei der letzten Phase der Gedächtnisprozesse, dem Abrufen, wird auf zuvor gespeicherte Inhalte zurückgegriffen. Wie bereits erwähnt, kann man sich trotz der theoretischen Unbegrenztheit des Langzeitspeichers nicht immer an jede einzelne gespeicherte Information erinnern. Der Abruf ist demnach, wie auch die Encodier- und Lernleistung, von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Solche beziehen sich auf die persönliche Gemütslage genauso wie auf die emotionale Konnotation und die Art der gespeicherten Darstellung. Am meisten wird die Wiedergabe aber von der Häufigkeit des Zugriffs darauf bestimmt. Je öfter Informationen aufgerufen werden, desto multipler werden sie vernetzt, indem sie mit weiteren Kontextinformationen in Verbindung gebracht werden.66 63 Vgl. Altenmüller (2006), S. 49f. Vgl. ebd. 65 Vgl. Spitzer (2002), S. 118 und Altenmüller (2006), S. 48-52. 66 Vgl. Pritzel/Brand/Markowitsch (2009), S. 412f. 64 22 In diesem Zusammenhang ist das Konzept der Verarbeitungstiefe zu erwähnen. Es knüpft an den Prozess der Re-Encodierung von Informationen an. Die aktive Erinnerungsfähigkeit ist also abhängig von der Art der Reizverarbeitung. Werden nur physikalische und sensorische Aspekte eines Stimulus aufgeschlüsselt, anstatt diesen mit Inhalt zu versehen, wird er weniger stark repräsentiert werden. Am tiefsten kann ein Reiz gelangen, wenn dieser semantisch verarbeitet und damit kategorisiert wird.67 Ein wichtiger Einflussfaktor für die „Tiefe“ der Verarbeitung ist das emotionale Gedächtnis. Die Amygdala und das mesolimbische System sind verantwortlich für die emotionale Konditionierung von Ereignissen und durch meist unbewusste emotionale Färbungen von Erfahrungen verantwortlich für eine stärkere Vernetzung. Obwohl es nicht bewiesen ist, dass die Amygdala der Speicherort für eine längerfristige Vernetzung von Emotionen ist, wird dennoch angenommen, dass sie Einfluss auf das mit viel größerer Speicherkapazität versehene Großhirn ausübt.68 2.3 Musik und Gedächtnis Die Aufnahme musikalischer Reize erfolgt genauso über den Wahrnehmungsprozess, wie andere, nicht-musikalische Eindrücke in das System aufgenommen werden. Gleichermaßen wird Musik in den Zentren verarbeitet, in welchen auch andere Reize verarbeitet werden. Kurz gesagt, gibt es keine Zentren, die nur musikalische Inhalte verarbeiten. Obwohl Studien zeigen, dass auch bei Schädigung gedächtnisrelevanter Hirnareale musikalische Inhalte noch erfasst werden konnten, konnte man bis jetzt kein externes Musikverarbeitungs- und Speicherungszentrum lokalisieren.69 Trotzdem kann man feststellen, dass vergleichbar mit der Sprachverarbeitung, gewisse Hirnareale eine höhere Aktivität bei Musikrezeption und-produktion aufweisen als andere. 2.3.1 Beteiligte Hirnstrukturen Musikalisches Gestalten setzt sich im Allgemeinen durch drei Einzelleistungen zusammen. Die Rezeption von Hören und Sehen und somit zwei der drei Parameter wurden in den vorigen Kapiteln schon grundlegend entschlüsselt. Das dritte Element bezieht sich demnach auf die Umsetzung von Musik: das Spielen. Bei einer Studie wurden dabei alle drei Parameter getrennt und in Verbindung zu einander untersucht.70 67 Vgl. Kielholz (2008), S. 92-95. Vgl. Roth (2011), S. 117f. 69 Vgl. Petrat (2014), S. 57. 70 Vgl. Spitzer (2002), S. 309f. 68 23 Das Hören aktivierte beidseitige Teile des superioren Temporallappen, die in Verbindung mit dem Sprachverarbeitungszentrum stehen und folglich auch bei der allgemeinen auditorischen Reizverarbeitung beteiligt sind. Der rechte Teil des Lappens zeigte allerdings nur erhöhte Aktivität, wenn es sich beim Gehörten um ein Stück handelte, was die Annahme bestätigt, das der rechte Hemisphärenteil von wichtiger Bedeutung für die Melodiewahrnehmung ist. Beim Lesen von Noten wurde nicht nur das visuelle Verarbeitungsareal im Okzipitallappen aktiviert, sondern auch Teile des Parietal- oder Scheitellappen, welchem die räumliche Reizverarbeitung zugeteilt wird.Eine mögliche Erklärung könnte dafür so formuliert werden: „Bedenkt man, dass in der Notenschrift die Tonhöhe rein räumlich und zeitliche Aspekte teilweise räumlich kodiert sind, wundert dies [die Aktivierungszunahme] im Grunde kaum.“71 Kombinierte man dazu den auditorischen Input eines Stückes, wurde zusätzlich noch ein Areal beidseitig im Scheitellappen aktiviert, welches auf der linken Seite für die symbolische Sprachrepräsentationen verantwortlich ist. Es könnte also vermutet werden, dass in der rechten Hemisphäre dieses Gehirnareals (Gyrus supramarginalis) Strukturen nur für die symbolische Musikverarbeitung zuständig sein könnten. Um Musik überhaupt hörbar zu machen, muss sie gespielt werden. Generell werden beim Spielen Teile des Frontalkortex benötigt, die strukturbedingt mit prämotorischen Arealen überlappen, welche auch beim Schreiben aktiv sind. Diese überlappenden Strukturenkönnten eine Erklärung für die Vermutung sein, dass die genannten Areale nicht nur musikalische, sondern auch sprachliche Inhalte verarbeiten. Um eine Melodie oder ein ganzes Musikstück umsetzen zu können, müssten nun all jene Areale aktiv werden, die sowohl für die auditorische als auch die visuelle Reizverarbeitung zuständig sind, sowie auch jene Strukturen, die die motorische und symbolische Entschlüsselung innehaben.72 In Hinblick auf die Frage nach spezifischen musikalischen Verarbeitungsvorgängen kann zusammenfassend Folgendes festgestellt werden: Obwohl es durch verschiedene Studien belegt scheint, dass die neurologischen Zentren für musikalische Produktion und Verarbeitung mit den sprachlichen großteils korrelieren, gibt es auch Hinweise, dass sich die Art der Musikspeicherung auch differenziert manifestiert. Bei den Wahrnehmungsprozessen hat sich gezeigt, dass eintreffende Reize anhand von 71 72 Spitzer (2002), S. 310. Vgl. Spitzer (2002), S. 309f. 24 Gruppierungsvorgängen analysiert werden. Dabei wurden drei biologisch verankerte Grundprinzipien (Nähe, Kontinuität und Ähnlichkeit) erwähnt, die für die Art der Zusammenfassung der aufgenommenen Informationen verantwortlich sind. Das Musikgedächtnis macht sich die drei Prinzipien zunutze, indem es die eintreffenden Reize umgewandelt in Töne „über die Zeit hinweg gesammelt und zu übergeordneten Einheiten [zusammenfasst].“ 73 Tatsächlich werden musikalische Inhalte zwar ähnlich wie verbale über die Zeit in Motive und Phrasen zusammengefasst, aber gegensätzlich zu sprachlichen Inhalten, die sofort mit übergeordneten semantischen Bereichen in Verbindung gebracht werden, nimmt man an, dass Klänge und Phrasen erst perzeptuell aufgenommen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt können diese musikalischen Inhalte durchaus mit semantischen Bedeutungen und Emotionen verknüpft werden; doch geht man davon aus, dass diese zu Beginn der Reizverarbeitung noch keine Bedeutungszuteilung erfahren.Musikalische Inhalte werden also, kurz gesagt, anhand der drei Grundprinzipien zusammengefasst und zeitlich vorgespeichert, bevor sie mit Bedeutungsinhalten versehen werden können.74 Hinsichtlich der inhaltlichen Speicherung kommen beide expliziten Gedächtnissysteme zur Verwendung. Vergleichbar mit dem Lesen und Schreiben muss im musikalischen Kontext die Notensprache erlernt werden. Dabei werden Symbole mit Inhalten verknüpft und im Speicher abgelegt. Neben dem semantischen Gedächtnis werden auch musikalische Informationen im episodischen Gedächtnisnetzwerk gespeichert. Das Erlernen von Musikstücken beinhaltet meistens die Einbindung in einen Kontext. Erinnert wird dabei nicht nur die rein musiktheoretische Seite, sondern auch die Empfindungen und Umstände, die zum einen, beim Erlernen des Stückes empfunden wurden, und zum anderen, die durch das Stück suggeriert werden.75 2.3.2 Mögliche Einflussfaktoren der Speicherung in musikalischer Hinsicht Die generelle und bereits definierte Unterteilung des Langzeitgedächtnisses beinhaltet natürlich auch musikalische Inhalte. Unser implizites Wissen hinsichtlich Tonalität, Klangfarbe und Tempo spielt nicht nur bei den unterschiedlichen Stadien der Wahrnehmung eine Rolle, sondern beeinflusst auch unser Kurzzeitgedächtnis. Des Weiteren wird sich zeigen, dass nicht nur musikalisches Vorwisseneine mehrfache 73 Jäncke (2009), S. 107. Vgl. ebd. 75 Vgl. Jäncke (2009), S. 314f. 74 25 Codierung der Reize hervorruft und somit eine Verankerung im Langzeitspeicher begünstigen könnte. Welche Faktoren ebenso Einfluss auf eine langfristige Speicherung haben könnten, werden in den folgenden Ausführungen untersucht. Kapazitätsbegrenzung Das Erfassen einer bestimmten Anzahl an Elementen und die Aufgabe diese wiederzugeben liegt im Wirkungsbereich des Kurzzeitgedächtnisses und in dessen Verlängerung, des Arbeitsspeichers. Die 7 +/-2 Regel wird dabei oft mit der siebenstufigen diatonischen Skala in Verbindung gebracht mit der Annahme, dass diese die Grundlage für die siebenteilige Gedächtnisspanne sein könnte. Obwohl diese Annahme durch die Tatsache, dass andere Kulturen mehrteilige Tonsysteme verinnerlicht haben, widerlegt wird, ist der Intervallanzahl der siebenstufigen Skala Aufmerksamkeit zu widmen. Der Unterschied in der Kapazität liegt also nicht in der Tonanzahl, sondern der Intervallanzahl. Musiker können zwar im Vergleich zu Nichtmusikern mehr als sieben Intervalle unterscheiden, was aber auf ihre musikalischen Vorkenntnisse zurückzuführen ist. Die fehlende Fähigkeit der Unterscheidung der Intervalle ist also auf das fehlende Vorwissen zurückzuführen. Anzunehmen ist nun, dass durch das Zeigen einer Hilfestellung für Nichtmusiker die Behaltensleistung erhöht werden könnte. Eine zusätzliche Codierung durch die Verbindung von Intervallen mit bekannten Liedanfängen zielt auf eine Verlängerung der Erinnerung ab und erhöht somit die Chancen für eine verlängerte Speicherung. 76 Ein weiterer Vorteil der Beschränkung auf den diatonischen Klangraum aus unserem Kulturkreis könnte sich durch dessen Struktur ergeben. Durch eine regelmäßige Abfolge von Tonabständen, bestehend aus Ganz- und Halbtonschritten, ergibt sich eine Gewichtung in Richtung eines tonalen Zentrums.77 Dabei könnte man annehmen, dass wieder eine Gruppierung der Elemente stattfindet und das somit zu einer erhöhten Speicherleistung führen könnte. Modalitätseffekt Der Modalitätseffekt beschreibt eine Besonderheit der auditiven Präsentation im Kurzzeitgedächtnis hinsichtlich der Erkenntnis, dass verbalisierte Gedächtnisinhalte eher wiedergegeben werden können, als nur visuelle. Angenommen wird, dass auditive 76 77 Vgl. Lange (2005), S. 78f. Ebd. 26 Reize, wie das Rhythmisieren von Daten, eine komplexere temporale Codierung zur Folge haben und somit eine stärkere Vernetzung erzeugen. Das wiederum lässt auf eine langzeitlichere Speicherung schließen. Die Voraussetzung dafür liegt allerdings in der Art der Rhythmisierung: nur eine regelmäßige Abfolge ermöglicht das Gruppieren von Elementen. Das übergeordnete Ziel der Zusammenfassung zu größeren musikalischen Elementengruppen kann in der Musik durch ein gleichmäßiges Metrum bewerkstelligt werden.78 Gruppierung Sinneseindrücke können hinsichtlich allgemeiner Wahrnehmungsvorgänge erst interpretiert werden, wenn sie in Beziehung zueinander gestellt werden. Die Voraussetzung dafür ist ein präexistenter Speicher, der den Vergleich von eintreffenden Reizen mit bereits verarbeiteten Informationen ermöglicht. Da bei beiden Prozessen die Reize nicht in ihrer individuellen Fülle aufgenommen und gespeichert werden können, finden Gruppierungsmechanismen statt. Beide Vorgänge, die Wahrnehmung und die Speicherung oder vice versa, sind folglich von Gruppierungsmechanismen abhängig. In Hinblick auf die musikalische Wahrnehmung sind Parameter wie Frequenz, Klangfarbe und Ursprungsort der Schallquelle strukturbildend. Ist eine Nähe in der Tonfrequenz zu definieren, werden die Klänge eher zu einer Melodie zusammengefasst werden. Der Lokalisationsparameter kommt zu tragen, wenn sich Töne in ihrer Klangfarbe und Höhe ähnlich sind.79 Um also die musikalische Gedächtnisleistung positiv beeinflussen zu können, sollte man auf Gruppierungsprozesse Rücksicht nehmen. Die Einteilung in musikalische Motive und Phrasen zeigt sich dabei von großer Bedeutung. Um allerdings die Behaltensleistung zu maximieren, sollte die Relation der Parameter, aus welchen Motive und Phrasen bestehen, miteinbezogen werden. Denn die rhythmisch-metrische Struktur und die Melodiekontur spielen nicht nur bei der Erschaffung, sondern auch bei der Wiedergabe von Musik eine wichtige Rolle. Will man beim Hörer eines Musikstücks eine Verwirrtheit auslösen, sollte man den Zusammenhang zwischen den beiden genannten Parametern übergehen. Möchte man aber die Wiedergabeleistung eines musikalischen Motivs erhöhen, sollten Rhythmus und Melodieverlauf kohärent 78 79 Vgl. Lange (2005), S. 79f. Vgl. Lange (2005), S. 83-86. 27 sein. 80 Lange (2005) erwähnt in diesem Zusammenhang eine Studie von Diana Deutsch81, die dieses Phänomen anhand von Beethovens Fünfter Sinfonie gezeigt hat. Dabei wurde die in der Einleitung dreiteilige Struktur in eine temporale Vierergruppe gespalten, was in rhythmischen Vierergruppen und melodischen Dreiergruppen resultierte. Diese Inkohärenz resultierte in einer nachweisbaren Leistungsminderung in Hinblick auf die Wiedergabe. Ähnlichkeit Soll eine Liste an Elementen wiedergegeben werden, ist die akustische Ähnlichkeit der Repräsentation dieser von Vorteil für die Wiedergabeliste. Als Beispiel dient eine Zahlenreihe, die auf unterschiedliche Weise vorgetragen wird. Es hat sich gezeigt, dass die Behaltensdauer der Elemente durch die gleichbleibende Klangfarbe und Höhe der Stimme positiv beeinflusst wurde. Obwohl ein Wechsel des Sprechers zu Einbußen hinsichtlich der Wiedergabe geführt hat, hat wiederum eine strukturierte Abwechslung zu einer höheren Speicherleistung geführt. 82 Musikalisch gesehen könnte man die Sprachpräsentation in eine Instrumentalpräsentation konvertieren. Musikalische Motive und Phrasen können natürlich auch mit verschiedenen Instrumenten produziert werden nicht nur durch eine strukturierte Abwechslung, sondern auch durch Variation eine Verdichtung der Codierung herbeirufen und somit eine verbesserte Speicherung bezwecken. 3. Allgemeine Einflussfaktoren Die Grundlage für improvisatorisches Gestalten ist die Fähigkeit, musikalisch tätig werden zu können. Folglich wurden die neurobiologischen Grundlagen in Form von Wahrnehmung und Gedächtnis im Allgemeinen mit spezifischen musikalischen Ergänzungen betrachtet. Die Tatsache, dass sich Gedächtnisstrukturen generell nicht als statisch erwiesen haben, wie durch die Neuroplastizität des Gehirns beschrieben wurde, lässt auf unterschiedliche Einflussfaktoren schließen. Denn anzunehmen ist, dass die Veränderung einer neuronalen Struktur durch das Kennenlernen von etwas Neuem und Ergänzen von schon Vorhandenem von inneren als auch äußeren Begebenheiten abhängig sein könnte. Bereits zu Anfang wurde das limbische System als eine 80 Ebd. Vgl. Deutsch, Diana: The Processing of Structured and Unstructured Tonal Sequences. In: Perception & Psychophysics 28 (1980), S. 381-389. 82 Vgl. Lange (2005), S. 86-88. 81 28 vorantreibende und beeinflussende Hirnstruktur für verschiedene neurologische Prozesse beschrieben. Die daraus resultierenden Emotionen sind nur einer der wichtigen Parameter, die sowohl auf die Wahrnehmung als auch die Speicherung (oder vice versa) und somit folglich auch auf entscheidende Elemente der musikalischen ProduktionEinfluss ausüben können. Das Folgende sollte demnach in Bezug zu bereits Erwähntem gesetzt werden, um als Voraussetzung für den anschließenden didaktischen Teil zu dienen. 3.1 Aufmerksamkeit Gedächtnisprozesse, speziell die des Arbeitsgedächtnisses, hängen stark von Aufmerksamkeit ab. Im Detail bedeutet das, dass eine Störung in der Aufmerksamkeitdie Gedächtnisleitung, insbesondere auch die Phase der Encodierung, stark beeinflussen kann. Wichtig zu erwähnen ist, dass wie bei anderen Gehirnleistungen, sich die Aufmerksamkeit nicht auf einen definierten Prozess reduzieren lässt. Eng verbunden mit der Wahrnehmung, werden die unterschiedlichsten kortikalen und subkortikalen Areale bei Aufmerksamkeitsprozessen miteinander vernetzt. Das Konzept der Aufmerksamkeit lässt sich in einen zeitlichen und räumlichen Prozess unterteilen. Spricht man von der Intensität, also der Leistung und Dauer, wird dies Vigilanz genannt. Dies deutet auf Aufmerksamkeit im Sinne eines Zustands, der über einen länger andauernden Zeitraum gehalten werden muss, hin. Zusätzlich wird auch hinsichtlich der Fokussierung unterschieden. Die selektive Aufmerksamkeit beschreibt die Zuwendung zu und damit die Ausblendung von bestimmten Sachverhalten.83 3.1.1 Selektion Um Aufmerksamkeit anhand ihrer beiden Parameter beschreiben zu können, muss der Begriff der Selektion hinsichtlich eintreffender Reize gespalten betrachtet werden. Wie in den vorigen Kapiteln bereits erwähnt wurde, ist eine selektive Reizerfassung in der ersten Phase der grundlegenden Wahrnehmungsprozesse von wichtiger Bedeutung. Reize werden zwar aktiv durch die adäquate Ausrichtung der Sinnesorgane wahrgenommen, allerdings ist dieser Prozess nicht immer bewusst aktiv, sondern stimulusgesteuert. Wenn das Wahrnehmungssystem für Reize empfänglich ist, nimmt es diese auch auf: ertönt ein lauter Ton, kann man sich nicht aktiv entscheiden, ob man 83 Vgl. Dauner/Münzel (2009), S. 100. 29 diesen nun hören möchte oder nicht. Der Reiz erlangt automatisch Zugangsberechtigung zu unserem System.84 Selektive Aufmerksamkeit impliziert allerdings zusätzlich eine zweite Art von Reizauswahl. Nicht die ganze Fülle an zur Verfügung stehenden Reizen kann verarbeitet werden. Obwohl gewisse Reize nicht ausgeschaltet werden können, besteht doch die Möglichkeit, dass sie nach einer bestimmten Zeit fast ganz ausgeblendet werden. Das bedeutet, dass man die Aufmerksamkeit auf etwas Anderes richten kann, weg von dem Reiz, der stört oder nicht als interessant oder relevant eingestuft wird.85 Dabei ist zu bemerken, dass der Fokus dabei nur auf einem Objekt oder einem Input liegen kann. In der Tat kann man sehr schnell zwischen einzelnen Stellen hin und her schalten; trennen kann man die Fokussierung der Aufmerksamkeit aber nicht. Abhängig von der Betrachtungsintensität eines Reizes, kann einem weiteren Reiz nur mehr eine bestimmte Menge an Aufmerksamkeit gewidmet werden. Man geht davon aus, dass eine stärkere Gewichtung auf die bewusst beeinflussbare Verarbeitung, die unbewusste Reizverarbeitung minimiert. Die Schlussfolgerung daraus würde dann die Annahme ergeben, dass es nur eine limitierte Aufmerksamkeitskapazität gibt, die je nach bewusster oder unbewusster Fokussierung verteilt wird. Beide Arten von Stimuliverarbeitung beeinflussen sich gegenseitig.86 Die Frage ob die Kontrolle dieser Verteilung von außen oder innen kommt, ist allerdings schwer zu beantworten. Obwohl die Bedeutungsverleihung an einen Stimulus von außen schwer erfassbar und nachzuforschen ist, ist es doch bekannt, dass diese von unterschiedlichen Bedürfnissen oder Gemütslagen abhängig sind.87 Die aktiv bewusste Selektion ist allerdings nicht nur ein „Wegschalten“ von Uninteressantem, sie hat auch eine entscheidende Bedeutung beim aktiven Agieren. Mulder (2007) beschreibt dies wie folgt: „Das Entdecken eines bekannten Gesichts in einer Menschenmenge ist ein Beispiel für einen derartigen aktiven Selektionsprozess. Hier unterdrücke ich nichts, sondern suche geradezu nach etwas, das ich wiedererkenne.“88 Das Wahrnehmungssystem muss dabei so viele Reize wie möglich entschlüsseln und gleichzeitig auf die bereits gespeicherte Information zugreifen können. Bei diesem Prozess erkennt man die Wichtigkeit der einzelnen beschriebenen 84 Vgl. Mulder (2007), S. 116. Vgl. Mulder (2007), S. 115f und Spitzer (2003), S. 143-145. 86 Vgl. Spitzer (2003), S. 143-145. 87 Vgl. Mulder (2007), S. 116. 88 Mulder (2007), S. 116. 85 30 Parameter: das Gespeicherte wird vom Gedächtnis zur Verfügung gestellt und der Wahrnehmungsapparat kontrolliert die Aufnahme und Encodierung, angeregt durch die Aufmerksamkeit. 3.1.2 Vigilanz Die selektive Aufmerksamkeit ist für eine längerfristige Aufmerksamkeitszuwendung die Voraussetzung. Bei konstantem und differenziertem Informationsfluss sind die Aufrechterhaltung des Fokus und die darauf reagierenden Abläufe nicht schwer zu bewerkstelligen. Dieses Phänomen wird als Daueraufmerksamkeit beschrieben.89 Im Gegensatz dazu beschreibt der Begriff der Vigilanz eine Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit unter „monotonen Reizbedingungen mit geringer Reaktionsfrequenz.“ 90 Viele Studien lassen darauf schließen, dass der Mangel an Information über einen längeren Zeitraum nicht nur die Reaktionsgeschwindigkeit, sondern auch den ganzen Gemütszustand verändern kann. Gezeigt wurde das teilweise durch eine Studie, bei der Probanden ein Ziffernblatt beobachten mussten. Der Sekundenzeiger machte nach beliebigen Wiederholungen hin und wieder einen Doppelschritt. Diesen mussten die Testpersonen durch das Drücken eines Knopfes bemerkbar machen. Trotz ausgesetzter Wiederholung konnte nach kurzer Zeit ein Leistungsabfall bemerkt werden. Bei der Wiederholung dieses Experiments gab man den Teilnehmern drei Uhren zur Beobachtung, womit man zwar wieder einen vorausgesagten Leistungsabfall, allerdings über einen längeren Zeitpunkt und geringeren Ausmaßes, verzeichnen konnte.91 Man kann also den Schluss ziehen, dass auch nur geringe Abwechslung, welche die Mechanismen der selektiven Aufmerksamkeit aktiviert, eine Verbesserung in der Vigilanz bezwecken kann. Aufmerksamkeit beeinflusst also durch unterschiedliche bewusste oder unbewusste Steuermechanismen die Reizaufnahme und filtert nicht nur Information, sondern generiert diese auch. Der Weg zur Speicherung wird von einer generellen Wachsamkeit, der Vigilanz, geebnet und durch eine Art der selektiven Aufmerksamkeit gefördert. In Bezug darauf konnte festgestellt werden, dass die aktive Zuwendung zu einer bestimmten Sache nicht nur die adäquate Reizaufnahme steuert, sondern damit auch aktiv die korrelierenden Gehirnareale anregt. Kurz gesagt handelt es sich dabei sowohl 89 Vgl. Schneider/Niebling (2008), S. 43. Schneider/Niebling (2008), S. 43. 91 Vgl. Mulder (2007), S. 117. 90 31 um einen psychologischen als auch messbar neurobiologischen Prozess. Konzentriert man sich beispielsweise auf bestimmte Farben oder Bewegungen, resultiert dies in einer Aktivitätszunahme in den neuronalen Farb- und Bewegungszentren. So logisch dieser Prozess auch klingen mag, so entscheidend ist er für das Behalten von Informationen. Führt man sich nochmals vor Augen, dass Informationen zum Zwecke des Ordnens durchaus, um dem Beispiel zu folgen, anhand ihrer Farb- und Bewegungseindrücke verarbeitet werden, aber nicht zwingend gespeichert werden, kann man den essentiellen Unterschied bemerken. Erst durch die Aktivierung bestimmter Areale mit Hilfe der selektiven Aufmerksamkeit wird der Weg für die darauffolgende Speicherung von Eindrücken geebnet.92 Betrachtet man dieses Konzept der aktiven Zuwendung in Bezug auf bestimmte Sinneseindrücke, könnte man dessen Wichtigkeit für komplexere Aufgaben erkennen. Denn die Konzentration auf einzelne Informationen aus der Umwelt bildet Bausteine für ganze Situationen und Aufgaben in unserem Alltag. Genauso wie bei Sinneseindrücken gefiltert wird, geschieht das bei Alltagsszenarien. Umgemünzt auf das Musizieren bedeutet das, dass man sich aktiv darauf konzentrieren und anderen Umwelteinflüssen widerstehen muss. Leicht wird man durch andere reizvolle Aktivitäten abgelenkt, was durch die Aufmerksamkeitszuwendung zum Musizieren abgewendet werden kann. Entscheidend dabei ist, dass das Lenken und Beibehalten der Aufmerksamkeit wieder von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird. Illustriert wird dieses durch die neuronalen Verarbeitungsprozesse. Wie zu Beginn erwähnt, sind bei Aufmerksamkeitsprozessen die unterschiedlichsten Gehirnareale beteiligt. Besonders wichtig sind Hirnstrukturen, die sich im Frontal- und Temporallappen befinden. Dabei wird auf Informationen zurückgegriffen, die im Frontallappen mit Gefühlen in Verbindung gebracht und abgespeichert wurden. Zusätzlich ist das Cingulum, welches sich zwischen den beiden Hemisphären von vorne nach hinten durchzieht, von entscheidender Bedeutung. Dieses ist nicht nur physiologisch die Verbindung zwischen den Gehirnhälften, sondern fungiert auch als Schaltzentrale zwischen den kognitiven und emotionalen Informationsspeicherzentren.93 Ausgehend von den beteiligten Gehirnarealen wird schnell klar, dass sich die Verarbeitung von Eindrücken und somit die Beeinflussung der Aufmerksamkeit bis in 92 93 Vgl. Spitzer (2003), S. 146-156. Vgl. Jäncke (2009), S. 53f. 32 die emotionsverarbeitenden und emotionsgenerierenden Hirnstrukturen erstreckt. Das bewusste Lenken und Behalten eines Fokus auf eine Situation ist also genauso gefühlsgebunden wie die Verarbeitung von Informationen. Zusätzlich spielt der Willen, also die Motivation, sich auf eine Situation zu konzentrieren eine große Rolle, was sich in den folgenden Ausführungen noch genauer zeigen wird. 3.2 Emotionen Gedächtnis- und Wahrnehmungsvorgänge wurden als hochkomplexe und miteinander verbundene Prozesse beschrieben und entschlüsselt. Konzepte der Reizaufnahme, Analyse und Implementierung sowie Speichermechanismen sind in diesem Zusammenhang erklärt worden. Ein zusätzlicher entscheidender Faktor, der sowohl bei der Wahrnehmung als auch Informationspräsentation eine Rolle spielt und noch genauere Betrachtung benötigt, ist das Emotionsverarbeitungssystem. Emotionen sind aus den neuronalen Verarbeitungsprozessen nicht wegzudenken, da sie nicht nur an jedem einzelnen von den bereits beschriebenen Konzepten beteiligt sind, sondern auch mit jedem der einzelnen Einflussfaktoren wie Aufmerksamkeit und Motivation in Relation stehen. Da sich die Erforschung von Emotionsprozessen als noch komplexer wie die der Wahrnehmung oder Aufmerksamkeit erweist, wird beschrieben, dass eine allgemein anerkannte Konzeption der Emotionen noch aussteht. Differenzieren kann man allerdings anhand der Emotionsstärke (viel oder wenig) und Valenz (positiv oder negativ), sowie einem kognitiven, gefühlsmäßigem und körperlichem Aspekt. In Hinblick auf die Lokalisation eines emotionalen Zentrums im Gehirn, kann man kein genaues Areal festlegen. Vergleichbar mit dem musikalischen Gedächtnis sind auch hier eine Reihe an unterschiedlichsten Strukturen und Prozessen in verschiedenen Teilen des neuronalen Systems beteiligt. Ein erklärender Faktor zeigt sich in der Verbindung von Körper, Denken und Emotion und der daraus resultierenden Annahme, dass das Gehirn keine Wahrnehmungs- oder Speicherungsprozesse ohne Emotionen vollziehen könnte. Versucht man sich an Ereignisse aus der Vergangenheit zu erinnern, sind die, die am weitesten zurückliegen, höchstwahrscheinlich mit eindrucksvollen Emotionen gepaart und können dadurch wieder schnell ins Bewusstsein geholt werden.94 94 Vgl. Spitzer (2003), S. 157. 33 3.2.1 Neurobiologische Grundlagen Obwohl ein Emotionszentrum als solches nicht zu finden ist, kann man doch bestimmen, welche Gehirnstrukturen an der Entstehung beteiligt sind. Neurophysiologisch gesehen wird das Areal, das am meisten am Entstehen von Emotionen und daraus resultierenden Gefühlsreaktionen beteiligt ist, als das limbische System beschrieben. Dieses beschreibt eine Gruppierung von Strukturen, die unterhalb des Großhirns liegen und somit an den Hirnstamm angrenzen. Verbunden mit der Großhirnrinde greift das limbische System somit auch auf den Hippocampus zu, der entscheidend für Gedächtnisleistungen ist. Zusätzlich besteht eine Verbindung zu den Mandelkernen, der Amygdala, bestehend aus einem tief im Temporallappen gelegenen neuronalen Netzwerk und nicht weit entfernt vom Hippocampus.95 Diese zeichnen sich durch ihre weitläufigen Verbindungen zu weiteren Gehirnarealen aus: So gibt es eine Fülle von auf- und absteigenden Assoziationsfasern zum Neocortex (vor allem in präfrontale Rindenregionen, die für höhere geistige Funktionen verantwortlich sind), aber auch Verbindungen zu den motorischen Rindenarealen und zum vegetativen Nervensystem, das die Tätigkeit der Organe und der Drüsen steuert.96 Diese weitläufigen Verbindungen ermöglichen die Kopplung von wahrgenommenen Reizen mit Empfindungen, welche bei der Übertragung in die Großhirnrinde zu Emotionen transformiert werden. 3.2.2 Emotionaler Einfluss auf kognitive Prozesse Bei der Auswahl der Reize, wie es bei der ersten Phase des Wahrnehmungsprozesses geschieht, ist das limbische System bereits beteiligt. Erst durch dessen Bewertung wird es einem Reiz möglich, weiterverarbeitet zu werden und was wir wahrnehmen, ist abhängig vom Fokus unserer Aufmerksamkeit. Der Fokus der Aufmerksamkeit ist wiederum emotionsgesteuert. Es herrscht also eine enge Verknüpfung zwischen den beiden Einflussfaktoren Aufmerksamkeit und Emotion, was wiederum Einfluss auf die Wahrnehmung und in weiterer Folge auf die Speicherung hat. Denn ohne das limbische System und dessen Gefühlsausschüttung würde das Konzept der Aufmerksamkeit nicht funktionieren, was wiederum Einfluss auf Wahrnehmung und Verarbeitung hätte. Ein gutes Beispiel dafür kann man an sich selbst beobachten: Beobachtet man an Tagen, an denen man sich selbst nicht besonders gut fühlt, seine eigene Wahrnehmungslenkung, 95 96 Vgl. Brandstätter (2004), S. 178-180. Brandstätter (2004), S. 179. 34 wird man erkennen, dass sich diese auf Menschen mit ähnlichem Gemütszustand bezieht. Ist man also selbst schlecht gelaunt, kann man bemerken, dass einem eher Leute mit selbigem Gesichtsausdruck oder korrelierenden Äußerungen auffallen.97 Wenn das limbische System die Aufmerksamkeit zum Positiven hinlenkt und damit den Zugang zu den Gedächtnisinhalten öffnet, findet in den weiteren Wahrnehmungsphasen die Reizanalyse inklusive emotionalem Abgleichen mit bereits gespeicherten Erfahrungen hinsichtlich Bekanntheit, Ähnlichkeit und emotionaler Koppelung statt. Erkennt das limbische System eine neue positive Reizerfahrung, resultiert dieses in der Ausschüttung des Neurotransmitters Dopamin. Dieser unterstützt die Synapsenbildung zwischen den Neuronen und bildet somit die Voraussetzung für die Prozesse, die dem Denk- und Sprachvermögen zugrunde liegen: „Planung von Bewegungen, Merkspanne, geistige Flexibilität, abstraktes Denken, zeitliche Sequenzierung [und] Kreativität“. 98 Diese wiederum können nur stattfinden, wenn ein Speicher existiert. Kurz gesagt, beeinflusst die Bildung von Dopamin in erster Instanz die Organisation und das Anlegen von Gedächtnisinhalten bevor weitere Vorgänge stattfinden können.99 Längerfristige und sinnvoll geordnete Abspeicherung von Inhalten, die jederzeit abrufbereit sein sollen, ist also emotionsbedingt. Tatsache ist, dass emotionsgebundene Inhalte effektiver, also schneller und mit besserer Verknüpfung, registriert werden. Durch die Koppelung von Emotionen und Reizen entstehen Markierungen im Gedächtnis, die ein schnelleres Abrufen der gespeicherten Informationen bei erneutem Reizeintritt ermöglichen. Besonders wichtig ist diese emotionale Abspeicherung für musikalische Inhalte. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die emotionale Entschlüsselung von musikalischen Eindrücken wesentlich schneller erfasst wird, als andere musikbezogene Parameter. Daraus könnte man also die These ableiten, dass „[…] die Fähigkeit, auf Musik mit Gefühlen zu reagieren, besonders tief in unserem Gehirn verankert ist.“100 Wie tief Emotionen generell in unserem Gehirn verankert sind, zeigt sich auch in der Art und Weise, wie Menschen manchmal spontan auf bestimmte Sinneseindrücke reagieren. Laute Geräusche oder hochfrequente Töne rufen zum Beispiel bei vielen Abwehr- oder Fluchtmechanismen hervor. Die Grundlagen für diese automatischen 97 Vgl. Brandstätter (2004), S. 180. Petrat (2014), S. 74. 99 Vgl. Petrat (2014), S. 74f. 100 Petrat (2004), S. 76. 98 35 Reaktionen lassen sich in der menschlichen Evolution finden. Menschen mussten bei Bedrohung schnell reagieren um ihr Überleben zu sichern, was oft keine Zeit für Überlegungen zuließ. Emotionen bahnten für adäquates und schnelles Handeln den Weg, indem sie dieVoraussetzungen dafür schufen, Situationen so schnell wie möglich zu erfassen. Heute noch merkt man die unwillkürlichen Reaktionen des Körpers wie Muskelanspannung, Zittern und erhöhte Herzfrequenz in Stress- oder Angstsituationen.101 Angst Angst ist ein elementares Gefühl, was evolutionär bedingt tief im menschlichen Emotionssystem verankert ist. Oft für die Beschleunigung eines Lernprozesses verantwortlich, entsteht die Emotion der Angst in den Mandelkernen. Diese sind der Ursprungsort für die Kopplung von Angst an bestimmte Situationen und die daraus resultierenden Vermeidungsmechanismen. Zusätzlich zur situativen Emotionskopplung können aber auch weiter entfernte Erfahrungen bereits den Zustand der Panik hervorrufen. So kann zum Bespiel die Angst vor Hunden beim bloßen Hören eines Bellen ohne das Tier auch nur zu sehen, in nicht beeinflussbaren körperlichen Reaktionen resultieren. Der Verarbeitungsprozess, der zu dieser automatischen Reaktion führt, vollzieht sich dabei wie folgt: Der erste Reizeindruck, ob es nur ein Bellen oder das Tier an sich ist, wird an einen Teil des im Zwischenhirn befindlichen Thalamus geleitet. Bereits am Weg dorthin findet eine elementare Erstanalyse des Reizes statt, welche dann in den korrelierenden Kortex (visueller oder auditorischer) weitergeleitet wird. Noch bevor die Reizverarbeitung dort vollendet ist, hat der Thalamus die Resultate der Erstanalyse an die Amygdala weitergeleitet, welche die automatischen körperlichen Abwehrreaktionen initiiert.102 Evolutionsbedingte Angstreaktionen beschränken sich allerdings nicht nur auf körperliche Erfahrungen, sondern auch auf geistige. So positiv sich diese automatisierten Vorgänge auch erweisen können, so negativ können sie sich auch auf unser Leben auswirken. Vergleichbar mit dem gebrachten Beispiel vom automatischen Fluchtverhalten initiiert durch Hundebellen, gibt es Erkenntnisse über ähnlich ablaufende kognitive Abwehrmechanismen. Das bedeutet, dass Angst auch eine ganz 101 102 Vgl. Petrat (2014), S. 26f. Vgl. Spitzer (2003), S. 162f. 36 bestimmte kognitive Reaktion hervorrufen kann, welche „[…] das rasche Ausführen einfacher gelernter Routinen erleichtert und das lockere Assoziieren erschwert. […] Wer Prüfungsangst hat, der kommt einfach nicht auf die einfache, aber etwas Kreativität erfordernde Lösung, die er normalerweise leicht gefunden hätte.“ 103 So kann ein evolutionsbedingter Abwehrmechanismus heutzutage zusätzlich zu Schwierigkeiten bei wichtigen Lernprozessen führen. Denn die Tatsache, dass Kreativität durch Angstgefühle gehemmt wird, hat durch ihren Einfluss auf Erlebtes auch Einfluss auf die Speicherung von Situationen. Ist es jemandem nicht möglich die persönlichen kreativen Eigenschaften in einer gewünschten Situation zu entfalten, kann das zu einer angstbesetzen Erinnerung führen, die dann den Speicherungsprozess negativ beeinflussen könnte. Inwiefern die Gedächtnisinhalte tatsächlich durch emotionale Codierung beeinflusst werden können, wurde in einer Studie getestet, durch welche man zusätzlich die Beteiligung von bestimmten Hirnarealen herausfinden wollte.104 Testpersonen wurden Bilder mit auslösenden positiven, negativen oder neutralen Emotionen in Verbindung mit zu speichernden Wörtern gezeigt. Die Wörter sollten im Anschluss in unbestimmter Reihenfolge wiedergegeben werden. Dabei konnte herausgefunden werden, dass die emotionale Färbung einer Speicherung tatsächlich Einfluss auf die Beteiligung bestimmter Hirnstrukturen ausübt. Begriffe, die in einen positiven Kontext eingebunden waren, wurden nicht nur am besten erinnert, sondern aktivierten beim erfolgreichen Speicherprozess auch eher den Hippocampus. Wurden negative Emotionen mit Wörtern gekoppelt, konnte eine erhöhte Aktivität der Amygdala hinsichtlich wieder abrufbarer Informationen verzeichnet werden. Während neutrale Emotionen beim erfolgreichen Einspeichern eine offensichtliche Beteiligung des unteren Frontallappen bewirken, aktivieren wiederum neutrale Informationen mit negativer Codierung die 105 Mandelkerne. Als Schlussfolgerung kann also gezogen werden, dass im Allgemeinen Gefühle nicht vom Denken getrennt werden können. Denn ohne emotionale Färbung der Inhalte nimmt man an, dass diese nicht erfolgreich, also wieder abrufbar, gespeichert werden können. Zusätzlich wurde bei diesem Experiment eine offensichtliche Verbesserung in 103 Spitzer (2003), S. 164. Vgl. Erk et al. (2002), S. 439-447. 105 Vgl. Spitzer (2003), S. 165-167. 104 37 der Speicherleistung unter Einfluss einer positiven Grundeinstellung verzeichnet. 106 Zusammengefasst kann man also behaupten, dass das Erzeugen eines positiven Gemütszustands, der durch unterschiedliche Faktoren hervorgerufen werden kann und sich als essentiell für erfolgreiches Implementieren von Informationen gezeigt hat, das übergeordnete Ziel eines jeden Lern- und Erfahrungsprozesses sein sollte. Denn nur durch eine positive Codierung von erlernten Inhalten, kann man am ehesten annehmen, dass diese nicht nur am längsten in unseren Speichern verankert bleiben, sondern auch am besten wieder aufgerufen werden können. Stress Angst ist nicht der einzige Dopaminhemmer, der somit Einfluss auf den generellen Speichervorgang ausübt. Die Ausschüttung des Neurotransmitters ist entscheidend für die Synapsenentwicklung und somit für die erfolgreiche Verankerung eines Inputs in das bereits bestehende Neuronennetzwerk, was wiederum die Voraussetzung für das spätere unbegrenzte Abrufen der Information darstellt. Vergleichbar mit Angstgefühlen, hemmt Stress aber nicht nur den Informationsaufnahmeprozess, sondern auch den Abruf von bereits Gespeichertem. Stresserzeuger haben dabei den gleichen Einfluss auf den Organismus wie bereits bei Angstreaktionen beschrieben wurde. Bei der Unvereinbarkeit von Anforderungen aus der Umwelt mit den persönlichen Kompetenzen, Einstellungen und Bedürfnissen entsteht ein Zustand des Ungleichgewichts. Dieser Zustand wird als Stress definiert, der in Wechselwirkung mit der Situation, die das Ungleichgewicht hervorruft, steht. Stress, hervorgerufen durch eine spezifische Situation beeinflusst wiederum die Stresssituation. Entscheidend dabei ist, dass dieses zirkuläre Verhältnis vom individuellen Organismus abhängig ist. Denn inwiefern jeder Einzelne auf bestimmte Situationen mit Stressreaktionen reagiert, ist keine allgemein erfahrbare Tatsache, sondern abhängig von persönlichen Erfahrungen und Verarbeitungsmechanismen.107 Obwohl Stress, wie viele emotionale Reaktionen, individuell bedingt ist, konnte man doch Erkenntnisse hinsichtlich Situationen, die vermehrt Stress hervorrufen, gewinnen. Um dieses zu zeigen, wurden zwei Affen, die für mehrere Tage keine Nahrung bekamen, mit anderen, die regelmäßig gefüttert wurden, in einen Käfig gesperrt. Dabei 106 107 Ebd. Vgl. Asen (2004), S. 102. 38 konnte beobachtet werden, dass die fastenden Tiere emotionale Stressreaktionen zeigten, wenn sie den anderen beim Fressen zuschauen mussten. Im Gegensatz dazu zeigten die beiden Affen keine solchen Reaktionen, wenn sie nur zu zweit und getrennt von den anderen im Käfig fasten mussten. Der Stresserzeuger war in diesem Experiment also nicht das Fasten an sich, sondern die psychologische Situation. Durch eine andere Studie zu stressauslösenden Umständen konnte zusätzlich die Annahme bestätigt werden, dass kalkulierbare Stresshervorrufende Disharmonie erträglicher ist, als spontane Stresssituationen. Bei dieser wurden zwei Ratten in unterschiedlichen Käfigen die gleiche Anzahl an unangenehmen Elektroschocks versetzt. Der Unterschied zwischen den beiden war allerdings, dass eine Ratte das Auslösen des Schocks manchmal durch einen Hebelmechanismus verhindern konnte, während der anderen ständig überraschend einen Schlag versetzt wurde. Essentiell dabei war, dass die Ratte, die eine begrenzte Kontrolle hatte, weniger Stresssymptome zeigte, als die andere.108 Die Erkenntnisse, die man aus beiden Experimenten ziehen kann, sind von entscheidender Wichtigkeit hinsichtlich der Bedeutung von Stress für die Reizverarbeitung und Einbettung in das Langzeitgedächtnis. Es wurde gezeigt, dass man annehmen kann, dass die Aufgabe an sich nicht das Problem bei einem Lernprozess darstellen kann, sondern eher die psychologische Situation, in welche man diese integriert. Nicht der Inhalt ist der Stressauslöser, sondern die Präsentation oder die Erarbeitungsweise. In Verbindung dazu kann man den Stresspegel reduzieren, wenn man sich auf stressauslösende Situationen einstellen kann, anstelle von überraschendem Erzeugen eines Ungleichgewichts von äußerlichen Anforderungen und innerlichen Leistungsvoraussetzungen. 3.3 Motivation Motivation ist der zentrale Antrieb für unser Handeln. Obwohl die beiden vorangegangenen Konzepte von Aufmerksamkeit und Emotionen auch wichtig für handlungsorientierte Prozesse sind, beeinflussen diese doch eher Wahrnehmungs- und Speicherungsvorgänge. Ohne Motivation als die Gesamtheit der Motive unseres Tuns würden wir uns Menschen, banal ausgedrückt, nicht mehr von der Stelle bewegen. Der evolutionsbedinge Antrieb in uns ist daher ein nicht zu verachtender, übergeordneter 108 Vgl. Spitzer (2003), S. 167-170. 39 Faktor hinsichtlich der bereits beschriebenen neuronalen Vorgängen, die sich alle als essentiell für musikalisches Verstehen und Handeln zeigen. Motivation als weitgefächerter Begriff spielt in vielen Lebenslagen eine Rolle. Achtet man darauf, bemerkt man eventuell, dass die meisten Alltagshandlungen nur durch das innere Antriebssystem erst ermöglicht werden können. Viele fragen sich vielleicht auch manchmal, wie man dieses oft unbewusste System bei sich selbst und bei anderen zum Positiven beeinflussen kann. Folgt man der weit anerkannten Theorie der Konditionierung, müsste das Antriebssystem durch das Streben nach Erwünschtem und dem Vermeiden von Unerwünschtem durch Belohnung und Bestrafung einfach beeinflussbar sein. Dass diese Theorie nicht die ganze und einzige Erklärung sein kann, zeigt sich immer wieder in nicht zutreffenden menschlichen Reaktionen. 109 Um der Frage nach der Beeinflussung auf den Grund zu gehen, werden im folgenden Abschnitt nicht nur die neuronalen Grundlagen von Motivation, sondern auch verschiedene motivationale Ansätze behandelt. 3.3.1 Das Belohnungssystem und Aktivierungsbeispiele Die Tatsache, dass unser Gehirn durchgehend mit einer Fülle an Reizen umgehen muss, wurde bereits in vorherigen Kapiteln ausführlich beschrieben. Erwähnt wurde, dass Reize dabei vorverarbeitet werden müssen, um deren Relevanz zu prüfen. Hinsichtlich der Motivationsprozesse ist es in diesem Zusammenhang entscheidend, dass das Gehirn bei dieser Voranalyse kontinuierlich Ergebnisse von Reizanalysen vorhersagt. Nur dadurch ist es möglich, die Schnelligkeit der Informationsaufnahme und Bewertung zu gewährleisten und beizubehalten. Erfüllen die eintreffenden Stimuli das Erwartete, braucht das System dieses nicht weiterzuverarbeiten und die Reize werden deshalb auch nicht weiterhin festgehalten. Übertrifft das Resultat der Analyse das zuvor Angenommene, wird ein Signal durch die Ausschüttung des Botenstoffes Dopamin generiert. Dieses wiederum bildet die Voraussetzung für Speichermechanismen, wie auch schon im vorigen Kapitel beschrieben wurde.110 Der Botenstoff Dopamin ist demnach an verschiedenen neuronalen Prozessen beteiligt. Er bildet die Basis für vier funktionelle Systeme, von welchen eines für Belohnung und Motivation verantwortlich ist. Die dopaminergen Neuronen haben ihren Sitz im 109 110 Vgl. Spitzer (2003), S. 175. Vgl. Spitzer (2003), S. 176f. 40 Mittelhirn mit direkten Verbindungen zum so-genannten Nucleus accumbens, einem Kerngebiet in den Basalganglien.111 Dieser schickt nicht nur die Impulse weiter zum frontalen Kortex, sondern ist auch für die Produktion von körpereigenen opiatähnlichen Stoffen verantwortlich. Vergleichbar mit künstlich hergestellten Opiaten, aktivieren sie das neuronale Netzwerk, in welches der Nucleus accumbens eingebettet ist. Das Resultat daraus ist die Weiterleitung der eigens produzierten Opioide in den Frontalkortex. Dieser Prozess erzeugt einen Belohnungseffekt, welcher als Basis für die Informationsspeicherung beschrieben werden kann. Entscheidend dabei ist, dass das Dopaminausschüttungssystem für die Bewertung von Reizen zuständig ist. Es wird erst aktiviert, wenn etwas noch nicht Bekanntes, etwas Unvorhergesehenes mit positivem Effekt oder generell etwas Gutes für uns selbst von Bedeutung ist.112 Das Dopaminsystem kann also als das köpereigene Belohnungssystem beschrieben werden. Studien haben gezeigt, dass dessen bewusste Stimulation durch die Einnahme von Suchtgiften wie Kokain genauso wie durch das Essen von Schokolade stattfindet. Zusätzlich wurde beobachtet, dass Musik den gleichen Effekt hervorrufen kann. Die dazugehörige Studie beinhaltete Testpersonen mit musikalischer Vorbildung, bei welchen durch die Wahl ihres Lieblingsstückes Gänsehaut verursacht wurde. Je nach Intensität der Gänsehautreaktion konnte sowohl eine Aktivitätszunahme in bestimmten Gehirnarealen als auch eine Abnahme in anderen festgestellt werden. Wie erwartet konnte eine Beteiligung des Bereichs um den Nucleus accumbens festgestellt werden, welcher sich auch bei der Einnahme von Kokain und Schokolade als aktiv gezeigt hat. Allerdings verzeichnete man zusätzlich Aktivität im „[…] linken dorsomedialen Mittelhirn, dem rechten orbitofrontalen Kortex sowie der Insel beidseits (ebenfalls bekanntermaßen in Bewertungsvorgänge bzw. emotionale Prozesse involviert) sowie Bereichen, die für Aufmerksamkeit […] und Bewegungskontrolle […] zuständig sind.“113 Interessanterweise bemerkte man eine Aktivitätsreduktion in den beidseitigen Mandelkernen, welche bereits als der Ursprungsort für Angstreaktion beschreiben wurde, und in einem Teil des präfrontalen Kortex, welcher bei Unwohlsein tätig wird. Als angenehm empfundene Musik hat demnach einen entscheidend weitläufigeren Effekt als die Einnahme von Rauschdrogen. Einerseits stimuliert sie das Belohnungssystem durch die Ausschüttung von Dopamin und folglich der Produktion 111 Vgl. Braus (2004), S. 34. Vgl. Spitzer (2003), S. 195. 113 Spitzer (2003), S. 188. 112 41 von endogenen Opioiden, was andererseits zueiner Aktivitätsabnahme der angst- und stressauslösenden Areale führt. Musik könnte demnach als Einflussfaktor für generelles Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit gesehen werden.114 Unter den vielen Studien hinsichtlich des Belohnungssystems ist eine weitere besonders prägnant, wenn man die Wichtigkeit von menschlichen Interaktionen erkennt. Vergleichbar mit den Hirnaktivitäten, die durch musikalische Stimuli hervorgerufen werden, konnte ein ähnlicher Effekt bei der Betrachtung von positiven Gesichtsausdrücken und freundlichen Äußerungen bemerkt werden. Die Resultate der Testpersonen, denen Bilder mit nach vorne fokussierenden attraktiven Gesichtern gezeigt wurden, korrelierten mit jenen, welche mit unattraktiven und wegschauenden Gesichtern konfrontiert wurden: Bei beiden Situationen wurde eine Aktivitätsänderung im ventralen Striatum (der Bereich um den Nucleus accumbens) in Form einer Wechselwirkung verzeichnet. Das Belohnungssystem war also sowohl bei direkter und bei abgewendeter Blickrichtung aktiv. In Relation dazu, hatte auch die Darbietung von positiven und negativen Wörtern in einer andern Studie eine erhöhte Dopaminausschüttung zur Folge.115 Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass das Belohnungssystem durch die unterschiedlichsten Stimuli aktiviert werden kann. Die wesentliche Voraussetzung für die Aktivierung manifestiert sich aber nicht nur in der Art des Informationsträgers, welcher relevante und neue Erkenntnisse beinhalten sollte, sondern auch in der Art der vorherrschenden motivationalen Grundstimmung des Rezipienten. Da der Ursprung und die Form unseres Handelns von den unterschiedlichsten Faktoren abhängt, wird zwischen verschiedenen äußeren und inneren motivischen Entstehungsorten und –arten unterschieden, was zur Erläuterung der Frage nach der Erzeugung und Beeinflussung von Motivation beitragen wird. 3.3.2 Motivationsarten Ausgehend von der Frage nach dem Antrieb hinter dem menschlichen Tun gibt es unzählige Motivationstheorien resultierend aus der Vielfältigkeit der Handlungsmotive. Teilweise können Ursachen des Verhaltens oft gar nicht bewusst artikuliert werden, während der Auslöser von manchen Reaktionen klar auf äußerliche Bedingungen 114 115 Vgl. ebd. Vgl. Spitzer (2003), S. 184-192. 42 zurückzuführen ist. Die Art und Weise wie sich Motivation äußert kann daher unter anderem auch auf Rahmenbedingungen die biologische zurückgeführt Ausstattung werden. In oder Bezug auf darauf die sozialen können zwei unterschiedliche Ausprägungsformen definiert werden, die beide unter Einfluss der genannten und noch weiteren Faktoren stehen.116 3.3.2.1 Intrinsische Motivation Wie bereits angedeutet kann der Auslöser von Motiven oft nicht selbst definiert werden. Bei genauerer Betrachtung könnte man allerdings die Richtung eines Handlungsdrangs erkennen. Manche würden zum Beispiel die Begründung ihres Handelns auf die daraus resultierende Freude zurückführen. In Bezug auf das Belohnungssystem ist dabei zu bemerken, dass ehrliche Freude nicht von außen in ein System eingepflanzt werden kann. Die Dopaminausschüttung im Gehirn ist kein extern initiierbarer Vorgang. Die erste motivationale Ausprägungsform kann daher auf einen inneren Ursprungsort zurückgeführt werden. Diese so genannte intrinsische Motivation bezieht sich auf Handlungen, welchen interne und individuelle Interessen zugrunde liegen. Voraussetzung dafür ist die Tatsache, dass sich die „handelnde Person als autonom oder selbstbestimmt wahrnimmt.“ 117 Autonomes Handeln bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Gegebenheit, dass der Zweck einer Handlung in der Handlung selbst liegt. Der Hintergrund einer Handlung ist also der eigene Antrieb, welcher sich durch die Freude an der Sache oder durch die Befriedigung der Handlung zeigen kann.118 3.3.2.2 Extrinsische Motivation Obwohl intrinsische Motivation nicht von außen erschaffen werden kann, kann sie doch durch äußere Faktoren beeinflusst werden. Betrachtet man seine eigene Handlungsbereitschaft, kann man so manchen Ursprung auf keine rein intrinsischen Faktoren zurückführen. Dieser Umstand wird durch den Begriff der extrinsischen Motivation beschrieben und bezieht sich auf das Ausführen einer Handlung auf Basis von erzielbaren Folgen. Der Fokus liegt dabei nicht auf dem Tun selbst sondern auf dem daraus entstehenden erwünschten Resultat.119 116 Vgl. Hechinger (2010), S. 24. Hechinger (2010), S. 25. 118 Vgl. Hechinger (2010), S. 25f. 119 Vgl. Hechinger (2010), S. 27f. 117 43 Das Durchführen der Handlung, obwohl extrinsisch motiviert, findet doch auf der Ebene der Selbstbestimmtheit statt. Nur durch eine gewisse Anerkennung der von außen wirkenden Einflüsse kann der Sinn einer Handlung erkannt werden, was wiederum entscheidend für die Durchführung und den Speicherungsprozesseines Inputs ist. In diesem Sinne spricht man von Internalisations- und Integrationsprozessen, welche den Grad der Anerkennung und Implementierung von extrinsischen Motiven beschreiben. Abhängig von den Prozessen der vollständigen Aufnahme von extrinsischen Motivationsgründen (Internalisation) und der langsameren Integrierung von neuen und Abgleichung mit vorhandenen Motiven (Integration) werden bestimmte Formen von extrinsischer Motivation unterschieden.120 Wird eine Handlung nur in Hinblick auf eine versprochene Belohnung ausgeführt, ist diese die unterste Stufe auf einer Skala von fremdbestimmten Motivationsformen. Es handelt sich dabei um externale Verhaltensbeeinflussung, die nur so lange aufrechterhalten wird, solange der Anreiz der Belohnung existiert. Obwohl sich der Ausführende auf das zu Erfüllende einlassen muss um überhaupt zu handeln, ist das Ergebnis dieses Tuns in Qualität nicht mit motivierterem Verhalten zu vergleichen. Oft werden bei dieser extremsten Form der Fremdbestimmtheit nicht ausreichende Bewältigungsstrategien angewendet, was auch auf die durch extrinsische Faktoren bedingte Kreativitätseinbuße zurückgeführt werden kann. „Gleichzeitig ist das Verhalten meist durch negative Erlebnisqualitäten (wie zum Beispiel Angst, Stress und/oder wenig Freude) gekennzeichnet.“121 Kurz gesagt ist diese Form der Motivation nicht nur schädigend für das Ergebnis der Handlung, sondern beinhaltet durch das geringstmögliche Maß an Selbstbestimmtheit auch mögliche destruktive Auswirkungen auf das emotionale Befinden. Die nächste Stufe auf der Motivationsskala in Richtung Autonomie beschreibt Handlungen, die durch Verpflichtungen geprägt sind. Aufgaben werden nur erledigt, damit das allgemeine Ansehen von anderen gewährleistet ist. Ziele und Motive, die gesellschaftlich anerkannt sind, werden dabei als Motivationsanstoß gesehen und dienen als Vermeidungsreaktionen hinsichtlich Angst- und Stressgefühlen. Diese können durch ein fehlendes Zugehörigkeitsgefühl entstehen, welches evolutionsbedingt in den menschlichen Köpfen verankert ist. Durch das Erfüllen von allgemein anerkannten 120 121 Vgl. Hechinger (2010), S. 27f. Hechinger (2010), S. 29. 44 Motiven soll eine Akzeptanz in der Gesellschaft hervorgerufen werden, was wiederum zu einem Gefühl der inneren Zufriedenheit führen soll.122 Die beiden beschriebenen extrinsischen Motivationskonzepte werden hauptsächlich durch ihren hohen Anteil an Fremdbestimmtheit charakterisiert. Die darauffolgende und somit dritte und vorletzte motivationale Ausprägungsform zeichnet sich durch ihr viel stärkeres Maß an Autonomie aus. Dabei orientiert man sein Tun zwar genauso wie beim vorherigen Konzept an allgemein anerkannten Verhaltensweisen, erhöht dabei aber unbewusst den Grad der Integration. Zuvor wurden gesellschaftliche Ideale und Ziele nur verfolgt, um als Mitglied anerkannt zu werden. Nun kann man sich mit diesen identifizieren und versieht die anerkannten Werte mit persönlichen Hintergrundinformationen und Erklärungen für deren Anerkennung und folglich der Aufnahme in das eigene Selbstkonzept.123 Die oberste Stufe auf der extrinsischen Skala ist die bereits zu Anfang erwähnte zur Gänze integrierende Motivationsform. Diese beinhaltet den höchsten Grad an Autonomie, bezieht ihre Impulse aber von der Außenwelt. Gehandelt wird zwar nicht zum Selbstzweck wie bei intrinsischen Intentionen, allerdings sind dabei „[…] Ziele und Werthaltungen vollständig und widerspruchsfrei in das eigene Selbst integriert.“124 Der Unterschied zwischen diesen beiden motivationalen Ausprägungsformen besteht somit darin, dass die extrinsische Motivation noch immer von außerhalb des Systems generierten Ansichten geleitet wird und die reine Selbstbestimmtheit als solche nur bei intrinsischen Motiven zu finden ist. Kann man keinerlei Handlungsbereitschaft verzeichnen, weder extrinsisch noch intrinsisch, wird diese Inaktivität als Amotivation beschrieben. Entstehen kann ein solch fehlender Handlungstrieb durch die fehlende Sinnerkenntnis oder destruktive Gefühle der Inkompetenz und Überforderung.125 Die Gegenpole Amotivation und intrinsische Motivation verdeutlichen den Entwicklungsprozess von Fremdbestimmtheit zu Selbstbestimmtheit. Letztere trägt nicht nur zu allgemeinem Wohlbefinden bei, welches in diesem Kontext durch die Freude an der Handlung erklärt werden kann, sondern auch nachweislich zur Qualität 122 Vgl. Hechinger (2010), S. 29. Vgl. Hechinger (2010), S. 29. 124 Hechinger (2010), S. 30. 125 Vgl. Hechinger (2010), S. 28. 123 45 der Handlungsergebnisse und in weiterer Folge den neuronalen Integrationsprozessen. 126 Die Entwicklung der Selbstbestimmtheit, oft erreicht durch das Durchlaufen des zuvor beschriebenen Internalisierungsprozesses, kann durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst werden, die zur Förderung einer positiven Motivationsstimmung beitragen. Kurz gesagt, zeigt sich die Wichtigkeit dieser Faktoren in ihrem positiven Einfluss auf das generelle Konzept der Motivation. Nur wenn sich ein Individuum autonom und selbstbestimmt fühlt, ist die Wahrscheinlichkeit der Entspannung am höchsten, was eine Blockade von etwaigen Hemmungsgefühlen wie Angst oder Stress minimieren kann.127 3.3.2.3 Leistungsmotivation Die Konzepte der intrinsischen und extrinsischen Motivation nehmen eher Bezug auf den Entstehungshintergrund und Ursprung menschlichen Verhaltens. Da die Ursachen unseres Handelns je nach Situation und persönlichen Erfahrungen, Gemütszuständen und sozialen Umständen variieren kann, ist es von wichtiger Bedeutung einen weiteren motivationalen Faktor miteinzubeziehen: das leistungsmotivierte Verhalten. Vergleichbar mit den vorherigen Ausführungen ist auch bei der Leistungsmotivation die Möglichkeit der Selbstbestimmung als Voraussetzung anzuerkennen. Zurückzuführen ist dies auf den Kerngedanken des Konzepts, welcher durch das Erreichen oder Verfehlen von bestimmten Bezugsnormen durch persönliche Fähigkeiten charakterisiert wird. Diese Bezugsnormen können sowohl fremdbestimmt, also von außen vorgegeben, oder selbstbestimmt gesetzt sein. Der motivierende Faktor an diesem Konzept wird dabei nicht nur durch die Erreichung der Normen, gefördert durch die individuellen Kompetenzen, erzeugt, sondern auch durch den jeweiligen Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung determiniert. Das individuelle Anspruchsniveau ist dabei die treibende Kraft im Hintergrund, die Einfluss auf die Wahl der Aufgabe und dessen Erfüllbarkeit ausübt.128 Ausschlaggebend bei einer Aufgabenwahl ist daher nicht nur die „[…] Erfolgswahrscheinlichkeit sondern auch […] der Anreiz des Erfolges. Je schwieriger eine zu bewältigende Aufgabe erscheint, desto größer ist der Anreiz.“129 Entscheidend dabei ist allerdings, dass die Ziele noch erreichbar erscheinen und nicht die individuellen Kompetenzen überschreiten würden. 126 Vgl. Lämmle (2011), S. 102f. Vgl. Hechinger (2010), S. 30. 128 Vgl. Schlag (2006), S. 85. 129 Hechinger (2010), S. 20. 127 46 Das subjektive Empfinden der Erfolgswahrscheinlichkeit determiniert die Wahrnehmung der Anforderungssituation. Abhängig vom Selbstkonzept eines Individuums wird zwischen Erfolgsmotivation und Misserfolgsmotivation unterschieden. Personen, die sich ihres Könnens und ihrer Fähigkeiten bewusst sind und die Erfüllung einer Aufgabe eher auf ihre eigenen Kompetenzen zurückführen, werden als erfolgsmotiviert beschrieben. Misserfolge werden in diesem Zusammenhang auf Einflussfaktoren von außen oder zufälligen Begebenheiten zurückgeführt. Diese Personen würden eher schwierigere als zu leichte Aufgaben wählen, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Im Gegensatz dazu gibt es diejenigen, die sich lieber Leistungssituationen entziehen möchten, um Misserfolg, welcher auf ihre persönlichen Eigenschaften zurückgeführt werden könnte, zu vermeiden. Es werden dabei entweder sehr schwierige oder sehr leichte Aufgaben gewählt. Bei unerfüllbaren Zielen kann das Versagen als allgemein anerkannte Reaktion abgetan werden, da diese ja auch von keinem anderen erreicht werden können. Sehr leichte Aufgaben hingegen ermöglichen einen schnellen Erfolg, was der Vermeidung des aufkommenden Schamgefühls bei Misserfolg entgegenwirken kann. Zusätzlich neigen diese Personen dazu, Erfolg durch zufällige oder glückliche Umstände zu erklären und dabei ihren persönlichen Beitrag durch ihre Kompetenzen zu ignorieren.130 Beide Arten von Leistungsmotivierung sind kaum getrennt in einer Person zu verzeichnen. Handlungsmotive können durch beides, Streben nach Erfolg und das Vermeiden von Misserfolg, gleichzeitig beeinflusst und initiiert werden. Wichtig ist in diesem Kontext, dass die Art der Polarisierung zum einen oder anderen Extrem zu erkennen ist und die Aufgabenstellung demnach ausgewählt oder zusammengestellt werden soll. Ein zu hoher oder niedriger Schwierigkeitsgrad ist für Speicherungsprozesse nicht förderlich, da die Personen dabei selten adäquat gefördert werden können.131 3.3.3 Psychologische Grundbedürfnisse Zufriedenheit in Hinblick auf den motivationalen Effekt kann man durch intrinsische und somit vollkommen selbstbestimmte Handlungshintergründe erlangen. Die Beeinflussung des Selbstkonzepts kann man also als Voraussetzung für mögliche 130 131 Vgl. Hechinger (2010), S. 20-22. Vgl. Hechinger (2010), S. 21f. 47 Einflussfaktoren hinsichtlich Motivation im Allgemeinen betrachten. Die Tatsache, dass das neuronale Belohnungssystem nicht external initiiert werden kann und eine Motivationserzeugung von außen eigentlich nicht stattfinden kann, sollte in Hinblick auf die Didaktik durch die Möglichkeiten der Beeinflussung und Förderung kompensiert werden. Jeder Mensch hat Grundbedürfnisse, die er befriedigt sehen möchte. In Hinblick auf motivatonale Vorgänge spielen drei davon eine entscheidende Rolle. Wie bereits bei den extrinsischen Motivationsformen erwähnt wurde, sind das soziale Umfeld und die Beziehung zwischen einem Individuum und seiner gesellschaftlichen Umwelt von wichtiger Bedeutung. Das Gefühl der Eingebundenheit in ein soziales Netzwerk hat sich als eines der menschlichen Grundbedürfnisse gezeigt. Im Zuge dessen ist das Empfinden von Selbstkompetenz ein weiterer Einflussfaktor. Menschen, die sich in ihrem Können und in ihren individuellen Kompetenzen selbstbewusst fühlen,gesellschaftlich anerkannte und auferlegte Aufgaben adäquat lösen zu können, „weisen verstärkt ein auf Selbstbestimmung beruhendes Verhalten auf.“132 Ein weiterer bedeutender Faktor ist das Erleben und Spüren der Autonomie. Eine Entwicklung von Selbstbestimmtheit ist nur möglich, wenn man das Gefühl unabhängig handeln zu können, schon erlebt hat.133 Die Förderung dieser drei psychologischen Grundbedürfnisse ist zwar keine Garantie für eine Motivationssteigerung, kann aber zu einem verbessertem menschlichen Wohlbefinden beitragen. 134 Dieses beeinflusst die emotionalen Voraussetzungen für eine positive Grundeinstellung, was wiederum den Weg für eine ideale Lernsituation ebnet. 3.3.4 Fazit Motivation in ihren mannigfachen Ausführungen ist die Antriebskraft in jedem Individuum. Die entscheidende Frage, die sich immer wieder stellt und wichtig für Lehr- und Lernprozesse ist, betrifft die Erzeugung von Motivation. Enttäuschenderweise wurde gezeigt, dass man Motivation von außen nicht hervorrufen kann. Das interne Belohnungssystem, welches unter anderem durch die Ausschüttung von Dopamin geprägt ist, muss von internen Prozessen in Gang gesetzt werden, bevor 132 Hechinger (2010), S. 26. Vgl. Hechinger (2010), S. 31. 134 Vgl. Hechinger (2010), S. 32. 133 48 äußere Einflüsse greifen können. Die Annahme, dass man jemanden mit einem amotivationalen Gemütsstatus von außen Motivation „einpflanzen“ könnte, kann durch die erforschten neuronalen Vorgänge widerlegt werden. Der ausschlaggebende Faktor, der sich allerdings feststellen lässt, ist die Tatsache, dass das menschliche Motivationssystem von Natur aus aktiv ist. Wenn also ein Zustand von minimalster Motivation vorherrscht, sollte nicht die Frage nach der Motivationserzeugung, sondern die nach ihrer Beeinflussung gestellt werden.135 Denn wenn ein Mensch evolutionsbedingt einen ständigen Tatendrang verspürt, kann angenommen werden, dass Einflussfaktoren existieren, die diesen Status zum positiven oder negativen lenken können. Es ist unsicher, ob das Erfassen dieser Faktoren in ihrer Gesamtheit überhaupt möglich ist. Wie allerdings gezeigt wurde, beeinflussen sowohl intrinsische Begebenheiten wie das Selbstkonzept hinsichtlich persönlicher Kompetenzen, die Selbstbestimmtheit und evolutionsbedingte Grundbedürfnisse als auch extrinsische Faktoren wie die soziale Umwelt und daraus entstehende und zu erfüllende Ideale durch Belohnung oder Zwang den Motivationsgrad. In Bezug auf die Beeinflussung der Motivation von außen sollte daher Rücksicht auf diese verschiedenen Einflussfaktoren genommen werden. Eine allgemeine Voraussetzung für Lehr- und Lernprozesse sollte daher die Erfüllung und Befriedigung der Grundbedürfnisse sein, sowie das Anerkennen von extrinsischen und intrinsischen Motivationsgründen und das daraus resultierende Ziel der Umwandlung von rein äußerlich geförderten zu innerlich verankerten Handlungen.136 3.4 Kreativität Ein weiteres Bindemitglied in der Reihe der beschriebenen Konzepte ist die Kreativität. Aufmerksamkeit, Emotionen und Motivation können auch durch die Verbindung zueinander charakterisiert werden und zusammengefasst haben sie großen Einfluss auf die kreativen Prozesse. Die Wichtigkeit dieser zeigt sich in einer ihrer vielen Definitionen: „Unter dem Begriff Kreativität verstehen wir die Fähigkeit zu schöpferischem Denken und Handeln. Das Wesen der Kreativität ist allerdings, dass etwas Neues und Sinnvolles erschaffen wird.“ 137 Der Kreativitätsbegriff bezieht sich demnach auf Vorgänge, die in Relation zu etwas schon Vorhandenem stehen, Einfluss 135 Vgl. Spitzer (2003), S. 192f. Vgl. Hechinger (2010), S. 33f. 137 Jäncke (2009), S. 319. 136 49 auf die Produktion von neuartigen aber der Situation angemessenen Einfällen ausüben. Dabei zeigt sich die Korrelation mit dem Konzept der Motivation: kreative Prozesse sollen Neuwertiges, zum Beispiel in Form einer Problemlösung durch Denken oder Handeln, welche zum Zwecke einer sinnvollen Neuentdeckung intrinsisch motiviert sein sollten, hervorbringen. Theoretisch könnten extrinsisch angeregte Prozesse, wenn sie durch die Internalisierung zu einer selbstbestimmteren Form gebracht wurden, auch förderlich sein. Trotzdem kann man annehmen, dass ein Rest an von außen auferlegtem Zwang dem Individuum den Zugang zu den zur Verfügung stehenden Ressourcen verwehren würde. Es ist nämlich nur dann mit dem höchsten kreativen Ertrag zu rechnen, wenn der menschliche Geist ungehemmt reagieren kann.138 Kreative Entfaltungsmöglichkeiten sind von großer Wichtigkeit, weil sie in allen Lebensbereichen Verwendung finden. Alltägliche Problemlösungen hinsichtlich schwieriger Situationen oder Aufgaben, welche sowohl durch äußerliche Vorgaben, aber auch durch Emotionen oder Empfindungen entstehen können, basieren auf kreativen Einfällen und der Verarbeitung von existentem Wissen und Umgangstechniken.139 Musikalisch gesehen ist das weitläufige Konzept der Kreativität nicht nur für interpretatorische Tätigkeiten von essentieller Bedeutung, sondern natürlich auch für improvisatorisches Gestalten. Da der Wirkungsbereich von Kreativität eine bedeutende Größe aufweist und in den verschiedensten Lebenslagen zur Verwendung kommt, sollte ein Augenmerk auf das Verständnis der grundlegenden kreativen Prozesse gelegt werden. 3.4.1 Neurobiologische Hintergründe So weitläufig wie das Konzept der Kreativität im Alltag eine Rolle spielt, so schwierig scheint die korrelierende neurobiologische Lokalisation zu sein. Obwohl man heute noch von Tendenzen hinsichtlich unterschiedlicher Entstehungsorte (linke und rechte Hemisphäre) von rationalen und kreativen Prozessen ausgeht, tendieren manche doch eher zu einem Netzwerkmodell. Dabei wird angenommen, dass das limbische System, ein großer Teil des Stirnhirns und der Temporallappen den größten Anteil an kreativen Vorgängen haben.140 138 Vgl. Zimbardo (1983), S. 453. Vgl. Linke (2005), S. 17. 140 Vgl. Jäncke (2009), S. 321. 139 50 Emotionen werden vom limbischen System gesteuert. Der Antrieb für unser Tun kommt auch von diesem System. Zusammengenommen mit der Dopaminausschüttung kann das somit der Auslöser, aber auch gleichzeitig der neurologische Hemmer für Kreativität sein. Denn das limbische System führt teilweise durch zu viel Aktivität zu einer Übersteuerung, was meistens in negativen Auswirkungen auf die Leistung resultiert. Angenommen wird, dass die Ausschüttung von überflüssiger Energie vom Stirnhirn gesteuert wird. Dieser Teil unseres Gehirns soll durch komplizierte Abläufe von Hemmung und Stimulation der limbischen Information diese in gedrosselter Weise wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückleiten. Durch die Korrelation der beiden kann ein angemessenes Maß an Energie erzeugt und erhalten werden. Der frontale Kortex übernimmt dabei die Aufgabe eines Informationsspeichers. Kreative Prozesse werden demnach so erklärt, dass die gespeicherten Informationen im Kortex durch die adäquate Kontrolle des Stirnhirns beeinflusst werden und dadurch das Abrufen ermöglichen. Das limbische System ist dabei der Energieversorger für die Umsetzung der abgerufenen Information.141 Das Auffällige an dieser Erklärung ist der Zugriff auf einen Speicher. Die Lösung von Aufgaben bezieht sich daher auf bereits existierende Informationen. Die logische Betrachtungsweise von Kreativitätsprozessen bestätigt die neurologischen Annahmen: Man kann nur Neues erfinden, wenn man auf etwas „Altes“ im System zurückgreifen kann und dieses als Vergleichsparameter heranzieht. Bereits Gespeichertes muss vorhanden sein, wie bei der Entschlüsselung des Gedächtnisses erörtert wurde. Dieses dient somit als Grundlage für ein kreatives Ergebnis. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Kreativität in den unterschiedlichsten Weisen definiert werden kann und es viele Modelle gibt, die die Problematik der Bewertungsmaßstäbe kreativer Produkte zum Thema haben. In diesen Ausführungen wird Kreativität im Sinne der zu Anfang erwähnten Definition angesehen. Weiters ist zu bemerken, dass in den später folgenden didaktischen Ausführungen aufbauend auf dem Kreativitätsbegriff, dieser von den beteiligten Personen jeweils für die Situation passend selbst definiert werden soll. 141 Vgl. Jäncke (2009), S. 322f. 51 3.4.2 Der kreative Prozess anhand von musikalischen Beispielen Die Annahmen hinsichtlich der Beteiligung kognitiver Strukturen in Hinblick auf Kreativität lassen auf das Zusammenwirken verschiedener Elemente in einem diesbezüglichen Prozess schließen. Oft wird auf verschiedene Problemlösungsprozesse Bezug genommen und anhand dieserwerden die für den kreativen Prozess relevanten Erkenntnisse extrahiert und angewendet. Aus verschiedenen Modellen lassen sich vier Phasen eines produktiven Prozesses ableiten, der gleichermaßen auf die 142 Kreativitätsvorgänge angewendet werden kann. Zu Beginn steht die Vorbereitungsphase, in welcher sich das Individuum mit dem Problem oder der Aufgabenstellung das erste Mal auseinander setzt. Der Sinn besteht darin, die Essenz des zu Erfüllenden zu erfassen, indem man genau definiert, begrenzt und analysiert, worum es eigentlich geht. Um das tun zu können, benötigt man Vorwissen, um die in der Aufgabe gestellten Inhalte zu verstehen und folglich eine Verbindung herzustellen. Es muss sich dabei nicht immer um eine spezifische Problemstellung handeln, denn diese Phase kann sich auch „[…] als eine spezifische Art der Begegnung zwischen Subjekt und Umgebung darstellen.“143 Als Beispiel dient der künstlerische Schaffensprozess. Komponisten benötigen teilweise gar keine fixe Aufgabenstellung, sondern konzentrieren sich auf die entstehenden Emotionen und Reaktionen auf ihre Umwelt um ihren individuellen kreativen Prozess zu initiieren. Wenn es darum geht, künstlerisch und somit kreativ tätig zu werden, ist generell die intensive Auseinandersetzung mit der übergeordneten Thematik vorauszusetzen. Dabei werden bereits existierende Erfahrungswerte gesammelt und mögliche Lösungsvarianten abhängig von unterschiedlichen Variablen abgewogen. Gibt man jemanden die Aufgabe, von einem bestimmten Ausgangston zu einem anderen zu gelangen, muss derjenige über musikalisches Vorwissen verfügen, um zuerst die Aufgabenstellung zu verstehen und in Folge über Strukturen verfügen, die die Ausführung ermöglichen. Ohne jegliche Vorinformation, welche auch auf Instruktion beruhen kann, sind musikalische Informationen nicht kognitiv verarbeitbar und ohne diese kann man musikalische Kreativität nicht ausleben.144 142 Vgl. Stiefel (1976), S. 34. Ribke (1979), S. 166. 144 Vgl. Stiefel (1976), S. 35f. 143 52 Die gesammelte Information in der Vorbereitungsphase muss dann in einer nächsten Phase zusammengeführt werden, um auf eine neue Lösung stoßen zu können. In der sogenannten Inkubationsphase wird versucht, aus den bestehenden Informationskombinationen, die in der vorherigen Phase generiert wurden, die sinngebenden herauszufiltern und anschließend etwas Neues zu kombinieren. Oft wird dieser Vorgang als schwer beeinflussbar und unmerklich fortschreitend beschrieben. Das Ende dieser Phase ist von einem spontanen Einfall geprägt, der auf den zuvor unbewusst ablaufenden Prozess zurückgeführt werden kann. Betrachtet man den Denkprozess, der spontanen Erkenntnissen vorangeht, wird man diesen schwer bewusst definieren können. Es entsteht das Gefühl, dass das Gehirn manchmal eine kurze Pause benötigt, um auf ein Ergebnis zu kommen. Diese kann man als den Faktor der Unbewusstheit in dieser kreativen Phase bezeichnen. Welche kognitiven Strukturen am Kreativsein genau beteiligt sind, ist deshalb sehr schwierig zu definieren. Obwohl man erhöhte Aktivitäten in den drei erwähnten Gehirnstrukturen feststellen konnte, ist es doch fast unmöglichzu bestimmen, welches Areal für den eigentlichen kreativen Einfall zuständig sein könnte.145 Der spontanen Erkenntnis in der Inkubationsphase folgt eine Manifestation dieser in der Einsichts- oder Illuminationsphase. Hier nimmt die entstandene Idee Form an. Der entscheidende Kernpunkt ist, dass der kreative Prozess wieder in das Bewusstsein gerückt wird, indem gleichzeitig das Zusammensetzen des Gefundenen sowie dessen Realisierung stattfindet. Denn um etwas bewusst begreifen zu können, muss eine Möglichkeit der Mitteilung erschaffen werden, nicht nur für andere, sondern vorrangig auch für sich selbst. Musikalisch betrachtet bedeutet das, dass eine musikalische Idee wie eine Melodie oder eine Phrase auch die Darstellung dieser in den kreativen Prozess miteinbeziehen muss, also: Wie bringe ich meine musikalische Phrase zum Ausdruck? Ob man dabei auf bestimmte Instrumente zurückgreifen möchte oder diese bildlich darstellt, ist Teil des kreativen Prozesses, der sogleich den Übergangspunkt zur nächsten und letzten Phase markiert.146 Die ins Bewusstsein gerückte Idee wird in der letzten Phase, der Verifikation, der Prüfung unterzogen. Nachdem die Bewertung anhand von Neuheit und Angemessenheit 145 146 Vgl. ebd. und Ribke (1979), S. 167f. Vgl. Ribke (1979), S. 169; Stiefel (1976), S. 36f; Zimbardo (1983), S. 452. 53 durchgeführt wurde, können Ideen, wie auch in der Inkubationsphase, noch abgewandelt und verbessert werden. Die Verbindung zu der vorigen Phase zeigt sich darin, dass sich die Überprüfung, Bewertung und Abänderung auch in Bezug auf die Darstellungsform der Idee beziehen kann.147 Wichtig zu beachten ist, dass diese Phase für die Festigung und das Behalten von Ideen entscheidend ist. Dazu muss diese in disziplinierter Weise organisiert werden, da sich viele Menschen zwar durch außergewöhnliche kreative Einfälle auszeichnen, diese allerdings nicht allzu lange behalten und realisieren können. Besonders bei Jüngeren sollte darauf geachtet werden, dass der Phase der Verifikation leitende Beachtung geschenkt wird, um das ideale Ergebnis nicht nur zu erzielen, sondern auch festzuhalten. Um das zu spezifizieren: Angelehnt an die kognitiven Speichervorgänge ist zu beachten, dass Neues in ein Netzwerk von existierender Information eingebunden werden soll, um auf längere Zeit wieder abrufbar gemacht zu werden. In diesem Zusammenhang wird erwähnt, dass „[…] eine individuelle Ritualbildung, die ein optimales Gleichgewicht zwischen disziplinierter Arbeit und unstrukturierten Freiräumen […]“ 148 die Einbindung von kreativen Erkenntnissen in ein Speicherdepot und somit die Reproduktion ermöglichen kann. Generell sollte also ein Gleichgewicht zwischen Strukturiertheit und Freiraum geschaffen werden, um eine adäquate Verifikationsphase, welche die unbeschränkte Prüfung der kreativen Idee zum Ziel hat, zu ermöglichen.149 Der Einfluss des limbischen Systems auf die letzten beiden Phasen des Kreativitätsprozesses zeigt sich durch die dabei entstehenden Emotionen. Bereits in der Illuminationsphase wird ein Gefühl der Freude oder Erleichterung beschrieben, wenn das erste Mal eine Idee in das Bewusstsein gerückt wird. Zu beachten ist, dass die Gefühlsäußerungen gebunden an die kreativen Phasen nicht immer positiven Ursprungs sein müssen. Obwohl sich die meisten doch über ihre kreativen Leistungen zu freuen scheinen, kann auch ein hemmendes Gefühl hinsichtlich der sozialen Umwelt entstehen. Es wird beobachtet, dass sich manche an ihren Ideen weder erfreuen können, noch dass sie diese zu schätzen wissen. Im Gegenteil, das Gefühl der Angst ist in kreativen Prozessen kein seltenes. Abgesehen von der einen Art von Angst, dass die erbrachte Leistung nicht den vorgegebenen Standards entsprechen könnte, fürchten sich manche vor den Reaktionen ihrer Mitmenschen, weil ihre Kreativität eventuell etwas 147 Vgl. Ribke (1979), S. 170. Holm-Hadulla (2011), S. 189. 149 Vgl. Holm-Hadulla (2011), S. 189f. 148 54 Außergewöhnliches hervorgebracht hat. Ein Faktor der menschlichen Grundbedürfnisse, die im Zusammenhang mit motivationalen Faktoren eine wichtige Rolle spielen, bezieht sich auf das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe. Hat aber jemand das Gefühl, sich in einer außergewöhnlichen Weise von den anderen zu unterscheiden, wird er dazu verleitet zu fürchten, dass sich diese eventuell abwenden könnten. Oft erlernt durch Hänseleien in der Kindheit, ist das Gefühl von Neid oft ein Ausschlussfaktor. 150 Diese Tendenz zeigt sich häufiger in der letzten Phase des Kreativprozesses, wenn jemand seine Ideen zum Ausdruck bringen will. Auch wenn das Gefühl von Neid nicht von jedem geteilt wird, sollte die Beteiligung des limbischen Systems an Kreativität nicht unterschätzt werden. 4. Motorik Musik selbst umzusetzen bedingt viele hochkomplexe Prozesse, die, wie schon in den vorigen Kapiteln mehrmals erwähnt wurde, nicht immer wissenschaftlich zu belegen sind. In Hinblick auf die Gehirnforschung gibt es noch immer viele Variablen, die wissenschaftlich nicht greifbar, geschweige denn erforschbar sind. Die Einheit von Mensch und Gehirn ist noch immer zu Teilen ein undurchsichtiges Mysterium; die Ansicht ob das so bleiben soll oder nicht, sei jedem selbst überlassen. Im Vergleich dazu sind die Prozesse, die für musikalisches Gestalten verantwortlich sind, ähnlich komplex erfassbar und großteils nur zu vermuten. Obwohl grundlegende Erkenntnisse über Wahrnehmungs- und Speicherungsvorgänge, die auch teilweise auf musikalische Prozesse zutreffen, in Erfahrung gebracht werden konnten, müssten noch weit komplexere und noch nicht erforschte Verarbeitungsmechanismen existieren. Denn hinter dem Produzieren von Musik „[…] verbergen sich vielfältige Prozesse, die von der einfachen Betätigung von Musikinstrumenten, zur Vorstellung von Musik bis hin zum kreativen Prozess des Erfindens von Musik […] reichen.“.151 In Bezug darauf sollten die Erläuterungen der elementaren kreativen Prozesse, sowie die der weiteren möglichen Einflussfaktoren und Elemente wie Aufmerksamkeit und Motivation für musikalisches Gestalten, als Grundlage für weitere Ausführungen dienen. In diesem Zusammenhang sollte noch ein letzter wichtiger Faktor für das Musizieren in Betracht gezogen werden: die motorische Kontrolle. 150 151 Vgl. Holm-Hadulla (2011), S. 189f. Jäncke (2009), S. 307. 55 Musikalische Produktion im Sinne von spielen mit Instrumenten setzt motorische Tätigkeiten voraus. Generell werden Bewegungen nicht als ein großes Ganzes gespeichert, sondern in kleine Teilbewegungen gesplittet und hierarchisch organisiert gespeichert. Ganze Bewegungsabläufe sind also wiederum komplexe Abläufe, die sich aus vielen kleinen Elementen zusammensetzen. Ziel des Gehirns ist es, die Verbindung der einzelnen Elemente so zu optimieren, sodass der ganze Ablauf nicht nur schneller, sondern auch automatisch vollzogen werden kann. Denn wie bei den Aufmerksamkeitsprozessen erwähnt wurde, wird angenommen, dass das Gehirn nur über eine bestimmte Kapazität verfügt. Je nachdem wie viel Aufmerksamkeit eine Handlung benötigt, wird der Anteil für eine andere Tätigkeit minimiert. Wenn das Gehirn nun viel Kapazität für einen Bewegungsablauf benötigt, ist die Konzentration auf andere Bereiche geschwächt. Entscheidend für die Möglichkeit den Fokus auf andere wichtige Musikinhalte zu legen, ist demnach die Automatisierung von musikalischen Bewegungsabläufen. Dies gelingt durch das Üben der kleinen Teilbewegungen und die exakte Speicherung dieser. Später sollte dann aus diesen das ganze Bewegungsmuster zusammengefasst werden.152 Zu Beginn werden die Teilbewegungen noch lateral (seitlich) im Stirnhirn kontrolliert. Mit zunehmender Automatisierung kann man eine Verlagerung in die mittleren Gehirnstrukturen (mesial), den supplementärmotorischen Arealen in den Basalganglien und dem Kleinhirn verzeichnen. Die Automatisierung der motorischen Abläufe ist daher geprägt von der Aktivitätsverlegung von den seitlichen in die mittleren Hirnstrukturen. Die Wichtigkeit dieses Vorgangs zeigt sich bei der Verarbeitung von anderen für den musikalischen Prozess wichtigen Funktionen: die Kontrolle der Aufmerksamkeit sowie der Motivation und das Arbeitsgedächtnis benötigen ebenso die Beteiligung der seitlichen Stirnhirngebiete. Der Automatisierungsvorgang kann demnach als ein Grundprinzip des Gehirns beschrieben werden, da dieser einen minimal uneingeschränkten Fokus auf andere Funktionen ermöglicht.153 In Bezug auf das improvisatorische Gestalten ist zu bemerken, dass das Spielen mancher Instrumente möglicherweise keine expliziten Übungsvorgänge benötigt; eventuell darauf zurückzuführen, dass gewisse Instrumente schon bekannt sind und schon gespielt wurden. Trotzdem ist anzuerkennen, dass manche musikalische 152 153 Vgl. Jäncke (2009), S. 308f. Vgl. Jäncke (2009), S. 309f. 56 Verarbeitungsverzögerungen daher rühren könnten, dass Personen zu große Schwierigkeiten mit den motorischen Abläufen haben und sich daher nicht genug auf andere Dinge konzentrieren können. Wie das Üben der Teilbewegungen ausschauen könnte, wird im nächsten Abschnitt behandelt. 57 TEIL II: Interpretation Nachdem versucht wurde einen Überblick über die wissenschaftlichen Grundlagen für musikalisches Gestalten darzulegen, werden die daraus gewonnen Erkenntnisse im Folgenden zusammengeführt, um auf mögliche didaktische Implikationen des Improvisierens im Musikunterricht einzugehen. Aufbauend auf der Darstellung möglicher Begründungsansätze für improvisatorisches Gestalten folgt eine Begriffseingrenzung in Hinblick auf die Interpretation der zuvor erläuterten Erkenntnisse. Anhand dieser soll ein allgemeines Konzept für didaktische Vorgehensweisen in Bezug auf Improvisationsaktivitäten entwickelt werden, welches im darauffolgenden praktischen Teil angewendet und in unterschiedlichen musikalischen Beispielen veranschaulicht werden soll. 1. Einleitung Improvisation ist ein Begriff, der nicht auf einzelne Wirkungsbereiche beschränkt werden kann. Die Wortzusammensetzung von im (lat. „nicht“) und providere (lat. „voraussehen, Sorge tragen“)154 lässt auf etwas Unvorhergesehenes und Überraschendes schließen, was per Definition allerdings nicht auf einen Lebensbereich reduziert zu sein scheint. Denn die Kunst des Improvisierens wird nicht nur in musikalischer Hinsicht mit Hilfe von Instrumenten oder der Stimme verwirklicht, sondern spielt auch im alltäglichen Leben eine wichtige Rolle. Spontane Reden, genauso wie überraschende Probleme, die schnelle und unvorbereitete Lösungsvorschläge voraussetzen und benötigen, können sowohl im nicht-musikalischen als auch im musikalischen Kontext stattfinden. Im letzteren würde man das erste Beispiel eher spontanes Spielen oder Musizieren nennen, welches aber vom Grundkonzept die gleichen Vorgänge impliziert: Immer wieder muss man seiner Kreativität freien Lauf lassen, um unvorhergesehene und nicht kalkulierbare Situationen meistern zu können. Der daraus klar ersichtliche Zusammenhang von Improvisation und Kreativität wird zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer erläutert werden. Entscheidend ist, dass das Konzept der Improvisation in all ihren Ausführungen und Anwendungen von den gleichen Einflussfaktoren wie von den Prozessen der Kreativität und Motivation abhängig gemacht werden kann. Improvisationstechniken, die eng mit Kreativitätsprozessen verbunden sind und angewendet werden, sind meistens unbewusst in alltägliche Situationen integriert. 154 Wortdefinition siehe http://www.wissen.de/wortherkunft/improvisieren, 21.05.2015. 58 Manchmal ertappt man sich selbst, wenn man etwas Unvorhergesehenes bewältigen muss und auf die Frage nach der Vorbereitung mit „Jetzt muss ich improvisieren!“ antwortet. Es könnte angenommen werden, dass in solchen Momenten selten der Zusammenhang zu meist automatisierten improvisatorischen Vorgängen erkannt wird, geschweige denn die Verbindung zu musikalischem Improvisieren bedacht wird. Die Anerkennung dieser Verbindung ist speziell für Lehrpersonen von Bedeutung, da die Förderung kreativen Gestaltens demnach nicht nur einem rein musikalischen Zweck dient, sondern auch zur persönlichen Entwicklung beitragen kann. Zum einen kann musikalische Improvisation genauso unbewusst vollzogen werden wie alltägliche Problemlösungen vonstattengehen, beruhend auf der Automatisierung ihrer zugrunde liegenden Prozesse. Langerfahrenen Musikern ist es möglich, musikalische Aufgabenstellungen zu lösen, ohne auch nur einen Gedanken an die Umsetzung zu verschwenden. Meist genügt ein Gedankenanstoß, wie die Vorgabe einer Tonart, eines Rhythmus oder eines Liedanfangs und die Spielenden sind in der Lage, ohne für sie offensichtliche planende Vorgänge, zu musizieren und etwas musikalisch Sinnvolles zu erschaffen. Wie bei nicht-musikalischen Problemlösevorgängen ist es den Musikern danach meistens nicht erklärbar, wie sie das Gespielte „erschaffen“ haben. 155 Oft bemerkt man, dass diese das Produzierte nochmals aktiv wiederholen müssen, um selbst Einblicke in die automatisierten Vorgänge zu erlangen und im Zuge dessen Außenstehenden die musikalische Vorgehensweise überhaupt erklären zu können. Demzufolge kann man eine Verbindung zu nicht-musikalischen Vorgängen feststellen: Spontane Lösungsansätze entstehen sehr oft durch unbewusste und nicht nachvollziehbare Kreativitätsprozesse. Musikalische Improvisationsvorgänge können also genauso unbewusst stattfinden wie allgemeine Bewältigungsmechanismen. Zum anderen könnte die Offensichtlichkeit der Verbindung zwischen den unterschiedlichen Improvisationsformen (musikalisch und nicht-musikalisch) in den Begründungsansätzen hinsichtlich der Integration von Improvisationstechniken in den Musikunterricht bemerkt werden. Geteilt in musikalischen und sozialen Nutzen werden im Folgenden verschiedene positive Aspekte betrachtet, die sich durch das Integrieren von Improvisationsaktivitäten in den Unterricht herauskristallisieren können. In Bezug auf den Teil, der den sozialen Nutzen beim musikalischen Improvisieren behandeln 155 Siehe in diesem Zusammenhang auch Hechinger, Martina: Das musikalische Flow-Erlebnis. Eine Forschungsstudie über Flow, Motivation und Selbstwirksamkeit im Instrumentalspiel. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller 2010. 59 wird, könnte dann festgestellt werden, dass die angewendeten Argumente teilweise nicht nur auf musikalisches Gestalten, sondern auch auf die erwähnten allgemein kreativen Vorgänge im Improvisationsprozess zutreffen. Kurz gesagt, wird in den folgenden Ausführungen bezüglich der Wichtigkeit der Integration von Improvisation in den Musikunterricht auch auf soziale Faktoren eingegangen, die auch bei nichtmusikalischen Improvisationsvorgängen integriert werden und sich von entscheidender Bedeutung erweisen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Begriff der Improvisation auf viele Bereiche angewendet werden kann. Musikalischen und nicht-musikalischen Aufgaben können ähnlich unbewusste Prozesse zugrunde liegen, die allerdings bei beiden vorher schon einmal durch einen gewissen Input erlernt werden mussten. Vergleichbar sind diese auch anhand ihrer Wichtigkeit für verschiedene soziale und individuelle Aspekte und Entwicklungsmechanismen, auf welche auch im Rahmen des Unterrichtens Rücksicht genommen werden muss. Im folgenden Abschnitt wird deshalb noch genauer auf die Hintergründe von improvisatorischem Gestalten eingegangen. 1.1 Begründungsaspekte Das Konzept der Improvisation wird oft als „zu kompliziert“ für den allgemeinen Musikunterricht angesehen. Viele erwarten, dass eine jahrelange musikalische Vorbildung vorausgesetzt werden muss und sie deshalb keinen Nutzen für diejenigen bringen würde, die über kein ausreichendes Vorwissen verfügen. Im Gegensatz dazu zeigen Anwendungsbeispiele von elementaren Improvisationstechniken, dass Improvisation durchaus zu Beginn des Musikunterrichts funktionieren kann. Zusätzlich kann durch adäquate Integration solcher Techniken nicht nur das Verständnis für musikalische Inhalte, sondern auch für soziale Verhaltensweisen gefördert und erweitert werden. So wie der Musikunterricht nicht nur musikalische Aspekte beinhalten sollte, so sollte sich das improvisatorische Gestalten auch nicht nur auf das Produzieren von Klängen in den unterschiedlichsten Formen stützen. Es ist unbestritten, dass Unterricht im Allgemeinen nicht nur auf den thematischen Schwerpunkt fokussiert werden sollte, sondern auch im Sinne der Vielgestaltigkeit und der adäquaten Förderung der Lernenden auf weitere Kompetenzen Rücksicht genommen werden muss. Um dieses als Lehrperson bewerkstelligen zu können, sollten die Lehrinhalte auf ihre Richtigkeit und Relevanz in Bezug auf verschiedene Aspekte geprüft werden. Dementsprechend sollten dem Organisierenden der eigentliche und der mögliche Lernertrag einer jeden Übung 60 bewusst sein. In Anlehnung daran sind die folgenden Aspekte in Hinblick auf einen Begründungsansatz für das didaktische Integrieren von improvisatorischem Gestalten zu sehen. Das Gefühl der Zugehörigkeit ist eines der drei psychologischen Grundbedürfnisse, deren Erfüllung nicht nur für die Motivation ausschlaggebend sein kann. Fühlt sich jemand ausgegrenzt und gemieden, kann das negative Auswirkungen auf seinen persönlichen Gemütszustand ausüben, was wiederum in einer Reihe von weiterführenden Effekten resultieren könnte. Denn wird das Gefühl der Ausgrenzung nicht abgewendet, könnte dieses in eine Angstreaktion münden, was wiederum in einer Aktivitätszunahme der Amygdala resultiert und somit eine Verminderung der Dopaminausschüttung nach sich zieht. Der Neurotransmitter Dopamin ist nicht nur für die Erzeugung von Glücksgefühlen zuständig, sondern übt durch seine Funktionen auch maßgeblichen Einfluss auf die Prozesse der Aufmerksamkeit aus. Der hemmende Faktor sollte also eliminiert werden.156 Die Erschaffung eines guten Klassenklimas ist demnach entscheidend für eine lernfördernde Umgebung. Dies kann durch Aktivitäten, die sich auf die Stärkung eines Gruppengefüges beziehen, erreicht werden. Die verschiedensten Improvisationstechniken ermöglichen es, unterschiedliche Gruppenkonstellationen zu fördern und auszuprobieren. Dabei wird nicht nur die Kommunikationsfähigkeit der Teilnehmerinnen, sondern auch das Vertrauen aufeinander angeregt, was wiederum ein zufriedeneres Selbstwertgefühl zur Folge haben könnte. Voraussetzung für Gruppenimprovisationen sind demnach verschiedene Arten von Interaktionen, welche sich nicht nur auf das Verbale beschränken lassen müssen und großen Einfluss auf das Zugehörigkeitsgefühl ausüben können.157 Ist ein Gruppengefüge geschaffen worden, kann das improvisatorische Gestalten auch als Kreativitätsförderung fungieren. Dies muss nicht auf musikalische Inhalte beschränkt sein, sondern kann sich auch auf allgemeine Kreativitätsprozesse beziehen. Aufbauend auf der zu Beginn erwähnten Vielfältigkeit des Improvisationsbegriffs kann angenommen werden, dass beim eigentlichen Improvisationsvorgang genauso viele unterschiedliche Strategien angewendet werden können, um auf ein zufriedenstellendes Ergebnis zu kommen. Die Improvisierenden haben dabei die Möglichkeit, auf ihre persönlichen Kompetenzen zurückzugreifen und etwas eigenständig zu erarbeiten. Dies 156 Vgl. Hechinger (2010), S. 32. Siehe in diesem Zusammenhang Anwendungsbeispiele in Schwabe, Matthias: Musik spielend erfinden. Improvisieren in der Gruppe für Anfänger und Fortgeschrittene. Kassel: Bärenreiter 1992. 157 61 ist der Kernpunkt des Kreativitätsprozesses und wird somit bei Improvisationsaktivitäten genauso benötigt. Entscheidend dabei ist, dass besonders freies Gestalten die Flexibilität eines Teilnehmenden voraussetzt und weg von einer Theorielastigkeit drängt.158 Denn Improvisation erfordert individuelle Anstrengung und im Vergleich zu anderen musikalischen Aktivitäten, bei welchen Dinge bereits vorgegeben sind, wird ein offener Umgang mit musikalischen Inhalten ermöglicht, was wiederum als Abwechslung im Schulalltag empfunden werden kann. Man könnte annehmen, dass Improvisation in ihrer Weitläufigkeit mit jeder neuen Aufgabe Abwechslung ermöglicht. Es soll nicht impliziert werden, dass andere Aktivitäten weniger wichtig für den Unterricht sind; allerdings bietet das kreative und improvisatorische Gestalten in der Tat sehr viele unterschiedliche Aufgaben, ohne dass auf diese speziell Rücksicht genommen werden müsste oder könnte. Denn generell hat jeder Mensch seine eigenen Vorgaben in Form seines Wissens und seiner Erfahrungen, welche besonders bei kreativen Prozessen individuell verbunden werden müssen, um auf ein zufriedenstellendes Ergebnis zu kommen. Improvisatorische Aufgaben beinhalten also an sich schon vielfältige Anforderungen, da jeder individuell mit seinen gespeicherten Inhalten umgehen muss. Die Steigerung dieser Vielfältigkeit kann demnach so erfolgen: Umso mehr Aufgaben in einer Aktivität verankert sind, umso abwechslungsreicher könnten diese beschrieben werden. Die Wichtigkeit Ursprungsbeschreibung Aufmerksamkeitsspannen von benötigen dieser Tatsache zeigt sich in Aufmerksamkeitsprozessen. immer wieder neue Reize, der Längere um das Konzentrationsniveau nicht rapide absinken zu lassen. Bei vielfältigen Aufgaben werden diese benötigten Impulse durch den abwechslungsreichen Charakter von selbst dargeboten. Demnach könnten improvisatorische Aktivitäten, wenn die adäquaten Voraussetzungen erbracht werden, auch als Aufmerksamkeitsförderung dienen. Im Zuge der Kreativitätsförderung können Improvisationsaufgaben auch einen freien Raum für persönliche Entfaltung zur Verfügung stellen. Achtet die Lehrperson darauf, dass eine positive und ungehemmte Stimmung vorherrscht, wird den Teilnehmerinnen die Chance für die Erfahrung ihrer persönlichen Ausdruckskraft gegeben. Die Basis dafür befindet sich im Grundkonzept der kreativen Prozesse: In der ersten Phase der Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung und dem innerlichen Suchen nach 158 Vgl. Eckhardt (1995), S. 24f. 62 Lösungsmöglichkeiten muss sich ein Individuum mit den vorhandenen Inhalten beschäftigen. Oft erlebt man selbst, dass das gespeicherte Wissen für bestimmte Lösungsansätze als zu gering empfunden wird und der kreative Prozess darunter leiden kann. Die Konsequenz ist manchmal das Entstehen von Selbstzweifeln, welche auf persönliche Kompetenzen und Eigenschaften zurückgeführt werden könnten. Im Gegensatz dazu könnte sich aber auch ein besonders kreativer und hilfreicher Einfall als Glanzleistung erweisen, was wiederum eine Bestärkung der persönlichen Fähigkeiten nach sich ziehen könnte. Beide Varianten stützen sich auf die Erfahrung von individuellen Eigenschaften. Zu bemerken ist, dass eine Konfrontation mit individuellen Fähigkeiten sicherlich nicht bei jedem kreativen Prozess stattfinden wird und kann. Trotzdem fördern selbstgelenkte Aufgaben individuelle Ausdrucksmöglichkeiten, welche für die Persönlichkeitsentwicklung und Festigung von Bedeutung sind. Denn besonders bei Gruppenimprovisationen kann man seine sozialen Fähigkeiten austesten und erweitern, indem die Position in einer Gruppe verändert wird. Meist gibt es jemanden, der Anfang oder Ende einer Improvisation einleitet und andere, die diesem folgen. In solchen Konstellationen besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Positionen in einer Gruppe auszutesten und seine persönliche Präferenz auszuleben. Diese kann auf übergeordneter Ebene bewusst eingebunden werden, um daran zu arbeiten. Bemerkt eine Lehrperson zum Beispiel, dass jemand sehr schüchtern ist und sich im Gruppengefüge immer unterordnen muss, weil die Durchsetzungskraft fehlt, kann die Aufmerksamkeit bei der Improvisation sanft auf diese Person gelenkt werden, um derjenigen das Gefühl einer leitenden Position zu vermitteln und eine Entfaltungsmöglichkeit zu schaffen. Musikalisch betrachtet kann das Gruppengefüge auch durch die verschiedenen Arten von Improvisationstechniken unterschiedlichsten und Musikinteressen deren können Inhalten dabei gefördert in ein werden. großes Die Ganzes zusammengefasst werden, was die Aufmerksamkeit bei mehreren Personen gleichzeitig fördern kann. Motivationale Antriebsmuster werden aktiviert, wenn die Aufgabe den individuellen Geschmack trifft. Improvisatorisches Gestalten ermöglicht es, die musikalischen Vorstellungen einer Gruppe von Teilnehmern in ein gemeinsames Stück überzuführen. Folglich wird dabei nicht nur das Zugehörigkeitsgefühl gestärkt, sondern es werden auch die individuellen Interessen berücksichtigt, was wiederum die Chancen auf eine Aufmerksamkeitssteigerung und Motivationsanregung erhöhen könnte. 63 Die individuelle Verwirklichung in improvisatorischen Aufgaben kann auch anhand von unterschiedlichen Instrumenten gefördert werden, was gleichzeitig als eine indirekte Instrumenteneinführung verwendet werden kann. Improvisieren bedeutet nicht immer, dass ein Instrument perfekt beherrscht werden muss. Besonders die freie Improvisation ermöglicht das Ausprobieren von verschiedenen klangerzeugenden Objekten und die Umsetzung individueller Vorstellungen. Schülerinnen, die sonst eventuell nicht die Möglichkeit bekommen würden auf verschiedenen Musikinstrumenten zu spielen, könnten somit ein rasches Erfolgserlebnis bemerken. Anzunehmen ist, dass die Verwendung der Instrumente auch das diesbezügliche Speichern von korrelierenden Inhalten begünstigt. Denn wenn die zu lernenden Inhalte selbst erfahren werden, werden diese bewusster wahrgenommen, was wiederum eine Verlängerung der Behaltensdauer im Kurzzeitspeicher bewirkt und folglich eine Verankerung im Langzeitgedächtnis fördert. Dieser Prozess ist vergleichbar mit der Erfahrung, dass Musikstücke, die man selbst gesungen oder gespielt hat, „länger“ gemerkt werden, als andere. Der Grund dafür kann auf die neurologischen Speicherungsprozesse zurückgeführt werden: Wird ein Stück selbst musiziert, erfolgt eine gleichzeitige Aktivierung von mehreren Reizsystemen Synapsen verbinden diese Bereiche miteinander und schaffen eine Verbindung zu bereits gespeichertem Material. Oft werden diese Stücke dann wiederholt, was bei jedem Mal eine Verdickung der Synapsenverbindung zwischen den Strukturen mit sich zieht. Umso mehr Verbindungen zu anderen Bereichen hergestellt werden und umso öfter dieses stattfindet, desto „tiefer“ gelangt dieses in den Speicher und kann auch nach längerer Zeit wieder abgerufen werden.159 Demnach könnte also angenommen werden, dass improvisatorisches Gestalten längerfristige Speicherungsprozesse begünstigt, weil die benötigten Unterschiede der Reizeinflüsse durch Faktoren wie die Verwendung von verschiedenen Musikinstrumenten zur Verfügung gestellt werden. Ein weiterer Faktor, der die Speicherung eines Inhalts beeinflussen könnte, ist die Tatsache, dass beim Musizieren zusätzlich die Hörfähigkeit auf eine spezielle Weise trainiert wird. Es ist anzunehmen, dass das Hören beim Produzieren von Musik jeder Art eine entscheidende Rolle spielt, dennoch könnte man bei Einzelimprovisationen sowie bei Gruppenaktivitäten unterschiedliche Parameter des Zuhörens definieren. Wenn man alleine improvisiert, baut das System eine konstante Verbindung mit sich 159 Vgl. Eckhardt (1995), S. 233. 64 selbst auf. Es wird meist unbewusst auf gewisse Inhalte zugegriffen und durch kreative Prozesse mit anderen Reizen verbunden, um etwas Neues zu schaffen. Kreislaufartig muss dabei innerlich „vorgehört“ werden, was gespielt werden soll und im Anschluss überprüft werden, ob dieses tatsächlich so gelungen ist. Die Produzierende muss sich dabei auf das eigene Verarbeitungssystem konzentrieren, obwohl der Vorgang der Verarbeitung natürlich auf einer weit höheren und eigentlich nicht zugänglichen Ebene stattfindet. Im Vergleich dazu kann man in einer Gruppensituation das Gespielte der anderen nur von außen aufnehmen, was wiederum einen zirkulären Hörvorgang mit sich zu ziehen scheint, welcher allerdings auf eine andere Art und Weise vollzogen wird. Um dieses erklären zu können, muss Folgendes bewusst sein: Improvisieren in Gruppen hat meistens das gleiche musikalische Ziel wie Einzelimprovisationen. Es soll ein zusammenhängendes, in sich geschlossenes Klangerlebnis am Ende entstanden sein. Um das mit mehreren Personen erzielen zu können, spielt nicht nur die Kommunikation eine entscheidende Rolle, sondern auch das Können der Teilnehmerinnen. Umso professioneller die Musikerinnen dabei sind, umso geringer ist die Wichtigkeit der Kommunikationsstrategien, denn diese scheinen schneller auf ihre Mitspielerinnen reagieren zu können als musikalische Anfängerinnen. Erklärt könnte dieses Phänomen durch Unterschiede in der primären Reizanalyse der Wahrnehmungsprozesse werden. Im Zusammenhang mit dem limbischen System wurde erwähnt, dass bei der Voranalyse der eintreffenden Stimuli Ergebnisse vorhergesagt werden, um den ganzen Prozess der Reizaufnahme beschleunigen zu können. Diese Vorhersage kann allerdings nur anhand bereits gespeicherter Information und mit Hilfe von Gruppierungsvorgängen durchgeführt werden. Professionelle Musikerinnen können schneller auf musikalische Reize reagieren, weil diese das Vorwissen für eine beschleunigte Reizanalyse und Ergebnisvorwegnahme besitzen. Diese haben die musikalischen Muster und Spieltechniken so oft wiederholt, dass die neuronalen Netzwerke weitaus dicker vernetzt sind als bei Laien. Zusammengefasst bedeutet das, dass die Interaktion bei Improvisationen von Musikerinnen mit profunder Vorbildung deshalb so fließend sein kann, weil diese oft wissen, worauf die andere hinaus will, bevor diese es gespielt hat. Bei Personen mit wenig musikalischer Vorbildung ist die Kommunikation bei Improvisationen von entscheidender Bedeutung, da sich diese noch mitteilen müssen, auf welches Ziel man gemeinsam zusteuert. In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass die Hörfunktion bei 65 Nichtmusikern wie bei Musikern in Gruppenimprovisationen sich zu Einzelimprovisationen darin unterscheidet, dass nicht immer angenommen werden kann, was der andere spielen wird. Das Hören ist differenzierter, weil man dabei nicht nur auf sich selbst eingehen muss, sondern auch auf andere achten und nach adäquater Analyse auch wieder antworten sollte. Musikalische und nicht-musikalische Kommunikationsstrategien, die dabei benötigt werden, können beim improvisatorischen Gestalten trainiert werden, genauso wie das Zuhören und Interpretieren von anderen Eindrücken. Weitere musikalische Parameter wie Rhythmus, Melodie und Dynamik sind unerlässliche Faktoren beim Musizieren. Genauso wie das Ausprobieren von verschiedenen Musikinstrumenten kann das musikalische Gestalten einen offenen Raum für das Experimentieren mit zeitlichen, tonräumlichen und dynamischen Klangfunktionen ermöglichen. In Verbindung mit unterschiedlichen Umsetzungsformen kann dabei zusätzlich auf die Veränderbarkeit der Klangfarbe eingegangen werden. Es ist anzunehmen, dass diese Parameter auch anhand von vorgegebenen Stücken oder Inhalten erlernt werden können und sollten, wie zu späterem Zeitpunkt noch erläutert werden wird. Es soll auch nicht bestritten werden, dass vorgegebene musikalische Inhalte in vielen Lernsituationen notwendig und sehr förderlich sind. Der Vorteil von freiem Gestalten zeigt sich allerdings darin, dass zusätzlich noch andere Fähigkeiten wie Flexibilität und Originalität ausgebildet werden können. 1.2 Begriffseingrenzung Die Vielfältigkeit des Improvisationsbegriffs hat gezeigt, dass das Konzept des improvisatorischen Gestaltens auf verschiedene Bereiche des Lebens angewendet werden kann. In musikalischer Hinsicht ist dieses nicht weniger vielgestaltig, was auch zur Wichtigkeit der Integration in den Unterricht beiträgt. Die Tatsache, dass unzählige Faktoren in improvisatorische Aufgaben miteinbezogen werden können, macht es zum idealen Werkzeug der Musikvermittlung. In Hinblick auf die folgenden Ausführungen ist allerdings eine Eingrenzung des Begriffs vonnöten. Eingegangen wird dabei auf den musikalischen Improvisationsbegriff im Rahmen einer allgemeinen schulischen Ausbildung. Ziel der Integration dieses Konzepts ist die Einführung in kreatives Musizieren und dazu passende Improvisationstechniken. Die Zielgruppe sind Schülerinnen mit wenig bis durchschnittlicher Musikausbildung, welchen anhand verschiedener Techniken eine 66 kreative Zugangswiese zu Musik in einem schulischen Rahmen vermittelt werden soll. In diesem Zusammenhang werden verschiedene Improvisationsaufgaben mit unterschiedlichen Vorgaben integriert, abhängig von Lehr- und Lernzielen. Die Zusammensetzung und der Aufbau dieser Aufgaben werden anhand der gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse des ersten Teils stattfinden. Im Folgenden wird deshalb auf mögliche allgemeine didaktische Implikationen eingegangen, bevor daraus resultierende Aufgabenstrukturierungen präsentiert werden können. 2. Didaktische Implikationen 2.1 Voraussetzungen Improvisatorisches Gestalten steht in enger Verbindung mit Kreativitätsprozessen. Die Definition von beiden bezieht sich auf etwas Unvorhergesehenes, was durch das Aktivieren von inneren Prozessen hervorgerufen werden soll. Angelehnt an die erste kreative Phase müssen bestimmte situative und inhaltliche Voraussetzungen vorherrschen, um einen Improvisationsprozess beginnen zu können. Es folgt eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Grundlagen in Hinblick auf didaktische Implikationen für das Unterrichten und in diesem Zusammenhang als adäquat betrachtete Übungen und Aufgabenstellungen. 2.1.1 Strukturbildung von außen und innen Zu beachten ist, dass bei jeder kreativen Tätigkeit im schulischen Rahmen der adäquate Raum zur Entfaltung geschaffen werden muss. Die Verantwortung dafür liegt bei der Lehrperson, da diese die Planung und Leitung der schulischen Aktivitäten innehat. Die Wichtigkeit einer Bezugsperson zeigt sich dabei nicht nur anhand inhaltlicher Instruktionen, sondern auch in Bezug auf die Lenkung der verschiedenen kreativen Prozesse. Wie bei der Aufschlüsselung dieser ersichtlich wurde, haben Lernende oft Schwierigkeiten ihre kreativen Einfälle adäquat festzuhalten. Obwohl dieses Phänomen durchaus auf verschiedene motivationale Einflussfaktoren zurückgeführt werden kann, hat sich eine Abhängigkeit von situativen Umständen gezeigt. Eine Abwechslung zwischen freien und von außen strukturierten Kreativitätsphasen hat sich als günstig für die Behaltensleistung der kreativen Einfälle erwiesen.160 Die Strukturvorgabe für die festgelegte Periode sollte als Teil des Aufgabenbereichs einer Lehrperson angesehen 160 Vgl. Holm-Hadulla (2011), S. 189f. 67 werden. Um die kreativen Einfälle nicht wieder aus dem Kurzzeitspeicher entweichen zu lassen, sollte eine aktive Instruktion für Strukturbildungen integriert werden. Wenn Schülerinnen wissen, wie sie ihre Ideen behalten können um diese mitzuteilen, ermöglicht das ungehemmte kreative Phasen, die wiederum durch die strukturierten abgelöst werden können. Generell sollte also ein übergeordneter inhaltlich-strukturierter Aufbau von Aufgaben geschaffen werden, damit die Teilnehmenden die Möglichkeiten bekommen, ihre Kreativität auszuleben und in sinnhafter Weise mitteilen zu können. Diese Strukturbildung von außen könnte durch aktive Benennung vonseiten des Improvisationsleiters, also der Lehrperson, gefördert werden. Freie kreative Phasen könnten als Ideenfindung verwendet werden, welche im Anschluss, um einer Ordnung zu folgen, präsentiert werden sollten. Um dieses in die Tat umzusetzen, müssen die Schülerinnen über Strukturierungsmechanismen verfügen, welche bestimmte Speicherungskategorien zur Voraussetzung haben. Man könnte also daraus schließen, dass eine Strukturierung von außen nur möglich ist, wenn die Teilnehmenden bereits über bestimmte Kategorien verfügen, anhand derer sie ihre kreativen Einfälle organisieren können. Wenn man also improvisatorisches Gestalten zum Thema im Musikunterricht machen möchte, sollten gewisse Kategorien vorhanden sein, um ein sinnvolles Ergebnis zu erzielen. Obwohl Sinnhaftigkeit durchaus im Auge des Betrachters liegen mag und jeder Improvisationsleiter die Vorgaben und Inhalte individuell definieren kann und sollte, bemerkt man doch schnell, ob Schülerinnen einen Zweck hinter ihrem Tun erkennen. Ein wichtiger Indikator könnte dabei die Benennungsleistung der kreativen Einfälle sein. Sinnvolles Gestalten könnte also dadurch erkannt werden, dass die Produzierenden das Produzierte erklären, beziehungsweise benennen können, was im Zuge dessen großen Einfluss auf die Speicherungsleistung haben kann. Denn durch das Benennen eines kreativen Prozesses kann dieser in Schemata eingeordnet werden, was die Behaltensdauer im Kurzzeitspeicher verlängert, indem Verknüpfungen mit bestehenden Inhalten hergestellt werden. Voraussetzung für das Benennen musikalischer Ideen und die Speicherung sind bereits existierende Kategorien. Möchte man Schülerinnen in improvisatorisches Gestalten einführen, wäre folglich zu Beginn eine „Bestandsaufnahme“ der bestehenden Vorkenntnisse günstig. Eingebunden in aufwärmende Übungen, kann eine solche Überprüfung bei weiteren improvisatorischen Aufgaben auch als Fortschrittskennzeichnung verwendet werden. 68 Anzunehmen ist, dass jeder unbewusst über bestimmte musikalische Kategorien verfügt. Vergleichbar mit dem Spracherwerb, werden wir von Geburt an auch mit musikalischen Inhalten konfrontiert: Es wird bereits im Kindergarten sowie in der Volksschule gesungen. Zusätzlich werden musikalische Reize auch nur durch Musikhören verarbeitet. Es kann also festgestellt werden, dass musikalische Kategorien generell bestehen müssten, da wir Musik als solches sonst nicht sinnvoll speichern könnten. Auch Personen, die sich selbst als unmusikalisch bezeichnen würden, können Melodien oder ganze Lieder wiedergeben, was eine Speicherung dieser voraussetzt. Übergeordnete musikalische Kategorien müssen also nicht von außen erschaffen werden, da diese im menschlichen Verarbeitungssystem bereits existieren sollten. Die Bezeichnung „unmusikalisch“ wird deshalb oft mit einer falschen Konnotation verwendet. Denn es ist anzunehmen, dass eine „Grundmusikalität“ im Sinne der angeborenen Verarbeitung bei jedem Menschen existieren muss. Sofern keine neurologischen Schädigungen bestehen, ist die musikalische, genauso wie die sprachliche Reizentschlüsselung möglich. Jemand ist nicht von Geburt an unmusikalisch, wenn man gewisse Inhalte nicht exakt benennen oder sich mit gewissen Musikstücken nicht identifizieren kann. Der Unterschied zu anderen besteht darin, dass verschiedene Kategorien, je nach musikalischer Vorbildung, im neuronalen Netzwerk angelegt werden. Gezeigt wird dieses in Untersuchungen hinsichtlich einer Lateralisation der musikalischen Verarbeitungsstrukturen: Obwohl die Annahme, dass Musik generell ganzheitlich verarbeitet wird, vorherrschend ist, haben sich doch Unterschiede in der musikalischen Reizverarbeitung bei Musikerinnen und Laien gezeigt. Durch das Musiklernen anhand von strukturierten Kategorien, wie es bei Musikerinnen der Fall ist, haben sich diese eher in der linken Hemisphäre feststellen lassen, wo eher analytisch und nicht emotional verarbeitet wird. Durch die Fähigkeit der Benennung von musikalischen Inhalten werden diese bei Personen mit Vorbildung anders gespeichert, was ein schnelleres Abrufen erleichtert. Personen mit wenig aktiv gespeicherten musikalischen Inhalten haben diese oft nur an emotionale Reize gekoppelt, was auch die Hemisphärenspezialisierung auf die linke Seite erklären und einen aktiven Zugriff erschweren kann. Wie bereits zuvor erwähnt wurde, bedingt eine weitgefächerte Speicherung auch eine bessere Abrufleistung. Musiker speichern Inhalte 69 nicht nur anhand von emotionalen Eindrücken, sondern verbinden diese vielfach mit formalen Kategorien auf unterschiedlichen Ebenen.161 Eine gewisse Kategorisierung von Inhalten ist also wichtig für das Abrufen, welches bei improvisatorischem Gestalten auch von Bedeutung ist. Um die Strukturierung zu gewährleisten und damit Inhalte für weitere Aufgaben speichern zu können, sollten gewisse Kategorien zur Benennung in Verbindung mit den bereits existierenden und übergeordneten Strukturen zur Verfügung gestellt werden. Es könnte deshalb mit vorgegebenen Stücken oder kurzen Phrasen im kleinen tonalen Raum begonnen werden, um gewisse Strukturen zu erschaffen. Dies wäre möglich durch die Integration von rhythmischen Parametern, durch das Üben von verschiedenen Rhythmisierungen, oder von klanglichen Parametern, durch das Ausprobieren von verschiedenen Instrumenten und deren Funktionen. Stimmlich kann auf die Ausdrucksart und das Einsetzen dieser (flüstern, sprechen, singen) geachtet werden, genauso wie auf verschiedene Spielformen, wie gleichzeitiges und abwechselndes Spielen. Es sollen dabei musikalische Schemata erschaffen werden, auf welche die Schülerinnen später zugreifen können. Obwohl improvisatorisches Gestalten das freie Produzieren von Musik als Ziel hat, wird, wie bei einem kreativen Prozess in der Anfangsphase, ein Bezugsrahmen benötigt. Umso freier die Aufgaben gestaltet werden, umso zugänglicher und strukturierter sollte das Vorwissen sein. Um Improvisation möglich zu machen, sollten zugängliche Kategorien durch Implementierung von neuem Wissen erschaffen werden. Wichtig zu erwähnen ist, dass die übergeordneten Strukturen, die bereits existieren, als Anschlusspunkt fungieren können. Auch wenn Schülerinnen nur wenig musikalisches Wissen vorweisen, haben sie dennoch meistens emotionale Musikerinnerungen. Die Reizaufnahme und Verankerung wird im Sinne von Assimilations- und Akkommodationsprozessen anhand dieser Erinnerungen gesteuert: Bereits Vorhandenes wird als Bezugssystem für eingehende Informationen verwendet, was wiederum durch diese verändert werden kann. Die Wechselwirkung von bottom-up und top-down Prozessen ist essentiell für die Kategorienbildung, da diese auch die Informationsaufnahme steuern. Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass Schülerinnen unabhängig vom Grad ihrer musikalischen Ausbildung, über emotionale Assoziationen hinsichtlich bestimmter musikalischer Inhalte verfügen. Im Sinne der erwähnten Reizaufnahmeprozesse wird 161 Vgl. Altenmüller (1986), S. 342-354. 70 dabei auf die gespeicherten Inhalte in Verbindung zu den Emotionen zugegriffen und abhängig von den eintreffenden Stimuli verarbeitet. Es sollte bewusst gemacht werden, dass immer Verknüpfungen hergestellt werden können, unabhängig von der Art des musikalischen Vorwissens. Umso geringer die musikalische Vorbildung ist, umso wichtiger ist die Herstellung einer Verbindung zu anderen gespeicherten Inhalten. Vergleiche zu sprachlichen oder bildlichen Kategorien bezwecken dabei nicht nur eine deutlichere Veranschaulichung, sondern auch eine vielfältigere Speicherung der neu erlernten Bedeutungen. Beim Erschaffen von neuen Kategorien ist auch die motorische Umsetzung von Musik zu erwähnen. Abhängig von den Musikinstrumenten und von der Art wie man diese spielt, sollten bei unerfahrenen Schülerinnen auch motorische Abläufe geübt werden. Motorische Tätigkeiten werden ebenso von bestimmten Hirnstrukturen umgesetzt und müssen, wenn diese noch nicht bekannt sind, gespeichert werden. In Hinblick auf improvisatorisches Gestalten ist das Üben der zu verwendenden Instrumente essentiell, da die Verarbeitung der Motorik in den gleichen Gehirnarealen stattfindet wie Aufmerksamkeit, Motivation und die Prozesse des Arbeitsspeichers. Obwohl natürlich vielfache Verarbeitungsvorgänge zugleich vollzogen werden können, wird angenommen, dass die Kapazitätsbegrenzung, die bei Aufmerksamkeitsprozessen erwähnt wurde, auch auf andere Mechanismen zutrifft. Folglich sind die Automatisierung der motorischen Umsetzung von Musik und die damit verbundene Verlagerung der Verarbeitung in andere Gehirnareale von wichtiger Bedeutung. Kreative Prozesse können sich viel besser entfalten, wenn die bewusste Konzentration auf das Spielen von Instrumenten wegfällt und die beteiligten seitlichen neuronalen Strukturen entlastet werden.162 Technisch wäre dieses in Teilabschnitten umzusetzen. Unabhängig vom Schwierigkeitsgrad der zu spielenden Instrumente sollten unbekannte motorische Vorgänge abgekoppelt von kreativen Phasen geübt werden, auch wenn es sich dabei nur um eine kurze Zeitspanne handelt. Das „Ausprobieren-Lassen“ der Instrumente hat, bevor noch strukturiert gespielt wird, wichtige Bedeutung. Die Motorik muss geübt werden, damit sich das System an den Klang und das Spielgefühl gewöhnt und somit die Verarbeitung in mittlere Hirngebiete verlegen kann. Gibt es Schwierigkeiten beim Automatisieren von gewissen Bewegungen, sollten diese in kleine Teilabläufe getrennt 162 Vgl. Jäncke (2009), S. 308-310. 71 und solange geübt werden, bis sie nicht mehr die volle Aufmerksamkeit benötigen. Danach können die Teilbewegungen zusammengefasst, um nochmals wiederholt zu werden. Sind die Schülerinnen in der Lage, die Instrumente zu spielen und gleichzeitig Anweisungen zu folgen, ist die Aufmerksamkeitsverteilung für ungehemmte kreative Prozesse ideal. Bei Improvisationen im allgemein schulischen Raum wäre die Verwendung von leicht spielbaren Instrumenten wie Klanghölzern oder Xylophonen mit eventuell eingeschränktem Tonraum zu empfehlen. Schülerinnen, die kein Instrument lernen oder gelernt haben, können dabei genauso wie andere an den improvisatorischen Aufgaben teilnehmen. Es könnte durchaus als Bereicherung empfunden werden, wenn Teilnehmende, die außerhalb dieses Rahmens schon Erfahrung mit anderen Instrumenten gemacht haben, diese auch einbringen. In Hinblick auf das Gruppengefüge wäre allerdings darauf zu achten, dass sich andere nicht ausgeschlossen oder minderwertiger fühlen, wenn sie noch keine Vorkenntnisse vorweisen können. In diesem Fall könnte man sich auf die Instrumente konzentrieren, die von allen ohne längere Vorinstruktionen gespielt werden können. Eine besonders kreative Möglichkeit der Gleichberechtigung in diesem Zusammenhang wäre das Basteln von eigenen Instrumenten im Rahmen der schulischen Ausbildung. Einfache Rhythmusinstrumente können schnell mit wenig Aufwand hergestellt werden, was nicht nur die Kreativität, sondern auch ein Gefühl der Selbstkompetenz fördern kann. Durch diese Individualisierung der Instrumente müssen sich die Bastelnden kreativ in den Prozess miteinbringen, was eine persönliche Verbindung zu dem Thema schaffen kann. Zufriedenheit mit sich selbst und im Vergleich zu anderen Mitgliederinnen aus der Gruppe führt zu einer positiven Grundstimmung, sodass die Erfahrungen automatisch mit Gefühlen abgespeichert werden. Die Verwendung der selbsthergestellten Instrumente beim improvisatorischen Gestalten ermöglicht zusätzlich eine weitläufigere Speicherung, was die Erinnerungsleistung um ein Vielfaches vergrößern kann. Werden starke Gefühle mit Erfahrungen verlinkt, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass diese sehr lange abrufbar sein werden. Zusätzlich kann die Verknüpfung mit individuell generierten Emotionen die Wahrscheinlichkeit von intrinsischen Motivationsfaktoren steigern. 72 2.1.2 Die Wirkung von Emotionen Bereits vorhandene Emotionen können allerdings nicht nur positiv zur Implementierung von neuerlernten Inhalten beitragen. Alle Lernprozesse werden nicht nur von den vorherrschenden, sondern auch von den gespeicherten Emotionen beeinflusst. Obwohl es sich als äußerst positiv für den weiteren Lernerfolg erweisen kann, wenn Verknüpfungen von musikalischen Erlebnissen mit Gefühlen existieren, können diese den Speicherungsprozess nicht nur hemmen, sondern gleich von Anfang an verhindern. Negative Emotionen, ob gespeichert oder durch zu Erlernendes hervorgerufen, können unkontrolliert den ganzen Kreativitätsprozess einschränken, indem zuerst die Aufmerksamkeit und in Folge dessen die damit einhergehenden Prozesse blockiert werden.163 Ohne Aufmerksamkeit kann improvisatorisches Gestalten nicht stattfinden, da diese für die Steuerung der Reizaufnahme verantwortlich ist und in Wechselwirkung mit Motivationsprozessen steht. Werden keine für das System relevanten Reize aufgenommen, kann die Aufmerksamkeit auch nicht aufrechterhalten werden. 164 Emotionsbedingte Blockaden hinsichtlich musikalischer Inhalte sollten demnach so bald wie möglich beseitigt werden, um den kreativen Prozess in Gang setzen zu können. Besonders bei jüngeren Schülerinnen könnte das eine schwierige Aufgabe sein, da diese den Hintergrund ihrer Gefühle oft noch nicht benennen können. Situationsstörendes Verhalten oder unwillige Bemerkungen könnten darüber Aufschluss geben, dass negative Emotionen die Aufmerksamkeit hemmend beeinflussen. Beseitigungsstrategien könnten sich in diesem Zusammenhang auf das Thematisieren solcher Probleme beziehen. Durch das Bewusstmachen der negativen Reaktion auf bestimmte Aufgabenstellungen oder deren Inhalte könnte man als Lehrperson eventuell die blockierenden Emotionen herausfiltern. Ob es ein offenes Ansprechen dieser erfordert oder eher ein verstecktes Bearbeiten der negativen Gefühle eingebettet in spielerische Aufgaben, sollte situations- und personenabhängig gemacht werden. Hemmend sind allerdings nicht nur gespeicherte Emotionen, sondern auch diese, die in bestimmten Situationen hervorgerufen werden. Durch die individuellen Erfahrungen sind die Reaktionen verschiedener Personen auf gleiche Situationen unterschiedlich. Das erfordert besondere Achtsamkeit vonseiten der Lehrperson, die die Leitung der improvisatorischen Aufgaben übernehmen soll. Bei der Planung sollte bereits Rücksicht 163 164 Vgl. Spitzer (2003), S. 162–167. Vgl. Mulder (2007), S. 117. 73 auf gewisse angsterzeugende Situationen genommen werden. Obwohl die Reaktionen unterschiedlich sein können, gibt es doch gewisse Parameter, die bei vielen Menschen das Gleiche bewirken, was eventuell auf evolutionsbedingte Faktoren zurückgeführt werden kann. Im Besonderen ist das Gefühl der Angst oft ein erkanntes Problem bei kreativen Übungen. Angst kann entstehen, wenn man sich mit Situationen überfordert oder von diesen bedroht fühlt.165 Der Hintergrund solcher Gefühle kann unter anderem auf den situationsbedingten Einfluss auf die psychologischen Grundbedürfnisse zurückgeführt werden. Zufriedenheit und eine positive Grundstimmung kann man durch Aufgaben herbeiführen, die den Teilnehmern das Gefühl der Zugehörigkeit und der Selbstkompetenz ermöglichen. Haben Schülerinnen den Eindruck, dass sie von der Gruppe abgespalten werden, weil sie eventuell nicht den Ansprüchen gerecht werden können, ist eine Angstreaktion nicht unwahrscheinlich. Das Erschaffen eines Gruppengefüges ist daher von essentieller Bedeutung für improvisatorisches Gestalten. Schülerinnen sollten das Gefühl haben, sich individuell entfalten zu können und trotzdem Teil einer Gruppe zu sein. Diese Abwechslung zwischen individuellen Gestaltungsformen und gruppenbezogenen Aufgaben kann wiederum durch die adäquate Strukturierung durch den Improvisationsleiter stattfinden. Einführende Kommunikationsübungen wären eventuell ein guter Einstieg, um Schülerinnen aufzuwärmen, auf die Situation vorzubereiten und gleichzeitig ein Gruppengefühl und Vertrauen zu schaffen. Die Einstellung zu einer Gruppe ist demnach als ein entscheidender Faktor für improvisatorisches Gestalten zu sehen. Das Wohlfühlen in einem Umfeld ist allerdings nicht nur auf ein ausgebildetes Zugehörigkeitsgefühl zurückzuführen: Wie bereits angedeutet wurde, benötigt jede strukturierte Phase auch freie Aufgaben, die Raum für individuelles Gestalten schaffen. Auch wenn dieses in einer Gruppensituation gegeben ist, bezieht sich die Kreativität dabei auf die individuellen Kompetenzen einer jeden Teilnehmerin. In diesen Teilphasen ist es entscheidend, dass Schülerinnen ein Gefühl der Autonomie und Selbstkompetenz erlangen. Diese zwei psychologischen Grundbedürfnisse sind ein weiterer positiver Einflussfaktor auf die individuelle Grundstimmung und folglich auch für die Gruppendynamik. Zu beachten wäre allerdings, dass Phasen, die von der Lehrperson als frei und grundlegend für die 165 Hechinger (2010), S. 29 und Spitzer (2003), S. 164–167. 74 individuelle Entfaltung vorgesehen sind, nicht automatisch ein Autonomiegefühl hervorrufen. Selbst frei handeln und dabei die eigenen Kompetenzen zu entdecken und auszukosten, muss erst ermöglicht werden. Durch das Eingehen auf einfache musikalische Kategorien zu Beginn eines Improvisationsprozesses, kann ein gemeinsamer Ausgangspunkt geschaffen werden, von dem aus die Schülerinnen individuell kreativ gestalten können. Dadurch könnte man zu Beginn einer Angstreaktion hinsichtlich der Kompetenzen vorbeugen, um die Aufmerksamkeit nicht zu hemmen.Die erlernten Inhalte, wenn diese gut gespeichert wurden, werden somit einer autonomen Verwendung zur Verfügung gestellt. Neben der Strukturierung der Aufgaben spielt auch die Schwierigkeit eine wichtige Rolle. Zu Beginn ist es ratsam, die Vorgaben leichter einzustufen, da zu schwierige Anforderungen nicht nur eine Angst-, sondern auch eine Stressreaktion auslösen können. Auch wenn Aufgaben gelöst werden könnten, besteht die Möglichkeit, dass das Auseinandersetzen mit neuen musikalischen Inhalten schon genug Spannung erzeugt, sodass bei weiteren Übungen auf ein geringeres Niveau geachtet werden sollte. Dafür ist die Dopaminausschüttung durch das limbische System verantwortlich, was bei Übersteuerung auch zu einer kreativitätshemmenden Situation führen kann. Stressreaktionen können dann entstehen, wenn das Verlangte durch die erfahrene Selbstkompetenz nicht erfüllt werden kann. Wenn Schülerinnen allerdings schon mehr Erfahrung mit unterschiedlichen musikalischen Kategorien und freiem Gestalten gemacht haben, kann das Anspruchsniveau durchaus hinaufgesetzt werden. 2.1.3 Motivation fördern In Hinsicht auf motivationale Aspekte sollte eine stetige Anpassung des Aufgabenniveaus stattfinden. Auch wenn zu Beginn eher leichtere Übungen eingebunden werden sollten, dient dieses hauptsächlich dem Zweck der Kompetenzeinschätzung seitens der Lehrperson. Generell zu leichte Aufgaben zu geben kann früher oder später zu einer Motivationsabnahme führen. Fühlen sich Schülerinnen unterfordert, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Interesse verloren geht, was mit äußerlichen Motivationsversuchen meistens nicht den gleichen Effekt erzielen kann, als wenn diese intrinsisch motiviert gewesen wären. Es ist davon auszugehen, dass Motivation und Aufmerksamkeit eng verbunden sind und das stetige Präsentieren von neuen Reizen entscheidend für das Aufrechterhalten von beiden Konzepten ist. Die Stimuli müssen dabei nicht immer von außen kommen, wie sich bei intrinsisch 75 Motivierten beobachten lässt. Abhängig von individuellen Vorerfahrungen ist anzunehmen, dass Schülerinnen bei der Einführung in improvisatorisches Gestalten von unterschiedlichen Grundmotivationen angetrieben werden. Bei besonders Interessierten, die die neuentdeckten Inhalte mit gespeicherten Erfahrungen verbinden können, werden weniger motivationale Reize von außen vonnöten sein, als bei denjenigen, die noch keine positiven Erfahrungen mit Musizieren gemacht haben. Innere Grundmotive sind generell schwer von außen zu definieren, deshalb sollten bei jeder Aufgabenplanung unterschiedliche Anforderungen miteinbezogen werden. Die Erfüllung der drei Grundbedürfnisse (Zugehörigkeitsgefühl, Selbstkompetenz, Autonomie) sollte in jeder Aufgabenstellung enthalten sein, was als Basis für weitere Prozesse gesehen werden kann. Der Internalisierungsprozess von äußeren Faktoren kann in diesem Zusammenhang als übergeordnetes motivationales Ziel angesehen werden. Denn es ist oft beobachtbar, dass Lernende zu Beginn eines neuen Themas noch keine diesbezüglichen intrinsischen Antriebskräfte aufweisen. Diese Tatsache könnte darauf zurückgeführt werden, dass noch keine positiven Erfahrungen gespeichert wurden und die Schülerinnen eventuell noch keinen Sinn hinter einer Aufgabe erkennen. Um diese Situation aufzulösen, können extrinsische Motivationsanstöße helfen, um einen kreativen Prozess zu starten. Im Musikunterricht hilft manchmal auch nur eine begeisterte Lehrperson, um die Aufmerksamkeit zu aktivieren und gleichermaßen die Dopaminausschüttung, welche auch für motivationale Prozesse verantwortlich ist, zu aktivieren. Wie im ersten Teil erklärt wurde, können Emotionen von Mitmenschen die eigenen durchaus beeinflussen. Manchmal benötigen Schülerinnen nur einen kleinen Anstoß, um von einem Stadium der Amotivation in eine andere Motivationsphase zu gelangen. Zeigt der Improvisationsleiter dabei selbst Begeisterung und eine positive Einstellung, kann sich diese durchaus auf andere übertragen. Wie sich bei Experimenten gezeigt hat, haben Gesichtsausdrücke und Körperhaltungen Einfluss auf unser Gegenüber und können diesen unbewusst beeinflussen. Oft wird es als negativ betrachtet, dass Schülerinnen am Unterricht nur aktiv teilnehmen wollen, weil sie die Lehrperson als sehr sympathisch und kompetent empfinden. Die Kritik, dass der Unterrichtsinhalt der motivierende Faktor sein muss, ist allerdings nicht klar belegbar. Besonders diejenigen, die sich mit dem Unterrichtsthema schwer identifizieren können, benötigen andere Motive, um am Unterricht Freude zu empfinden 76 und daraus auch wirklich etwas mitzunehmen. Die Einstellung der Lehrperson kann als äußerer motivationaler Anstoß von entscheidender Bedeutung für die innere individuelle Motivation sein. Beim improvisatorischen Gestalten ist dieses besonders wichtig, damit von Anfang an das Gefühl des Vertrauens entstehen kann. Auch wenn die Voraussetzungen für die Erfüllung der Grundbedürfnisse mit Hilfe der Aufgabenstrukturierung geschaffen wurden, sollte zu Beginn eines jeden kreativen Prozesses das Gefühl des Vertrauens vorherrschen. In diesem Zusammenhang bezieht sich die Bedeutung dieses Begriffs nicht nur auf die Sicherheit in der Gruppe, sondern auch auf die sinnhafte Bedeutung des musikalischen Inhalts. Das bedeutet, dass neben dem Gefühl, dass man im Gruppengefüge nicht bloßgestellt werden kann, auch der Eindruck, dass der musikalische Inhalt persönliche Relevanz mit sich bringen wird, Vertrauen definiert. Eine positive Einstellung der Lehrperson kann demnach in zweierlei Hinsicht Einfluss auf die Motivation anderer ausüben: Einerseits wird Vertrauen in das musikalische Thema geschaffen, was durch die positive Grundstimmung die Dopaminausschüttung fördert und gleichzeitig Stress- und Angstreaktionen minimieren kann. Andererseits kann die unbewusste Beeinflussung des Belohnungssystems zur Internalisierung der externen Motive führen. In anderen Worten, kann die Begeisterung von außen als extrinsischer Motivationsfaktor Anstoß für die Entwicklung und Förderung von intrinsischen Faktoren fungieren. Der Weg zur Freude am Musizieren setzt also die Erfüllung der drei Grundbedürfnisse und das Schaffen von Vertrauen voraus. Die grundlegende Neugier eines jeden Menschen könnte dabei als zusätzliches vereinfachendes Element hinsichtlich des Motivierens gesehen werden. Geschickt in das improvisatorische Gestalten integriert, könnten überraschende Elemente die Wissbegierde der Schülerinnen fördern. In Hinblick auf den Musikunterricht wäre das Einbringen von neuen Instrumenten sowie anderen Spieltechniken eine gute Möglichkeit um Interesse zu wecken. Abwechslung in der Gruppenzusammenstellung oder der Raumsituation wären nicht-musikalische Inhalte, die variiert werden könnten, um etwas Neues zu erschaffen. Als Vorbereitung für improvisatorisches Gestalten könnten Bilder oder Videos den Inhalt betreffend gezeigt werden, um den kreativen Prozess zu initiieren. Der planenden Kreativität sind dabei also keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur, dass Schülerinnen mit neuen Reizen konfrontiert werden, damit ihre Aufmerksamkeit aufrechterhalten werden kann. Sobald diese Spaß empfunden haben, kann angenommen werden, dass die intrinsischen 77 Motivationsmechanismen in Kraft treten, was weitere improvisatorische Gestaltungseinheiten erleichtern wird. 2.2 Anwendungsbeispiele Eine gewisse Strukturiertheit ist in jedem Lernprozess von großer Wichtigkeit, auch wenn es sich dabei um freies Gestalten handelt.166 Um improvisatorisch im Unterricht gestalten zu können, müssen die Schülerinnen über diverse Grundkenntnisse verfügen. Abhängig von den individuellen Vorerfahrungen können diese als Basis verwendet werden, um direkt in den kreativen Prozess einzusteigen, oder müssen erst einer Strukturierung und Erweiterung unterzogen werden, um darauf zugreifen zu können. Im Folgenden werden demnach unterschiedliche Vorschläge für musikalische Aufgaben und Übungen in Hinblick auf eine Einführung in improvisatorisches Gestalten vorgestellt. Diese sind in unterschiedliche Kategorien und Phasen eingeteilt, um eine adäquate Anpassung an die jeweilige Unterrichtssituation zu ermöglichen. Abhängig von der Vorerfahrung der Schülerinnen können passende Beispiele aus der folgenden Auflistung ausgewählt und als Vorbild für weitere Übungen gesehen werden. Die Entstehung der Phaseneinteilung ist auf die zuvor zusammengefassten wissenschaftlichen Erkenntnisse zurückzuführen. Zu Beginn werden unterschiedliche Übungen für das Aufwärmen und Einstimmen in die Situation vorgestellt. Da improvisatorisches Gestalten eine freie, ungezwungene, offene und angstfreie Unterrichtssituation voraussetzt, sollen Schülerinnen durch verschiedene Arten von Kommunikationsübungen, die sowohl ein Gruppengefühl als auch Vertrauen schaffen sollen, eine Einführung erhalten. Die zweite Phase enthält anschließend Übungen, die zur Kategorisierung und Ergänzung von musikalischen Inhalten dienen sollen. Dies beinhaltet verschiedene Aufgaben wie das Ausprobieren von Instrumenten inklusive körpereigenen und stimmlichen Umsetzungsmöglichkeiten. Der dritte Teil soll dann konkrete Anregungen für Aufgabenstellungen in Hinblick auf improvisatorisches Gestalten vorstellen. Zu beachten ist, dass die drei Abschnitte, die als unterschiedliche Phasen beschrieben werden, durchaus nicht immer klar trennbar und nicht als unabhängige Teile zu definieren sind. Diese Einteilung dient der Orientierung und soll als Strukturierungsversuch für Aufgaben und Übungen dienen, die als eine Möglichkeit für 166 Vgl. Hattie (2009), S. 36f. 78 die Einführung in improvisatorisches Gestalten gesehen werden könnenDa der Improvisationsbegriff äußerst vielschichtig ist und vielfältige Implikationen für das Agieren nach sich zieht, sollte eine Eingrenzung für den Unterricht individuell durchgeführt werden. Die folgenden Übungen sollen in Hinblick auf eine Art der Eingrenzung betrachtet werden: Das Ziel in diesem Fall ist die Vorbereitung auf Improvisieren im tonalen Raum. In diesem Sinne werden verschiedene Arten von musikalischen Übungen integriert, welche unterschiedliche Kompetenzen, die für freies Gestalten wichtig sind, fördern sollen. 2.2.1 Aufwärmphase Generell ist es ratsam, mehrere Reize bei Übungen zur Verfügung zu stellen, um dem Risiko der Unterforderung zu entgehen. In Hinblick auf den Musikunterricht bedeutet das, dass Aufwärmübungen für den Körper nicht getrennt, sondern sofort in Verbindung mit anderen musikalischen Aufgaben durchgeführt werden sollten. Bei manchen Gruppen oder Situationen könnte diese Kombination von zu vielen Übungen auf einmal zu einer Überforderung führen und ihren Sinn damit verfehlen. Sind Schülerinnen zu energiegeladen, könnte die Reduktion der Aufgabenvielfalt zur besseren Fokussierung auf den tatsächlichen Unterrichtsinhalt beitragen. In diesem Zusammenhang liegt der Schwerpunkt der folgenden Aufgaben auf übergeordneten Inhalten wie das Fördern eines Gruppengefüges, auf welches nicht nur im Rahmen des Musikunterrichts Rücksicht genommen werden sollte. Bemerkt man grundlegende Vertrauensprobleme in einer Gruppe, wären zu Beginn eines kreativen und somit auch improvisatorischen Prozesses kurze Körperübungen ratsam. Auch wenn diese nicht direkt mit musikalischen Inhalten in Verbindung stehen, können sie doch zu einer besseren Grundstimmung beitragen. Sind Schülerinnen zu Beginn improvisatorischer Übungen bereits gehemmt, weil sie sich in der Gegenwart anderer nicht präsentieren wollen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sie bei kreativen Übungen ihre Kompetenzen ausschöpfen können. Übung I: Sich fallen lassen Begonnen kann mit einer Körperübung werden, bei welcher eine Einteilung in Fünfergruppen die Voraussetzung ist. Eine Person befindet sich in der Mitte, während der Rest sich gleichmäßig um diesen Mittelpunkt verteilt. Diese soll sich nun langsam und aufrecht in eine Richtung fallen lassen und muss darauf vertrauen, dass sie die 79 anderen sanft auffangen und wieder in ihre Ausgangsposition zurückschubsen. Die Bewegungen sollten dabei flüssig und geschmeidig durchgeführt werden. Eine Steigerung wäre möglich durch das Schließen der Augen vonseiten der Person im Mittelpunkt. Nach einer bestimmten Zeit sollen die Plätze getauscht werden, sodass jede Schülerin die Möglichkeit bekommt, sich in der Mittelpunktposition zu befinden. Beachtet werden muss, dass die Schülerinnen sanft miteinander umgehen und im Vorhinein offensichtlich darauf hingewiesen werden.167 Zu Beginn wäre es eventuell von Vorteil, wenn sich die Teilnehmenden ihre Gruppenmitglieder aussuchen können. Vertrauen zu den Gruppenmitgliedern ist bei dieser Übung entscheidend. Die Teilnehmenden müssen ein Gefühl dafür entwickeln, in welche Richtung sich die zentrale Person bewegen wird und mit adäquater Stärke diese abfedern, um sie wieder zurück in die Ausgangsposition zu bringen. Die Person, die sich in der Mitte befindet, muss ihre Kontrolle bis zu einem gewissen Grad abgeben können, da die Übung sonst wegen Versteifung nicht funktionieren würde. Als Aufwärm- oder Lockerungsübung kann diese auch als Übergang zwischen Unterrichtseinheiten und verschiedenen Aufgaben dienen. Als Zusatz für den Musikunterricht kann als Untermalung passende Musik im Hintergrund gespielt werden. Abhängig vom weiteren Verlauf der Übungen kann entweder ein Musikstück gespielt werden, welches dann später als Kategorienfüller verwendet werden kann, oder es könnten Klangwolken von einer anderen Gruppe von Schülerinnen erzeugt werden. Letzteres ist eine ideale Möglichkeit, um Musik von Beginn an selbst zu erschaffen und den Umgang mit gewissen Instrumenten gleich zu üben. Es können dabei natürlich alle zur Verfügung stehenden Instrumente, je nach Ermessen, verwendet werden. Die Idee dahinter ist, Schülerinnen eine angenehme und nicht zu aufgeregte Untermalung kreieren zu lassen, damit sich diejenigen, die sich in der Körperübung befinden, nicht von außen aus der Ruhe bringen lassen. Instrumente wie Schüttelrohre oder verschiedene Glockenspiele wären dafür sehr geeignet; allerdings könnten auch Trommeln oder Klanghölzer verwendet werden, wenn darauf passend gespielt wird. Entscheidend ist, dass die Instruktion der Lehrperson beinhaltet, dass die musikalische Untermalung einem Zweck dient und den anderen als Unterstützung für die Übung dienen soll. Die Spielenden können dabei die Instrumente nicht nur kennenlernen, sondern auch verschiedene Spieltechniken ausprobieren. 167 Vgl. Soth (2014), S. 193. 80 Als musikalische Ergänzung kann bereits auf weitere Parameter eingegangen werden. Möchte man die nächste Phase der „Speicherfüllung“168 gleich miteinbeziehen und die Hintergrundmusik für die Vertrauensübung in eine Struktur bringen, kann ein Wechselspiel zwischen den Gruppen hinsichtlich dynamischer Veränderungen initiiert werden. Je nach Bewegungsart und Geschwindigkeit der Bewegungsgruppe könnte die Musikgruppe mit dynamischen Veränderungen auf die Bewegungen reagieren. Zu Beginn könnte dabei nur eine kurze Einführung seitens der Lehrperson stattfinden, sodass den Schülerinnen die Interpretation überlassen wird. Schülerinnen mit den Instrumenten sollen die Bewegungen der Bewegungsgruppe nicht nur untermalen, sondern mit dynamischen Unterschieden unterstützen und eventuell vorantreiben. Es wäre dabei interessant zu beobachten, welche Gruppe dabei die Dominanz übernimmt und ob sich diese verändert oder abwechselnd übergeben wird. Das Ziel wäre ein Wechselspiel zwischen den beiden Gruppen, sodass eine Bestimmung der führenden Gruppe von außen nicht mehr möglich ist. Das Reagieren aufeinander ist eine grundlegende Form der musikalischen Kommunikation, die in dieser Übung gefördert werden kann. Möchte man dieses noch verstärken, lässt man in der Gruppe der Spielenden nur jeweils einen oder zwei gleichzeitig spielen, je nachdem ob sich Schülerinnen schon alleine trauen zu spielen, oder nicht. Zu Beginn wird eine Kleingruppe bestimmt, die anfangen darf die Bewegungen der anderen zu begleiten. Diese Gruppe darf nach ihrem Ermessen so lange spielen, bis sie das Gefühl hat, dass situationsbedingt ein Wechsel möglich und notwendig ist. Es soll dabei nicht gesprochen werden, sondern nur anhand von Blicken oder Instrumenten Hinweise erfolgen. Die Voraussetzung dafür liegt zuerst bei der Verständigung in den Kleingruppen, sodass das „Spielrecht“ einer anderen Gruppe durch Blicke weitergegeben werden kann. Neben der Förderung der nonverbalen Verständigung, wird dabei auch die Aufmerksamkeit der Schülerinnen verstärkt, da diese durchgehend auf neue Hinweise achten müssen. Der Übergang zwischen den einzelnen Spielgruppen soll so fließend wie möglich stattfinden, damit die Bewegungen der anderen Gruppe durch den Wechsel in der instrumentalen Begleitung nicht gestört werden. Dieses Wechselspiel zwischen den einzelnen Kleingruppen kann auch bei der musikalischen Darstellung der 168 Gemeint ist damit das beständige Bespielen der notwendigen Hirnareale mit kategorialen Informationen. 81 Bewegungsgruppe miteinbezogen werden. Mit jeder Übergabe des Spielrechts werden unterschiedliche Klänge der verschiedenen Instrumente dargeboten, auf welche mit anderen Bewegungsabfolgen reagiert werden könnte. Die Person in der Mitte könnte sich bei einem Wechsel in eine andere Richtung bewegen, langsamer oder schneller werden oder den Fokus bei bestimmten Klängen auf bestimmte Gruppenmitglieder legen. Dabei entstehen zusätzliche Reaktionsebenen: Es müssen nicht nur die musikalischen Kleingruppen aufeinander reagieren, damit ein zusammenhängender Klangeidruck geschaffen wird. Auch das Achtgeben auf unterschiedliche Instrumente und die damit verbundenen Veränderungen in ihren Bewegungen sind Teil einer Interaktion zwischen den Mitgliedern der Bewegungsgruppe. Die übergeordnete Reaktionsebene bezieht sich schließlich auf die Großgruppen und die Lehrperson, die den Beginn und das Ende dieser Übung leiten muss. Übung II: Musikalische Orientierung Um eine weitere Form der musikalischen Kommunikation kennenzulernen und Vertrauen untereinander aufzubauen, kann eine Art Orientierungsspiel mit musikalischen Hinweisen angewendet werden.169 Schülerinnen werden dabei wieder in Kleingruppen zu je fünf Personen eingeteilt. Der Kernpunkt dieser Übung besteht darin, dass eine Person mit verbundenen Augen durch das Klassenzimmer nur anhand von bestimmten Klängen geführt werden soll. Die restlichen Gruppenmitglieder dürfen je ein Instrument wählen, von welchen jedes für eine Bewegungsart steht: vorwärts gehen, stehen bleiben, nach links, oder rechts drehen. Wenn es der Klassenraum ermöglicht, können dabei mehrere Gruppen gleichzeitig diese Übung durchführen. Möchte sich die Lehrperson allerdings auf eine Gruppe konzentrieren, können die restlichen Schülerinnen als „Aufpasser“ den Klassenraum sichern, sodass die Person mit den verbundenen Augen sich nicht verletzen kann. Wenn es die situativen und zeitlichen Umstände erlauben, kann dabei auch eine Art Hindernisparcours mit Sesseln oder anderen Gegenständen im Klassenzimmer aufgebaut werden. Die Lehrperson muss dabei allerdings immer abschätzen können, ob die Teilnehmenden achtsam genug miteinander umgehen, sodass keine Verletzungsgefahr besteht. Der Sinn hinter dieser Übung besteht nicht nur darin, dass diejenigen mit verbundenen Augen den Spielenden Vertrauen entgegenbringen sollen, sondern erst unterschiedliche 169 Diese Übung kann als Anlehnung an den Orientierungslauf aus dem Lehrwerk Club Musik 1 gesehen werden. Siehe Wanker/Gritsch/Schausberger (2009), S. 15. 82 Klangeindrücke mit bestimmten Bewegungsabläufen erlernen und anschließend richtig reagieren müssen. Vereinfacht wird diese Übung, wenn unterschiedliche Instrumente für unterschiedliche Richtungen verwendet werden. Die Schwierigkeit kann gesteigert werden, wenn ein Instrument verwendet wird, beispielsweise ein Xylophon, und nur unterschiedliche Tonhöhen eine Änderung in der Bewegung signalisieren. Dabei kann ein gemeinschaftliches Lernen der Töne zu Beginn miteinbezogen werden: Alle Schülerinnen müssen die Augen schließen, während die Lehrperson die einzelnen Töne vorspielt und die Bewegungsabläufe dazu erklärt. Nachdem alle die Töne mit den Bewegungen verbinden konnten, kann das Spiel begonnen werden. Somit wird die Hörfähigkeit nicht nur bei einer Person, sondern in der Großgruppe trainiert, was wiederum gemeinsame Voraussetzungen schaffen kann. In Bezug auf die genaue musikalische Umsetzung beider Übungen sind keine exakten Klangvorschriften zu vermitteln, da die Umsetzung in vielen unterschiedlichen Varianten erfolgen kann. Abhängig von äußeren Umständen ist das zur Verfügung stehende Instrumentarium oft begrenzt, was wiederum Einfluss auf die Art der musikalischen Umsetzung hat. Rückbeziehend auf die einleitenden Worte kann in diesem Zusammenhang das Herstellen von eigenen Instrumenten zu einer Erweiterung der Ressourcen beitragen und zugleich eine persönliche Verbindung zu den Übungen herstellen. Die Umsetzung betreffend können fortgeschrittene Teilnehmender eigene Klangmuster entwickeln. Wird diese Übung allerdings als Einführung verwendet, sollten diese von der Lehrperson vorgegeben werden. Umso unterschiedlichere Muster verwendet werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese zu einer Erweiterung der bereits vorhandenen Inhalte beitragen. Möchte man die musikalische Umsetzung den Schülerinnen auch gleich zu Beginn frei überlassen, könnte diese als eine Art Bestandsaufnahme dienen. Bei der Vorstellung der Instrumente könnte die Aufgabenstellung sein, dass Teilnehmende unterschiedliche musikalische Muster mit Hilfe von verschiedenen Musikinstrumenten darstellen. Dabei kann nicht nur der Umgang mit diesen beobachtet werden, sondern auch die Spontanität der Schülerinnen in Hinblick auf musikalische Umsetzungen. An die Ergebnisse könnte dann direkt mit weiterfolgenden Übungen angeknüpft werden. Dies soll durch die Lehrperson geleitet, aber unbewusst für die Schülerinnen in die darauffolgenden Aufgaben integriert, oder gleich im Anschluss an die Aufwärmübung thematisiert werden, wobei die Kategorisierung des Gespielten auch 83 beobachtet werden kann. In anderen Worten, es kann beim Sprechen über produzierte musikalische Muster erkannt werden, ob die Schülerinnen das Gespielte benennen und einordnen können oder nicht. Ist eine Beschreibung anhand von musikalischen Parametern wie Rhythmus oder Melodie möglich, ist anzunehmen, dass diese über bereits klar vordefinierte Kategorien verfügen. Können Schülerinnen ihre musikalischen Erfindungen nicht benennen, könnte das auf das Fehlen von gespeicherten Mustern oder auf zu wenige strukturelle Verknüpfungen im Gehirn, anhand derer das Produzierte eingeordnet wird, zurückgeführt werden. Je nachdem, wie profund die musikalische Umsetzung klingt, könnte die Schwierigkeit beim Benennen auch auf einen hochkreativen Prozess zurückgeführt werden, bei welchem musikproduzierende Vorgänge vollständig unbewusst ablaufen und „von selbst kommen“. Es ist durchaus anzumerken, dass diese Prozesse von außen oft sehr schwer zu definieren sind. Ist die Lehrperson allerdings mit ihren Schülerinnen vertraut, kann diese die Hintergründe der kreativen Vorgänge oft gut einschätzen. Der Fokus bei beiden Übungen liegt nicht unbedingt auf den Bewegungen, obwohl diese auch als körperliche Aufwärmübungen gesehen werden können. Schülerinnen müssen dabei aufstehen und die Klassenraumsituation wird verändert. Wichtig dabei ist die Kommunikation, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden kann. Teilnehmende verständigen sich dabei nonverbal und mit musikalischen Mitteln in kleineren Gruppen, aber auch in der Großgruppe. Kleinste Reaktionen können dabei beachtet und selbst in Musik umgesetzt werden. Das Reagieren auf andere ist dabei von entscheidender Bedeutung, was eine konstante Aufmerksamkeit voraussetzt. Es geht dabei um das gemeinsame Spielen und das gemeinsame Achtgeben, dass sich andere nicht verletzen und den richtigen Weg durch das Klassenzimmer finden. Es kann durchaus improvisatorisch gestaltet werden, wenn die Schülerinnen nicht körperlich aufgewärmt sind, oder keine Kommunikationsübungen zuvor gemacht wurden. Wenn die Teilnehmenden allerdings noch keine Erfahrungen mit Improvisieren und kreativem oder freiem Gestalten haben, sind die beschriebenen Lockerungsübungen durchaus von Vorteil, da sich die Teilnehmenden vorher auf die Situationen einstellen können. Der Auslöser für Stresssituationen kann oft auf das Unwohlsein im Klassengefüge zurückgeführt werden, da emotionale Verspannung die kreativen Prozesse hemmen kann und die Schülerinnen in Folge dessen oft nicht ihr Potenzial ausschöpfen und zeigen können. Die Übungen sollen zur Aktivierung der 84 Aufmerksamkeit in Richtung Kommunikation und Vertrauen zueinander beitragen. Die freien musikalischen Gestaltungsformen können als Aufwärmübungen für weitere Aufgaben genutzt werden. 2.2.2 Kategoriale Phase Die Übungen, die dieser Phase zugeteilt sind, sollen zur Ergänzung und Erweiterung des bereits gespeicherten Wissens dienen. Wie zu Beginn erwähnt wurde, hat jedes Individuum anhand seiner eigenen Erfahrungen musikalische Inhalte gespeichert, auf welche aber oft nicht bewusst zugegriffen werden kann. Anzunehmen ist, dass nicht bewusst abrufbare musikalische Kenntnisse eher anhand emotionaler Eindrücke zutage treten, da die emotionale Kopplung eine deutlichere und somit zugänglichere Speicherung mit sich ziehen kann. Daher wäre es in dieser Phase der Vorbereitung angebracht, dass Übungen mit bildlichen oder sprachlichen Inhalten mit stark emotionalen Färbungen verbunden werden, um so zu einem späteren Zeitpunkt an bereits existierendes Wissen anknüpfen zu können. Im Folgenden wird demnach auf unterschiedliche musikalische Kategorien170 eingegangen, eingebettet in verschiedene freiere, aber auch fix vorgegebene Übungen, um den Schülerinnen einen Wirkungsrahmen mit bewusst zugänglichen Inhalten zur Verfügung zu stellen. An dieser Stelle ist nochmals zu erwähnen, dass jedes Individuum musikalische Eindrücke unterschiedlich verarbeitet und speichert und die damit verbundenen neuronalen Prozesse noch nicht vollständig erklärt werden können. Die folgenden Aufgaben sollen deshalb als ein Versuch improvisatorisches Gestalten vorzubereiten, gesehen werden. Übung I: Musik und Sprache Die Tatsache, dass Musik Emotionen nicht nur hervorrufen, sondern auch darstellen kann, ist Thema der folgenden Übung. Schülerinnen werden gefragt, welche Gefühle sie beim Hören von Musik schon empfunden haben. Die verschiedenen Ideen werden an der Tafel gesammelt und in Gruppen zusammengefasst, wie zum Beispiel: Ärger, Freude, Traurigkeit. Jede Schülerin darf sich ein Instrument aussuchen, auf welchem dann von der Lehrperson präsentierte Rhythmen, passend zu jeder Kategorie, gespielt werden. Diese sollten gut merkbar und klar voneinander zu unterscheiden sein, da sie durch mehrfaches Wiederholen auswendig gespielt werden müssen. Je nach 170 Musikalische Kategorien beziehen sich in diesem Zusammenhang unter anderem auf rhythmische, melodische und dynamische Parameter. 85 Aufnahmefähigkeit der Teilnehmenden kann die Anzahl der Kategorien und Rhythmen verkleinert oder vergrößert werden. Anschließend werden die Schülerinnen in Zweiergruppen geteilt mit der Aufgabe, sich die erlernten Rhythmen mit unterschiedlicher Dynamik vorzuspielen und gegenseitig erraten zu lassen. Wichtig ist, dass die Gruppen zwei verschiedene Instrumente enthalten. Es soll dabei besonders auf einen möglichen Emotionsunterschied geachtet werden, der je nach Instrument, Spielart, Rhythmus und Dynamik entstehen kann. Nachdem unterschiedliche Variationen ausprobiert wurden, soll sich jedes Gruppenmitglied für eine unterschiedliche Darstellung der Inhalte entscheiden. Die Instrumente werden in den Kleingruppen gewechselt und die Partnerinnen sollen das Gespielte der jeweils anderen versuchen exakt zu wiederholen. Um die dynamischen Präferenzen zu benennen, kann die Bezeichnung dieser auf der Tafel zu den unterschiedlichen Kategorien hinzugefügt werden. Als Abschluss kann eine Art musikalischer Dialog initiiert werden, indem die musikalischen Einheiten abwechselnd von den Schülerinnen gespielt werden. Der Sinn dieser Übung besteht darin, unterschiedliche Klänge auf verschiedenen Instrumenten zu erzeugen, mit der Intention, emotionale Eindrücke darzustellen. Inhaltlich soll vermittelt werden, dass Musik auch als eine Art Sprache angesehen werden kann und folglich eine kreative Orientierung an sprachlichen Inhalten beim musikalischen Gestalten von großem Vorteil sein kann. Dieses Aufzeigen der Verbindung von Musik und Sprache ist besonders wichtig, da dadurch den Schülerinnen der Eindruck vermittelt werden kann, dass musikalisches Gestalten für jede zugänglich und umsetzbar ist. Das Erzählen und Darstellen von Ereignissen ist musikalisch wie sprachlich möglich und nicht auf eine bestimmte Gruppe von Personen beschränkt. Durch das Aufzeigen verschiedener Gestaltungsformen sollen den Schülerinnen in bewusster Weise musikalische Werkzeuge zur Verfügung gestellt werden, damit sie Eindrücke nicht nur sprachlich darstellen können. Wichtig zu beachten ist, dass dieses den Teilnehmenden durch die Improvisationsleiterin aktiv bewusst gemacht werden sollte. Denn ist es selbstverständlich, dass jede ihre eigenen Ideen auch ohne ausführliche Vorbildung auf eine bestimmte Art und Weise musikalisch umsetzen kann und der Kreativität somit keine Grenzen gesetzt sind. Formal kann in dieser Übung auf das Notieren von Rhythmen sowie das Benennen von dynamischen Parametern eingegangen werden. Zusätzlich erfordert diese genaues Zuhören und das Erfassen von unterschiedlichen klanglichen Nuancen, da das Gespielte 86 von den Partnerinnen wiederholt werden soll. Das Verbinden von emotionalen Inhalten mit rhythmischen und dynamischen Parametern bedingt Vorkenntnisse, die bei den Teilnehmenden hervorgerufen werden müssen, um die Übung zu meistern. Durch das anfängliche Auswendiglernen der Rhythmen soll dabei an die bekannten emotionalen Inhalte angeknüpft werden, um die Integrierung der musikalischen Elemente zu begünstigen und somit eine weit gefächerte Verknüpfung zu fördern. Auch wenn diese rhythmischen Elemente zu einem späteren Zeitpunkt nicht exakt wiedergegeben werden, kann angenommen werden, dass sie durchaus zu einer Strukturierung im neuronalen System beitragen können und Teil der Assimilations- und Akkommodationsprozesse werden. Somit können neue rhythmische Reize schneller analysiert und integriert werden. Eine mögliche Erweiterung dieser Übung kann durch das Hinzufügen von Tonhöhen erfolgen. Die rhythmischen Darstellungen der Gefühlskategorien können durch Töne ergänzt und somit zu kurzen melodischen Phrasen erweitert werden. Das Zusammenstellen kann dabei einerseits von der Lehrperson gemacht werden, wodurch die Schülerinnen eventuell einen Einblick in kreative Vorgänge erlangen können, oder andererseits von den Schülerinnen selbst, was schon als ein Element im improvisatorischen Gestaltungsprozess beschrieben werden kann. Wenn als Einführung eine Variante vorgegeben wird, wäre eine Beschränkung auf einen kleinen Tonraum ratsam. Die tatsächliche Anzahl von unterschiedlichen Tönen ist wiederum individuell abhängig, sollte aber nicht die 7 +/-2 Elemente Regel 171 überschreiten. Bei der anschließenden Gruppenphase sollte die Tonraumreduzierung beibehalten werden, sodass eine Verbindung zu den einleitenden Kategoriedarstellungen hergestellt werden kann. Möchte man den Schwierigkeitsgrad dabei erweitern, kann man den Partnern bei der Gruppenübung unterschiedliche Instrumente zur Verfügung stellen. Das Imitieren der gespielten Melodiefrequenzen kann sich dadurch als noch komplexer erweisen. Generell sollte bedacht werden, dass die Verbindung von Tonhöhen und Rhythmen für musikalische Anfänger eine entscheidend größere Schwierigkeitsstufe bedeutet, als für diejenigen mit musikalischem Vorwissen. Umso sinnvoller ist es daher, dieses auch im Vorhinein zu üben, bevor freiere improvisatorische Aufgaben gestellt werden. Darauf aufbauend können die Übungen und das Ausprobieren in den Kleingruppen als eine Art der freien Kreativitätsphase betrachtet werden. Wird diese Aufgabe gut geleitet, kann 171 Vgl. Spitzer (2002), S. 117. 87 die übergeordnete Grundstruktur bestehend aus sich abwechselnden vorgegebenen und freien Phasen von sinnvollem Nutzen sein. Übung II: Vertonen von Bildern Das musikalische Darstellen von Emotionen, wie es in der vorigen Übung beschrieben wurde, ist eine Möglichkeit aktiv kreativ zu werden. Denn es ist anzunehmen, dass Schülerinnen zu Beginn gewisse Anhaltspunkte benötigen, um musikalisch umsetzbare Ideen aktiv entstehen lassen zu können. Dies lässt sich unter anderem anhand des allgemeinen Kreativitätsprozesses ableiten: Ein gewisser Bezugsrahmen muss vorhanden, sodass das menschliche Verarbeitungssystem überhaupt neue Inhalte produzieren kann. In diesem Sinne ist eine weitere Möglichkeit Anhaltspunkte zur Verfügung zu stellen das musikalische Interpretieren von visuellen Eindrücken. Kurz gesagt, können sich Schülerinnen beim Gestaltungsprozess nicht nur an der Darstellung von Emotionen orientieren, sondern auch an verschiedenen Bildern und Eindrücken aus ihrer Umgebung. Die passende Übung dazu beinhaltet unterschiedliche Bilder, welche zusammenhängende Elemente darstellen sollten. Eine Möglichkeit wären Darstellungen von verschiedenen Tieren (z. B. Schlangen, Tiger, Spinnen) und mehreren Lebensräumen (z. B. Dschungel, Wüste, Meer). Schülerinnen werden in Zweiergruppen eingeteilt und dürfen sich ein Instrument aussuchen und zu Beginn probieren, wie man die Bilder musikalisch und pantomimisch darstellen könnte. Während eine Teilnehmerin das Bild vertont, soll die andere dieses nur anhand von Gesten beschreiben. Danach wird gewechselt, sodass jede beides geübt hat. Anschließend stellt sich die ganze Gruppe im Kreis mit den Instrumenten auf. Die Spielleiterin wählt das erste Tierbild aus und fordert mit Blickkontakt eine Gruppe auf, dieses mit dem ausgesuchten Instrument gepaart mit Pantomime darzustellen. Ohne zu unterbrechen, soll durch Blicke das „Spielrecht“ weitergegeben werden und die nächste Gruppe den passenden Lebensraum dazu darstellen. Die Spielleiterin gibt das nächste Tier vor, während die vorige Gruppe die Nächsten mit Blicken auszuwählen hat. Es sollten dabei alle Bilder vertont und so viele Versionen wie möglich gehört werden. Dabei wäre ein durchgehendes Metrum von Vorteil, welches durch die Lehrperson zur Verfügung gestellt werden kann. Als Abschluss oder Erweiterung kann anschließend ein Ratespiel folgen, indem Schülerinnen ein Tier und einen dafür untypischen Lebensraum vertonen und die andern das Dargestellte erraten müssen. 88 Bei dieser freieren Übung sind bereits improvisatorische Elemente enthalten. Die Begründung, warum sie als Vorbereitung für weitere Gestaltungsprozesse verwendet werden kann, bezieht sich auf die verschiedenen musikalischen und nicht-musikalischen Parameter, die darin eingebettet sind. Neben der körperlichen Aufwärmung durch die Pantomime, werden erste Versuche von freiem kreativem Gestalten gefördert. Durch die Darstellung von bekannten Eindrücken kann ein neuer Zugang zur Musik geschaffen werden, was als Voraussetzung für komplexere Improvisationsprozesse gesehen werden kann. Als Orientierungshilfe dient dabei das Vertonen von Tieren, aus dem Grund, dass Schülerinnen sowohl deren Geräusche als auch deren Gangarten darstellen können. Dadurch sollen ihnen kreative Anhaltspunkte zur Verfügung gestellt werden. In diesem Sinne sind die darin enthaltenen kurzen improvisatorischen Phasen noch von außen geleitet, was ein Eingreifen vonseiten der Lehrperson zulässt. Zu Beginn ist die Leitung von außen noch entscheidend, da Schülerinnen nicht überfordert werden sollen. Das Darstellen von bekannten Inhalten ermöglicht demnach eine Balance zwischen schon Bekanntem und freien kreativen Gestaltungsformen. Die Koordination mit pantomimischen Elementen soll unterstützend für die Speicherung der kreativen Einfälle dienen. Bewegung bringt Auflockerung und Abwechslung, was für die Aufmerksamkeit und Motivation von wichtiger Bedeutung ist. Zusätzlich wird das Gespielte mit unterschiedlichen Eindrücken in Verbindung gebracht und deshalb auch in verschiedenen Gehirnarealen verarbeitet. Musik wird mit Bewegung vernetzt, was zu einer besseren Speicherungs- und Abrufleistung beitragen kann. Dieses ist von entscheidender Bedeutung, da bei freiem improvisatorischem Musizieren auf das Erlernte zurückgegriffen wird. Je vielfältiger die Vorübungen also gestaltet sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die geübten Inhalte sinnvoll und zugänglich gespeichert werden, und desto kreativer kann jemand bei anschließenden Übungen agieren. Gelernt wird dabei auch von der Kreativität anderer: Durch das Vorspielen der Vertonungen werden die musikalischen Umsetzungen der anderen auch aufgenommen und analysiert. Soll die Speicherung dieser noch gefördert werden, kann man die Schülerinnen das Gespielte der anderen noch wiederholen lassen. Durch das Ergänzen eines Metrums sollen sich die Teilnehmenden auf einen gemeinsamen Grundrhythmus einstellen können. Um dieses zu Beginn zu erleichtern, können die einzelnen musikalischen Darstellungen der Tiere auch in der Großgruppe besprochen und geübt werden. Das Ziel sollte sein, ein durchgehendes Metrum durch 89 den ganzen Spielprozess beizubehalten. Obwohl dieses bei freien Improvisationsübungen nicht von allzu wichtiger Bedeutung zu sein scheint, kann es doch als ein wichtiger Bestandteil des tonalen Improvisierens gesehen werden. Denn für Letzteres sollte eine musikalische Strukturiertheit geschaffen werden, damit die entstehenden kreativen Einfälle sinngemäß wiederholt und behalten werden können. Zusätzlich fördert das Üben eines gemeinsamen Metrums das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Gruppe. Deshalb könnten gemeinsame rhythmische Übungen in jeder Aufwärmphase verwendet und somit einleitend für jede improvisatorische Tätigkeit integriert werden. Übung III: Gemeinsam musizieren Allgemeine Übungen zur Förderung des Vertrauens in einer Gruppe wurden in der Aufwärmphase beschrieben. Darauf aufbauend sollte auch musikalisch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entstehen, sodass Musizierende lernen, dass auch beim kreativen Prozess aufeinander Rücksicht genommen werden muss. Das kollektive „Spielen“ von Pausen kann dabei als eine Möglichkeit gesehen werden, dieses zu erreichen. Die folgende Aufgabe bezieht sich auf das Musizieren von Pausen und kann durch ihre Einfachheit an verschiedene Situationen und Klangstücke angepasst werden. Schülerinnen dürfen sich Instrumente aussuchen, die sie kurz ausprobieren sollen. Die Gruppe soll sich anschließend in einem Kreis zusammenfinden und gemeinsam ein Klangstück gestalten. Ohne zu sprechen, beginnt jemand zu spielen, bis eine andere einsetzt. Hat man das Gefühl, dass die Vorige ihren Gedanken musikalisch abgeschlossen hat, kann auch eine Pause gelassen werden. Rücksicht sollte dabei auf Dynamik und Spielart genommen werden. Unabhängig von der Länge dieses Stückes, sollte das Ziel ein gemeinsamer Abschluss sein. Im Nachhinein wird besprochen, ob die Schülerinnen mit dem Ergebnis zufrieden sind und gemeinsame Pausen möglich sind. Die Übung kann danach beliebig oft wiederholt werden.172 In dieser einfachen Ausführung kann die beschriebene Übung als Einstimmung auf gemeinsames Gestalten verwendet werden. Die Aufmerksamkeit der Gruppenmitglieder ist dabei von entscheidender Bedeutung, da sonst das Spielen von Pausen nicht möglich wäre. Es soll dabei kein wahlloses und unkoordiniertes Klangexperiment entstehen, sondern ein in gewisser Weise geleitetes Musikstück. Zu Beginn wird es durchaus sehr 172 Für eine Erweiterung dieser Übung siehe Schwabe (1992), S. 42f. 90 schwierig sein, Pausen gemeinsam durchzuhalten, was durch eine Lenkung vonseiten der Lehrperson verbessert werden könnte. Es kann im Vorhinein auch die Anzahl der zu spielenden Pausen ausgemacht werden, sodass die Schülerinnen verschiedene Anhaltspunkte in dieser doch sehr freien Aufgabe haben. Der Vorteil dieser Übung kann durchaus in ihrer Einfachheit gesehen werden, denn die Reduktion von verschiedenen Aufgabenstellungen in einer Übung kann auch zu einer besseren Konzentration beitragen. Zu Beginn kann es durchaus von Vorteil sein, wenn die Schülerinnen ihre Aufmerksamkeit nur auf ein bis zwei Elemente richten müssen, vor allem wenn die Instrumente, die sie dafür verwenden, noch unbekannt waren. Sind diese allerdings schon bekannt, kann die Übung auch als Zwischenaufgabe verwendet werden. Wird darauf geachtet, dass sich die Schülerinnen ruhig in diese Übung einfühlen können, kann dadurch deren Aufmerksamkeit wieder auf die Gruppe und den Unterricht gelenkt werden. Das „Fühlen“ der Pausen muss dabei genauso geübt werden, wie der Umgang mit Instrumenten und beispielweise das Spielen von Rhythmen. Möchte man diese Übung etwas weniger frei gestalten, kann jedem Instrument wieder ein unterschiedlicher Rhythmus und/oder können Dynamikunterschiede zugeteilt werden. In diesem Fall würde man den Schülerinnen wieder gewisse Vorgaben zur Verfügung stellen, sodass sie diese als Anhaltspunkt verwenden können. Vergleichbar mit den vorigen Übungen kann diese demnach als Einführung in den Umgang mit Instrumenten sowie mit der Umsetzung von verschiedenen musikalischen Parametern verwendet werden. Abhängig vom Vorwissen der Schülerinnen und deren Aufmerksamkeit können mehr oder weniger Zwischenaufgaben integriert werden. Als Vorbereitung auf vollkommen freie Gestaltungsaufgaben kann diese Übung mit vorgegebenem Tonraum verwendet werden, und zwar als Ergänzung zu einem fixen Musikstück. In diesem Zusammenhang ist das Singen von Liedern im Unterricht auch mit improvisatorischem Gestalten in Verbindung zu bringen. Jedes fix vorgegebene Musikstück kann als Anfangspunkt einer Improvisation verwendet werden. Als Einleitung sollte der Übergang von diesem Stück in die Improvisation bewusst geübt werden, was durch das Anhängen einer solchen Übung möglich wäre. Dabei könnte man auf das tonale Material eines im Unterricht behandelten Liedes zurückgreifen und dieses als Vorgabe für das zu Spielende in der Übung festlegen. Wie die genaue Umsetzung strukturiert sein könnte, wird in den Übungen der letzten Phase beschrieben. 91 Übung IV: Gleichzeitiges Hören und Umsetzen Improvisation im schulischen Raum ist nur schwer von Gruppenaktivitäten zu trennen. Obwohl es durchaus von wichtiger Bedeutung ist, dass sich die Schülerinnen auch individuell, zum Beispiel in einem Solo, zeigen können, sollte dieses doch immer in eine Gruppenübung eingebunden sein, da der Rest der Klasse auch miteinbezogen werden sollte. Kommt es zu gleichzeitigem Spielen, müssen die Teilnehmenden nicht nur in der Lage sein, ihr Instrument zu beherrschen und rhythmisch wie melodisch und dynamisch reagieren zu können, sondern simultan auch auf andere in musikalischer Hinsicht Rücksicht zu nehmen. Bei der ersten vorgestellten Übung wurde das Reagieren im Sinne von Zuhören und Nachspielen geübt. Um die Hörkompetenz noch um eine Stufe zu erweitern, sollten Schülerinnen in der Lage sein, aufzunehmen, was die anderen zur Verfügung stellen und dabei gleichzeitig die eigenen Ideen umsetzen. Die daraus resultierende Mehrstimmigkeit erfordert höchste Konzentration bei den Umsetzenden, wenn nicht nur mit der eigenen Stimme kreativ musiziert wird, sondern in Verbindung zu anderen gleichzeitig eine Interaktion entstehen soll. Um diese Kompetenz zu erlangen, muss die Benennung von anderen musikalischen Parametern wie Rhythmus oder Dynamik noch nicht zur Gänze erlernt sein und kann deshalb auch bei Anfängern bald in den Musikunterricht miteinbezogen werden. Eine hervorragende Möglichkeit der Einführung in das gleichzeitige Hören und Produzieren von Musik ohne dabei bewusst auf die erwähnten Parameter achten zu müssen, kann das Singen eines Kanons sein.173 Obwohl es durchaus von Vorteil ist, wenn Schülerinnen das musikalische Reagieren aufeinander in einfacheren Aufgaben geübt haben, kann das Spielen oder Singen eines nicht allzu schwierigen Kanons den gleichen Zweck erfüllen. Möchte man gleiche Voraussetzungen schaffen, sollte zu Beginn der Fokus auf dem Singen liegen, da Schülerinnen mit Instrumentalausbildung beim Spielen einen großen Vorteil gegenüber denjenigen hätten, die noch keine Erfahrungen vorweisen können. Besonders bei Aufgaben, die etwas essentiell Neues enthalten, wie in diesem Fall gleichzeitiges Singen und Reagieren (Hören) auf andere, sollten ideale Voraussetzungen für die Schülerinnen in Hinblick auf von außen beeinflussbare Umstände geschaffen werden. Obwohl Unterschiede in der musikalischen Vorerfahrung für manche keine Bedeutung haben, wird es doch als ein 173 Die Idee zur Verwendung von Kanons in Zusammenhang mit der vorbereitenden Förderung von improvisatorischem Gestalten (Zurverfügungstellung musikalischen Materials) stammt von Bernhard Gritsch, 2015. 92 allgemeines Grundbedürfnis angesehen, sich in Beziehung zu anderen zu setzen. In Bezug auf persönliche Beobachtungen könnte der hemmende Faktor des minderwertigeren Selbstkonzepts im Vergleich zu andern minimiert werden, wenn die Umsetzung eines Kanons zu Beginn stimmlich erfolgt. Auch wenn es durchaus Unterschiede in der stimmlichen Vorbildung zu beobachten gibt, scheint dies Schülerinnen weniger zu stören, als wenn diese von instrumentaler Natur sind. In Hinblick auf die strukturelle Planung kann eine Aufwärmphase nicht nur zur körperlichen und stimmlichen Aktivierung beitragen, sondern gleichzeitig auch freiere Sequenzen beinhalten. In Bezug auf den Inhalt des Kanons können dabei kurze sprachliche Improvisationsübungen, eventuell mit der Verwendung von Perkussionsinstrumenten als Untermalung, als Einstimmung auf das Folgende verwendet werden. Eine Art der Sprachimprovisation, die bei verschiedenen Inhalten verwendet werden kann, wäre das kreative Gestalten von Klängen und Geräuschen anhand von relevanten Begriffen, welche entweder im Liedtext vorkommen oder sinnbezogen assoziiert werden können. Die Instrumentalklänge können dabei clusterartig zusammengestellt und mit den sprachlich veränderten Wörtern zu einem Gesamteindruck zusammengefasst werden. Dieser kann anhand von Silben und daraus entstehenden Geräuschen kreativ verändert werden. Eine zusätzliche Erweiterung kann durch dynamische Veränderungen erzielt werden. In Verbindung mit körperlichen Bewegungen bietet sich an, diese kurze Übung sehr frei oder aber auch durch die Lehrperson gelenkt zu gestalten. Beim anschließenden Singen des Kanons besteht die Möglichkeit, auf die vorherigen Eindrücke und Klänge zurückzugreifen. Dies kann als vorgegebene Sequenz in der übergeordneten Struktur gesehen werden, in welcher bewusste Anleitungen der Lehrperson erfolgen sollten, sodass die Schülerinnen das Konzept der dabei entstehenden Mehrstimmigkeit auch bewusst erfassen können. Der große Vorteil dieser Übung ist das Verbinden von verschiedenen musikalischen Gestaltungsmöglichkeiten und deren Umsetzung in einer Gruppe, mit dem übergeordneten Üben von aufeinander hören und gleichzeitig musizieren. Die zur Aufwärmung gedachte kreative Sprachimprovisation kann fließend in den Kanon übergehen und somit strukturell von einer freieren Phase zu einer vorgegebenen Struktur führen. Vergleichbar mit den vorigen Übungen können sich die Schülerinnen beim freieren Teil mit verschiedenen Instrumenten, Rhythmen und Dynamikarten auseinandersetzen. Dies kann wiederum als Einleitung für das Folgende verwendet 93 werden: Abhängig vom übergeordneten Inhalt der Unterrichtsstunde kann die Improvisationsleiterin bei diesem Teil besonders Rücksicht auf unterschiedliche Parameter nehmen. Beim anschließenden Singen des Kanons wird nicht nur die stimmliche Umsetzung trainiert, sondern auch das aufeinander Hören im Rahmen einer Mehrstimmigkeit. Dies ist besonders wichtig für weiterführende improvisatorische Übungen. Nur wenn es den Gruppenmitgliedern gelingt, gleichzeitig kreativ zu musizieren und auf andere zu hören, kann ein homogenes Musikstück ohne Unterbrechungen entstehen. Das automatische Hören auf andere und das spielende Reagieren kann allerdings nicht innerhalb von ein paar Stunden geübt werden. Deshalb sollten adäquate Aufgaben, die dieses beinhalten, von Anfang an so gut wie möglich integriert werden. Nur durch die Wiederholung wird es den Schülerinnen möglich sein, gleichzeitig zu spielen und Rücksicht auf das Gespielte der anderen zu nehmen. In diesem Zusammenhang zeigt sich die Besonderheit des Kanons: Dieser kann von Beginn an in den Musikunterricht miteinbezogen werden, da das Schwierigkeitsniveau leicht angepasst werden kann. Zu Beginn könnte man sich auf kürzere und leichtere Melodien beschränken, was das Auswendiglernen begünstigen würde. Denn Singen ohne Noten ermöglicht eine bessere Konzentration auf das Hören und Reagieren, da die Aufmerksamkeitskapazität weniger geteilt werden muss. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass verschiedene Arten von Übungen als Vorbereitung auf improvisatorisches Gestalten verwendet werden können. Die Aufgaben, die in dieser Phase beschrieben wurden, beinhalten nicht nur vorgegebene Inhalte, sondern auch freiere Aufgaben, bei welchen die Kreativität gefördert und aktiviert werden soll. Durch diese Vielfältigkeit sollen so viele musikalische Parameter wie möglich kennengelernt und gespeichert werden, sodass sie für die Schülerinnen später wieder verwendet werden können. In den beschriebenen Übungen wurde demnach unter anderem auf folgende Faktoren wertgelegt: Körperliches Aufwärmen, Bewegungsabläufe, Metrum und Rhythmik, Dynamik, Instrumenteneinführung, Singen und Mehrstimmigkeit. Diese wurden in verschiedenen Konstellationen zusammengestellt, wobei sowohl vorgegebene Musikstücke als auch improvisatorische Elemente ihre Verwendung finden sollten. Zusätzlich wurde auf gruppen- und vertrauensbildende Aspekte Rücksicht genommen, welche bei Kreativitätsprozessen von entscheidender Bedeutung sind. Wenn diese Übungen als Vorbereitung für weitere 94 Aufgaben dienen und komplexeres improvisatorisches Gestalten fördern sollen, möge die Improvisationsleiterin neben den erwähnten Faktoren der Tatsache Beachtung schenken, dass bekannte Inhalte vorhanden sein müssen. Als Beispiel dient die musikalische Darstellung von sprachlichen oder bildlichen Vorgaben, welche in den ersten beiden Übungen enthalten sind: Bereits bekannte Emotionen oder Vorstellungen sollen mit neuen Reizen aktiv verknüpft werden, sodass Anhaltspunkte für späteres Gestalten geschaffen werden können. Dies kann als der Kernpunkt jeder Übung aus der kategorialen Phase gesehen werden. Bereits existierende Inhalte sollen auf aufmerksamkeits- und motivationsfördernde Weise, was meist durch Vielfältigkeit in der Aufgabenstellung erreicht wird, mit neuen musikalischen und für improvisatorisches Gestalten besonders wichtigen Elementen zusammengefügt werden. 2.2.3 Improvisatorische Phase Die Aufgabenstellungen in dieser letzten Phase sollen als mögliche Anleitungen für improvisatorisches Gestalten gesehen werden. Die folgenden Beschreibungen können demnach als Vorlage für weiterführende Übungen dienen und an die situativen Umstände einer Lehr- und Lernsituation angepasst werden. Es handelt sich dabei um Aufgaben, welche einen möglichen Beginn von freiem Musizieren im Sinne von „ohne vorgegebene Noten etwas Neues erschaffen“ darstellen könnten. Die Übungen bestehen deshalb nicht nur aus freien improvisatorischen Elementen, sondern beinhalten bewusst noch Anhaltspunkte wie vorgegebene Tonräume oder Rhythmen, um den Schülerinnen einen fließenden Einstieg in das freie kreative Gestalten zu ermöglichen. Der Unterrichtsvorbereitung sollte in diesem Zusammenhang besondere Beachtung geschenkt werden. Das Klassenklima und die persönlichen Interessen sollten, wenn möglich, im Vorhinein bekannt sein, sodass die Lehrperson adäquate Bedingungen für kreative Prozesse schaffen kann. Wie bereits erwähnt wurde, spielt das Anforderungsniveau der Übungen in Hinblick auf hemmende Reaktionen eine wichtige Rolle. Zusätzlich ist sicherzustellen, dass sich die Schülerinnen so gut wie möglich in der schulischen Umgebung entfalten können und keine Angst haben müssen, sich vor anderen zu blamieren. Neben dem Fördern einer sicheren Umgebung durch Vertrauensübungen können auch motivationale Faktoren Stress- und Angstreaktionen vorbeugen. Sind die zu erfüllenden Übungen so geplant, dass sie das Interesse der Teilnehmenden erwecken und diese neugierig machen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Dopaminausschüttung sehr hoch. Das limbische System generiert somit positive 95 Emotionen, welche großen Einfluss auf das motivationale Verhalten ausüben, indem unter anderem die Aktivierung der Amygdala und somit eine Kopplung von situativen Bedingungen an Angstreaktionen verhindert wird. Die Aufgabenstellungen sind demnach so gewählt, dass diese gut an die vorherrschenden Bedingungen angepasst werden können und die Möglichkeit von Anfang an besteht, die Interessen der Teilnehmenden miteinzubeziehen. Übung I: Vom Lied zur Improvisation In der folgenden Übung wird Bezug genommen auf eine bereits beschriebene Erweiterungsmöglichkeit der dritten Aufgabe aus der vorigen Phase. Dabei soll ein Lied, auch in Form eines Kanons, als musikalische Vorlage dienen. Nachdem dieses erarbeitet wurde, wird ein bestimmtes Tonmaterial in Form einer kurzen Phrase oder auch nur eines Rhythmus entnommen und gemeinsam für die anschließende Improvisationsübung festgelegt. Dieses Element kann dabei gesungen oder gespielt werden und als Vorbereitung in der Gruppe geübt werden. Anschließend soll das Lied nochmals musiziert werden, allerdings in einem Klangteppich enden. Jede darf ein Geräusch mit ihrem Instrument oder der Stimme erzeugen, welches dann zu einem gemeinsamen Ton aus dem Lied zusammenfinden soll. Aus diesem darf dann eine zuvor festgelegte Teilnehmerin mit der Improvisation beginnen, indem das ausgewählte Tonmaterial gespielt wird. Nacheinander können die anderen dann einsetzen. Pausen, sowie spontane Veränderungen innerhalb des vorgegebenen Tonraumes sind erlaubt und erwünscht. Hat man das Gefühl, dass sich jeder verwirklichen konnte, sollte wiederum ein Klangteppich aus unterschiedlichen Geräuschen entstehen, welcher als Abschluss in einem gemeinsamen Ton zu enden hat. Wie die Umsetzung der ausgesuchten Phrase zu erfolgen hat, sollte im Vorhinein besprochen werden. Vereinfacht könnte dieses dadurch werden, dass die aus dem Lied entnommene Ton- oder Rhythmussequenz im Vorhinein schon improvisatorisch verändert werden kann, sodass die Schülerinnen in dem Moment der gemeinsamen Improvisation auf die geübten Phrasen zurückgreifen können. Zu Beginn kann die Konzentration dabei nur auf eine rhythmische Phrase, die auf unterschiedlichen Tonhöhen wiederholt werden soll, gesetzt werden. Möchte man dies erweitern, nimmt man mehrere rhythmische Phrasen aus dem Lied und lässt anhand von diesen eine Improvisation beginnen. Die Spielweise, ob mehrstimmig oder einstimmig, sollte vom 96 ausgesuchten Tonmaterial und dem daraus entstehenden Klangerlebnis abhängig gemacht werden. Der Sinn dieser Übung soll in der Erkenntnis liegen, dass improvisatorisches Gestalten auch an bereits existierende Stücke angelehnt werden kann. Als Einführung kann dieses eine ideale Möglichkeit sein, mit dem musikalischen Inhalt des Stückes noch weiterzuarbeiten und daraus etwas Neues zu schaffen. Schülerinnen können sich dabei an etwas Vorgegebenem orientieren und gleichzeitig individuell kreativ werden. Die Improvisation kann dabei einstimmig oder mehrstimmig vollzogen werden, abhängig von den Vorgaben der Lehrperson. Für Letzteres ist das Üben eines Kanons von großem Vorteil, da dieser als Vorbereitung für gleichzeitiges Spielen und Hören fungieren kann. Sollten die Schülerinnen Schwierigkeiten haben, die musikalischen Phrasen sinnvoll umzusetzen, kann eine Verbindung zu anderen Übungen, in welchen sprachliche oder visuelle Inhalte als Vorlage dienen, hergestellt werden. Die Darstellung von Emotionen oder Bildern kann es ermöglichen, dass Schülerinnen die musikalischen Inhalte für sich selbst sinnvoll interpretieren und somit auch strukturierter musizieren können. Denn umso geordneter die Reize von außen im System in eine Struktur gebracht werden, umso nachhaltiger werden die Inhalte gespeichert und können später wieder abgerufen werden. Auch wenn diese nach dem einmaligen Üben nicht bewusst zugänglich sind, wurden dadurch neurologische Verbindungen geschaffen, welche als Grundlage für weiterführende Prozesse gesehen werden können. Es wird angenommen, dass Kreativitätsvorgänge unter anderem auch auf diese geschaffenen Strukturen zurückgreifen, auch wenn die durch Wiederholung noch nicht selbstbestimmt zugänglich gemacht wurden. 174 Da improvisatorisches Gestalten eng mit kreativen Prozessen verknüpft zu sein scheint, ist dieses von besonders wichtiger Bedeutung für komplexere improvisatorische Tätigkeiten. Denn das Ziel sollte sein, vollkommen selbstständiges musikalisches Gestalten zu ermöglichen. Die Entstehung von musikalischen Umsetzungsschwierigkeiten hat ihren Ursprung in unterschiedlichen Faktoren, welche von der Improvisationsleiterin bereits im Vorhinein in Betracht gezogen werden müssen. Löst die beschriebene Aufgabenstellung offensichtliche Überforderung in der Gruppe aus, kann man sich zuerst mehr auf vorbereitende Übungen mit kurzen improvisatorischen Elementen beziehen, bevor man diese Übung nochmals wiederholen möchte. Bei Unterforderung kann das 174 Vgl. Jäncke (2009), S. 322f. 97 Improvisationselement freier gestaltet werden, indem man den Schülerinnen nicht nur kurze Phrasen als Vorgabe gibt, sondern nur einen angepassten Tonraum, in welchem sie sich frei mit individuell rhythmischen Umsetzungsmöglichkeiten bewegen können. Entscheidend ist, dass genügend, aber nicht zu viele, Reize von außen vorhanden sind, sodass die Aufmerksamkeits- und Motivationsspanne aufrechterhalten werden kann. In diesem Zusammenhang ist der große Vorteil dieser Übung, dass das Ausgangslied frei gewählt und somit an die Interessen der Schülerinnen angepasst werden kann. Dies ist besonders essentiell für den motivationalen Aspekt: Nur wenn die Teilnehmenden von einem intrinsischen Motivationsantrieb gelenkt werden, kann das musikalische Ergebnis optimal gestaltet und erfahren werden. Übung II: Weiterführung einer Melodie Das aufeinander Hören und gemeinsame Musizieren können in dieser Übung als Kernpunkt betrachtet werden. Zu diesem Zweck wird den Teilnehmenden ein bestimmter Tonraum vorgegeben. Zu Beginn sollte dieser eher kleiner angesetzt werden, mit drei unterschiedlichen, aber aufeinander folgenden Tönen, was im Laufe der Zeit erhöht und demnach an das Können der Schülerinnen angepasst werden sollte. Die Vorgabe eines durchgehenden Metrums vonseiten der Improvisationsleiterin ist von Vorteil. Zu Beginn kann eine kurze gemeinsame Phrase geübt werden, die im Laufe der Improvisation als Anhaltspunkt und Refrain verwendet werden kann. Die Improvisation beginnt, wenn die Leiterin das Metrum vorgibt und alle gemeinsam die erste Phrase spielen. Sitzt man dabei im Kreis, kann das „Spielrecht“ nacheinander weitergegeben werden. Möchte man dieses strukturierter gestalten, darf jede eine bestimmte Taktanzahl spielen, bevor die nächste fortsetzen darf. Das Ziel sollte sein, dass jede mit den vorher ausgemachten Tönen eigenständige musikalische Phrasen kreiert, welche durch den nächsten weitergeführt werden sollen. Pausen sind dabei durchaus erlaubt, das Metrum sollte allerdings nicht unterbrochen werden. Die Weiterführung einer musikalischen Phrase sollte von außen erkennbar sein. Imitationen sind durchaus erlaubt. Möchte man die Anforderung zusätzlich erhöhen, dürfen die Schülerinnen nur mit dem zuletzt gespielten Ton fortsetzen. Abhängig von der Anzahl der Teilnehmerinnen und der Tempowahl können mehrere Runden mit unterschiedlichen bild- oder emotionsbezogenen (traurig oder heiter spielen, ein Tier nachmachen, etc.) Vorgaben gespielt werden. Als Abschluss jeder Runde kann der zu Anfang geübte Refrain gemeinsam gespielt werden. 98 Diese Art von Improvisationsübung ist durchaus bekannt und häufig verbreitet. Der große Vorteil davon ist, dass sie durch die Vorgaben vonseiten der Lehrperson adäquat an die Fähigkeiten der Teilnehmenden und zugleich den Lerninhalt angepasst werden kann. Als Bespiel dient die Ergänzung, dass Schülerinnen nur mit einem vorgegebenen Ton weiterspielen dürfen: Dadurch wird nicht nur die inhaltliche Fortsetzung der zuvor gespielten Phrase verlangt, sondern auch die Konzentration auf die musikalische Umsetzung gelenkt. Teilnehmende müssen nicht nur auf das Dargestellte hören, sondern auch auf die Art, wie dies musiziert wird. Es ist anzunehmen, dass das Finden des richtigen Tons zu Beginn sicherlich nicht allzu einfach sein wird. Beschränkt man die Auswahl der verschiedenen Töne allerdings auf eine kleine Gruppe, kann dies für die Schülerinnen vereinfacht werden. Möchte man die benötigte Aufmerksamkeit noch erhöhen, kann die Vorgabe einer zu spielenden Taktanzahl weggelassen werden. Wenn Improvisationsteilnehmerinnen nicht wissen, wie lange ihre Vorgängerin spielen wird, muss die Konzentration auf das Gespielte sehr groß sein, sodass sie adäquat fortsetzen können. Das Spielen eines Refrains kann dazu auch beitragen: Wird vorher nicht ausgemacht, wann dieser gespielt wird, kann jede Teilnehmerin diesen einbringen, wenn sie selbst nicht kreativ fortsetzen möchte. Die Aufmerksamkeit der anderen ist dabei von großer Bedeutung, da der zuvor geübte Refrain immer von allen Teilnehmenden gemeinsam gespielt werden soll. Der Zweck dieser Übung ist, in einem geschützten Rahmen innerhalb einer Gruppe und doch individuell etwas musikalisch Unvorhergesehenes zu erschaffen. Die Tatsache, dass gewisse Vorgaben, wie die zu spielende Taktanzahl oder die darzustellende Stimmung, integriert werden können, ermöglicht eine gewisse Strukturiertheit, die im Vorhinein geplant werden kann. Improvisieren in der Gruppe erlaubt es, auf andere Ideen reagieren zu können und diese als Anhaltspunkt zu verwenden. Ließe man die Teilnehmerinnen alleine spielen, könnten ihre kreativen Prozesse nur auf das Gespeicherte zurückgreifen. Bei dieser Übung sollen die Schülerinnen voneinander lernen, aber gleichzeitig selbst kreativ gestalten. Haben diese Vertrauen in ihre Gruppe, können sie sich lustvoll und musikalisch entfalten und ihre eigenen Ideen miteinbringen. Es geht dabei nicht um perfekt klingende Phrasen, sondern das Erlernen von Selbststrukturiertheit durch das gleichzeitige Aufnehmen von äußerlichen Reizen und das persönliche musikalische Reagieren und Ergänzen dieser anhand von individuellen Kreativitätsprozessen. Die Beschränkung auf einen vorgegebenen tonalen Raum soll in diesem Zusammenhang die Improvisation erleichtern. Denn anzunehmen 99 ist, dass die meisten Teilnehmerinnen aus der in der Einleitung erwähnten Zielgruppe, noch keine ausreichenden Erfahrungen gemacht haben, sodass keine Vorgaben notwendig wären. Übung III: Erzählende Musik Die folgende Übung soll es den Teilnehmenden ermöglichen, sich kreativ in kleineren Gruppen zu zeigen und selbst spontan Musik zu erfinden. Im Vorhinein müssen kleine Kärtchen vorbereitet werden, auf welchen sich Beschreibungen von verschiedenen Personen, Beziehungen und Orten befinden. Schülerinnen werden in Gruppen zu mindestens vier Personen eingeteilt und dürfen je nach Vorgabe verschiedene Kärtchen ziehen. Gemeinsam sollen sie mit den darauf befindlichen Informationen eine kurze Geschichte zusammenstellen, die mit Hilfe von musikalischer Untermalung erzählt werden soll. Ob beim Erzählen dieser Geschichte im Anschluss gesprochen werden darf oder nur pantomimisch gezeigt werden soll, kann durch die Improvisationsleiterin festgelegt werden. Musikalisch gesehen sollte die Vorgabe sein, dass jede Person mit einer bestimmten kurzen Phrase charakterisiert werden soll. Die Instrumente dürfen selbst gewählt werden. Um tonales Improvisieren zu ermöglichen, könnte wiederum eine Begrenzung der zu verwendenden Töne im Vorhinein besprochen werden. Möchte man die musikalische Umsetzung nicht nur auf melodische Phrasen beschränken, könnten freiere Gestaltungsformen auch erlaubt sein. Das Endziel sollte allerdings die Darstellung einer kurzen Geschichte mit musikalischer Untermalung sein. Beachtet werden sollte, dass die Gruppen auch getauscht werden, sodass jede einmal nur schauspielern oder musizieren kann. So einfach die Beschreibung dieser Übung klingen mag, so kreativ müssen die Schülerinnen dabei sein. Mit minimalsten Vorgaben sollen diese die Personen und Orte musikalisch charakterisieren und zu einem Ganzen zusammenfügen. Als Vorübung wäre die Darstellung von Emotionen, Sprache und Bildern mit musikalischen Mitteln eine adäquate Vorbereitung. Zu beachten ist, dass zu Beginn die Schülerinnen genug Zeit zur Vorbereitung bekommen, wenn sie das erste Mal selbstständig musikalische Phrasen erfinden sollen. Umso mehr Vorgaben dabei gemacht werden, umso leichter sollte sich dieses für die Teilnehmenden gestalten. Wie bereits bei anderen Übungsbeschreibungen erwähnt wurde, können sowohl musikalische als auch inhaltsbezogene Einschränkungen der Strukturierung von eintreffenden und aus kreativen Prozessen entstehenden Reizen beitragen. Wird diese Aufgabenstellung als 100 Anregung für die erste freiere Gestaltungsübung verwendet, sollten, um Überforderungsmechanismen zu vermeiden, demnach mehrere Parameter vorgegeben werden. Möchte man allerdings spontanes, improvisatorisches Gestalten anregen, kann diese Übung auch ohne Vorbereitung angewendet werden: Dazu kann die Klasse in zwei große Gruppen geteilt werden, eine soll pantomimisch, die andere musikalisch darstellen. Die Lehrperson sollte dabei die Kärtchen mit den Vorgaben ziehen und den Schülerinnen diese „zurufen“. Die Schauspieler sollen sich spontan eine Rolle aussuchen und mit wenigen Worten deren Gemütszustand beschreiben. Nachdem diese ihre Beschreibung erzählt hat, soll eine kurze melodische Phrase, um das Erzählte zu untermalen, von der anderen Gruppe gespielt werden. Um sich diese auch zu merken und eine Strukturiertheit zu garantieren, sollten diese von allen Musikern im Anschluss gleich wiederholt werden. Es werden mehrere Personenbeschreibungen stattfinden, welche immer musikalisch unterlegt werden sollen. Mehr als fünf verschiedene Phrasen und deshalb auch Personen sollten allerdings nicht miteinbezogen werden, da angenommen werden kann, dass sich diese die Schülerinnen nicht merken könnten.175 Sind die Personen vorgestellt, kann eine Schülerin als Erzählerin diese spontan, mit Hilfe der anderen Informationen von den gezogenen Kärtchen, zu einer kurzen Geschichte zusammenfügen. Jedes Mal, wenn dabei die Personen erwähnt werden, muss die passende Phrase, die zu Beginn gestaltet wurde, gespielt werden. Dieses letzte Element des Geschichtenerzählens kann allerdings auch weggelassen werden. Ist diese Übung schon bekannt und können sich die Teilnehmenden deshalb die musikalischen Phrasen sehr schnell merken, ist der letzte Teil als eine adäquate Ergänzung zu sehen. Der Vorteil beider Versionen zeigt sich in der Abwechslung: Das Erfinden einer Geschichte erlaubt das Darstellen von kreativen Einfällen auf unterschiedliche Weise (pantomimisch und musikalisch), welche situationsbedingt entstehen können und sollen. Im Vergleich zur vorigen Übung können bei dieser die Schülerinnen wieder voneinander kreativ inspiriert werden. Die pantomimische Darstellung kann dabei nicht nur Anregungen für die musikalische Umsetzung zur Verfügung stellen, sondern auch gleich zum körperlichen Aufwärmen beitragen. Lässt man die Teilnehmenden vor den Personenbeschreibungen die Umgebung darstellen, können dabei Klangteppiche und Cluster nicht nur als instrumentale Beschreibung, sondern auch als Eingewöhnung auf 175 Vgl. 7 +/-2 Elemente Regel. 101 die Instrumente eingesetzt werden. Zusätzlich ist der positive motivationale Aspekt dieser Aufgabenstellung von entscheidender Bedeutung: Die Möglichkeit besteht, dass spezifische Personen- (z. B. Superheld, Bösewicht, Mörder, Weihnachtsmann) und Situationsbeschreibungen zusammengestellt werden, welche das Interesse der Schülerinnen mit großer Wahrscheinlichkeit erwecken werden. Spezielle Orte (z. B. Tropische Insel, Mars, unter Wasser) und außergewöhnliche Eigenschaften (z. B. unsterblich, durchsichtig, allwissend) könnten diesen Effekt noch unterstützen. Sind die Interessen der Teilnehmenden noch unbekannt, würde sich die Möglichkeit anbieten, die Kärtchen mit den Beschreibungen selbst zu basteln. Die Kreativität und das Interesse an der darauffolgenden Übung kann somit von Beginn an geweckt werden. Zusammenfassend ist zu bemerken, dass die Vielfältigkeit des Improvisationsbegriffs ein großer Vorteil im Unterricht sein kann. Die beschriebenen Übungen sind nur Beispiele für mögliche Umsetzungsvarianten und können durch Kleinigkeiten schnell und effektiv verändert und an die Unterrichtssituation angepasst werden. Bewegungssequenzen können dabei genauso wie musikalische Darstellungen Kernpunkt einer Improvisation sein. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, was nicht nur zur musikalischen, sondern auch zur persönlichen Entwicklung beitragen kann. In Hinblick auf die unzähligen Improvisationsinhalte ist eine Beschränkung für die Unterrichtssituation wichtig. Die Eingrenzung auf einen tonalen Wirkungsbereich ist als Hilfestellung sowohl für die Schülerinnen als auch die Lehrpersonen gedacht: Möchte man komplexeres freies Gestalten integrieren, muss dieses erst „gelernt“ werden, indem zugrundeliegende Prozesse vorher geübt werden. Die Konkretisierung des Gestaltungsbegriffs kann demnach zur Strukturierung von Unterrichtssequenzen beitragen. Dies ist entscheidend, da die entstehenden kreativen Einfälle auch sinngemäß zum Lernprozess beitragen sollen, was durch strukturierte Speicherung begünstig wird. 3. Zusammenfassung Die Wichtigkeit der Integration von freien Gestaltungsaufgaben zeigt sich in den Beschreibungen der Aufgaben: Kreatives Gestalten liegt in der Natur des Menschen und ist in vielen Alltagssituationen unentbehrlich. Im Musikunterricht kann dieses gefördert werden, wenn auf verschiedene Faktoren Rücksicht genommen wird. Zu beachten ist, dass an gespeicherte Erfahrungen leicht angeknüpft werden kann, wenn Schülerinnen aufmerksam und motiviert sind. Die Wichtigkeit dieses Vorgangs bezieht sich auf das Lernergebnis: Auch wenn freies Gestalten eine Momentaufnahme sein kann, sollten die 102 kreativen Einfälle doch zur Speicherung des Erlernten beitragen, sodass darauf wieder zurückgegriffen werden kann. Besonders vielfältige Aufgaben aktivieren dabei weitgefächerte neuronale Strukturen, welche ein späteres Abrufen fördern können. Dieses sollte als der entscheidende Vorteil von improvisatorischem Gestalten gesehen werden. Schülerinnen können dabei selbst kreativ werden und ihre Ideen individuell nach ihren Ansprüchen umsetzen. Indem sie dabei selbst aktiv werden, können die erlernten Inhalte besser vernetzt und in das menschliche Erfahrungssystem integriert werden. Werden die Übungen auf die individuellen Interessen abgestimmt, können positive Emotionen bedingt durch die resultierende Dopaminausschüttung Aufmerksamkeit und Motivation fördern. Denn das übergeordnete motivationale Ziel sollte die intrinsische Form von Motivation sein, welche durch individuelle Erfahrungen und Vorlieben entstehen kann. Angst- und Stressreaktionen können dadurch vermindert und durch das Schaffen von Vertrauen im Vorhinein sogar eventuell verhindert werden. Zusätzlich fördert die Erfüllung der drei Grundbedürfnisse (Gefühl der Zugehörigkeit, Selbstkompetenz und Autonomie) eine positive Grundstimmung, welche sich sowohl auf den Lern- als auch den Speicherungsprozess positiv auswirkt. In den beschriebenen Übungen werden die drei Faktoren automatisch miteingebunden, da Schülerinnen durch die strukturierte Planung immer wieder freie Phasen für ihre kreative Entfaltung zur Verfügung gestellt bekommen. Sind Schülerinnen musikalisch noch unerfahren, sollte auf die Strukturierung besonders viel Wert gelegt werden, da bei nicht nachvollziehbarer Planung des Unterrichts rasch Gefühle der Überforderung und Resignation entstehen können. In diesem Sinne wurden die vorgeschlagenen Übungen in drei Phasen eingeteilt, welche zu einer besseren Orientierung hinsichtlich der Planung von kreativen Aufgaben für den Unterricht beitragen sollen. Die Aufgabenstellungen wurden so strukturiert, dass bei den Einführenden bereits kurze, freie kreative Sequenzen enthalten sind. Denn das Lernen von improvisatorischem Gestalten ist ein Entwicklungsprozess und sollte daher so bald wie möglich in den Unterricht integriert werden. Speziell die Übungen der Kategorialen Phase können leicht erweitert werden, sodass sie als reine Improvisationsaufgaben verwendet werden können. Die Vereinfachung der anderen Übungen könnte dazu beitragen, diese als Einführungsübungen zu verwenden. Ist die Zeit begrenzt, besteht 103 durchaus die Möglichkeit, einzelne Übungen aufzuteilen und in mehreren Stunden zu bearbeiten. Ziel dieser Aufgabenbeschreibung sollte es sein, die Wichtigkeit und die Einfachheit der Integration von improvisatorischem Gestalten in den Unterricht zu zeigen. Schenkt die Lehrperson gewissen Einflussfaktoren Beachtung, kann angenommen werden, dass die Schülerinnen auf eine positive Weise sowohl musikalisch als auch persönlich profitieren können. 104 Resümee Es ist durchaus wichtig zu erfahren, welche internen Prozesse das Musizieren beeinflussen können. Speziell für den Musikunterricht sind neurologische Vorgänge interessant, da durch das Erschaffen von Musik viele interne Prozesse angeregt und genutzt werden können. Kreatives Gestalten beinhaltet solch wichtige Prozesse, ist in vielen Lebenssituationen von entscheidender Bedeutung und kann besonders im Musikunterricht in unzähligen Formen beobachtet werden. Die aktive Förderung von Kreativität kann durch Improvisationsübungen erfolgen, wenn diese adäquat strukturiert und geplant sind. Zu diesem Zweck wurde als Grundlage auf wissenschaftliche Erkenntnisse der Neurowissenschaften und Musikpsychologie eingegangen. Zu bemerken ist, dass die Resultate der Forschung im Allgemeinen noch keine einheitlichen Aufschlüsse über genaue neuronale Verarbeitungsmechanismen gebracht haben. Obwohl es in der Tat gewisse Annahmen gibt, die durch verschiedene Studien belegt werden können, ist die Aufnahme, Verarbeitung und Erzeugung von Musik noch nicht vollkommen erklärbar. In Hinblick auf improvisatorisches Gestalten konnten dennoch beeinflussbare Faktoren festgestellt werden. Es hat sich gezeigt, dass die Möglichkeit besteht, Voraussetzungen dafür zu schaffen. Die „Erzeugung“ von kreativen Ideen oder Motivation durch äußerliche Faktoren soll allerdings nicht möglich sein. Die wichtigste Erkenntnis, die sich aus der Zusammenfassung ableiten ließe, ist der Einfluss der Emotionen auf den Lernerfolg. Das limbische System, welches für die Erzeugung von emotionalen Reaktionen verantwortlich ist, lenkt schon zu Beginn die Reizaufnahme und deren Auswahl. Anhand dieser werden Stimuli aufgenommen, verarbeitet und werden, wenn sie mehrere Prozesse durchlaufen haben, als Erfahrungen gespeichert. Auf diese kann wiederum am besten durch das Hervorrufen der gekoppelten Emotionen zugegriffen werden. In Hinblick auf den Musikunterricht bedeutet das, dass als negativ empfundene Erfahrungen, welche auch unbewusst im Laufe der Unterrichtseinheit hervorgerufen werden, eine hemmende Wirkung auf das improvisatorische Gestalten ausüben können. Kurz gesagt, beeinflussen Emotionen sowohl die Aufnahme von Reizen als auch deren Speicherung. Jede kann nur an ihre eigenen an Emotionen gekoppelten Erfahrungen anknüpfen. Deshalb sollte im Allgemeinen auf die Erzeugung eines guten Klassenklimas als Grundlage für jeden Lehr- und Lernprozess Rücksicht genommen werden. 105 Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Vermittlung von Freude an der Musik bedeutend durch improvisatorisches Gestalten gefördert werden kann. Schülerinnen können sich selbst musikalisch betätigen und in einer kreativen und spielerischen Weise neue Inhalte erlernen. Die Vielfältigkeit der Improvisation erlaubt es, diese mit Lernenden aller Altersstufen zu verwenden und an jede neue Situation und bestehenden Vorerfahrungen anzuknüpfen. Unbewusst wird das Spielen und Reagieren in einer Gruppe geübt, genauso wie unzählige musikalische Parameter (Dynamik, Rhythmus, Melodie, Mehrstimmigkeit, etc.) integriert werden können. Da Kreativität nicht nur in musikalischer Hinsicht wichtig ist, kann improvisatorisches Gestalten auch zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen: Denn es wird nicht nur ein Gefühl des Vertrauens zu anderen, sondern auch gleichzeitig zu sich selbst und in die eigenen Kompetenzen gefördert. Die Tatsache, dass neuronale Verarbeitungsstrukturen für musikalische Reize noch nicht ins Detail erforscht werden konnten, sollte die Grundeinstellung für das Planen eines Unterrichts widerspiegeln: Genauso wie bei improvisatorischen Prozessen sind dabei immer noch Vorgänge beteiligt, die nicht zu definieren und entschlüsseln sind. Die bestehenden Erkenntnisse sollten zwar in die Vorbereitung miteinbezogen werden, aber noch genügend Platz für Unvorhergesehenes lassen. Spontanes Reagieren auf die Situation im schulischen Raum ist von gleich wichtiger Bedeutung wie das Strukturieren einer Lernumgebung. Es kann angenommen werden, dass die Lehrperson beim improvisatorischen Gestalten genauso viel lernen kann wie die Schülerinnen. 106 Literaturverzeichnis Aebli, Hans: Denken. Das Ordnen des Tuns. Bd. 2: Denkprozesse. Stuttgart: Klett-Cotta 1981. Altenmüller, Eckart: Hirnelektrische Korrelate der cerebralen Musikverarbeitung beim Menschen. In: European Archives of Psychiatry and Neurological Sciences 235 (1986), S. 342-354. Altenmüller, Eckart: Hirnphysiologische Grundlagen des Übens. In: Mahler, Ulrich (Hg.): Handbuch Üben. Grundlagen, Konzepte, Methoden. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 2006, S. 48-58. Altenmüller, Eckart: Musikwahrnehmung und Amusien. In: Karanth, Hans-Otto / Thier Peter (Hg.): Kognitive Neurowissenschaften. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag3 2012, S. 529-536. Asen, Karin: Konzentration und Entspannung. In: Deutscher-Manager Verband (Hg.): Handbuch Soft Skills. Psychologische Kompetenz. Zürich, Singen: vdf Hochschulverlag AG 2004, S. 75-151. Aumüller, Gerhard / Aust, Gabriele / Engele, Jürgen et al.: Anatomie (Duale Reihe). Stuttgart: Thieme3 2014, S. 194-220. Behrends, Jan / Bischofberger, Josef / Deutzmann, Rainer et al.: Physiologie (Duale Reihe). Stuttgart: Thieme2 2012, S. 755-759. Birbaumer, Niels / Schmidt, Robert Franz: Biologische Psychologie. Heidelberg: Springer Medizin Verlag6 2006. Blamemore, Sarah-Jane/ Firth, Uta: Wie wir lernen. Was die Hirnforschung darüber weiß. München: Deutsche Verlags-Anstalt 2006. Brach, Sandra: Analyse der Wahrnehmung von Markenarchitekturen in der Kostümgüterbranche. Hamburg: Diplomica GmbH 2004. Brandstätter, Ursula: Bildende Kunst im Dialog. Ästhetische, zeichentheoretische und wahrnehmungspsychologische Überlegungen zu einem kunstspartenübergreifenden Konzept ästhetischer Bildung. Augsburg: Wißner 2004. Braus, Dieter: Ein Blick ins Gehirn. Moderne Bildgebung in der Psychiatrie. Stuttgart: Thieme 2004. Dauner, Ruth / Münzel, Karin: Prävention aus neurobiologischer Sicht. In: Grohnfeldt, Manfred (Hg.): Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Bd. 3: Diagnostik, Prävention und Evaluation. Stuttgart: Kohlhammer2 2009, S. 93102. 107 de la Motte-Haber, Helga: Modelle der musikalischen Wahrnehmung. Psychophysik Gestalt – Invarianten – Mustererkennen – Neuronale Netzwerke Sprachmetapher. In: de la Motte-Haber, Helga / Rötter, Günther (Hg.): Musikpsychologie. (Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Band. 3). Laaber: Laaber-Verlag 2005, 55-73. Deutsch, Diana: The Processing of Structured and Unstructured Tonal Sequences. In: Perception & Psychophysics 28 (1980), S. 381-389. Eckhardt, Rainer: Improvisation in der Musikdidaktik. Eine historiographische und systematische Untersuchung. (Forum Musikpädagogik 16). Augsburg: Wißner 1995. Engel, Andreas: Prinzipien der Wahrnehmung. Das visuelle System. In: Roth, Gerhard / Prinz, Wolfgang (Hg.): Kopfarbeit. Gehirnfunktion und kognitive Leistungen. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag 1996. Erk, Susanne / Kiefer, Markus, et al.: Emotional context modulates subsequent memory effect. In: Neuroimage 18/2 (2003), S. 439–447. Faller, Adolf / Schünke, Gabriele: Der Körper des Menschen. Einführung in Bau und Funktion. Stuttgart: Thieme16 2012. Förstl, Hans / Hautzinger, Martin / Roth, Gerhard: Neurobiologie Psychischer Störungen. Heidelberg: Springer Medizin Verlag 2006. Gagel, Reinhard: Improvisation als soziale Kunst. Überlegungen zum künstlerischen und didaktischen Umgang mit improvisatorischer Kreativität. Mainz: Schott Music 2010. Goldenberg, Georg: Neuropsychologie. Grundlagen, Klinik, Rehabilitation. München: Elsevier GmbH4 2007. Gruhn, Wilfried: Der Musikverstand. Neurobiologische Grundlagen des musikalischen Denkens, Hörens und Lernens. Hildesheim: Georg Olms Verlag 2005. Harnischmacher, Christian: Subjektorientierte Musikerziehung. Eine Theorie des Lernens und Lehrens von Musik. (Forum Musikpädagogik 86). Augsburg: Wißner 2008. Hattie, John: Visible Learning. A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Routledge: Taylor & Francis Group 2009. Hechinger, Martina: Das musikalische Flow-Erlebnis. Eine Forschungsstudie über Flow, Motivation und Selbstwirksamkeit im Instrumentalspiel. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller 2010. Holm-Hadulla, Rainer: Kreativität zwischen Schöpfung und Zerstörung. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht GmbH & Co.KG 2011. 108 Jäncke, Lutz: Macht Musik schlau. Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie. Bern: Verlag Hans Huber 2009. Kielholz, Annette: Online-Kommunikation. Die Psychologie der neuen Medien für die Berufspraxis. Heidelberg: Springer Medizin Verlag 2008. Koelsch, Stefan / Schröger, Erwin (Hg.): Affektive und Kognitive Neurowissenschaft. Göttingen: Hogrefe Verlag 2013. Kurt, Ronald: Improvisation als Grundbegriff. Gegenstand und Methode der Soziologie. In: Göttlich, Udo / Kurt, Ronald (Hg.): Kreativität und Improvisation. Soziologische Positionen. Wiesbaden: Springer Fachmedien 2012, S. 165-187. Lange, Elke: Musikpsychologische Forschung im Kontext allgemeinpsychologischer Gedächtnismodelle. In: Motte-Haber, Helga de la / Rötter, Günther (Hg.): Musikpsychologie. Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft. Band 3. Laaber: Laaber-Verlag 2005, S.74-100. Lämmle, Lena: Motivation und Selbstregulation im (Hoch-) Leistungssport. In: Dresel, Markus / Lämmle, Lena (Hg.): Motivation, Selbstregulation und Leistungsexzellenz. Münster: Lit Verlag Dr W. Hopf 2011, S. 91-113. Linke, Detlef B.: Die Freiheit und das Gehirn. Eine neurophilosophische Ethik. München: C.H. Beck 2005. Lucius, Runhild / Schwegler, Johann: Der Mensch. Anatomie und Physiologie. Stuttgart: Thieme5 2011. Mulder, Theo: Das adaptive Gehirn. Über Bewegung, Bewusstsein und Verhalten. Stuttgart: Thieme 2007. Neisser, Ulrich: Kognition und Wirklichkeit. Prinzipien und Implikationen der kognitiven Psychologie. Stuttgart: Klett-Cotta 1979. Petrat, Nicolai: Glückliche Schüler musizieren besser. Neurodidaktische Perspektiven und Wege zum effektiven Musikmachen (Forum Musikpädagogik 121). Augsburg: Wißner2014. Piaget, Jean: Das Erwachen der Intelligenz. Stuttgart: Klett 1969 (1936). Pritzel, Monika / Brand, Matthias / Markowitsch, Hans: Gehirn und Verhalten. Ein Grundkurs der physiologischen Psychologie. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag 2009. Reichert, Heinrich: Neurobiologie. Stuttgart, New York: Thieme2 2000. Révész, Geza: Einführung in die Musikpsychologie. Bern: Francke2 1972. Ribke, Juliane: Musikalität als Variable von Intelligenz, Denken und Erleben. Hamburg: Verlagder Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner 1979. 109 Ricken, Michael: Objektorientierte Systemgestaltung. Ein kommunikationsbasierter Ansatz zwischen Kognition und Konstruktion. Wiesbaden: Deutscher Universitäts- Verlag GmbH: 2002. Roth, Gerhart: Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt. Stuttgart: Klett Cotta 2011. Salzman, Ralph: Multimodale Erlebnisvermittlung am Point of Sale. Eine verhaltenswissenschaftliche Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Wirkungenvon Musik und Duft. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 2007. Schiepek, Günter: Neurobiologie der Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer GmbH 2003. Schlag, Bernhard: Lern- und Leistungsmotivation. Wiesbaden: Springer2 2006. Schneider, Frank / Niebling, Wilhelm: Psychische Erkrankungen in der Hausarztpraxis. Heidelberg: Springer Medizin Verlag 2008. Schwabe, Matthias: Musik spielend erfinden. Improvisieren in der Gruppe für Anfänger und Fortgeschrittene. Kassel: Bärenreiter 1992. Soth, Johannes: Lernfeld Persönlichkeit. Körperorientierte Entspannungs- und Konzentrations-Schulung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG 2014. Spitzer, Manfred: Musik im Kopf. Stuttgart: Schattauer 2002. Spitzer, Manfred: Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag GmbH 2003. Spornitz, Udo: Anatomie und Physiologie. Lehrbuch und Atlas für Pflege- und Gesundheitsfachberufe. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag 2002. Steiner-Welz, Sonja: Die wichtigsten Körperfunktionen der Menschen. Mannheim: Reinhard Welz Vermittler Verlag 2005. Stiefel, Eberhard: Kreativität und Musikpädagogik. Kastellaun: Aloys Henn Verlag 1976. Tücke, Manfred: Grundlagen der Psychologie für (zukünftige) Lehrer. Münster: Lit Verlag Münster 2003. Wanker, Gerhard / Gritsch, Bernhard / Schausberger, Maria: Club Musik 1. Arbeitsbuch für die 1. Klasse Hauptschule und AHS-Unterstufe. Rum/Innsbruck: Helbling 2009. Zimbardo, Philip: Psychologie. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag4 1983. 110 Onlineressourcen Lexikon der Neurowissenschaft. Cochleariskern. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag 2000. http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/cochleariskern/2288 (26.04.2015). Anatomie der Universität Tübingen. http://www.anatomie.unituebingen.de/project/projII/Neuroassistant/nuclei_deu/text/ncl_cochlearis_txt.htm (26.04.2015). Schäfers, Andrea: Gehirn und Lernen. http://www.gehirnlernen.de/gehirn/dasgro%C3%9Fhirn/die-gro%C3%9Fhirnrinde-neo-oder-isocortex/ (26.04.2015). http://www.wissen.de/wortherkunft/improvisieren (21.05.2015). 111 ANHANG G 112