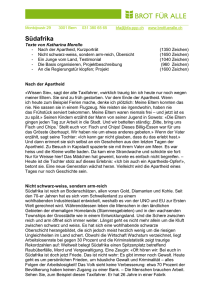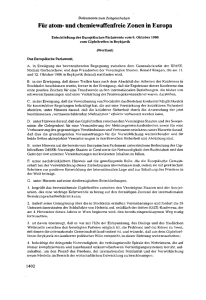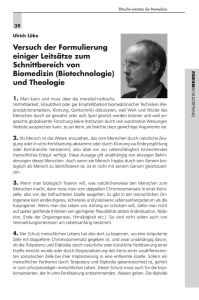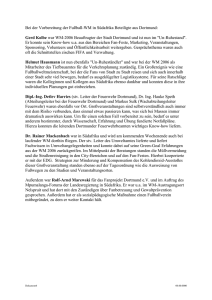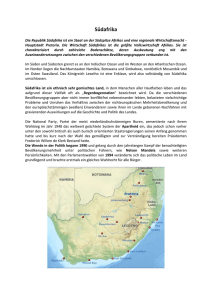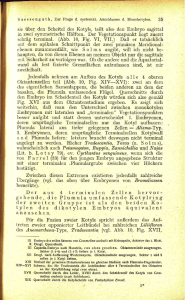Gef BroschŁre - Gesellschaft für ethische Fragen
Werbung

GEF Gesellschaft für ethische Fragen Nr. 44 Dezember 2003 Arbeitsblatt 2003 Herausgeberin: Gesellschaft für ethische Fragen Medien und Politik Eine Wechselbeziehung mit neuen Regeln? von Esther Kamber u. a. Wo ist der Rubikon? Ethische Fragen zur Nutzung von Embryonen von Stephan Wehowsky Die Unsicherheit wächst Was sollen wir tun? Ethik oder Ästhetik? Divergente Zugänge zu Fragen der Moral von Ursula Renz Die Schweiz und die Apartheid Kann man nachträglich Gerechtigkeit herstellen? von Peter Hug, Mascha Madörin und Maya Doetzkies Nachträgliche Gerechtigkeit Welche Wege führen zu einem fairen Ausgleich? von Vera Rottenberg Liatowitsch, Wolfgang Lienemann und Andreas Loebell Der Embryo Mensch oder menschliches Leben? von Prof. Johannes Fischer Inhalt Editorial 1. 3 Medien und Politik – eine Wechselbeziehung mit neuen Regeln? (GEF-Zyklus April bis Juni 2001) 1.a. Zerstört die Privatisierung, Personalisierung und Skandalisierung der Politik die demokratische Öffentlichkeit? von Esther Kamber, mit Ergänzungen aus dem Referat von Prof. Otfried Jarren (Problemaufriss aus den Diskussionsrunden vom 4. April, 2. und 16. Mai 2001) 1.b. Medien und Politik. Eine Wechselbeziehung mit neuen Regeln? Podiumsdiskussion mit Andreas Durisch, Chefredaktor SonntagsZeitung; Kurt Imhof, Soziologie / Publizist; Markus Notter, Regierungsrat Kanton Zürich; Andreas Iten, alt Ständerat; Iwan Rickenbacher, Kommunikationsberater und Erwin Koller, Moderator (Podiumsgespräch vom 30. Juni 2001) 14 2. Wo ist der Rubikon? Ethische Fragen zur Nutzung von Embryonen von Dr. Stephan Wehowsky (GEF-Referat an der Mitgliederversammlung vom 1. Juni 2001) 16 3. Die Unsicherheit wächst – was sollen wir tun? (GEF-Diskussion vom 8. Dezember 2001) 26 4. Ethik oder Ästhetik? Divergente Zugänge zu Fragen der Moral von Ursula Renz (GEF-Referat an der Mitgliederversammlung vom 6. Mai 2002) 27 5. Nachträgliche Gerechtigkeit – Die Schweiz und die Apartheid Kann man nachträglich Gerechtigkeit herstellen? (GEF-Club vom 25. Januar 2003) 5.a. Schweiz – Südafrika: Fakten, Mentalitäten, Entscheidungsstrukturen, Altlasten von Dr. Peter Hug, Historisches Institut der Universität Bern 5.b. Schuldenstreichung und Reparationen Eine völkerrechtliche Aktualisierung alter Forderungen von Mascha Madörin 5.c. Fazit über offene Fragen und Konsequenzen von Maya Doetzkies 6. 7. Nachträgliche Gerechtigkeit: Welche Wege führen zu einem fairen Ausgleich? Einleitung und Diskussionspunkte von Erwin Koller, Moderator des Clubs (GEF-Club vom 5. Juli 2003) 6.a. Die Logik der Justiz und die Forderung nach Gerechtigkeit: Eignet sich ein Gerichtsverfahren als Beitrag zur Gerechtigkeit? von Dr. Vera Rottenberg Liatowitsch 6.b. Schuld und Versöhnung im Kontext der südafrikanischen Wahrheitskommission Schuldzurechnung in differenzierten Perspektiven von Prof. Dr. Wolfgang Lienemann 6.c. Was kann Entwicklungszusammenarbeit zwischen der Schweiz und Südafrika zur Konfliktbewältigung beitragen? von Andreas Loebell 6.d. Stichworte zur innerafrikanischen Kontroverse zwischen Desmond Tutu und Woole Soyinka zusammengestellt von Erwin Koller, Moderator der Clubs Der Embryo – Mensch oder menschliches Leben? von Prof. Johannes Fischer (GEF-Referat an der Mitgliederversammlung vom 14. Mai 2003) 2 4 5 34 36 39 47 49 51 53 65 69 71 Editorial Das letzte Arbeitsblatt ist Ende 2000 erschienen. Inzwischen hat sich unsere Gesellschaft bei verschiedenen Anlässen mit ethischen Fragestellungen auseinandergesetzt. Ein erstes Konzept, das wir im Jahr 2001 erprobt hatten, bestand aus einem Diskussionszyklus zum Thema „Medien und Politik. Eine Wechselbeziehung mit neuen Regeln?“ von April bis Juni 2001 sowie aus einer Diskussionsveranstaltung „Die Unsicherheit wächst – was sollen wir tun?“, die nach den Ereignissen im September und Oktober 2001 aus aktuellem Anlass am 8. Dezember 2001 stattfand. Sie finden über beide Anlässe die wichtigsten Diskussionsbeiträge in diesem Arbeitsblatt. Leider entsprach das Echo unserer Mitglieder wie der Öffentlichkeit nicht ganz unseren Erwartungen. Der Vorstand der GEF diskutierte deshalb an zwei Klausurtagungen im Frühling und Sommer 2002 Formen und mögliche Inhalte unserer künftigen Aktivitäten. Unsere Gesellschaft setzt sich zum Ziel, grundlegende Probleme der Gegenwart ethisch fundiert zur Diskussion zu stellen. Folgende Leitsätze prägen unsere Arbeit: - Die GEF will eine reflektierte Auseinandersetzung über ethische Themen führen, ohne damit wissenschaftliche Ansprüche zu stellen. - Die GEF greift aktuelle Themen auf und will dabei die grundlegenden ethischen Fragestellungen herausschälen. - Die GEF bekennt sich zum ethischen Diskurs, will aber keine moralischen Botschaften verkünden. Gestützt auf diese Leitsätze entwickelten wir das Konzept für einen GEF-Club. Zwei dieser GEF-Clubs fanden zum Thema „Nachträgliche Gerechtigkeit“ am Beispiel Schweiz – Südafrika Ende Januar 2003 und anfangs Juli 2003 mit schöner und intensiver Beteiligung von Mitgliedern und Eingeladenen statt. Wir freuen uns, dass sich dieses neue Konzept bewährt. Sie finden in diesem Arbeitsblatt die Einleitungsreferate zu den beiden GEF-Clubs und Auszüge aus den Diskussionen. Ebenfalls finden Sie die Referate an den Mitgliederversammlungen der Jahre 2001, 2002 und 2003. Die nächsten GEF-Clubs werden am 21. Februar 2004 und am 4. September 2004 stattfinden zum Thema „Die Öffentlichkeit als ethischer Faktor“. Die Fragestellung im Februar lautet: „Welche Auswirkungen hat die Öffentlichkeit auf ethische Fortschritte in der Unternehmenspolitik?“, diejenige im September: „Inwiefern können ethische Standards der Industrieländer auf Entwicklungsländer übertragen werden?“ Geplant ist, künftig jedes Jahr ein Arbeitsblatt mit Referaten und Diskussionsbeiträgen der Club-Veranstaltungen und der GEF-Mitgliederversammlung zu publizieren. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an ethischen Fragen und hoffe, dass die GEF weiterhin einen Beitrag dazu leisten kann. Ich freue mich über Ihre Unterstützung. Baar, im Dezember 2003 Hanspeter Uster, Präsident 3 1. Medien und Politik – eine Wechselbeziehung mit neuen Regeln? (GEF-Zyklus April bis Juni 2001) Dieser GEF-Zyklus – als erstes neues Diskussionsformat des erneuerten GEFVorstandes und seines neuen Präsidenten – bestand aus drei Diskussionsrunden, in denen nach Einführungsreferaten nachgefragt und diskutiert wurde, und aus einer Podiumsveranstaltung, an der RepräsentantInnen aus Politik und Medien sowie ExpertInnen zu den in den vorherigen Veranstaltungen vorbereiteten Fragen und Problemen Stellung bezogen. In den ersten drei Diskussionsrunden ging es darum Veränderungen in der öffentlichpolitischen Kommunikation zu beschreiben, daraus erwachsende Probleme aufzuzeigen und ethische Fragen zu benennen. Ausgangspunkt war das Faktum, dass sich das moderne Mediensystem von der Politik entkoppelt hat und verstärkt nach ökonomischen Kriterien funktioniert. Die Politik ihrerseits ist aber nach wir vor auf massenmediale Öffentlichkeit angewiesen. Unter diesen Bedingungen stellt sich die Frage nach der Wechselbeziehung zwischen Medien und Politik und ihren Regeln bzw. den wünschenswerten und schliesslich auch durchsetzbaren Prinzipien in vielfältiger Weise. Die drei Diskussionsrunden zeigten, dass der Problemaufriss zur Wechselbeziehung von Medien und Politik viele Fragen aufwarf und die Auseinandersetzung und Klärung von ethischen Fragen in diesem komplexen Feld erst in den Anfängen stecken. In den drei teilweise unterschiedlich zusammengesetzten, aber immer rege zu Kenntnis nehmenden und diskussionsfreudigen Runden gab es Konsens hinsichtlich allgemeiner Forderungen. Deren Zuspitzung, Konkretisierung und 'machbare' Umsetzung blieb aber meist offen. Erstens wurde bezüglich der Medien eine Konzentration bzw. Mono- oder Oligopolisierung abgelehnt und gleichzeitig der Meinungsvielfalt in der Öffentlichkeit ein hoher Stellenwert zugemessen. Denn – so das Argument – nur sie ermöglicht insbesondere in einer direktdemokratischen, pluralen, multikulturellen und -lingualen Gesellschaft wie der Schweiz die Problemwahrnehmung, die politische Problemlösung und damit die fortwährende soziale Integration. Mit dem demokratietheoretischen Anspruch auf Meinungsvielfalt wurde auf der Seite der Medien die Frage nach publizistischer Qualität verbunden. Die Meinungen, was Qualität sei und hiesse, waren im Zyklus vielfältig und gingen auseinander. Dass es allerdings hinsichtlich der Politik und der gesamten Gesellschaft Qualitätsstandards braucht – nicht nur bezüglich des Medieninhaltes, sondern auch hinsichtlich des medialen Umgangs mit der sozialen Welt und vor allem mit den Individuen als Leser, als Leserbriefschreiber, als Medienobjekt etc. – , war nicht umstritten. Über solche Standards hinaus stellte sich allgemein die Frage, inwiefern und inwieweit Medien als freiheitliches Gut der Moderne im Dienste der ihre Freiheit und Rechte garantierenden Gesellschaft stehen. Auch hier gingen die Vorstellungen über Pflichten und Rechte auseinander. Vor allem aber wurde die Frage gestellt, welche Institutionen, Organisationen und zivilgesellschaftlichen Akteure die Pflichten der Medien definieren und Pflichterfüllung anmahnen und sanktionieren sollen und können. Denn – so der Konsens – ein sanktionierendes Gremium muss machtvoll sein, will es die Medien kontrollieren und 4 gleichzeitig die Einflussnahme von Interessengruppen zu ihren Gunsten verhindern. Daher wurde der Unabhängigkeit der Medien als wichtiges freiheitliches Gut auch hohe Bedeutung zugemessen und die Übernahme von Medien durch branchenfremde Unternehmen bzw. deren Beteiligung an den Medien mit Skepsis betrachtet. An die Politik wurde zweitens die allgemeine Forderung gestellt, einen reflektierten, professionellen und kompetenten Umgang mit den Medien zu entwickeln. Medien können – so das Argument – im politischen System vor allem dann hohe Wirkung erzielen, wenn die Spielregeln in der Politik selber bzw. im Austauschverhältnis mit den Medien unklar bzw. unterschiedlich sind. Gerade wegen des – zwar oft medientauglichen – inszenierenden und skandalisierenden Umgangs von Oppositions- bzw. Bewegungsparteien (SVP) mit dem Medien wurde allerdings zu bedenken gegeben, dass eine 'geregelte' Beziehung seitens der Politik oft schwer falle. 1.a. Zerstört die Privatisierung, Personalisierung und Skandalisierung der Politik die demokratische Öffentlichkeit? von Esther Kamber, mit Ergänzungen aus dem Referat von Prof. Otfried Jarren (Problemaufriss aus den Diskussionsrunden vom 4. April, 2. und 16. Mai 2001) In diesem Betrag wird der Inhalt der Referate von Esther Kamber vom 4. April und vom 16. Mai 01 wiedergegeben, teilweise ergänzt mit Ausführungen von Prof. Otfried Jarren vom 2. Mai 01. In diesen Vorträgen wurden anhand von sozialwissenschaftlichen Beobachtungen problematische Konstellationen im schwierigen Verhältnis von Medien und Politik aufgezeigt. Der Blick sollte damit auf Veränderungen in der öffentlichen Kommunikation gelenkt und die Frage gestellt werden, welche Folgen dieser Strukturwandel der Öffentlichkeit für moderne Demokratien hat. Mit einer solchen Skizzierung von beobachtbaren Wandlungsprozessen werden Problemfelder in der Wechselbeziehung von Medien und Politik benannt. Allerdings beginnt die ethische Diskussion erst auf der Grundlage einer solchen Problembeschreibung. Mit anderen Worten: Das Angebot dieses Beitrages ist Reflexions- und Orientierungswissen, nicht aber eine ethische Auseinandersetzung. Dabei werden erstens der jüngste Strukturwandel der Öffentlichkeit am Beispiel der Schweiz aufgezeigt und einige seiner Phänomene – Privatisierung, Personalisierung und Skandalisierung – erläutert. Zweitens wird darauf eingegangen, wie die Politik auf diese Veränderungen reagiert und inwieweit sich die Resonanzchancen für politische Akteure in den Medien gewandelt haben. Und schliesslich werden drittens beide Seiten ins Blickfeld genommen, um an ethische Fragen im Wechselverhältnis von Medien und Politik heranzuführen. 5 1. Veränderungen in der öffentlich-politischen Kommunikation – Strukturwandel der Öffentlichkeit Der moderne demokratische Staat setzt Öffentlichkeit als verfassungsprägendes Prinzip, als Bedingung demokratischer Entscheidungsfindung und als normative Anforderung für die Kontrolle von Macht voraus. Nur dank der Öffentlichkeit ist jener bereits von Kant erstrebte Modus bürgerlicher Freiheit denkbar, in dem sich die Staatsbürger den von ihnen gemachten Gesetzen unterwerfen. Obwohl diese – aus der Aufklärungsphilosophie stammende – Verknüpfung von Staat, Nation und Öffentlichkeit immer noch Geltung hat, haben sich die Rahmenbedingungen dieser Verschränkung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark verändert. Waren Medien bis in die 60er Jahre mit den politischen Parteien (Presse) oder mit dem Staat (öffentlich-rechtlicher Rundfunk) eng verzahnt, sind sie heute eigenständig und funktionieren zunehmend nach ökonomischen Kriterien. Und eben diese Loslösung der Medien von der Politik zeitigt Konsequenzen. Mit der Entkoppelung der Medien von der Politik haben vorerst insbesondere auf Seiten des ausdifferenzierten Mediensystems neue Regeln Einzug gehalten. Die zu erreichenden Leser, Hörer und Seher zählen nicht länger zu einem Staatsbürgerpublikum, das durch die Presse in seinen politischen Lagern erreicht und durch den Integrationsrundfunk als Staatsbürger angesprochen wird, sondern sie gliedern sich in Zielgruppen. Das hat unmittelbar zwei Folgen: Zum einen entgrenzt sich der medial erschlossene Raum vom politischen Geltungsraum: Die Verschränkung von Staat bzw. Gemeinwesen und Öffentlichkeit löst sich auf. Zum anderen werden dafür Medieninhalte und der Werbemarkt über ihre Publikumsausrichtung indirekt gekoppelt, auch wenn nach wie vor ein ethischer Anspruch auf die Trennung des redaktionellen vom Werbeteil besteht. Mit anderen Worten: Insbesondere Printprodukte als zentrale Träger der öffentlich-politischen Kommunikation müssen am Markt bestehen. Aber auch Sendungen des Radios und Fernsehens unterliegen der Zielgruppenresonanz. Deshalb kommen moderne Massenmedien bis hin zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen generell nicht umhin, sich kommerziellen Kriterien zu beugen. Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird nicht nur, aber auch nach den Einschaltquoten bewertet. Durch diese Zielgruppenorientierung nach kommerziellen Kriterien hat sich die Selektion, Interpretation und Präsentation von Themen der General-Interest-Medien (Tageszeitungen, Wochenpresse, Fernsehvollprogramme) verändert. An diese Medien wird zwar der Anspruch gestellt, soziale Integration zu gewährleisten. Längst sehen sie sich aber mit dem Anspruch konfrontiert, Zielpublika zu bedienen, und längst fokussieren sie nicht mehr nur Themen aus Politik, Wirtschaft und der höheren Feuilleton-Kultur. Neben Sport und der Unterhaltung ist am eindrücklichsten der Siegeszug von Human InterestThemen, welche vom Sex über Verbrechen bis zur Prominenz alles umfasst, was Publikumsresonanz findet. Aber nicht nur der Inhalt, sondern auch die Präsentation und Interpretation hat sich verändert. ‚Eine Nachricht wert’ sind Ereignisse, die besonders spektakulär, skandal- und konfliktträchtig sind, persönliche Betroffenheit zeigen oder auslösen, einzelne Personen in den Mittelpunkt stellen oder mit Erotik aufgeladen sind. Diese neuen Inhalte und Präsentationsformen sind nicht bei allen Formaten der General-Interest-Medien gleich ausgeprägt. Aber durch die Geschäftspresse, das Aufkommen 6 der Boulevardformate und die Entstehung des privaten Rundfunks befördert, haben sich die Aufmerksamkeitsstrukturen der Massenmedien insgesamt erweitert und gewandelt, neue Selektions-, Interpretations-, Präsentationslogiken etablieren sich. Für die öffentlich-politische Kommunikation der deutsch-schweizerischen Medienarena ist im Zuge dieser Veränderungen eine Privatisierung, Personalisierung und Skandalisierung der Politikdarstellung zu konstatieren. Diese Phänomene möchte ich im Folgenden näher erläutern. Öffentlichkeit setzt sich im Aufklärungsideal Kants klar von der Privatheit ab. "Mündige Bürger" treten in dieser Vorstellung aus ihrer Privatheit heraus, um in der "bürgerlichen Öffentlichkeit" ein "herrschaftsempanzipiertes Raisonnement" zu führen und sich selbst auf der Basis von Vernunftskriterien "aufzuklären". Ein Öffentlichkeitsideal, das Privates wie später Intimes und die Wirtschaft entöffentlichte, konnte in der Praxis nicht bestehen. Insbesondere der Kultur- und Nationalitätenkampf zerstörte die aufklärerische Öffentlichkeitsutopie, und über die soziale Frage bzw. den Klassenkampf kam es zu einer Politisierung der sozialen, schichtspezifischen und damit auch privaten wie (privat)wirtschaftlichen Verhältnisse. In diesem politischen Kampf wurde die anfänglich sehr eingeschränkte Veröffentlichung von Privatem in der Gerichtsberichterstattung und in postumen Würdigungen durch eine neue Form erweitert. Die Arbeiterpresse veröffentlichte das Private in Form von Sozialreportagen, um mit Alltagsbeispielen soziale und wirtschaftliche Zustände politische anzuprangern. Aber erst mit der Boulevardpresse und der 68er Bewegung beschleunigten sich die Privatisierung der Öffentlichkeit und die Veröffentlichung des Privaten in Form des Intimen und Lebensalltäglichen. Vom Boulevard und dem privaten Rundfunk angetrieben stehen politische Themen in Konkurrenz zu unpolitischen (Human Interest, Sex & Crime, Sport). Zudem wird der politische Inhalt der massenmedial dominierten Öffentlichkeit mit persönlichen bzw. privaten 'Einsichten' in das Leben des politischen Personals oder der von politischen Situationen bzw. Problemen Betroffenen angereichert. Abstrakte und komplexe politische Fragen werden so absatzträchtig, unterhaltend und lebensnah aufbereitet – Stichwort: Infotainment. Andererseits sorgte die 68er Bewegung für eine Politisierung des Privaten in Form der Veröffentlichung von Intimem und insbesondere der Geschlechterfrage. Die Deregulierung des Rundfunks in den 80er Jahren verstärkte dann den ohnehin ausgeprägten Unterhaltungscharakter dieser szenischen Medien und trug entscheidend zur Privatisierung der Politikdarstellung bei. Politiker werden in Homestories als Privatpersonen erlebbar, weshalb die Selbstdarstellung der Person zum entscheidenden Faktor für die Politikerrolle wird. Diese Personalisierung der Politik kann als Komplexitätsreduktion beschrieben werden. Die im demokratischen Prozess argumentativ ausgehandelten Gruppenpositionen erscheinen dabei medial als Botschaft prominenter Exponenten und die politischen Auseinandersetzungen werden als Zweikampf inszeniert. Diese Bindung der schwer vermittelbaren kognitiven Argumentationen mit affektiven, an Personen gebundenen Positionen macht die Politik fernseh- und boulevardtauglich. Die föderale und kulturell vielfältige Struktur der Schweiz und ihre auf Konsens ausgerichteten demokratischen Problemlösungsverfahren allerdings brachte eine politische Kultur hervor, die sich stark auf Inte7 ressengruppen abstützte und gerade nicht politische Führerfiguren bevorzugte. In der traditionell Charisma-feindlichen Schweiz befördern damit die modernen Massenmedien die Kreation von politischer Prominenz und von Führerfiguren. Und gerade diese politischen 'Medienstars' wecken wieder das mediale Interesse für ihr Privatleben. In dieser Darstellung des politischen Personals durch die Medien steigt das Risiko der Skandalisierung. Gerade weil Privates veröffentlich wird und der Politiker persönlich für die politischen Positionen steht, werden bei einer Skandalisierung nicht nur die Leistung in seiner Rolle als Politiker, sondern auch persönliche Aspekte bewertet. Nicht mehr nur politisches, sondern jedes moralisierbare Fehlverhalten, auch im Privaten, kann deshalb Ausgangspunkt eines Skandals in den Medien werden. Insgesamt zeigen diachrone Analysen von Skandalisierungen, dass eine Intensivierung der Machtkontrolle durch die Medien stattgefunden hat, weil alles skandalisier- und moralisierbar wird. Mehr noch: Die Aufdeckung von moralischem Fehlverhalten ist eine wichtige Leistung der Medien in ihrem Kampf um Aufmerksamkeit und um das Überleben im harten Konkurrenzmarkt. Wenn sie nämlich mit Skandalisierung Resonanz erhalten, werden sie in der Medienarena zum Agendasetter, geniessen dann als Medium selber Resonanz und erzeugen damit besonders hohe Publikumsbeachtung und Werbeattraktivität. Gleichzeitig kann diese Tendenz zur Enthüllung legitimiert werden durch die Kontrollfunktionen, die den Medien bzw. der kritischen Öffentlichkeit in der Demokratie zugeschrieben werden. Wie reagiert nun die Politik auf diese Veränderung im ausdifferenzierten Mediensystem? 2. Die Anpassung der Politik an das ausdifferenzierte Mediensystem Die Chancen, massenmediale Resonanz zu erhalten, verändern sich im Strukturwandel der Öffentlichkeit insofern, als etablierte wie nicht-etablierte politische Akteure nun den gleichen Selektionskriterien ausgesetzt sind, nachdem die Parteien ihren direkten Zugang zu Presseöffentlichkeit verloren haben. Nicht-etablierte soziale Bewegungen und Protestparteien treffen dabei auf ein Mediensystem, welches ihren spektakulären und unkonventionellen politischen Aktionen (Demonstration, Streik, Blockade) privilegiert Resonanz verschaffen. Dadurch waren die nicht-etablierten Akteure vorerst auf die neuen Inputbedingungen der Massenmedien bedeutend besser vorbereitet als die etablierten politischen Akteure. Aber auch Etablierte halten sich inzwischen an die Inputbedingungen der Medien und betreiben ein gezieltes politisches Marketing, das mit Provokationen und Konfliktinszenierungen arbeitet. Politisches Marketing bedeutet vorerst, die massenmedialen Resonanzchancen zu optimieren. So versprechen der gezielte Einsatz von prominenten Exponenten, Provokationen und Konfliktinszenierungen die Durchsetzung der favorisierten politischen Themen. Generell ist insbesondere seit den 80er Jahren eine sogenannte 'Eventisierung' politischer Ereignisse festzustellen. Beispielsweise werden Parteitage mit unterhaltenden Showeinlagen angereichert, oder im Zuge von Flüchtlingswellen wird durch symbolisches Handeln wie den Besuch von Auffanglagern Solidarität inszeniert. Damit stellen sich politische Akteure auf das neue Mediensystem ein, erhöhen die Resonanzchancen von politischen Ereignissen durch Unterhaltung und Spektakel bzw. inszenierten politische Events zur Pflege ihres Images. Provokative und auf Personen zugespitzte Kon8 fliktinszenierungen garantierten insbesondere der SVP in den eidgenössischen Wahlen 1999 eine überragende massenmediale Resonanz. Diese hohe mediale Beachtung dürfte nicht unwesentlich zum Wahlerfolg beigetragen haben. Und genau deshalb kommen die anderen Grossparteien durch die SVP zunehmend unter Druck. Allerdings ist ein politisches Marketing mit nur einer Symbolfigur riskant. Denn dem Parteinachwuchs wird die Eigenprofilierung erschwert, und der Übergang von einer Symbolfigur zur nächsten ist deshalb fragil, weil persönliche Bindungskraft schwer übertragbar ist. Mit zunehmendem politischen Marketing und der Konzentration auf wenige Symbolfiguren steigt deshalb die Kontingenz der Politik. Im Zentrum des politischen Marketings steht dementsprechend nicht das diskursive Abwägen von Argumenten, sondern eine den Bedürfnissen der Medien angepasste Symbolpolitik, welche Positionen und Personen eingängig und breitenwirksam präsentiert. Dabei tritt an die Stelle politischer Argumentation die Darstellung von persönlicher Effizienz, Integrität und sozialpsychologisch eingängigen Ausschnitten aus dem Politikerleben in Form von Stimmungsbildern und Identifikationsmöglichkeiten. Angestrebt wird durch das Marketing insbesondere bei Wahlen weniger das überzeugte Einverständnis zu politischen Positionen, als vielmehr eine Zustimmungsbereitschaft, die in eine möglichst offene Vertrauensdelegation mündet. Dies zeitigt Rückwirkungen auf die mediale politische Kommunikation. Exekutivwahlen werden immer wichtiger und im Vergleich zur politischen Kommunikation der 60er und der 90er Jahre ist eine prägnant zunehmende Fokussierung auf die Exekutive und die Verwaltung und korrelativ eine massive Schrumpfung der Medienaufmerksamkeit auf das Parlament festzustellen, obwohl gegenläufig die parlamentarische Tätigkeit zugenommen hat. In den 90er Jahren haben nur noch hoch konfliktive Abstimmungen und Parlamentsdebatten die Chance, in der medienvermittelten Öffentlichkeit auf intensive Resonanz zu stossen. Mit anderen Worten: In der Aera der Parteipresse vermittelten die Medien noch die deliberativen Aushandlungsprozesse einer Versammlungsöffentlichkeit, die gleichsam virtuell nachzuvollziehen war. Im ausdifferenzierten Mediensystem aber werden die deliberativen Kernstrukturen des Politischen zunehmend im Parlament eingeschlossen. Gesamthaft hat deshalb die Diskursivität medienvermittelter öffentlicher Kommunikation deutlich abgenommen. Mit Blick auf das politische Marketing haben die neuen Regeln im Mediensystem also auch neue Regeln im politischen System mit sich gebracht, die wiederum Rückwirkungen auf die massenmediale öffentliche Kommunikation zeitigen. Ausserdem orientiert sich die medienvermittelte Darstellung der Politik immer mehr an der Exekutive auf Kosten der Legislative. 3. Problembereiche im Interaktionsverhältnis zwischen Politik und Medien Wenn wir nun erstens davon ausgehen, dass moderne Demokratien zwingend auf die Öffentlichkeit als zentrale Vermittlungsinstanz der Gesellschaft angewiesen sind, und wenn wir zweitens voraussetzen, dass die Öffentlichkeit eine wichtige integrative Funktion für die moderne Gesellschaft hat, dann stellt sich in Kenntnis des jüngsten Strukturwandels der Öffentlichkeit und der Anpassungsleistungen der Politik die Frage, inwie9 weit von einer Gefährdung der politisch-rechtlichen, der deliberativen und der integrativen Potentiale der demokratischen Öffentlichkeit gesprochen werden kann? Man mag es bedauern, dass die profunde politische Medieninformation, welche auch den deliberativen Aushandlungsprozess der Demokratie und nicht nur politisches Symbolhandeln zeigt, kein Massenpublikum mehr findet, welches als Staatsbürger angesprochen werden kann. Allerdings existiert ein solches Angebot in der Schweiz in Form von Elitemedien nach wie vor und bis jetzt ist keineswegs zu beobachten, dass diese Formate aus dem Medienmarkt verschwinden, im Gegenteil. Und auch im ausdifferenzierten Mediensystem sind Situationen zu beobachten, in denen sich die gesamte Medienarena, vom Boulevard über Forums- und Elitepresse bis zum privaten und öffentlichen Rundfunk, auf gesellschaftspolitische Konflikte und normativ umstrittene Fragen konzentriert und damit über verschiedenste Medienformate hinweg einen gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsraum kreiert. Damit partizipieren unterschiedlichste Nutzungsgruppen, wenn auch in sehr verschiedener publizistischer Qualität, an gesamtgesellschaftlich relevanten Diskussionen. Empirisch stellen wir im historischen Vergleich von konfliktiven Kommunikationsverdichtungen keine Fragmentierung der Öffentlichkeit fest. Aber die öffentlich-politische Kommunikation erweitert sich auf die Bereiche des 'Human Interest', des 'Sex & Crime' und vor allem auch auf Vorgänge im ökonomischen Teilsystem. Feststellbar ist dabei eine deutlich zunehmende Politisierung der Ökonomie. Deshalb möchte ich nicht von einer Zerstörung der demokratischen Öffentlichkeit sprechen. Aber aufgrund der massiven Wandlungsprozesse im Zeitalter der Informationsund Mediengesellschaft müssen neue soziale Arrangements gefunden werden. Und genau hier liegt die Herausforderung, um demokratische Prozesse auch in einem ausdifferenzierten Mediensystem zu garantieren. Gefordert sind Politik und Medien, ihre internen und externen normativen Regelsysteme aufgrund der neuen Funktionsregeln zu reflektieren und aktiv zu gestalten. Denn der Staat kann über die Gesetzgebung nur Rahmenbedingungen vorgeben. Informelle Regeln, auch im Sinne einer politischen und medialen Kultur, müssen diese gesellschaftlichen Bereiche für sich und im Austausch mit andern selber normativ verankern. Anzeichen dafür, dass neue Spielregeln definiert werden, gibt es durchaus (Presserat, Medienkommission, Ombudsmann, Qualitätsdiskussion). 10 4. Folgerungen für die Politik Für die Politik möchte ich folgende drei Punkte festzuhalten: 1. Politisches Marketing und Kommunikationskompetenz (Prof. O. Jarren) Unausweichlich muss sich die Politik darauf einstellen, dass politisches Marketing für das Erreichen eines Massenpublikums notwendig ist. Politik wird in der gesättigten Informations- und Unterhaltungsgesellschaft nicht einfach vom Souverän nachvollzogen, sondern muss im wahrsten Sinne des Wortes an die Frau und den Mann gebracht werden. Es stellt sich aber die Frage, inwiefern die Diskursivität der öffentlich-politischen Kommunikation wieder gestärkt werden kann und soll. Denkbar ist, dass die ausgeprägt persuasive und symbolische politische Kommunikation mindestens teilweise mit diskursiven Elementen angereichert werden kann. Dazu müssten politische Entscheidungsvorgänge von Beginn an "kommunikativ gedacht" und als "Prozesse organisiert" werden. Der Aufbau einer solchen Kommunikations- und Organisationskompetenz von politischen Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen bedeutet, dass verschiedenste gesellschaftliche Akteure in diesen Prozess einbezogen werden, um "gesellschaftsweite öffentliche Werte-Diskurse" zu organisieren und "sichtbar zu machen, was die Gesellschaft will und soll". Auf diese Weise werden Medien nicht nur als "Transmissionsagenturen zur Vermittlung von fertigen Lösungen genutzt (...), sondern sind Bestandteil einer öffentlichen Diskurskultur" (Jarren). Mit anderen Worten stellt sich die Frage, inwieweit die Politikdarstellung diskursiv gestaltet werden kann, so dass sie gleichsam einen öffentlichen Vernehmlassungsprozess darstellt. Besonders schwer fällt ein aktuelles und personenzentriertes politisches Management politischen Gruppierungen, welche intern unterschiedlichste Lager integrieren. Denn für den Positionenkampf mit politischen Gegnern, müssen interne Machtkämpfe und konfliktive Aushandlungsprozesse in entscheidenden Situationen nach aussen abgedeckt werden. Vertrauen erwecken und Solidität verkörpern jene Parteien, die in heissen Phasen hinter ihren medialen Protagonisten stehen und klare Positionen vermitteln. Für Parteien besteht deshalb ein fragiles Verhältnis zwischen der Binnenintegration und der massenmedialen Präsentation. Zudem stellt sich für die Politik grundsätzlich die Frage, mit welchen Mitteln politisches Marketing betrieben und massenmediale Resonanz erzeugt werden soll. 2. Inszenierung des Privaten Mit einer gezielten Veröffentlichung von Ausschnitten aus dem Privaten können Politiker Vertrauen und Sympathie gewinnen. Das Risiko solcher Inszenierungen der Privatheit besteht darin, dass Politiker die Geister, die sie gerufen haben, nicht mehr loswerden. Ist die 'Büchse der Pandora' einmal geöffnet, wird auch die Grenze zwischen privater und öffentlicher Person eliminiert. Erhalten in politischen Skandalisierungen private Aspekte Bedeutung, erweist es sich als äusserst schwierig, medial auf der Unterscheidung von öffentlicher und privater Person zu 11 beharren und auf Funktionsrollen hinzuweisen.1 Aus der Sicht der Politik drängt es sich vor diesem Hintergrund auf, sich grundsätzlich Gedanken zu machen, inwieweit das Mittel der Inszenierung des Privaten eingesetzt werden soll. Eine permanente Vermischung von privater und öffentlicher Rolle führt nicht nur zu einer moralischen Anspruchsüberlastung des politischen Personals, sondern zerstört beim Publikum auch die differenzierte Wahrnehmung der Politiker als spezifische Rollenträger. 3. Grenzen der Provokation Obwohl Provokation ein Mittel ist, öffentliche Aufmerksamkeit für die eigenen Anliegen zu erlangen, stellt sich die Frage, wo Grenzen gezogen werden. Provokationen können als Tabubruch dann öffentliche Wertediskussionen auslösen, wenn sie sachbezogen sind und helfen, latente Spannungen in der Gesellschaft aufzubrechen. Provokationen allerdings, die auf die Diffamierung des politischen Gegners oder sozialer Gruppen zielen, haben desintegrative Wirkungen und befördern die Polarisierung. Dies ist der schweizerischen Konkordanzpolitik abträglich, weil sie nach wie vor auf die Aushandlung von Kompromissen zwischen verschiedensten politischen und kulturellen Lagern angewiesen ist. Dass nicht alle Mittel, um massenmediale Resonanz zu erzeugen, erwünscht sind, zeigte sich am öffentlichen Streit um die Plakatkampagne der SVP im Rahmen der eidgenössischen Wahlen 1999. Aber auch das CDU-Plakat, welches Bundeskanzler Schröder mit Fahndungsphotos abbildete und mit Rentenbetrug betitelt war, hat in Deutschland massive Kritik ausgelöst. In diesem Prozess der Etablierung von informellen Regeln, welche der Provokation Grenzen zu ziehen versuchen, wird es immer wieder Ausreisser geben. Gerade darum muss in der Politik die Frage nach dem Umgang mit politischen Gegnern immer wieder neu gestellt werden. 5. Folgerungen für die Medien Für die Medien möchte ich ebenfalls drei Punkte festhalten: 1. Qualitätsstandard, Kritik und Selbstregulierung Die Medien sind gefordert, sich mit publizistischer Qualität auseinanderzusetzen und neue Standards zu definieren. Dabei müssen ökonomischen Kriterien durch ethische Normen ergänzt werden, damit sie ihre Rolle als Vermittler in der öffentlich-politische Diskussion wahrnehmen können. Dies ist keineswegs ein selbstloser Akt zugunsten der Allgemeinheit, sondern fördert auch ihr Prestige. Im überquellenden Informationsmarkt wird Reputation zu einer entscheidenden Wettbewerbsressource, weil sie Vertrauen generiert. Um aber Qualitätsstandards Geltung zu verschaffen, ist es notwendig, dass sich die Medien wechselseitig beobachten und kritisieren. Damit reflektieren sie nicht 1 Sogenannte 'Outings' erscheinen heute als die erfolgreichere Variante, mit moralisch umstrittenen Aspekten des Privatlebens umzugehen statt sie zu leugnen. Denn in einer solchen Situation kann die mediale Aufmerksamkeit dann zum Prestigegewinn führen, wenn Ehrlichkeit inszeniert wird. Hingegen verleiht die Entlarvung eines Politiker als Lügner einem Skandal grosse Dynamik. 12 nur die Bedeutung des und die Veränderungen im Mediensystem, sondern lancieren auch Diskussionen über wünschenswerte Regeln im journalistischen Handwerk. Nur im Rahmen einer solchen Selbstreflexion und der wechselseitigen Kritik versetzen sich die Medien in die Lage, selbstregulierend wirken zu können. 2. Medienvielfalt und Unabhängigkeit (Prof. O. Jarren / Dr. P. Donges). Medienpolitisch muss die Vielfalt und die Unabhängigkeit der Medien garantiert werden. Zu verweisen ist bezüglich Vielfalt auf Konzentrationsprozesse, welche einzelne Unternehmen in eine 'monopolistische Lage' versetzen. Dadurch werden die redaktionellen Freiheiten sowie die publizistische Vielfalt und das gegenseitige Kritikpotential eingeschränkt. Zudem ist die Beteiligung von branchenfremden Unternehmen an Medienunternehmen problematisch. Denn die damit verbundenen Renditeerwartungen negieren den besonderen Charakter publizistischer Güter und erhöhen den Druck auf die Redaktionen, sich werbestrategischen Kriterien zu beugen. 3. a. b. c. Normative Anforderung: integrative Leistungen Welche integrativen Leistungen können den Medien abgefordert werden? Thematisierung sozialer Problemlagen Massenmedien müssen soziale Problemlagen thematisieren, insbesondere dann, wenn Interessengruppen davon betroffen sind, denen eine politische Lobby für die Durchsetzung ihrer Ziele fehlt. Damit leisten sie einen entscheidenden Beitrag für das Anstossen politischer Problemlösungsverfahren. Beobachtung sozialer Konfliktlagen (Prof. O. Jarren) Massenmedien müssen Konfliktlagen in der Gesellschaft thematisieren und damit den Konfliktparteien die Möglichkeit geben, sich gegenseitig zu beobachten. Damit gewährleisten sie die kommunikative Anschlussfähigkeit zwischen den Konfliktparteien in einer Situation, in der die Wahrscheinlichkeit einer desintegrativen Dynamik zunimmt. Reflexion der Interessenlagen und der Medieninstrumentalisierung (Prof. O. Jarren) Massenmedien müssen die Interessenlagen reflektieren, welche sich hinter den teilweise mittels Symbolpolitik vermittelten Position verbergen. Weil sich politische Akteure an die Inputbedingungen des Mediensystems angepasst haben und politisches Marketing nicht auf Konsensfindung, sondern auf Profilierung ausgerichtet ist, können Medien durch einem reflexiven Umgang mit politischen Akteuren dazu beitragen, Kompromisslinien sichtbar zu machen; und sie können sich einer Instrumentalisierung durch Konfliktparteien bewusst entziehen. 13 1.b. Medien und Politik. Eine Wechselbeziehung mit neuen Regeln? Podiumsdiskussion mit Andreas Durisch, Chefredaktor SonntagsZeitung; Kurt Imhof, Soziologie / Publizist; Markus Notter, Regierungsrat Kanton Zürich; Andreas Iten, alt Ständerat; Iwan Rickenbacher, Kommunikationsberater und Erwin Koller, Moderator (Podiumsgespräch vom 30. Juni 2001) Nach einer kurzen Zusammenfassung der sozialwissenschaftlichen Befunde und Diskussionen in den drei vorangehenden Runden des Zyklus nahm das Podium zuerst zu den wichtigsten Punkten Stellung und schilderte die eigenen Erfahrungen in der politischen und medialen Praxis. Im zweiten Teil stand die Frage im Zentrum: Brauchen Politik und Medien neue Regeln? 1. Veränderungen in der politischen und medialen Praxis Die politischen Vertreter des Podiums nehmen die benannten Veränderungen in der öffentlich-politischen Kommunikation wahr und machen damit ihre eigenen Erfahrungen. Solche Lernprozesse im Umgang mit den Medien gehören zu jeder Politikerlaufbahn in einer Zeit, da die Parteipresse weitgehend verschwunden ist. Die Erfahrungen der Politiker mit den Medien beschränken sich nicht auf die Phänomene der Personalisierung, Privatisierung und Skandalisierung in der politischen Medienkommunikation, wesentlich ist auch der Umgang mit den Journalisten. Oft habe ein Politiker mit immer wieder neuen, schlecht ausgebildeten oder ahnungs- wie kenntnislosen Journalisten zu tun, was den notwendigen Austausch erschwere und der öffentlich-politischen Kommunikation schade (Notter). An den Medien kritisieren die Politiker die Gleichförmigkeit und die fehlende analytische Schärfe der massenmedialen politischen Berichterstattung. Auffallend sei oft eine ritualisierte Abhandlung gleicher Themen im Rhythmus von Wochen, in denen der Ball herumgereicht werde. Dabei würden aber die Blätter und Sendungen nicht durch eigenständige Reflexionen und Kommentare auffallen. Vielmehr wäre die Berichterstattung gleichförmig und gleich gehaltvoll bzw. gehaltleer. Insbesondere fehlen in der heutigen Medienberichterstattung reflektierende Kommentare bzw. ein analytischer Meinungsjournalismus (Iten, Imhof). Es gebe wohl Empörung und Kampagnenjournalismus, aber keinen für die politische Kommunikation wichtigen Positionsbezug und auch keine einordnenden Darstellungen von Perspektiven und Zusammenhängen. Die Kommunikations- und Medienvertreter sind sich bewusst, dass Medien heutzutage verstärkt den Regeln des ökonomischen Erfolges gehorchen. Dies wird aber nicht nur als Niedergang, sondern auch als Chance betrachtet. Medien seien daher aufgefordert, im eigenen Interesse ständig an ihrer Qualität zu arbeiten (Rickenbacher). Nur Medien mit Qualität und gutem Prestige werden überleben und verkaufen sich auf Dauer. Die Frage aber, was Qualität sei, liess sich evidenterweise nicht erschöpfend diskutieren. Der Qualitätsbegriff sei je nach dem Zielgruppenpublikum anders anzusetzen, war eine Position (Durisch). Bei den PolitikerInnen wurde eine fehlende Professionalität im Umgang mit den Medien bemängelt (Durisch). 14 2. Neue Regeln und Steuerungsinstrumente Grundsätzlich war man sich auf dem Podium einig, dass das Rad der Entwicklung der Presse- und Parteienlandschaft nicht zurück gedreht werden kann und dass auch bloss moralische Appelle nicht weiter führen. Zu der Frage, wie und wo nun reguliert werden soll und welche Chancen regulierende Massnahmen haben, auch Wirkmächtigkeit zu erlangen, gingen die Meinungen allerdings auseinander. Die Vorschläge zur erfolgreichen Etablierung von formellen und informellen Regeln in Politik und Medien sind sehr unterschiedlich. Der Frage der regulierten Selbstregulierung der Medien wird in der offenen Diskussion von Podium und Plenum viel Aufmerksamkeit geschenkt. Auch Skepsis wird laut: Die Banken wollen die Geldwäscherei selbst regeln, die Sportverbände das Doping. Woher sollen wir den Glauben nehmen, dass die Medien erfolgreicher sind? Leider sei eine regulierte Selbstregulierung seitens der Medien in vielen Bereichen nicht zu erkennen. Verwiesen wird auf den unverantwortlichen Umgang ‚der Medien’ mit Kolumnen und Leserbriefen, wenn darin Falschmeldungen, ja sogar diffamierende Aussagen gemacht würden. Gefordert wird ein Ausbau der Meinungsäusserungsfreiheit – auch hinsichtlich des Publikums – in Richtung Publikationsrecht (für die Redaktion verpflichtende Leserbriefseiten u.ä.). Kritik wird auch am Qualitätsbegriff laut, der je nach Zielpublikum ausgerichtet wird. Denn im Zentrum stehe die Glaubwürdigkeit insgesamt, die nicht teilbar sei. Mit Blick auf die Medienkonzentration werden insbesondere ordnungspolitische Massnahmen angesprochen. Eine klare Verantwortung der Kartellkommission bei Medienmonopolen sei notwendig (Imhof), was von den andern Podiumsteilnehmern weitgehend als unrealistisch beurteilt wird. Allerdings wird auch moniert, dass alternative Ansätze, wie z. B. Publikumsräte und Ombudsmänner für alle Presseorgane, zu wenig konsequent verfolgt würden, eine regulierte Selbstregulierung also kaum greifen würde. Der Service Public des Rundfunks wird (mit Ausnahme von Durisch) vom ganzen Podium befürwortet, vor allem mit Hinweis auf die grundlegende und weit gefächerte Informationspflicht und auf den kultur- und minderheitspolitischen Ausgleich in der Schweiz, ganz besonders zwischen den Sprachregionen. Mit der Zeit müssten Regeln ähnlich dem Service public auch für die Presse eingeführt werden, weil die Information für die Demokratie mehr sei und etwas anderes als die sonstigen kommerziellen Güter und Dienstleistungen (Notter). Auf informeller Ebene müsse sich aber auch die Politik selber disziplinieren im Umgang mit den Medien. Eine Selbstverpflichtung bzw. ‚kulturelle Regulierung’ der Politik sei insbesondere bei einer öffentlichen Diffamierung des politischen Gegners ebenso notwendig wie die Selbstdisziplinierung der Medien. Mindestanstandsregeln und eine Professionalisierung seien auf der Seite der Politik daher unabdingbar. Die lebhafte Auseinandersetzung im Podium und mit dem Plenum zeigte, dass neue Regelns erst diskutiert werden, ein Konsens über neue Regeln für Medien und Politik aber noch nicht gefunden und etabliert sind. Es war jedoch der Wille zu spüren, dass man aufeinander eingeht und dass vor allem die Qualitäts- und Regulierungsfrage eine Herausforderung sowohl an die Medien wie an die Politik ist, die ernst genommen und weiter verfolgt werden muss. 15 2. Wo ist der Rubikon? Ethische Fragen zur Nutzung von Embryonen von Dr. Stephan Wehowsky2 (GEF-Referat an der Mitgliederversammlung vom 1. Juni 2001) In Deutschland tobt derzeit eine Debatte um die Frage, welchen Status der Embryo hat. Der Hintergrund dafür ist der Wunsch einiger Forscher, Zellen von Embryonen zu benutzen. Zu diesem Zweck müssten entweder Embryonen erzeugt werden oder man nimmt sogenannte überzählige Embryonen, wie sie zum Beispiel bei der künstlichen Befruchtung entstehen. Auf jeden Fall ist ein Embryo, dem Zellen entnommen werden, nicht überlebensfähig. Er wird, wie man zurückhaltend sagt, "verbraucht". Ein weiteres Problem heizt diese Debatte an. Es geht dabei um die Frage, ob es zulässig sein soll, Embryonen, die künstlich ausserhalb einer Gebärmutter erzeugt worden sind, auf ihren Gesundheitszustand hin zu testen, bevor man sie eingepflanzt. Es handelt sich dabei um die sogenannte Präimplantationsdiagnostik, abgekürzt PID. Auf den ersten Blick scheint es nur vernünftig zu sein, Embryonen, bevor man sie in eine Gebärmutter einsetzt, damit sie sich zu vollständigen Menschen ausbilden, daraufhin zu testen, ob sie nicht möglicherweise mit schweren Erbkrankheiten belastet sind. Der Haken besteht jedoch darin, dass jene Embryos, die diesen Test nicht bestehen, also den Ausbruch einer schwereren Krankheit erwarten lassen, vernichtet werden. Bevor ich diese Debatte weiterverfolge, möchte ich eine Bemerkung zu dem Stellenwert dieser Diskussion für die Schweiz machen. Ihnen wird aufgefallen sein, dass dieses Thema hier und da in den Zeitungen auftaucht, aber hierzulande keine grösseren Debatten auslöst. Der Grund dafür ist einfach. In der Schweiz ist die PID ebenso verboten wie die verbrauchende Forschung an Embryonen. Damit ist der Fall aber nicht erledigt. Ich habe vor ein paar Tagen einen Arzt, einen Experten für Fortpflanzungsmedizin, nach der Schweizer Debatte gefragt. Er sagte mir, dass die Fachleute die deutsche Diskussion sehr aufmerksam verfolgen und die Hoffnung hegen, dass in Deutschland die PID und die verbrauchende Forschung an Embryonen zugelassen wird. Denn dann bestehe die Chance, dass dies auch in der Schweiz geschehe. Mit anderen Worten: Die deutsche Diskussion hat für die Schweiz allergrösste Bedeutung. Was an der gegenwärtigen Debatte in Deutschland auffällt, ist die Tatsache, dass die bedeutendste konservative Tageszeitung Deutschlands, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, seit Monaten wie Kassandra auftritt. Diese Zeitung, die jahrelang alle Gegner oder auch nur Kritiker oder Skeptiker mit Hohn und Spott überzogen hat, weil sie davon überzeugt war, dass der technisch-wissenschaftliche Fortschritt allein selig machend sei, warnt nun in schrillen Tönen vor den Folgen einer Freigabe der PID und der entsprechenden Forschung. Da haben sich die Fronten total verkehrt. Der sozialdemokratische Bundeskanzler Schröder will eine "Diskussion ohne ideologische Scheuklappen". Er sieht die hohe wirtschaftliche Bedeutung dieses noch offenen Feldes. Seine Justizministerin widerspricht ihm heftig, indem sie darauf hinweist, dass das deutsche Grundgesetz 2 Vgl. auch den Aufsatz von Prof. Johannes Fischer im Kapitel 7 dieses Arbeitsblattes. 16 und das Embryonenschutzgesetz einen Verbrauch bzw. die planmässige Selektion und Vernichtung von Embryonen wie bei der PID verbietet. In der CDU verlaufen die Fronten unübersichtlich. Der ehemalige Zukunftsminister Rüttgers möchte ein bisschen erlauben, andere möchten ein bisschen mehr verbieten, und wenn ich die Parteivorsitzende Merkel richtig verstanden habe, möchte sie auch kein hartes Nein. Die Parteibasis tendiert dagegen eher zur Ablehnung, und die CSU wird sich wohl auf ein Verbot festlegen. Ich möchte Sie nicht mit allen Verzweigungen dieser Debatte langweilen. Aber ich möchte diese Debatte zum Anlass nehmen, ein paar Fragen zu stellen. Dank der Anregung von Hanspeter Uster hat sich die GEF umbenannt. Statt ethische Forschung zu betreiben, will sie ethische Fragen stellen. Ich halte das für absolut sachgemäss, denn ich habe mir noch nie vorstellen können, was ethische Forschung sein soll. Forschung dient doch dazu, etwas Neues herauszufinden. Und Ethik hat mit dem zu tun, was die Menschen im Innersten bestimmt und zusammenhält. Der katholische Philosoph Robert Spaemann hat einmal bemerkt, dass ein Satz, der eine grundlegend neue Aussage über den Menschen enthalte, mit Sicherheit falsch sei. Und so kann ich auch sagen, dass ich ein paar sehr alte Fragen an eine neue Entwicklung stellen möchte. Und sie werden sehr rasch feststellen, dass das Thema der PID mehr ein Anlass als die Sache selbst ist. Das zeigt übrigens auch die Art der Diskussion, wie sie in der FAZ geführt wird. Denn es liesse sich ja mit guten Gründen sagen, dass ein paar hundert oder tausend Fälle der PID oder eine ja auch nicht massenhaft stattfindende Embryonenforschung kein Grund sind, die ethischen Grundlagen unserer Gesellschaft im Wanken zu sehen. So betrachtet liesse sich die Frage, wie das Ganze gesetzlich geregelt werden soll, vertagen. Man könnte sagen: "Nun forscht mal erst, betreibt PID, und wenn wir erkennen können, in welchen Grössenordnungen hier Probleme entstehen, machen wir Gesetze." – Aber so einfach lassen sich die Diskutanten nicht abspeisen. Und damit haben sie Recht. Denn es geht um die Frage, was zuletzt überzeugender ist: ethische Grundsätze oder Nutzenversprechen. Ich meine dies so: Das deutsche Grundgesetz legt fest, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Weiter wurde in einzelnen Gesetzen und Verfassungsgerichtsurteilen festgestellt, dass der Mensch diese Würde besitzt, auch wenn er nicht in der Lage ist, diese für sich selbst zum Ausdruck zu bringen. So besitzt der Schwerstkranke, der Debile, ja sogar der Schwerverbrecher eine unveräusserliche Menschenwürde. Andere Demokratien teilen diese Grundsätze im Prinzip, auch wenn sich hier und da deutliche Akzentverschiebungen beobachten lassen. Für Deutschland gilt nun, dass die Menschenwürde bereits dem Embryo zugesprochen wird. Mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle haben wir es also mit einem Gebilde zu tun, das Anspruch auf genau den gleichen Schutz hat wie irgend ein Mensch, der auf der Strasse herumläuft. Nun wissen wir, dass in Deutschland die Abtreibung unter gewissen Bedingungen praktiziert wird. Der Gesetzgeber hat sich mit folgender Konstruktion geholfen: Die Abtreibung ist zwar verboten, wird aber unter gewissen Bedingungen nicht unter Strafe gestellt. Man sieht schon, wie gross die Schwierigkeit ist, einem Gebilde Menschenwürde zuzuschreiben, unter dem man sich nicht mehr vorstellen kann, als dass es sich um die Ansammlung einiger Zellen handelt, die bei normaler Entwicklung irgendwann als schreiender Mensch das Licht der Welt erblicken. 17 Und da komme ich zu meiner ersten Frage. Immanuel Kant hat gelehrt, dass Begriffe, denen die Anschauung fehlt, leer laufen. Das heisst, ein Begriff, der nicht mit Anschauung gefüllt wird, der nicht auf etwas Demonstrierbares verweist, hat keine rechte Kraft. Nun hatte Kant selbst mit Begriffen gearbeitet, denen keine Dinge zuzuordnen sind. Aber immerhin sprach er vom moralischen Gesetz in uns, dass uns ebenso wie der Sternenhimmel über uns mit Achtung erfülle. Und nun frage ich: Was hilft uns eine rational geführte Debatte, wenn die Begriffe, die dabei verwendet werden, für viele Diskutanten leer sind. Wenn sich also jemand unter der Menschenwürde des Embryos gar nichts vorstellen kann, was ihn mit Achtung erfüllt? Hilft es da, dass die deutsche Justizministerin auf den Konflikt mit dem Grundgesetz hinweist? Etwas salopp formuliert: Schiesst die Ministerin am Ende nicht ein Eigentor? Heisst es am Ende nicht, dass das Grundgesetz reformbedürftig sei? Die Journalistinnen und Journalisten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beobachten bei den jetzigen Diskussionen, dass die meisten Teilnehmer versuchen, harte Unterscheidungen aufzuweichen. Ein Beispiel. In einem Interview der Illustrierten Stern wurde Bundeskanzler Schröder gefragt: "Darf man töten, um . . .?" Er unterbrach die fragenden Redakteure brüsk und verbat sich jede begriffliche Klärung in dieser Sache mit dem Satz: "Ich würde bitten, bei diesem schwierigen Gebiet von so plakativen Begriffen wegzukommen." Hätte er geantwortet: "Nein, einen Zellhaufen kann man gar nicht töten", hätte er wenigstens eine klare Markierung gesetzt. Er hätte dann klar gemacht, dass er in einem Embryo noch keine Person zu erkennen vermag, der ein Lebensrecht zukommt. So aber umspielte er die harten ethischen Unterscheidungen, indem er sie für unangemessen erklärte, auch wenn sie der Gesetzgeber gerade in den zu diskutierenden Fällen für äusserst angemessen angesehen hat. Begriffe ohne Anschauung laufen leer. Der neue deutsche Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin, seines Zeichens Philosoph und Ethiker, hat übrigens so argumentiert, wie ich es dem Bundeskanzler Schröder gerade in den Mund gelegt habe. Nida-Rümelin ist tatsächlich der Meinung, dass man einen Zellhaufen nicht töten könne, da dieser noch nicht über "Selbstachtung" verfüge. Nur jemanden, der über die Gabe der Selbstachtung verfüge, könne im strengen Sinne getötet werden. – Man versteht, dass dieser Kulturstaatsminister mit diesen Äusserungen nicht nur in der Fachwelt ungläubiges Kopfschütteln ausgelöst hat. Dass Begriffe für diejenigen, die sie nicht mit Anschauung füllen können, derartig leer laufen, hatte man sich so wohl nicht vorgestellt. Wie markant die Tatsache ist, dass Begriffe ohne Anschauung leer laufen, möchte ich zusätzlich an einem Beispiel mit Anschauung demonstrieren, und dazu erlauben Sie mir bitte einen kleinen Scherz. Stellen Sie sich vor, die Waffenindustrie würde über ihre PRAgenturen den Satz lancieren: "Der Tod ist nicht das Schlimmste." Bundeskanzler Schröder, auf diese Parole der Waffenindustrie angesprochen, würde nicht antworten: "Also darüber wollen wir doch einmal ohne alle ideologischen Scheuklappen diskutieren." Da sich jeder unter einem durch Waffen verursachten Tod etwas vorstellen kann, würde sich der Kanzler hier nicht so liberal verhalten, obwohl er sich dabei durchaus in guter Gesellschaft befände: "Das Leben ist der Güter höchstes nicht", hat Friedrich Schiller in der "Braut von Messina" formuliert. Schiller war bekanntlich kein Lobbyist der 18 Waffenindustrie, sondern er wollte lediglich darauf aufmerksam machen, dass es Ideale gibt, die zu verteidigen man durchaus sein Leben einsetzen sollte. Nun könnte man natürlich in Anlehnung an Schillers Beispiel fragen, ob sich mit den neuen Forschungsrichtungen oder Diagnosepraktiken nicht Ideale verbinden, die geeignet sind, unsere bisherigen Anschauungen von der Würde des Menschen schon im embryonalen Stadium zu korrigieren. Das wäre ja etwas. Wenn die Forschung uns Perspektiven eröffnen könnte, die gewisse ethische Opfer Wert wären. Was könnte das zum Beispiel sein? Menschen, die sich gegenseitig nicht mehr umbringen? Menschen, die nicht mehr krank werden? Menschen, die ökologisch mit diesem Planeten umgehen? Das alles sind für sich genommen fantastische Ziele, und das "Human Genom Project" in den USA hatte diese Ziele gewissermassen als Subtext. Dahinter stand die Überlegung intelligenter Leute, dass sich auf soziale Weise der Mensch ohnehin nicht verbessern lasse. Effizienter sei es, seine Gene so zu manipulieren, dass er seine negativen Eigenschaften verliert. Öffentlich wurde darüber natürlich nicht gesprochen. Nun stellen wir uns vor, unsere Forschereliten würden uns die verbrauchende Embryonenforschung eben mit diesem Argument schmackhaft machen: "Eure PID-geprüften Kinder werden, sobald es nur genügend von ihnen gibt, es besser haben als ihr und in einer besseren Welt leben." Das käme in der Öffentlichkeit überhaupt nicht gut an. Denn diese Art der Einmischung würde man sich dann doch wohl verbitten. Kriege sind zwar nicht schön und eine kaputte Umwelt auch nicht, von Krankheiten gar nicht zu reden, aber dies ginge uns dann doch wohl zu sehr an die Identität. Der Mensch, würde Bundeskanzler Schröder in einem solchen Fall sicher sagen, müsse lernen, mit seinen Unzulänglichkeiten zurechtzukommen. Die Ziele der Forscher und Fortpflanzungstechniker sind denn auch viel bescheidener. Sie erzählen uns zwei Sachen. Einmal verkünden sie, dass es gelte, schwere Erkrankungen zu therapieren. Zum anderen sehen sie ihre Aufgabe darin, kinderlosen Paaren zu einem Kind zu verhelfen. Beiden Zielen wird man auf den ersten Blick nicht die Zustimmung verweigern. Wer möchte schliesslich nicht, dass schwere Krankheiten gelindert oder gar ganz geheilt werden, und wer gönnt kinderlosen Paaren nicht das ersehnte Kind? "The devil has a soft stepp", sagen die Engländer. Man verspricht nicht zuviel, aber doch genug, um Begehrlichkeiten zu wecken. Es handelt sich hier um Suggestionen, die stark genug wirken, um den Verstand und das Urteilsvermögen der meisten Diskussionsteilnehmer lahmzulegen. Beide Suggestionen sind verschieden gelagert, so dass ich sie hier kurz getrennt behandeln will. Den Wunsch, von schweren Krankheiten geheilt zu werden, hat jeder Mensch. Komplementär dazu verhält sich die Angst, bereits eine schwere Erkrankung in sich zu tragen. Nun hat die Medizin gerade in den vergangenen Jahrzehnten fantastische Fortschritte gemacht. Logisch betrachtet müsste damit die Angst vor Krankheit zurückgegangen sein. In Bezug auf einige Erkrankungen, die früher tödlich waren und heute leicht therapierter sind, ist dies auch ganz sicher der Fall. Doch man kann fragen, wen man will, ob Laien oder Fachärzte: Insgesamt ist die Angst vor Krankheit nicht geringer geworden. Ich kenne mehrere Fachärzte, die sich bewusst, standhaft und schon seit Jahrzehnten weigern, sich selbst einmal untersuchen zu lassen. Und ein bekannter Schweizer Arzt, 19 der Internist und Kardiologe Frank Nager, hat mir gesagt, dass für ihn selbst sein Wissen über gewisse Krankheitsverläufe "nicht eben lebensdienlich" sei. Und auf der Wissenschaftsseite der von mir bereits mehrfach erwähnten FAZ konnte man kürzlich lesen, dass die moderne Medizin den Menschen kränker anstatt gesünder mache. Denn, so der Autor, mit der Ausweitung der Diagnostik werde eben immer mehr entdeckt. Und nun erzählen uns die Forscher, dass sie mit ihren gentechnischen Methoden mehr Gesundheit produzieren wollen. Natürlich ist das nicht ganz falsch, aber falsch wäre die Annahme, dass damit die Krankheitsproblematik in irgendeiner Weise verringert wird. Wo sollte denn der Punkt erreicht sein, an dem die Angst vor schweren Erkrankungen verschwunden ist? Mit Hilfe der auf Gentechnik beruhenden Therapiemöglichkeiten wird man ihn nie erreichen. Denn das Menschenbild, das dieser Form der Diagnostik, Prognose und Therapie zugrunde liegt, ist höchst einseitig. Es impliziert, dass unser Schicksal von den Genen abhängt. Ganz sicher haben die Gene einen grossen Einfluss. Aber es gibt ernst zu nehmende Wissenschaftler und Ärzte, die bezweifeln, dass die Gene so mächtig sind, wie sie hingestellt werden. So könnte es gut sein, dass die innere Stimmigkeit eines Menschen sich äusserst stark auf seine Gesundheit auswirkt. Und dies würde bedeuten, dass sein Körper mehr ist als ein verdächtiges Feindesland, das ständig auf Partisanennester abgesucht werden muss. So jedenfalls hat es einmal der Philosoph Peter Sloterdijk in einem Bild formuliert. Wenn die Bedeutung der gentechnisch orientierten Medizin zunimmt, verstellt sie uns den Blick dafür, dass es andere Dimensionen in uns selber gibt als jene, die sich gentechnisch reproduzieren lassen. Diese Andeutungen müssen hier genügen, aber ich kann sie noch etwas deutlicher machen, wenn ich auf das Thema des Kinderwunsches eingehe. Die neuen Techniken der künstlichen Befruchtung dienen dazu, Eltern, denen es auf anderem Wege nicht möglich ist, einen Kinderwunsch zu erfüllen. Dafür will man auch in Kauf nehmen, dass Embryonen, denen nach deutscher und Schweizer Rechtslage Menschenwürde und entsprechender Schutz zusteht, vernichtet werden. Von der Logik des Verfahrens her ist dies nicht zu beanstanden. Denn es müssen mehrere Embryonen erzeugt werden, weil nicht jede Einpflanzung ein Erfolg wird. Und bevor man einpflanzt, will man natürlich wissen, was man da einpflanzt. Dies gilt ganz besonders für jene Paare, die in ihrer Familie bereits von schweren Erbkrankheiten geplagt worden sind. Soweit, so gut. Ich möchte hier ein paar Fragen stellen: Wo steht eigentlich geschrieben, dass ein Kinderwunsch in jedem Falle erfüllt werden muss? Besteht das Leben nicht auch in der Kunst, mit unerfüllten Wünschen zurechtzukommen? Ich weiss, diese Fragen klingen pharisäerhaft. Aber wer fragt eigentlich danach, was die ganzen Prozeduren, die für die künstliche Erfüllung des Kinderwunsches notwendig sind, für die künftigen Eltern bedeuten? Und welche Auswirkungen haben diese Prozeduren und die damit verbundenen Kosten für die Art und Weise, wie die künftigen Eltern ihr künftiges Kind betrachten? Wie sehen sie ihr Kind? Ist es nicht ein Produkt, für das sie viel Aufwand getrieben haben? Hat es sich nicht ihren Wünschen genauso zu fügen, wie vorher die Zellen im Labor? 20 In der Familientherapie spricht man von Verrechnungsproblemen, wenn es darum geht, die Leistungen und Opfer, die sich die Partner gegenseitig bringen und abverlangen, auszugleichen. Welche Position kann bei Verrechnungsproblemen ein Kind einnehmen, das unter grossem persönlichen und finanziellen Aufwand hergestellt worden ist? Während ich diese Frage formuliere, bekommt der gesichtslose Zellhaufen für mich plötzlich eine Bedeutung. Er hat schon eine Geschichte, die seine Geschichte als Mensch in dieser oder jener Weise prägen wird. Muss man die Kunden und Kundinnen der neuen Fortpflanzungsmedizin nicht sehr ernsthaft darum bitten, sich einmal genau ihre Motive anzuschauen? Könnte es nicht sein, dass sie ihr Lebensglück auf anderen Wegen besser erreichen? Mit diesen Fragen komme ich, ich weiss es, etwa zwanzig Jahre zu spät. Deswegen möchte ich noch ein paar Fragen anfügen, die mit der jetzt heiss diskutierten PID zusammenhängen. "The devil has a soft stepp": Glauben Sie bloss nicht denjenigen, die uns heute erzählen, bei der PID ginge es lediglich um die Diagnose schwerster Erbkrankheiten. So dumm sind die Forscher nicht. Im Laufe der Jahre werden sie in der Lage sein, mehr als nur schwerste Erbkrankheiten zu diagnostizieren. Es wird also so etwas wie einen Fortschritt in der PID geben. Und nun stelle ich mir vor: ein künstlich erzeugter und in der PID geprüfter Mensch geht eines Tages mit einem Leiden zum Arzt. Der sag ihm: "Da haben sie Pech. Als sie erzeugt wurden, konnte man ihre Krankheit noch nicht diagnostizieren. Übrigens hat es dann noch drei Jahre gedauert, bis man sie therapieren konnte. Sie sind einfach der falsche Jahrgang." Der amerikanische Molekularbiologe Lee M. Silver hat kürzlich darauf hingewiesen, dass es bei der PID natürlich nicht allein um die Diagnose schwerer Erbkrankheiten gehe. Vielmehr werde es eine Optimierung der Gene geben. Eltern, die viel Geld für die Ausbildung ihrer Kinder in Privatschulen steckten, würden darauf doch wohl kaum verzichten wollen. Vielleicht klingt manches, was sich gesagt und gefragt habe, etwas spekulativ. Deswegen möchte ich zurück auf den Boden der Debatte, die zur Zeit nicht nur in Deutschland geführt wird. Ich habe mich jetzt etwas seltsam ausgedrückt, wenn ich sage, nicht nur in Deutschland. Ich möchte auf eine Symmetrie zu sprechen kommen. Parallel zur Frage, wie mit Embryos umgegangen werden soll, wird wieder das Problem der Sterbehilfe diskutiert. Beide Probleme haben, so scheint es, wenig miteinander zu tun. Aber mir ist schon im Jahre 1986 auf dem 53. Deutschen Juristentag in Berlin aufgefallen, dass dort zwei Schwerpunktthemen waren: Embryonenforschung und Sterbehilfe. Und so ist es auch jetzt. Als würde das kollektive Bewusstsein unter einem Geständniszwang stehen. Als würde es sagen: Wenn wir schon über den Lebensanfang befinden, müssen wir auch dasselbe mit dem Ende machen. Und irgendwie ist das ja auch logisch. Man kann im Zellhaufen noch keinen Menschen erkennen und nicht mehr im leidenden Bündel. Ich will mich hier nicht zum Thema der Sterbehilfe äussern. Ich will nur auf dieses Phänomen der Gleichzeitigkeit der Diskussion aufmerksam machen. Und auf die Gefahr, dass ein reduziertes Menschenbild eine Logik entwickelt, der man sich am Ende nicht entziehen kann. Ich habe kurz dem 53. Deutschen Juristentag in Berlin erwähnt. Damals berichtete ein Gynäkologe aus Bonn davon, dass man aus Embryonen ein Mittel gegen Leukämie ge21 winnen könne, wobei der Embryo natürlich "verbraucht" würde. Dies sei nach deutschem Recht nicht möglich. Danach traf ich einige meiner Freunde in München – alles eher links-alternativ eingestellte Leute. Ich erzählte davon und fragte sie, ob es nicht eventuell richtig sei, das Grundgesetz zu ändern, so dass auch in Deutschland Embryos für Medikamente verwendet werden können. Sie waren dagegen. Dann fragte ich, wie sie sich im Falle einer Leukämieerkrankung ihrer selbst oder bei einem ihrer Angehörigen verhalten würden, wenn es zum Beispiel die Möglichkeit gäbe, etwa auf dem asiatischen Markt entsprechende Mittel zu erwerben. Sie sagten alle, dass sie dann ein solches Mittel kaufen würden. Sie sehen, Ethik und Heuchelei liegen sehr eng beieinander, und wir können froh sein, wenn wir selber nicht in Versuchung geführt werden. Aber ich glaube gerade deshalb, dass die neuen Forschungen und Praktiken die ethischen Fragen verschärfen werden. Der Gesetzgeber wird wahrscheinlich dem Mainstream folgen und sich vergleichsweise liberal geben. Und um so lauter – vielleicht nicht lauter, aber vernehmbarer und deutlicher – werden Stimmen wie die von Robert Spaemann zu hören sein, die sagen: "So etwas tut man nicht." Individualisierung heisst auch, dass man sich nicht auf staatlich gesetzte Normen stützt, sondern dass der Staat nur noch das ethische Minimum vertritt und der einzelne versuchen muss, daraus sein ganz persönliches ethisches Maximum zu machen. Ich weiss, das klingt sehr idealistisch, aber es ist überhaupt nicht idealistisch. Denn je mehr angeboten wird, desto genauer müssen wir uns fragen, ob uns diese Angebote wirklich weiterhelfen. Und diese Fragen können wir nur beantworten, wenn wir prüfen, wie wir uns und die Welt sehen. Wenn wir in der Welt nur wenig zu erkennen vermögen, dann werden wir unsere Wünsche überschätzen. Dann werden wir in die paradoxe Situation kommen, in einem Embryo nur einen Zellhaufen zu erkennen, um dann allerdings zu erwarten, dass dieser Zellhaufen uns eines Tages das grosse Glück beschert. Sei es als Medikament, sei es als Mensch, für den viel Aufwand betrieben und gezahlt worden ist. Ich möchte noch bei dieser eigentümlichen Dialektik verweilen. Um unsere Wünsche zu erfüllen, muss die Welt depotenziert werden. Wir können auch sagen, erst eine reduktionistische Sicht eröffnet uns die Möglichkeit schrankenloser Eingriffe. Der Mensch muss zur Sache werden, damit man ihn mit gutem Gewissen für seine Zwecke einsetzen kann. Als die Deutsche Forschungsgemeinschaft kürzlich ihre bisherige Linie verliess und sich für die verbrauchende Embryonenforschung aussprach, konnte man im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nachlesen, jetzt sei ein Rubikon überschritten worden. Und mit grossem Scharfsinn wurde die Argumentation der DFG zerpflückt. Denn einerseits äusserten die Vertreter der DFG selber Zweifel daran, dass die Erwartungen in neue Therapien wirklich begründet sind. Auf der anderen Seite hielten sie sie aber für "nicht unbegründet". Allein die Tatsache, dass die Aussichten auf ganz neue Heilungschancen "nicht unbegründet" sind, rechtfertigt also nach Auffassung der DFG die Auflösung jenes Prinzips, nach dem Embryonen nicht wie Sachen, sondern wie Personen mit ihrer Unantastbarkeit zu behandeln sind. Damit ist in der Tat der Rubikon überschritten, und man hat ein anderes Ufer der Argumentation erreicht. 22 Denn von nun an haben sich die Begründungen umgekehrt. Musste man früher begründen und rechtfertigen, warum man sich in die Nähe des menschlichen Quellcodes bewegen oder gar in ihn eingreifen oder ihn gegebenenfalls auslöschen wollte, so muss man jetzt begründen, warum man es nicht tut, warum man also nicht alles für künftige Erfolge einsetzt. War vorher jedes menschliche Leben vom Anbeginn an mit einer Würde ausgestattet, die es im Prinzip als unantastbar erscheinen liess, so ist es heute umgekehrt. Im Prinzip ist das Leben antastbar, und man muss begründen, ab wann man so etwas wie eine Würde annehmen will, die der Antastbarkeit Grenzen setzt. Ich hatte schon angedeutet, dass das kollektive Bewusstsein sich unterschwellig mit dieser Frage auseinandersetzt, wenn es parallel zur Diskussion um die PID die Frage nach der Sterbehilfe stellt. Es hat gespürt, dass der Mensch von nun an nur noch Würde auf Zeit besitzt. Irgendwann nach der PID ist seine Umwelt der Meinung, dass eine unantastbare Würde vorhanden ist, und eines Tages, wenn seine geistigen und körperlichen Kräfte zu wünschen übrig lassen, ist auch die Würde dahin. Die Würde ist also einer Art Accessoire, das sich kürzer beim Menschen aufhält, als seine reale Existenz dauert. Mit diesem Perspektivenwechsel handelt sich die Gesellschaft wohl mehr Fragen ein, als sie beantworten kann. Der viel gescholtene Peter Sloterdijk hat vor kurzem Zweifel daran geäussert, dass man wirklich vom Fortschritt sprechen kann, wenn uns eben dieser Fortschritt auf anderer Ebene mehr Probleme bereitet, als wir lösen können. Aber man kann auch fragen, ob dieser Fortschritt vermeidbar ist. Ich mute Ihnen jetzt also noch einen Perspektivenwechsel zu. Ich behaupte nicht, dass der Fortschritt unvermeidbar ist, ich stelle lediglich diese Frage. Dafür gibt es einen persönlichen Grund: In meinem Freundeskreis gibt es ein paar Leute, die sich leidenschaftlich für die Weiterentwicklung der Gentechnik einsetzen. Und ich kann deren Argumente verstehen, so gross auf der anderen Seite meine Zweifel auch sind. So spricht der Physiker und Philosoph Bernd-Olaf Küppers davon, dass wir aus der "Evolutionsfalle" heraus müssten. Es gehe jetzt um eine "Befreiung von der Natur". Er meint damit, dass wir die Mittel unserer technisch-wissenschaftlichen Kultur dazu benutzen sollten, um jene Möglichkeiten, die die Natur nicht realisiert hat, erst einmal kennen zu lernen. Die Evolution, so Küppers, habe jeweils ganz bestimmte Möglichkeiten auf Kosten anderer realisiert. Sie ist also durch und durch historisch. Genauso, wie wir im Bereich der Kultur gelernt haben, historisch Gegebenes nicht einfach hinzunehmen, sondern zu verändern, müssten wir jetzt anfangen, die historische Bedingtheit der Natur zu durchschauen und nach neuen Möglichkeiten abzusuchen, indem wir selbst evolutionäre Schritte ausprobieren, die die Natur selbst nicht gegangen ist. Nicht ganz so grundsätzlich, aber ähnlich argumentiert der Salzburger Herzchirurg Felix Unger, der der katholischen Kirche sehr nahe steht und hohe kulturelle Ämter innehat. Es sieht in der Anwendung unseres Wissens und Könnens auf die Lebensentstehung die logische Fortsetzung der Entwicklung der Wissenschaft. Und wenn ich ihn recht verstehe, dann vergleicht er Überschreitung des Rubikon mit den Veränderungen unseres Weltbildes, wie sie von Zeit zu Zeit immer wieder wissenschaftliche Entwicklungen begleitet haben bzw. deren Folgen waren. Eindringlich warnt er die katholische Kirche davor, wieder die Fehler zu machen, die sie gegenüber der Naturwissenschaft häufiger 23 begangen hat. Vielmehr meint er, dass es geradezu Pflicht der Kirche sei, sich den Chancen der neuen Techniken zu öffnen. Gleichwohl bleibt die Schwierigkeit, dass die Würde des Geschöpfes nicht mehr durch die Unantastbarkeit ausgedrückt wird. Unger legt die Würde sozusagen eine Stufe höher. Es sieht sie nicht dadurch gefährdet, dass Menschen in den Quellcode des Lebens eingreifen. Vielmehr sieht er hierin eine Fortsetzung der Schöpfung, indem der Mensch nun selber schöpferisch tätig wird. Dies ist ein neues Glaubens- und Weltbild. Und wie alles wirklich Neue erfüllt es einen mit einem gewissen Schaudern. Sehr treffend hat der Soziologe Peter Gross formuliert: "Das Neue ist dadurch neu, dass es neu ist." Und so kann es durchaus sein, dass die Überschreitung des Rubikon lediglich ein subjektives Krisensymptom ist, das mit der Entwicklung des Neuen so unvermeidlich einher geht wie das Fieber mit der Grippe. Das würde bedeuten, dass man die ethischen Bedenken nicht überbewerten sollte, weil sie einem Weltbild angehören, das zu überwinden wir uns gerade anschicken. Und um diesem Argument noch eines draufzugeben, oder, wie man neuerdings sagt, um es zu "toppen", liesse sich anführen, dass wir nicht wissen können, nach welchen Kriterien unsere Nachkommen urteilen werden. Allerdings liesse sich dagegen das Argument ins Feld führen, dass sich der Mensch in seinem Kernbereich nicht so stark ändert, wie manche das gerne möchten. Gleichwohl müssen wir davon ausgehen, dass die Werte, die einigen von uns heute lieb und teuer sind, eines Tages eine geringere oder gar keine Rolle mehr spielen. Nicht ohne Grund habe ich angedeutet, dass Bernd-Olaf Küppers und Felix Unger Freunde sind. Befreundet sein kann man nur mit Menschen, deren Grundeinstellungen man irgendwie teilt. Allerdings werden Sie meine Skepsis in Bezug auf die neuen Entwicklungen herausgehört haben. Wie verträgt sich diese nun mit der Freundschaft zu Menschen, die diese Skepsis so nicht haben? Übe ich da nicht Verrat an mir selbst beziehungsweise an meinen Überzeugungen? Ich weiss es nicht genau. In den Gesprächen vertrete ich meine Skepsis, und gerade Bernd-Olaf Küppers musste es mehrfach erleben, dass ich mich in Radiosendungen, die ich zusammen mit ihm produziert habe, auf die Seite seiner Kontrahenten geschlagen habe. Aber diese Antwort allein genügt noch nicht. Vielmehr muss ich auch zugeben, dass mich die Wette, für die die beiden eintreten, auch irgendwie fasziniert. Der Mensch ist eben nicht immer logisch, er vertritt nicht nur eine Meinung, sondern hört, wenn er aufmerksam ist, mehrere Stimmen in sich. Und so habe ich die Stimme des konservativen Ethikers ebenso in mir wie die, die vom Fortschritt fasziniert ist und ihre Neugier schlecht verbergen kann. Und, so seltsam das klingt, da schwingt auch ein bisschen die Resignation mit. Die besteht in der Einsicht, dass das technisch Machbare nicht zu verhindern ist – am allerwenigsten mit feinsinnigen ethischen Argumenten. Mit Recht werden Sie sich fragen, weswegen ich jetzt etwa 30 Minuten geredet habe, um Ihnen das mitzuteilen. Hätte ich gleich am Anfang gesagt, dass die Dinge sowieso kommen wie sie kommen, hätte ich mir die ganzen ethischen Fragen und Überlegungen sparen können. Aber ist das wirklich so? Stimmt diese Alternative? Könnte es nicht auch so sein, dass die ethischen Fragen einfach notwendig sind, auch wenn sie gewisse Dinge nicht zu stoppen vermögen? Albert Schweitzer hat einmal gesagt: "Das gute Gewis24 sen ist eine Erfindung des Teufels." Vielleicht dienen ethische Fragen auch dazu, Dinge zwar nicht zu verhindern, sie aber mit etwas mehr Nachdenklichkeit voranzutreiben. Das ist wenig, gewiss. Aber stellen Sie sich vor, es gäbe diese skeptischen Fragen nicht. Würde dann den Forschern nicht selbst angst und bange werden? Eine letzte Frage: In Deutschland hat sich die CSU gerade auf ein Nein zur PID festgelegt. Diese, so sagt der bayerische Ministerpräsident, verstosse eindeutig gegen das christliche Menschenbild. Ist diese Haltung, so wie sie vorgetragen wird, nicht sehr gefährlich? Es ist doch jetzt schon zu erkennen, dass die PID kaum aufzuhalten sein wird. Man wird ein paar Kautelen wie z. B. den Verdacht auf schwere Erbkrankheiten aufgrund entsprechender Vorbelastungen einführen, aber die PID wird kommen. Wäre es da ethisch nicht vernünftiger, anders zu argumentieren: "Wir haben grosse Zweifel daran, dass sich die PID mit unseren christlichen Überzeugungen verträgt. Wir werden diese Zweifel wieder und wieder vortragen, aber wir erkennen auch, dass es andere Menschen mit anderen Überzeugungen gibt. Wir halten diese Überzeugungen für falsch. Dies werden wir deutlich machen. Dies soll aber nicht auf dem Wege von Verboten geschehen, sondern umgekehrt. Wir möchten uns darum bemühen, unser Menschenbild so anschaulich wie möglich zu machen, damit unsere ethischen Begriffe und Werte mit Leben erfüllt werden." 25 3. Die Unsicherheit wächst – was sollen wir tun? (GEF-Diskussion vom 8. Dezember 2001) Diese Veranstaltung der GEF orientierte sich an einem neuen Konzept, das neben dem Plenum auch Arbeitsgruppen für eine vertiefende Diskussion vorsah. Dies erschien besonders wichtig aufgrund des Themas, dass im Herbst 2001 ausserordentliche Brisanz hatte und weit herum grosse Betroffenheit auslöste. Die insgesamt gelungene Veranstaltung war für den Vorstand in der Vorbereitung und Durchführung mit einem besonderen Schatten belegt. Traurige Aktualität erhielt das behandelte Thema durch den Anschlag in Zug, von dem unser Präsident betroffen war, was den Vorstand tief berührt hat. In diesem schwierigen Moment haben wir keine Texte verfasst. Einen Einblick in die Veranstaltung gewährt daher lediglich das Programm. Programm 09.30 – 09.55 Begrüssungs-Kaffee 10.00 – 10.50 Begrüssung Thesen zum Alltag – Donata Schöller-Reisch, Philosophin, Mutter Thesen zur Wirtschaft – Beat Rüegger, Arzt/Sicherheitsexperte Swissair Thesen zur Politik – Vreni Wicky, Stadträtin und Kantonsrätin Zug 11.00 – 12.00 Erfahrungen mit der Unsicherheit – Diskussion in Gruppen Alltag – Moderation Stefan Grotefeld, Theologe Wirtschaft – Moderation Stephan Wehowsky, Philosoph Politik – Moderation Ursula Renz, Philosophin 12.00 – 13.30 Mittagessen 13.30 – 14.00 Unkorrekte Gedanken – Stephan Wehowsky, Philosoph 14.00 – 15.30 Haltsuche in der Haltlosigkeit – Annemarie Pieper, Philosophin Diskussion moderiert von Erwin Koller, Redaktionsleiter SF DRS 26 4. Ethik oder Ästhetik? Divergente Zugänge zu Fragen der Moral von Ursula Renz (GEF-Referat an der Mitgliederversammlung vom 6. Mai 2002) Als in den 80er Jahren auch im deutschsprachigen Raum die Rede vom Ende der Moderne oder von der Postmoderne laut wurde, brachten findige Philosophen ihre Aussagen unter dem Label des ästhetischen Denkens unter die Leute. Dieses ästhetische Denken rückte allerdings nicht einfach die Frage der Kunst ins Zentrum, sondern verstand sich als eine Diagnostik von Gegenwartsproblemen. Im Stichwort des ästhetischen Denkens verbinden sich im Grunde genommen drei Dinge: Erstens eine These, zweitens ein Werturteil und drittens ein methodisches Postulat. Die These lautet, dass die postindustrielle Gesellschaft in ein ästhetisches Stadium getreten sei.3 Das Werturteil besteht darin, dass dieser Eintritt in das ästhetische Stadium als gut oder wünschenswert eingeschätzt wird. Das methodische Postulat schliesslich basiert auf der Annahme, dass ein Denken, das die Ästhetik zu ihrer Leitdisziplin mache, den Problemen und Phänomenen der postindustriellen Gesellschaft am ehesten gerecht werden könne. Diese Diskussion ist mittlerweilen in den Hintergrund getreten. In der Öffentlichkeit macht die Philosophie nicht mehr primär durch Gesamtbetrachtungen zur neuen Unübersichtlichkeit von sich reden, sondern eher durch ihre Stellungnahmen zu Problemen der angewandten Ethik. Die Grundfragen, die mit dem ästhetischen Denken der 80er Jahre verbunden sind, bleiben allerdings bestehen. Nach wie vor stellt sich die Frage, wie viel und was genau ästhetisches Denken in der post- oder spätmodernen Gesellschaft zu leisten vermag. Von Interesse ist dabei insbesondere das Verhältnis ästhetischer Erfahrung zur Ethik. Ist die ästhetische Erfahrung eine Unterstützung, eine Ergänzung oder – wie es der Titel suggeriert – eine Konkurrenz der Ethik? Diese Frage möchte ich im Folgenden anhand von drei Themen diskutieren. Als erstes möchte ich der Frage nachgehen, wie wir in unseren Wahrnehmungen auf moralische Probleme reagieren. Zweitens werde ich den Begriff der Kontingenz, auf den sich das ästhetische Denken vermehrt beruft, klären und systematisch verorten. Unter dem Stichwort der ästhetischen Verführung werde ich als drittes der Frage nachgehen, inwiefern die ästhetische Erfahrung selbst ein spezifisch ethisches Problem – nämlich jenes von Täter- und Opferidentifizierung – aufwirft. 1. Verhältnis von Wahrnehmung und Moral Das ästhetische Denken basiert auf der Voraussetzung, dass Ästhetik ein Zugang zur Moral, zu den Werten und Orientierungen einer Gesellschaft sein kann. An diese Voraussetzung sind zwei Fragen zu richten: Erstens haben Wahrnehmungen überhaupt mit Moral zu tun? Selbstverständlich stellen Wahrnehmungen einen möglichen Zugang zur 3 Wolfgang Welsch (Hrsg.): Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. Einleitung S. 40f., Weinheim 1988. 27 Moral dar. Das lässt nicht sich bestreiten, wenn man sich beispielsweise in Erinnerung ruft, welche Entrüstung avantgardistische Kunstwerke zu Beginn des letzten Jahrhunderts auszulösen pflegten. Wenn ein Affekt unbestritten moralischer Natur ist, dann dürfte dies Entrüstung oder Empörung sein. Dabei ist bemerkenswert, dass wir uns über Dinge empören können, die uns direkt gar nichts angehen, sondern „nur“ unser moralisches Selbstverständnis in Frage stellen. Das gilt m. E. auch für die Reaktion der Entrüstung bei der Kunst. Wenn Bilder, Romane oder andere Kunstwerke Entrüstung auslösen, dann hat das nicht so sehr damit zu tun, dass sie gegen ästhetische Normen verstossen, sondern vielmehr damit, dass sie moralisch empfindliche Bereiche tangieren, beispielsweise indem sie einen ästhetischen Zugang zu einem moralischen Problem wählen, oder indem sie moralische Schutzzonen in Frage stellen. Wir können also festhalten, dass ästhetische Wahrnehmungen nicht einfach in einem moralisch indifferenten Raum operieren, sondern in einem Netz gesellschaftlich sanktionierter Normen operieren und die Reflexion auf unsere Wahrnehmung durchaus auch die moralische Verfasstheit einer Gesellschaft zu erfassen vermag. Daran schliesst sich nun aber eine zweite Frage an: Stellt die Ästhetik als solche das analytische Instrumentarium dar, um diese Zusammenhänge von Wahrnehmung und moralischem Selbstverständnis aufzuschlüsseln? Meines Erachtens ist dies nur bedingt möglich. Das zeigt nicht zuletzt das oben bereits genannte Beispiel der Entrüstung gegenüber Kunstwerken. Wir empören uns über Kunst, wo sie in einem moralischen Sinn gegen den guten Geschmack verstösst. Im Gegensatz dazu ist das eigentlich ästhetische Moment gegen Empörung seltsam immun. Wo wir etwas unter rein ästhetischen Vorzeichen wahrnehmen können, bleiben wir moralischen Tabubrüchen gegenüber kühl. Auf ästhetisch strittige Kunstwerke reagieren wir nicht mit Entrüstung, sondern eher mit der Frage, was denn das noch mit Kunst zu tun habe. Allerdings ist die ästhetische Rezeption sehr leicht verdrängt, wo moralische Probleme aufwarten. Das liess sich an den Reaktionen auf den Roman von Martin Walser Der Tod des Kritikers sehr schön ablesen. Hier verdrängte das moralische Problem die ästhetische Diskussion. Es war der Antisemitismus-Vorwurf und nicht eine streitbare Qualität des Textes, der die Gemüter erhitzte.4 Ebenso empörten wir uns über die Werbungen von Benetton, nicht weil sie ästhetisch nicht gelungen wären, sondern weil sie uns moralisch zuwider sind. Der gute Geschmack, gegen den bei dieser Werbung verstossen wurde und auf den wir uns beim Protest dagegen berufen, ist gerade nicht der ästhetische Geschmack. Meine erste These, mit der ich diesen ersten Themenkomplex abschliessen möchte, lautet daher: Wahrnehmungen können unser moralisches Selbstverständnis tangieren. Genau dieses Moment in der Wahrnehmung ist allerdings nicht eine Frage der Ästhetik, es weist vielmehr darauf hin, dass Wahrnehmungen per se moralisch nicht indifferent sind. Wahrnehmungen gehören nicht ausschliesslich in die Domäne der Ästhetik. 4 Vgl. dazu klärend Andreas Isenschmid in der NZZ am Sonntag vom 2. Juni 2002, S. 21 sowie Roman Bucheli in der NZZ vom 6. Juni 2002, S. 57. 28 2. Kontingenz Das ästhetische Denken der Postmoderne zeichnet sich u. a. dadurch aus, dass es sich einen Themenkomplex zu eigen macht, den ich unter das Stichwort der Kontingenz, der Zufälligkeit, rücken möchte. Hinter dem Interesse des ästhetischen Denkens an der Kontingenzthematik stehen ganz verschiedene Motivationen. Einerseits drückt sich in der Zuwendung zur Kontingenz ein historisches Selbstverständnis des ästhetischen Denkens aus. Die Postmoderne begreift sich geschichtsphilosophisch als eine Zeit, die sich der grundsätzlichen Kontingenz der eigenen Werte bewusst geworden ist. Das radikale Bekenntnis zur Pluralität, das sie verkündet, setzt die Einsicht in die grundsätzliche Zufälligkeit moralischer und lebensweltlicher Orientierung unweigerlich voraus. Andererseits ist Thema der Zufälligkeit aber auch mit der Beachtung singulärer Gesetzlichkeiten verbunden. Das ästhetische Denken, das sich als ein Exerzitium des Pluralismus versteht, ist der Eigenlogik singulärer Phänomene verpflichtet. Diese Eigenlogik mag in sich stimmig und schlüssig sein, doch im Hinblick aufs Ganze erweist sie sich als höchst zufällig und arbiträr. Die ästhetische Zuwendung zum Singulären bringt so gesehen die Einsicht in die Zufälligkeit auch hervor. Diese Akzentuierung der Zufälligkeit hat nun m. E. sehr spannende, aber auch schwierige und heikle Seiten. Spannend ist, dass ganz zentrale Momente ästhetischer Erfahrung neu begreifbar werden. Ästhetische Erfahrung zeichnet dadurch aus, dass sie als solche nicht unmittelbar unserer Selbstbestimmung unterstellt ist. Ästhetische Erfahrung ist gerade nicht eine Frage der Selbstmacht. Das hängt mit zwei Charakteristiken zusammen: Zum einen kann sie uns in hohem Masse unseren Gefühlen ausliefern. Sie kann uns überwältigen, sie kann uns aber auch verführen, uns suggerieren, was zu geniessen ist. In der ästhetischen Erfahrung verfüge ich weder in negativer noch in positiver Hinsicht über mich, sie unterliegt nur sehr bedingt meinem eigenen Willen. Sie kann in mir etwas auslösen, das ich nicht will, und sie kann umgekehrt sogar, wenn sie, wie im Falle guter Werbung, geschickt initiiert ist, bestimmen, was ich zu meinem Willen erkläre. Ästhetische Erfahrung ist daher häufig mächtiger als unser eigener Wille. Zum andern aber ist ästhetische Erfahrung in hohem Masse eine Frage der Phantasie. Was wir ästhetisch geniessen, muss nicht immer und nicht primär das sein, was wir sehen. Häufig geniessen wir die einen Eindruck begleitenden Vorstellungen mindestens ebenso sehr wie den Eindruck selbst. Ein gutes Kunstwerk ist daher eines, das unsere eigenen Imaginationen in Gang setzt und ihnen gleichzeitig einen gebührlichen Raum offen lässt. Diese beiden Momente der ästhetischen Erfahrung, die Nähe zu den Gefühlen und die Nähe zur Phantasie, eröffnen uns nun in der Tat einen ganz neuen Zugang sowohl zur Wirklichkeit wie auch zu uns selbst. Da sie mit unseren Gefühlen arbeitet, trägt sie die Wirklichkeit näher an uns heran. Gerade auf dieser Ebene kann Kunst immer auch aufklärerische Wirkung haben. Kunst kann uns leiden machen an der Not in dieser Welt. Indem die ästhetische Erfahrung an die Phantasie anschliesst, sprengt sie aber auch unsere begrifflichen Raster. Sie hinterfragt das Gewöhnliche. Phantasie lädt ein zur Fiktion und zur Überlegung, dass es in unserer Welt noch ganz anders sein könnte. Über diese beiden Kanäle kann uns die ästhetische Erfahrung insbesondere in der Kunst die 29 Kontingenz unserer Lebensumstände wie auch grundlegender Zusammenhänge unserer Weltanschauungen unmittelbar erfahrbar machen. Von der ästhetischen Erfahrung her ist der Bezug ästhetischen Denkens auf das Thema der Kontingenz also sehr wohl nachzuvollziehen. Trotzdem frage ich mich, ob das Thema der Kontingenz im ästhetischen Denken gut aufgehoben ist. Kontingenz mag ästhetisch erfahrbar sein und sich in der ästhetischen Erfahrung erschliessen, doch sie ist im Grunde genommen kein ästhetisches Problem. Sie ist vielmehr, so möchte ich annäherungsweise formulieren, eine Frage der Standpunktgebundenheit menschlicher Existenz. Damit meine ich, dass wir nicht vollständig und nicht prinzipiell davon absehen können, dass wir als Menschen einen je individuellen und historischen Ort haben, von dem wir ausgehen und auf den wir in entscheidenden Situationen zurückgeworfen sind. Dieses Faktum spielt natürlich in unsere ästhetische Erfahrung hinein und bestimmt sie nachhaltig. Es bestimmt aber auch ganz andere Bereiche unseres Daseins und es markiert nicht zuletzt auch eine prinzipielle Begrenztheit unseres theoretischen Horizonts. Wir können unser theoretisches Wissen nicht beliebig vergrössern. Wir haben zwar sehr wohl viele gesicherte Kenntnisse, auf denen wir aufbauen und die wir erweitern können, doch wir haben nie den totalen Blick auf das Ganze. Selbst wenn wir uns den theoretischen Blick aufs Ganze vorstellen könn(t)en, so gibt es doch keinen Standpunkt, den wir einnehmen könnten, von dem aus sich dieser Blick eröffnen würde. Aus demselben Grund können wir auch nie hinter uns selber kommen. Der Standpunkt, von dem aus wir uns erkennen, kann nicht unser Standpunkt sein. Zu einem drängenden Problem scheint das Thema der Kontingenz allerdings dort zu werden, wo es mit moralischen Fragen verknüpft ist. Grundsätzlich scheint mir die Auseinandersetzung mit Kontingenz für die Ethik nicht weniger prägend, als für das ästhetische Denken. Ich würde sogar behaupten, dass die Ethik einen nicht unwichtigen Teil ihres spezifisch ethischen Problembewusstseins aus der Einsicht in die Standpunktgebundenheit menschlicher Existenz gewinnt.5 Es gibt ein Beispiel, an dem sich das sehr 5 An dieser Stelle möchte ich kurz auf Fragen eingehen, die im Anschluss an meinen Vortrag von zwei professionellen Ethikern aufgeworfen wurden. Die Lektüre ist aber auch für Nicht-Profis von Belang. Stefan Grotefeld stellte mir die Frage nach dem Ethikbegriff, Stefan Streiff forderte mich mit der Bemerkung heraus, dass ich der Ästhetik sämtliches Reflexionspotential abspreche. Was Ethik genau ausmacht, darüber streiten sich selbst die professionellen Ethiker. Ich denke, dass ich bis zu diesem Punkt meiner Ausführungen nicht mit einem strittigen Ethikbegriff operiert, mich aber mit einem minimal bestimmten Ethikbegriff begnügt habe. Dieser minimal bestimmte Ethikbegriff lässt sich anhand folgender Voraussetzungen ausdeutschen. Erstens gehe ich davon aus, dass Ethik nicht mit Moral gleichgesetzt werden kann, sondern auf eine Reflexion über Moral abzielt. Kein Ethiker wird das bestreiten wollen. Daran schliesst sich als zweite Voraussetzung an, dass nicht jedes Nachdenken über Moral Ethik ist, sondern nur jenes, das seine Grundlagen u. a. einer systematischen Reflexion darüber verdankt, was ein Problem zu einem moralischen Problem macht. Auch damit ist noch keineswegs hinreichend bestimmt, was Ethik genau zu tun hat, doch dürften wohl die meisten modernen Ethiker auch dieser Bestimmung als einer notwendigen Voraussetzung zustimmen. Das streitbare Moment meiner Ausführungen dürfte daher genau in der oben formulierten Behauptung liegen, dass die Einsicht in die Kontingenz menschlicher Lebensumstände für die Entwicklung eines ethischen Problembewusstseins von grosser Bedeutung ist. Diese Behauptung möchte ich allerdings ebenfalls nicht als systematische Bestimmung, was ein moralisches Problem ausmacht, verstanden wissen, sondern als Antwort auf die Frage, wodurch sich ein ethisches Problembewusstsein gegenüber einem ästhetischen auszeichnet. 30 schön zeigen lässt, und das ist die Frage der Armut.6 Eine ethische Reflexion auf das Problem der Armut setzt voraus, dass ich Armut unter dem Gesichtspunkt einer nie gehabten Chancengleichheit begreife. Das impliziert unter anderem, dass ich mir klar mache, dass der Arme an seiner Armut prinzipiell nicht schuld ist. Es gibt nur historische, soziale, geographische Ursachen dafür, dass er arm ist, es gibt aber keine rationalen Gründe, die seine Armut in irgendeiner Weise zu rechtfertigen vermöchten. An diese Einsicht in die rationale Grundlosigkeit der Armut können verschiedene, mehr oder weniger auf Eigenverantwortung aufbauende, sozialethische oder ökonomische Lösungsvorschläge anschliessen. Für die Frage eines ethisch zu rechtfertigenden Umgangs mit dem Problem ist es aber unabdingbar, dass die grundsätzliche Kontingenz des Armseins anerkannt wird. Sonst fällt man unweigerlich in ein archaisch mythologisierendes Denken zurück. Der ethische reflektierte Umgang mit dem Phänomen der Armut setzt daher bei der Frage an, wie ich Armut denke. Das Beispiel der Armut ist für die Frage, wie wir die Kontingenz menschlichen Daseins denken sollen, höchst aufschlussreich. Kontingenz erweist sich an diesem Beispiel als rationale Grundlosigkeit. Es ist zwar nicht einfach zufällig, dass die Verhältnisse so und nicht anders sind, trotzdem gibt es aber keine Rechtfertigung dafür, dass sie so sind. Es gibt zwar empirische Ursachen, aber keine rationalen Gründe dafür. Genau dies ist nun aber auch der Grund, weshalb ich der Ansicht bin, dass die Kontingenz als philosophisches Thema beim ästhetischen Denken schlecht aufgehoben ist. Eine ästhetische Erfahrung kann uns zwar die historische Standpunktgebundenheit unserer Existenz exemplarisch vor Augen führen. Jenes ästhetische Denken jedoch, dass sich dieser exemplarischen Erfahrung annimmt, ist von sich aus schlecht gerüstet für die gedankliche Auseinandersetzung mit der Kontingenz, und zwar genau deshalb, weil es den Unterschied zwischen empirischen Ursachen und rationalen Gründen nicht zur Verfügung hat. Auf sich allein gestellt kann die Ästhetik die rationale Grundlosigkeit der Kontingenz unserer Erfahrung nicht von der Empirie der faktischen Ursachen unterscheiden. Aus diesem Grund ist für den Umgang mit der Kontingenz, mindestens sofern sie das menschliche Zusammenleben belastet, ein ethisches Denken gefragt und nicht ein ästhetisches. Zum Schluss dieses zweiten Kapitels möchte ich auch die vorangegangenen Überlegungen in einer These zusammenfassen: Ästhetische Erfahrung kann uns die Kontingenz der eigenen Welt erfahrbar machen. Das Problem der Kontingenz ist aber kein genuin ästhetisches Problem, sondern eine Frage der Standpunktgebundenheit menschlicher Existenz. Als solche ist sie aber bei Vor dem Hintergrund der oben genannten Voraussetzungen lässt sich auch die Frage nach der Reflexionskraft der Ästhetik genauer lokalisieren. Was ich der Ethik – oder genauer: der Metaethik – vorbehalten möchte, ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als das systematische Nachdenken darüber, was ein moralisches Problem ausmacht. Vor diesem Hintergrund wird die im Titel angesprochene Gegenüberstellung von ethischem und ästhetischem Zugang zu Fragen der Moral erst brisant. Es geht dabei weder um die Frage, ob ästhetische Erfahrung ein moralisches Problem aufspüren kann, noch um die Frage, ob die Ästhetik ein Reflexionspotential in Hinblick auf moralische Probleme bereitstellen kann, sondern um die Frage, ob die Ethik im ästhetischen Denken eine systematische Grundlage ihrer eigenen Tätigkeit finden kann. Letzteres möchte ich verneinen. 6 Vgl. dazu auch Ursula Renz, Die Rationalität der Kultur. Kulturphilosophie und ihre transzendentale Begründung bei Cohen, Natorp und Cassirer. Hamburg 2002, S. 276ff. 31 der Ethik besser aufgehoben als bei der Ästhetik. Denn nur die Ethik hat das analytische Instrumentarium zur Verfügung, um den Mangel rationaler Gründe von der Empirie der faktischen Ursachen zu unterscheiden. 3. Ästhetische Verführung Ich möchte zum Schluss noch ein Thema ansprechen, das sehr zentral in diesen Zusammenhang gehört, aber recht schwierig zu fassen ist und mir auch noch nicht gänzlich klar ist. Es geht um das Problem der ästhetischen Verführung. Was damit gemeint ist, soll in den folgenden Ausführungen über ein paar Umwege erarbeitet werden. Die Postmoderne hat den Vorrang der Ästhetik für das Begreifen der heutigen Wirklichkeit u. a. damit begründet, dass die Wirklichkeit in der heutigen Mediengesellschaft massgeblich ästhetisch konstituiert sei.7 Dieser Punkt ist keineswegs veraltet, im Gegenteil. Im Zeitalter, wo jede Firma, ja bald jede Privatperson ihren optisch überzeugenden Internet-Auftritt haben muss, wo aber auch Fernsehen, Videos und Computerspiele die Wirklichkeitsauffassungen vieler Jugendlicher nachhaltig prägen, muss die Frage nach dem Verhältnis von Ästhetik und der Wahrnehmung von Wirklichkeit nach wie vor brennend interessieren. Ich möchte dabei nun allerdings nicht beim Problem der Wahrnehmung von Wirklichkeit ansetzen, sondern nochmals von einer Reflexion auf die ästhetische Erfahrung ausgehen. Es gibt nämlich, zusätzlich zu den beiden bereits angesprochenen Charakteristika ästhetischer Erfahrung, dass sie Gefühle auslösen kann und dass sie auf unsere Phantasie abstellt, noch ein drittes wichtiges Moment. Ästhetische Erfahrungen evozieren eine erhöhte Aufmerksamkeit für einen selber. Kant hat in diesem Zusammenhang das ästhetische Urteil auch als ein Reflexionsurteil bezeichnet. Ästhetische Erfahrung ist eine reflexive Erfahrung. Das lässt sich etwa am Beispiel der Ironie deutlich machen: Wir schätzen Ironie nur soweit, als wir uns im sicheren Gefühl wähnen, dass wir sie bemerkt und richtig verstanden haben. Die Entdeckung, dass wir eine ironische Bemerkung nicht als solche aufgefasst haben, ist uns hingegen eher peinlich. Die Ästhetik der Ironie setzt daher gewissermassen den souveränen Ironiker voraus. Das reflexive Moment ästhetischer Erfahrung lässt sich aber auch am Geniessen einer sorgfältig zubereiteten Mahlzeit aufzeigen. Wir geniessen diese Mahlzeit nicht aus blosser Lust am Essen, sondern aus Lust am Geniessen. Eine ästhetische Lust ist nicht eine blosse Lust am jeweiligen Gegenstand, sondern eine Lust an der Lust. Dieses Moment der ästhetischen Erfahrung, das als solches moralisch völlig indifferent ist, kann nun meines Erachtens vor allem in einem Kontext zu einem nicht ganz harmlosen Problem werden, im Zusammenhang mit dem Verhältnis von Ästhetik und Macht oder Gewalt. Dazu ist zunächst wichtig, sich klar zu machen, dass das Problem der Macht sich weder auf das Verfügen über Mittel noch auf die Frage von Herrschaftsbeziehungen reduzieren lässt, sondern darüber hinaus häufig auch einen Lust-Aspekt hat. Die Frage ist, wie dieser Lust-Aspekt in der ästhetischen Thematisierung von Gewalt zum Tragen kommt. Grundsätzlich kann Macht oder Gewalt in der ästhetischen Erfah7 Welsch, a. a. O., S. 41. 32 rung auf zwei Ebenen präsent sein: auf der Ebene des Gegenstandes wie auch auf der Ebene des Mediums. Das ist insbesondere beim Film augenfällig. Es werden nicht nur Macht und Ohnmachtsverhältnisse oder aber Gewaltereignisse gezeigt, sondern die Kamera selbst nimmt eine Position der Macht ein, oder genauer: der Allmacht. Dem Zuschauer wird dadurch ein doppeltes Identifikationsangebot gemacht. Er wird sich nicht nur mit einer der dargestellten Figuren identifizieren, sondern macht sich – mehr oder weniger bewusst – den allmächtigen Blick der Kamera zu eigen, der seine eigene Aufmerksamkeit steuert, ob er will oder nicht. Die spezifische Ästhetik des Films liegt u. a. in diesem doppelten Identifikationsangebot begründet.8 Dieses doppelte Identifikationsangebot ist per se nicht problematisch, doch stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob nicht in der Ästhetik der Massenmedien, soweit diese tatsächlich nach ästhetischen Gesetzmässigkeiten funktionieren, ein mit diesem doppelten Identifikationsangebot vergleichbares Moment vorliegt, derart, dass man sich nicht nur informiert und von der Information mehr oder weniger betreffen lässt, sondern sich auch hier mit der imaginären Allmacht des Betrachters identifiziert. Wenn dem so ist, zeigt sich darin eine grundsätzliche strukturelle Beschränkung der Medien, die darin besteht, dass eine Identifikation mit dem Schwächeren leicht und gerne durch die Identifikation mit der Allmacht des Betrachters unterlaufen wird. Es ist dann kaum zu verhindern, dass Gewaltdarstellungen in den Medien mit einer Lust an der fiktiven Allmacht des Betrachters einhergehen. Unabhängig davon, ob dieses Moment in den Medien selbst auch tatsächlich spielt, ist auf jeden Fall klar geworden, worin die Verführung des Ästhetischen liegt. Sie besteht darin, dass wir uns imaginär immer auch auf der Seite der Allmacht wähnen. Ein Denken, dass sich primär auf das Ästhetische verlässt, hat dem gar nichts entgegenzusetzen. Ich möchte auch den dritten Punkt in einer These zusammenfassen: Ästhetische Lust hat die Struktur einer Lust an der Lust. Dieses Moment ästhetischer Erfahrung kann im Zusammenhang mit der Frage nach der Darstellung von Macht und Gewalt zu einem ethischen Problem werden. Abgesehen von der Identifizierung mit dargestellten Tätern und Opfern findet nämlich auch eine Identifikation mit der Allmacht des Betrachters statt. Dieser Identifikation kann nur ein ethisches, nicht aber ein ästhetisches Denken etwas entgegenhalten. Fazit meiner Ausführungen ist also, dass eine ästhetische Diagnose von Gegenwartsproblemen eine ethische Reflexion darauf nicht ersetzen kann. Im Gegenteil, wo man meint, dies zu können, missversteht man die ästhetische Erfahrung ebenso sehr, wie man die ethischen Probleme verkennt. 8 Vgl. dazu auch Christina von Braun: Versuch über den Schwindel. Religion, Schrift, Bild, Geschlecht. Zürich/München 227f. 33 5. Nachträgliche Gerechtigkeit – Die Schweiz und die Apartheid Kann man nachträglich Gerechtigkeit herstellen? (GEF-Club vom 25. Januar 2003) Im Clubgespräch der GEF zum Thema „Nachträgliche Gerechtigkeit“ unter besonderer Berücksichtigung des Apartheidregimes in Südafrika und dessen Beziehungen zur Schweiz zeigte sich eine Offenheit für unterschiedliche Positionen und eine tiefer gehende Diskussion.9 Mit den einleitenden Referaten von Dr. Peter Hug und Mascha Madörin wurde bereits zu Beginn die Verschiedenheit der Blickwickel und der Thematisierung des Phänomens sichtbar. Nicht dass die zwei Positionen – die eines Historikers und die einer Vertreterin der Opfer – die Pole des Meinungsspektrums darstellten und keine Berührungspunkte hatten. Aber es wurde offensichtlich, dass der Umgang der Schweiz mit dem südafrikanischen Apartheidstaat die Schweizer mitten in ihrer Identität trifft. Da werden politische Fragen aufgeworfen, welche die Schweiz in letzten 25 Jahren polarisierten. Die Themen Südafrika, Entwicklungspolitik, UNO und Menschenrechte, Neutralität sowie Wirtschaftsbeziehungen stellen aussen- und innenpolitische Konfliktlinien dar. Worüber ist man sich aber nun zu Beginn des 21. Jahrhunderts einig und was bleibt kontrovers? Zuerst lässt sich natürlich immer über Fakten und insbesondere deren Auslegung streiten. In den zwei schriftlich vorliegenden Referaten werden einige Fakten dargelegt. Freilich ist auch die Faktendarstellung nicht losgelöst von der eingenommenen Position. Die Clubrunde war sich explizit und implizit einig, dass eine Faktenaufarbeitung wichtig ist, dass aber die Diskussion nicht beim blossen Faktenstreit stecken bleiben darf. Man war sich auch bewusst, dass im politischen Meinungskampf die Faktenbehauptung und – auslegung trotzdem eine zentrale Rolle spielt. Dies wird für die Auseinandersetzung oft als hinderlich empfunden, da der Eindruck aufkommt, dass es in der öffentlichpolitischen Diskussion nicht um die Sache und deren Lösung sowie um Lern- wie Einigungsprozesse geht, sondern um die Durchsetzung der eigene Meinung. Zudem erscheint es schwierig, mit widersprüchlichen Fakten innen- wie aussenpolitisch umzugehen. Da die Clubrunde die Faktenlage und die Frage nach dem Zugang zu den Fakten nicht weiter vertiefte, wurden keine Details besprochen, in denen bekanntlich der Teufel steckt. Weitgehend einig war man sich im Club darüber, dass die Schweiz im Zusammenhang mit dem Apartheidregime von Südafrika eine besondere Rolle spielte und dass sich daraus eine Betroffenheit – im doppelten Sinn: von und über etwas betroffen sein – und eine Verantwortung ergibt. Es soll nichts entschuldigt werden, das Geschehene war nicht gerecht. Wir Schweizer waren und sind beteiligt und leben im Schatten des Vergangenen. Aber was sind wir? Ein wir, das kollektiv schuldig ist – nein! Ein wir, das für gestern und heute verantwortlich ist, das aus dem gestern für heute lernen muss – ja! 9 Dieser Einleitungstext wurde anhand der Zusammenfassung von Frau Maya Doetzkies zur Clubdiskussion und der Notizen von Esther Kamber verfasst. 34 Und wer sind wir? Wir, das Volk, die Regierung, die Opposition, die Wirtschaft? Vorerst einmal Staatsbürger, die handeln und gestalten können, denn das Volk ist manchmal offener als die Regierung. Alles andere bedarf einer differenzierten, beurteilenden, allenfalls verurteilenden, aber nicht richtenden Betrachtung, denn das befreite Südafrika hat in eindrücklicher Weise gezeigt, was unter schlimmsten Umständen Versöhnung heissen kann. Die Kontroverse entzündete sich an den Mitteln der "Wiedergutmachung" bzw. an der Frage, wie Verantwortung gezeigt und übernommen wird. Mascha Madörin forderte für die Opfer Reparation, Kompensation, Rehabilitation und Satisfaktion. Und sie sieht – wie sie im Beitrag ausführt – in den US-amerikanischen Apartheidklagen ein zentrales Mittel, um dies durchzusetzen. Die Clubrunde sah aber vielerlei Probleme, denn juristische Verfahren können zwar Legalität, nicht aber Legitimität herstellen. Wichtig wäre deshalb nicht nur das Beharren auf juristische Wege, speziell auch auf haftungsrechtliche Fragen, sondern pragmatisch-politische Mittel, die in nützlicher Frist umgesetzt werden können. Zudem sind Symbole oft ebenso wichtig, wie finanzielle Mittel. Insbesondere im Nachgang zur Clubdiskussion ist erstaunlich, dass im Zusammenhang von juristischen Wegen und Symbolen das Gespräch nicht auf den internationalen Strafgerichtshof kam, der Mittel entwickeln könnte, um symbolisch und sanktionierend zu handeln. Als Konsequenz der Clubdiskussion ergeben sich viele offene Fragen, weshalb die GEF das Thema in einem weiteren Club fortführt und vertieft. Als Fazit der Diskussion kann festgehalten werden: Erstens soll das Thema nicht versanden. Die Schweizer sollen eine Auseinandersetzung führen, denn die Schaffung von Gerechtigkeit ist auch ein Diskurs über sie und ein Prozess, in dem es keine Patentrezepte gibt. Zweitens müssen dabei die Opfer wahrgenommen werden. Denn sie sind noch da, leben oft in schlechten sozialen Verhältnissen und deshalb besteht Handlungsbedarf. Drittens ist es wichtig weite Kreise einzubeziehen. Gerade die Schweiz könnte durch die Idee eines runden Tisches mit allen Beteiligten – Regierungen, Unternehmer, NGO, Kirchen usw. – als Mediatorin mit dem Ziel der Versöhnung und Einigung eine Vorreiterrolle spielen. Schliesslich stellt sich viertens nicht nur im Zusammenhang mit Südafrika, sondern auch im Zusammenhang der aktuellen, weltpolitischen Situation die Frage, wie Menschenrechte, das Völkerrecht bzw. der humane Umgang insbesondere auch in Konfliktsituationen gesichert und durchgesetzt werden kann. 35 5.a. Schweiz – Südafrika: Fakten, Mentalitäten, Entscheidungsstrukturen, Altlasten von Dr. Peter Hug, Historisches Institut der Universität Bern Vom 17. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert war die Beziehung der Schweiz zu Südafrika auf die Auswanderung von ein paar Siedlern und Missionaren beschränkt, die sich meist in der Burenrepublik Transvaal niederliessen. Den Ton gaben Pietisten aus den Waadtländer Freikirchen an. Die dadurch entstehenden menschlichen Beziehungen wirkten sich in der Schweiz politisch erstmals in der einseitigen Burenbegeisterung während des Burenkrieges aus. In den 1930er Jahren reagierte Südafrika auf die Krise mit einer massiven Staatsintervention in die Wirtschaft und leitete damit einen bis Anfang der 70er Jahre anhaltenden Boom ein. Dies lockte auch die Schweizer Wirtschaft an. Auf Wunsch der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung vom März 1938 ergänzte das Politische Departement die diplomatischen Vertretungen der Schweiz in Südafrika kurz vor dem Krieg mit einem «Erweiterten Handelsdienst», der laut Bundesrat von Anfang an «verheissungsvolle Erfolge» erzielte. In den 1950er Jahren flossen aus der Schweiz in keinen anderen Staat so viele bewilligte Bankkredite wie nach Südafrika. Ende der 1960er Jahre belegte die Schweiz Platz vier der nach Südafrika Kapital exportierenden Staaten. Die Handelsimporte aus Südafrika stiegen bis 1989 auf deutlich über 1 Milliarde Franken oder den 32fachen Wert von 1963 an, die Ausfuhren erreichten aufgrund eines starken Anstiegs der Investitionsgüterexporte 1981 mit 670 Mio. Franken ihren Höhepunkt. In den 1970er und 80er Jahren sicherte die Exportrisikogarantie die Schweizer Ausfuhrgeschäfte nach Südafrika durchschnittlich mit 80 bis 90 Mio. Franken pro Jahr ab. Der 1968 von den drei Schweizer Grossbanken gegründete Zürcher Goldpool importierte in den 1980er Jahren über 50 Prozent der südafrikanischen Goldproduktion. Mit den ab 1985 von alt Nationalbankspräsident Fritz Leutwiler organisierten Krediten bewahrte die Schweiz die südafrikanische Regierung laut UNO-Studien vor dem Bankrott. Von zentraler Bedeutung war zudem der von der südafrikanischen DeBeers Tochtergesellschaft in Luzern organisierte Diamantenhandel, den DeBeers ab 1987 aufgrund britischer Sanktionen auch physisch über die Schweiz abwickelte. Marc Rich kaufte derweil von Zug aus u. a. aus Nigeria stammendes Erdöl und verkaufte es in Unterlaufung konvergenter Sanktionen nach Südafrika. Zusammenfassend scheint mir kaum bestreitbar zu sein, dass der Gold-, Diamanten-, Banken- und Handelsplatz Schweiz für die südafrikanische Regierung in der Schlussphase des Apartheidsystems von entscheidender Bedeutung war. Zweitens ist auf die politisch-diplomatische Unterstützung hinzuweisen. Die Schweiz sprach sich als eines der ganz wenigen Länder in allen internationalen Organisationen während über 40 Jahren konsequent gegen jegliche Form von Sanktionen oder auch bloss einer diplomatischen Isolation Südafrikas aus und begab sich dabei oft genug in eine unangenehme Aussenseiterposition. Die südafrikanischen Apartheidpolitiker honorierten dieses Verhalten, indem sie in der Regel überall, wo sie in Internationalen Orga- 36 nisationen noch vertreten waren, Schweizer Kandidaturen in die Exekutivämter unterstützten. Drittens sind die militärischen, rüstungstechnischen und nuklearen Beziehungen der Schweiz zu Südafrika zu erwähnen. Gemäss meinem aktuellen Erkenntnisstand gehen diese nicht auf isolierte Einzelaktionen von militärischen Abenteurern oder gewinnsüchtigen Firmen zurück. Vielmehr sind sie das Ergebnis einer breit abgestützten Aussenpolitik, die der Eindämmung des Kommunismus höchste Priorität vor allen anderen Überlegungen, insbesondere menschenrechtlichen, einräumte. In der Regel war es die Verwaltung, welche die Privatindustrie und die Wissenschaftler auf mögliche Rüstungs- und Nukleargeschäfte bzw. -Kontakte mit Südafrika aufmerksam machte. Zentral scheint mir zu sein, dass die meisten Entscheidungsträger in der Schweiz die UNO während Jahrzehnten als massgeblichen Ort der moralischen, politischen und rechtlichen Normenbildung der Völkergemeinschaft ablehnten. Ursache war m. E. ihr Verhältnis zu Deutschland. Bis in die 60er Jahre und darüber hinaus erblickten viele in der UNO eine blosse Nachfolgeorganisation der Alliierten und in den Alliierten keine moralisch gerechtfertigten Befreier vom Nationalsozialismus, sondern eine Kriegspartei mit hegemonialen Absichten. Damit verzögerten die Schatten des Zweiten Weltkrieges eine angemessene Einschätzung der von der UNO seit 1950 als rassendiskriminierend und damit als menschenrechtswidrig verurteilten südafrikanischen Politik der Rassentrennung (Apartheid)10 bis nahe in die Gegenwart. Gegenüber dem heimischen Publikum vergrösserten die Behörden und Spitzenverbände ihren aussenpolitischen Handlungsspielraum, indem sie die falsche Behauptung verbreiteten, die Schweiz sei neutral, mache nur in technischen Organisationen mit und führe im Grunde gar keine Aussenpolitik. Tatsächlich gehörte die Schweiz im ganzen 20. Jahrhundert stets zu den sieben am häufigsten in internationalen Organisationen vertretenen Staaten überhaupt und scheute sich dort nicht, politisch – etwa gegen kommunistische Tendenzen – anzutreten und Verantwortung zu übernehmen. In Form schiefer Geschichtsbilder blockiert die falsche Behauptung, die Schweiz sei neutral und stehe abseits, noch heute eine angemessene innenpolitische Abstützung der effektiv geführten multilateralen Aussenpolitik. In der Schweiz wird Aussenpolitik allerdings nicht von der Regierung, sondern von einzelnen Ämtern geführt. Es sind über 50 Bundesstellen aus allen sieben Departementen, die regelmässig auf der internationalen Bühne auftreten. Eine koordinierende Stelle gibt es kaum, die Kohärenz ist entsprechend gering. Die meisten vertraten auf der internationalen Bühne bis Ende der 1980er Jahre Positionen, die andere Staaten nur als apartheidfreundlich interpretieren konnten. Die andern verurteilten die Apartheid seit 1963 immer wieder als moralisch verwerflich, um nach aussen Imageprobleme abzubauen und innenpolitisch apartheidkritische kirchliche Kreise und soziale Bewegungen zufriedenzustellen. 1980 systematisierte die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit ihr Programm für positive Massnahmen in Südafrika und unterstützte dabei explizit Apartheidopfer. Angesichts der bedeutenden Rolle, die die Schweiz politisch, wirtschaft10 UNO-Generalversammlung, Resolution 395 (V), 2. 12. 1950. 37 lich und rüstungstechnisch für die Apartheidregierung spielte, empfanden viele dieses Programm freilich als blosses Alibi. Ich möchte die Prognose wagen, dass uns folgende drei Stichworte noch lange beschäftigen werden: 1. die Frage nach den Apartheidschulden, 2. Herr Regli und sein Umfeld und 3. die Frage nach der Reichweite unserer Verantwortung. Zur ersten Frage: Die südafrikanische Regierung will zur Erhaltung ihrer internationalen Kreditwürdigkeit zwar die während der Apartheidzeit angehäuften Schulden zurückzahlen, ähnlich wie die Bundesrepublik Deutschland 1952 gegenüber der Schweiz die berühmte Clearingmilliarde beglich – eine Art Exportkredit des Schweizer Steuerzahlers zugunsten der NS-Regierung im Krieg. Dennoch bleibt uns die von Jubilee 2000 aufgeworfene Frage erhalten, ob ein demokratisches Gemeinwesen für etwas haftbar gemacht werden kann, das kriminelle Unterdrücker zur persönlichen Bereicherung und für repressive Zwecke an schändlichen Schulden («odious debts») illegitimerweise angehäuft haben. Zweitens frage ich mich, ob die vielfältigen militärischen, rüstungstechnischen und nuklearen Beziehungen der Schweiz zu Südafrika, für die ich gerne Beispiele beibringe, dadurch aus unserer Verantwortung entfernt werden können, dass wir einen Einzelnen, nämlich Herrn Regli, einem strafrechtlichen Verfahren unterziehen, oder anders formuliert, ob der begrenzte Blick in die Dunkelkammern der Geheimdienste in einer Demokratie genügt, um die gemeinsame Verantwortung festzustellen. Dies führt mich zur dritten, grundsätzlicheren Frage nach der Reichweite der Verantwortung. Trägt ein Unternehmen, das in einem Unrechtsstaat Geschäfte macht, menschenrechtliche Mitverantwortung? Kann ein Schweizer Wissenschaftler, der auf nuklearem Gebiet eine enge wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit mit einem Staat pflegt, der ein Atomwaffenprogramm unterhält, sich dadurch aus der Verantwortung verabschieden, dass er seine Arbeit zur zweckfreien Grundlagenforschung erklärt? Kann sich der liberale Staat dadurch von der Mitverantwortung entbinden, dass er erklärt, Handlungen seiner Bürger in einem anderen Staat würden nicht seiner Rechtssprechung unterliegen? Kann sich die Schweiz als Nation und demokratisch verfasste Gesellschaft dadurch der Verantwortung entziehen, dass sie – wie jüngst anlässlich der verqueren Debatte über den Umschlag des Buchs von Herrn Eizenstat – das pseudoliberale Konstrukt «gute Gesellschaft – böse Elite» propagiert? 38 5.b. Schuldenstreichung und Reparationen. Eine völkerrechtliche Aktualisierung alter Forderungen von Mascha Madörin 1. Politische Legimität von Schulden In den 80er Jahre wurde die Legitimitätsfrage von Schulden der Drittweltstaaten vor allem in den Zusammenhang mit Ausbeutung und kolonialer wie neokolonialer Zerstörung gebracht. Die Analysen waren stark auf eine antikoloniale Kapitalismuskritik ausgerichtet und basierten vorwiegend auf wirtschaftspolitischen Überlegungen sowie auf Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit. Es galt der Slogan: "Die Schulden sind mehrfach bezahlt" durch zu tiefe Rohstoffpreise, durch die hohen Zinsen, durch Transferpricing, durch Kapitalflucht, Profittransfers etc. Der Gegenkongress zur Jahrestagung von IWF und Weltbank vom 23./24. September 1988 in West-Berlin – an dem verschiedenste soziale Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) teilnahmen – verabschiedete eine Erklärung zur Verschuldung der Dritten Welt und stellte klare Forderungen auf. Verlangt wurde erstens eine umfassende und sofortige Schuldenstreichung, zweitens Reparations- und Entschädigungszahlungen an die "Dritte Welt" für vergangenes Unrecht und für koloniale und neokoloniale Ausplünderung, drittens, dass die Lasten der Entschuldung nach dem Verursacherprinzip von denen getragen werden müssen, welche für die Krise in diesen Ländern verantwortlich sind – private Geschäftsbanken und Konzerne, westliche Regierungen, internationale Finanzorganisationen und die herrschenden Eliten –, und viertens eine globale Schuldenkonferenz, in denen Schuldnerländer und Gläubiger gleichberechtigt beteiligt sind. Den Von-Fall-zu-Fall-Ansatz von IWF, Banken und Gläubigerregierungen lehnte der Kongress klar ab.11 Zudem wurde die Verknüpfung von Schuldenerlassen mit wirtschaftspolitischen Bedingungen abgelehnt, auch wenn es sich bei diesen um Bedingungen "in sozialem und ökologischem Gewand" handelt.12 In der nordwestlichen entwicklungspolitischen Szene liess man die Forderung nach genereller Schuldenstreichung jedoch rasch fallen, setzte mit Lobbying zunehmend auf Einzelländer, auf soziale und ökologische Rahmenbedingungen bei Strukturanpassungsprogrammen und auf Umschuldungsbedingungen, welche auch Forderungen nach "Good governance" enthielten.13 Die Kritik an Banken und Transnationalen Konzernen 11 Während die Gläubiger international bei Umschuldungsverhandlungen in Bankenclubs, dem sogenannten Londoner Club, oder - wenn es sich um Schulden gegenüber Regierungen handelte - im Pariser Club oder in IWF und Weltbank bestens organisiert sind, müssen die Regierungen der Schuldnerländer nach wie vor einzeln zu den Verhandlungen antreten. 12 Widerspruch (1989): "Schuldenkrieg und CH-Finanzkapital, IWF, Entwicklungspolitik und Solidaritätsbewegung". Sonderband, April 1989. Zürich. S. 5ff. 13 Das Konzept "Good governance" stellt faktisch ein machtpolitisches Arrangement zwischen NGOs und IWF/Weltbank dar. Der IWF stellt seit der Schuldenkrise der 80er Jahre eine Reihe wirtschaftspolitischer Bedingungen, wenn Regierungen Auslandsschulden umschulden wollen. Diese Vorschriften wurden im Verlauf der Zeit durch das Lobbying von NGOs angereichert mit Forderungen nach Demokratisierung, Vermeidung schwerer Menschenrechtsverletzungen, Miteinbezug von einheimischen NGOs in die Staatspolitik und neuerdings mit Armutsbekämpfungsprogrammen, welche Vorschriften über den Anteil des Staatsbudgets enthalten, der für soziale Zwecke und Programme zur Armutsbekämpfung verwendet wird. 39 (TNCs) wurde zunehmend leiser. In der Schweiz wurde anfangs der 90er Jahre zur 700Jahrfeier die Entschuldungspetition lanciert. Obwohl die Aktion Finanzplatz Schweiz diese Petition unterstützte, wandte sie kritisch ein, dass mit dieser Kampagne und mit der Einrichtung der Gegenwertsfonds eine Richtung eingeschlagen werde, welche die Forderungen der West-Berliner unterlaufen: Die Weltwirtschaftsentwicklung werde ignoriert, ebenso die Machtfrage, die Frage nach der Legitimität der Schulden und der Verantwortung von Banken und TNCs. 2. Tragfähigkeitsgrenze von Schulden, faire Verfahren und Verursacherprinzip Seit Ende der neunziger Jahre wurden von den globalisierungskritischen Bewegungen die Schuldenstreichungs- und Wiedergutmachungsforderungen wieder aufgenommen. Heute steht aber in Debatten bei den NGOs im Norden und zum Teil im Süden nicht mehr das Gerechtigkeitsargument an vorderster Stelle, sondern ein entwicklungspolitisches: Es geht um die "Tragfähigkeitsgrenze" (sustainability) von Schulden. Die öffentliche Debatte zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit von Schulden ist brisant, weil es implizit um international anerkannte Kriterien geht, die eine Basis für das Recht auf Schuldenstreichung sein könnten.14 Nach wie vor ist die Frage der Entschuldungsrechte, wie die HIPC-Initiative zeigt, ein heiss umstrittenes Feld. Die Konflikte drehen sich im Wesentlichen um die Kriterien eines Erlassbedarfs und – was für die Institutionalisierung von globalen Regelungen sehr wichtig ist – um die Entscheidungsverfahren im Fall eines Schuldenstreichungsrechts15. Schon seit langem gibt es zwei Vorschläge, welche die unfairen, undemokratischen, willkürlichen und erpresserischen Verhandlungsverfahren ersetzen sollen: Zum einen internationale Schuldenkonferenzen16 und zum anderen Schiedsgerichtsverfahren, wie sie heute zwischen Wirtschaftspartnern auf internationaler Ebene schon längst praktiziert werden.17 Langjähriges Lobbieren und fachliche Kontroversen haben dazu geführt, dass die Frage eines Insolvenzrechts oder zumindest eines geregelten Entschuldungsverfahrens inzwischen den Internationalen WährungsLaufend werden neue Kriterien hinzugefügt. Dieser Mix aus neoliberaler Wirtschaftspolitik, Sozial- und Demokratisierungsprogrammen ist in Süd-NGOs heftig umstritten. 14 1984 wurde an internationalen Schuldenkonferenzen in Quito und Cartagena von Südregierungen die untragbare Schuldendienstgrenze definiert (Hurtienne, Thomas [1987]: Gibt es für den verschuldeten Kapitalismus einen Weg aus der Krise? In: Die Armut der Nationen, hrsg. von Elmar Altvater et al. Berlin: Rotbuch. S. 137), und zwar noch über dem heute festgelegten Niveau der HIPC-Initiative. Es dauerte länger als 10 Jahre, bis das allzu bescheidene Schuldendienst-Kriterium der Konferenzen von 1984 im Rahmen der HIPC-Initiative Eingang in die IWF- und Weltbankpolitik gefunden hat. Zudem gilt es nur für sehr arme Länder (mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen) und nicht prinzipiell für alle Länder. 15 Kaiser, Jürgen (2002): Eine gescheiterte Initiative und eine halbe Reform. In: Finanzplatz-Informationen, Basel 4/2002. 16 Solche wurden schon in den 80er Jahren z.B. von Fidel Castro und Julius Nyerere vorgeschlagen, nun im Südlichen Afrika von NGOs diskutiert und wiederholt von afrikanischen Staatschefs gefordert. 17 Solche schlägt beispielsweise der Volkswirtschaftsprofessor Raffer für ein internationales Insolvenzrecht vor. Die Grundkonzepte sind dargestellt bei: Raffer, Kunibert (1990): Applying Chapter 9 Insolvency to International Debts: An Economically Efficient Solution with a Human Face. In: World Development, Vol.18/2. Und: Raffer, Kunibert (1992): What's Good for the United States Must be Good for the World: Advocating an International Chapter 9 Insolvency. Referat gehalten am Kreisky Forum Symposium, Wien Sept. 1992.). Ein solches Insolvenzrecht könnte auch auf die Auslandsschulden eines Landes oder auf irgendwelche Staatsschulden angewendet werden. 40 fonds dazu veranlasst hat, als Gegenvorschlag zu den Schiedsgerichtsverfahren, seine Vorstellungen „für einen gesetzesgestützten Entschuldungsmechanismus“ zu lancieren. Der Konflikt dreht sich letztlich darum, wie transparent und neutral solche Entscheidungsmechanismen sind und welche neuen ökonomischen Chancen ein Land durch solche Entschuldungsverfahren haben soll. In den 90er Jahren hatte sich die Debatte über Schuldenerlass fast nur um Schulden gegenüber Staaten und multilateralen Institutionen gedreht. Dass auch Banken, TNCs und Spekulanten einen Teil der Verantwortung zu tragen haben, davon wurde kaum geredet. So wurde in der Schweiz von den in der Entschuldungspetition involvierten entwicklungspolitischen Organisationen wie der Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke kaum öffentlichen skandalisiert, dass die Schweizer Banken im Rahmen der 700-JahreEntschuldungskampagne nicht bereit waren, eine namhafte Menge der Schuldpapiere an die Schweizer Regierung zu verkaufen. Wohlverstanden: Es ging damals um Verkäufe zu regulären Marktpreisen und nicht darum, dass Banken einen Teil der Schuldpapiere 1991 anlässlich zur 700-Jahr-Feier hätten abschreiben müssen. Dies veränderte sich 1997 mit einem aufsehenerregenden Artikel, den der Börsenmakler George Soros in der Financial Times veröffentlichte. Er schrieb, dass seit den 80er Jahren alle Schuldenkrisen des internationalen Finanzsystems auf dem Buckel der Schuldnerländer und zugunsten der Banken und Spekulanten geregelt worden seien. Dies sei die Rolle des IWF gewesen. Ein entscheidender Punkt bei den Schuldendebatten ist nämlich, dass die Verantwortung der privaten Banken und Investoren nur dann ins Blickfeld kommt, wenn auch über die Schuldenproblematik von Ländern geredet wird, die sich noch nicht im Endstadium der Schuldenkrisen befinden, d.h. in einem Stadium, wo der grösste Teil der Auslandsschulden gegenüber der ausländischen Privatwirtschaft schon längst durch Leistungen von Exportrisikoversicherungen und durch mehrfache Umschuldungen in Schulden gegenüber ausländischen Staaten und multilaterale Organisationen umgewandelt worden ist. 3. Die wichtige Rolle von Südafrika Was die Frage der Legitimität der Schulden anbelangt, so muss insbesondere die internationale Kampagne für Schuldenstreichung und Entschädigung im südlichen Afrika erwähnt werden, welche sowohl mit der Wiedereinführung des anfangs des 20. Jahrhunderts angewendeten Konzeptes der „Odious Debt“18 als auch in Sachen Reparationsforderungen und -klagen eine neue Debatte initiierte und in deren Durchsetzung 18 Hinter dem Konzept der Odious Debt (illegitime, verabscheuungswürdige Schulden) steht die Idee, dass Kredite an Diktatoren, welche diese zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung verwendet oder für die eigene Bereicherung gestohlen haben, nicht zurückbezahlt werden müssen. Zur Geschichte des völkerrechtlichen Konzepts „Odious Debt“ und zu neueren Diskussionen vgl. Adams, Patricia (1991): Odious Debts. Loose Lending, Corruption, And the Third World’s Environmental Legacy, London/Toronto: Earthscan. Und: Weibel, Amanda Hg. (2002): Odious Debts, Hinterlassenschaften der Diktatoren, Apartheid-Connections 2. Hrsg. von Aktion Finanzplatz Schweiz und Recherchiergruppe Schweiz-Südafrika, Zürich. Zu bestellen bei [email protected]. 41 neue Wege beschreitet. NGOs aus dem Südlichen Afrika19 begannen ab 1998 im Rahmen der Jubilee 2000 Kampagnen dieselben Fragen und Forderungen aufs Tapet zu bringen, wie jene, die zehn Jahre früher von NGOs vor allem aus Lateinamerika und Asien in West-Berlin aufgestellt wurden. Am Jahrestag des Sowetoaufstandes, am 16. Juni 1998, lancierten in Europa schweizerische, deutsche und britische NGOs ein Pressecommuniqué von SANGOCO, der südafrikanischen Koalition von NGOs. Darin rief SANGOCO zur Unterstützung einer Kampagne auf, welche die Streichung der Apartheidschulden von Südafrika und den umliegenden Ländern sowie Entschädigungen für die Schäden der Apartheid fordert. Im Aufruf hiess es: "Die Völker des südlichen Afrika bezahlen immer noch die Kosten der Apartheid. ... Wir glauben, dass es unmoralisch und nicht zu rechtfertigen ist, dass die Leute zweimal für die Apartheid bezahlten müssen. ... Die Opfer der jahrzehntelangen Menschenrechtsverletzungen in Südafrika und den umliegenden Länder sollen nach Abschaffung des totalitären und rassistischen Regimes nicht erneut benachteiligt werden. Wegen fehlender Finanzen wird heute im Südlichen Afrika Millionen von Menschen das Recht auf elementare Gesundheitsversorgung und Schulbildung vorenthalten. Es ist ungerecht und absurd zu verlangen, dass sie für Schulden, die zu ihrer Unterdrückung aufgenommen worden sind, zahlen müssen. Die Banken und Unternehmen haben diese Kredite entgegen den Interessen der Bevölkerung Südafrika gegeben und haben das Apartheidregime in seiner Destabilisierungs-, Unterdrückungs- und Zerstörungspolitik gestärkt. Personen und Institutionen, die von der Apartheid profitiert haben, sind für die heutige Lage im Südlichen Afrika mitverantwortlich: Die Schulden sollen gestrichen und die Opfer entschädigt werden. Wir rufen alle Gruppen, welche unseren Kampf gegen die Apartheid unterstützt haben, auf, unseren Aufruf zu unterstützen, dass die Apartheidschulden gestrichen und Reparationen von all denjenigen bezahlt werden, die von unseren Leiden profitiert haben. Insbesondere rufen wir zur Unterstützung folgender Punkte auf: - Die Gewährung von Krediten und Anleihen an das Apartheidregime war illegitim. Für deren Rückzahlung darf das demokratische Südafrika heute nicht verantwortlich gemacht werden. - Die Nachbarländer haben sich infolge der Destabilisierungspolitik des Apartheidregimes verschuldet sowie schwere soziale und ökonomische Schäden erlitten. Eine Rückzahlung dieser vom Krieg verursachten Schulden zu verlangen, ist unfair. - Die bereits erfolgte Rückzahlung der mit der Apartheid verbundenen Anleihen ist auf Kosten der Bevölkerung geschehen. Dieses Geld soll für den Wiederaufbau des Südlichen Afrikas zurückgegeben werden. - Unternehmen und Banken, welche die internationalen Sanktionsforderungen während der Apartheid ignorierten, sollen für die Profite aus jener Zeit Entschädigungen an die Bevölkerung des Südlichen Afrikas bezahlen." Inzwischen wird diese Kampagne von der Organisationskoalition "Jubilee Südafrika" getragen, welche nach wie vor von sozialen Bewegungen und Menschenrechtsorganisationen, aber auch von wichtigen kirchlichen Organisationen und von Gewerkschaften unterstützt wird. Die südafrikanische Regierung macht sich inzwischen stark für eine Schuldenstreichung in Afrika und vertritt die Meinung, dass alle Opfer der Apartheid das Recht haben, Entschädigung einzuklagen, dass aber die Regierung selbst keine Ent19 Siehe dazu verschiedene Verlautbarungen von Konferenzen und Kampagnen von Jubilee 2000 Netzwerken in Südafrika, Afrika und Lateinamerika., wie sie vor allem im Verlauf der Jahre 1998 und 1999 formuliert wurden. Informationen bei: www.aidc.org.za. 42 schädigungsprozesse führt. Die Inhalte dieses Aufrufs sind erst kürzlich durch eine Konferenz der Zivilgesellschaften des Südlichen Afrika und der EU-Länder in der Schlussresolution bestätigt worden. Und im zweiten Halbjahr 2002 haben verschiedene südafrikanische Klägergruppen in den USA Entschädigungsklagen gegen deutsche, schweizerische, britische, US-amerikanische und japanische Unternehmen und Banken deponiert, welche von der Apartheid profitierten bzw. sie unterstützten. Im Fall der Apartheid-Schulden spielt die Frage der Verletzung von Menschenrechten eine zentrale Rolle. Auch die Tragfähigkeitskriterien können allenfalls als Teil der sozialen und wirtschaftlichen Menschenrechte gesehen werden. Aber es gibt auch politische Menschenrechte, auf die der Westen jedenfalls während des Kalten Krieges immer sehr viel Wert legte. Forderungen nach Entschädigung der Folteropfer sind beispielsweise in der Folterkonvention enthalten. Durch die Kampagne zu Apartheid-Schulden rückt für Südafrika auch wieder die Verantwortung der privaten Banken und Investoren ins Zentrum der Betrachtung. Schulden sollen – so das Argument – nicht gestrichen werden, weil Südafrika am Abgrund einer Schuldenkrise steht, sondern weil es Schulden der Apartheid sind. "Sollen wir für die Apartheid zweimal bezahlen?" fragen VertreterInnen von südafrikanischen NGOs. Sollen nun Menschen, die sich jahrelang gegen ein brutales, mit Polizei und Militär hochgerüstetes Folterregime gewehrt haben, auch noch für die Kredite haften, welche ausländische Banken eben diesem Regime gegeben haben? Und soll der Nachbarstaat Moçambique die ganze Last der Kriegsschulden und zerstörungen tragen, die in einem vom Apartheidregime gesponserten und unterstützten Contra-Krieg entstanden sind, und sollen keine Forderungen an diejenigen Staaten, Banken und TNCs gestellt werden dürfen, welche das Apartheid-Regime unterstützt haben? Die Schuldenkampagne zum Südlichen Afrika zeigt klar, dass verschiedene Kriterien für einen Schuldenerlass ausschlaggebend sein müssten. Berücksichtigung finden müssten erstens die Insolvenz von Ländern bzw. die Tragfähigkeitsgrenze von Schulden, zweitens die Illegitimität von Schulden bzw. "odious debt" und drittens Schulden, die durch eine unverschuldete Kriegs- und internationale Konfliktsituation verursacht wurden (post conflict countries). Es gibt im Privatrecht für alle drei Fälle bereits vergleichbare Regelungen auf nationaler Ebene: - Im privaten Konkurs- und Insolvenzrecht wird von einem Recht auf ein Existenzminimum ausgegangen. - In den Gesetzen zu unsittlichen Geschäften oder auch bei der juristischen Vorstellung von Treu und Glauben sind Schulden illegitim. - Bei höherer Gewalt, die es einem Geschäftspartner (zum Beispiel im Fall von Krieg oder bei einem Erdbeben) verunmöglicht, Verträge einzuhalten, ist von Unschuld auszugehen. Solche Klauseln stehen in jedem Versicherungsvertrag. Durch entsprechende internationale Regelungen könnten also vorhandene Rechtsvorstellungen und national geltende Gesetzesbestimmungen, wie sie in westlichen kapitalistischen Ländern durchgesetzt wurden, übernommen und auf die internationale Ebene übertragen werden. Angesichts der Globalisierung wäre das nur logisch. Diese Debatte ist nun voll in Gang. 43 4. Entschädigung für schwere Menschenrechtsverletzungen Seit 1998 ist die Kampagne sowohl in Südafrika als auch im Ausland bedeutend grösser geworden und bewegt sich nun in zwei Bahnen. Zum einen arbeitet ein Teil von Jubilee im breiten Bündnis mit Sozialforen und internationalen Schuldenkampagnen zur Frage illegitimer Schulden. Zum anderen hat sich innerhalb von Jubilee eine spezielle Struktur gebildet, die sich mit der Frage der Entschädigung befasst. Diese Zweiteilung macht nicht nur deshalb Sinn, weil es verschiedene Bündnisse und Kenntnisse – etwa über ein anderes Vorgehen in der Öffentlichkeit – braucht, sondern auch die unter Druck zu setzenden Institutionen andere sind. Bei der Schuldenstreichung sind die politischen Gegenspieler vor allem die Westregierungen, IWF und Weltbank, bei den Entschädigungsklagen geht es um zivilrechtliche Forderungen direkt gegenüber Konzernen. Zwar gibt es aufgrund der Menschenrechtskonventionen schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, vor Menschenrechtsgerichten Entschädigungen für schwere Menschenrechtsverletzungen gegenüber Staaten einzuklagen, nicht aber gegenüber Konzernen und Banken. Letztere können faktisch nur in den USA eingeklagt werden aufgrund eines über zweihundert Jahre altes Gesetzes, der „Alien Tort Claims Act". Dieses Gesetz wurde Ende des 18. Jahrhunderts gegen die Piraterie erlassen und war eine Antwort auf den damaligen Globalisierungsschub, als der internationale Handel und die Schifffahrt immer wichtiger wurden und die Meere einen rechtsfreien Raum darstellten. Der entscheidende Punkt an diesem Gesetz ist, dass es allen Opfern irgendwelcher Länder möglich ist, Entschädigungen für schwere Menschenrechtsverletzungen gegenüber Unternehmen einzuklagen, vorausgesetzt diese haben einen Sitz oder eine Tochtergesellschaften in den USA.20 Eine zweite Voraussetzung für Klagen gegen Unternehmen reicht ebenfalls in das späte 18. Jahrhundert zurück, in die Zeit des Verbots des Sklavenhandels: „Wer Schiffe für den Sklavenhandel baut, solche montiert oder ausstattet, wer ... Schiffe belädt, zur Abreise vorbereitet oder auf Reise schickt und weiß oder beabsichtigt, dass sie für den Sklavenhandel gebraucht werden, soll daran gehindert werden; ebenso wer mit seinen Geschäften dem Sklavenhandel Vorschub und Beistand leistet.“ Dies beschloss im Jahr 1794 der US-Kongress, verschärfte 1820 das Gesetz und sah für solche Vergehen die Todesstrafe vor. Sklaverei wurde damit juristisch wie Piraterie behandelt. Auch bei den Nürnberger Prozessen nach 1945 stellte die Anklage fest, dass Hitler als Führer die „Zusammenarbeit von Staatsmännern, militärischen Führern, Diplomaten und Geschäftsleuten“ gebraucht habe, um seine Absichten durchzusetzen, und dass diese deshalb zur Verantwortung gezogen werden müssten.21 Gegenwärtig sind über zehn solcher Entschädigungsklagen wegen Menschenrechtsverlet20 Erst Mitte der 80er Jahre, meines Wissens im Fall des philippinischen Ex-Diktators Ferdinand Marcos, der die letzte Phase seines Lebens auf US-Territorium verbrachte, hat ein findiger US-Anwalt dieses alte Gesetz bei Entschädigungsklagen von philippinischen Menschenrechtsorganisationen eingesetzt. Eine ausführliche Dokumentation über die Entwicklung der Konzepte und die Praxis der Wiedergutmachung bei Menschenrechten und über den Fall Marcos findet sich bei: Egli, Martina und Madörin, Mascha: Entschädigung ist ein Menschenrecht. Konzepte und Analysen zur Debatte um Wiedergutmachung bei Menschenrechtsverletzungen, Apartheid–Connection 3. Hrsg. von der Aktion Finanzplatz Schweiz und der Recherchiergruppe Schweiz-Südafrika, Zürich2001. 21 Siehe das Dokument zum juristischen Hintergrund der Klage, welches Jubilee Südafrika anlässlich der Lancierung der Klage veröffentlichte: www.aktionfinanzplatz.ch. 44 zungen von Konzernen hängig. Die nun in den USA eingereichten Entschädigungsklagen von Apartheidopfern rollen in beeindruckender Weise die lange Geschichte eines internationalen Rechtsverständnisses auf. Dieses geht davon aus, dass die Prinzipien der Rechenschaftspflicht, der Haftbarkeit und Entschädigungspflicht in Sachen Menschenrechten auch für Unternehmen gelten. 5. Widerstand der Politik und der Konzerne gegen die Entschädigungsklagen «In dieser Klage drücken wir unser Engagement für eine bessere Zukunft der Apartheidopfer, für die Menschenrechte und für Rechtsstaatlichkeit - 'the rule of law' - aus», schrieben Khulumani, die 30'000 Mitglieder zählende Selbsthilfeorganisation von Apartheidopfern, und Jubilee Südafrika in ihrer Medienmitteilung anlässlich der Einreichung der Klage. Dass Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit international gestärkt werden könnten, wenn die Apartheidklage in den USA Erfolg hat, befürchten auch in internationalem Recht bewanderte Fachleute von Konzernen. Sie vermuten, dass ein Präzedenzfall geschaffen wird und dass künftig die indirekte Unterstützung von Unrechtsregimes durch die Wirtschaft – und nicht wie bisher „nur“ schwere Menschenrechtsverletzungen im eigenen Betrieb – eingeklagt werden kann. Noch vor Einreichung der Apartheidklagen warnte die US-Regierung ein Gericht, dass der Prozess gegen Menschenrechtsverletzungen des Ölkonzerns Exxon Mobil in Indonesien die Terrorismusbekämpfung und die Investitionen in einem wichtigen verbündeten Land behindern könnte. Auf gleiche argumentative Schützenhilfe aus dem Weißen Haus konnte im Herbst 2002 auch der Ölmulti Unocal hoffen. Gegen ihn und gegen seine Unterstützung der Militärdiktatur in Burma haben BurmesInnen wegen Zwangsarbeit geklagt. Darauf kommentierte ein früherer Mitarbeiter des US-State Department das Vorgehen der US-Regierung: Das Terrorismusargument sei eine "unwiderstehliche Möglichkeit" den "Alien Tort Claims Act" loszuwerden. Trotz dieser für US-Verhältnisse unüblichen Intervention der Regierung bei Gerichten gab das Gericht im Fall Unocal den KlägerInnen recht. Damit wurde insofern neues Recht geschrieben, als nun auch gegen Unternehmen wegen der Unterstützung eines Regimes, das sich schwerer Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht hat, Entschädigungsklagen geltend gemacht werden können. Der Fall Unocal ist für die Apartheidklagen hinsichtlich der Banken besonders wichtig. Denn juristisch gesehen, war es bisher sehr schwierig die Financiers von Unrechtsregimes einzuklagen. Kurz nach Einreichung der Apartheidklage durch Hausfeld und dem ebenfalls im Herbst 2002 erfolgten Grundsatzentscheid im Fall Unocal, haben sich die im Zusammenhang mit der Apartheid beklagten Konzerne zusammengetan, um in den USA den "Alien Tort Claims Act" abzuschaffen. Ihr Argument: Unter diesen Bedingungen wird es in vielen Entwicklungsländern immer schwieriger und unattraktiver zu investieren. Für die Entschädigungsklagen der Apartheidopfer kommt jedoch eine mögliche Abschaffung des "Alien Tort Claims Act" zu spät, da die Klagen schon deponiert sind. Die Konzerne verfolgen aber eine doppelte Strategie: einerseits, dass die Klagen von den Gerichten als nicht relevant erklärt werden, und andererseits, dass möglichst bald Verhandlungen stattfinden. Gegenwärtig versuchen sie deshalb die südafrikanische Regierung und wichtige Institutionen der südafrikanischen Gesellschaft – so beispielsweise Kirchen, Hilfswerke und Gewerkschaften – davon zu überzeugen, dass die Klagen re45 spektive das Wühlen in der Vergangenheit kontraproduktiv sei, dass man nun in die Zukunft blicken und Investitionen fördern müsse. Dahinter steckt die nicht unberechtigte Hoffnung, dass damit mögliche Entschädigungszahlungen wesentlich billiger zu stehen kommen, und dass sie sich vor allem den Imageschaden durch die öffentliche Verhandlung ihrer Untaten während der Apartheidzeit ersparen können. Denn ebenso unangenehm wie hohe Entschädigungszahlungen ist für Konzerne die Tatsache, dass die USGerichte bei Entschädigungsklagen die Öffnung von Konzernarchiven und unabhängige Untersuchungen anordnen können. Dies war für die Schweizer Banken bereits im Rahmen der Holocaust-Klagen ein wahrer Albtraum. In Südafrika selber hat sich Frederik W. de Klerk, der letzte Präsident des ApartheidRegimes, in Sachen Klagen kurz nach deren Einreichen im November 2002 zu Wort gemeldet. Er geißelte in einer Rede an einem Treffen mit der US-amerikanischen Handelskammer in Johannesburg vehement die Tendenz, Entschädigungsklagen gegen multinationale Konzerne der Schweiz und der USA einzureichen. Er warnte davor, dass am Schluss die Banken und Firmen jede Möglichkeit verlören, irgendwo Geschäfte zu tätigen (Business Day (SA) vom 11.11.02). Ähnlich argumentiert der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, und am World Economic Forum in Davos wurde die Klage der Apartheidopfer ebenfalls diskutiert, schließlich waren da wichtige Akteure aus Wirtschaft, Politik und Kirchen anwesend, um sich über geeignete Strategien zu unterhalten. Solche Entwicklungen voraussehend hat Jubilee Südafrika anfangs 2003 kurz vor dem World Economic Forum eine neue Erklärung lanciert, von der sie hofft, dass sie von möglichst vielen zivilgesellschaftlichen und globalisierungskritischen Organisationen unterschrieben werden. Diese Erklärung wurde anlässlich einer internationalen Konsultation abschliessend redigiert. In der Erklärung wird im Unterschied zu derjenigen von 1998 vor allem betont, wie wichtig die Rechtsprechung in Sachen Menschenrechte ist, insbesondere das Recht auf die Einklagbarkeit von Menschenrechtsverletzungen. Denn wie bei den Entschädigungsklagen geht es bei den Rechten zur Schuldenstreichung in ähnlicher Weise darum, dass es ein international geregeltes und prinzipielles Recht gibt und nicht Verhandlungen und Verfahren, die von Fall zu Fall festgelegt werden. Insofern können die Auseinandersetzungen um die Beziehungen der TNCs und Banken zum Apartheidregime wegweisende Wirkung haben. 46 5.c. Fazit über offene Fragen und Konsequenzen von Maya Doetzkies 1. Nachträgliche Gerechtigkeit Die erste Frage betrifft den Titel der Veranstaltung: Kann es aus ethischer Sicht eine „nachträgliche“ Gerechtigkeit geben? Oder müsste man sich auf den bescheideneren Begriff der Wiedergutmachung beschränken? 2. Wiedergutmachung Für eine Wiedergutmachung sind folgende Schritte notwendig: 1. Schuldfrage klären Obwohl in den Referaten P. Hug und M. Madörin viele Fakten aufgezeigt wurden, stellt sich die Frage, wie mit Fakten umgegangen wird. Dies gilt insbesondere auch für politische Instanzen (Beispiel: Aussage der Interdepartementalen AG, dass zu keiner Zeit südafrikanische Schulden gegenüber der Schweiz bestanden hätten). Wie also muss das „Ausmass“ (juristisch, moralische Schuld) bestimmt werden, wie muss die Suche nach Wahrheit vor sich gehen? Unbestritten ist, dass die Perspektive der Opfer gesehen werden muss, dass wir Opfer Wahr-Nehmen müssen (Holocaust-Beispiel). Wie aber sehen „Täter und Opfer“ die „Jubilee 2000“-Kampagne bzw. deren Forderung nach Schuldenstreichung für die Schweiz? Was ist die Antwort der NGO? Wer nutzt welche Fakten und Argumente zu welchem Zweck? 2. Schuld anerkennen Wir teilen das Gefühl der Scham. Geschehenes kann durch nichts entschuldigt werden. Wir tragen zwar keine Verantwortung für die Taten unserer Vorgänger, aber wir sind involviert und leben im Schatten des Getanen. Hindernisse und Unklarheiten ergeben sich allerdings in folgenden Punkten und Fragen: „Wagenburgmentalität“ der Schweiz und fehlendes Skandalbewusstsein; Wer ist eigentlich „wir“? In wessen Namen und Interesse sprechen wir (Transparenz der Quellen und der Absichten)? Können wir Regierung, Politiker/innen, Unternehmer, NGO und „das Volk“ in einen Topf werfen? Was ist mit der Opposition, den zahlreichen Parlamentsvorstössen gegen die Apartheid? („Das Volk“ ist manchmal offener als seine Regierung, „Prestige“Beispiel ist die Kundgebung und Solidarität in Zug). Südafrikanische Regierung will keine Schuldenstreichung (wegen Kreditwürdigkeit) und unterstützt keine Sammelklagen: ist das zu respektieren? 3. Sühne bzw. Verantwortung übernehmen Die Forderungen der Opfer sind gemäss M. Madörin: Reparation - Kompensation - Rehabilitation – Satisfaktion Sind Sammelklagen allerdings das richtige Mittel? 47 - Aus juristischer Sicht klaffen Legalität und Legitimität auseinander. Wichtiger als juristisches Beharren wäre es, zu fragen, was pragmatisch am sinnvollsten ist, um es auch umzusetzen Universität können. Symbole können so wichtig sein wie Reparationszahlungen. Wer und wie wird Verantwortung übernommen? Welche Rolle hat der Staat? Ist er Stellvertreter für private Unternehmen? Was, wie und wer kann die Unternehmen dazu bringen, Verantwortung zu übernehmen? - Wer übernimmt Verantwortung für jene Unternehmen, die nicht mehr existieren? Welche neuen Formen der Sühne gibt es? Welche symbolische Taten und welche handfesten Reparationen sind angebracht? - Brauchen auch wir in der Schweiz eine nationale Versöhnung (reconciliation), die uns erlaubt, die Zukunft mit der Vergangenheit neu zu entwerfen? Welche neuen Formen der Sühne gibt es? Müssen nicht unterschiedliche Formen möglich sein? - 4. Lehren ziehen Ob wir bereits Lehren gezogen haben, bleibt offen. Insbesondere auch, ob die neue Sanktionspolitik des Bundesrates als „Lehre“ zu bezeichnen und einzuordnen ist. 3. 1. 2. 3. 4. Konsequenzen Druck muss aufrecht erhalten werden, damit das Thema nicht versandet (siehe Auf und Ab der öffentlichen Perzeption). Opfer sind noch da, „am Leben“, ihre sozialen Verhältnisse sind miserabel. Deshalb besteht Handlungsbedarf. Weiterverfolgen der Forderung, dass (wirtschaftliche, soziale, kulturelle, politische) Menschenrechte eingeklagt und krasse Menschenrechtsverletzungen auf internationaler Ebene verfolgt und sanktioniert werden können. Diskurs über Gerechtigkeit weiterführen. Dies ist ein Prozess, zu dem es keine Patentrezepte gibt. Perspektiven müssen entwickelt werden, wie die Würde der Menschen wiederhergestellt werden kann. Dazu gehören auch Transparenz, das Öffnen der Archive und das „WAHR-NEHMEN“ der Opfer. Neue Ideen zur Mediation zwischen allen Stakeholdern sind notwendig. Die Schweiz könnte darin eine Vorreiterrolle übernehmen, alle an einen Tisch zu bringen (Regierungen, Unternehmer, NGO, Kirchen usw.), um Verhandlungsresultate zu erreichen. 48 6. Nachträgliche Gerechtigkeit: Welche Wege führen zu einem fairen Ausgleich? Einleitung und Diskussionspunkte von Erwin Koller, Moderator des Clubs (GEF-Club vom 5. Juli 2003) Im ersten Teil befasst sich das Club-Gespräch nach den Referaten der Bundesrichterin Dr. Vera Rottenberg Liatowitsch (Die Logik der Justiz und die Forderung nach Gerechtigkeit) und Professor Wolfgang Lienemann (Der Umgang mit historischer Schuld im südlichen Afrika) mit den Chancen und Grenzen des Rechts und der Wahrheit für den Prozess der Schaffung von Gerechtigkeit und Versöhnung. In diesem ersten Teil wurden die folgenden Diskussionspunkte eingebracht: Hug: Die Resolution Nr. 44/2002 der UNO-Menschenrechtskommission (Menschenrecht von Opfern schwerer Menschenrechtsverletzungen auf Wiedergutmachung) soll eine Weiterentwicklung des Rechts im Hinblick auf ein Recht auf Wiedergutmachung bringen: Restitution, Kompensation, Rehabilitation, Genugtuung und Verhinderung von Wiederholungen. Das Problem ist der Adressat dieser Forderung. Oft ist es die Nachfolgeregierung (in Südafrika betrifft es ca. 20'000 durch die Wahrheitskommission offiziell registrierte Opfer). Die Schweiz ist aufgerufen, Klarheit über vergangene Verstrickungen von Behörden und Unternehmen in schwere Menschenrechtsverletzungen zu schaffen. Ausgangspunkt muss stets die Opferperspektive sein, die auch für die Arbeiten der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg wegleitend war. Weil kein Unrechtsregime ohne die Unterstützung durch Dritte auf Dauer funktionieren kann, stellt sich die Frage, wie dieses Bewusstsein der Wiedergutmachung bei Dritten, die daran beteiligt waren, stimuliert und durchgesetzt werden kann, etwa im Sinn eines Schuldenerlasses, einer Entschuldigung und einer Klärung der Entschädigungsfrage. Meist fehlt jegliches Skandalbewusstsein. Dreyfuss: In den USA dient das Rechtswesen (und insofern auch die Sammelklagen) zur Durchsetzung von gesellschaftlichen Werten. Wehowsky: Skepsis ist angebracht gegenüber der Aussage, dass die Erinnerung den Opfern ihre Würde zurückgibt. Es gibt auch eine Erinnerungsindustrie, welche die Opfer ein weiteres Mal demütigt. Imfeld: Kommt weg von den Denkmälern. Nehmt wahr, was in Kunst und Literatur an Auseinandersetzung längst geschieht. Thürer/Schweizer: Im Fall Spring hätte das Bundesgericht ein deutlicheres Zeichen setzen können und müssen, wie die Schweiz mit Opfern umgehen soll, im Sinn des modernen und weiterentwickelten Völkerrechts. 49 Loebell: Schweizer Firmen hätten für ihre Verantwortung am Unrecht in Südafrika (wie für den Holocaust) entschiedener zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Der Schlussbericht der südafrikanischen Wahrheitskommission nennt die Schweiz explizit und als einziges Land. Würgler (unterstützt von der Runde): Wir laden den Vorstand GEF ein, beim Bundesrat wegen der Aktensperre von Archiven zu Südafrika zu intervenieren. Lienemann: Wo historisches Unrecht geschah, müssen Archive rückhaltlos offen gelegt werden. Nichts ist für eine Demokratie schädlicher, als wenn sie das Tageslicht scheut. Im zweiten Teil befasst sich das Club-Gespräch nach dem Referat des HEKSProgrammbeauftragten für das Südliche Afrika Andreas Loebell (Was kann Entwicklungszusammenarbeit zwischen der Schweiz und Südafrika zur Konfliktbewältigung beitragen?) mit der Frage: Welche Alternativen gibt es ausserhalb des Rechts, um Konflikte zu lösen sowie einen Ausgleich und eine Versöhnung zustande zu bringen? In diesem zweiten Teil standen folgende Diskussionspunkte im Zentrum: Wehowsky: Was können wir tun, damit Banken und Unternehmen ihren Teil der Wiedergutmachung in Südafrika leisten? Schweizer: Noch zu viele haben überhaupt kein Unrechtsbewusstsein. Eine öffentliche Diskussion ist notwendig und muss herausgefordert werden. Loebell: In Südafrikas Wirtschaft geben die Weissen den Ton an. Es braucht den öffentlichen Druck auf sie, was ein wichtiger Beitrag für die Schweiz und für Südafrika wäre. Heute werden die Opfer, die Entschädigung verlangen, delegitimiert. Es braucht eine materielle Entschädigung, und es muss ein Entschädigungsfond eingerichtet werden. Wehowsky u. a.: Diskussion darüber, wie wir handeln können. Sollten wir in dieser Sache einen runden Tisch einrichten, vielleicht zuerst vertraulich? Gehörten nicht auch die Reiseveranstalter oder die Gesellschaft Schweiz-Südafrika dazu? Die Schweiz kommt um eine Aufarbeitung nicht herum. Man könnte auch Südafrikaner zu uns einladen. Und man müsste die Aktion mit andern Ländern koordinieren. Priorität haben ältere Menschen. Thürer: Traditionell wurden die Menschenrechte verstanden als ein Recht gegenüber dem Staat, heute werden sie immer mehr zu einem Recht gegenüber gesellschaftlichen Mächten, also auch gegenüber Unternehmen, die in dieser Frage eine eigene Verantwortung haben. Lienemann: Erziehung ist die wichtigste Aufgabe für die Zukunft. 50 6.a. Die Logik der Justiz und die Forderung nach Gerechtigkeit: Eignet sich ein Gerichtsverfahren als Beitrag zur Gerechtigkeit? von Dr. Vera Rottenberg Liatowitsch Einleitung Aufzeigen der Charakteristika eines rechtsförmigen Verfahrens. Eignung des Verfahrens als Beitrag der Gerechtigkeit ist anschliessend zu diskutieren. 1. Verfahren sind durch Bestimmtheit gekennzeichnet. a. Klar definierte Parteien: - Kläger – Beklagter / Ankläger – Angeklagter; mit klar definierten Rollen: - Kläger macht bestimmten Anspruch geltend. - Gegenpartei widersetzt sich in aller Regel. Anspruch aus einem bestimmten Lebensvorgang. b. Strikte Spielregeln, sprich: Verfahrensvorschriften. Wer sie nicht einhält, scheidet ganz oder teilweise (mit einzelnen Vorbringen) aus. 2. Zweck des Verfahrens a. Entscheid: Herbeiführen eines autoritativen, d. h. durchsetzbaren Entscheids über eine bestimmte Streitlage. b. Streitlage: - Frage, ob der behauptete Lebenssachverhalt zutrifft. - Frage des Bestandes der geltend gemachten Forderung, d. h. Frage, ob der eingeklagte Anspruch aufgrund des anwendbaren Rechts gegeben ist. - Frage der Klagbarkeit, bzw. der Durchsetzbarkeit der Pflicht der beklagten Partei, den Anspruch zu befriedigen (keine Verjährung, Verwirkung etc.; vorschriftsgemässes Verhalten im Prozess). 3. Entscheidinstanz – Gericht a. Instanz: Staatliche oder private Instanz, die in einem vorgegebenen Verfahren zur Entscheidfindung eingesetzt wurde. b. Zuständigkeit: Gericht hat vor Befassung mit der Sache seine Zuständigkeit zu prüfen. 51 c. Unabhängigkeit: Ihrerseits in aller Regel bei der Entscheidfindung an ein bestimmtes Verfahren gebunden (Ausnahme: z. B. Schiedsgericht, Formlosigkeit vorgesehen). d. Grundsätze: Gewisse Grundsätze haben traditionellerweise Allgemeingültigkeit erlangt (Gleichbehandlung der Parteien, rechtliches Gehör). 4. Zusammenfassung a. Generell: Rechtsordnung als Friedensordnung. Es geht zur Hauptsache um Beilegung von Streit zur Ermöglichung des sozialen Lebens. b. Rechtsförmige Verfahren und Gerechtigkeit: Entgegen einem weit verbreiteten Vorurteil kann es bei rechtsförmigen Verfahren nicht um die Verwirklichung von Gerechtigkeit auf Erden gehen, wenngleich bei der Rechtsetzung wie auch bei der Rechtsanwendung Wertungen einfliessen, die sich an der Gerechtigkeitsidee der betreffenden Machthaber ausrichten. 52 6.b. Schuld und Versöhnung im Kontext der südafrikanischen Wahrheitskommission – Schuldzurechnung in differenzierten Perspektiven von Prof. Dr. Wolfgang Lienemann In zahlreichen Ländern hat es in den vergangenen zwei Jahrzehnten nach einer Epoche von Unterdrückung, schweren Verletzungen der Menschenrechte, Genoziden und Bürgerkriegen den Versuch gegeben, eine rechtsstaatliche Neuordnung zu wagen und dabei zu versuchen, die Greuel der Vergangenheit nicht zu beschweigen oder zu verdrängen, sondern sich diesen in einer teilweise enormen Anstrengung historischer Vergewisserung zu stellen. Das bekannteste Beispiel für diesen Prozess politischer Rechenschaft – wenn man theologisch sprechen will: öffentlicher Beichte und (vielleicht) Busse – begegnete ich in den 1990er Jahren in Südafrika nach den Jahrzehnten der Apartheid. Ich möchte über diesen Prozess kurz berichten und ihn exemplarisch im Blick auf die Frage nach dem Umgang mit historischer Schuld in relativ groben Umrissen skizzieren. 1. Ausgangspunkte 1. Grundlagen der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika sind der Anhang zur Verfassung von 1994 sowie der „National Unity and Reconciliation Act“ vom 26. Juli 1995. Demzufolge wurde eine „Truth and Reconciliation Commission“ (TRC) eingesetzt, die vier Ziele verfolgen sollte: 1. Gewinnung eines möglichst umfassenden Bildes der Menschenrechtsverletzungen seit 1960, besonders unter Einbeziehung der Perspektiven der Opfer. 2. Gewährung von Amnestie für bestimmte Personen, die aufgrund (subjektiv bejahter) politischer Zielsetzungen Verbrechen begangen hatten. 3. Offenlegung der Schicksale v.a. der Apartheidopfer und Gewährung von Ausgleichs- und Schadensersatzleistungen. 4. Erstellung eines umfangreichen Berichtes über die Zeit der Apartheid und das Schicksal ihrer Opfer. Die Kommission hat seinerzeit unverzüglich ihre Arbeit aufgenommen. Der umfangreiche fünfbändige Bericht lag schon 1998 vor; ein (vorläufiger) Abschlussbericht wurde in 2001 erstattet. Besonders hervorzuheben sind die erschütternden Anhörungen der Opfer von Menschenrechtsverletzungen und ihrer Angehörigen durch zahlreiche Komitees der TRC in den Provinzen Südafrikas. Das südafrikanische Fernsehen hat zahlreiche dieser Anlässe übertragen, doch die weisse Bevölkerung hat sich nur wenig dafür interessiert. Die Videos, Filme und Akten werden in den National Archives aufbewahrt; die Arbeit der TRC ist im Internet zugänglich.22 2. Amnestie wurde nur in einem Bruchteil der beantragten Fälle gewährt, aber auch nur gut 10 Prozent derer, die zu Verbrechen in der Vergangenheit aussagen wollten, kamen zur Sprache. Vor allem die Frage der möglichen Reparationen und Rehabilitationen 22 www.doj.gov.za/trc 53 wurde auf die lange Bank geschoben, so dass viele Apartheidopfer am Ende von der Arbeit der TRC tief enttäuscht waren. 2. In den letzten zwei Jahrzehnten hat es in zahlreichen Ländern Versuche gegeben, mit Hilfe von „Wahrheitskommissionen“ Verbrechen aufzuklären und sich den Untaten in der Vergangenheit zu stellen.23 Meist ging es lediglich um Dokumentation und geschichtliche Erinnerung. Strafrechtliche Konsequenzen, jedenfalls im Rahmen nationaler Kompetenzen, hat man überwiegend gescheut, denn die jeweiligen „neuen“ Ordnungen waren zunächst sehr prekär. Südafrika bildet insofern einen Sonderfall, als nach scharfen politischen Auseinandersetzungen von Anfang an (1) keine generelle, sondern nur eine „bedingte“ Amnestie ausgesprochen wurde, (2) das Strafrecht prinzipiell in Geltung blieb und (3) über das doppelte Ziel einer umfassenden historischen Aufklärung und einer damit beabsichtigen Versöhnung hinaus auch Reparationen angestrebt wurden. 3. Kann es eine „nachträgliche Gerechtigkeit“ für historisches Unrecht des Ausmasses der Apartheid geben? Die realistische Antwort kann wohl nur lauten: Nein. Die Arbeit der TRC war dennoch sicher notwendig und richtig. Ich kenne aller Kritik an der TRC zum Trotz keinen Menschen „dunkler“ Hautfarbe und auch nur wenige „Weisse“ in Südafrika, die grundsätzlich die Arbeit der TRC abgelehnt hätten. Das Ausbleiben von immer wieder angemahnten Wiedergutmachungsleistungen war und ist indes schwer erträglich, zumal ein dem Präsidenten unterstellter Fonds hierfür lange ungenutzt blieb. Vor allem haben Armut, Arbeitslosigkeit, Krankheiten und elementare Not sich im Leben der schwarzen Mehrheit während und nach der Apartheid in der Wahrnehmung der Betroffenen nur unwesentlich verändert. Nachträgliche Gerechtigkeit, denke ich, überschreitet indes das menschliche Vermögen. Wohl aber gibt es eine Pflicht, zur Erinnerung und, wenn es denn möglich ist, zur Heilung und Vernarbung von Unrecht und Schuld beizutragen und für erlittenen Schaden zumindest eine „Wiedergutmachung“ zu leisten. Wichtig sind vor allem die Erkenntnis, Feststellung und öffentliche Bekanntmachung begangener Taten. Doch wer bekennt sich in welchem Sinne angesichts derartiger Zeugnisse als „schuldig“, und was bedeutet dies dann persönlich und gesellschaftlich? Danach soll hier gefragt werden. 2. Zurechenbarkeit historischer Schuld? Wenn man nach dem „Umgang mit historischer Schuld“ und der Möglichkeit der Zurechnung historischer Schuld fragt, sollte man wohl zuerst eine Binnen- und eine Aussenperspektive unterscheiden. Ich beginne mit der ersten und beziehe die zweite nach und nach ein, indem ich acht Problemaspekte nenne. 1. Auch wenn die Arbeit der TRC für die Mehrheit der schwarzen Bevölkerung im südlichen Afrika vielleicht nur relativ wenig unmittelbare Bedeutung hatte und hat24, kann 23 Überblick bis 1995: Neil J. Kritz (Hg.), Transitional Justice. How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, 3 vols., Washington 1995; vgl. auch die Beiträge zur Arbeit verschiedener Wahrheitskommissionen in der Zeitschrift „Der Überblick“ 35, H. 3/1999. 24 Es konnte nur an wenigen Orten über einen Teil der Apartheidverbrechen, aber auch der Verbrechen aufseiten der Befreiungsbewegungen öffentlich verhandelt werden. Für viele schwarze Menschen besonders in den ländlichen Gebieten waren die Komitees weit weg. Dennoch darf man m. E. die Wirkung der Tatsache, dass die TRC-Komitee-Treffen überhaupt stattfanden, nicht gering schätzen. 54 man die langfristigen Wirkungen schwerlich überschätzen. Vielleicht darf man aus der neueren europäischen Geschichte an die Erfahrung erinnern, dass es meist mehr als eine Generation braucht, um einen Prozess kollektiver Erinnerung zu vollziehen, der zu schmerzhaften, aber befreienden Einsichten befähigt. Umso wichtiger ist es, die Zeugnisse und Dokumente vergangener Gewaltherrschaft zu sichern, denn, wie Walter Benjamin schrieb, „auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein.“ Und Benjamin fügte hinzu: „Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört.“25 Die TRC hat durch ihre Existenz, ihr Verfahren und die dokumentarische Sicherung ihrer Arbeit dazu beigetragen, dem Vergessen zu widerstehen. Die der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit verpflichtete Erinnerung der Schuld der Täter und der Leiden der Opfer dient der Wahrung menschlicher Würde im nivellierenden Fluss der Zeiten. 2. „Historische“ Schuld ist, wenn dieser Begriff sinnvoll sein soll, nicht (m)eine persönliche Schuld aufgrund (m)einer bestimmten Tat oder Unterlassung, sondern ein umfassenderes Schuldverhältnis, in das auch die Nachgeborenen eintreten können, sofern sie sich beispielsweise bewusst in den generationen- und zeitübergreifenden Zusammenhang eines Volkes, einer Nation oder einer Klasse hineinstellen, dem sie in der Folge der Geschlechter geschichtlich verbunden sind und den sie für sich anerkennen. Man kann dies nicht von jedem Menschen in gleicher Weise erwarten und schon gar nicht rechtlich normieren, aber es gehört zu den Möglichkeiten von Menschen, in die Solidarität von historischen Schuldverhältnissen nachträglich einzutreten, auch wenn man selbst dafür ursächlich nicht verantwortlich gemacht werden kann. Der Kniefall des früheren deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt im Warschauer Ghetto ist ein Sinnbild dieser menschlichen Möglichkeit freiwillentlicher Schuldübernahme. Damit ein solches persönliches Eintreten in überindividuelle Schuldverhältnisse überhaupt möglich ist, bedarf es des individuellen Gewissens, einer starken Identifikationskraft, des kollektiven Gedächtnisses und einer entsprechenden Öffentlichkeit, in der historisches Gedenken seinen anerkannten Platz hat. 3. In Südafrika (und anderswo) neigt die erste Generation nach der Befreiung anscheinend eher dazu, die Geister der Vergangenheit in ihren Gräbern zu lassen. Der Ruf nach Amnestie erweist sich bisweilen als der Wunsch nach Amnesie. Nur nicht an die vergangenen Verbrechen und Wunden rühren! Es ist aber leicht zu sehen, dass der Verzicht auf strafrechtliche Verfolgung – sei es gemäss den Gesetzen des alten Regimes, sei es nach Kriterien der Völkerrechtsgemeinschaft, sei es nach Massgabe eines neuen Amnestiegesetzes – nur Ungleichheit und neues Unrecht schafft oder schaffen kann. Zumindest muss man verlangen, dass die Täter von einst nach denselben Gesetzen abgeurteilt werden, die sie selbst erlassen und angewendet haben. Mord bleibt Mord. Ich denke, dass man mit den Möglichkeiten einer Amnestie, besonders aus politischen Gründen, sehr vorsichtig umgehen sollte.26 25 Über den Begriff der Geschichte, Abschnitt 6, in: ders., Ges. Schriften I/2, Frankfurt/M. 1974, 691-704 (695). 26 Siehe zur Amnestieproblematik Wolfgang Huber, Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik, Gütersloh 1996, 359-361; Wolfgang Lienemann (unten Anm. 29). 55 4. Ein Mensch kann in rechtlicher Hinsicht unschuldig sein, aber zugleich für sich selbst moralische Schuld empfinden. Wo kein Strafrichter Klage erhebt, kann gleichwohl das Gewissen anklagen. Für mich war in den letzten Jahren höchst aufschlussreich, wie die sogenannte Wehrmachtsausstellung in Deutschland27 vielfach Anlass zur individuellen Freizeichnung von historischer und moralischer Schuld wurde. Juristische Schuld wird nach feststehenden Regeln von aussen zugerechnet; historische und moralische Schuld ist allein Gegenstand freier Selbstzurechnung. Daher kommt es auch, dass zwei Personen praktisch nie dieselben sittlichen Schuldempfindungen bekunden. Die Selbstzurechnung von Schuld ist immer das Ergebnis höchst komplexer, einmaliger biographischer Entwicklungen. 5. Vermutlich hat keine Diktatur, hat kein Unrechtsregime längeren Bestand ohne das unterstützende Interesse Dritter. Das südafrikanische Apartheidregime wurde jahrzehntelang auch von aussen gestützt. Diese Unterstützung schwand freilich im Laufe der Zeit, und zwar in dem Masse, wie sich im Zuge der Dekolonisation, der Anerkennung des Selbstbestimmungsrecht des Völker und der zunehmenden Durchsetzung menschenrechtlicher Standards die Einsicht verbreitete, dass Ungleichheit vor dem Gesetz aufgrund von Merkmalen der Rassenzugehörigkeit schlechthin verwerflich ist. 6. Seit den 1950er Jahren hat die Völkerrechtsgemeinschaft das Apartheidregime abgelehnt und verurteilt. In dem Masse, wie sich diese Überzeugung im Völkerrecht festigte, verlor jede ältere Legitimation von „getrennter Entwicklung“ ihre Grundlagen. In diesem Prozess der Ausbildung eines neuen Rechtsbewusstseins entwickelten sich sittliche Überzeugungen und rechtlich bindende Beschlüsse freilich nicht synchron. Man konnte beispielsweise in den 1970er Jahren als Unternehmer noch legal in Südafrika investieren, auch wenn dies in immer mehr Gruppierungen zunehmend als moralisch problematisch, ja verwerflich erschien, ohne dass man rechtlich zur Verantwortung gezogen werden konnte. Die Kirchen begannen zu bekennen „apartheid is a heresy“, aber dies blieb zunächst politisch folgenlos, wenngleich diese symbolische Ächtung durchaus Gewicht hatte. Wer indes nach 1986 angesichts einer Reihe von UN-Resolutionen immer noch zögerte, seine Investitionen im südlichen Afrika abzuziehen, darf sich nicht beschweren, wenn er heute als damaliger Komplize der Apartheid bezeichnet wird. 7. Es gab die Grauzonen. Dort protestierte man als Investor häufig nicht offen gegen das Apartheidregime, traf aber vielleicht Entscheidungen, die einer friedlichen Revolution zuarbeiteten. (Leutwilers von Nelson Mandela ausdrücklich verdankte Umschuldungsaktion rechne ich hierzu.) In derartigen prärevolutionären Übergangsphasen ist es sowohl für die Zeitgenossen wie für die Nachkommenden praktisch unmöglich, Schuld an der Beibehaltung des Unrechtsregimes von Beiträgen zu seiner Überwindung klar zu unterscheiden. Mancher, der formal im Rahmen der Legalität handelte, wird sein damaliges Verhalten heute nicht mehr korrekt finden und bereuen. Was sich rückblickend jemand als schuldhaftes Versäumnis selbst zuzurechnen bereit ist, hängt u. a. von Wahrnehmungen, Handlungsmöglichkeiten, Erwartungen und äusseren Bedingungen ab – vom Wissen, Wollen, Können und Selbstverständnis in der Vergangenheit. Das gilt für 27 Siehe den Ausstellungskatalog: Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.), Vernichtungskrieg. 4 Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, Hamburg 1996 ( überarb. Aufl. 1999). 56 Einzelne wie für Gemeinschaften. Schuld ist ein mehrfach konditioniertes Selbst- und Fremdverhältnis. 8. In dieses Feld der Uneindeutigkeit von Verantwortlichkeit und Schuld wird man auch die Beziehungen zwischen der Schweiz und Südafrika einzeichnen müssen. Das bedeutet, dass es auch rückblickend eine Einsicht in Versäumnisse geben kann und sollte, die man zwar kaum strafrechtlich fassen kann, die aber geradezu nach der freiwilligen Übernahme von historischer und moralischer Schuld ruft. Einer solchen Einsicht würden eine aus freien Stücken bejahte moralische Mitverantwortung und die entsprechende Bereitschaft zu Wiedergutmachung Ausdruck geben können. Hinsichtlich der Beziehungen Schweiz – Südafrika ist darum nach meiner Überzeugung nicht der Gesetzgeber, wohl aber die Zivilgesellschaft gefordert. Diese kurzen Hinweise sollten deutlich machen, dass die Zurechnung von Schuld für vergangene Taten unter Bedingungen schwerer historischer Verwerfungen ungemein schwierig ist. Fremdzurechnung und Selbstzurechnung von Schuld lassen sich häufig nicht zur Deckung bringen, und beide unterliegen wiederum im Zeitverlauf je für sich neuen Einstellungen, Erfahrungen und Bewertungen. Dies nötigt meines Erachtens dazu, die Dimensionen möglicher Schuld nicht nur nach dem Schema von rechtlichen und sittlichen Selbst- und Fremdzurechnungen zu differenzieren, sondern nach der Bedeutung weiterer Unterscheidungen zu fragen. 3. Die dreifache Gestalt der Schuld und die Zuordnung von juristischer, politischer und theologischer Schuldzurechnung Die TRC hat vielfach Opfer und Täter konfrontiert. Sie personalisierte dabei Probleme, die in einer transpersonalen Struktur (nämlich dem formellen und informellen Regelwerk der Apartheid) ihren Ursprung haben, welche ihrerseits wiederum nur Bestand haben konnte aufgrund individueller Mittäterschaft, Akzeptanz oder Gleichgültigkeit. Wir sprechen zu Recht vom System der Apartheid, aber darüber darf man natürlich nicht vergessen, dass der Bestand jedes Systems von einer Unzahl sich ergänzender Willensentscheidungen aufgrund personaler Freiheit abhängt. 1. Die juristische Schuldfrage In den neueren Strafrechtsdiskussionen ist viel von einem möglichen Täter-OpferAusgleich die Rede.28 Die südafrikanische TRC hat vielfach Täter und Opfer konfrontiert; diese Zeugnisse sind teilweise sogar im Internet zugänglich. Vonseiten der theologischen Rechtsethik hat u. a. Traugott Koch Überlegungen zu "Strafe und Schuld im Horizont von Reue und Vergebung" zur Diskussion gestellt.29 In Anlehnung an Wolfgang 28 Vgl. dazu Karl-Ludwig Kunz, Kriminologie, 2. Aufl., Bern - Stuttgart - Wien 1998, 60-67. 313f. 387f. ZEE 42,1998, 110-121. Vgl. auch Wolfgang Huber, Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik, Gütersloh 1996 322-361; Hans-Richard Reuter, Rechtsethik in theologischer Perspektive, Gütersloh 1996, 167-183; Wolfgang Lienemann, Amnestie – Gnadenakt oder Rechtsanspruch? Theologische und rechtsethische Überlegungen, in: Wolfgang Vögele (Hg.), Gnade vor Recht oder gnadenlos gerecht?, Loccum 1999, 7-25. Zur geschichtlichen Entwicklung vgl. Hans Dombois (Hg.), Die weltliche Strafe in der evangelischen Theologie, Witten 1959. 29 57 Schild und dessen stark durch Hegels Strafrechtstheorie30 geprägte Sicht argumentiert Koch dahingehend, dass der einzige ethisch vertretbare Sinn, Rechtfertigungsgrund und Zweck einer Strafe für begangene Verbrechen in der freien Schuldeinsicht und anerkennung des Täters liegt. (Hinsichtlich des rechtlichen Zwecks einer Strafe wird heute überwiegend auf die generalpräventiven und die positiv-spezialpräventiven Funktionen verwiesen, doch das ist hier nicht mein Thema.) Wenn man die Strafe nicht allein unter gesellschaftlich-funktionalen Gesichtspunkten betrachtet, sondern auch in der Dimension ethisch zu verantwortenden Freiheitsgebrauchs und -entzuges, dann muss gefragt werden, was nicht allein aus rechtlichen und politisch-sozialen, sondern auch aus genuin sittlichen Erwägungen einem Täter oder einer Täterin "zugefügt" werden darf oder gar muss. Hegel hat dazu seinerzeit, in Kritik an sozial-funktionalen Strafzwecken, prononciert die These formuliert, dass der Verbrecher durch die rechtmässige und gerechte Strafe "als Vernünftiges geehrt" werden solle31, so dass der solcherart Verurteilte, wenn er nur vernünftig ist, selbst und aus Freiheit die über ihn verhängte Strafe wollen kann. Um des Bestehens einer Rechtsordnung überhaupt willen (theologisch als "Schöpfungsordnung" oder als Institution im Sinne Ernst Wolfs zu verstehen32) muss sich diese – unter bestimmten Bedingungen – auch in Sanktionen realisieren. Diese Auffassung schliesst im übrigen keineswegs die Kritik konkreter positiver Strafgesetze und Strafvollzugsgesetze aus, sondern enthält, modern gesprochen, den Imperativ, allererst eine Strafrechts-"Pflege" (einschliesslich der Gestaltung des Strafvollzuges bis hin zu einem weitgehenden Verzicht auf die Freiheitsstrafe) zu schaffen, welche den genannten Prinzipien entspricht33. Für die juristische Schuldfrage kommt es aber nicht nur darauf an, diese individuelle Dimension der rechtlichen Schuldzurechnung und Strafzumessung zu berücksichtigen, sondern auch die Bedeutung dieser Vollzüge für das rechtliche und sittliche Empfinden der Bevölkerung zu bedenken. Eine primär empirisch orientierte, womöglich rein utilitaristischen Prinzipien folgende Auffassung der Strafgerichtsbarkeit steht in der Gefahr, die symbolische Funktion der Strafe, die Wohltat und Würde des Rechts im Dienste aller 30 Hierzu siehe auch Kurt Seelmann, Anerkennungsverlust und Selbstsubsumtion, Freiburg/Br. – München 1995. 31 "Dass die Strafe darin als sein eigenes Recht enthaltend angesehen wird, darin wird der Verbrecher als Vernünftiges geehrt", schreibt Hegel in § 100 der Rechtsphilosophie von 1821 (Theorie-Werkausgabe 7, 191). Vgl. dazu Wolfgang Schild, Das Gericht in Hegels Rechtsphilosophie, in: Überlieferung als Aufgabe (FS Erich Heintel), Bd. 2, hg. v. Herta Nagl-Docekal, Wien 1982, 267-294; ders., Ende und Zukunft des Strafrechts, in: ARSP 70, 1984, 71-112; ders., Strafe – Vergeltung oder Gnade?, Schweizerische Zs. für Strafrecht 90, 1982, 364-384. 32 Vgl. dazu jetzt Gert Ulrich Brinkmann, Theologische Institutionenethik. Ernst Wolfs Beitrag zur Institutionendiskussion in der evangelischen Kirche nach 1945, Neukirchen-Vluyn 1997. 33 Ich selbst bin überzeugt, dass der Strafvollzug in den üblichen Justizvollzugsveranstaltungen diese Doppelfunktion, einen rechtlichen und einen ethischen Sinn oder Zweck der Strafe zu realisieren, nicht erfüllen kann, weil der übliche Strafvollzug eine dafür erforderliche Unterscheidung beider Zwecke weder faktisch noch symbolisch zur Darstellung bringen kann. Also kommt es darauf an, die beiden Funktionen sozial, personal, örtlich und zeitlich zu trennen. Diese Trennung beginnt ansatzweise schon dort, wo Gefängnisseelsorger selbst innerhalb der Unfreiheit des Gefängnisses einen Raum und eine Zeit der (symbolischen) "Freiheit vom Gesetz" gewinnen und gewähren können. Noch wichtiger ist dann aber die weiterführende Begleitung ehedem Straffälliger nach Verbüssung ihrer Strafe. Als vorbildlich möchte ich hier die Bürgeraktion „Verein für Strafgefangenenhilfe e.V. Munderkingen“ in Baden-Württemberg erwähnen. 58 Menschen zur öffentlichen Geltung zu bringen, auszublenden. Mit dieser These wird nicht dem "gesunden Volksempfinden" und dem Stammtischruf nach drakonischen Strafen das Wort geredet, wohl aber darauf hingewiesen, dass nicht nur im Blick auf eine straffällige Person, sondern auch im Blick auf die Institution des Rechtes und des Rechtsstaates über den Sinn der Strafe nachgedacht werden muss. In derselben Richtung bewegte sich ein Vortrag des ersten Chefanklägers des Den Haager Kriegsverbrechertribunals, des südafrikanischen Richters Richard J. Goldstone anlässlich einer Tagung des Einstein Forums in Potsdam über "Amnestie oder Die Politik der Erinnerung in der Demokratie"34. Goldstone argumentiert, dass die Nichtverfolgung von schwerwiegendem Unrecht, also von Kriegsverbrechen und schwersten Menschenrechtsverletzungen (wozu man die Verbrechen zur Aufrechterhaltung der Apartheid rechnen muss), dazu führen muss, dass der Ruf nach Rache und Selbsthilfe unausweichlich wird. Will man hingegen den Kreislauf von Verbrechen und Vergeltung durchbrechen und eine Friedensordnung schaffen, dann müssen nicht nur die Erfüllungsgehilfen, sondern die politisch Verantwortlichen strafrechtlich belangt werden. Um des Rechtes und der Gerechtigkeit willen müssen die Befehlsgeber und nicht nur die Befehlsempfänger zur Rechenschaft gezogen werden. Strafe muss sein – nicht um der Vergeltung und der Rache willen, sondern um des Rechtes als einer übergreifenden Ordnung für alle Menschen willen35. Südafrika ist diesen Weg eines nationalen oder gar internationalen Strafgerichtes zur Aufdeckung und Ahndung schwerster Verbrechen in seiner jüngeren Geschichte aus nachvollziehbaren Gründen indes nicht gegangen.36 Die Arbeit der TRC schliesst zwar die Ahndung ordinärer Verbrechen, wenn sie nicht verjährt sind, im Rahmen der üblichen Strafrechtspflege keineswegs aus. Doch mit der Ausnahmestellung politisch motivierter Verbrechen für eine Amnestie wurde für wenige, relativ klar bestimmte, aber objektiv äusserst schwer wiegende Unrechtshandlungen eine Exemtion aus Gewissensgründen in extremen politischen Konflikten institutionalisiert. Kann und darf der weite Mantel des Begriffs des Politischen soviel Schutz gewähren? Das für Amnestien zuständige Committee in Südafrika hat in dieser Frage den schwierigen Weg der differenzierenden Urteilsbildung nach Massgabe gewichteter Kriterien für jeden einzelnen Fall gewählt. Gleichwohl ist es für das durchschnittliche Rechtsbewusstsein mindestens eine Belastung, dass geständige Mörder und Folterer bei Vorliegen bestimmter Gründe amnestiert werden konnten, selbst wenn sie keine Zeichen von Schuldbewusstsein und Reue erkennen liessen. 34 Frieden und Gerechtigkeit – Ein unvereinbarer Gegensatz?, jetzt in: Gary Smith/Avishai Margalit (Hg.), Amnestie oder Die Politik der Erinnerung in der Demokratie, Frankfurt/M. 1997, 37-47. 35 Nur wenn diese Bedeutung des Rechtes anerkannt und auch empirisch erfahrbar ist, kommt ein Ende von Selbsthilfe, Rache und Vergeltung in Sicht. Martin Luthers heftig umstrittene Position im Bauernkrieg muss man unter diesem Aspekt würdigen; vgl. dazu Gottfried Maron, "Niemand soll sein eigener Richter sein". Eine Bemerkung zu Luthers Haltung im Bauernkrieg, Luther 46, 1975, 60-75. 36 Man muss freilich hinzufügen, dass von der TRC nicht akzeptierte Amnestiebegehren für Verbrechen damit ebenso wenig von der Strafverfolgung ausgenommen sind wie bisher nicht bekannte Delikte. Andererseits muss man in allen (nicht nur Entwicklungs-) Ländern davon ausgehen, dass die Begrenztheit der Ressourcen der Strafverfolgung den potentiellen „Kandidaten“ in höchst unterschiedlicher Weise zugute kommen. 59 2. Die geschichtlich-politische Schuldfrage Die Zurechnungsprobleme des "normalen" Strafrechtes sind in der Praxis im Einzelfall schon schwer genug zu lösen – man denke nur an komplexe Hergänge und Ursachen wie im Umweltstrafrecht37. Doch erst die Frage historischer Zurechenbarkeit von Handlungen und Unterlassungen, also die Problematik der geschichtlichen Verantwortung, macht die meisten Menschen zurecht ratlos. Natürlich sind Handlungen und Unterlassungen nur nach Massgabe von Wissen und Macht individuell zurechenbar, aber von welchem Hinsehen oder Nicht-Hinsehen, Handeln oder Weggehen an begann am 9. November 1938 in Deutschland, als die Synagogen brannten, die Sphäre individueller und (möglicherweise auch) kollektiver Schuld? Wie ist – damals und heute – zu beurteilen, dass Karl Barth 1949 (also nach der kommunistischen Machtübernahme in Ostmitteleuropa) sich dagegen verwahrte, "einen Mann von dem Format von Joseph Stalin mit solchen Charlatanen wie Hitler, Göring, Hess, Goebbels, Himmler, Ribbentrop, Rosenberg, Streicher usw. es gewesen sind, auch nur einen Augenblick im gleichen Atem nennen"38 zu wollen? Konnte ein Mensch mit einem klaren politischen Urteil, auch und gerade ein überzeugter Sozialist, nach dem 21. August 1968 weiter in der "Allchristlichen Prager Friedenskonferenz" mittun? Und kann ein deutsches Gericht nach 1989 aufgrund welcher rechtsstaatlichen Grundlagen die "Mauerschützen" zur Verantwortung ziehen, wenn und solange ein führender Vertreter des alten DDR-Regimes wie SchalckGolodkowski, der die Geschäfte mit den westlichen Politikern besorgte, unbehelligt am Tegernsee leben kann? Juristisch und politisch-historisch zurechenbare Schuld müssen unterschieden werden, aber in concreto ist das ungemein schwierig. In diesem Grenzbereich musste die TRC ihre Arbeit zu positionieren versuchen. Nur wenn man diesen Umstand bedenkt, kann man wahrscheinlich die Stärken und Schwächen der TRC verstehen. Die Frage geschichtlicher Schuld und des Umganges damit betrifft aber keineswegs nur die je betroffene Gesellschaft, sondern auch die Menschen in anderen Staaten, die mit einem Unrechtsregime in irgendeiner Weise im Verkehr standen. Machte sich, wer den Aufrufen zu Embargo und Boykott gegenüber Südafrika seit Mitte der 1970er Jahre nicht folgte, an der Aufrechterhaltung der Apartheid mitschuldig? Durfte die Regierung eines Rechtsstaates wie der Bundesrepublik Deutschland der DDR einen überlebenswichtigen Kredit gewähren und hätte sie gleichzeitig Kredite für Südafrika gesetzlich verbieten dürfen, ja müssen? War es vereinbar, die Apartheid zu ächten und die Greuel im Kontext der sogenannten Kulturrevolution in China nicht zur Kenntnis zu nehmen? Und im Blick auf die deutschen Kirchen gefragt: War die seinerzeit verfolgte „multiple Strategie“ vertretbar oder nicht? Und alle diese Fragen muss man, wenn man nicht besserwisserisch oder rechthaberisch sein will, doch wohl so formulieren, als kenne man kontrafaktisch den seitherigen Gang der Geschichte nicht. Unter diesen Voraussetzungen wird deut37 Vgl. dazu am Beispiel des Chemie-Unfalls von Schweizerhalle (1986) und der strafrechtlichen Aufarbeitung die Basler Rektoratsrede von Günter Stratenwerth, Das Strafrecht in der Krise der Industriegesellschaft, Basel 1993. 38 Die Kirche zwischen Ost und West, Zollikon-Zürich 1949, 22. Der Vortrag wurde in der Stadtkirche Thun und dann am 6.2.1949 im Berner Münster gehalten und bildete den äusseren Anlass für den sog. Feldmann-Streit in Bern; vgl. dazu Karl Barth, Offene Briefe 1945-1968, Zürich 1984, 214-273. 60 lich, wie schwer ein „gerechtes“ Urteil über geschichtliche Alternativen und geschichtliche Schuld ist. Dietrich Bonhoeffer hat im Blick auf das Phänomen geschichtlich-politischer Schuld in einem Fragment seiner "Ethik"39 zwischen Vergebung und Vernarbung unterschieden. "Die Kirche erfährt im Glauben die Vergebung aller ihrer Sünden und einen neuen Anfang durch Gnade, für die Völker gibt es nur ein Vernarben der Schuld in der Rückkehr zur Ordnung, zum Recht, zum Frieden, zum freien Ergehenlassen der kirchlichen Verkündigung von Jesus Christus."40 Im Leben der Völker ist es eine Erfahrung, dass aus einem ursprünglichen Fluch Segen werden kann und bisweilen wird (und Christen glauben, dass dies durch Gottes gnädiges Regiment in der Geschichte geschieht), dass aus Aufruhr Ordnung, aus Blutvergiessen Frieden hervorgehen können. Wäre in Deutschland ein Rechtsstaat entstanden, wenn die Alliierten mit Hitler 1943/44 Frieden geschlossen hätten? Hat die Franco-Diktatur vielleicht auch die Sensibilität für die Gefährdungen des Rechtes in der Demokratie geschärft? Es geht hier um historische Möglichkeits- und stets problematische Zurechnungsurteile; von der damit erfassten Erfahrung meint Bonhoeffer, dass Schuld hier nicht mehr individuell zugerechnet und geahndet (und dann vielleicht vergeben) werden kann, sondern dass die Zeit die Wunden durch Vernarbung heilen wird. In diesem Sinne – Überwindung von Unrecht durch Vernarbung unter gleichzeitigen Anstrengungen zur Heilung der Wunden – muss die Arbeit der TRC als ein Vorbild gewürdigt werden, mit geschichtlicher, überindividueller Schuld mittels rückhaltloser Aufdeckung der Wahrheit umzugehen, ohne diese Schuld personal zurechnen und individuell vergeben zu können. „Vernarbung“ im Sinne Bonhoeffers stellt sich freilich nicht allein durch den Zeitverlauf ein. Sie muss gewollt, ermöglicht und verwirklicht werden. Vernarbung ist nicht möglich, wenn alte Wunden immer wieder neu aufgerissen werden oder neue zugefügt werden. Insofern kam und kommt der Frage von Reparationen und Rehabilitationen eine ganz entscheidende Bedeutung als Folge der bisherigen TRC-Arbeit zu. Aber das neue Südafrika ist nicht reich genug, die Folgen der Apartheid in kurzer Zeit zu überwinden. Vernarbung hat keine Chance unter Bedingungen der Verarmung und der Ausschliessung einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb hat Wolfram Kistner zurecht gesagt: „Die Verarmung der Mehrheit der Südafrikaner ist entsprechend dem Kontext der fünften Bitte des Vaterunsers ... auch Folge unseres Versagens, auf die Vergebung Gottes, die wir empfangen haben, so zu antworten, dass sie sich auf unseren Umgang und auf die Verwaltung der Gaben auswirkt, die er uns zur Erhaltung menschlichen Lebens und der Schöpfung anvertraut hat.“41 Wem nicht die Schuld, wohl aber die Strafe durch 39 DBW 6, München 1992, bes. 133-136. Diesen Gedanken Bonhoeffers nahm Kistner in seinem Berliner Vortrag auf: Schuld und Versöhnung in Südafrika, a.a.O., 71-74. 40 Ebd., 134. 41 A.a.O., 72. Kistner verweist in diesem Zusammenhang auf Frank Crüsemann, „Wie wir vergeben unsern Schuldigern“. Schuld und Schulden in der biblischen Tradition, in: M. Crüsemann/W. Schottroff, Schuld und Schulden, München 1992, 90-103. 61 Amnestie erlassen wird, dem sollen die Schulden der Anderen nicht gleichgültig sein. Amnestie und der Kampf um soziale Gerechtigkeit gehören zusammen.42 3. Die existentielle und die religiöse Schuldfrage Ganz anders verhält es sich mit der persönlichen Schuld. Was ich mir als Schuld zurechne – und ich muss es mir, sofern es Schuld ist, selbst zurechnen und nicht nach einem allgemein-abstrakten Gesetz mir von anderen zurechnen lassen (denn dies ist ja charakteristisch für die Schuldzurechnung in der Sphäre des Rechtes) – , das kann, muss aber nicht auf anerkannte rechtliche Vorwürfe oder allgemein Vorwerfbares bezogen sein, welche jeder rechtlich urteilsfähige Mensch erheben könnte. Ich kann vor mir selbst (oder vor Menschen, die für mein Selbstverhältnis und Selbstverständnis massgeblich sind) in Hinsichten schuldig sein, an welche kein Strafrecht und keine Pflichtenethik heranreichen. Möglicherweise betrifft diese Erfahrung häufig weniger Handlungen als vielmehr Unterlassungen. Denn im Vergleich zu dem, was ein Mensch getan hat (und was, sofern es auch sichtbar in Erscheinung getreten ist, nicht nur sittlicher, sondern auch rechtlicher Beurteilung zugänglich ist), ist das, was jemand unterlassen hat und wofür er oder sie sich gleichwohl verantwortlich weiss, nur sehr schwer bestimmbar. Es gibt Unterlassungen, die von keinem Strafgesetztatbestand der unterlassenen Hilfeleistung erfasst werden und dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – ein Gewissen schwer belasten können. Überhaupt scheinen moralische Verantwortung und Schuld mit dem „Gefühl“ für Sittlichkeit zu korrelieren, und zwar in individuell stets besonderer Weise. Dies dürfte mit dem nicht trivialen Umstand zusammenhängen, dass Gewissensbildung immer ein Prozess der Individuierung ist. Und in diesem Prozess wird auch – jedenfalls in vielen Lebensläufen – eine abgestufte Bereitschaft und Fähigkeit der Selbst- und (akzeptierten) Fremdzurechnung von Verantwortlichkeit entwickelt. Banal gesagt: Wo der eine sich moralisch infrage gestellt fühlt, hat die andere keine Bedenken. Es stehen immer auch komplexe und biographisch entwickelte Selbst- und Fremdbilder auf dem Spiel, und diese können sich wiederum in der Generationenabfolge verändern und verschieben. Die TRC hat anscheinend aus wohl erwogenen Gründen sich nicht angemasst, zu beurteilen, was die wahren Verhaltensgründe derer waren, die ausgesagt haben. Kein weltlicher Richter kann jemals in das Herz eines Angeklagten sehen. Umso wichtiger ist, ob und wie Menschen ohne den Zwang des Gesetzes sich selbst und ihren Mitmenschen gegenüber zur existentiellen Rechenschaft fähig werden. Wann werden die Kinder der Verteidiger der Apartheid die Väter- und Grossmüttergeneration fragen: Was hast Du damals gemacht, 42 Eine hier anschliessende Frage betrifft die Mitverantwortung der Völkergemeinschaft und insbesondere der Staaten, die selbst und deren Wirtschaftsunternehmen mit Südafrika während der Apartheidszeit ökonomische und politische Beziehungen unterhielten. In der Schweiz und in Deutschland wurde 1999 eine „Internationale Kampagne für Entschuldung und Entschädigung im südlichen Afrika“ lanciert; vgl. dazu Mascha Madörin/Gottfried Wellmer/Martina Egli, Apartheidschulden. Der Anteil Deutschlands und der Schweiz, Stuttgart 1999. Ich selbst stehe einem generellen, unbedingten Schuldennachlass (der nach gelegentlich erhobenen Forderungen sogar auf die gesamte sogenannte Dritte Welt ausgedehnt werden soll) aus unterschiedlichen, hier aber nicht darzulegenden Gründen skeptisch gegenüber und befürworte statt dessen entschieden einen Solidaritätsfonds für die Opfer der Apartheid, welcher den südafrikanischen „President’s Fund“ für Reparationen und Rehabilitation ergänzen und unterstützen könnte. 62 und was hast Du vor allem nicht getan? Dann wird es unausweichlich, das eigene Leben zu erzählen und ganz aus freien Stücken Rechenschaft zu geben. Für religiös geprägte Menschen – und wer wäre das in Südafrika nicht? – hat die existentielle Schuldfrage noch eine besondere Dimension. Theologisch gesprochen äussert sich Schuld, wo ein Mensch sich vor Gott zu verbergen und ihn zu fliehen sucht, um dadurch auch sich selbst und seiner mitmenschlichen Verantwortlichkeit zu entkommen. Es spricht vieles für die ebenfalls theologische Einsicht, die hier freilich nicht weiter ausgelegt werden kann, dass diese Art von existenzieller Schuld erst dann und dadurch voll zu Bewusstsein kommt, wenn sie durch die Erfahrung einer zuvorkommenden, bedingungslosen Vergebung – und nicht durch (verhärtende) Schuldvorwürfe und Anklagen – aufgedeckt wird.43 Diese existenziell-religiöse Dimension der Schuld, hinsichtlich der die klassische Theologie des Buss-Sakramentes zwischen den Akten der contritio cordis, confessio oris und satisfactio operis unterschieden hat, geht Recht, Politik und Öffentlichkeit nun allerdings schlechterdings nichts an – in dieser individuell entscheidenden Dimension gilt das Gebot der Urteilsenthaltung, weil hier ein Anderer allein richtet und freispricht, ja, weil hier schon freigesprochen ist. Diese Urteilsenthaltung hinsichtlich des Gewissens schliesst natürlich die Gewissensbildung nicht aus, aber sie ist notwendig und strikt zu respektieren, damit hinsichtlich der äusseren Handlungen und Unterlassungen ebenso wie hinsichtlich der klar erkennbaren (politischen oder anderen) Tatmotive der Wahrheit die Ehre gegeben und unter dieser Voraussetzung dann auch sorgfältig geurteilt und geahndet werden kann, wo das menschliche Zusammenleben dies mit Notwendigkeit erfordert. Die freie Schuldübernahme ohne Zurechnung äusserer Handlungen als primärer Ursache geht also weit über das, was von Menschen intersubjektiv erwartet werden kann, hinaus. Es gibt aus den Verhandlungen der TRC Beispiele dafür, dass genau dies auch geschehen ist. Wolfram Kistner hat in seinem Berner Vortrag im Dezember 1997 eindringlich darüber berichtet, wie der methodistische Bischof von Johannesburg, Paul Verryn, von Winnie Madikizela-Mandela fälschlich und schändlich angeschuldigt, dieselbe doch um Versöhnung gebeten hat. Und ich darf noch einmal an das eingangs erwähnte Beispiel Joe Seremanes erinnern: Die überwindende Kraft der einseitigen Vergebung ermöglicht, die Wahrheit aufzudecken, ihr standzuhalten und Versöhnung in und durch eine neue Gerechtigkeit zu suchen. 4. Notwendige Unterscheidungen Ich denke, dass aus dem Gesagten deutlich geworden ist, wie wichtig es ist, zwischen juristischer, politischer und individueller Schuld(selbst)zurechnung zu unterscheiden. Die TRC in Südafrika bezieht ihre Arbeit vor allem auf die politische Ebene, indem sie eine strafrechtliche Würdigung weitgehend ausschliesst, aber auch die individuell-religiöse Dimension von Schuld und Verantwortlichkeit als Amnestievoraussetzungen ausdrücklich ausspart. Vielleicht ist es eine ganz spezifische Herausforderung an die Kirchen, 43 Traugott Koch zitiert in seinem erwähnten Aufsatz eine ehemalige Nazifunktionärin mit den Worten: "Die verzeihende Liebe, die mir begegnet war, schenkte mir die Kraft, unsere und meine Schuld anzunehmen. Erst jetzt hörte ich auf, Nationalsozialist zu sein." A.a.O., 119. 63 den Zusammenhang dieser drei Dimensionen, ihre notwendige Unterscheidung, aber auch ihre Wechselwirkungen immer aufs Neue zu aufzudecken und zu bedenken, damit die Täter ihrer unvertretbaren Verantwortlichkeit inne werden und die Opfer die Kraft finden, den Tätern neue Gemeinschaft ohne Vorbedingungen zu ermöglichen. Eine Schlussbemerkung: Ich habe in diesem Beitrag den Zusammenhang von Gerechtigkeit und Versöhnung vor allem im Blick auf die TRC in der Dimension der strafenden Gerechtigkeit angesichts geschichtlicher Schuld thematisiert. Das System der Apartheid bildete aber nicht nur eine Form der Unfreiheit im Sinne einer auf Rassenmerkmalen gegründeten pseudolegalen Sklavenhaltergesellschaft, sondern es diente auch schlicht der materiellen Ausbeutung schwarzer Arbeitskraft. Nach dem Wegfall der formalen Rassenschranken reproduzieren die südfrikanischen Märkte, Institutionen und Interaktionsstrukturen nach wie vor Klassenunterschiede und -schranken. Versöhnung in Gerechtigkeit fordert deshalb auch einen materiellen Lastenausgleich im Bildungswesen, in der Landwirtschaft, im Wohnungsbau und in der Arbeitswelt. Doch dieses ganze Feld – die Frage nach den Bedingungen einer Frieden und Gerechtigkeit fördernden Wirtschaftsverfassung – muss hier unerörtert bleiben. 64 6.c. Was kann Entwicklungszusammenarbeit zwischen der Schweiz und Südafrika zur Konfliktbewältigung beitragen? von Andreas Loebell Kein Hilfswerk und kein Akteur der Entwicklungszusammenarbeit, der in Südafrika tätig ist, kann die aus der Apartheid geerbte soziale Ungleichheit ignorieren, die heute immer noch entlang rassischer Linien verläuft. Daran ändert auch die kleine schwarze Oberschicht und Elite nichts, die den sozialen Aufstieg vollzogen hat. In allen brennenden sozialen und entwicklungspolitischen Herausforderungen des Landes wie Arbeitslosigkeit, HIV-AIDS, Stadt-Land-Gefälle oder dem Zugang zu Ressourcen wie Land, Wasser, Gesundheit und einer menschenwürdigen Behausung oder Elektrizität spiegeln sich auch heute – fast 10 Jahre nach den ersten freien Wahlen – die durch die Apartheid geschaffenen enormen Diskrepanzen. Der ANC und die Regierungen unter den Präsidenten Mandela und Mbeki sind 1994 mit der Verpflichtung angetreten, der Überwindung dieser Ungleichheiten oberste Priorität zu geben, mit einer entsprechenden Wirtschafts- und Sozialpolitik, aber auch mit der für den Aufbruch des neuen Südafrikas geschaffenen Wahrheitskommission TRC. Sie sollte mithelfen, den Weg zu einer Versöhnung zu öffnen. Heute sieht die Bilanz dieses Ausgleichs allerdings eher düster aus. Die Schwarzen sind ärmer, die Weissen reicher geworden. Seit 1994 hat sich die Arbeitslosigkeit fast verdoppelt und liegt bei rund 30 Prozent. Die Einkommen schwarzer Haushalte sind um fast 20 Prozent zurückgegangen, während die Einkommen weisser Haushalte um 15 Prozent gestiegen sind. 44 Das neoliberale Wirtschaftsprogramm der südafrikanischen Regierung hat sich statt an den Bedürfnissen der durch die Apartheidpolitik Benachteiligten vor allem an Rationalisierungen und der Senkung von Produktionskosten orientiert. Wohl ist es gelungen, die Infrastruktur für Teile der Bevölkerung zu verbessern, aber was nützt ein Strom- oder Wasseranschluss einer Familie, der das Einkommen fehlt, diese Produkte auch zu erwerben. Seit 1994 sind rund eine Million Arbeitsplätze verloren gegangen, vor allem in der Landwirtschaft und im Bergbau. Heute leidet jeder vierte Haushalt des an Ressourcen überaus reichen Südafrikas unter chronischer Armut. Die Armutsentwicklung in Südafrika stellt auf dem Hintergrund der Apartheidvergangenheit ein nicht zu unterschätzendes soziales Spannungspotential dar, das die relative Stabilität Südafrikas und damit der ganzen Region nachhaltig bedrohen könnte. Soziale Bewegungen, Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und Kirchen in Südafrika fordern immer deutlicher eine Umkehr dieser Wirtschaftpolitik, wirksamere Massnahmen zur Armutsbekämpfung und andere Prioritäten im Staatshaushalt. In der noch jungen Demokratie werden diese Stimmen aus der Zivilgesellschaft von der Regierung immer häufiger als illegitim zurückgewiesen. Die Förderung der organisatori44 Studie University of Western Cape, Cape Town 2003 65 schen und fachlichen Kapazitäten von Nichtregierungsorganisationen oder kirchlicher Basisorganisationen bildet für HEKS zum Beispiel einen wichtigen Anknüpfungspunkt für Krisenprävention und soziale Gerechtigkeit. Diese Entwicklung einer wachsenden sozialen Ungleichheit stellt auch die Versöhnung der in der Vergangenheit so tief gespaltenen südafrikanischen Gesellschaft vor ernste Herausforderungen. Auf der einen Seite leben die Opfer der Apartheid in ihrer überwiegenden Mehrheit heute in Armut. „Opfer“ wird hier in einem umfassenden Sinn verstanden und meint Menschen, gegen die schwere Menschenrechtsverletzungen verübt worden sind, wie Folter, Mord, Vergewaltigung oder willkürliche Verhaftungen, schliesst aber auch die rund sechs Millionen Menschen ein, die zwangsweise von ihrem Land vertrieben wurden und schliesslich die Millionen schwarzer, farbiger, aber auch indischstämmiger Frauen und Männer, die unter der Apartheid systematisch entrechtet und ihrer Würde beraubt worden sind. Auf der anderen Seite leben die meisten Täter, die Mitläufer und die Profiteure des Systems der Rassentrennung im Wohlstand. Dieses alte Bild im neuen Südafrika wirft heute auch ein anderes Licht auf die Wahrheitskommission. Ein Prozess, der als innovatives und Opfer-zentriertes Verfahren begann, verkehrte sich im Laufe der Jahre immer mehr in ein Täter-freundliches Instrument einer auf der Strecke gebliebenen Versöhnung. Mit der Wahrheits- und Versöhnungskommission TRC hatte das Land ohne Zweifel einen beispielhaften Prozess in Gang gebracht. Das geschehene Unrecht wurde ans Licht gebracht und mit der Anerkennung des Leidens wurde ein Schritt zur individuellen wie zur kollektiven Verarbeitung und Heilung von Verbrechen der Apartheid ermöglicht. Die TRC gab den Tätern die Möglichkeit der Amnestie, sofern sie ihre Taten offen legten und ihre Verantwortung eingestanden. Die TRC verzichtete also bewusst auf Vergeltung. Schliesslich verpflichtete sich der Staat mit der TRC rechtlich und moralisch dazu, den Opfern stellvertretend Entschädigung zu leisten, als symbolischen aber auch materiellen Beitrag zur Bewältigung ihrer Leiden und Verluste. Über mehrere Jahre haben wir haben als Hilfswerk zum Beispiel Initiativen und Projekte der südafrikanischen Zivilgesellschaft unterstützt, die auch jenen Zehntausenden von Opfern und Gemeinschaften die Möglichkeiten gaben, über das erfahrene Unrecht zu sprechen und „ihre Erinnerungen zu heilen“ (Healing the Memories), die nicht vor der Wahrheitskommission TRC erscheinen konnten und nicht im Scheinwerferlicht von Fernsehkameras standen. Eine ganz wichtige Erkenntnis auch dieser „basisnahen Aufarbeitungsprojekte“ war, dass zum langwierigen Prozess der Wiedererlangung der menschlichen Würde und des Selbstwertgefühls auch eine wiederherstellende Gerechtigkeit gehört, eine Anerkennung des begangenen Unrechts und ein sichtbarer Ausgleich. Für die Einrichtung der Wahrheitskommission ist die südafrikanische Regierung international gelobt worden. Bei den Angehörigen der Opfer hat sie jedoch inzwischen viel von ihrem Kredit verspielt. 66 Zuletzt Mitte April 2003, als Präsident Mbeki wesentliche Empfehlungen der Wahrheitskommission zur Opferentschädigung ignoriert bzw. zurückgewiesen hat. Statt die registrierten Opfer – etwa 22'000 Personen – über sechs Jahre zu entschädigen, gestand der Präsident den Opfern nur eine einmalige Zahlung von umgerechnet etwa 5'000 Franken zu. Vergleicht man diesen Umgang mit den Apartheidopfern etwa mit den Pensionen, welche den Staatsbeamten des Apartheidregimes bis zu ihrem Tod gesichert ist und die aus Steuergeldern finanziert werden oder mit den weitaus grosszügigeren Sonderpensionen für ältere, aus dem Exil zurückgekehrte Befreiungskämpfer, so werden die Unterschiede offenkundig. Die Wahrheitskommission hatte in ihrem Schlussbericht auch die Mitverantwortung südafrikanischer und internationaler Konzerne für Menschenrechtsverletzungen während der Apartheid hervorgehoben. Als eine Form der Wiedergutmachung der südafrikanischen Konzerne, die von der Apartheid profitiert hatten, wurde eine Steuer empfohlen, die von der südafrikanischen Regierung jedoch abgelehnt wurde. Stattdessen kritisierte Präsident Mbeki die Zivilklagen, die von Apartheidopfern vor amerikanischen Gerichten gegen internationale Konzerne eingereicht worden sind, und rief die in- und ausländischen Konzerne zu freiwilligen Zahlen auf. Frühere Aufrufe von Desmond Tutu für freiwillige Spenden zu Gunsten der Opfer blieben bisher ohne grossen Erfolg. Der von südafrikanischen Konzernen gegründete „Business Trust“, der Sozial- und Gesundheitsprojekte finanziert, hat bisher lediglich 800 Mio. Rand (ca. 130 Mio. CHF) an Zuwendungen erhalten. Und nach Einschätzung der Wahrheitskommission umfasst der von der DEZA gemeinsam mit Schweizer Firmen aufgelegte Entwicklungshilfefonds nur Zuwendungen in der Höhe von 0,02 Prozent der jährlichen Gewinne, die Schweizer Banken und Firmen in Geschäften mit dem Apartheidregime erwirtschafteten. Hier liegt heute auch eine Verpflichtung von Hilfswerken wie dem HEKS, das seit den 80er Jahren zusammen mit anderen Trägern der Antiapartheidbewegung in der Schweiz anwaltschaftlich für Sanktionen und gegen die Unterstützung der Apartheid durch Kredite von Schweizer Banken eingetreten ist. Auf den Wunsch und das Drängen unserer Partnerorganisationen in Südafrika haben wir neben Projektunterstützungen in Südafrika damals auch Sanktionen als Druckmittel unterstützt, hat HEKS seine Konten bei der Schweizerischen Bankgesellschaft aufgelöst oder das Sonderprogramm gegen den Rassismus des Weltkirchenrates unterstützt. Es war unter anderen auch ein gewisser Thabo Mbeki, der am 13. September 1989 während eines Besuchs in der Schweiz auf die „besondere Rolle der Schweizer Banken bei der Umschuldung“ hinwies und dazu aufrief, „allen möglichen Druck auf die Schweizer Banken auszuüben“, dem südafrikanischen Regime nicht mit einer Umschuldung unter die Arme zu greifen. Eine Umschuldung, die dann bekanntlich unter Beteiligung von Schweizer Banken und koordiniert von Fritz Leutwiler durchgeführt worden war. Die südafrikanische Zivilgesellschaft und besonders marginalisierte Bevölkerungsgruppen wie Vertriebene, Landlose, Frauen und Männer, die schwere Menschenrechtverlet67 zungen erlitten, haben ausserhalb von Südafrika keinerlei Lobby –im Unterschied etwa zur südafrikanischen Regierung oder mächtigen Interessengruppen der Privatwirtschaft. Marginalisierte Gruppen in Südafrika haben heute noch weniger Möglichkeiten und Kanäle als während der Apartheid, ihre Anliegen, ihre Situation und ihre Wahrnehmungen in die schweizerische Öffentlichkeit einzubringen. Das ist mit ein Mandat von Organisationen wie dem HEKS, nämlich deren Stimme bei uns hörbar zu machen, Verständnis und Unterstützung zu finden und wenn nötig als „Briefträger“ oder „Türöffner“ tätig zu werden. Wir verstehen es als einen Beitrag zur Konfliktbewältigung, wenn Transparenz über die vergangenen Beziehungen zwischen der Schweiz und Südafrika geschaffen wird, und wir setzen uns dafür ein, dass Staat, Politik, Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft in unserem Land Anerkennung und Mitverantwortung für begangenes Unrecht zeigen. Es kann keine versöhnten und geheilten Beziehungen zwischen Menschen und Ländern geben ohne Wahrheit und Recht. Thandiwe Shezi von der südafrikanischen Opfer-Selbsthilfegruppe Khulumani (sie vertritt 32'000 Apartheidopfer und hat in den USA eine Klage gegen internationale Konzerne eingereicht), brauchte lange, bis sie über die Folter und Vergewaltigung sprechen konnte, die sie unter der Apartheid im Gefängnis erlitten hat. Im April machte sie vor den Medien in Frankfurt deutlich, wie wichtig es für die Opfer ist, dass die Unternehmen und Banken Rechenschaft über ihre Beziehungen zum Apartheidregime ablegen, Entschädigung leisten und anerkennen, dass Millionen von Menschen unglaubliches Unrecht geschehen ist. Wozu sie denn das Geld brauchen würde, wollte ein Journalist wissen. Thandiwe nannte die mangelnden schulischen Möglichkeiten für arme Kinder und Jugendliche und sprach von den Verschwundenen, die noch immer nicht gefunden und beerdigt seien. Sie machte aber auch klar, dass jede Entschädigung nur symbolische Wiedergutmachung sein kann. 68 6.d. Stichworte zur innerafrikanischen Kontroverse zwischen Desmond Tutu und Wole Soyinka zusammengestellt von Erwin Koller, Moderator der Clubs 1. Desmond Tutu: Keine Zukunft ohne Versöhnung (Patmos 2001) Wortlaut der neuen südafrikanischen Verfassung (im Buch S. 45): „Die Annahme dieser Verfassung legt das sichere Fundament für die Menschen Südafrikas, die Teilung und die Zwietracht der Vergangenheit zu überwinden, die in gewalttätigen Konflikten grobe Verletzungen der Menschenrechte und Verstösse gegen menschliche Prinzipien und ein Vermächtnis aus Hass, Furcht, Schuld und Rache hinterlassen hat. Dieses Vermächtnis kann nur auf der Basis des Verständnisses und nicht der Rache, auf Basis der Wiedergutmachung und nicht der Vergeltung, auf Basis von Ubuntu und nicht von ungerechter Behandlung aufgearbeitet werden. Um die Versöhnung und den Wiederaufbau voranzutreiben, soll eine Amnestie nach Berücksichtigung der Taten, Unterlassungen und Vergehen mit politischem Kontext, die vor dem Hintergrund der Konflikte der Vergangenheit begangen wurden, gewährt werden. Zu diesem Zwecke sollte das Parlament unter dieser Verfassung ein Gesetz beschliessen, das feste Termine setzt … und für die Gremien, die Kriterien und die Verfahren, einschliesslich von Tribunalen, sorgt und festlegt, wie die Amnestie gehandhabt wird, nachdem dem Gesetz zugestimmt wurde.“ „Diejenigen, die die Vergangenheit nicht zu erinnern vermögen, sind dazu verurteilt, sie zu wiederholen.“ Ausspruch von George Santayana, dem Buch als Motto vorangestellt. Wir wollen keine Siegerjustiz, keinen Nürnberger Prozess, keine automatische Amnestie: „Eine Generalamnestie würde in Wahrheit eine Amnesie bedeuten.“ Wer alle Fakten seiner Untat auf den Tisch legt, bekommt die Chance, von einer Strafe befreit zu werden. Die Aussprache des Unrechts heilt Opfer. Vergebung verleiht Menschen Kraft, befähigt sie, zu überleben und menschlich zu bleiben, trotz aller Bemühungen, sie zu entmenschlichen. Die Strafe für die Täter besteht in ihrer öffentlichen Blossstellung und Demütigung. Der Preis dieser Art von Versöhnung für die Opfer ist, dass sie ihr Recht auf Zivilklage, Schadenersatz und Schmerzensgeld verlieren. Von „Wiedergutmachung“ zu reden wurde darum von der Kommission bewusst vermieden. Wichtig war das Beispiel Mandelas, nach 27 Jahren Gefängnis. Und Martin Luther King: „Wenn wir nicht lernen, gemeinsam als Brüder und Schwestern zu leben, werden wir gemeinsam als Narren sterben.“ „Es geht darum, dass man die Täter aus der Verantwortung für ihre Taten entlässt, wenn man die Hoffnung in sie aufgibt, wenn man sie als Monster und Dämonen verdammt.“ (S. 74) 69 „Ich habe stets behauptet, dass der Unterdrücker im gleichen Masse entmenschlicht wird wie die Unterdrückten, wenn nicht sogar mehr.“ (S. 89) „Eine der blasphemischsten Folgen von Unrecht, besonders von rassistischem Unrecht, ist, dass es ein Kind Gottes zweifeln lassen kann, ein Kind Gottes zu sein.“ (S. 163) „Vergebung bedeutet nicht vergessen… Vergebung bedeutet nicht, über etwas Geschehenes hinwegzusehen… Vergebung bedeutet nicht bloss, sentimental zu sein… Vergebung bedeutet, das Recht aufzugeben, es dem Täter mit gleicher Münze heimzuzahlen, aber das ist ein Verlust, der das Opfer befreit.“ (S. 224f.) „Die Bereitschaft zu Konzessionen ist ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche.“ (S. 232) „Es ist etwas schwierig für mich zu verstehen, warum die Juden so gerne die umfangreichen Reparationszahlungen der europäischen Regierungen und Institutionen auf Grund ihrer Komplizenschaft im Holocaust entgegennehmen. Denn wenn wir das Argument akzeptieren, sie könnten nicht im Namen all jener vergeben, die in der Vergangenheit litten und starben, wie können sie dann in deren Namen die Reparationszahlungen annehmen?“ 2. Wole Soyinka: Die Last des Erinnerns. Was Europa Afrika schuldet – und was Afrika sich selbst schuldet (Patmos Verlag 2001). Soyinka schreibt vor dem Hintergrund der Beobachtungen beim Human Rights Investigation Panel für Nigeria. Dieses Panel erhebt nur den Anspruch auf Feststellung von Fakten, wie andere Kommissionen dieser Art – jedoch im Unterschied zur Südafrikanischen Wahrheitskommission, die eine nationale Versöhnung anstrebt. Figuren, die nach solchen Kommissionen rufen sind Mobutu, Pol Pot, Abacha, Abiola. Soyinka übt Kritik an der christlich geprägten Konzeption von Desmond Tutu. Die Verbrecher kommen zu gut weg. Was da gewährt wird, ist eine billige Gnade. Wenn Tutu sagt: Jede Geste der Vergebung ist eine Aufforderung an die Täter zur Reue und Wiedergutmachung, gibt Soyinka zur Antwort: „Sie sind ein Heiliger!“ Wahrheit als einzige Forderung und Voraussetzung zur Versöhnung genügt nicht. Auch Gerechtigkeit und Verantwortung gehören dazu. „Die Forderung nach Entschädigung wird nicht wieder verschwinden.“ Konkret fordert er z.B. eine Steuer für Weisse, die von der Apartheid profitiert haben. Er verlangt eine begleitende Mission des Heilens, der Versöhnung, der Wiedergutmachung und Mechanismen zur Verhinderung ähnlicher Taten in der Zukunft. Eine Tat ist nie nur gegen den einzelnen gerichtet. Sie richtet sich gegen die Gemeinschaft. Darum muss auch die Gemeinschaft bestimmen, wie sie gut zu machen ist. Der Einzelne ist oft überfordert, sei es wenn er Rache verlangt oder wenn er Vergebung gewährt. Es gibt auch eine verminderte Zurechnungsfähigkeit der Opfer. Fazit (S. 83): „Das Beispiel Südafrika ist keines, das wir … zur Besänftigung der Seelenqualen dieses Kontinents zu empfehlen wagen und erst recht nicht für die Wiedergutmachung jener Gewalttaten, die immer noch gegen seine Bewohner begangen werden.“ 70 7. Der Embryo – Mensch oder menschliches Leben? von Prof. Johannes Fischer45 (GEF-Referat an der Mitgliederversammlung vom 14. Mai 2003) I. Das Thema, über das ich sprechen werde, wird, wie Sie wissen, höchst kontrovers und teilweise sehr leidenschaftlich diskutiert. Lassen Sie mich daher zwei Bemerkungen vorausschicken, die Ihnen meinen Umgang mit dieser Thematik verdeutlichen sollen. Mein Beruf ist die Ethik, genauer die evangelische Ethik. Ich will daher vorweg etwas sagen zu dem Verständnis von Ethik, dem ich mich verpflichtet fühle. Gerade in der Frage, was Ethik ist und leisten soll, trifft man manchmal auf gewisse Unklarheiten. Das betrifft vor allem die Unterscheidung bzw. Verwechslung von Ethik und Moral. Die Vorstellung ist dann, dass derjenige der entschiedenste Anwalt der Ethik ist, der am konsequentesten und unbeirrbarsten einen bestimmten moralischen Standpunkt vertritt, mag es um Schwangerschaftsabbruch, um Sterbehilfe oder um die Forschung an embryonalen Stammzellen gehen. Demgegenüber ist daran zu erinnern, dass Ethik von ihren Anfängen an etwas Anderes war und ist, nämlich: ein kritisches und vor allem selbstkritisches Überdenken vorhandener moralischer Überzeugungen; das heisst gerade: Distanznahme vom eigenen moralischen Standpunkt; die Bereitschaft, diesen zur Diskussion zu stellen und im Lichte besserer Gründe und Argumente zu überprüfen; die faire Erwägung von anderen Positionen, Einwänden und Gegenargumenten; das SichOffenhalten dafür, dass man auch irren und niemals sicher sein kann, im definitiven Besitz der Wahrheit zu sein; die Einladung an Andere, an diesem Reflexionsprozess mit offenem Ausgang teilzunehmen. Ethik hat zum Ziel, mit solcher Einladung zur Distanznahme die Dinge noch einmal genau anzusehen: Ist es denn so, wie wir glauben, dass es ist? Das beginnt mit der schlichten Frage: Warum? Warum ist es moralisch falsch, an menschlichen Embryonen zu forschen oder sie zur Gewinnung von Stammzellen zu nutzen? Wer so fragt, der setzt seine moralische Überzeugung der Überprüfung im Lichte von Gründen pro und contra aus, und er riskiert damit, dass er sie am Ende womöglich im Lichte besserer Gründe revidieren muss. Warum ist diese Differenzierung zwischen Moral und Ethik wichtig? Wir brauchen heute eine ethische Kultur – und ich denke, die westlichen Gesellschaften sind dabei, sie auszubilden –, die auf der Bereitschaft zu ständig neuer diskursiver Überprüfung geltender moralischer Überzeugungen beruht. Die Welt, in der wir leben, ist nun einmal durch die Entwicklungen in Wissenschaft und Ökonomie einer Dynamik ausgesetzt, die einen dauernden Anpassungsprozess unserer lebensweltlichen Orientierungen erfordert. Der Ethik wächst dadurch die Aufgabe zu, einen unabschliessbaren Vergewisserungsprozess weiterzuführen, der unsere moralische Orientierung nach Möglichkeit in kritischer Entsprechung hält zu den ständigen Veränderungen, mit denen wir durch den wissenschaftlichen Fortschritt und die globale ökonomische Dynamik konfrontiert sind. 45 Vgl. auch den Aufsatz von Dr. Stephan Wehowsky im Kapitel 2 dieses Arbeitsblattes. 71 Das sollte nicht verwechselt werden mit einer bloss resignativen Anpassung unserer moralischen Überzeugungen an das, was ohnehin geschieht. Denn es vollzieht sich gerade im kritischen Bilden der eigenen Überzeugung und Einsicht im Lichte von Gründen und Argumenten. Und es zielt gerade darauf ab, dem, was geschehen könnte, nach dem Stand gegenwärtiger moralischer Einsicht die notwendigen Grenzen zu ziehen. Nicht alles, was gemacht werden kann, sollte auch gemacht werden. Die Verweigerung gegenüber einem solchen Vergewisserungs- und Lernprozess, das heroische Festzurren einmal eingenommener moralischer Positionen birgt demgegenüber die Gefahr in sich, dass man am Ende nur noch aus einer blossen Ohnmachtposition heraus die Welt, wie sie sich faktisch entwickelt, moralisch anklagen kann, statt sie verantwortlich mitzugestalten. Der auf Dauer gestellte ethische Vergewisserungsprozess, wie wir ihn gegenwärtig in den westlichen Gesellschaften erleben, erfüllt hier gewissermassen die Funktion, das Abgleiten in ein solches gnostisches Ohnmacht- und Fremdheitsgefühl gegenüber der Welt, die uns umgibt, nach Möglichkeit zu verhindern. Eine zweite Bemerkung. Sie betrifft den Unterschied zwischen dem moralisch Richtigen und dem politisch Richtigen. Wir leben in einer in ihrer Grundverfassung liberalen Gesellschaft, deren Vorzüge niemand von uns missen möchte. In dieser Gesellschaft ist es jedem freigestellt, seine Vorstellung von einem guten Leben zu verwirklichen, ohne dass wir uns dazu auf ein gemeinsames Konzept von einem „guten Leben“ verständigen müssten. Das unterscheidet die moderne Situation von der vormodernen Situation, dass nicht mehr allgemein und für jedermann verbindlich festgelegt werden kann, worin ein „gutes Leben“ besteht. Das muss jeder und jede für sich selbst herausfinden. Worüber wir uns jedoch verständigen müssen, ist das, was man eine „gute Gesellschaft“ nennen kann. Gemeint ist damit die Gesellschaft, in der wir gemeinsam leben wollen. So, wie wir nicht in einer Gesellschaft leben wollen, in der es willkürliche Grausamkeit gegenüber Tieren gibt und Tierquälerei dem individuellen Belieben des einzelnen überlassen ist, so geht uns gemeinsam die Frage an, wie in der Gesellschaft, in der wir leben, mit menschlichem Leben in seinem frühesten Stadium umgegangen werden soll und was mit ihm gemacht werden darf. Das möchten wir nicht dem individuellen Belieben und der Willkür des Einzelnen überlassen sehen. Bei der gesetzlichen Regelung dieser Frage geht es nun aber nicht nur um das moralisch Richtige und Falsche, sondern auch darum, was die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes aus eigener Überzeugung mitzutragen in der Lage sind. Denn andernfalls könnte die Situation entstehen, dass die Gesellschaft, in der sie leben, eben nicht die Gesellschaft ist, in der sie leben wollen, also eine in ihren Augen gute Gesellschaft, weil in ihr Dinge geschehen, die sie aus tiefster Überzeugung ablehnen. Insofern hat es seinen guten Sinn, dass das, was am Ende verbindliches Gesetz wird, nicht durch die Ethiker, sondern in einem politischen Prozess entschieden wird, bei dem am Ende allemal ein Kompromiss steht, der auf eine möglichst breite Abstützung in der Bevölkerung zielt. So wichtig es ist, in der Auseinandersetzung um das moralisch Richtige kompromisslos auf das bessere Argument zu setzen, so wichtig ist es doch andererseits, dabei das politische Ziel einer für die Gesellschaft im Ganzen akzeptablen gesetzlichen Regelung im Auge zu behalten. Das bedeutet, dass wir uns auch in unseren moralischen Kontrover72 sen als Bürgerinnen und Bürger verstehen sollten, die das gemeinsame Interesse an einem Gemeinwesen verbindet, mit dem sich nach Möglichkeit auch der Andersdenkende soll identifizieren können. Das sollte unseren moralischen Kontroversen die unversöhnliche Schärfe nehmen. Und es sollte davor zurückhalten, in der öffentlichen Auseinandersetzung über die zu treffende gesetzliche Regelung nur auf die Durchsetzung der eigenen moralischen Position aus zu sein. Ich sage dies als jemand, der in manchen bioethischen Fragen einer eher liberalen Position zuneigt, der aber sieht, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger damit ihre Schwierigkeiten haben. In diesem Sinne bedarf es nicht nur einer ethischen, sondern auch einer politischen Kultur im Umgang mit bioethischen Fragen. II. Ich komme damit zu dem mir gestellten Thema. Die Kontroverse um den Lebensanfang wird in der Regel unter der Fragestellung nach dem „moralischen Status des Embryos geführt“. Dabei geht es um die Frage, welche moralischen Pflichten wir gegenüber dem menschlichen Embryo haben, welche moralische Berücksichtigung er verdient, ob ihm bestimmte Rechte zuerkannt werden können oder ob der Träger von Menschenwürde ist. Die Antwort auf diese Fragen hängt davon ab, was ein menschlicher Embryo ist bzw. als was er anzusehen ist. Was können wir darüber wissen? Ich möchte in einem ersten Schritt ausgehen von der intuitiven Beunruhigung, die sich bei vielen Menschen in Anbetracht der verbrauchenden Nutzung von Embryonen für Zwecke der Forschung und Stammzellgewinnung einstellt. Die Untersuchung der leitenden Intuitionen ist bei vielen moralischen Problemen ein hilfreiches heuristisches Verfahren, um das moralische Problem einzugrenzen und die dahinter stehende normative Frage zu identifizieren. Fragen wir also: Was genau ist es, das bei solcher Nutzung verletzt wird? Ist es der Respekt vor dem Leben? Wohl kaum. Denn die Haltung des Respekts vor dem Leben schliesst die Vernichtung von Leben nicht aus. Das lässt sich gerade an der Ethik Albert Schweitzers verdeutlichen, für die die Haltung der Ehrfurcht vor dem Leben im Zentrum steht. Auch derjenige, der diese Haltung einnimmt, muss doch einräumen, dass er selbst ständig Leben nutzen und dabei vernichten muss, um sich selbst am Leben zu erhalten. Wer den menschlichen Embryo vor solch verbrauchender Nutzung schützen will, der muss dies daher mit etwas begründen, das den Embryo gerade von anderem Leben unterscheidet und aus ihm heraushebt. Das scheint die Tatsache zu sein, dass es sich bei ihm um menschliches Leben handelt. In der Tat wird in dieser Frage von verschiedenen Seiten mit einem spezifischen „Wert“ oder gar einer „Heiligkeit“ menschlichen Lebens argumentiert, um dessen herausgehobenen Status zu bezeichnen. Doch kann und muss man auch hier fragen, ob dies schon den entscheidenden Punkt trifft. Ist doch menschliches Leben auch eine jede menschliche Hautzelle, von der die meisten wohl kaum sagen würden, dass sie heilig ist und dass deshalb an ihr nicht geforscht werden darf. Das zeigt, dass es nicht allgemein um menschliches Leben geht, sondern konkret um den menschlichen Embryo. Offenbar verbinden wir mit diesem sehr viel mehr als nur dies, dass er menschliches Leben ist. 73 Wir verbinden mit ihm einen Menschen, zu dem er oder als der er sich entwickelt. Das unterscheidet ihn von einer Hautzelle. Offenbar ist es dies, was im Blick auf die verbrauchende Nutzung von Embryonen für die Forschung den intuitiven Widerstand erregt. Eine Bestätigung für dieses vorläufige Resultat, das wir auf dem Weg der Eingrenzung der Intuition gefunden haben, stellen die zentralen Argumente dar, mit denen man die besondere Schutzwürdigkeit des menschlichen Embryos zu begründen sucht. Sie alle versuchen diese Schutzwürdigkeit von dem Menschen abzuleiten, zu dem oder als der der Embryo sich entwickelt. Es sind in der Debatte vor allem drei Argumente, die hier angeführt werden. Das Identitätsargument macht geltend, dass der Embryo identisch ist mit diesem Menschen. Das Potentialitätsargument macht geltend, dass im Embryo bereits dieser Mensch angelegt ist. Das Kontinuitätsargument macht geltend, dass zwischen dem Embryo und diesem Menschen ein Kontinuum ohne erkennbare Einschnitte besteht. Alle drei Argumente zielen darauf ab, das, was den Menschen auszeichnet und seinem Leben eine besondere Schutzwürdigkeit verleiht, auf den Embryo zu übertragen. Das heisst nun aber in der Konsequenz: Menschliches Leben ist nicht als solches, qua menschliches Leben, schützenswert, sondern um des Menschen willen, dessen Leben es ist. In diesem Punkt kommt die allgemeine Problemwahrnehmung übrigens auch mit der Sicht des menschlichen Lebens in unserer religiösen Tradition überein. Bekanntlich hat in dieser Tradition der Mensch eine Sonderstellung gegenüber allen anderen Kreaturen. Fragt man, worin diese Sonderstellung begründet ist, dann bezieht sich alles, was in christlicher Sicht den Bereich des Menschlichen gegenüber den übrigen Kreaturen auszeichnet – ich nenne hier: die Gottebenbildlichkeit, die Erwählung des Menschen zum Bundespartner Gottes, die Rechtfertigung des Sünders, das Gebot der Nächstenliebe, das Tötungsverbot – auf den Menschen, und zwar auf den Menschen als Person46. Menschliches Leben verdient daher auch in christlicher Perspektive besonderen Schutz um des Menschen willen, um dessen Leben es sich handelt. Der Gedanke einer spezifischen47 Heiligkeit des menschlichen Lebens als solchen, unabhängig und in Absehung davon, dass es das Leben eines Menschen ist, ist der biblischen und christlichen Tradition fremd. Man trifft in der Diskussion um den Status menschlichen Lebens nun freilich auch auf eine hiervon abweichende Auffassung, die auf das menschliche Leben übertragen möchte, was vom Menschen gilt. So hat das deutsche Bundesverfassungsgericht geurteilt: „Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu“48. Das ist inso46 Zum Person-Verständnis dieser Tradition, das sich von dem in der Bioethik heute verbreiteten tief greifend unterscheidet, vgl. R. Spaemann, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen ‚etwas‘ und ‚jemand‘. 47 In der Sicht des Alten Testaments ist alles Leben heilig, insofern es von Gott kommt. Das aber schliesst nach dem Noah-Bund die Tötung von Tieren nicht aus. Worauf es an dieser Stelle ankommt, ist die Tatsache, dass das Tötungsverbot gegenüber Menschen nicht in einer spezifischen Heiligkeit menschlichen Lebens begründet ist, sondern darin, dass es sich um das Leben von Menschen handelt. 48 BverfGE 39, 1 <41>. In der Fortsetzung dieses Satzes heisst es allerdings: „...es ist nicht entscheidend, ob der Träger sich dieser Würde bewusst ist und sie selbst zu wahren weiss“. Unterstellt wird also, dass überall da, wo menschliches Leben ist, immer auch ein Träger dieses Lebens ist. 74 fern nicht unproblematisch, als der Begriff der Menschenwürde, jedenfalls nach der in dieser Diskussion immer wieder zitierten auf den Philosophen Immanuel Kant zurückgehenden Auffassung, sich ebenfalls auf den Menschen bezieht – und zwar auf den Menschen als Person – und nicht auf das menschliche Leben in einem rein biologischen Sinne. Wird also in dieser Frage mit der Menschenwürde argumentiert, dann verdient menschliches Leben allein deshalb besonderen Schutz, weil und insofern es sich um das Leben eines Menschen handelt. Es genügt dann nicht, den Embryo als „menschliches Leben“ zu beschreiben, um seine Schutzwürdigkeit zu begründen; vielmehr ist dann die entscheidende Frage, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Sinne man im Blick auf den Beginn menschlichen Lebens von einem Menschen sprechen kann. Dies ist m. E. die zentrale ethische Frage in dieser ganzen Diskussion. Diesbezüglich nun gibt es nun eine kategoriale Schwierigkeit. Der Begriff ‚Mensch‘ lässt sich nicht direkt auf einen Embryo anwenden im Sinne etwa der Aussage: Embryonen sind Menschen (im Sinne von menschlichen Personen). So, wie wir unterscheiden zwischen einem Menschen als Person und dem in die Perspektive der Biologie oder Medizin fallenden Körper bzw. Organismus, den er hat, so ist zu unterscheiden zwischen einem Embryo als dem Anfangsstadium eines Organismus und dem Menschen, den dieser Embryo möglicherweise verkörpert. Ein Organismus bzw. Embryo ist „etwas“, das in die Perspektive der Biologie fällt, eine menschliche Person hingegen ist „jemand“49. Um hier gleich einem nahe liegenden Missverständnis vorzubeugen, sei betont, dass das Wort ‚etwas’ nicht eine Sache meint, sondern dass es den Gegenbegriff zu ‚jemand’ bezeichnet. ‚Etwas’ ist alles, was nicht ‚jemand’ ist, also zum Beispiel auch eine Schnecke oder eine Ameise, die die meisten von uns nicht als ‚jemanden’, als Person, aber auch nicht als eine blosse Sache betrachten. Die Unterscheidung zwischen ‚jemand’ und ‚etwas’ ist in einem bestimmten Verständnis des Menschen als Person angelegt, das über die christliche Theologie Eingang in unser kulturelles Bewusstsein gefunden hat. Es hat seine Wurzeln in den sogenannten trinitarischen bzw. christologischen Kontroversen im 4. und 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Damals sah sich die Kirche dem Vorwurf des Tritheismus ausgesetzt, also dem Vorwurf, nicht einen Gott, sondern drei Götter zu verehren in Gestalt des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie musste die Frage beantworten, wie sich die Einheit Gottes wahren und dennoch von dieser Dreiheit sprechen lässt. Es ist hier nicht Raum, auf diese Debatte näher einzugehen. Nur das Ergebnis ist für unseren Zusammenhang wichtig: Es bestand darin, zwischen den drei göttlichen Personen und der einen göttlichen Natur zu differenzieren. Eine Person der göttlichen Trinität, nämlich der Sohn hat dabei zwei Naturen, eine göttliche und eine menschliche. Nach christlichem Verständnis ist Christus sowohl wahrer Mensch wie wahrer Gott. Aus dieser theologischen Differenzierung resultiert das Verständnis der Person, wie wir es kennen. Eine Person ist hiernach ein unverwechselbares Individuum, das als solches von seiner „Natur“, d. h. von allen Eigenschaften, die von ihm ausgesagt werden können und die nicht unverwechselbar sind, sondern die es mit anderen Personen gemeinsam hat – Haarfarbe, Körpergrösse usw. –, unterschieden ist. Sie ist nicht ein Exemplar von Dingen mit 49 Vgl. zu diesem Unterschied R. Spaemann, Personen..., a. a. O. 75 denselben Eigenschaften, nicht ein „Fall von etwas“, sondern das Wort ‚Person‘ ist, wie der Theologe Thomas von Aquin es ausgedrückt hat, ein Eigenname für ein „individuum vagum“, für ein unbestimmtes Individuum. Jemand ist Person, insofern er Träger eines Eigennamens ist. Er ist individuiert über eine Gemeinschaft von Personen, die sich wechselseitig in ihrer Individualität anerkennen50. Dieses ursprünglich auf die göttlichen Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist bezogene Person-Verständnis wurde in der Folge auf den Menschen übertragen. Danach ist eine menschliche Person unterschieden von ihrer leiblichen und psychischen51 „Natur“, die wir in Merkmalen und Eigenschaften – Körpergrösse, Haarfarbe usw. – beschreiben können und die ein „Fall von etwas“ ist, z.B. ein Fall von Darmkrebs (Leib) oder ein Fall von Schizophrenie (Psyche). Die Person ist nicht identisch mit ihrer Natur, sondern sie „hat“ diese Natur als das Medium ihres In-Erscheinung-Tretens und kann und muss sich zu ihr verhalten (Hinweis: Wahrnehmung eines komatösen Menschen). Die Unterscheidung zwischen ‚jemand’ und ‚etwas’ spiegelt diese Differenz zwischen der Person und ihrer leiblichen und psychischen „Natur“ wider. Aufgrund dieser kategorialen Differenz kann nun an einem Embryo nicht aufgewiesen werden, dass er einen Menschen – also ‚jemand’ – verkörpert, so wenig wie die rein biologische Untersuchung des Organismus eines geborenen Menschen die menschliche Person zeigt, deren Organismus es ist. Die Erforschung von ‚etwas’ führt nicht zu ‚jemand’. Insofern hilft die embryologische Forschung an diesem Punkt nicht weiter. Als ‚jemand’ tritt ein Mensch in einer anderen Perspektive in Erscheinung als jener der Biologie, nämlich in der Perspektive zwischenmenschlicher Kommunikation mit ihm, in der er als ein ‚Du’ begegnet.52 Das bedeutet nun freilich nicht, dass für das vorgeburtliche Leben die Perspektive auf eine menschliche Person, also auf ‚jemand’, von vorneherein unangemessen ist. Das Argument, dass der Embryo doch ersichtlich bloss ein Zellkonglomerat ist und dass daher von einem Menschen nicht die Rede sein könne, ist nichts anderes als die Verabsolutierung der Perspektive der Biologie. Es ist von derselben Art, wie wenn jemand auf den Organismus eines geborenen Menschen zeigen und sagen würde, dass es sich ersichtlich nur um einen Organismus – um ‚etwas’ – handelt und dass daher nicht von einer menschlichen Person die Rede sein könne, die dieser Körper verkörpert. Was berechtigt dann aber dazu, im Blick auf den Anfang menschlichen Lebens von einem Menschen – von jemand – zu sprechen, wenn dies doch am Embryo selbst gar 50 „In Wirklichkeit kann eine Person nur als Person unter Personen begriffen werden.“ Weizsäcker, Gesammelte Schriften, Bd. 7, 1986, 315. 51 Ich spreche bewusst von der leib-psychischen und nicht von der leib-seelischen Natur. Denn die Seele ist nach dem Verständnis der theologischen und philosophischen Tradition gerade dasjenige, was die Person in ihrer Individualität und Unverwechselbarkeit ausmacht. Diese ist von der Psyche als einem Bereich von Verhaltensmustern und Dispositionen, welche die Person mit anderen Personen teilt, zu unterscheiden. 52 Vgl. dazu etwa J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, 2001, 64f: „Was den Organismus erst mit der Geburt zu einer Person im vollen Sinne des Wortes macht, ist der gesellschaftlich individuierende Akt der Aufnahme in den öffentlichen Interaktionszusammenhang einer intersubjektiv geteilten Lebenswelt.“ 76 nicht aufgewiesen werden kann. Offenbar kommt hier dem Aspekt der Entwicklung eine ausschlaggebende Bedeutung zu: Wir verbinden gleichsam vom vorweggenommenen Ende der beginnenden Entwicklung her mit dem ‚etwas‘ des Embryos den an diesem selbst nicht aufweisbaren ‚jemand‘, der im Verlauf der Schwangerschaft und vollends mit der Geburt als Person innerhalb der Gemeinschaft existierender Personen in Erscheinung treten wird. Kann es ernstlich strittig sein, dass nur so, vom Ende her, im Blick auf den Anfang menschlichen Lebens von einem Menschen gesprochen werden kann? Dann ist aber Voraussetzung dafür, dass wir mit einem Embryo einen ‚jemand‘ in Verbindung bringen können, dass die Entwicklungsmöglichkeiten auf dieses Ende zu gegeben sind. Bei der Mehrzahl der Embryonen, die die Natur verschwenderisch entstehen lässt, kann davon nicht die Rede sein, weil die äusseren Bedingungen für eine Entwicklung, nämlich die Einnistung in die Gebärmutter einer Frau, nicht gegeben sind. Wer dennoch sagt, dass es sich auch bei ihnen um Menschen im Sinne von menschlichen Personen und also um Träger von Menschenwürde handelt, der muss zeigen, wie dies unabhängig von jeglicher Entwicklungsmöglichkeit begründet werden kann. Andernfalls bleibt dies eine Behauptung. Im Übrigen ist zu fragen: Was wird aus den Begriffen ‚Mensch‘ oder ‚Person‘, wenn sie unterschiedslos jeder totipotenten menschlichen Zelle zuerkannt werden? Übrigens gibt es auch hier eine Parallele zur Sicht des Menschen in unserer religiösen Tradition. Ist diese doch ganz vom geborenen Menschen her gedacht. Nach diesem Verständnis ist die Personalität des Menschen auf ihrem tiefsten Grund darin fundiert, dass er das von Gott angeredete und zur Antwort gerufene Wesen ist. Insbesondere in der Perspektive evangelischer Theologie ist er in seiner Beziehung zu Gott geradezu definiert als der aus Glauben und nicht durch seine Werke gerechtfertigte Sünder (so die Bestimmung Martin Luthers). Damit ist das, was den Menschen ausmacht, vom geborenen Menschen her bestimmt, der einen Anruf vernehmen und antworten, Werke tun und am Glauben teilhaben kann. Wenn aber die christliche Sicht des Menschen als Gottes personales Gegenüber am geborenen Menschen orientiert ist, dann muss der Status des vorgeburtlichen Lebens von der Beziehung abgeleitet werden, in der es zum geborenen Menschen steht: als das Leben einer sich biologisch zur Geburt hin entwickelnden, werdenden menschlichen Person. Ist es nicht unserem Schutz und unserer Fürsorge überantwortet, weil es eben dieses ist? Bedeutet dies dann aber nicht weiterhin, dass menschliches Leben, das in keiner Beziehung zu einem in Zukunft geborenen Menschen steht, etwa in Gestalt natürlich entstandener Embryonen, die nicht zur Einnistung in die Gebärmutter gelangen, einen anderen Status hat und haben muss? Aufschlussreich ist die Frage, warum die Rede von Personalität und Menschenwürde eines jeden, auch des nichteingenisteten Embryos trotz der sich hier stellenden Fragen eine so grosse Akzeptanz findet. M. E. liegt die Erklärung in der veränderten Situation, die mit der Einführung der Reproduktionstechniken entstanden ist. Bevor es diese Techniken gab, trat die Existenz eines neuen Menschen mit der Schwangerschaft ins Blickfeld, d. h. in einer Phase, in der die Voraussetzungen für eine Entwicklung bis zur Geburt im Normalfall gegeben waren. Das hatte eine Konsequenz, die in der heutigen Diskussion weithin in Vergessenheit geraten zu sein scheint, nämlich dass es von Natur 77 einen zweifachen Status menschlichen Lebens gab: Es gab mit dem Beginn der Schwangerschaft das Leben eines werdenden, sich entwickelnden Menschen; und es gab Leben in Gestalt natürlich entstandener Embryonen, die nicht zur Einnistung gelangt sind und deshalb nach einer gewissen Zeit abstarben, das im biologischen Sinne menschliches Leben war, ohne dass vom Werden eines Menschen gesprochen werden konnte. Dieser naturgegebene zweifache Status menschlichen Lebens war in der Praxis allgemein akzeptiert, was daraus ersichtlich ist, dass man sich zwar gegenüber dem Leben im ersten Sinne, nicht aber gegenüber dem Leben im zweiten Sinne in Pflichten der Lebenserhaltung gesehen hat. Die breite gesellschaftliche Akzeptanz nidationshemmender Verhütungsmethoden – also der Spirale – lässt sich nur auf diesem Hintergrund verstehen. Mit ihnen wird auf künstliche Weise einem Vorgang – der Nichteinnistung eines Embryos in die Gebärmutter – nachgeholfen, der auch von Natur aus geschieht und das Schicksal der Mehrzahl der natürlich entstandenen Embryonen darstellt. Akzeptiert war dieser zweifache Status übrigens auch in der evangelischen Kirche. Im Zentrum der ethischen Debatte über das vorgeburtliche Leben standen die Probleme des Schwangerschaftsabbruchs. Demgegenüber haben nidations-hemmende Verhütungsmethoden, die menschliches Leben im zweiten Sinne betrafen, innerhalb der evangelischen Ethik für keine tief greifenden Kontroversen gesorgt. So stellt Hartwig von Schubert in seinem Buch „Evangelische Ethik und Biotechnologie“ fest: „Es gibt schon in den vierziger Jahren [des 20. Jahrhunderts] auf evangelischer Seite kaum noch Meinungsunterschiede hinsichtlich der Zulässigkeit der bewussten Empfängnisverhütung“, wobei die „Wahl der dafür geeigneten Mittel von der Enthaltsamkeit bis zu medizinischen Präparaten und Eingriffen ... den Ehepartnern überlassen“53 wurde. Diese Situation hat sich grundlegend verändert mit der Einführung der Reproduktionstechniken. Diese führen zu einem fundamentalen Bewusstseinswandel. Denn mit ihnen rücken die Bedingungen dafür, ob ein Embryo die Chance der Entwicklung zur individuellen Existenz eines Menschen erhält, in den Bereich menschlicher Verfügung. Das aber rührt an eine im kulturellen Bewusstsein tief sitzende und letztlich auf religiöse Wurzeln zurückgehende Überzeugung, nämlich die Überzeugung von der Unverfügbarkeit und Gott- bzw. Naturgegebenheit des Status menschlichen Lebens, der all unserem Entscheiden und Handeln verbindlich vorgegeben ist. Unter den neuen, veränderten Bedingungen lässt sich diese Überzeugung nur aufrecht erhalten, wenn der Status menschlichen Lebens von den äusseren Entwicklungsbedingungen unabhängig gemacht wird, da diese durch die reproduktionsmedizinischen Zugriffsmöglichkeiten manipuliert werden können. Damit aber gibt es keinen zweifachen Status menschlichen Lebens mehr, sondern es gibt nur noch einen Status, den alle Embryonen unabhängig von ihren Entwicklungsmöglichkeiten haben. Und so diskutieren wir heute über den moralischen Status „des“ Embryos unter der stillschweigenden Prämisse, dass alle Embryonen denselben Status haben. Damit aber ergeben sich die bekannten Begründungsprobleme. Um sämtlichen Embryonen Personalität, Menschenwürde und Rechte zuerkennen zu können, müssen sie in 53 Schubert, 384f. 78 Verbindung mit einem Menschen gebracht werden, auch wenn sie sich gar nicht zu einem solchen oder als ein solcher entwickeln. Vielleicht wäre es ja schon ein Fortschritt in der Diskussion, wenn anerkannt würde, dass das eigentliche Motiv und die unausgesprochene Prämisse in der Embryonendebatte eben diese Überzeugung ist: dass der moralische Status menschlichen Lebens all unserem Entscheiden und Handeln unverfügbar vorgegeben ist und vorgegeben bleiben muss. Eben deshalb sucht man diesen Status aus der biologischen Verfasstheit des Embryos abzuleiten, mit all den Problemen und Fragwürdigkeiten, die man sich damit auflädt. Demgegenüber ist zu fragen, ob es nicht der Klärung dient, wenn wir die Tatsache akzeptieren, dass mit den heutigen reproduktionsmedizinischen Zugriffsmöglichkeiten eine neue Situation eingetreten ist. Bestimmte zuvor die Natur, ob ein Embryo den Status eines werdenden, sich entwickelnden Menschen erlangt oder nicht, so liegt dies heute tatsächlich im Bereich menschlicher Verfügung. Erst mit der Anerkennung dieser Tatsache kann die Frage nach den Grenzen solcher Verfügung angemessen gestellt und erörtert werden. Wo immer die äusseren Bedingungen für eine Entwicklung gegeben sind, insbesondere mit Beginn der Schwangerschaft, da hat das vorgeburtliche Leben vom Zielpunkt dieser Entwicklung her den Status einer werdenden, sich entwickelnden menschlichen Person, und es verdient entsprechenden Schutz und entsprechende Achtung. Denn als Person kann ein Mensch sich nur entwickeln, wenn die Gemeinschaft existierender Personen sich auf ihn als Person bezieht und nicht etwa in der reinen Beobachterperspektive verharrend abwartet, ob ‚etwas‘ von selbst zu ‚jemand‘ mutiert. Die Individuierung des Menschen als Person ist m. a. W. auf einen Vorschuss seitens der Gemeinschaft existierender Personen angewiesen in dem Sinne, dass er als Person betrachtet wird, bevor er sich selbst als diese erweisen kann. Dieser Individuierungsprozess beginnt bereits in der vorgeburtlichen Phase. Andererseits kann dort, wo die äusseren Bedingungen für eine Entwicklung nicht gegeben sind wie bei natürlich entstandenen, aber nicht eingenisteten Embryonen, aber auch bei den überzähligen Embryonen aus der In-vitro-Fertilisation, für die sich keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr finden, auch nicht vom Werden oder von der Existenz eines Menschen ausgegangen werden. Dementsprechend bestehen hier auch keine Pflichten von derselben Art, wie sie gegenüber Menschen bestehen. Das bedeutet aus meiner Sicht freilich keinen Freibrief in dem Sinne, dass mit diesen menschlichen Embryonen beliebig verfahren und alles gemacht werden darf. Wie wohl die meisten empfinde ich die Vorstellung intuitiv als unerträglich, dass menschliche Embryonen in vitro für die Forschung erzeugt werden könnten. Aber ich denke, man muss, um dies zu verhindern, nicht die Personhaftigkeit eines jeden Embryos postulieren. Ich würde es so sehen, dass dasjenige, wogegen sich jene Intuition richtet, die Verdinglichung der Lebensvorgänge ist, die zum Leben eines Menschen führen, zugunsten anderer Zielsetzungen und Zwecke. So begriffen wäre diese Intuition, positiv gewendet, ein Hinweis auf eine eigene Würde des menschlichen Lebens, die allerdings von der Person- und Menschenwürde 79 zu unterscheiden ist.54 Sie begründet ein niedrigeres Schutzniveau als diese. Der Respekt vor der Würde menschlichen Lebens sollte sich z. B. darin manifestieren, dass wir das, was wir an nichtmenschlichen Embryonen erforschen können, nicht an menschlichen Embryonen erforschen. Und er schliesst aus, dass wir Embryonen in vitro für Zwecke der Forschung oder Stammzellgewinnung erzeugen. Ich komme zum Schluss. Ich denke, die Debatte über den moralischen Status des Embryos ist exemplarisch dafür, wie wir angesichts neuer Herausforderungen die Orientierungen, die wir mit uns tragen, stets aufs Neue überprüfen müssen hinsichtlich dessen, was sie eigentlich genau beinhalten. Das betrifft in diesem Fall das Verständnis des Menschen als Person. Nur von der Erhellung dieses Verständnisses her lässt sich die Frage beantworten, ob alle Embryonen als Personen und Träger von Menschenwürde anzusehen sind oder nicht. Ich habe Ihnen hier meine Sicht dargelegt, oder besser gesagt: diejenige, die mich zum gegenwärtigen Zeitpunkt am meisten überzeugt. Es gibt andere Positionen, die ich respektiere, wenn sie mich auch im Letzten nicht überzeugen. Lassen Sie mich noch zwei Bemerkungen hinzufügen. Innerhalb der Ethik betrifft eines der Postulate, die an eine moralische Position zu stellen sind, die logische Kohärenz. Das bedeutet auf unser Problem bezogen: Man kann nicht einerseits für den strikten Embryonenschutz eintreten, andererseits aber zu nidationshemmenden Verhütungsmethoden schweigen, insoweit diese nicht mit absoluter Sicherheit verhindern, dass es zu einer Verschmelzung von Ei- und Samenzelle kommt, also Embryonen entstehen, die dann an der Einnistung gehindert werden und absterben. Diese Verhütungsmethoden befinden sich gegenwärtig in einem rechtsfreien Raum. Es könnte sein, dass in der Schweiz in dieser ganzen Frage ein liberaleres Gesetz verabschiedet werden wird als in Deutschland. Ich sage dies ohne jede Bewertung. Ich denke, jede Gesellschaft kann und sollte sich in dieser Frage diejenigen Regelungen geben, die eine möglichst grosse Mehrheit ihrer Bürgerinnen und Bürger mitzutragen in der Lage sind. Und da sind die Voraussetzungen in anderen Ländern andere. Hier geht es letztlich nicht um das aus ethischer Sicht Richtige – wie immer man dieses sehen mag –, sondern um das politisch Richtige, das es den Bürgerinnen und Bürgern erlaubt, sich nach Möglichkeit mit ihrer Rechtsordnung zu identifizieren. 54 Vgl. zu dieser Unterscheidung J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur, a. a. O., 56ff. 80 Beitrittserklärung ______________________________________ __________________________________________________________________ Name _________ _________________________________________ Ja q Nein q * _________________________________ Gesellschaft für ethische Fragen c/o Hanspeter Uster, Inwilerriedstrasse 19, CH-6340 Baar _______________________________ Unterschrift Rücksende-Adresse: Ort/Datum N° ________ (G) _________________________________________ Ort Zu meiner Information wünsche ich ein Exemplar der Gesellschafts-Statuten: (*Bitte Zutreffendes ankreuzen) E-Mail-Adresse __________________________ Telefon N° (P) __________________________ PLZ Postfach ___________________________________ Strasse ___________________________________________ _______________________________________________________________________ Korrespondenzadresse: Firma/Institution Titel/berufliche Stellung Vorname ______________________________ Beitreten können Privatpersonen wie auch Firmen/Institutionen Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 50.--, Ehepaare Fr. 75.--, Kollektivmitglieder Fr. 100.-- zur Gesellschaft für ethische Fragen Die Arbeitsblätter wurden früher herausgegeben vom Schweizerischen Arbeitskreis für ethische Forschung und unterstützt von der Gesellschaft zur Förderung der ethischen Forschung (GEF). Nachdem der Arbeitskreis aufgelöst wurde, gibt nun die Gesellschaft für ethische Fragen (GEF) das Arbeitsblatt heraus. Redaktion: Esther Kamber, unter Mitarbeit von Erwin Koller Gesellschaft für ethische Fragen (GEF), Inwilerriedstrasse 19, 6340 Baar Dem Vorstand gehören an: Margrit Huber-Berninger, Wettswil Stefan Grotefeld, Zürich Esther Kamber, Feldmeilen, Aktuarin, Redaktion Arbeitsblatt Erwin Koller, Uster Ursula Renz, Zürich Georg Stäheli, Freienbach, Quästor Stephan Wehowsky, Zug Hanspeter Uster, Baar, Präsident Schutzgebühr: Fr. 10.– Druck: DMG Offsetdruckerei, Zug Leitsätze der Gesellschaft für ethische Fragen (GEF) Die GEF will eine reflektierte Auseinandersetzung über ethische Themen führen, ohne damit wissenschaftliche Ansprüche zu stellen. Die GEF greift aktuelle Themen auf und will dabei die grundlegenden ethischen Fragestellungen herausschälen. Die GEF bekennt sich zum ethischen Diskurs, will aber keine moralischen Botschaften verkünden.