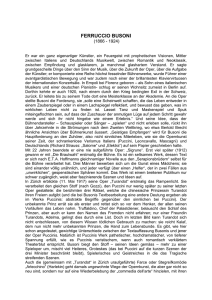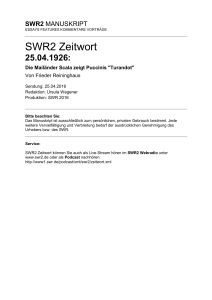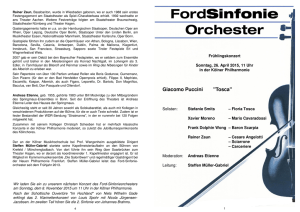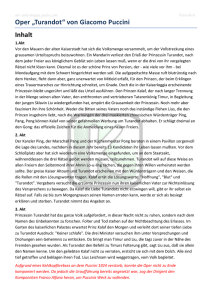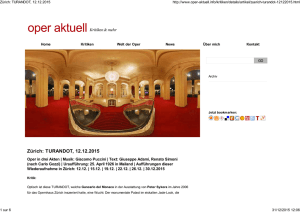Puccini Turandot - Gruppe Musik Hug
Werbung

M IC H A E L HO R S T Puccini Turandot Weitere Bände der Reihe O P E R N F Ü H R E R K O M P A K T : Daniel Brandenburg Verdi Rigoletto Detlef Giese Verdi Aida Michael Horst Puccini Tosca Malte Krasting Mozart Così fan tutte Silke Leopold Verdi La Traviata Robert Maschka Beethoven Fidelio Robert Maschka Mozart Die Zauberflöte Robert Maschka Wagner Tristan und Isolde Volker Mertens Wagner Der Ring des Nibelungen Clemens Prokop Mozart Don Giovanni Olaf Matthias Roth Donizetti Lucia di Lammermoor Olaf Matthias Roth Puccini La Bohème Marianne Zelger-Vogt / Heinz Kern Strauss Der Rosenkavalier Michael Horst, aufgewachsen in Rinteln / Weser, studierte Germanistik, Musikwissen­ schaft und Italienisch in Marburg, Münster und Bologna. 1986 Magisterabschluss mit einer Arbeit über Die Rezeption des Orpheus-Mythos im Opernlibretto. 1987–1995 im Feuilleton der Westfälischen Nachrichten Münster tätig, anschließend bis 2002 bei der Berliner Morgenpost. Seitdem arbeitet er als freier Journalist von Berlin aus für Printmedien und Radio, außerdem übersetzte er das 2013 bei Henschel / Bären­ reiter publizierte Buch Mein Verdi von Riccardo Muti aus dem Italienischen. Bei ­Henschel / Bärenreiter erschien darüber hinaus sein »Opernführer kompakt« Puccini – Tosca (2012). OPERNFÜHRER KOMPAKT M IC H A E L HO R S T Puccini Turandot Die O-Töne Puccinis und seiner Briefpartner wurden größtenteils vom Autor ins Deutsche übersetzt, in einigen Fällen auch aus den genannten Puccini-Biografien übernommen. Die Angaben zu weiteren Übertragungen aus dem Italienischen sind den Literaturhinweisen im Anhang zu entnehmen. Wir danken den Fotografen für die freundliche Genehmigung zum Abdruck ihrer Fotografien. Nicht in allen Fällen konnten trotz intensiver Recherchebemühungen die Urheber ausfindig gemacht werden; wir bitten bei berechtigten Ansprüchen um Mitteilung an den Verlag. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. © 2015 Seemann Henschel GmbH & Co. KG, Leipzig Gemeinschaftsausgabe der Verlage Bärenreiter, Kassel, und Seemann Henschel GmbH & Co. KG, Leipzig Umschlaggestaltung: Carmen Klaucke, Berlin, unter Verwendung eines Fotos von Tristram Kenton / ROH aus Andrei Serbans Turandot am Royal Opera House, London von 1984 (mit David Butt Philip als Pang, Grant Doyle als Ping und Luis Gomes als Pong; WA Jeremy Sutcliffe, Aufführung vom 20. Februar 2014) Lektorat: Susanne Van Volxem, Frankfurt a. M. / Paula Eisler, Leipzig Bildredaktion: Susanne Van Volxem, Frankfurt a. M. Innengestaltung: Dorothea Willerding, Kassel Satz: Das Herstellungsbüro, Hamburg Notensatz: Tatjana Waßmann, Winnigstedt Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-89487-940-2 (Henschel) ISBN 978-3-7618-2375-0 (Bärenreiter) www.henschel-verlag.de www.baerenreiter.com Inhalt Turandot – Puccinis letzte und spektakulärste Oper 7 Ein Mann wird älter … Puccinis letzte Lebensjahre 10 Der »König der Melodien« hält Hof in Wien und London 12 Die Kehrseite der Medaille: der frustrierte Ehemann und depressi­ ve Liebhaber 13 Die bayerische Geliebte der (Vor-)Kriegsjahre: Josephine von Stengel 16 Endstation Privatsekretär: Puccinis einziger Sohn Tonio 17 Hoffen auf Recht und Ordnung: Italien in den ersten Jahren unter Mussolini 18 Der neue Chef in Mai­ land: Konflikte mit Tito Ricordi 20 Der Verlust von Freunden, Kollegen und Familienangehörigen 23 Unfreiwilliger Umzug nach Viareggio 25 Mit dem Auto durch Deutschland, Holland und die Schweiz 28 Die letzte Geliebte: eine Sängerin aus Hamburg 29 Vom Libretto bis zur Uraufführung 37 Puccinis neues Librettistenduo: Giuseppe Adami und Renato Simoni 38 Neues Jahr, alte Probleme: »Wann bekomme ich weitere Texte?« 48 Drei Jahre Arbeit – und noch kein Ende in Sicht 49 Zwei Alphatiere im Kindergarten: Puccini und Arturo Tosca­n ini 52 Der Retter in der (Komplettierungs-)Not: Franco Al­fano 54 Die Handlung 57 Die musikalische und dramaturgische Gestaltung der Turandot 62 1. Akt: Ein fulminantes Crescendo gipfelt in drei Gongschlä­ gen 63 2. Akt: Charmante Idylle und eiskaltes Duell – der Akt mit den zwei Gesichtern 80 3. Akt: Liebe in drei Spielarten – Siegestrophäe, Todesengel und Horrorvision 90 Die zeitgenössische Rezeption in Italien und Deutschland 97 Die deutschsprachige Erstaufführung an der Dresdner Oper 101 »Ungeschickt und minderwertig«: Alfred Brüggemanns deut­ sche Übersetzung des Librettos 104 Von der Arena di Verona bis Doris Dörrie: die Inszenierungs106 geschichte der Turandot auf Bühne und DVD Turandot-Renaissance in den Achtzigern: Andrei Serban, Marco Arturo Marelli, Jean-Pierre Ponnelle 108 Chinesische Oper am Originalschauplatz in Peking 112 Neue Blicke hinter die chinesische Märchenkulisse: Robert Carsen, Nikolaus Lehnhoff ­ D-Brille: und David Pountney 113 Zwischen Riesenhandy und 3 schrille Deutungsversuche von Doris Dörrie und La Fura dels Baus 115 Der neue Turandot-Schluss von Luciano Berio 116 Turandot auf CD: Powerfrau mit Belcanto-Erfahrung gesucht 120 Im Geist der Mailänder Uraufführung: Turandot von 1938 mit Gina Cigna 121 Psychologie in den 1950er Jahren: Inge Borkh unter Alberto Erede und Maria Callas unter Tullio Serafin 123 La Turandot assoluta: Birgit Nilsson 124 Die Belcanto-Prin­ zessin: Joan Sutherland 1973 unter Zubin Mehta 126 Aus Liù wird Turandot: Montserrat Caballé unter Alain Lombard und Katia Ricciarelli unter Herbert von Karajan 127 Die umstrittene Nachfolgerin der Nilsson: Éva Marton 1984 unter Lorin Maazel und 1993 unter Roberto Abbado 128 Essay: Rätselraten auf Leben und Tod 130 Anhang 133 Glossar 133 Zitierte und empfohlene Literatur 135 Bildnachweis 136 Turandot – Puccinis letzte und spektakulärste Oper »Es gibt unumstößliche Gesetze am Theater: Interesse wecken, überraschen und zu Tränen rühren oder richtig zum Lachen bringen.« Giacomo Puccini am 11. November 1921 an seinen Librettisten ­Giuseppe Adami während der Arbeit an Turandot Turandot? Ist das nicht die Oper von Nessun dorma?! Wohl bei kei­ nem anderen Werk hat eine einzige Arie den Charakter einer ganzen Oper so vernebelt, haben drei kurze Minuten die übrigen zwei Stunden völlig in den Schatten gestellt. Und spätestens seit Pavarotti & Co. da­ mit ihre Triumphgesänge angestimmt haben, seit ein linkischer Tenor namens Paul Potts mit Nessun dorma die Massen in riesigen Hallen zu Tränen rührte, wissen auch Menschen, die sonst mit Klassischer Musik eher wenig zu tun haben: Turandot ist die Oper, die zu der Arie gehört, die mit dem geschmetterten hohen Ton endet. »Vincerò!« lautet das letzte Wort: »Ich werde siegen!« Kann man sich einen plakativeren Schluss vorstellen? Dabei gibt es ungleich mehr in diesem Werk zu entdecken. Längst haben großartige Dirigenten seine musikalische Sprengkraft zur Explosion gebracht. Denn Turandot steht nicht nur am Ende ­einer langen Reihe von großen Puccini-Opern, sondern als einzige auch mit beiden Beinen im 20. Jahrhundert. Die musikalische Moderne, von Claude Debussy bis Igor Strawinsky, hat hier ihre unüberhörbaren Spu­ ren hinterlassen. Ein Komponist, fast schon im Rentenalter, begibt sich noch einmal auf ganz neue Pfade. Seine Inspiration findet er bei einem durch und durch exoti­ schen Stoff, einem Märchen aus alter Zeit, das in China spielt. Der An­ 7 walt der Näherinnen, Geishas und Saloon-Wirtinnen, der Kumpel von Polizeichefs, Marineleutnants und Frachtkahnbesitzern widmet sich der Geschichte von einer bösen Prinzessin und einem tapferen Prin­ zen – die auch noch ein Happy-End hat. Er macht daraus ein gewaltiges Werk, eine Grand Opéra der Neuzeit, die problemlos neben Verdis Aida bestehen kann, er erfindet Chorszenen von be­ zwingender Sogwirkung, die jeder Wag­ ner-Oper Paroli bieten. Er komponiert ein letztes Meisterwerk, das der frühe Puccini-Biograf Richard Specht wenige Jahre nach der Uraufführung im expres­ siven Stil seiner Zeit so beschrieben hat: »[…] bezwingend, von düsterer Pracht, hieratisch starr und wieder dunkel flu­ tend in Lauten der gepreßten Seele und des qualvoll ausbrechenden Fiebers der Liebesleidenschaft.« Umso tragischer mutet es an, dass ausgerechnet diese Oper, die glück­ lich ausgehen sollte, vom Komponisten nicht vollendet wurde – er starb über den Skizzen für das Finale im November Immer perfekt gekleidet und mit Ziga1924. Der Tod der Sklavin Liù und der rette in der Hand: Puccini zur Entstehungszeit seiner letzten Oper Turananschließende Trauermarsch wurden dot, 1923 somit zu den letzten Noten aus Puccinis Feder. Warum hat er das große Schluss­ duett nicht geschrieben? Warum hat er die richtigen Worte und Töne dafür nicht gefunden? Diese Fragen sind ebenso spannend wie müßig. Dramaturgische Gründe werden gleicher­ maßen angeführt wie psychologische Blockaden des Komponisten. In jedem Fall blieb Turandot eine Oper ohne Schluss – in prominenter Ge­ sellschaft mit Busonis Doktor Faust (ebenfalls 1924) und Alban Bergs Lulu (1935). Die Komplettierung ist ein spannender Fall für sich: Zu­ erst war es Puccinis geschätzter Kollege Franco Alfano, der sich die­ ser ­Herausforderung unterzog (und dafür heftig kritisiert wurde), in jüngster Zeit hat Luciano Berio einen neuen Versuch unternommen, Turandot zu einem überzeugenden Schluss zu verhelfen. Dieses Buch versteht sich als Plädoyer für ein vielfach als protzi­ ges Ausstattungsstück missverstandenes Werk. Es möchte neue Anre­ 8 gungen für ein besseres Verständnis dieser mit Raffinement, höchstem Kunstverstand und Herzblut komponierten Oper geben. Dabei ver­ dankt der Autor sein Wissen nicht zuletzt jenen, die bereits ausgiebig zu Puccini geforscht haben. Genannt seien hier vor allem die peni­ ble biografische Aufbereitung durch Dieter Schickling und die angel­ sächsisch-klare Darstellung von Vita und Œuvre Puccinis durch Julian Budden. Unverzichtbar war auch Harold Ashbrooks Spezialstudie zu Turandot, die in der italienischen Ausgabe wertvolle Ergänzungen, namentlich zu Luciano Berios neuem Finale, gefunden hat. Besonde­ re Impulse habe ich durch Mosco Carner erfahren, jenen aus Wien emigrierten englischen Dirigenten und Musikwissenschaftler, der mit seiner Neugier, immer über den Gartenzaun der Musikwissenschaft zu schauen, hoffentlich seine Spuren auch in dieser Turandot-Monografie hinterlassen hat. 9 Ein Mann wird älter … Puccinis letzte Lebensjahre Am 29. November 1924, um 11.30 Uhr vormittags, stirbt Giacomo Puc­ cini nach einem zehnstündigen Todeskampf in einer Brüsseler Privat­ klinik. Ein plötzliches Herzversagen nach einer scheinbar gelungenen Operation, mit der ein Tumor am Kehlkopf entfernt werden sollte, setzt dem Leben des fast 66-Jährigen ein Ende. In Windeseile verbreitet sich die Nachricht um den ganzen Globus: Der berühmteste Opern­ komponist der Welt ist tot! Die Mailänder Scala setzt am Abend die Vorstellung von Arrigo Boitos Nerone ab und bleibt als Symbol der stil­ len Trauer geschlossen. An der New Yorker Metropolitan Opera fügt man in die Vorstellung von Puccinis La Bohème den Trauermarsch von Frédéric Chopin ein. An nächsten Morgen erscheinen nicht nur in Italien die Zeitun­ gen mit seitenlangen Nachrufen, in denen noch einmal die großen Er­ folge des Verstorbenen aufgelistet werden. Und es sind viele: Mit Manon Lescaut begann 1893 sein unaufhaltsamer Aufstieg, dem nur drei Jahre später mit La Bohème ein zweites Meisterwerk folgte. Endgültig zum erfolgreichsten Opernkomponisten seiner Zeit avancierte Puccini im Jahr 1900 mit der Uraufführung der Tosca. Doch damit nicht genug: Auch Madama Butterfly konnte sich nach der misslungenen Mailänder Premiere in einer gestrafften Neubearbeitung schnell durchsetzen. Die ersten zwei Jahrzehnte des neuen Jahrhunderts haben Puc­ cinis Ruf höchst eindrucksvoll bestätigt. Wo man auch hinschaut, ob in Wien oder Buenos Aires, in San Francisco, Lissabon oder St. Peters­ burg, in den Metropolen wie in der Provinz – überall wird er gespielt. Nicht alle Kritiker schätzen ihn, aber das Publikum liebt ihn. Er kom­ poniert nicht für die Intellektuellen, sondern er schreibt zum Weinen schöne Melodien, die mitten ins Herz des Zuschauers treffen. So ver­ 10 schieden seine drei Bestseller – La Bohème, Tosca und Butterfly – auch sein mögen: In ihnen verbindet sich die sinnliche Sensibilität eines gro­ ßen Künstlers mit dem überragenden Können eines Klangzauberers. In seinen Werken spiegeln sich alle Emotionen, derer Menschen fähig sein können. Das macht sie so wahr – und erfolgreich. Einen Einschnitt bedeutet der Erste Weltkrieg: Mit dem Kriegs­ eintritt Italiens im Mai 1915 sind die Werke Puccinis unversehens in Deutschland und Österreich nicht mehr gern gesehen. Und in seiner Heimat, die immer stärker unter der Kriegslast zu leiden hat, muss ein Opernhaus nach dem anderen schließen. Die Uraufführung des Trittico – der drei Einakter Il tabarro, Suor Angelica und Gianni Schicchi – kann Das Bühnenbild der Uraufführung von ­Gian­ni Schicchi an der Met in New York, nicht wie geplant in Italien stattfinden. 1918 Stattdessen kommt das Triptychon am 14. Dezember 1918 an der Metropolitan Opera in New York auf die Bühne. In den Wirren der Wochen nach dem Waffenstillstand vom November 1918 hat Puccini das Risiko gescheut, mit dem Schiff in die Neue Welt zu reisen, und zum ersten Mal überhaupt findet eine Uraufführung ohne ihn statt. Auch wenn es die begeisterten Telegramme des Met-Inten­ danten Giulio Gatti-Casazza, eines Freundes aus früheren Mailänder Zeiten, an den ungeduldigen Komponisten in seiner toskanischen Villa natürlich anders darstellen: Einen durchschlagenden Erfolg erringt der Trittico in New York nicht. 11 Der »König der Melodien« hält Hof in Wien und London Umso gespannter wartet Italien auf die römische Premiere, bei der am 11. Januar 1919 im Teatro Costanzi die Wellen der Begeisterung deutlich höher schlagen. Auch König Vittorio Emanuele III. und seine Gemahlin Elena sind gekommen, schließlich ist es das erste Mal seit Madama Butterfly gut 14 Jahre zuvor, dass wieder eine Oper ihres weltweit gefei­ erten Landsmanns in seiner Heimat uraufgeführt wird. Der dritte und letzte Teil des langen Abends, mit der Erbschleicher-Geschichte Gianni Schicchi nach einer Vorlage aus Dantes Göttlicher Komödie, kann die meiste Zustimmung für sich verbuchen, auch das tragische Schicksal der Nonne Angelica rührt das katholische Publikum in Rom – anders als im puritanischen New York. Nur das Eröffnungsstück, das Pariser Eifersuchtsdrama Der Mantel, stößt auf starkes Befremden; derlei düs­ terer Verismo ist seit der Jahrhundertwende eigentlich längst aus der Mode gekommen. Auch die anderen großen Opernhäuser Europas sind begierig, ihrem Publikum das neue Werk zu präsentieren. Somit reist Puccini im Juni 1920 nach London, wo ihm am Royal Opera House ein glanz­ voller Empfang bereitet wird – auch hier in Anwesenheit des Königs­ paares, King George V. und Queen Mary. Die Presse preist den italie­ nischen Gast als »king of melodies«; und voller Stolz nennt dieser ­Großbritannien »mein Königreich«. In der Tat: Es gleicht einem Pucci­ ni-Festival, was dort in den drei Wochen seines Aufenthaltes zu erleben ist. Alle vier großen Opern, von Manon Lescaut bis zur Butterfly, stehen auf dem Programm – welcher andere lebende Komponist könnte eine solche Auszeichnung für sich verbuchen? Noch im Oktober desselben Jahres besuchen Giacomo und sei­ ne Frau Elvira Wien, wo an der Staatsoper – in deutscher Sprache – ebenfalls das »Triptychon« vorgestellt wird, mit Maria Jeritza, Pucci­ nis Lieblings-Tosca, als Giorgetta im Mantel und Lotte Lehmann, der großen Strauss- und Wagner-Sängerin, in der ungewohnten Rolle der Angelica. Der Italiener liebt diese Stadt noch mehr als London, und die Menschen winken ihm zu, wenn sie ihn mit seinem luxuriösen Auto, einem Lancia Trikappa, über den Ring chauffieren sehen. Der gerade beendete große Krieg hat der gegenseitigen Wertschätzung nichts an­ haben können. Auch hier gibt es »Puccini satt«: neben den drei Ein­ aktern noch Bohème, Tosca und Butterfly. Der Komponist genießt die öffentliche Anerkennung ebenso in vollen Zügen wie das reiche Mu­ sikleben der Donaustadt. Zu seiner großen Freude trifft er den inzwi­ 12 schen 23-jährigen einstigen Wunderknaben Erich Wolfgang Korngold wieder, der bereits an seiner dritten Oper Die tote Stadt arbeitet, und erneuert die Freundschaft mit dem Operettenkönig Franz Lehár. Noch heute hängt ein Foto mit Widmung des Österreichers über dem AugustFörster-Klavier im Puccini-Museum in Torre del Lago. Fast überflüssig zu erwähnen, dass sich diese künstlerischen Dauererfolge auch in klingender Münze niederschlagen. Seit dem Ende des Weltkriegs fließen die Einnahmen aus dem In- und Ausland wieder kräftig. Dieter Schickling hat beeindruckende Zahlen dazu gesammelt: Die Halbjahres-Abrechnung, die Puccini Anfang 1920 von Ricordi er­ hält, weist den gewaltigen Betrag von 250 000 Lire aus (nach heuti­ ger Umrechnung etwa 600 000 Euro). Im Frühjahr 1922 ist die Sum­ me bereits auf 400 000 Lire gestiegen – trotzdem verdächtigt Puccini den Verlag, ihm zu wenig Tantiemen ausgezahlt zu haben. Die letzte Abrechnung überhaupt, die er im Juli 1924 in Händen hält, beläuft sich auf über 454 000 Lire. Dass darin bereits ein Teil des Honorars für die Turandot – die der Verlag mit 250 000 Lire vergütet – enthalten ist, schmälert den Eindruck vom schwerreichen Komponisten Puccini nicht im Geringsten. Die Kehrseite der Medaille: der frustrierte Ehemann und depressive Liebhaber Doch der glänzende öffentliche Erfolg ist nur die eine Seite der Me­ daille. Ganz anders sieht es mit dem Privatmann Puccini aus. Liest man die Briefe aus den Nachkriegsjahren, die er mit vertrauten Freun­ den – wie seinem weltgewandten Bewunderer Riccardo Schnabl Rossi oder der Engländerin Sybil Seligman – austauscht, so überraschen die vielfachen Klagen, die weit über das sonst übliche Maß an Unlust oder künstlerischen Zweifeln bei dem Komponisten hinausgehen, vor allem in den »unruhigen« Zeiten zwischen zwei Opernprojekten. Gesund­ heitlich plagt ihn besonders die Diabetes, und er setzt große Hoffnun­ gen auf das gerade entdeckte Insulin, dessen Wirkung er bei einem Sa­ natoriumsaufenthalt in Wien ausprobiert. In seinem letzten Lebensjahr machen dem Kettenraucher dann zusätzlich starker Hustenreiz und Schmerzen in der Brust empfindlich zu schaffen – erste Anzeichen des Tumors, dem er im November 1924 erliegt. Der äußere Glanz und die innere Verfassung, die so wenig zusam­ menpassen wollen: In einem Brief an Schnabl, den vermögenden Mu­ 13 sikliebhaber mit österreichisch-italienischen Wurzeln, vom 15. August 1920 geht Puccini genau auf diese beiden Punkte ein. Nachdem er stolz vermerkt hat, dass er im letzten Halbjahr 300 000 Lire verdient habe und noch jede Menge Kronen und Mark zu erwarten seien, beklagt er sich: »Man muss nicht vor Hunger sterben – aber, beim allerhöchsten Gott, das Problem ist, dass ich alt wer­ de – ich sollte mich an den Professor in Berlin wenden, den mit den Drüsen – und wenn er tatsächlich damit Erfolg ge­ habt hat, dann lass ich mich verjüngen!« Ein halbes Jahr später ist es Sybil Seligman in London, der er seine Ängs­ te anvertraut: »Ich bin völlig nieder­ geschlagen. Mir scheint, dass ich kein Selbstvertrauen mehr habe, ich verliere den Mut für die Arbeit, ich finde nichts Gutes. Es scheint mir jetzt ein zunichte gewordenes Dasein zu sein – ich bin alt – das ist wirklich wahr – und es ist sehr traurig – besonders für einen Künstler.« Makabererweise wird zur gleichen Zeit Die Vertraute aus London: Sybil Seligsogar schon weltweit über Nachrichten­ man (1868–1936). Puccini kannte die agenturen sein Tod vermeldet. Dass es vielseitig interessierte Bankiersgattin sich dabei um eine Verwechslung mit seit 1905 und blieb ihr bis zu seinem Tod eng verbunden. dem toskanischen Dichter Renato Fucini aus dem nahen Empoli handelt, dürfte einen labilen Menschen wie Puccini nur wenig beruhigt haben. Sogar Enrico Caruso hat in den USA davon ge­ hört und schreibt ihm am 18. April 1920: »Du weißt, was das bedeutet: langes Leben und Glück ohne Ende.« Diese Prophezeiung sollte sich nicht erfüllen … Zweifellos muss es an dem Künstler Puccini genagt haben, dass es immer wieder die alten Kompositionen sind, die vom Publikum be­ sonders gefeiert werden. Mit dem Siegeszug der Schallplatte haben sich Mimìs Arie Mi chiamano Mimì, Cavaradossis E lucevan le stelle oder auch das Duett Butterfly / Pinkerton Bimba dagli occhi pieni di malia zu Bestsellern entwickelt. Nichts davon mit La fanciulla del West von 1910, geschweige denn mit La rondine, Puccinis »operetta«, die 1917 in Mon­ te Carlo uraufgeführt wurde. Und auch die zwiespältige Resonanz auf den Trittico nagt an seinem Stolz. Denn schon bald gehen die meisten 14 Marco Arturo Marellis Turandot: Von Bremen bis Bregenz Eigentlich beschäftigt Marco Arturo Marelli das Thema Turandot schon seit über 30 Jahren. Doch nach seiner skandalumwitterten Bremer Inszenierung von 1983 gönnte sich der Schweizer eine lange Pause, bis er Puccinis letztes Werk 2013 erneut auf die Bühne brachte: an der Stockholmer Oper, wo einst Birgit Nilsson und nun Nina Stemme in der Rolle der Turandot debütierte. Der besonderen Herausforderungen für einen Regisseur war sich Marelli sehr wohl bewusst: Wie kann man die Oper zu einem dramaturgisch überzeugenden Abschluss bringen – den schon Puccini trotz langwieriger Bemühungen nicht gefunden hat? Oder anders gesagt: Wie kann man nach dem hochemotionalen Tod Liùs überhaupt noch eine Steigerung erreichen? Calaf und Turandot bringen dazu, so Marellis Analyse, eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen mit, da sie selbst schwer belastet sind: Calaf soll, obwohl er quasi mitschuldig ist an Liùs Tod, das Geheimnis der Liebe einer Frau wie Turandot offenbaren, die wiederum durch den Befehl zur Folterung schwer belastet ist. Kann dann ein Kuss allein – wie in Alfanos Version – alle Probleme lösen? Ganz sicher nicht. Die Lösung fand der Regisseur in der erstaunlichen Parallele zwischen Puccinis eigener Identitätskrise als Komponist in seinen späten Jahren und dem Kampf des Prinzen Calaf um die Prinzessin – für Puccini gleichermaßen jene unnahbare Diva, die letzte Repräsentantin der italie­ nischen Oper alten Zuschnitts. Folgerichtig stimmt eine kurze Anfangsszene auf den biografischen Rahmen der Handlung ein: Puccini öffnet die (historisch verbürgte) Spieldose des Baron Fassini, aus der die chinesischen Melodien erklingen, bevor sich die Bühne in die bekannte Szenerie verwandelt. Im finalen Liebesduett wird Calaf wieder zu Puccini, während Turandot sich all ihrer Machtsymbole entledigt und ihre Identität als Frau entdeckt. Diesmal ist sie es, die sich selbst aus ihrer Verpanzerung befreien kann und Calaf / Puccini den erlösenden Kuss gibt – eine fundamentale Kehrtwendung im Kampf der beiden »schwerbewaffneten« Kontrahenten. Dieses interpretatorische Konzept prägt auch Marellis Inszenierung für die Bregenzer Festspiele im Sommer 2015, wird dort allerdings stärker auf die gigantischen Ausmaße der Open-Air-Bühne auf dem Bodensee zugeschnitten. Die optische Klammer für die pausenlos ablaufende Aufführung bildet ein »grafisches China« (Marelli), ein riesiges Segment der berühmten chinesischen Mauer, vor deren Mitte eine Spielfläche Platz für die intimeren Momente der Oper bietet. Hinzu kommen filmische Einblendungen; sie dienen etwa der Visualisierung der dramatischen Rätselszene des 2. Aktes, um auch noch denjenigen der 7000 Zuschauer, die in den hintersten Reihen sitzen, das dramatische Geschehen so intensiv wie möglich nahezubringen. 109 und Bewegung, Masken und Gewändern atmosphärisch dichte Bilder, nicht nur in der nächtlichen Parade der herumgeisternden Lampions im 3. Akt. Virtuos setzt der Regisseur auch Requisiten wie etwa die Miniaturtotenschädel ein, mit denen die drei Minister, halb Clowns, halb Henkersknechte, der spielerischen Der Franzose Jean-Pierre Ponnelle Aktion eine düstere Folie verpassen. (1932–1988) blieb vor allem durch den Erstmals beginnen in dieser Zeit Monteverdi-Zyklus, die Bayreuther TrisTurandot-Regisseure auch das Alfano-Fi­ tan-Inszenierung (1983) und die Uraufführung von Aribert Reimanns Lear nale szenisch in Frage zu stellen. Einen (1978) in Erinnerung. Das Foto zeigt radikalen, aber sicherlich diskutierbaren seine Münchner Turandot von 1987. Weg geht Marco Arturo Marelli (* 1949) in einer seiner ersten Inszenierungen in Bremen: Er bricht die Aufführung mit­ ten im Finalduett mit einem Blackout ab – getreu dem Brecht’schen Motto »Der Vorhang zu – und alle Fragen offen!« An der Deutschen Oper Berlin dramatisiert Götz Friedrich (1930–2000) im Jahr 1986 den Bruch zwischen Puccinis Original und der Ergänzung Alfanos, indem er das Einheitsbühnenbild der vorherigen Akte beiseite räumen und das Paar Turandot / Calaf allein auf der hellen, kahlen Bühne zurück lässt. Explizit betont Friedrichs Inszenierung die Nähe zum Expressio­ 110 nismus im Theater wie im Film, für ihn wird Peking zu einem »Metro­ polis der toten Seelen«. Auch der überaus produktive Franzose Jean-Pierre Ponnel­ le (1932–1988) widmete sich in den 80er Jahren zweimal der Turandot: zuerst 1981 in Köln, dann 1987 noch einmal an der Bayerischen Staatsoper in München. Dem Hang des Regisseurs zu sinnlich-farben­ freudigen »Opern-Revuen«, wie sie exemplarisch in seinem Züricher Monteverdi-Zyklus zu erleben waren, kam der exotische Stoff sehr ent­ gegen. Immerhin setzte Ponnelle im Jubelfinale ein unübersehbares szenisches Fragezeichen, indem er aus dem Auge des riesigen, fahl angestrahlten Buddhakopfs einen Tropfen Blut fallen ließ. Grundsätz­ lich wenig Neues entdeckte allerdings die Süddeutsche Zeitung in der Inszenierung: »Turandot als plakatives, buntes Spektakel-Oratorium, illustrativ, logisch im statuarischen Gesamtkonzept, phantasiebestückt im Detail. Ein Märchen aus ferner Zeit, artistisch-zirzensisch in be­ wegte Bilder umgesetzt.« Interessanterweise kamen die Kostüme dieser Produktion von Pet Halmen, der wenige Jahre später, 1993, selbst eine Turandot-Insze­ nierung in Angriff nahm: An der Deutschen Oper am Rhein in Düssel­ dorf löste er das Problem des Alfano-Schlusses, indem er eine originel­ le Rahmenhandlung hinzufügte: Zu Anfang brütet der schwerkranke Komponist 1924 über seinen Turandot-Entwürfen, dann nehmen plötz­ lich die Opernfiguren, »einem surrealen Alptraum gleich«, das Zimmer in Besitz. Wie im Delirium erlebt Puccini seine Oper; er selbst wird in die Rolle des Timur hineingezwungen. Mit Liùs Tod stirbt auch TimurPuccini, und die Musik bricht unvermittelt ab. Im Epilog verwandelt sich die Szene zurück in Puccinis Arbeitszimmer. Man sieht die Haupt­ figuren ratlos mit den Finalskizzen, als überraschend ein Bote von Ricordi erscheint und die von Alfano fertiggestellte Partitur übergibt, nach der die Aufführung zu Ende gespielt wird. In jenes Jahrzehnt fällt auch die Wiederentdeckung der ur­ sprünglichen Langfassung von Alfanos Turandot-Komplettierung. 1982 wurde sie in konzertanter Version im Londoner Barbican Center unter Leitung von Owain Hughes vorgestellt (mit Sylvia Sass als Turandot und Franco Bonisolli als Calaf). Die ersten szenischen Aufführungen folgten 1983 an der City Opera in New York und 1985 in den römischen Caracalla-Thermen (wo der Regisseur Sylvano Bussotti bewusst auf die Uraufführungsdekors von 1926 zurückgriff). Durchgesetzt hat sich »Alfano lang« nicht, nach wie vor greift die allergrößte Zahl der Opern­ häuser auf die von Toscanini durchgesetzte kürzere Fassung zurück. 111 Chinesische Oper am Originalschauplatz in Peking Als Open-Air-Spektakel mit weltweiter Übertragung ist die Inszenie­ rung von 1998 aus der »Verbotenen Stadt« in Peking in die Turandot-Ge­ schichte eingegangen. Damit kehrte die Oper an ihren Originalschau­ platz zurück, und wieder wurden »keine Kosten und Mühen« gescheut: In sechsmonatiger Vorbereitungszeit baute man einen großen, bewegli­ chen Pavillon vor den alten Kaiserpalast, installierte ein ausgeklügeltes Klangsystem, um die 4000 Zuschauer vor Ort akustisch angemessen mit Puccinis Klängen zu verwöhnen – und trainierte sogar eine Hun­ dertschaft Soldaten der chinesischen Volksarmee für ihren Einsatz als historische Palastwachen. Regisseur Zhang Yimou, damals im Westen bereits bestens be­ kannt durch seinen Film Rotes Kornfeld (Goldener Bär bei der Berlinale 1988), suchte bewusst die Nähe zur Peking-Oper und bewahrte durch die Strenge von Bewegungen und Gestik die Aufführung vor ­einer sinnentleerten China-Show. Auch im Detail zeigt sich seine eigene Handschrift: Die Figur des Henkers besetzte Yimou, inspiriert von der Peking-Oper, mit einer zarten Frau, die durch Bewegungen des chinesi­ schen Kampfsports die Hinrichtung des persischen Prinzen ausdrückt. Selbstverständlich wurde die Produktion auch auf DVD festge­ halten (RCA), doch sie lässt in vielen Momenten durch uninspirierte Kameraführung die Faszination der Aufführung nur erahnen. Der be­ währte Zeremonienmeister derartiger Mega-Produktionen, der Dirigent Zubin Mehta (»Die drei Tenöre« in Rom, 1990; Tosca live von den römi­ schen Originalschauplätzen, 1992) war auch hier im Einsatz und hielt das Ganze mit bewundernswerter Souveränität zusammen. Als ver­ lässliche Kräfte hatte er Chor und Orchester des Maggio Musicale aus Florenz mitgebracht. Von der Dreifachbesetzung der Aufführungsserie wurden für die DVD Giovanna Casolla und Sergej Larin in den Titel­ partien ausgewählt, die allerdings beide nur wenig Glanz und Charis­ ma versprühen. Angemessenes Niveau für eine Produktion, die um die ganze Welt ging, zeigte allein Barbara Frittoli als Liù. Einen verspäteten Nachzügler dieser chinesischen Sichtweise bot 2008 die Inszenierung des Filmemachers Chen Kaige (Lebewohl, meine Konkubine) am neuen Opernhaus in Valencia. Er macht die interpretatorische Rolle rückwärts: »Der Chor und die Statisten sind selbst ein Publikum wie das Theaterpublikum. Sie sind das Volk, das den Mächtigen auf der Bühne zuschaut.« Demnach ist alles nur schöne, aber harmlose Schau, ein Märchen mit prachtvollen Kostümen direkt 112