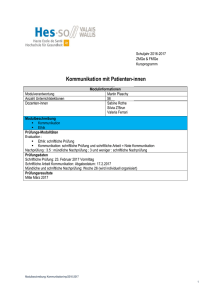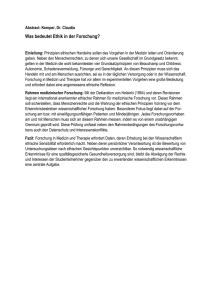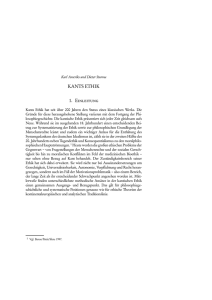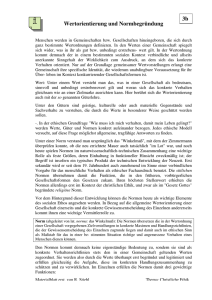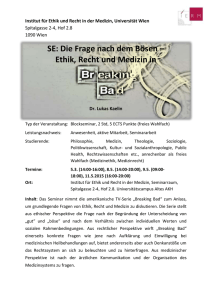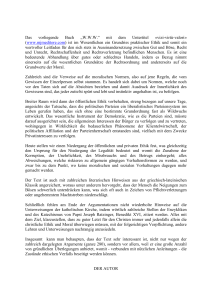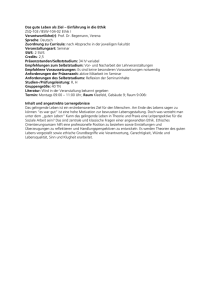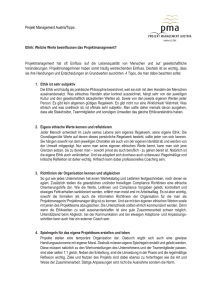Vom Nutzen der Rechtstheorie für die angewandte
Werbung

Working Papers in Rechts- und Sozialphilosophie Facheinheit Rechts- und Sozialphilosophie Fachbereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften Universität Salzburg Churfürststr. 1 5020 Salzburg Vom Nutzen der Rechtstheorie für die angewandte Ethik: Spezifizierung, Abwägung und Kasuistik in der Bioethik Norbert Paulo (Salzburg) September 2015 ©Norbert Paulo, Salzburg (September 2015) Vom Nutzen der Rechtstheorie für die angewandte Ethik: Spezifizierung, Abwägung und Kasuistik in der Bioethik Norbert Paulo Die Rechtstheorie hat als eines der Grundlagenfächer an juristischen Fakultäten einen schweren Stand. Wie der Wissenschaftsrat 2012 richtig konstatiert hat, wird sie zunehmend marginalisiert und in Forschung und Lehre zu Gunsten solcher Bereiche der Rechtswissenschaft eingeschränkt, die von sich eine größere Praxisrelevanz behaupten.1 Wenn letzteres der Maßstab ist, scheint der weitere Weg der Marginalisierung vorgegeben zu sein. Schließlich behaupten die vor allem rekonstruktiv vorgehenden Grundlagenfächer nicht primär Praxisrelevanz in diesem recht oberflächlichen Sinne; ihnen geht es vielmehr zunächst darum, das Recht zu verstehen. Dass aus einem besseren Verständnis Kritik und Potential für Verbesserungen des Rechts – auch der Rechtspraxis – erwachsen können, muss in einem Band, der interdisziplinären Aspekten der Rechtswissenschaft gewidmet ist, wohl nicht weiter erläutert werden. In diesem Sinne ist die Rechtstheorie als ein Grundlagenfach natürlich praxisrelevant. Ich möchte in diesem Beitrag den Versuch unternehmen, zu zeigen, dass diese Praxisrelevanz keineswegs nur auf das Recht selbst beschränkt ist, sondern viele Einsichten bereit hält, die auch für andere normative Bereiche informativ sind. Konkret möchte ich darlegen, wie die Bioethik von der rechtstheoretischen Methodendiskussion lernen kann, ihre eigenen Methoden zu verbessern. Ich versuche mithin, den üblichen Erkenntnisweg umzudrehen. Normalerweise greifen die Grundlagenfächer auf Erkenntnisse aus Disziplinen wie Philosophie, Soziologie, Linguistik oder Geschichte zu, um damit die Rechtswissenschaft zu bereichern. Mein Weg geht andersherum. Ich biete den Ethikerinnen einen Einblick in die Rechtswissenschaft, den sie für die Ethik fruchtbar machen können.2 Es wird sich zeigen, dass dieser Zugang noch einen zweiten Blick über den Tellerrand nahe legt. Nachdem ich im Hauptteil gezeigt habe, wie eine Prinzipienethik, die dem kontinentaleuropäischen Civil Law strukturell sehr nahe steht, von ebenjenem lernen kann, möchte ich nämlich am Ende des Beitrags andeuten, dass die Methoden des Common Law interessante Einsichten für eine andere ethische Tradition, nämlich die Kasuistik, bereithalten. 1 Siehe den Bericht des Wissenschaftsrats „Perspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland. Situation, Analysen, Empfehlungen“. 2 Ausführlicher habe ich dies in meiner noch unveröffentlichten Dissertation „Methods in Applied Ethics – A View from Legal Theory“ (Hamburg 2014) getan. 1 1 Recht und Ethik: Normen und Methoden3 Warum ein solcher Versuch, Lerneffekte zu erreichen, im Bereich der Methoden besonders vielversprechend ist, zeigt eine einfache Überlegung. Ethikerinnen und Juristinnen stellen sich ganz ähnliche Probleme. Sie müssen unter Rückgriff auf abstrakte und generelle Normen konkrete und individuelle Fragen beantworten.4 Und sie müssen dies auf eine Art und Weise tun, die transparent und rational nachvollziehbar ist. Kurz: Ethikerinnen und Juristinnen müssen einen methodengeleiteten Umgang mit Normen beherrschen. Denken Sie nur an Fragen wie diese: Sollte eine Ärztin aus moralischer Sicht den ernsthaften und wiederholt vorgebrachten Sterbewunsch einer Patientin respektieren und sie bei dessen Umsetzung unterstützen? Auch wenn die Patientin Anzeichen von Depression zeigt? Ändert sich die Bewertung, wenn diese Anzeichen eine Folge der wiederholten Zurückweisung ihres Wunsches sind? Um solche und andere schwierige Fragen zu beantworten, benötigt man einen normativen Referenzrahmen. Juristinnen werden im Medizin(straf)recht nachsehen. Medizinethikerinnen haben es etwas schwerer.5 Ihnen ist nämlich kein Normensystem vorgegeben. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie keines hätten. Nun hat sicher nicht jeder Mensch ein expliziertes System moralischer Normen. Aber je professionalisierter die Beschäftigung mit Ethikkommissionen, der des Bioethik ist Ethikrates – denken oder an Sie die nur an die Fachleute Mitglieder in von bioethischen Forschungszentren – desto expliziter und reflektierter ist üblicherweise das jeweils in Anschlag gebrachte moralische Referenzsystem. Ethik, auch angewandte Ethik, ist mehr als ein Rosinenpicken aus zufällig zusammengewürfelten moralischen Erwägungen. Die angewandte Ethik ist aber andererseits auch schon lange über den Punkt hinaus, den ganz klassischen Moraltraditionen treu zu bleiben und zu versuchen, Fragen wie die gerade angedeutete zur Sterbehilfe allein mittels der klassischen Moralprinzipien zu beantworten.6 Ob man nun mit dem Utilitätsprinzip fragt, welche Lösung zum größten Glück bei der größten Zahl von Menschen führen würde, oder ob man sich am Kantischen kategorischen Imperativ orientiert und überlegt, welche im konkreten Fall handlungsleitende Maxime so beschaffen 3 Ich greife hier und im Folgenden teilweise zurück auf meinen Aufsatz „Abwägung und Spezifizierung in ethischen Entscheidungen“, in: O. Rauprich, R. Jox, G. Marckmann (Hrsg.), Vom Konflikt zur Lösung, Mentis (im Erscheinen). 4 Ich beschränke mich auf Prinzipienethiken und blende damit solche Positionen aus, die meinen, in der Ethik ohne Generalisierungen auskommen zu können (oder zu müssen), vgl. etwa Jonathan Dancys Partikularismus (2004) und Bernward Gesangs Verteidigung des Generalismus (2000). Zum Skeptizismus der ethischen Kasuistik in Bezug auf Prinzipien komme ich am Ende kurz zu sprechen. 5 Gleiches gilt für konkrete Fragen in anderen Bereichen der angewandten Ethik, bspw. die Wirtschaftsethik, die Umweltethik oder die Tierethik. Ich beschränke mich in diesem Beitrag aus Platzgründen auf die Medizinethik (die ich im Übrigen synonym mit „Bioethik“ verwende). 6 Inzwischen sollte deutlich geworden sein, dass ich die Begriffe „Moral“ und „Ethik“ synonym verwende. Weder in der Umgangssprache noch innerhalb der akademischen Philosophie hat sich eine klare Unterscheidung beider Begriffe herausgebildet. Ich hoffe, dass in meinen Ausführungen im jeweiligen Kontext deutlich wird, ob ich eher auf konkrete Regeln oder auf das Theoretisieren über solche Regeln Bezug nehme – ersteres wird teilweise als Moral, letzteres als Ethik bezeichnet, vgl. etwa von der Pfordten (2010: 1 ff.). 2 ist, dass man von ihr zugleich wollen kann, dass sie allgemeines Gesetz werde – welches klassische Moralprinzip man auch immer in Anschlag bringt, ein Problem wird schnell offensichtlich: Diese Prinzipien sind zu abstrakt, um eine klare Entscheidung in konkreten medizinethischen Fragen vorzugeben. Aus diesem Grund hat sich in den 1960er und 1970er Jahren mit dem Aufkommen immer neuer Möglichkeiten der Medizin die angewandte Ethik als eigene philosophische Disziplin herausgebildet und verbreitet aus den klassischen Moralprinzipien solche Prinzipien entwickelt, die konkreter sind und somit die handlungsleitende Funktion der Moral besser erfüllen. Es handelt sich also um eine Ausdifferenzierung, wie auch das Recht sie durchgemacht hat. Tom Beauchamp und James Childress haben etwa vier ethische Prinzipien vorgeschlagen, die den gesamten Bereich der Medizinethik erfassen und handlungsleitender sein sollen als die klassischen Moralprinzipien. Diese vier Prinzipien sind weithin bekannt: Respekt vor Autonomie (respect for autonomy), Nichtschaden (nonmaleficence), Wohltun (beneficence) und Gerechtigkeit (justice).7 Allerdings sind sie noch immer zu abstrakt, als dass sie klare Entscheidungen in konkreten medizinethischen Fragen vorgeben könnten. In der Ethik wie im Recht bedarf es neben der Normen noch geeigneter Methoden zur Konkretisierung und Anwendung von Normen. Schließlich erwarten wir, dass zwischen der Einzelfallentscheidung und den in Anschlag gebrachten Prinzipien eine Beziehung besteht. Beauchamp und Childress nutzen für ihre medizinethische Theorie, den principlism, vor allem zwei Methoden, nämlich Spezifizierung (specification) und Abwägung (balancing). Beide Methoden sollen helfen, unter Rückgriff auf die Prinzipien Einzelfallentscheidungen transparent zu treffen und zu rechtfertigen. Beides ist eminent wichtig im Umgang mit schwierigen medizinethischen Fragen, über die oftmals kein gesellschaftlicher Konsens besteht.8 Im Folgenden versuche ich am Beispiel des einflussreichen Verständnisses der Methoden der Abwägung und der Spezifizierung bei Beauchamp und Childress anzudeuten, wie die Rechtstheorie die Methodendiskussion in der angewandten Ethik bereichern kann. Schließlich beschäftigen sich Juristinnen schon seit sehr langer Zeit mit Methodenfragen. In der Ethik werden solche Fragen erst seit wenigen Jahrzehnten ausführlicher diskutiert, nämlich erst seitdem die Ethik durch die immer neuen technischen Entwicklungen und die damit einhergehende Orientierungslosigkeit in Erklärungsnot geraten und die hinter all den metaethischen Debatten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lange verborgene Leitfrage der Ethik – Was soll ich tun? – wieder in den Vordergrund getreten ist. Die Beantwortung dieser Leitfrage bedarf einer normativen Grundlage und geeigneter Methoden. In der Ethik ist es sicherlich leichter als im Recht, sich der bindenden Kraft eines bestimmten Regelsystems zu entziehen. Selbst wenn man eine bestimmte Rechtsnorm für 7 8 Vgl. Beauchamp und Childress 2013, S. 101 ff. Siehe Quante 2010, S. 9 ff. 3 inhaltlich falsch hält, für ineffizient etwa oder für unmoralisch, ist man grundsätzlich weiter an sie gebunden. Dies gilt nicht in gleicher Weise für die Ethik. Wenn man bspw. den principlism nicht weiter als individuell leitend ansehen möchte, weil er nicht die Menschenwürde als höchstes Gut schützt, ist man frei darin, sich ein alternatives System zu suchen oder selbst zu entwickeln. Es besteht also ein Unterschied auf der Bindungsebene zwischen Recht und Ethik. Auf der Ebene der Methoden besteht dieser Unterschied hingegen nicht. Egal welches System man konkret vertritt, man wird immer vor dem Problem stehen, die jeweiligen Normen transparent und rational mit konkreteren Normen und mit Einzelfallentscheidungen verbinden zu müssen. Dem Problem kann man nur entgehen, wenn man den Anspruch auf Systematizität, Transparenz und Rationalität aufgibt. 2 Spezifizierung Ich habe schon gesagt, dass ich mich zunächst exemplarisch auf zwei Methoden konzentrieren möchte – die Abwägung und die Spezifizierung. Wenn hier von Spezifizierung die Rede ist, dann ist nicht bloß das metaphorische Verständnis, dass etwas spezifischer gemacht wird, gemeint. Gemeint ist die Methode der Spezifizierung wie sie von dem Philosophen Henry Richardson entwickelt und in die medizinethische Debatte eingeführt wurde.9 David DeGrazia hat das Potential dieser Methode speziell für den principlism erkannt und bezeichnet die Methode als „the most significant contribution to bioethical theory in some time“.10 Was aber ist diese Spezifizierung? Grob gesagt geht es bei ihr darum, eine Norm spezifischer zu machen, indem man ihren Anwendungsbereich verringert. Dies geschieht durch die Hinzufügung von Bedingungen, die bspw. spezifizieren, wo, wann, wie und durch wen eine Handlung vorzunehmen ist. Spezifiziert wird also nicht durch die Feststellung der Bedeutung der Terme der Norm (Interpretation), sondern durch die Verringerung des Anwendungsbereichs der Norm. Dadurch soll ihre Anwendung im Einzelfall Schritt für Schritt leichter werden. Richardson geht davon aus, dass das Phänomen der Moral so komplex ist, dass wir nie in der Lage sein werden, tatsächlich universell gültige Moralprinzipien zu formulieren. Stattdessen, so Richardson, müssen wir uns mit prima facie-Normen begnügen, die immer offen sind für Ausnahmen und sogar für Revisionen. Diese Sichtweise passt zu vielen Theorien in der angewandten Ethik. Und sie hat eine entscheidende Auswirkung in methodischer Hinsicht: Wenn wir es in der Ethik immer mit prima facie-Normen zu tun haben, dann können wir nicht aus diesen Normen deduzieren, weil die Deduktion gerade das Vorhandensein einer universellen Norm voraussetze.11 Die Spezifizierung soll also gerade dort eine stabile Verbindung zwischen abstrakten und konkreteren Normen bzw. Einzelfalllösungen herstellen, wo die Deduktion als Option ausfällt. Zugleich soll die 9 Siehe Richardson 1990. DeGrazia 1992, S. 524. 11 Richardson 2000, S. 287 ff. 10 4 Spezifizierung rationaler sein als die eher intuitionistische Abwägung. Wie genau funktioniert also die Spezifizierung? Hier ist Richardsons Definition: „Norm p is a specification of norm q (or: p specifies q) if and only if (a) norms p and q are of the same normative type; (b) every possible instance of the absolute counterpart of p would count as an instance of the absolute counterpart of q (in other words, any act that satisfies p’s absolute counterpart also satisfies q’s absolute counterpart); (c) p specifies q by substantive means … by adding clauses indicating what, where, when, why, how, by what means, by whom, or to whom the action is to be, is not to be, or may be done or the action is to be described, or the end is to be pursued or conceived; and (d) none of these added clauses in p is irrelevant for q.”12 Diese Definition klingt etwas obskur, u.a. weil sie mit kontrafaktischen Annahmen arbeitet. Sie soll für universelle und für nicht-universelle (also prima facie-) Normen funktionieren. Bei nicht-universellen Normen soll man sich immer fragen, wie die Spezifizierungsrelation bei dem universellen Gegenstück (absolute counterpart)13 der Norm aussehen würde. Davon abgesehen zeigen Richardsons Erläuterungen zu der Definition, dass es vor allem auf die Kriterien (b) und (c) ankommt. Die Idee ist demnach, dass eine Norm p eine Spezifizierung einer Norm q ist, wenn jeder Fall von p auch immer ein Fall von q ist (Kriterium b) und wenn p tatsächlich spezifischer als q ist, weil Bedingungen hinzugefügt wurden (Kriterium c). Kriterium (b) sorgt also für die Einengung des Anwendungsbereichs der ursprünglichen Norm während (c) sagt, wie diese Einengung zu geschehen hat, nämlich durch die Hinzufügung von Bedingungen.14 Eine Definition der ‚Respekt vor Autonomie‘-Norm im principlism als ‚erlaube kompetenten Personen, ihre Freiheitsrechte auszuüben‘ wäre demnach keine Spezifizierung, weil sie Richardsons Kriterien nicht erfüllt.15 Sie engt den Anwendungsbereich der Autonomienorm nicht ein, sondern expliziert nur ihre Bedeutung. Eine Spezifizierung wäre etwa „Respektiere die Autonomie von Menschen, indem du als Ärztin den Sterbewunsch einer Patientin respektierst.“ Diese Norm könnte man weiter spezifizieren: „… indem du sie bei der Umsetzung des Sterbewunsches unterstützt“, und weiter: „… auch wenn die Patientin Anzeichen von Depression zeigt“, und noch weiter: „… jedenfalls wenn diese Anzeichen eine 12 Richardson 1990, S. 295 f. Der hier zitierte Aufsatz von Richardson findet sich auf Deutsch in dem sehr hilfreichen, von Oliver Rauprich und Florian Steger herausgegebenen Band „Prinzipienethik in der Biomedizin“, Frankfurt a.M. (Campus), 2005, S. 252-290. 13 Richardsons Begrifflichkeiten sind mitunter nicht sehr gut gewählt. Was er als „absolute“ bezeichnet, übersetze ich hier als „universell“. Gemeint ist eigentlich, dass universelle bzw. absolute Normen solche sind, die all-quantifiziert sind. Eine Norm der Form „Für alle x,y,z gilt: Wenn X, dann soll Y“ wäre also universell bzw. absolut; sie ist nicht offen für Ausnahmen. 14 Die Kriterien (a) und (d) sind eher Randkriterien; ich lasse sie im Weiteren außer Acht. 15 Vgl. Beauchamp 2011, S. 310 ff. 5 Folge der wiederholten Zurückweisung ihres Wunsches sind.“ Dieses Beispiel zeigt, wie der Anwendungsbereich der Ursprungsnorm durch die Hinzufügung von Bedingungen immer weiter eingeengt werden kann.16 2.1 Spezifizierung als formale Relation Für das Verständnis der Spezifizierung als Methode ist es wichtig, zu sehen, dass sie lediglich eine formale Relation zwischen zwei Normen – einer abstrakteren und einer spezifischeren – ist. Die Spezifizierung selbst liefert keinerlei Kriterien für die Rechtfertigung einer Norm. Ebenso wenig gibt sie selbst Kriterien für die Wahl zwischen verschiedenen möglichen Spezifizierungen einer abstrakten Norm an. Im genannten Sterbehilfe-Beispiel wären Richardsons Kriterien für Spezifizierung etwa auch hiermit erfüllt: „Respektiere die Autonomie von Menschen, indem du als Ärztin den Sterbewunsch einer Patientin respektierst, indem du sie bei der Umsetzung des Sterbewunsches unterstützt, es sei denn die Patientin zeigt Anzeichen von Depression.“ Die Frage, ob nun diese Spezifizierung oder die oben vorgeschlagene besser ist, wird nicht von der Spezifizierungsrelation beantwortet.17 Für diese Auswahl zwischen alternativen Spezifizierungen greift Richardson auf das weite Überlegungsgleichgewicht zurück18, wie es seit John Rawls diskutiert wird und vor allem von Norman Daniels weiterentwickelt wurde. Diese Bezugnahme passt zwar wiederum gut zum principlism bei Beauchamp und Childress, ist allerdings nicht zwingend. Man kann die Spezifizierung ebenso gut mit anderen Rechtfertigungstheorien verbinden, z.B. mit Formen des Utilitarismus, des Kantianismus, der Kasuistik oder einfach mit dem Mehrheitsprinzip. Nicht zu sehen, dass die Spezifizierung eine rein formale Relation zwischen zwei Normen und kein materiales Prinzip ist, ist ein zentrales Missverständnis, dem ein Großteil der Literatur unterliegt.19 Diese beiden Ebenen auseinanderzuhalten, ist in der Rechtstheorie Allgemeingut. Bei Robert Alexy heißt die formale Relation – bei ihm die Deduktion – interne Rechtfertigung, während die materialen Rechtfertigungsprinzipien „extern“ genannt werden.20 Bei Hans-Joachim Koch und Helmut Rüßmann ist die Rede von Haupt- und Nebenschema.21 Der Punkt ist der gleiche: Die formale Relation ist unabhängig von den in Anschlag gebrachten materialen Prinzipien. So trivial der Punkt erscheinen mag. Er ist als Vorbedingung von formaler Gerechtigkeit und Regelanwendungsgleichheit ein Kernelement von Transparenz und Gerechtigkeit.22 16 Für eine komplette Falllösung mittels Spezifizierung siehe Rauprich (2011). Vgl. Tomlinson 2012, S. 64. 18 Siehe Richardson 1990, S. 300. 19 Vgl. etwa Strong 2000, S. 323 ff. oder Quante und Vieth 2000, S. 5 ff. 20 Alexy 1983, S. 273 ff. 21 Koch und Rüßmann 1982, S. 48 ff. 22 Vgl. nur Perelman 1967, S. 9 ff. und Rawls 1979, S. 78 und 265 ff. 17 6 2.2 (Keine) Trennung zwischen Normentwicklung und Anwendung Die Spezifizierung hat als Methode auch in dem engeren Verständnis als formale Relation zwischen zwei Normen eine Reihe von Problemen. Ich möchte hier nur eines davon hervorheben, nämlich die fehlende Trennung zwischen Normentwicklung und 23 Normanwendung – auch dies eine Unterscheidung, die in der Rechtstheorie zentral ist. Es ist zunächst überraschend, dass Richardson zwar eigentlich das Ziel vor Augen hatte, unter Rückgriff auf abstrakte Normen konkrete Fälle oder Probleme zu lösen, er dieses Ziel dann aber bereits auf Normebene als erfüllt ansieht. Spezifizierung beginnt mit einer abstrakten Norm und endet mit einer spezifischeren Norm. Keine Norm beantwortet aber konkrete und individuelle Fälle oder Probleme. Jede Norm, sei sie noch so spezifisch, bedarf der Anwendung auf das konkrete und individuelle Problem. Es scheint also, als wäre die Spezifizierung ein Mittel zur Weiterentwicklung des jeweiligen Moralsystems und kein Mittel zur Lösung konkreter Probleme. Er hat natürlich Recht, dass es immer leichter wird, Normen anzuwenden, je spezifischer sie formuliert sind. Aber das macht die Anwendung dieser Norm nicht irrelevant. Selbst eine recht spezifische Norm wie „Respektiere die Autonomie von Menschen, indem du als Ärztin den Sterbewunsch einer Patientin respektierst, indem du sie bei der Umsetzung des Sterbewunsches unterstützt, es sei denn die Patientin zeigt Anzeichen von Depression“ bedarf noch der Anwendung im Einzelfall. Es muss noch festgestellt werden, ob die Bedingungen der Norm bei der konkreten Patientin erfüllt sind. Man wird um eine Interpretation der Norm (sowie der Fall- oder Problembeschreibung) nicht umhin kommen, um die Kluft zwischen Norm und Einzelfall zu überbrücken. Insbesondere Koch und Rüßmann haben sich darum verdient gemacht, herauszuarbeiten, wie interpretativ und logisch komplex diese Überbrückung selbst in einfach gelagerten Fällen ist.24 Man muss die Spezifizierung also von einem Teil der ihr zugedachten Aufgabe befreien. Sie allein kann keine Einzelfälle beantworten. Zum einen ist sie nur eine formale Relation zwischen zwei Normen, die nicht selbst vorgibt, welche von mehreren möglichen Spezifizierungen gewählt werden soll. Zum anderen verbleibt sie per definitionem auf der Normebene und erreicht nie die Ebene des Einzelfalls. Beide Probleme sind aber behebbar, indem man die Spezifizierung explizit mit einer Rechtfertigungstheorie verbindet und in ein System verschiedener Methoden der Normanwendung und Normentwicklung25 einbettet. Sie selbst würde dabei zu letzteren gehören. Derart eingebettet kann Spezifizierung sinnvoll sein – speziell für ethische Theorien, die üblicherweise nicht den Detailgrad eines Rechtssystems haben (sollen). 23 Für eine ausführliche Diskussion weiterer Probleme siehe Paulo (im Erscheinen). Koch und Rüßmann 1982, S. 14 ff. und 48 ff. 25 Ich unterscheide Normanwendung und Normentwicklung in der Weise, dass erstere mit gegebenen Normen arbeitet und diese unverändert lässt, während letztere das jeweilige normative System immer verändert, sei es durch die Hinzufügung neuer Normen oder durch die Revision bestehender Normen. 24 7 3 Abwägung Im Gegensatz zu Richardson sehen Beauchamp und Childress die Spezifizierung nicht als eine Alternative zur Methode der Abwägung, sondern als deren Ergänzung.26 Während die Spezifizierung eher der Weiterentwicklung des ethischen Normsystems dient, indem sie die Generierung immer konkreterer Normen ermöglicht, ist die Abwägung eher für Einzelfallentscheidungen relevant. Insbesondere kommt es auf die Abwägung an, wenn zwei prima facie-Normen miteinander in Konflikt geraten. Und dies geschieht in Prinzipienethiken wie dem principlism andauernd. Es ist geradezu die Grundidee solcher Prinzipienethiken, dass die jeweiligen ethischen Prinzipien nicht hierarchisch oder lexikalisch geordnet sind, sondern ihr Gewicht nur im konkreten Einzelfall bestimmt werden kann. Während im obigen Sterbehilfe-Beispiel das Prinzip des Respekts vor Autonomie das Nichtschadensprinzip überwiegen könnte, mag dieses Verhältnis in anders gelagerten Fällen anders sein. Es gibt keinen abstrakten Vorrang eines Prinzips über irgendein anderes. Die Vorrangbeziehungen können nur in konkreten Einzelfällen bestimmt werden. Wie aber findet diese Bestimmung statt? Beauchamp und Childress versuchen, dem Einwand, Abwägung sei ein rein intuitiver Vorgang und mithin anfällig für Irrationalität, zu begegnen, indem sie Kriterien benennen, die erfüllt sein müssen, um Einschränkungen von Prinzipien im principlism rechtfertigen zu können. Und zwar diese: “1. Good reasons can be offered to act on the overriding norm rather than on the infringed norm. 2. The moral objective justifying the infringement has a realistic prospect of achievement. 3. No morally preferable alternative actions are available. 4. The lowest level of infringement, commensurate with achieving the primary goal of the action, has been selected. 5. Any negative effects of the infringement have been minimized. 6. All affected parties have been treated impartially.”27 Diese Kriterien sind insgesamt hilfreich. Jedoch trifft dies nicht auf alle zu. Problematisch ist ferner, dass sie unsystematisiert nebeneinander stehen und einfach ad hoc, ohne weitere Begründung, eingeführt werden. Drei dieser sechs Kriterien – nämlich 1, 3 und 6 – kann man direkt als wenig hilfreich beiseitelegen. Kriterium 1 ist extrem unbestimmt und scheint eher ein weiterer Verweis auf die Abwägungsmetapher zu sein, als selbst die Abwägung zu steuern. Geradezu dubios ist Kriterium 3, ist es doch eine grundlegende Anforderung an jede moralische Bewertung: Wenn es eine moralisch vorzugswürdige Alternative gibt, dann ist diese – aus Sicht der Moral – vorzuziehen. Kriterium 6 verlangt Unparteilichkeit. Diese 26 27 Beauchamp und Childress 2013, S. 17 ff. Beauchamp und Childress 2013, S. 23. 8 Forderung ist an sich sehr berechtigt. Fast alle ethischen Theorien beinhalten eine Unparteilichkeitsforderung – entweder als ausdrückliches Prinzip oder indirekt durch die Nutzung genereller Normen. Eine Norm ist grob gesagt dann generell, wenn ihr „Adressatenkreis mit allgemeinen Merkmalen beschrieben und durch Anwendung dieser Merkmale im Einzelfall bestimmbar ist“28. Wenn ich eine derartige generelle Norm parteilich anwende, dann wende ich sie falsch an. Unparteilichkeit gehört zu jeder Prinzipienethik, hat aber nichts mit der Abwägung zu tun.29 Viel interessanter sind die drei übrigen Bedingungen, die allerdings bei Beauchamp und Childress unsystematisiert daherkommen und ad hoc eingeführt werden. Die Systematisierung dieser Kriterien, die ich hier vorschlage, macht sich die Parallelität zwischen den Kriterien und dem rechtstheoretischen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zunutze. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entstammt bekanntermaßen dem deutschen öffentlichen Recht, wird heutzutage aber fast weltweit eingesetzt, um Konflikte zwischen Rechtsprinzipien aufzulösen.30 Besonders relevant ist er im Bereich der Grund- und Menschenrechte; diskutiert wird er aber auch als Grundelement einer zunehmend globalisierten 31 Rechtsordnung. Im Kern besagt der Grundsatz, dass Rechte oder Prinzipien im Konfliktfall nur eingeschränkt werden können, wenn dies (1) mit einem legitimen Ziel geschieht, (2) die eingesetzten Mittel zur Zielerreichung tatsächlich geeignet sind, (3) die Mittel die mildesten sind, die zur Zielerreichung zur Verfügung stehen (Erforderlichkeit), und wenn (4) die Mittel im engeren Sinne verhältnismäßig sind (Abwägung/balancing). Wenn man diesen Grundsatz nun mit Beauchamp und Childress‘ Kriterien vergleicht, scheint es schon an einer Entsprechung für die erste Verhältnismäßigkeitsbedingung (legitimes Ziel) zu fehlen. Diese Bedingung besagt, dass nur solche Ziele ein Rechtsprinzip einschränken können, die selbst in dem jeweiligen Rechtssystem legitim sind. Der principlism kennt eine solche Bedingung nicht direkt; indirekt aber schon: Schließlich kommt es im principlism erst dann zu einem abwägungsbedürftigen Konflikt, wenn zwei Prinzipien kollidieren – und zwar zwei principlism-immanente Prinzipien. Die Struktur des principlism setzt diese Bedingung also voraus. Das rechtstheoretische Geeignetheitskriterium verlangt eine rationale Verbindung zwischen dem verfolgten Ziel und den dafür eingesetzten Mitteln. Die Mittel müssen zumindest geeignet sein, das Ziel zu erreichen. Dieses Kriterium hat einen starken empirischen Einschlag, verlangt also oftmals die Beantwortung schwieriger tatsächlicher Fragen, und 28 Koch und Rüßmann 1982, S. 81. Vgl. auch Tomlinson 2012, S. 55. 30 Vgl. Barak 2012, S. 181 ff.; kritisch: Urbina 2012, S. 49 ff. 31 Vgl. Klatt und Meister 2012, S. 1 ff. 29 9 schließt bloß symbolische Maßnahmen aus. Ein ganz paralleles Kriterium ist das zweite bei Beauchamp und Childress. Eines verwundert bei deren Formulierung allerdings: Sie vergessen, sicherzustellen, dass die Erfolgsaussichten gerade mit den eingesetzten Mitteln bestehen – es wäre hingegen wenig sinnvoll, wenn zwar das verfolgte Ziel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erreicht werden kann, jedoch nicht mit dem aktuell vorgesehenen Mittel. Beauchamp und Childress‘ Kriterien 4 und 5 sind das Spiegelbild zur Erforderlichkeitsbedingung im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Es ist nicht ganz klar, ob Kriterium 5 eigenständig ist. Impliziert die Auswahl derjenigen Option mit der geringsten Beeinträchtigung nicht bereits die Minimierung der Auswirkungen der Beeinträchtigung? Möglich wäre allerdings, dass Auswirkungen auf Dritte gemeint sind. Die rechtstheoretische Erforderlichkeitsbedingung verlangt, dass kein weniger beeinträchtigendes Mittel verfügbar sein darf, das zur Zielerreichung mindestens ebenso geeignet ist, wie das gewählte. Auch hier ist also oft empirisches Wissen gefragt. Außerdem ist diese Bedingung eine Aufforderung zur Kreativität, gilt es doch, sich immer wieder zu fragen, ob es nicht doch noch Alternativen gibt, die milder sind. Ob die mildere Alternative dann nur irgendwie (wie im principlism) oder genauso effektiv (wie im Recht) das Ziel erreichen muss, ist eine Frage, die weiterer Präzisierung bedarf. Genau für solche Fragen könnten externe Effekte, wie sie Kriterium 5 evtl. andeutet, relevant sein. 3.1 Zwischenergebnis Lassen Sie mich kurz zusammenfassen: Wir haben gesehen, dass Beauchamp und Childress‘ Kriterien 1, 3 und 6 wenig hilfreich bzw. deplatziert sind. Außerdem haben wir gesehen, dass die Struktur des principlism zusammen mit den Kriterien 2, 4 und 5 weitgehend den ersten drei Stufen des rechtstheoretischen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes entsprechen. Dieses Zwischenergebnis ist etwas überraschend. Schließlich sollten die sechs Kriterien dem Einwand begegnen, dass Abwägung im principlism zu irrational und intuitiv sei. Von Abwägung war bisher aber gar nicht die Rede. Ein erneuter Blick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz macht deutlich, was hier passiert: Die Kriterien des principlism übernehmen genau Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, die Funktion nämlich die der drei Vorbereitung ersten des Stufen des eigentlichen Abwägungsprozesses. Die ersten Stufen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes haben eine Filterfunktion. Sie schließen nach und nach verschiedene in Betracht gezogene Maßnahmen und Mittel als illegitim aus. Nur solche Mittel und Maßnahmen, die alle drei Bedingungen erfüllt haben, bedürfen überhaupt einer Abwägung. Ebenso im principlism: die Kriterien 10 begrenzen die Anzahl der Fälle, die einer Abwägung bedürfen. Sie steuern aber selbst nicht die Abwägung.32 3.2 Die eigentliche Abwägung Nun, da wir dank des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ein klareres Bild haben, welche Funktion Beauchamp und Childress‘ Kriterien haben, wissen wir aber noch immer nicht, wie die eigentliche Abwägung im principlism funktioniert. Verstreute Hinweise machen jedoch zumindest zwei Elemente deutlich, die für die Abwägung besonders wichtig zu sein scheinen, nämlich dass (1) die Gewichtung der Prinzipien im jeweiligen Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände vorzunehmen ist und dass (2) Unsicherheiten sowie Erfolgsaussichten zu berücksichtigen sind.33 Auch hier bringt ein Blick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz mehr Klarheit. Nach dem sehr einflussreichen Modell Alexys besteht Abwägung im Wesentlichen aus drei Stufen.34 Auf der ersten Stufe werden die abstrakten Gewichte der betroffenen Prinzipien oder Rechte bestimmt. Abstrakt sind die Gewichte hier in dem Sinne, dass sie nicht von den konkreten Umständen im Einzelfall abhängen sondern in allen Fällen gleich sind. So ist etwa die Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) abstrakt gewichtiger als das Recht, Gesellschaften zu gründen (Art. 9 Abs. 1 GG). Eine solche abstrakte Ordnung soll es im principlism nicht geben. Relevanter sind daher die folgenden Stufen. Auf der zweiten Stufe geht es um den Grad der Beeinträchtigung der betroffenen Prinzipien. Diese Grade können nicht abstrakt, sondern nur im konkreten Einzelfall bestimmt werden. So mag in einem Fall einer zweifelhaften Zwangsunterbringung in einer geschlossenen Anstalt zwar das öffentliche Wohl betroffen sein, weil die Untergebrachte ein gewisses Risiko darstellt. Viel gravierender und konkreter betroffen sind in einem solchen Fall aber Prinzipien, die die Freiheit der Betroffenen schützen sollen. Auf der dritten Stufe schließlich geht es um die empirische Sicherheit (oder Unsicherheit), die der gewählten Maßnahme zugrunde liegt. Je höher der Grad an Beeinträchtigung eines Prinzips auf der zweiten Stufe ist, desto sicherer muss man sich hinsichtlich der Prämissen der gewählten Maßnahme sein, die diese Beeinträchtigung mit sich bringt. Diese kurzen Bemerkungen sollten bereits deutlich machen, dass Alexys Modell die beiden eher intuitiven Hinweise von Beauchamp und Childress aufnehmen und zu ihrer Präzisierung und Systematisierung beitragen kann. Es ist übrigens kein Zufall, dass die Struktur der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Recht und im principlism derart ähnlich ist. Schließlich ist das Prinzipienverständnis bei Alexy und bei Beauchamp und Childress nahezu identisch 35; 32 Vgl. Tomlinson 2012, S. 55 f. Beauchamp und Childress 2013, S. 20 ff. 34 Vgl. etwa Alexy 2003, S. 436 ff. 35 Vgl. Alexy 1996, Kapitel 3 und Beauchamp und Childress 2013, S. 13 ff. 33 11 beide bauen auf W.D. Ross‘ Idee von prima facie-Normen auf, die im Konfliktfall nach genau einer solchen Struktur verlangen, wie sie der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bietet. Alexy versucht sogar, den Grundsatz aus der Normstruktur heraus zu begründen.36 Alexy und andere haben 37 ausgearbeitet. dieses dreigliedrige Grundmodell der Abwägung sehr detailliert Ein Blick hierauf – der mir hier aus Platzgründen nicht möglich ist – ist auch für die Ethik informativ. 3.3 Kritik Die Abwägungsdebatte innerhalb der Rechtstheorie hat aber auch kritische Punkte hervorgebracht, die in der ethischen Debatte noch erstaunlich unterbelichtet sind. So wird etwa schon länger diskutiert, ob der Abwägung eine konsequentialistische Maximierungslogik zugrunde liege, die jeder normativen Theorie eine (oft verborgene) konsequentialistische Schlagseite gibt.38 Bereits Alexys Bezeichnung der Prinzipien als „Optimierungsgebote“ legt diese Vermutung nahe. Wenn diese Kritik zuträfe, dann wäre die Abwägung aber – anders als viele Vertreter der Prinzipientheorie behaupten – kein normativ neutrales Element einer Argumentationstheorie, also ein Element der internen Rechtfertigung, das nur auf (substantielle) externe Rechtfertigungen verweist, um die konkreten Gewichte im Einzelfall zuzuweisen. 39 Der Grundsatz wäre quasi normativ strukturiert. Ich kann hier keine umfängliche Antwort auf diese Kritik bieten. Andeuten möchte ich aber wenigstens, dass es nicht notwendig ein Problem darstellt, das Neutralitätsideal aufzugeben. Schließlich könnte man den gesamten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als eine elaborierte Verbindung rivalisierender Moraltheorien verstehen. Die Grundidee, Rechte als normative Kategorie zu nutzen, ihnen bestimmte Gewichte zuzuordnen und Rationalitätskriterien aufzustellen, die die Einschränkung der Rechte steuern, ist – wie die ersten Stufen des Grundsatzes – tief in der deontologischen Denkweise verankert. Die Stufen der Erforderlichkeit und der Angemessenheit bieten erst danach die Möglichkeit, komparativ und konsequentialistisch maximierend feinzusteuern, wo die gröbsten Ungerechtigkeiten bereits im Voraus deontologisch ausgeschlossen wurden. Eine zweite Kritiklinie, die im Recht wie in der Ethik gleichermaßen relevant wie bisher ungelöst ist, besagt, dass Abwägungen fast immer an Unvergleichbarkeit (incomparability) oder Inkommensurabilität scheitern.40 Die Grundidee ist, dass zwei Dinge – seien es Stühle, Blumen, Rechte oder Prinzipien – nur dann miteinander verglichen werden können, wenn es 36 Alexy 1996, S. 100 ff. Vgl. etwa Klatt und Meister 2012, S. 7 ff. 38 Vgl. Urbina 2012, S. 49 ff. 39 Zu diesem Missverständnis der Kritik siehe bspw. Klatt und Meister 2012, S. 56, 64 f. 40 Vgl. Endicott 2012, S. 5 ff. 37 12 einen gemeinsamen Referenzpunkt gibt.41 So kann man zwei Stühle etwa in Bezug auf ihre Größe oder ihren Preis vergleichen und sagen, dass der eine größer oder teurer ist als der andere. Was ist aber der Referenzpunkt in der Abwägung von Prinzipien? Verschiedene Vorschläge wurden unterbreitet42, die jedoch alle nicht durchweg überzeugend erscheinen. Auch diese bisher ungelösten Kontroversen innerhalb der Rechtstheorie können das Verständnis der Abwägung und vergleichbarer Methoden in der Ethik verbessern. 4 Kasuistik Bisher habe ich mich auf den principlism als eine sehr einflussreiche Variante einer Prinzipienethik beschränkt, die dem Civil Law strukturell sehr nahe steht. Entsprechend habe ich mich vor allem solcher Elemente bedient, die der kontinentaleuropäischen Rechtstheorie entspringen. Nun möchte ich in einem kurzen Ausblick noch andeuten, dass Lerneffekte auch zwischen der Rechtstheorie des Common Law und der ethischen Kasuistik entstehen können. Anknüpfen möchte ich hierfür an der oft festgestellten Ähnlichkeit zwischen Common Law und Kasuistik in der Ethik. John Arras etwa hat die Kasuistik „common law morality“ und „morisprudence“ genannt.43 Ähnliche Bezeichnungen finden sich bei Beauchamp und Childress44 sowie bei Albert Jonsen und Stephen Toulmin45, auf deren Ausarbeitung der Kasuistik ich mich hier beschränke.46 Der grundsätzliche Unterschied zwischen Common Law und Civil Law auf der einen Seite und Kasuistik und Prinzipienethik auf der anderen ist der gleiche: Während Civil Law und Prinzipienethik bei der Entscheidung von Einzelfällen auf Normen zurückgreifen, die sie auf die Fälle anwenden, wählen Common Law und Kasuistik einen ganz anderen Zugang. Letztere suchen bei Einzelfallentscheidungen nicht nach Normen, sondern nach Fällen, in denen ähnliche Streitfragen bereits entschieden wurden. Jonsen und Toulmin haben diesen Zugang zu normativen Fragen für die Ethik neu belebt, indem sie vor allem auf die Kasuistik zurückgegriffen haben, wie sie von den Jesuiten im 16. und 17. Jahrhundert praktiziert wurde. Aus der Tradition des Common Law haben sie nicht – oder jedenfalls nicht über metaphorische Bezugnahmen hinaus – geschöpft. Die ethische Kasuistik greift die verbreitete Einsicht auf, dass Menschen sich oft in der Beurteilung von Einzelfällen sicher sind, jedoch nicht in den abstrakteren Gründen für die jeweilige Entscheidung. In praktischen Lebensbereichen läge unsere Sicherheit eben im Konkreten, nicht im Abstrakten (wie in theoretischen 41 Bereichen wie z.B. der Geometrie). Vgl. Chang, 1997, S. 6. Vgl. Barak 2012, S. 484 sowie Klatt und Meister 2012, S. 63. 43 Arras 1990, S. 35 ff. 44 Beauchamp und Childress 2013, S. 400. 45 Jonsen und Toulmin 1988, S. 316. 46 Ich tue dies, weil es – soweit ich sehe – die am besten ausgearbeitete und einflussreichste ethische Kasuistik ist. 42 13 Prinzipienethiken würden dieser Einsicht nicht gerecht und täten so, als wäre die Ethik Teil des Theoretischen, wo wir uns über abstrakte Prinzipien einigen könnten.47 Kasuistik will also weg von Prinzipien und hin zur Argumentation mittels Analogien zwischen Einzelfällen. Zumindest für den Bereich der Medizinethik, für den ihr Buch The Abuse of Casuistry vor allem gedacht ist, kommen sie damit auch der Denkweise von Medizinerinnen entgegen, die ihr Fach vor allem anhand paradigmatischer Fälle gelernt haben und nicht über den Umweg hochabstrakter Theorien. Eine kasuistische Falllösung soll grob in drei Schritten ablaufen.48 Zunächst muss man die Morphologie des Falles verstehen, was zweierlei erfordert: erstens die Herausarbeitung der Maximen, die im Zentrum des Falles widerstreiten, und zweitens die Bestimmung der relevanten Umstände des Einzelfalls. Im zweiten Schritt wird eine Taxonomie gebildet, also eine Anordnung vergleichbarer Fälle von einem klaren paradigmatischen Fall hin zu immer zweifelhafteren Fällen im gleichen Problemfeld. Im dritten Schritt – Kinetik – findet dann die eigentliche Entscheidung statt, welcher ähnliche Fall die Entscheidungsgrundlage des aktuellen Falls werden soll, welche Analogie also die entscheidende ist. Dieses Modell der Falllösung in drei Schritten wurde verschiedentlich kritisiert.49 Ich möchte hier nur einen der vielen Punkte herausgreifen, in denen die Rechtstheorie helfen kann, die Funktionsweise der ethischen Kasuistik besser zu verstehen, nämlich die Rolle von Paradigmen. Diese werden in der Kasuistik verstanden als Regeln, die abstrakter sind als die Maximen in der Morphologie. Sie sollen paradigmatische Regeln für Richtigkeit oder Falschheit sein – bspw. sexueller Missbrauch von Kindern –, die eine Entscheidung dann determinieren, wenn keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen.50 In Einzelfällen können Paradigmen also wie prima facie-Normen überwogen werden. Kasuisten sehen hierin trotzdem keine Aufgabe ihrer Prinzipienskepsis, da sie die Paradigmen immer als in konkreten Fällen formulierte Regeln ansehen. Dies ist freilich auch im Common Law der Fall. Eine Falllösung im Common Law besteht üblicherweise aus fünf Elementen: (a) der Fallbeschreibung, (b) der relevanten Rechtsfrage, (c) der Erwägung dieser Frage, (d) der Entscheidung über diese Frage (ratio decidendi) und (e) der Entscheidung über den konkreten Einzelfall, die aus (d) folgt.51 Die meisten dieser Elemente einer Falllösung finden sich – bei genauerer Analyse – auch in der Kasuistik. Fraglich ist dies lediglich in Bezug auf (d), die ratio decidendi, die zur Grundlage einer deduktiv52 getroffenen Einzelfallentscheidung wird. Im Recht ist es genau diese Entscheidung der Rechtsfrage, die als Paradigma für zukünftige Entscheidungen 47 Jonsen und Toulmin 1988, S. 10 ff. Vgl. Jonsen 1991, S. 296 ff. 49 Siehe etwa Tomlinson 2012, S. 99 ff. 50 Vgl. Jonsen und Toulmin 1988, S. 307. 51 Vgl. Lamond 2006. 52 Zur Rolle der Deduktion in Analogieschlüssen siehe Brewer 1996, S. 1003 ff. 48 14 herangezogen wird. Richterinnen hangeln sich nicht von Einzelfallentscheidung zu Einzelfallentscheidung (also von Element (e) zu Element (e)), sondern sie suchen Regeln, die auf ihren konkreten Fall anwendbar sind. Dies sind auch die Regeln, die als Paradigma Eingang in Lehrbücher und Kommentare finden. Wie die Paradigmen in der ethischen Kasuistik werden auch die rechtlichen Paradigmen in konkreten Fällen entwickelt und formuliert. Und natürlich helfen die anderen Elemente der Lösung des paradigmatischen Falles bei der Auslegung der paradigmatischen Regel. Dies ändert jedoch nichts daran, dass das Paradigma nichts ist als eine Regel – im Recht wie in der ethischen Kasuistik. Genau wie in der Kasuistik wird ein Paradigma auf einen neuen Fall deduktiv angewendet – ganz wie ein Gesetz im Civil Law. Wenn der neue Fall die Tatbestandsmerkmale der ratio decidendi eines Paradigmas erfüllt, dann muss das Paradigma grundsätzlich angewendet werden. In diesen Fällen wird nicht einmal mit Analogieschlüssen gearbeitet, sondern schlicht aus der ratio decidendi deduziert.53 Die Bindung an das Paradigma ist jedoch nur bedingt. Sollte der neue Fall zwar unter die Regel des Paradigmas fallen, aber auch Merkmale aufweisen, die der dem Paradigma zu Grunde liegende Fall nicht aufwies, und werden diese neuen Merkmale als so relevant angesehen, dass es richtig erscheint, das Paradigma nicht auf den neuen Fall anzuwenden, dann können Gerichte im Common Law die Regel des Paradigmas verändern (distinguishing).54 Dies geschieht durch die Hinzufügung weiterer Kriterien des Ausgangsfalls mit dem Effekt, dass der aktuelle Fall nicht mehr unter die neue Regel fällt. Dieses Zusammenspiel von Regel und Ausnahme spiegelt ziemlich genau das wider, was Jonsen und Toulmin für ihre Kasuistik entwickeln wollten, aber leider nur auf recht unpräzise Art und Weise getan haben.55 Das Common Law könnte hier als Beispiel dafür dienen, wie man die gewünschte Orientierung an Fällen – mit dem Schwerpunkt auf Umständen des Einzelfalls – verbinden kann mit der Nutzung von Paradigmen, ohne entweder in einen Prinzipienfetischismus oder in einen Prinzipienskeptizismus zu verfallen. 5 Fazit Ich habe in diesem Beitrag zunächst die zwei Methoden vorgestellt und diskutiert, die Beauchamp und Childress in ihrem principlism nutzen, nämlich die Spezifizierung und die Abwägung. Unter Rückgriff auf die Rechtstheorie habe ich auf Probleme hingewiesen und Verbesserungsvorschläge angedeutet. Gleiches habe ich sodann unter Rückgriff auf das Common Law für die ethische Kasuistik getan. Ich hoffe, mit diesem kurzen Beitrag gezeigt 53 Vgl. Raz 2009, S. 180 ff. Von der Möglichkeit des overrulings sehe ich hier ab, weil die Kompetenz dafür bei nur sehr wenigen (hohen) Gerichten liegt, während jedes Gericht ein distinguishing vornehmen darf. Zu der genauen Vorgehensweise beim distinguishing siehe Raz 2009, S. 186 f. 55 Vgl. Jonsen und Toulmin 1988, S. 252, 316. 54 15 zu haben, dass die Methodendiskussion in der Rechtstheorie für jene in der Ethik überaus informativ ist. Eine Weiterentwicklung der Methoden ist ein sehr aussichtsreicher Weg, der Kritik an der angewandten Ethik insgesamt, sie sei zu untheoretisch und unwissenschaftlich, zu begegnen. Literaturverzeichnis Alexy, Robert (1983): Theorie der juristischen Argumentation. Frankfurt a.M. (Suhrkamp). Alexy, Robert (1996): Theorie der Grundrechte. 3. Auflage. Frankfurt a.M. (Suhrkamp). Alexy, Robert (2003): On balancing and Subsumtion. In: Ratio juris 16, S. 433-449. Arras, John (1990): Common Law Morality. In: Hastings Center Report 20, S. 35-37. Barak, Aharon (2012): Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations. Cambridge (Cambridge University Press). Beauchamp, Tom L. (2011): Making Principlism Practical: A Commentary on Gordon, Rauprich, and Vollmann. In: Bioethics 25, S. 301-303. Beauchamp, Tom L.; Childress, James F. (2013): Principles of Biomedical Ethics. 7. Aufl. New York (Oxford University Press). Brewer, Scott (1996): Exemplary Reasoning. In: Harvard Law Review 109, S. 923-1028. Childress, James F. (2007): Methods in Bioethics. In: Steinbock, Bonnie (Hrsg.): The Oxford Handbook of Bioethics. Oxford (Oxford University Press), S. 15-45. Dancy, Jonathan (2004): Ethics Without Principles. Oxford (Clarendon). DeGrazia, David (1992): Moving Forward in Bioethical Theory: Theories, Cases, and Specified Principlism. In: The Journal of Medicine and Philosophy 17, S. 511-539. Endicott, Timothy (2012): Proportionality and Incommensurability. University of Oxford Legal Research Paper Series. Paper No. http://ssrn.com/abstract=2086622. 16 40/2012. Verfügbar unter SSRN: Gesang, Bernward (2000): Kritik des Partikularismus. Paderborn (Mentis). Jonsen, Albert R. (1991): Casuistry as Methodology in Clinical Ethics. In: Theoretical Medicine 12, S. 296-307. Jonsen, Albert R.; Toulmin, Stephen (1988): The Abuse of Casuistry. Berkeley (University of California Press). Klatt, Matthias; Meister, Moritz (2012): The Constitutional Structure of Proportionality. Oxford (Oxford University Press). Koch, Hans-Joachim; Rüßmann, Helmut (1982): Juristische Begründungslehre. München (C.H. Beck). Paulo, Norbert (im Erscheinen): Specifying Specification. In: Kennedy Institute of Ethics Journal. Perelman, Chaïm (1967): Eine Studie über die Gerechtigkeit. In: ders.: Über die Gerechtigkeit. München (Beck), S. 9-84. Quante, Michael (2010): Menschenwürde und personale Autonomie. Demokratische Werte im Kontext der Lebenswissenschaften. Hamburg (Meiner). Quante, Michael; Vieth, Andreas (2000): Angewandte Ethik oder Ethik in Anwendung? Überlegungen zur Weiterentwicklung des principlism. In: Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 5, S. 5-34. Rauprich, Oliver (2011): Specification and Other Methods for Determining Morally Relevant Facts. In: Journal of Medical Ethics 37, S. 592-596. Rawls, John (1979): Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a.M. (Suhrkamp). Raz, Joseph (2009): Law and Value in Adjudication. In: ders.: The Authority of Law. 2. Aufl. New York (Oxford University Press), S. 180-209. Richardson, Henry S. (1990): Specifying Norms as a Way to Resolve Concrete Ethical Problems. In: Philosophy and Public Affairs 19, S. 279-310. 17 Richardson, Henry S. (2000): Specifying, Balancing, and Interpreting Bioethical Principles. In: The Journal of Medicine and Philosophy 25, S. 285-307. Strong, Carson (2000): Specified Principlism: What is it, and Does it Really Resolve Cases Better Than Casuistry? In: The Journal of Medicine and Philosophy 25, S. 323-341. Tomlinson, Tom (2012): Methods in Medical Ethics. New York (Oxford University Press). Urbina, Francisco (2012): A Critique of Proportionality. In: American Journal of Jurisprudence 57, S. 49-80. Von der Pfordten, Dietmar (2010): Normative Ethik. Berlin/New York (De Gruyter). 18