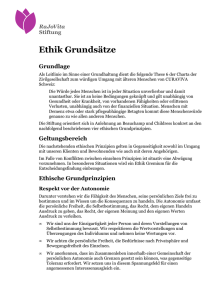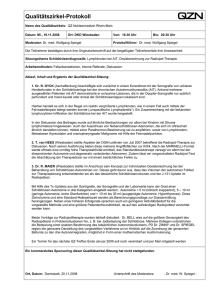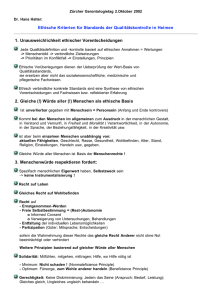Fragile Formate
Werbung

Pädagogische Rund-Schau Fragile Formate Bildung als inversive Subjektivierung Anselm Böhmer Bildung wird gegenwärtig aus vielerlei Gründen fraglich. Hierbei spielen insbesondere gesellschaftliche Aspekte für die Verbindung zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen eine Rolle, aber auch das grundsätzliche Fraglichwerden der Legitimation von Bildung, die als Konzept einer teleologischen und auf Vervollkommnung abzielenden Normierung individueller Selbstkonzepte kritisiert wird (vgl. Böhmer 2012). Der vorliegende Aufsatz verfolgt die Absicht, gegenwärtige Diskursstränge einer Problematisierung des Bildungsbegriffes aufzunehmen, um unter Verwendung der mit ihnen einhergehenden Argumentationsfiguren zu einem Verständnis von Bildung vorzudringen, das sich insbesondere der poststrukturalistisch geleiteten und nicht minder der von Seiten der historischen wie empirischen Bildungsforschung vorgebrachten Skepsis stellt. Gewinn einer solchen Darstellung kann insofern die Reformulierung des Bildungsbegriffes unter diskursiv ebenso wie gesellschaftspolitisch in Veränderung begriffenen Rahmenbedingungen sein, um auf diese Weise die mögliche Anschlussfähigkeit des Bildungskonzeptes an jene gesellschaftlichen Transformationen näher bestimmen zu können. Daher soll hier die These vorgestellt und geprüft werden, dass Bildung derjenige Prozess sei, in dem Menschen auf die ihnen entgegen kommenden Verhältnisse (vgl. Witte 2010, S. 150) antworten und auf diese Weise temporäre Formate ihrer Existenz gestalten. Diese Formate der Existenz sind im Sinne einer Subjektivierung von materiellen, historischen, sozialen, kulturellen und politischen Vorgaben bestimmt, gestatten aber dennoch innerhalb ihrer Grenzen unterschiedliche Spielräume der Ausgestaltung. Um diese Auffassung historisch verorten (1), unter der Maßgabe einer kritischen Sichtung der tradierten Wissensbestände darlegen (2) und sodann einer revidierten Position zuführen zu können (3), werden im Folgenden Theoriebestände herangezogen, die sich der Reflexion auf die Positionierung der Bildungsdebatte innerhalb gesellschaftlicher Veränderungsprozesse dadurch als angemessen erweisen, dass sie diese Umgestaltungen aufgreifen, ihnen inhaltliche Ergänzungen zuteil werden lassen und somit schließlich — in Nuancen — eine gleichfalls transformierte Bildungskonzeption ergeben können (4). 337 1 Bildung als Selbstvervollkommnung Um zunächst einen Klassiker der Bildungsdiskussion zu Wort kommen zu lassen, sei daher auf Wilhelm von Humboldt rekurriert. Nach seiner Auffassung ist der menschliche Geist bestimmt von »vollkommene[r] Einheit und durchgängige[r] Wechselwirkung, beide muss er […] auch auf die Natur übertragen« (Humboldt 1960, Bd. I, S. 237). Aus einer solchen Auffassung ergibt sich der Anspruch, den Menschen als Geist zu begreifen, ihn darin als einheitliches und harmonisches Wesen zu konzipieren (»vollkommene Einheit«) sowie daraus, wie noch ausführlicher gezeigt werden soll, ein spezifisches Verhältnis zur Welt (»Natur«) abzuleiten (ebd.). Insofern liegt es nahe, aus dieser Einschätzung Humboldts eine anthropologische Struktur abzuleiten, die von reflexiver Balance des auf Welt bezogenen Menschen geprägt ist (vgl. auch Böhmer 2014, S. 45ff). Inwiefern eine solche Verständnisweise der Menschen Bildungsrelevanz besitzt, macht der nachfolgende Hinweis deutlich: »Was im Menschen gedeihen soll, muss aus seinem Innren entspringen, nicht ihm von aussen gegeben werden« (Humboldt 1960, Bd. I, S. 36). Insofern findet sich bei Humboldt über die vorhergehende Einschätzung hinaus eine Verständnisweise des Menschen, die eine Dichotomie zwischen Innen und Außen ansetzt, um das Selbstverständnis des Menschen in einem Dreischritt von innerem Ursprung, äußerer Abgrenzung und wiederum innerem Gedeihen zu gliedern. Dies bedeutet für das Bildungskonzept, dass eine Perspektive genutzt wird, die zwischen Mensch und Welt eine Kluft setzt, diese durch die Zweigliedrigkeit eines Inneren und eines Äußeren entfaltet, dem Inneren des Menschen eine reflexive Form zuspricht und wiederum dem ausgewogenen Verhältnis verschiedener Elemente in ihm besondere Bedeutung zu erkennt (die vorherige »vollkommene Einheit«). »Bildung ist diesem Verständnis zufolge sowohl in ihrem Subjekt- als auch in ihrem Weltverhältnis eine transformatorische Arbeit des Menschen an seiner Bestimmung.« (Benner 2012, S. 160f) Damit bekommt Bildung einen aktiven Charakter, den Menschen durch ihre »transformatorische Arbeit« anzielen und zugleich inhaltlich definieren — nämlich als inneren, reflexiven und auf Harmonie gerichteten Akt, der auf diese Weise Subjektivität und zugleich Welt wandelt. Zudem ist Benner beizupflichten, insofern er den Zweck von Welt auf den Menschen hin konzentriert, da der Mensch »an seiner Bestimmung«, nicht jedoch derjenigen von Welt, einem Wechselverhältnis von beiden oder aber deren Zwischenspiel selbst zu arbeiten habe. Auf diese Weise zeigt sich bei Humboldt ein spezifisches Bildungsverständnis, das mit einer teleologischen und dabei auf spezifische, nämlich harmonisierende, Weise den Menschen in den Mittelpunkt rückende Verfahrensform gleichgesetzt werden kann. Was hierbei aus dem Blick gerät, ist mindestens dasjenige Weltverhältnis des Menschen, das ihn zunächst in einer Welt verortet, bevor diese dann durch ihn ebenfalls bildend bearbeitet werden kann. Darüber hinaus muss gerade im Bildungsakt danach gefragt werden, woher dessen Initiative stamme. Das Innere eines Menschen, das zudem durch die Abgrenzung von einem Äußeren definiert wird, ist wohl 338 kaum dazu angetan, eigene, aber auch beispielsweise Ding-bezogene oder weitere materielle Strukturen zu tangieren oder gar zu verändern. Hierzu nämlich müsste die Wechselwirkung zwischen Selbst und Welt weit differenzierter und eventuell auch bereits jenseits einer Zweiteilung von Innen und Außen gesucht werden. Deutlich wird bei diesem Blick in humboldtsche Bildungsüberlegungen, dass das Beispiel klassischer Bildungstheorie einen Aspekt menschlichen Lernens und dessen Ausgestaltung zu einer individuellen Form des Weltverhältnisses sowie -aufenthalts bietet. Dieser Blickwinkel zehrt aber davon, eine spezifische anthropologische Grundstruktur zu unterstellen, die, wie noch gezeigt werden soll, alles andere als selbstverständlich ist. Insofern soll im folgenden Abschnitt eine gewandelte Perspektive gesucht werden, um unter dieser Hinsicht die hier vorgestellten Anfragen an ein im zuvor skizzierten Sinne klassisches Bildungskonzept zu untermauern, zu restrukturieren und schlussendlich einem neuerlich zu konzipierenden Bildungsverständnis zuzuführen. 2 Unterwerfung Die bereits aufgeworfenen Anfragen an das harmonisierende Selbstbild des Menschen innerhalb des Bildungsprozesses werden durch poststrukturalistische Theoriebestände noch intensiver infrage gestellt. So sind es etwa die Studien Michel Foucaults, die in ihrem historischen Rückblick auf Selbstumgangsformen der Menschen, dabei auch Selbstbewirtschaftungsformen menschlicher Ordnungen und die ihnen inhärenten Machtkonstellationen und -dispositive aufmerksam macht. Dabei gilt: »Dispositive sind strukturierte, gleichwohl bewegliche Bündel von Praktiken, die in einer spezifischen Weise […] in bestimmte Bereiche intervenieren« (Mecheril 2011, S. 51f), indem sie insbesondere Einfluss auf die Aussagemöglichkeiten innerhalb von Diskursen nehmen. Indem Foucault gesellschaftliche Ordnungen untersucht und die in ihnen transportierten Formate alltäglicher Praktiken beschreibt, kann er auf diese Weise Anhaltspunkte bieten, die einer Bildungstheorie als Theorie des menschlichen Selbstverhältnisses im Angesicht der Dinge, der Welt und der individuellen, gruppenbezogenen sowie gesellschaftlichen Normen neuen Ausdruck verleihen können. Dabei kommt er zu der Erkenntnis: »Der Mensch, von dem man uns spricht und zu dessen Befreiung man einlädt, ist bereits in sich das Resultat einer Unterwerfung, die viel tiefer ist als er. […] Die Seele: Effekt und Instrument einer politischen Anatomie. Die Seele: Gefängnis des Körpers.« (Foucault 1994, S. 42) An dieser Stelle nun soll nicht das Verhältnis von Seele- und Körper-Konzepten im Mittelpunkt der Überlegungen stehen, sondern vielmehr die gesellschaftlich induzierten Voraussetzungen für diese Konzepte. Solche Voraussetzungen nämlich haben nach Foucault den Effekt, dass sie Konstellationen der Unterwerfung ergeben, in denen Menschen aufgrund politischer, gesellschaftlicher oder auch sozialer Vorgaben in ihren Freiheiten und insbesondere in deren alltäglicher praktischer Realisierung eingeschränkt werden. Diese Einschränkung gilt nach Auffassung Foucaults insofern, als dass see339 lisch wahrgenommene Regungen der Menschen auf diese vorgegebenen Dispositionen gesellschaftliche Systeme zurückzuführen seien. Was sich also an seelischen Regungen zeige und als solche zur Sprache gebracht werden könne, sei zunächst einmal dem gesellschaftlichen Postulat an die Individuen geschuldet. Daraus resultiert ein Menschenbild, das in seinen gesellschaftlichen Prozessen und Projekten beschränkt bleibt auf die Realisierung dieser Vorgaben; bei Zuwiderhandlung droht die Einschränkung gesellschaftlicher Teilhabe in jeweils unterschiedlicher Weise. Vor dem Hintergrund einer solchen Einengung der Menschen und ihrer Freiheitsgrade werden die Individuen selber zur Disposition gestellt. Die solcherart wahrgenommene Differenz zwischen individueller Selbsteinschätzung und faktischer Selbstgestaltung scheint auch nach Auffassung Judith Butlers unüberbrückbar zu sein: »Ich bin mir selbst gleichsam immer anders, und es gibt keinen abschließenden Moment, in dem ich zu mir selbst zurückkehre.« (Butler 2007, S. 41) Insofern erfährt sich das in permanenter Wandlung begriffene Individuum ebenso permanent unterwegs, ein statisches Selbst mit klar zu umschreibenden Grenzen, Fähigkeiten und Bedingungen lässt sich nicht einmal mehr als unerreichbares Ideal postulieren. Vielmehr wird auf diese Weise Subjektivität als ein Format von Individualität sichtbar, dass dem dauernden Wechsel ebenso unterworfen ist wie es für das Individuum selber unverfügbar zu sein scheint. Im Zusammenhang mit der von Foucault hergeleiteten gesellschaftlich bestimmten Unterwerfung der Individuen wird mit Butler an dieser Stelle deutlich, dass sich eine solche Subjektivität nicht darauf beschränken kann, in Opposition zu gesellschaftlichen Sachverhalten zu verbleiben. Stattdessen durchdringt die Unterwerfungstendenz gesellschaftlicher Dispositionen nun im Modus der Subjektivierung die Selbsteinschätzung und -wahrnehmung der Individuen, um auf diese Weise Formate einer unterworfenen Existenz im Angesicht der gesellschaftlich unterschiedlich gegebenen Regime zu generieren. Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen sozialphilosophischen Perspektiven werden jüngere Einschätzungen gesellschaftlicher Veränderungen in ihrer Reichweite deutlicher und lassen sich umfänglicher einordnen. So sei zunächst auf das Konzept einer selbstkritischen Modernisierung (vgl. Lepenies 1996a; 1996b) verwiesen, das deutlich macht, dass Modernisierungsprozesse als ambivalent eingeschätzt werden und insofern einer kritischen Selbstreflexion unterzogen werden können. Dabei zeigt sich, dass das Mittel dieser selbstreflexiven Wahl unvermindert die Vernunftleistung der Menschen ist. Auf diese Weise wird der Reformulierung menschlichen Selbstverständnisses in der Moderne — nämlich im Modus der Reflexion — weiterhin Folge geleistet, wenngleich der ursprünglich mit dieser Formel verbundenen Hoffnung auf vollumfängliches Selbstverstehen und -gestalten nunmehr keineswegs entsprochen werden kann. Wurde dies bereits als die Dialektik der Aufklärung begriffen (vgl. Horkheimer/Adorno 1997), so wird mit der Lesart Lepenies’ des Weiteren zum Ausdruck gebracht, dass eine solche Gegenläufigkeit aufklärerische Bemühungen durch einen strukturellen Neuansatz, eben jenen der Selbstkritik, aufgehoben werden muss. Bildung unter dieser Hinsicht bedeutet insofern einerseits, sich der eigenen Vernunftbegabung bewusst zu sein und sie dementsprechend einsetzen zu kön- 340 nen, andererseits jedoch auch, ihre Grenzen zu gewärtigen und in das Kalkül der eigenen biografischen Gestaltung unabänderlich einbeziehen zu müssen. Ein weiterer Aspekt bildungsspezifischer Problemanzeigen wird mit dem Schlagwort der ›Ökonomisierung von Bildung‹ definiert. Mit diesem Terminus wird die Einschätzung verbunden, dass Bildungssysteme und -projekte mehr denn je davon betroffen seien, ihre Möglichkeit zur Realisierung vor allen Dingen unter ökonomischen Aspekten legitimieren zu müssen. Eine solche Sichtweise geht einher mit der Befürchtung, dass somit Bildung als individueller Freiheitsraum vermehrt unter ökonomische Sachzwänge gezwungen werde. In kritischer Abgrenzung von dieser Position macht hingegen Bellmann (2012) deutlich, dass unter historischer Hinsicht verschiedene Bildungskonzepte bereits mit »je spezifische[r] Ökonomie« (ebd., S. 156) ausgestattet waren. Dieser Hinweis mag nur ein geringer Trost für jene sein, die Möglichkeiten von Bildung durch eine solche Verwertungs- und von Ressourcenmangel beschränkte Perspektive eingegrenzt sehen. Auf der anderen Seite jedoch kann damit gezeigt werden, dass eine solche Herausforderung keineswegs neu für das Bildungssystem ist und insofern auch einige Hoffnung legitimiert, solche Herausforderungen im gegenwärtigen Bildungswesen neuerlich bewältigen zu können. Ein letzter Aspekt zur aktuellen Situation von Bildungssystemen sei unter Hinweis auf Lessenich formuliert. Dieser legt dar: »Der Sozialstaat ist eine veritable Erziehungsagentur, eine Schulungsinstanz sozialen Handelns.« (Lessenich 2012, S. 56) Daraus resultiert zunächst, dass staatliches Handeln stärker durch normierende Eingriffe mit dem Interesse einer Gesinnungs- und Haltungsveränderung agiert. Aus diesem erzieherischen Blickwinkel heraus bedeutet dies für Bildungsprozesse, dass sie sich in den Kontext eben jener Normative eingebunden finden und somit das Verhältnis der Menschen zu sich, den anderen und der Welt, das hier als Bildung verstanden werden soll, in einer spezifischen Weise bestimmt. Dieses Spezifikum nämlich fokussiert den »Aktivbürger« (ebd.), jene BürgerIn also, die weit weniger auf eigene Rechte und Freiheiten pocht, als vielmehr selbst aktiv werden zu wollen, um damit einer nahestehenden Gemeinschaft dienen und sich auf diese Weise selber aktiv in gesellschaftliche Versorgungs- und Bildungsprozesse einbringen zu können. Woher freilich ein solches Wollen stammt, muss mit der oben skizzierten Kritik am Seelenkonzept durch Foucault in Frage gestellt werden. Wenn nämlich sogar seelische Regungen letztlich bloß subjektive Ableitungen gesellschaftlicher Dispositive sind, werden Wollensregungen kaum umfängliche Autonomie für sich beanspruchen können. Wie kaum an anderer Stelle gesellschaftlicher Realitäten wird gerade hier augenfällig, inwieweit das Bildungssystem durch die erzieherischen Ansprüche staatlicher Instanzen gewandelt werden kann. Den in humboldtscher Weise mit Bildung verknüpften Erwartungen an die Bildungserträge von Ganzheitlichkeit, individueller Harmonie und innerer Reifung als Selbstvervollkommnung stehen unter der Hinsicht eines erzieherischen Staatskonzeptes veränderte Grundlagen-, Prozess- und Ertragsvorstellungen gegenüber. So wird nunmehr ein Menschenbild transportiert, dem nicht ein innerer Reifungsprozess zugetraut wird, sondern dem ein Aktivierungs341 geschehen zugemutet werden soll. Die dabei zu realisierenden Schritte wiederum müssen keine sein, welche die Individuen in freiheitlicher Selbstbestimmung wählen, sondern sie sind vielmehr jene, die sich als zielführend, wirkungsvoll und effizient erwiesen haben müssen. Schließlich sind die Ergebnisse, auf die ein solcher staatlicher Interventionismus hinwirken soll, mit einem verbindlich vorgegebenen Idealbild des aktiven und um das eigene Wohl wie das der anderen bemühten Bürgers gekoppelt, dem jeglicher Zug zu Passivität und nicht zuvor selbst erwirtschaftetem Genuss in Abrede gestellt wird (vgl. Böhmer 2013a; 2013b). Diese verschiedenen gesellschaftlichen Transformationen — die Dispositive subjektiver Unterwerfung, die daraus resultierenden subjektiven Formate der Unterworfenheit, die Notwendigkeit moderner Selbstkritik, die perpetuierte Ökonomisierung innerhalb der Bildungssysteme sowie schließlich das aktivierende sozialstaatliche Normativ — ergeben in toto eine Konzeption von Subjektivierung, welche aus dem vormaligen Herrscher und freiheitlichen Gestalter seiner selbst nunmehr den unterworfenen und sich in dieser Unterworfenheit ständig selbst rekapitulierenden Bestandteil des vergesellschaftenden Prozesses macht. Bildung unter dieser Hinsicht steht vor der gravierenden Herausforderung, eine Antwort auf diese gesellschaftliche Konstellation zu geben, welche einerseits mit deren Faktizität rechnet, ohne sich indes auf der anderen Seite diesem factum brutum schlicht ihrerseits zu unterwerfen. Wie aber soll unter diesen Perspektiven Bildung verstanden werden, wenn offenkundig der Weg zurück zu den Ursprüngen klassisch modernen Bildungsdenkens versperrt erscheint und andererseits zumindest limitierende, wenn nicht sogar negierende Strukturen einer uneingeschränkten Umsetzung von Bildungsaspirationen in Bildungsgeschehen entgegenstehen? 3 Alternative Annäherungen an den Bildungsbegriff Deutlich dürfte mit den bisherigen Ausführungen geworden sein, dass es alternativer Wege bedarf, um sich des Bildungsbegriffes in veränderten gesellschaftlichen Zusammenhängen zu versichern. Diese Versicherung erscheint insofern relevant, als der Begriff von Bildung ein Selbstverständnis pädagogischen Agierens, Organisierens und Reflektierens beschreibt, das verloren zu gehen drohte, wenn das diese Zusammenhänge beschreibende Begriffsinstrumentarium seinerseits verloren ginge. Somit soll im Folgenden eine solche alternative Annäherung an den Bildungsbegriff vorgeschlagen werden, die dem Bemühen geschuldet ist, diesen unter sich ändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu reformulieren und die mit ihm verbundenen strukturell-konzeptionellen Zugewinne pädagogischer Epistemologie aufrecht zu erhalten oder gar, geleitet durch die vorhergehenden Befunde, zu erweitern. Insofern soll bereits eine erste Korrektur an der mit Humboldt hergeleiteten These eines inneren Menschseins vorgenommen werden. Bei Merleau-Ponty etwa findet sich der in dieser Hinsicht die Perspektiven weitende Hinweis: »[…] es gibt keinen inneren Menschen: der Mensch ist zur Welt, er erkennt sich alleine in der Welt.« (Merleau-Ponty 1966, S. 7) Aus dieser Auffassung ergibt sich eine für die Interpreta342 tion aktueller gesellschaftlicher Zustände aufschlussreiche Ambivalenz des Menschseins. Denn zunächst sieht sich nach Merleau-Ponty der Mensch unter dieser Hinsicht genötigt, sich der Welt zuzuwenden; er ist gewissermaßen strukturell auf sie hin orientiert. Im Weiteren jedoch wird auch deutlich, dass unter einem solchen Zwang tatsächlich auch Selbsterkennen möglich werden kann. Was also diese notwendig erfolgende Hinwendung zur Welt für den Menschen bedeutet, ist seine strukturellen Verbundenheit mit eben dieser Welt, aus der er sich nachgerade nicht in eine innere Intimität flüchten oder aber in einer zweckorientierte Benutzung der in dieser Welt vorfindbaren Dinge und Rohstoffe begeben kann. Der Mensch unter dieser weltlichen Perspektive lässt sich somit verstehen als der kontinuierlich befremdete, dem solches Sich-fremd-Sein allgemein eignet und der sich als nachgerade Fremder selbst verstehen kann. Ein Weiteres sei angemerkt. Hatte nämlich jener Foucault der Reflexion auf Disziplinarmächte deutlich auf die Tendenzen zur Unterwerfung aufmerksam gemacht, so findet sich in seinem Spätwerk unter dem Label einer »Ästhetik der Existenz« (Foucault 2007) auch der Hinweis auf Möglichkeiten wie Notwendigkeiten einer kritischen Distanzierung der Individuen zu den Ansprüchen der gesellschaftlichen Regime (vgl. auch Foucault 1992). Damit aber wird eine Tendenz der Selbstführung in Foucaults Denken sichtbar, die auch für das Nachdenken über Bildung in gewandelten gesellschaftlichen Konstellationen weiterführende Gesichtspunkte bereithält. Hier zeigt sich insbesondere, dass trotz aller bisherigen Befürchtungen unumstößlicher Unterwerfungstendenzen nunmehr auch Freiheitsräume gewonnen werden können, die sich — wenn auch innerhalb der reglementierenden Dispositionen — eine gewisse Form von Selbstführung und somit -bestimmung als Inversion gesellschaftlicher Dispositive erringen könnten. Dabei soll als Inversion eine Umwandlung der dispositiven Prozesse und Effekte verstanden werden: hier nicht mehr von gesellschaftlichen Maßgaben auf die Individuen hin, sondern innerhalb der individuellen Selbstgestaltung als — mit gewissen Freiheitsgraden ausgestattete — Antwort auf gesellschaftliche Normative. Dabei sei abermals darauf verwiesen, dass daraus keine Dichotomie von Zwang und Freiheit abgeleitet werden kann, sondern vielmehr die dispositiven Aspekte gesellschaftlicher Regime allgemein fungieren und sich nunmehr im Kontext der solcherart agierenden Strukturen, Prozesse, Organisationen und (kollektiven) Akteure Möglichkeiten der Selbstgestaltung, aber mindestens ebenso sehr auch des Selbstentzuges bieten können. So ist gerade im Zusammenhang der auf Integration in der Erwerbsarbeitsgesellschaft zielenden Maxime des »Förderns und Forderns« (Sozialgesetzbuch II) ein solches Regime erzieherischer und damit normalisierend einschränkender Sozialstaatsansprüche anzusetzen. Freiheitsräume bieten sich hierin in ganz unterschiedlicher Weise. Beispielsweise mag die Übererfüllung der Eingliederungsvereinbarung, etwa hinsichtlich der verabredeten Anzahl von Bewerbungen, ein Ausdruck von Selbstführung sein können. Ein anderer dürfte sich in der — trotz aller institutionellen Reglementierungen — selbstbestimmten Suche nach einem den eigenen Ansprüchen genügenden Arbeitsplatz außerhalb der Pfade öffentlicher Arbeitsvermittlung ergeben können. Ein Selbstentzug findet sich ebenfalls in diesem Zusammenhang gerade 343 dann, wenn Menschen sich den Zumutungen eines solchen Regimes dadurch zu entziehen versuchen, dass sie sich entweder nicht mehr arbeitssuchend melden oder gleich ganz aus sozialen Sicherungszusammenhängen auszuscheren trachten, wie dies mitunter bei wohnungslosen Menschen angetroffen werden kann. Eine weitere Konkretisierung der Dimensionen möglicher Freiheitsgewinne für die Individuen ergibt sich im Hinblick auf Judith Butlers Reformulierung der ästhetisierenden Subjektivierungsbezüge innerhalb gesellschaftlicher Beschränkungen: »Sich so zu erschaffen, dass man diese Grenzen enthüllt, hieße nichts anderes, als sich einer Ästhetik der Existenz zu befleißigen, die eine kritische Beziehung zu bestehenden Normen unterhält« (Butler 2007, S. 27). Auch sie rekonstruiert mithin eine reflexive Form des menschlichen Selbstumganges, die durch nunmehr praktische Verwirklichung normativer Grenzbezeichnungen erste Anhaltspunkte für deren Überwindung gewinnen kann. Durch eine geringfügige Verschiebung der individuellen Selbstgestaltung unter der Hinsicht gesellschaftlicher Ansprüche nämlich lassen sich die Reibungspunkte mit bestehenden Ordnungen umso einfacher ausmachen, da mit diesen Abweichungen Konfliktfelder virulent werden, die sich sodann als vorgegebene Grenzen »enthüllen« lassen. Somit bedarf es nach Auffassung Butlers nicht allzu großer Anstrengungen, um dergestaltige Normen zu bezeichnen und durch eine solcherart fungierende Aufklärung bestehender Normative deren Fraglichwerden zu induzieren. Für die hier in Frage stehende Konzeption von Bildung resultiert daraus die Perspektive, sich in Bildungsprozessen in ein Selbst- und Weltverhältnis zu begeben, das »diese Grenzen enthüllt«, indem es verschiedene mögliche Spielarten der »Ästhetik der Existenz« durchspielt, weiter entwickelt und dabei in aller Fragilität der Ergebnisse existentielle Anfragen an bestehende Normen formuliert (ebd.). Dass eine solche Fragehaltung der eigenen Existenz erst sukzessive zu den ›passenden‹, weil mit zumindest nachweisbarem kritischen Potential ausgestatteten, Positionierungen des Selbst im sozialen und gesellschaftlichen Gefüge gelangen kann, macht die Vorläufigkeit und somit Fragilität der jeweiligen Ausdrucksgestalten aus. Insofern ergeben sich die »grundsätzlichen Dimensionen der Subjektivierung — Welt-, Anderen- und Selbstverhältnisse —« (Ricken 2013, S. 43) in einer Weise, die gesellschaftlich vorgegebene Ordnungen und Anrufungen der Individuen nicht zu überwinden, sondern zunächst zu »enthüllen« und im Zuge einer solchen Aufklärungsleistung zu kritisieren sucht. Existentielle Kritik erweist sich somit im Sinne des hier entwickelten alternativen Verständnisses von Bildung als ambivalente, weil Freiheitsgrade nachgerade in begrenzenden Verhältnissen ermittelnde Möglichkeit der Menschen. Diese Möglichkeit zu schaffen, kommt dabei menschlichen Bemühungen innerhalb eines Bildungsgeschehens zu, in dem sich die Beteiligten für eine existentiell wirksame Verhältnisbestimmung der Menschen zur Welt, den Anderen und sich engagieren. 344 4 Bildung — revisited Im zuvor entfalteten Argumentationsgang sollte gezeigt werden, dass unter den Ansprüchen der ambivalenten Selbst- und Weltverhältnisse das Individuum im Bildungsprozess in »reflektierter Unfügsamkeit« (Foucault 1992, S. 15) die ihm jeweils möglichen Freiheitsgrade anstreben kann. Somit wird Bildung zum Prozess der Formatierung einer situativ realisierten Melange von existentieller Fraglichkeit und Antwortversuch. In diesem Versuch konstituiert sich Subjektivität — situativ, weil sie stets von neuen Verhältnissen überholt werden kann, — strukturell different, da sie unterschiedlichste Strukturen bisheriger Subjektivität zur Geltung kommen lässt, — intersubjektiv diversifiziert, insofern sie mit verschiedensten Ausprägungen von Subjektivitäten im sozialen Feld zu tun bekommt — sowie fragil, da ein überzeitlich stabiles Format der Existenz unter den solcherart umrissenen Maßgaben nicht mehr realisiert werden kann. Auf diese Weise werden tradierte Auffassungen eines harmonisierend konzipierten Bildungsverständnisses und einer sich damit ergebenden Struktur gebildeten Menschseins unter ihrer teleologischen wie pragmatischen Hinsicht kritisiert. Eine Teleologie von Bildung lässt sich nicht mehr aufrecht erhalten, weil gesellschaftliche Normative mit ihrer spezifischen Prozessstruktur der Unterwerfungstendenzen kein dem Individuum zuerkanntes Zielstreben mehr zulassen, sondern eine diesem vorgängige Maxime polyvalenter Erträge verfolgen und somit einer am positiven telos orientierten Entwicklung der Menschen, insbesondere als Selbstzweck, zuwider laufen. Inmitten dieser dem individuellen Entwicklungsgang distanziert gegenüberstehenden Leitthemen jedoch finden die Individuen, so zeigte sich in der vorhergehenden Diskussion ebenfalls, auch Ansätze, eigene Praktiken der »Entunterwerfung« (ebd.) zu realisieren. Insofern kann von einer Inversion der freiheitlichen Selbstaktuierungen in bestehenden Unterwerfungsstrukturen gesprochen werden, sofern pragmatische Umformulierungen subjektivierender Antworten der Individuen bisherige Normative und ihre praktischen Äußerungen unterlaufen können. Formate existentieller Ausdrucksgestalten sind daher insoweit möglich, als sie gesellschaftlichen Vorgaben von Subjektivierung Rechnung tragen und ihnen in reflexiver Form gerade nicht entsprechende Ausdrucksgestalten eigener Existenz suchen und erproben. Solche Erprobungen wiederum werden sich innerhalb disziplinierender Ordnungen in aller Regel kaum langfristig aufrechterhalten lassen. Insofern muss davon ausgegangen werden, dass solche Formate eigenwilliger Beantwortung der Zumutungen von Subjektivierung brüchig und flüchtig sind. Ihre inversive Position innerhalb der dispositiven Felder gesellschaftlicher Normalisierung wird ihnen für gewöhnlich keine längerfristigen Möglichkeiten bieten. Daher kann die Eingangsthese nun einer Überprüfung unterzogen werden. Wurde dort formuliert, dass Bildung jener Prozess sei, in dem Menschen auf die ihnen entgegen kommenden Verhältnisse antworten und auf diese Weise temporäre Formate ihrer Existenz gestalten, so ist nunmehr zu ergänzen, dass solche Gestaltungsbemühungen sowohl unterworfen als auch freiheitlich erfolgen können. Die gesellschaftliche Rahmung mitsamt ihren dispositiven Vorgaben wird dabei nicht in Frage 345 gestellt, doch zeigen sich — gerade in der modernen Selbstvergewisserung der Individuen qua Reflexion — Spielräume einer transformierten Erfüllung gesellschaftlicher Ansprüche. Zudem ist darauf zu verweisen, dass diese Formate der Existenz im Sinne einer Subjektivierung von materiellen, historischen, sozialen, kulturellen und politischen Vorgaben bestimmt werden, sie aber dennoch unterschiedliche Spielräume der nunmehr situativen und fragilen Ausgestaltung gestatten. Unter dieser Hinsicht gilt für das solcherart revidierte moderne Bildungsverständnis: »Modern sein heißt nicht, sich selbst zu akzeptieren, so wie man im Fluss der vorübergehenden Momente ist; es heißt, sich selbst zum Gegenstand einer komplexen und strengen Ausarbeitung zu machen« (Foucault 2007, S. 181). Bildung könnte diese vorübergehenden Momente zum Anlass nehmen, Menschen darin mögliche Freiheitsräume suchen und reflektierend finden sowie nutzen zu lassen. Unter dieser Hinsicht wäre Bildung noch immer einem Selbstzweck der Menschen verpflichtet. Welchem jedoch, ließe sich lediglich individuell und situativ bestimmen. Literatur Bellmann, Johannes (2012): »The very speedy solution«. Neue Erziehung und Steuerung im Zeichen von Social Efficiency. In: Zeitschrift für Pädagogik 2/2012, S. 143-157. Benner, Dietrich (2012): Allgemeine Pädagogik. Eine systematisch-problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur pädagogischen Denkens und Handelns. Weinheim, München: Beltz Juventa. Böhmer, Anselm (2013): Das Fördern des Forderns. Eine subjekttheoretische Kritik transformierter Sozialpolitik. In: Benz, Benjamin/Rieger, Günter/Schönig, Werner/Többe-Schukalla, Monika (Hrsg.): Politik Sozialer Arbeit. Bd. I: Theoretische und disziplinäre Perspektiven. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, S. 247-264. [= Böhmer 2013a] Böhmer, Anselm (2013): Flexibel arbeiten — effizient leben? Die arbeitsgesellschaftliche Herausforderung komplexer Freiheiten. In: Spatschek, Christian/Wagenblass, Sabine (Hrsg.): Bildung, Teilhabe und Gerechtigkeit. Gesellschaftliche Herausforderungen und Zugänge Sozialer Arbeit. FS F.J. Krafeld. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, S. 125-138. [= Böhmer 2013b] Böhmer, Anselm (2014): Diskrete Differenzen. Experimente zur asubjektiven Bildungstheorie in einer selbstkritischen Moderne. Bielefeld: transcript. Butler, Judith (2007): Kritik der ethischen Gewalt (Erweiterte Ausgabe). Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag. Foucault, Michel (1992): Was ist Kritik? Berlin: Merve. Foucault, Michel (1994): Überwachen und Strafen. Die Ge­burt des Ge­fäng­nis­ses. Übers. von W. Seitter. Frank­furt/Main: Suhrkamp Verlag. Foucault, Michel (2007): Ästhetik der Existenz. Schriften zur Lebenskunst. Hrsg. von D. Defert u. F. Ewald unter Mitarbeit von J. Lagrange. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag. Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W. (1997): Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. In: Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften in zwanzig Bänden. Bd. 3. Hrsg. von Rolf Tiedemann unter Mitwirkung von Gretel Adorno, Susan Buck-Morss u. Klaus Schulz. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag. Humboldt, Wilhelm von (1960ff): Werke in fünf Bänden. Hrsg. von A. Flitner u. K. Giel. Stuttgart: Cotta. 346 Lepenies, Wolf (1996): Selbstkritische Moderne. Neue Leitbilder im Kontakt der Kultur. In: Dettling, Warnfried (Hrsg.): Die Zukunft denken. Neue Leitbilder für wirtschaftliches und gesellschaftliches Handeln. Frankfurt/Main: Campus-Verlag, S. 50-68. [= Lepenies 1996a] Lepenies, Wolf (1996): Selbstkritische Moderne. Neue Leitlinien im Kontakt der Kulturen. In: Internationale Politik 51/1996, S. 3-14. [= Lepenies 1996b] Lessenich, Stephan (2012): Der Sozialstaat als Erziehungsagentur. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 49-50/2012, S. 55-61. Mecheril, Paul (2011): Wirklichkeit schaffen: Integration als Dispositiv. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 43/2011, S. 49-54. Merleau-Ponty, Maurice (1966): Phänomenologie der Wahrnehmung. Übers. von R. Boehm. Berlin: De Gruyter. Ricken, Norbert (2013): Zur Logik der Subjektivierung. Überlegungen an den Rändern eines Konzepts. In: Gelhard, Andreas/Alkemeyer, Thomas/Ricken, Norbert (Hrsg.): Techniken der Subjektivierung. München: Wilhelm Fink, S. 29-47. Witte, Egbert (2010): Zur Geschichte der Bildung. Eine philosophische Kritik. München, Freiburg: Verlag Karl Alber. 347 Anerkennung, Autonomie und Erziehung Johannes Giesinger Während die moderne Pädagogik Autonomie, Selbstbestimmung oder Mündigkeit als Ziel von Erziehung definierte, sind in den vergangenen Jahrzehnten starke Vorbehalte gegen diese Ideen laut geworden. In der neueren deutschsprachigen Erziehungsphilosophie, die von postmodernen oder poststrukturalistischen Denkformen geprägt ist, hat sich weitgehend die Auffassung durchgesetzt, dass Autonomie als Illusion zu betrachten ist (vgl. Meyer-Drawe 1990; Schäfer 1996; Nordström 2009; Ricken 1999; Rieger-Ladich 2002). Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich auf einen zentralen Einwand gegen die Idee der Autonomie: Da das menschliche Selbst sozial, relational oder intersubjektiv konstituiert ist, kann es keine echte Autonomie geben. Dieser Grundgedanke scheint auch folgenden Ausführungen von Sabine Reh und Norbert Ricken zu Grunde zu liegen:1 »Wenn mit Anerkennung […] eine grundsätzliche, theoretisch gesprochen: kategoriale Weichenstellung einhergeht, dann ist es weder plausibel noch konsequent, sie bloß als Mittel und Phase zu denken, die dann aufhört, wenn Autonomie und Identität erreicht ist. Vielmehr ist Anerkennung eine grundsätzliche Struktur — was dann auch dazu führt, dass jeweilige Identitäts- und Autonomieverständnis[se] reformuliert werden müssen […]. Folgt man dieser Perspektive, dann taucht Anerkennung als Struktur und Existenz auf und muss auch als durchgängiges Medium verstanden werden — mit der Folge, dass Identität gerade nicht mehr als Selbsttransparenz und souveräne Autonomie, sondern als dezentrierte, relational bedingte Form der Selbstheit konzipiert werden muss« (Reh/Ricken 2012, S. 41). Wird die Idee der intersubjektiven Verfasstheit des Menschen ernst genommen, so diese Autoren, lässt sich die Vorstellung nicht halten, wonach Personen über »souveräne Autonomie« verfügen. Die obigen Formulierungen schließen nicht aus, dass auf der Basis der Anerkennungstheorie ein relationales Autonomieverständnis entwickelt werden könnte.2 Allerdings stehen Reh und Ricken Axel Honneths relationaler Autonomiekonzeption ablehnend gegenüber. Gegen Honneth (1994) nämlich richten sich die zitierten Bemerkungen, in denen unter anderem unterstellt wird, Honneth betrachte Anerkennung als bloßes Mittel zur Herstellung einer von intersubjektiven Bezügen unabhängigen Form von Identität und Autonomie. Honneth nimmt jedoch keineswegs an, dass nur Heranwachsende auf Anerkennung angewiesen sind. Vielmehr wird Anerkennung als allgemeine Bedingung von Autonomie gesehen (vgl. Anderson/Honneth 2005). Interessanterweise scheinen Reh und Ricken davon auszugehen, dass Autonomie durchaus möglich wäre, wenn Anerkennung nur »als Mittel und Phase« zu denken wäre, also bloß als Entwicklungsbedingung des Selbst, nicht aber als konstitutiv für menschliche Subjektivität. Jedoch scheint die Sinnhaftigkeit des Autonomieideals 348 auch dann in Frage gestellt, wenn Anerkennung »nur« für den primären Aufbau des Selbst, nicht aber für das Leben als Erwachsener relevant ist. Wenn wir nämlich in Kindheit und Jugend wesentlich durch intersubjektive Erfahrungen geprägt werden, so ist unklar, wie wir uns je wirklich von diesen absetzen können. In Abgrenzung gegen Honneth entwickeln Reh und Ricken einen basalen Begriff von Anerkennung, der nicht auf intersubjektive Formen der Bestätigung oder Wertschätzung fokussiert, sondern ganz unterschiedliche Arten der »Adressierung« einschließt (vgl. auch Balzer/Ricken 2010, S. 53ff). Ihre Auffassung lautet also, dass die moderne Idee souveräner Autonomie nicht mit der Vorstellung vereinbar ist, wonach das Selbst sich in Praktiken der Adressierung konstituiert. Honneths relationales Autonomieverständnis basiert demgegenüber auf der Annahme, dass Anerkennung die Autonomie der Person nicht unterminiert, sondern allererst ermöglicht. Gemäß dieser Auffassung können wir nicht autonom werden und sein, wenn wir von anderen nicht geliebt, sozial wertgeschätzt und respektiert werden und damit Gelegenheit haben, die entsprechenden Formen des Selbstverhältnisses (Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbstachtung) zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Mit dem Begriff der Anerkennung — allerdings mit zwei unterschiedlichen Verwendungen — verbinden sich also entgegengesetzte Thesen zum pädagogischen Problem der Autonomie. Vor diesem Hintergrund gehe ich zunächst auf zwei bekannte Konzeptionen von Autonomie ein, die beide keinen relationalen Charakter haben. Kants Konzeption autonomer Subjektivität ist einer der wichtigsten Bezugspunkte postmoderner Kritik (1.). Harry Frankfurts Auffassung, welche die neuere angelsächsische Autonomiedebatte wesentlich prägte, wurde dagegen bisher in der deutschsprachigen Erziehungsphilosophie kaum rezipiert (2.). Auf dieser Basis diskutiere ich Honneths Sichtweise, die er in Zusammenarbeit mit Joel Anderson präzisiert hat (3.), bevor ich meine eigene Position umreiße (4.). 1. Kant über Autonomie und Erziehung Kant verwendete den ursprünglich nur auf Staatswesen bezogenen Begriff der Autonomie (Selbstgesetzgebung) zur Charakterisierung individuellen Handelns. Autonom ist nach Kant das Handeln einer Person, die sich — in Absetzung von natürlichen Impulsen — dem in der Vernunft vorgegebenen moralischen Gesetz unterwirft. Diese Autonomievorstellung ist also nicht für beliebige Handlungsorientierungen offen, sondern erstens rationalistisch ausgerichtet und zweitens an die Befolgung moralischer Normen geknüpft. Hintergrund des hier in Anspruch genommenen Verständnisses von Vernunft ist die strikte Trennung zweier Sphären — der intelligiblen (oder noumenalen) und der empirischen (phänomenalen) Sphäre. Vernunft, Moralität und Autonomie sind außerhalb der empirischen Sphäre angesiedelt. Als vollständig autonom kann das Handeln einer Person nur dann gelten, wenn es seine Quellen nicht im empirischen Bereich hat, sondern vom noumenalen Selbst im Einklang mit dem vernünftigen Moralgesetz angestoßen wird.3 349 Es ist unmittelbar klar, dass eine solche Vorstellung von autonomem Handeln mit der Idee der relationalen Verfasstheit des menschlichen Selbst unvereinbar ist. Das noumenale Selbst besteht unabhängig von sozialen Erfahrungen. Hingegen ist das empirische Selbst durchaus in soziale Kontexte eingebettet und verändert sich durch Erziehung und Sozialisation. Autonom ist der Mensch gemäß Kant jedoch nur dann, wenn er sich nicht von dem bestimmen lässt, was er von seinem sozialen Umfeld gelernt hat, sondern sich an den unveränderlichen Gesetzen der Vernunft orientiert. Dies wirft die Frage nach der Rolle der Erziehung auf: Kann es überhaupt eine Erziehung zur Autonomie geben, wenn das autonome Selbst unabhängig von Erziehung ist? Die Erziehung zu moralischer Autonomie besteht für Kant — abgesehen von vorgängigen Prozessen der Disziplinierung — darin, die Vernunfttätigkeit des Kindes anzustoßen. Das Kind soll dazu angeregt werden, moralische Handlungsorientierungen kraft seiner eigenen Vernunft »in sich selbst« zu finden. Erziehung soll das Kind bei der Entdeckung und Entwicklung seines wahren — von relationalen Bezügen unabhängigen — Selbst unterstützen. Kant ist nicht der von Honneth vertretenen Auffassung, wonach menschliche Autonomie auf Anerkennung angewiesen ist. Selbstachtung (oder Selbstschätzung) entsteht gemäß Kant nicht aus Erfahrungen der Anerkennung oder Achtung, sondern aus dem autonomen moralischen Handeln selbst. Der Mensch verliert seine Selbstachtung oder Würde nicht dadurch, dass er von anderen gedemütigt wird, sondern durch eigene moralische Verfehlungen (vgl. dazu auch Koch 2001). Hingegen kann man mit Kant der von Reh und Ricken vertretenen These zustimmen, wonach ein intersubjektiv verfasstes Selbst nicht autonom sein kann. Wie andere erziehungsphilosophische Autoren akzeptieren diese beiden das spezifische Gepräge, das Kant dem Autonomiebegriff gegeben haben, bestreiten aber, dass Menschen autonom sein können. Diese Grundhaltung spricht auch aus Käte Meyer-Drawes einflussreichem, allerdings nicht pädagogisch ausgerichteten Buch Illusionen von Autonomie: »Die Illusion von Autonomie kann als Illusion begriffen werden und gerade deshalb maßgebliche Kraft entfalten, weil sie sich kritisch gegen reale Verstrickungen wendet« (Meyer-Drawe 1990, S. 12). Einerseits wird Autonomie hier als Illusion bezeichnet. Damit ist gemeint, dass die von Descartes oder Kant formulierten Theorien des Selbst der Verfasstheit des Menschen nicht entsprechen. Andererseits wird aber von realen Verstrickungen gesprochen, zu deren Kritik der illusionäre Begriff der Autonomie herangezogen werden soll. Wenn aber diese Verstrickungen — in welchem Sinne auch immer — real sind, so kann man sich fragen, ob kein Zustand denkbar ist, in dem diese Verstrickungen nicht vorhanden oder abgemildert sind. Wenn es reale Formen von Nicht-Autonomie gibt, warum sollte es dann nicht auch reale Formen von Autonomie geben? Die Frage ist deshalb, ob sich die Idee der Autonomie in einer Weise fassen lässt, die a) mit den empirischen Gegebenheiten des menschlichen Lebens vereinbar ist und b) die Identifikation und Kritik autonomiefeindlicher Erziehungsformen möglich macht.4 Eine Autonomie-Konzeption, welche zumindest dem ersten dieser Kriterien 350 zu genügen scheint, hat sich im Anschluss an Frankfurts Überlegungen zur Freiheit des Willens entwickelt.5 2. Frankfurt und die Idee der Autonomie Mit Frankfurt kann man Autonomie als Fähigkeit sehen, nach denjenigen Wünschen zu handeln, mit denen man sich vollumfänglich identifiziert.6 In der neueren philosophischen Debatte werden auf dieser Basis zwei Aspekte von Autonomie unterschieden — Kompetenz und Authentizität (vgl. Christman 2011). Kompetenz umfasst unter anderem gewisse rationale Fähigkeiten, Selbstkontrolle, sowie die Freiheit von psychischen Störungen oder systematischer Selbsttäuschung. Authentizität bezeichnet das Verfügen über eigene — oder eben authentische — Einstellungen. Sie wird in Frankfurts Modell durch Akte der Identifikation hergestellt: Indem ich mich mit bestimmten Wünschen oder Wertvorstellungen identifiziere, mache ich sie mir zueigen. Kompetenz ermöglicht mir, gemäß diesen Einstellungen zu handeln. Wie Kant geht Frankfurt von der reflexiven Struktur des menschlichen Selbst aus. Im Gegensatz zum Tier ist der Mensch nicht von Impulsen getrieben, sondern kann sich fragen, wie er handeln soll. In Frankfurts Begrifflichkeit ausgedrückt bedeutet dies, dass er Wünsche (bzw. Volitionen) zweiter Stufe ausbilden kann, die sich auf Wünsche erster Stufe beziehen — erstere drücken aus, dass die Person nach einem bestimmten Wunsch erster Stufe handeln oder nicht handeln will. Autonom ist eine Person nach diesem Modell, wenn es ihr gelingt, nach dem Wunsch (erster Stufe) zu handeln, nach dem sie — auf Grund eines Wunsches zweiter Stufe — handeln will. Typische Fälle mangelnder Autonomie ergeben sich aus Süchten oder inneren Zwängen, die dazu führen, dass Personen nicht im Einklang mit denjenigen Wünschen handeln, mit denen sie sich identifizieren. Diese relativ anspruchslose Autonomiekonzeption lässt manche der klassischen Kritikpunkte, die gegen die Idee der Autonomie vorgebracht werden, hinfällig erscheinen. Sie beruht nicht auf der Annahme eines nicht-empirischen Selbst, das Handlungen auslöst, und auch nicht auf einer anspruchsvollen Vorstellung von Rationalität. Zudem ist das Modell nicht intellektualistisch ausgerichtet — es setzt zwar eine basale Form von Reflexivität voraus, geht aber nicht mit der Idee einher, dass nur diejenigen Handlungen autonom sein können, die auf kritischer Selbstreflexion gründen.7 Schließlich ist die Konzeption auch nicht an bestimmte Wert- und Moralvorstellungen gebunden, sondern inhaltlich neutral. Hingegen setzt sie ein gewisses Maß an Selbsttransparenz voraus: Personen können nur frei sein, wenn sie sich der für sie wichtigen Wünsche bewusst sind. Das Handeln nach unbewussten Motiven gilt gemäß diesem Modell als unfrei. Wäre das menschliche Tun mehrheitlich oder ausschließlich von unbewussten Impulsen bestimmt, so könnte von Autonomie keine Rede mehr sein. Auch setzt Frankfurt voraus, dass Menschen oftmals in der Lage sind, ambivalente Einstellungen in einen Akt der Identifikation zu überführen. Sein Modell eignet sich hervorragend zur Beschreibung von Ambivalenzen, betrachtet diese aber als freiheitsgefährdend. Die 351 Annahme ist, dass Personen sich zumindest zu bestimmten Zeitpunkten klar festzulegen vermögen. Aus Sicht einer relationalen Konzeption von Identität oder Autonomie wird man bemängeln, dass dieses Modell der relationalen Einbettung des Selbst — und auch seiner relationalen Geschichte — keinerlei Beachtung schenkt: Wie individuelle Akte der Identifikation in erzieherischen und sozialisatorischen Prozessen zustande kommen, wird offengelassen. Um zu beurteilen, ob eine Person und ihr Handeln autonom sind, muss man ausschließlich die interne Struktur ihrer Wünsche beachten, nicht aber das soziale und kulturelle Umfeld, das diese Wünsche beeinflusst. Gerade diese Gleichgültigkeit gegenüber relationalen Faktoren hat zur Konsequenz, dass der Konflikt zwischen a) der These von der relationalen Verfasstheit des Menschen und b) der Idee menschlicher Autonomie sich auflöst. Die Annahme, wonach das menschliche Selbst sich durch intersubjektive Adressierung konstituiert, schließt nämlich keineswegs aus, dass Personen bestimmte Einstellungen als ihre eigenen akzeptieren und auf dieser Grundlage autonom werden können. Daraus kann man weiter schließen, dass jegliche Art der pädagogischen Adressierung, welche die Fähigkeit zur reflexiven Identifikation nicht beeinträchtigt, ein authentisches Selbst hervorbringt. Dies bedeutet unter anderem, dass die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Authentizität nicht auf moralisch relevante Formen der Anerkennung — Respekt, Wertschätzung oder Liebe — angewiesen ist. Die Frage nach der richtigen Erziehung kann sich im Rahmen des Frankfurt-Modells allenfalls auf die Kompetenzbedingungen von Autonomie richten: So ist beispielsweise anzunehmen, dass die Entwicklung von Selbstkontrolle pädagogisch gefördert werden kann. Verwendet man das Frankfurt-Modell im pädagogischen Kontext in normativer Absicht, so lassen sich zwar gewisse pädagogische Praktiken als unangemessen zurückweisen, aber viele Formen von Erziehung, die man intuitiv als manipulativ oder repressiv einstufen würde, entgehen dieser Kritik. Aus Sicht von Reh und Ricken ist dies nicht beunruhigend. Diese Autoren wollen weder einen normativ gehaltvollen Begriff von Anerkennung, noch ein pädagogisches Ideal von Autonomie oder Authentizität verteidigen, sondern lediglich erläutern, wie sich das menschliche Selbst in Praktiken intersubjektiver Adressierung bildet.8 Entsprechend stellen sie keine theoretischen Mittel zur normativen Beurteilung unterschiedlicher Formen pädagogischer Adressierung bereit. Eine moralische Kritik verfehlter Erziehungsprozesse ist hingegen auf der Basis von Honneths Anerkennungs- und Autonomietheorie möglich. 3. Anerkennung als Bedingung von Autonomie Anderson und Honneth schreiben: »The key initial insight of social or relational accounts of autonomy is that full autonomy — the real and effective capacity to develop and pursue one’s own conception of a worthwhile life — is achievable only under socially supportive conditions« (Anderson/Honneth 2005, S. 130). Die Autoren gehen von einer Kernvorstellung von Autonomie aus, welche die Fähigkeit zur 352