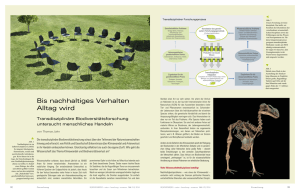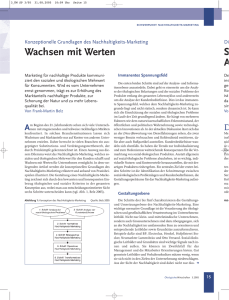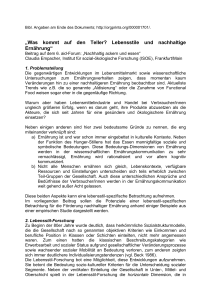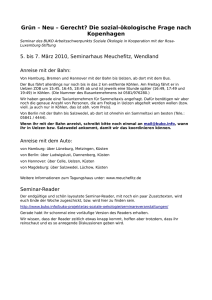Konzept und Genese des Förderschwerpunktes „Sozial
Werbung

Beitrag Berliner Tagung Konzept und Genese des Förderschwerpunktes „Sozial-ökologische Forschung“ Beitrag zur BMBF-Konferenz „Zukunft gewinnen – der Beitrag der sozialökologischen Forschung“, Berlin 6./ 7. Mai 2002, Harnack-Haus Dr. Thomas Jahn, Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE), Frankfurt am Main I. Ziemlich genau vor drei Jahren, Ende April 1999, erhielt das Institut für sozial-ökologische Forschung den Auftrag des BMBF, ein Konzept für den geplanten, neuen Förderschwerpunkt „Sozial-ökologische Forschung“ auszuarbeiten, und zwar möglichst schnell. Bis Ende des Jahres 1999 war diese Entwicklungsphase mit der BMBFVeröffentlichung des Rahmenkonzept für den neuen Förderschwerpunkt „Sozial-ökologische Forschung“ abgeschlossen, das sich im Wesentlichen auf ein Konzept bezog, welches vom ISOE gemeinsam mit Vertretern und Vertreterinnen der sozial-ökologischen Community erarbeitet worden war. Insgesamt waren an der Konzeptentwicklung ca. 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt. Sie kamen aus unterschiedlichen Disziplinen und Institutionen, beteiligten sich auf verschiedene Weise – von Befragungen über die Teilnahme an Workshops bis zum Verfassen von Einzelausarbeitungen zu ausgewählten Schwerpunkten. Die Aufgabe des ISOE war es, diesen partizipativen Prozess zu initiieren und zu koordinieren, d.h. die Konzeptentwicklung für möglichst viele, durchaus unterschiedliche Sichtweisen, Interessen, Erwartungen, Ansprüche und Erfahrungen offen zu halten. Das diskursiv und auch kontrovers erarbeitete Material deckte ein breites und heterogenes Spektrum an Themen, Problemen und konzeptionellen Vorstellungen ab. Es musste einerseits inhaltlich konsistent gemacht und methodisch gesichert werden; andererseits war es in die Form eines staatlichen Förderkonzeptes einzupassen, mit dem auch praktisch gearbeitet werden kann und das sich von anderen Förderkonzepten ausreichend unterscheidet. Die Phasen des partizipativen Öffnens mussten daher immer wieder durch inhaltliche Arbeitsphasen im Institut unterbrochen werden, die man auch als ein konzeptionelles Schließen ansehen kann. In dieser auf Partizipation und Transparenz angelegten Entstehungsphase hat sich ein aktives Wissensnetzwerk aus ExpertInnen, VertreterInnen des BMBF sowie potentiellen Antragstellern gebildet. Obwohl sich inzwischen seine jeweilige konkrete Zusammensetzung und auch die Arbeitsformen stark verändert haben, besteht es bis heute fort. 1 2 Seit Anfang 2000 wurden dann in vergleichsweise rascher Abfolge mehrere Förderaktivitäten ausgeschrieben, zahlreiche Projekte begutachtet und bewilligt. Zugleich wurden erste feed-back-Schleifen etabliert: beispielsweise wurden die eingegangen Anträge auf Sondierungsprojekte noch vor Projektbeginn inhaltlich ausgewertet. Damit sollten möglichst frühzeitig Lücken identifiziert werden, wie sie z.B. durch das Ergebnis des Begutachtungsverfahrens oder durch einen zu geringen Bekanntheitsgrad des neuen Förderschwerpunktes entstanden sind. Unser Institut hat nach Abschluss der eigentlichen Konzeptphase noch die wissenschaftliche Begleitung der ersten Umsetzungsschritte übernommen. Anfang 2001 war unser Auftrag an der Einrichtung des Förderschwerpunktes mitzuarbeiten, beendet. Mit der Präsentation der Ergebnisse der Sondierungsprojekte ist die Pilotphase abgeschlossen; was von den bewilligten Projekten etwa der Nachwuchsförderung oder der Verbundprojekte aus der ersten Ausschreibungsphase zu erwarten ist, darüber können Sie sich mit dieser Konferenz selbst ein Bild machen. II. Soweit die Entstehungsgeschichte des neuen Förderschwerpunktes in Kurzform. Es ist ein erstaunlicher Vorgang, der nur zu verstehen ist, wenn der Kontext dieser Geschichte noch etwas genauer betrachtet wird. Denn bis dahin war in die offiziellen Karten der deutschen Forschungslandschaft kein nennenswertes, größeres, zusammenhängendes Gebiet mit dem Namen „sozial-ökologische Forschung“ eingetragen. Weder forderte die Heilige Dreifaltigkeit der deutschen Wissenschaft – also Hochschulrektorenkonferenz, Max-Planck-Gesellschaft, DFG – die Förderung eines solchen Gebietes; noch standen entsprechende Forderungen aus der allgemeinen Öffentlichkeit auf einem der vorderen Plätze der politischen Agenda. Was also war geschehen? Welche Konstellation von Problemen, Diskursen und Akteuren machte sich mit dieser politischen Entscheidung und dem damit eingeleiteten Entwicklungsprozess plötzlich sichtbar? Wie ist sie in die Konzeption des neuen Schwerpunktes eingegangen? Vier Punkte möchte ich besonders herausstellen: 1. Die Grenzen der traditionellen Umweltforschung, 2. das Entstehen eines neuen Forschungssektors und eines neuen Forschungstyps, 3. das Aufkommen neuer Problemlagen 4. eine forschungspolitische Entscheidungssituation. 1. Die Umweltforschung war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in eine Sackgasse geraten. Zum einen war die Diskrepanz zwischen den investier- Beitrag Berliner Tagung ten Mitteln und den damit erzielten Erkenntnisgewinnen für gesellschaftliches Handeln unübersehbar geworden. Ein Beispiel dafür ist die Waldschadensforschung, die ständig neue Forschungsprobleme erzeugte und dafür immer mehr Mittel einforderte. Zum anderen war die Umweltforschung an ihre disziplinären und ressortspezifischen Grenzen geraten. Die Gebrauchsfähigkeit und Gebrauchswürdigkeit der Forschungsergebnisse für gesellschaftliche Akteure wurden dadurch immer stärker angezweifelt. Und schließlich zeigte sich die traditionelle Umweltforschung unfähig – gerade aufgrund ihrer disziplinären Abschottung und akademischen Selbstbezüglichkeit – sich wissenschaftlich den Herausforderungen des politischen Leitbildes einer „nachhaltigen Entwicklung“ zu stellen. Im Nachhaltigkeitsdiskurs entstanden durch die Vermischung und Wechselwirkungen von bisher in der Regel getrennten Bereichen (Ökologie, Ökonomie und Soziales) neuartige, hybride und komplexe Forschungsprobleme. Demgegenüber waren die Immobilität und die Erkenntnisgrenzen der traditionellen Umweltforschung eklatant. Dieses Defizit, das ich hier nur grob umreißen kann, wird inzwischen weitgehend anerkannt. Die sozial-ökologische Forschung setzt hier sowohl inhaltlich als auch forschungspraktisch an, formuliert neue Forschungsansätze, neue Themen und macht neue Angebote an die Gesellschaft: • beispielsweise dadurch, dass in der Forschungspraxis versucht wird, von Anfang an sozial-, natur-, kultur- und ingenieurswissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden miteinander zu verknüpfen; • oder dadurch, dass die gesellschaftliche Verursachung aber auch Gestaltbarkeit von Umweltproblemen besonders betont wird; • Und nicht zuletzt dadurch, dass sich die WissenschaftlerInnen nicht als Besserwissende sondern eher als „AndersWissende“ verstehen. Dadurch wird es ihnen möglich, die gegenwärtigen dramatischen Umwälzungen elementarer Lebensbereiche und Weltvorstellungen nicht nur zu beschreiben und zu kritisieren, sondern sie zusammen mit den davon Betroffenen auch aktiv zu gestalten. 2. In der offiziellen Karte der deutschen Forschungslandschaft finden sich bis Mitte der siebziger Jahre nur zwei große Sektoren: die klassische Hochschulforschung und die staatlich finanzierte außeruniversitäre Forschung. Doch die Karte ist nicht das Territorium. Populärliterarisch paraphrasierend kann man sagen: Ausgehend von einem kleinen badischen Dorf namens Whyl und unterhalb des Radars der öffentlichen Wahrnehmungssensoren entstand nach und nach eine neue Region in der Forschungslandschaft, gewissermaßen ein „Dritter Sektor“ kleiner, gemeinnütziger ökologischer Forschungsinstitute. Begonnen haben diese Institute, allen voran das Öko-Institut in Freiburg, als „Advocacy“Wissenschaft – als eine Wissenschaft, die eng mit Bürgerinitiativen, den 3 4 damals noch neuen sozialen Bewegungen und mit einzelnen Protestgruppen kooperierte. Inzwischen haben sich diese Institute stark verändert – das Spektrum der Kooperationspartner ist breiter geworden und reicht bei einigen Instituten inzwischen bis zur Großindustrie; teilweise sind die Institute näher an traditionelle Wissenschaftseinrichtungen und an einzelne akademische Disziplinen herangerückt, teilweise haben sie sich in Beratungseinrichtungen verwandelt. In diesen Instituten hat sich eine neue Umweltforschung herausgebildet: Sie öffnete sich einerseits zu Wirtschaft und Gesellschaft, untersuchte Energieversorgung, Stoffströme und Verkehrssysteme. Andererseits richtete sie frühzeitig den analytischen Blick auf spezifische Problemausschnitte einer nachhaltigen Entwicklung – sei es als nachhaltiges Wirtschaften, als nachhaltiger Konsum oder nachhaltige Mobilität. In diesen Instituten hat sich ein neuer Forschungstyp und mit ihm ein neuer Modus der Wissensproduktion herausgebildet, der sich mit den Begriffen Problemorientierung, Akteursorientierung und Transdisziplinarität charakterisieren lässt Was ist damit gemeint: Problemorientierung: Untersucht wird eine spezifische Problemdynamik, wie sie durch das Zusammenwirken gesellschaftlicher und natürlicher Prozesse entsteht. Forschungspraktisch bedeutet dies, dass bereits zu Beginn in einer ersten integrativen Arbeitsphase ein gemeinsamer Forschungsgegenstand definiert wird, indem eine existierende gesellschaftliche Problemlage – etwa die Wasserver- und entsorgung – in ein Ensemble wissenschaftlicher Probleme übersetzt wird. So entsteht eine komplexe Fragestellung, zum Beispiel die Frage nach dem gegenwärtigen und zukünftigen (funktional und sozial ausdifferenzierten) Umgang der Gesellschaft mit “ihren” Wässern. Diese übergreifende Fragestellung lässt sich nun in eine Vielzahl von – eher disziplinär zu bearbeitenden – Einzelproblemen aufspalten: • Läßt sich der Artenschwund grundwassergeprägter Biotope aufhalten? Welche sozio-kulturelle Bedeutung hat das Wasser? • Wie organisiert sich die Wasserwirtschaft gegenwärtig neu? • Wie lassen sich die Kosten langfristig senken? • Wie schränken aktuelle Problemlösungsstrategien die Handlungsspielräume zukünftiger Generationen ein? • Welche technischen Innovationen sind möglich? • Läßt sich das Abwasser als Ressource bewirtschaften und vom Frischwasser als Transportmedium entkoppeln? • Lassen sich sozial- und ökologisch adaptionsfähige Systeme entwickeln, die exportfähig – im Sinne der Nord/Süd-Problematik – sind? Daraus ergeben sich wiederum eine Fülle von (interdisziplinären) Querschnittsfragen. Im Kern geht es hier um die technischen, ökonomischen, wissenschaftlichen und administrativen Regulationen der damit verknüpften komplexen Probleme, um deren Form, Qualität und Veränderbarkeit. Beitrag Berliner Tagung Akteursorientierung: Hier geht es um eine pro-aktive Gestaltung, einschließlich der Frage, wem gesellschaftlich überhaupt ein Potential an Gestaltungsmacht zuerkannt wird – und vor allem wem nicht und aus welchen Gründen. Ohne viele unterschiedliche gesellschaftliche Akteure und Bevölkerungsgruppen aktiv einzubeziehen – gerade auch bisher randständige oder von Entscheidungsprozessen ausgeschlossenen Akteuren – können viele gesellschaftliche Entwicklungsprobleme überhaupt nicht mehr gelöst werden. Das heißt aber, dass Fragen der Sozialstruktur, der sozialen, ethnischen und Geschlechterdifferenzen nun systematisch in die Analysen natürlich-technischer Wirkungszusammenhänge mit aufgenommen werden. Und forschungspraktisch bedeutet dies, dass bei der Problemlösung die spezifischen Akteurskonstellationen, ihre divergierenden Interessen und Handlungsspielräume ebenso berücksichtigt werden müssen, wie zum Beispiel die Frage nach den Grenzen der gesellschaftlichen Steuerbarkeit und nach dem Enstehen von (zivilen) Selbstorganisationsstrukturen. Darüber hinaus muss an einer zielgruppenspezifischen Differenzierung von Lösungsalternativen gearbeitet werden. Und auch darum geht es: empirisch die Entstehung und Geltung von normativen Ansprüchen und Anforderungen von bzw. an Nachhaltigkeit in konkreten Handlungszusammenhängen zu analysieren. Transdisziplinarität: Darunter wird zunächst verstanden, dass die Forschung sich aus ihren fachlichen disziplinären Grenzen löst und ihre Probleme mit Blick auf außerwissenschaftliche, gesellschaftliche Entwicklungen definiert, um diese Probleme dann disziplin- und fachunabhängig zu bearbeiten und die Ergebnisse sowohl praktisch wie theoretisch zusammenzuführen. Im Mittelpunkt einer solchen transdisziplinären Forschung steht also eine komplexe gesellschaftliche Problemdynamik, für die beides erarbeitet werden soll: praktische gesellschaftliche Lösungen und wissenschaftsinterne Lösungen, was in der Regel zur Formulierung neuer Probleme führt und dadurch den wissenschaftlichen Fortschritt antreibt. Disziplinübergreifendes Arbeiten heißt hier, über den gesamten Forschungsprozeß hinweg bisher in der disziplinären bzw. gesellschaftlichen Wahrnehmung Getrenntes in Beziehung zueinander zu setzen, und es als Unterschiedenes, aber voneinander Abhängiges zu untersuchen. Dies bedeutet, ökonomische, ökologische, sozialwissenschaftliche und technische Wissensbestände und Methoden zusammenzubringen. Eine solche “transdisziplinäre Integration” muss durch eine entsprechende Organisationsform der Forschung unterstützt werden, z.B. durch regelmäßige Treffen mit einer strukturierten Arbeitsplanung und einem moderierten Ablauf, durch gegenseitiges “quer-disziplinäres” Kommentieren und Begutachten von Teilergebnissen, durch Patenschaftsverfahren. 5 6 3. Neue Problemlagen geraten in den Vordergrund Die Thematisierung von Umweltproblemen und die mit ihnen verknüpften sozialen Auseinandersetzungen Ende des letzten Jahrhunderts waren noch dominiert von einzelnen Konflikten um technologische Großprojekte, um die Akzeptanz und Einführung neuer Technologien oder aber um die lokale und regionale Gefährung einzelner Naturstücke – der Verunreinigung von Böden, der Schadstoffbelastungen von Wasser und Luft. Bald rückten komplexere Schadensmuster und globale ökologische Gefährdungen (anthropogener Treibhauseffekt, Artenschwund) ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Zugleich entwickelten sich mehr und mehr politische Zielkonflikte; Arbeitsplatzsicherheit gegen Umweltschutz, Konsumwünsche gegen Abfallvermeidung, nationale Standortvorteile gegen globale Verantwortung etc. Lokale oder globale Umweltveränderungen wurden in ihrem Zusammenhang mit einschneidenden innergesellschaftlichen Veränderungen gesehen, die die physischen, sozialen und kulturellen Lebensgrundlagen der Menschen tiefgreifend zu verändern begannen: Digitalisierung, Globalisierung, neue Formen der Arbeitslosigkeit und Staatsverschulden sind Stichworte dafür. Langsam wurde deutlich, dass isolierte wissenschaftliche, technische oder ökonomische Lösungsversuche einzelner ökologischer oder sozialer Probleme „erster Ordnung“ nicht nur ihren guten Zweck erfüllen, sondern auch unerwünschte Folgen und Nebenfolgen in anderen gesellschaftlichen oder natürlichen Bereichen haben können, (denken Sie etwa an die hohen Schornsteine an der Ruhr, den Katalysator, die sog. BSE-„Krise“ oder die Ökosteuer). Durch derartige Probleme „zweiter Ordnung“ ist eine neue Problemdynamik entstanden. Durch die Orientierung vieler Politikbereiche am Leitbild einer Nachhaltigen Entwicklung rücken gerade diese Probleme immer stärker ins öffentliche Bewußtsein und bestimmen heute wichtige Teile der politischen Auseinandersetzung. Die Forschung war allerdings auf diese gesellschaftliche Problemverschiebung kaum vorbereitet. Inzwischen beginnt sich international ein neues Forschungsfeld Sustainability Science zu konsolidieren. In den USA wird sie definiert als „science in support of a sustainable transition“. Beim Jahrestreffen der renommierten „American Association for the Advancement of Science“ (AAAS) im Februar diesen Jahres in Boston beschäftigten sich die Vorträge und Diskussionen hauptsächlich mit methodologischen und epistemologischen Fragen der neuen Sustainability Science. Deren zentrales wissenschaftliches Problem wird in einem vertieften Verständnis der „interactions between society and nature“ gesehen. Genau hier setzt der neue Förderschwerpunkt an, indem er zwei wissenschaftliche Herausforderungen in den Mittelpunkt stellt: Beitrag Berliner Tagung Einmal die übergreifende Frage, wie die dynamischen Beziehungen zwischen Natur und Gesellschaft so erkannt und beschrieben werden können, dass sich nachhaltige Entwicklungspfade bahnen lassen. Das bedeutet in den einzelnen Forschungsvorhaben für zentrale gesellschaftliche Bereiche die tiefgreifend gestörten oder zum Teil noch nicht entwickelten Gesellschaft-Natur-Beziehungen konkret zu beschreiben und sowohl zeitlich wie räumlich zu spezifizieren. Wir sprechen hier von der krisenhaften Transformation basaler gesellschaftlicher Naturverhältnisse. Die Ergebnisse dieser Forschungen – und der Weg auf dem sie gewonnen wurden – müssen sich wiederum an den normativen Grundprämissen der Nachhaltigkeit messen lassen und tragfähige, analytisch gewonnene Ansätze enthalten, wie sie praktisch auch umgesetzt werden können. Zum anderen werden Integrationsprobleme in den Mittelpunkt gerückt. Da es um die Gestaltung praktischer Handlungszusammenhänge geht, handelt es sich zum einen um soziale Integrationsprozesse: divergierende Interessen sind miteinander abzustimmen und wissenschaftliches Wissen ist mit den alltagspaktischen Erfahrungen unterschiedlicher Akteure in deren jeweiligen soziokulturellen Kontexten zu verknüpfen. Zugleich geht es um die Entwicklung neuer technischer Lösungen. Diese müssen in soziale Zusammenhänge eingebettet und die verschiedenen Lösungskomponenten so gestaltet werden, daß sie in einem nachhaltig funktionsfähigen System zusammenwirken können. Und es geht um kognitive Integrationsprozesse. Dafür müssen naturwissenschaftliche, technische und sozialwissenschaftliche Daten, Methoden und Theorien systematisch zusammengebracht und wissenschaftliche und alltagspraktische Wissenselemente so transformiert und miteinander verknüpft werden, dass neue, übergreifende, kognitive Strukturen entstehen können. Zwischenfazit: Aus dieser hier nur kurz skizzierten Konstellation von gesellschaftlichem Problemdruck, Kritik an der etablierten Forschungslandschaft und Alternativen zur herrschenden Forschungspolitik ist so etwas wie ein Entwicklungsschub entstanden: In technik- und risikosoziologischen Diskursen, in der Umweltforschung selbst sowie in den gesellschaftlichen Debatten über Nachhaltige Entwicklung wurde ein forschungspolitisches Defizit sichtbar. Gleichzeitig wurde im Rahmen von Monitoring-Prozessen (TAB) und durch die Evaluierung der Umweltforschung durch den Wissenschaftsrat aus dem etablierten Wissenschaftsbereich selbst die Kritik am Status Quo und die Forderung nach neuen Konzepten laut. Besonders deutlich artikulierte das Ökoforum (ein Zusammenschluss von sieben deutschsprachigen Instituten aus dem dritten Forschungssektor) forschungspolitische Defizite und machte konkrete Veränderungsvorschläge. Es kam hier also gewissermaßen zu nicht-beabsichtigten Resonanzen zwi- 7 8 schen sehr unterschiedlichen Akteuren und Bereichen. In diesem Diskurs haben sich bereits wesentliche Elemente der späteren Förderziele des Förderschwerpunktes herausgeschält: – die Förderung kleiner, flexibler Forschungsstrukturen; – die Förderung von inter-institutionellen und interdisziplinären Forschungskooperationen; – diegrundsätzliche Umorientierung in der Forschungsförderung hin zur Programmförderung, darin besonders die Unterstützung und der Ausbau von transdisziplinären Ansätzen in der Nachhaltigkeitsforschung, wozu die sozial-ökologische Forschung wesentlich zu zählen ist. 4. Eine neue Konstellation hatte sich herausgebildet, bisher getrennte Gruppen und Institute bewegten sich in die gleiche Richtung, die offizielle Karte der Forschungslandschaft und deren reales Territorium stimmten nicht mehr überein. Die Zeit war reif für politische Entscheidungen. Noch unter der Vorgänger-Regierung wurden innerhalb des BMBF mit bescheidenen Mitteln „sozial-ökologische“ Modellprojekte (die damals noch nicht so benannt waren) gefördert: Die erfolgreichen Projekte im Förderschwerpunkt „Stadtökologie“ oder die Modellprojekte für „nachhaltiges Wirtschaften“ , unterstützen die damaligen Oppositionsparteien SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN unter der Federführung von Edelgard Bulmahn an, eine grundlegende Alternative gegenüber der herrschenden Regierungspolitik zu formulieren und in die parlamentarische Auseinandersetzung einzubringen. Sie konnten dabei auf Konzepte, Instrumente und Begründungen zurückgreifen, wie sie besonders von Ökoforum formuliert worden waren. Nach dem Regierungswechsel wurde daraus die politische Entscheidung, einen neuen Förderschwerpunkt für „Sozial-ökologische Forschung“ im BMBF einzurichten. Seine Ziele wurden zusammengefasst und konkretisiert als • die gezielte Förderung sozial-ökologischer Forschungsprojekte einschließlich einer kooperativen und kontrollierten Identifizierung des zukünftigem Forschungsbedarfs („Projektförderung“); • die gezielte Förderung von kleinen, nicht-staatlichen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen und die stärkere Vernetzung dieses Sektors des Wissenschaftssystems mit den Hochschulen und den staatlich finanzierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen („Strukturförderung“); • die Initiierung und dauerhafte Etablierung eines für transdisziplinäre Forschung qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses („Nachwuchsförderung“). Beitrag Berliner Tagung III. Als vorläufiges Ergebnis und Ausblick möchte ich abschließend folgendes festhalten: Natürlich hat auch der neue Förderschwerpunkt „sozialökologische Forschung“ keinen Heiligenschein, d.h. er ist – vermutlich wie immer teils berechtigt, teils unberechtigt – von Gefühlen ungerechter Begutachtungen, bürokratischer Hürden und zeitlicher Verzögerungen, aber auch mangelnder öffentlicher Aufmerksamkeit und Anschaulichkeit der bisherigen Ergebnisse etc. begleitet. Aber es ist in relativ kurzer Zeit mit relativ geringem materiellen und personellen Aufwand und in einem – soweit ich weiß – bis dahin einzigartigen Entwicklungsprozess , (und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich meine Anerkennung an Frau Dr. Willms-Herget aussprechen) gelungen, • erstmals im Rahmen der existierenden BMBF-Förderstruktur systematisch transdisziplinäre Forschung zu fördern, • die erkennbare Benachteiligung einer bestimmten Gruppe von Forschungseinrichtungen offiziell anzuerkennen und deren Situation in einer mehr und mehr wettbewerblich verfassten Förder- und Auftragslandschaft in spürbarer Weise zu verbessern – wenngleich „in the long run“ so vermutlich noch nicht ausreichend um die mit der Förderung verknüpften Erwartungen an sozial-ökologische Kompetenzzentren auch tatsächlich erreichen zu können, • ein neues Verfahren der Entwicklung eines förderpolitischen Instruments und Maßnahme erfolgreich einzusetzen, wobei ‚erfolgreich’ im Falle von Forschungspolitik zunächst bedeutet: erfolgreich für die Wissenschaft und – leider – noch weniger für die öffentliche Wahrnehmbarkeit und Präsenz der Arbeit eines Ministeriums, • die öffentlich geförderte Forschung – über sozial-ökologisch Forschung hinaus – mit neuen inhaltlichen Herausforderung zu konfrontieren, nämlich sich stärker der Erforschung komplexer, selbst organisierter, stark vernetzter und gekoppelter Systeme und Handlungszusammenhänge zuzuwenden, und systematisch Werkzeuge der Integration zwischen den Disziplinen, zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, aber auch zwischen verschiedenen Kulturen für den Gebrauch in Wissenschaft und Gesellschaft zu entwickeln. Sie sehen, ein guter Anfang für eine interessante Zukunft ist gemacht. 9