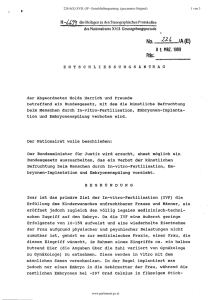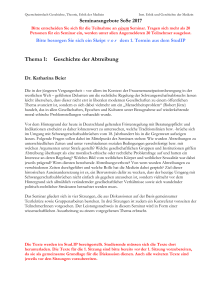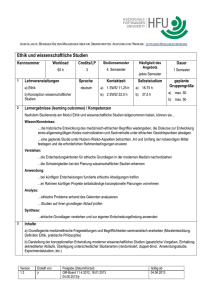Rezensionen - Fachzeitschriften Religion und Theologie
Werbung

Rezensionen Jörg Hübner: »Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon!« Grundsatzüberlegungen zu einer Ethik der Finanzmärkte, Stuttgart: Kohlhammer 2009, ISBN: 978-3-89670-377-4, 200 S., e 24,80. Für den Autor wie für die Öffentlichkeit ist es ein Glücksfall, wenn eine wissenschaftliche Arbeit punktgenau in eine aktuelle Diskussion trifft. In der Ethik ist ein solches Zusammentreffen besonders erfreulich. Schon deshalb ist Jörg Hübners Arbeit zur Ethik der Finanzmärkte zu begrüßen; sie nimmt die Fragestellungen, die sich mit der Finanzmarktkrise seit 2007 verbinden, in bemerkenswert weitem Umfang auf. Das Buch beginnt mit einer beispielhaften Skizze der aktuellen wirtschaftsethischen Diskussion an Hand der Positionen von Karl Homann und Eilert Herms. An Homann kritisiert der Vf. die Engführung, nach welcher die Wirtschaftsethik ganz im Bereich der Rahmenordnung wirtschaftlichen Handelns verankert wird, statt auf den wirtschaftlichen Gesamtprozess bezogen und als Mehrebenenproblem betrachtet zu werden; die Kritik gipfelt in der These, dass die Ethik damit letztlich doch der Ökonomik geopfert werde. An Herms kritisiert der Vf., dass die begrüßenswerte Betonung von Tugenden im Wirtschaftsleben und Bildung als dem Weg, solche Tugenden auszubilden, andere Steuerungsinstrumente – insbesondere Geld – unberücksichtigt lässt und damit auf eine Auskunft über die Chancen, ethische Maßstäbe im wirtschaftlichen Handeln zu berücksichtigen, weitgehend verzichtet. Von diesen beiden Positionen unterscheidet Hübner seinen Ansatz dadurch, dass er Wirtschaftsethik als »gemeinsame Suche von Ökonomie und Ethik nach einem verbindenden Humanum« versteht (30). Statt diesen Ansatz systematisch auszuführen und methodisch zu erläutern, knüpft der Autor indessen an das Gefangenendilemma an und interpretiert Wirtschaftsethik als eine »Ethik der Anreizsysteme« – eine Konzeption, die in der anschließenden Darstellung freilich nicht weitergeführt wird. Sie steht insofern ähnlich isoliert wie die Anknüpfung an die Geldtheorie des scholastischen Theologen und Universalgelehrten Nikolaus von Oresme, die den Gegenstand des zweiten Kapitels 62 bildet. So bahnbrechend diese Geldtheorie zu ihrer Zeit gewesen sein mag, so wenig kann sie eine heutige Ethik des Geldes und der Finanzmärkte begründen, zu der sich einige Überlegungen verblüffender Weise erst an einer viel späteren Stelle des Buches finden. Die Notwendigkeit einer solchen Ethik begründet der Vf. im 3. Kapitel mit Merkmalen der aktuellen Finanzmarktentwicklung. Ihre Möglichkeit erläutert er im Anschluss an den Forschungsansatz von Behavioral Finance dahingehend, dass auch die Finanzwissenschaft Handlungsspielräume identifiziert, von denen her sich die Frage stellt, nach welchen Kriterien zwischen unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten gewählt wird. Als ethischer Maßstab wird im 4. Kapitel das »Potenzial des Menschlichen« eingeführt. Zu dessen Erläuterung orientiert Hübner sich an den Menschenrechten, die er, die historische Entwicklung pathetisch überhöhend, als »Kondensat der Menschheitsgeschichte« bezeichnet (83) und deren »Globalisierung« er fordert (85). Wirklich überzeugend ist diese Konzession an den gängigen GlobalisierungsDiskurs nicht; denn die These von der universalen Geltung der Menschenrechte scheint nach wie vor der präzisere Problemzugang zu sein. Vor allem aber bleibt auf diese Weise die Frage unterbestimmt, in welcher Weise die Menschenrechte, die die Rechtsstellung des einzelnen gegenüber der Ausübung staatlicher Macht bestimmen sollen, auf die Gestaltung wirtschaftlicher Machtverhältnisse übertragen werden können. Für Hübners Konzeption bedeutungsvoller scheint auch die Anknüpfung an das ökumenische Konzept der »verantwortlichen Gesellschaft« zu sein, das er zu einem Konzept der »verantwortlichen Weltgesellschaft« weiterentwickelt und in sieben orientierenden Maximen für die Gestaltung eines globalen Finanzmarkts konkretisiert. Der Hinweis auf die Ausbildung neuer Verantwortlichkeiten am globalen Finanzmarkt leitet zur Anwendung dieser Maximen auf verschiedene Verantwortungsebenen über. Auf jeder dieser Verantwortungsebenen folgt auf die Problembeschreibung eine ethische Beurteilung, an die sich die Skizzierung von Reformschritten anschließt. Zunächst wird die dominante Rolle Zeitschrift für Evangelische Ethik, 55. Jg., S. 62 – 70, ISSN 044-2674 © Gütersloher Verlagshaus 2011 institutioneller Investoren auf den Finanzmärkten beschrieben und ethisch beurteilt. Sodann wird erörtert, in welcher Weise eine Regulierung der Hedge-Fonds, eine Reform der Rating-Agenturen und eine Gegenentwicklung gegen die Erosion bankenspezifischer Dienstleistungen möglich sind. In all diesen Fällen plädiert Hübner für eine Kombination zwischen der Selbstregulierung dieser Bereiche durch vereinbarte Codes of Conduct und einer wirksameren staatlichen Regulierung und Aufsicht. Das führt mit innerer Folgerichtigkeit im nächsten Schritt zur Frage nach dem Funktionieren der Bankenaufsicht und notwendigen Schritten zu einem besseren Sicherungssystem; erstaunlicherweise wird in diesem Zusammenhang das Wechselverhältnis zwischen Bankenaufsicht und staatlicher Intervention zur Rettung systemrelevanter Banken nicht behandelt. Schließlich wird unter der Überschrift »Global Finance« die Frage untersucht, wo eine internationale Finanzaufsicht angesiedelt werden kann – der Internationale Währungsfonds, das Forum für Finanzmarktstabilität und der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (vom Vf. nur Wirtschaftsrat genannt) werden als Kandidaten erörtert – und wie sie auszugestalten ist. Das sind materialreiche und übersichtlich gestaltete Kapitel, deren informierender und argumentativer Gehalt beträchtlich ist; die Reformschritte, die der Vf. vorschlägt, sind dabei plausibel aus der jeweiligen ethischen Beurteilung abgeleitet. Abschließend wendet sich der Vf. der Ethik des Geldes und der Finanzmärkte als einem, wie er sagt, »zentralen Thema einer Wirtschaftsethik in christlicher Perspektive« zu. Gegenüber einer Tendenz christlicher Ethik, den Geldumgang des Menschen zu dämonisieren, möchte er den Umgang mit Geld unter der Perspektive der Freiheit betrachten. Leider wird diese Perspektive erst am Schluss, also anhangsweise, skizziert. Hätte der Vf. dies zum ethischen Leitgedanken seiner Untersuchung gemacht, hätte er auch das Konzept einer verantwortlichen Weltgesellschaft und die daraus abgeleiteten Maximen für eine verantwortliche Gestaltung der Finanzmärkte wesentlich konsistenter begründen können. Freilich hätte er dabei die freiheitsdienliche Bedeutung des Geldes nicht auf die entlastende, entschuldende und die Verfügungsmöglichkeiten des einzelnen steigernde Funktion des Geldes beschränken dürfen (187f.). Denn auch die klassischen Geldfunktionen als Recheneinheit, Tauschmittel und Wertaufbewahrungsmittel (192f.) sind, recht betrachtet, freiheitsdienlich. Zum an- deren könnte die theologische Betrachtung schon dann an Konsistenz gewinnen, wenn man die beiden Grundaussagen Jesu über den Mammon im Zusammenhang bedenken würde. »Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon« (Lk 16,13) schärft ebenso die instrumentelle Bedeutung des Geldes ein wie »Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon« (Lk 16,9). Auf diesem Hintergrund braucht man auch die religionskritische Analyse einer selbstzwecklichen Betrachtung des Geldes und des Gelderwerbs um seiner selbst willen nicht als »Dämonisierung« beiseite zu schieben, sondern kann sie als Element eines ethischen Zugangs würdigen, der darauf zielt, den Umgang mit dem Geld in den Dienst kommunikativer Freiheit zu stellen. Vielleicht hängt die bloß anhangsweise vorgenommene Behandlung dieses Themas damit zusammen, dass das Buch um seiner Aktualität willen etwas überstürzt abgeschlossen wurde. Den Eindruck der Hast erweckt auch eine nicht geringe Zahl von – gelegentlich auch sinnentstellenden – Fehlern. Dass dem durch einen sorgfältigen Korrekturgang von Seiten des Verlags vorgebeugt wird, ist unter den gegenwärtigen Produktionsbedingungen wissenschaftlicher Bücher leider eine vergebliche Hoffnung. Das inhaltliche Verdienst, das Hübners Buch zukommt, wäre dann jedoch uneingeschränkter zur Geltung gekommen. Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber, Berlin Thomas Maak / Peter Ulrich, Integre Unternehmensführung. Ethisches Orientierungswissen für die Wirtschaftspraxis, Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2007, 532 S., ISBN 978-3-7910-2685-5, e 39,95. An die theoretischen Ansätze der Wirtschafts- und Unternehmensethik ist gelegentlich zumindest leise die Kritik gerichtet worden, sie seien zu wenig praxisrelevant, hätten mit dem Alltag von Führungskräften im Unternehmen wenig oder nichts zu tun oder würden sich in ein moralisches Wolkenkuckucksheim verziehen, aus dem heraus der Zeigefinger geschwungen wird. Helikopter-Management also in der Wirtschaftsethik: aus dem Himmel herabschweben, viel Staub aufwirbeln und dann wieder zurück in die Wolken. Dass Wirtschafts- und Unternehmensethik nicht nur theoretisch fundiert, sondern praxisrelevant im Management einer Organisation verankert werden kann (und nach Ansicht der Autoren: muss), be- 63 weisen Thomas Maak und Peter Ulrich in ihrem Buch »Integre Unternehmensführung. Ethisches Orientierungswissen für die Wirtschaftspraxis«. Die Autoren wollen »eine Lücke schließen – die Lücke zwischen wissenschaftlich-abstrakten Abhandlungen der Unternehmensethik einerseits und auf schnelle Wirkung bedachten Rezeptbüchern zum Thema ›Corporate Social Responsibility‹ oder ›Ethik und Management‹ andererseits« (V). Diesen Anspruch geht das Buch in drei Teilen, die jeweils in fünf »Module« gegliedert sind, an. Die Autoren folgen in der Unterteilung der mittlerweile gängigen Unterscheidung der Zugangsweise in der Wirtschafts- und Unternehmensethik über Gesellschaft (System), Unternehmen (Institution) und Einzelne / Einzelner (Individuum). Teil 1 widmet sich unter dem Titel »Policies – Gesellschaftliche Herausforderung und Mitverantwortung« (29ff) dem Unternehmen in seinen vielfältigen Bezügen zur Umwelt und Gesellschaft: Die Autoren entfalten die Konzepte von Corporate Citizenship national und global, Corporate Stewardship (treuhänderischer Umgang mit Ressourcen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit) sowie in zwei Modulen Konzepte zur Kooperation zwischen Unternehmen und ihren Stakeholdern (»Cross-Sector Partnerships« und »Stakeholder-Engagement und -Dialog«). Im zweiten Teil unter dem Titel »Processes – Die Eckpfeiler integrativen Integritätsmanagements« (205ff) wenden sich die Autoren unternehmensinternen Prozessen zu: Angefangen bei der Unternehmensführung (»Good Corporate Governance«) über interne Integritätssysteme, den Blick auf die Produktionskette und das Thema Marketing bis hin zur integren Unternehmenskultur. In diesem zweiten Teil liegt nach Ansicht des Rezensenten der praxisrelevante Mehrwert des Buches: Denn die Autoren widmen sich hier in genauer Analyse konkreten Managementfragen und klopfen sie auf ihre ethische Relevanz und Implikationen ab. Besonders interessant zu lesen ist Modul 9, das der Frage nachgeht, inwieweit Organisationen moralisch lernfähig sind (311ff). Im Blick auf die noch immer nicht überstandene Krise möchte man das Modul zur Pflichtlektüre für Führungskräfte in Wirtschaft und Politik machen. Der dritte Teil unter dem Titel »People – Individuelle Verantwortung und ihre Entwicklung« 365ff) geht auf die einzelne Führungskraft zu: Themen sind Fragen der Führungsethik, der ethischen Entscheidungsfindung in Konflikt- und Dilemmasitu- 64 ationen sowie die Professionalisierung und Personalisierung der ethischen Integrität einer Unternehmung in Gestalt eines Ethics Officer. Die klare Gliederung des Buches in drei Kapitel mit je fünf Modulen setzt sich in den einzelnen Kapiteln fort. Nach einer jeweiligen grundlegenden Einführung in das Modulthema mit in wenigen Stichworten zusammengefasster Zielangabe und darin bereits formulierten Reflexionsfragen geht der je Modul unter dem Buchstaben B geführte Teil in die Tiefe und stellt Konzepte, Anleitungen und Ideen vor. Teil C eines jeden Moduls fasst die Inhalte noch einmal zusammen, stellt weiterführende Fragen und verweist auf Literatur. Die vielen Praxisbeispiele machen die teils komplexen Überlegungen anschaulich und verdeutlichen zugleich, warum das Nachdenken über ethische Orientierung in der Wirtschaftspraxis so dringend geboten ist. Die Stärke des Buches liegt darin, die gängigen Fragen der Wirtschaftspraxis im Alltag aufzunehmen und deren ethische Implikationen klar herauszuarbeiten, abgesichert und verpackt in und mit Konzepten sowie Ideen. Das Ganze geschieht auf Grundlage eines theoretisch fundierten Konzepts, für das Peter Ulrich steht: die integrative Wirtschaftsethik. Für die grundlegenden Fragen der Wirtschafts- und Managementpraxis ist es den Autoren in der Tat gelungen, Orientierungswissen bereitzustellen, das handhabbar ist. Zugleich liegt in der Umfänglichkeit des Buches eine Schwäche. Mit über 530 Seiten wird es kaum in der Wirtschaftspraxis von Anfang bis Ende gelesen werden (was schade ist). Freilich: Den Anspruch erheben die Autoren nicht, vielmehr seien die Module vielfältig kombinierbar: Je nach eigenem Kenntnisstand können sich Leserinnen und Leser das jeweils für sie Interessante herausnehmen. Die vielen englischsprachigen Worte, mit denen die Autoren jonglieren, mögen manche Leserinnen und Leser abschrecken, sei es, weil die Begriffe manchmal verwirrend sind, sei es, weil es doch zu sehr an »auf schnelle Wirkung bedachte Rezeptbücher zum Thema« erinnert. Gleichwohl scheint es angesichts einer global agierenden Wirtschaft notwendig, international gängige Fachworte zu verwenden. Die jeweiligen Begriffsklärungen in den einzelnen Modulen ermöglichen es Leserinnen und Lesern, die Bedeutung nachzuvollziehen. Alles in allem kann man dem Buch viele Leserinnen und Leser wünschen, aus der Unternehmenspraxis, aber auch aus der Wissenschaft – dort besonders die Personen, die sich von der eingangs erwähnten Kritik, Wirtschafts- und Unternehmensethik sei häufig zu praxisfern, vielleicht angesprochen fühlten. Dr. Daniel Dietzfelbinger, München Marco Hofheinz: Gezeugt, nicht gemacht. In-vitroFertilisation in theologischer Perspektive (Ethik im theologischen Diskurs, Bd. 15), Berlin: LIT Verlag 2008, ISBN: 978-3-8258-0596-8 (Deutschland) / 978-3-03735-154-3 (Schweiz), 670 S., e 44,90. Mit seiner von der Berner Fakultät mit dem Eduard-Adolf-Stein-Preis und von der Karl-Heim-Gesellschaft mit dem Karl-Heim-Preis ausgezeichneten Dissertation legt Marco Hofheinz eine umfängliche Studie zu einer der brennenden Fragen im Bereich der Bioethik des Menschen vor: Wie ist die Technik der In-vitro-Fertilisation (abgekürzt: IVF) in theologischer Perspektive zu bewerten? Dabei wird diese Frage jedoch nicht in einer allgemeinen Weise behandelt. Vielmehr formuliert H. als wesentliches Ziel: »Es geht in dieser Untersuchung darum, einen eigenständigen christologischen Ansatz zu präsentieren, in den die Grenzfrage nach der Legitimität der IVF integriert ist« (58). Diese Zielsetzung und auch die grundlegende Umsetzung, das sei bereits an dieser Stelle gesagt, zeichnet die vorliegende Untersuchung vor vielen vergleichbaren Versuchen aus. Hier wird wirklich eine theologische Ethik betrieben, ohne dabei philosophische Fragestellungen aus dem Blick zu verlieren. Doch sind diese der theologischen Zielsetzung zugeordnet und nicht umgekehrt. Dies zeigt sich im klaren und schlüssigen Aufbau der Untersuchung. Die Antwort auf diese Fragestellung wird in sieben Kapiteln entfaltet. Nach einer Einleitung zum Stand der Forschung, den medizinischen und ethischen Bedenken sowie zur Frage, ob mit der IVF metaphorisch der Rubikon biomedizinischen Forschungshandelns überschritten ist, verortet H. im zweiten Kapitel die Fragestellung nach der Bewertung der IVF in einer Ethik der Geschöpflichkeit. Diese genuin theologische Einbettung wird mittels phänomenologischer Überlegungen zu den Begriffen »herstellen«, »handeln«, »Poiesis« und »Praxis« in Anlehnung an Hannah Arendt präzisiert. Das dritte Kapitel dient dazu, anhand von drei philosophischen Positionen (der diskursorientierte Ansatz Kuhlmanns, Singers Prä- ferenzenutilitarismus, Spaemanns onto-theologische Position), die »rudimentär« (59) für philosophische Positionierungen stehen, die Antwort auf die Abschlussfrage vorzubereiten, wie sich Kirche und Theologie dem öffentlichen Diskurs stellen sollen. Bevor H. im sechsten Kapitel das systematische Zentrum seiner Studie erreicht, untersucht er im vierten Kapitel den Status des menschlichen Embryos in biblisch-theologischer Sicht und stellt er im fünften Kapitel Modelle theologischer Urteilsbildung zur IVF dar. Dabei kontrastiert er die eher die IVF befürwortenden Ansätze M. Honeckers, U.H.J. Körtners und S.M. Daeckes mit den eher ablehnenden Positionen E. Pelkners, S. Hauerwas’ und K. Ulrich-Eschemanns. Das systematisch orientierte sechste Kapitel, das Jesus Christus als Schöpfungsmittler und Erlöser für die Fragestellung fruchtbar macht, erarbeitet das zentrale Ergebnis der gesamten Untersuchung: »Mit der IVF ist die Grenze des ethisch Erlaubten überschritten. Die IVF sprengt das Ethos des ›neuen Menschen‹. Sie ist außerhalb jenes Umrisses lokalisiert, den das Sein der neuen Kreatur in Christo markiert« (543), denn bei der IVF würden Embryonen verworfen und selektiert: »Jesu Zuwendung zu den ›geringsten Schwestern und Brüdern‹ lässt sich als Ausdrucksform seiner antiselektionistischen Ethik interpretieren« (543). Vor dem Hintergrund der leiblichen Auferweckung sei zudem die Entleiblichungstendenz bei der IVF zu kritisieren. Dabei besteht nach H., wie das abschließende siebte Kapitel zeigt, die Aufgabe der Kirche darin, Paare geduldig einzuladen, auf die IVF zu verzichten. Wie gesagt, zeichnet diese Studie aus, dass hier genuin theologisch argumentiert wird. Das Ergebnis leitet H. schlüssig aus seinen Annahmen zur Technik der IVF und seinen theologischen Überlegungen her. Dabei zeigt H. ein außerordentlich breites theologisches Wissen, das er in gelungener Weise für diese spezielle Fragestellung einbringt. Allerdings lassen sich an das theologische, aber auch den Sachverhalt der IVF auslegende Interpretationsschema Anfragen stellen. H. benennt von Anfang an medizinische und ethische Bedenken. Die positive Seite der IVF, dass nämlich manche Paare dank dieser Technik zu einem eigenen Kind kommen, wird kaum in den Blick genommen und zu wenig gewürdigt. Auch die Sprechweise lässt erkennen, dass das Interpretationsschema durch eine ablehnende Haltung geprägt ist. So gebraucht er Begriffe wie »Selektion«, die negativ konnotiert sind, und spricht 65 ausdrücklich von »Selektionsverdacht« (131). Diesen bezieht er nicht nur auf die in vielen Ländern mit der IVF verbundene genetische Präimplantationsdiagnostik (PGD), sondern auch auf die optische Diagnostik von menschlichen Keimen im Vorkernstadium, die bei jeder IVF zum Standard gehört. Er nimmt dabei nicht zur Kenntnis, dass diese optische Diagnostik nicht das Ziel eines perfekten Kindes hat, sondern einfach dazu dient, nur die Embryonen einzusetzen, die eine nach medizinischer Fachkenntnis gute Möglichkeit haben, überhaupt zu einer Geburt zu kommen. Ansonsten würde der Frau ein Embryo übertragen werden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht lebensfähig ist, und damit entweder keine oder nur eine kurze klinische Schwangerschaft ermöglicht, letztere mit allen belastenden Folgen eines Frühabgangs. Doch selbst wenn eine IVF mit einer Polkörperdiagnostik oder einer PGD verbunden wird, bedeutet dies nicht, dass jede Form dieser Diagnostiken einer selektiven Mentalität entspringen muss. Eine Nicht-Implantation bei einer festgestellten Trisomie 18 beispielsweise wäre mit passiver Sterbehilfe vergleichbar, selbst wenn man den frühen Embryo als Person versteht. Die Annahme, der Embryo sei von der Zeugung an Person, ist jedoch ebenfalls bestreitbar. Es ist eine große Stärke der Untersuchung, dies nicht nur einzuräumen, sondern auch theologisch zu begründen. So schreibt H. völlig zutreffend: »Nach theologischem Verständnis fängt die Geschichte eines Menschen […] nicht mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle oder einem beliebigen anderen Stadium der Zellentwicklung an« (247). Entscheidend ist theologisch also gerade nicht der konkrete Vollzug, wie ein Mensch in die Welt kommt, sondern dass der Mensch, der in die Welt kommt, immer schon von Gott her »gedacht« ist. H. wehrt sich sogar ausdrücklich gegen das kategorische Urteil, wonach der Mensch Person zum Zeitpunkt der Zeugung sei (vgl. 518). Aufgrund seines Tutiorismus kommt er jedoch zur bestreitbaren Forderung nach einer Praxis, »die den werdenden Menschen von Anfang an als Gegenüber personalen Umgangs und niemals als Objekt technischer Verfügung behandelt« (518, hierbei Spaemann zitierend). Dabei greift er neben Spaemann auf Kant und insbesondere Assel zurück (vgl. 516ff), deren Aussagen interpretationsoffen (Kant) bzw. diskussionswürdig (Spaemann, Assel) sind. Auch das weitere theologische Interpretationsschema lässt sich in Frage stellen. So wird der Fokus darauf gelegt, dass Gott allein über Fruchtbar- 66 keit und Unfruchtbarkeit entscheidet (vgl. 240), ohne vertieft das Drama der Kinderlosigkeit für den alttestamentlichen Gläubigen hinreichend zu würdigen, man denke nur an Abraham und Sara. Man könnte die IVF vor diesem Hintergrund auch als eine Möglichkeit deuten, wie Menschen als Mitschöpfer Gottes daran mitwirken können, ein derartiges Drama zu einem guten Ende zu führen. Darüber hinaus könnten die christologischen Überlegungen mit einer anderen Stoßrichtung durchgeführt werden. H. versucht die Christologie von Nizäa und Konstantinopel dafür fruchtbar zu machen, »die weltliche Zeugung der Kinder Gottes im Lichte dieser ewigen Zeugung des Sohnes Gottes wahrzunehmen« (480). Dabei begeht er freilich nicht den schweren theologischen Kategorienfehler, die Glaubensaussagen, die gerade das Gottsein Jesu herausstreichen, auf den Menschen zu beziehen. Vielmehr will H. diese Aussagen nur »im Sinne einer Analogiebildung aufeinander beziehen« (15). Nach meiner Ansicht läge es jedoch näher, die Differenz zwischen Jesus Christus als gezeugt und nicht geschaffen/gemacht und uns als geschaffen/gemacht ernst zu nehmen und zugleich den theologischen Gedanken seiner ungeschlechtlichen Menschwerdung in der Jungfrau Maria für die Fragestellung der IVF im Sinne einer Analogiebildung zu berücksichtigen. Freilich lässt sich damit die berechtigte Annahme, die IVF impliziere eine Entleiblichungs- und Machbarkeitstendenz, nicht grundsätzlich widerlegen. Nach meiner Meinung reicht dies aber nicht, um eine ethische Unzulässigkeit der IVF zu konstatieren. Doch trotz dieser Anfragen bleibt dieses Buch sehr empfehlenswert. Wer sich theologisch mit der Fragestellung nach der ethischen Bewertung der IVF auseinandersetzen will, kommt an diesem materialreichen, viele Facetten hervorragend ausleuchtenden und dabei dezidiert theologisch argumentierenden Werk nicht vorbei. Prof. Dr. mult. Nikolaus Knoepffler, Jena Ulrich Eibach: Gott im Gehirn? Ich – eine Illusion? Neurobiologie, religiöses Erleben und Menschenbild aus christlicher Sicht, 3. Aufl., Witten: R. Brockhaus 2010, ISBN: 978-3-417-24206-5, 152 S., e 10,90. Nach dem Auftakt mit dem fiktiven Gespräch eines Neurowissenschaftlers mit seiner Frau über verschiedene Perspektiven auf den Liebesbegriff beginnt das Buch mit einer Einordnung der neueren neurowissenschaftlichen Forschung in die Geistesgeschichte des Abendlandes. Unterteilt ist dieses zweite Kapitel in eine kurze Darstellung der Geschichte der Frage nach einem Dualismus bzw. Monismus zwischen Geist und Materie, in der neben der eigentlichen historischen Darstellung auch Begriffsklärungen hinsichtlich verschiedener Spielarten eines Monismus und Reduktionismus vorgenommen werden (14–26), in ein Teilkapitel über die Bedeutung der soziobiologischen Reduktion mittels des Genbegriffs bei Autoren wie Dawkins, Wilson, Avise, Hamer und Sosis (26–36) und in ein Teilkapitel über die Frage nach der praktischen Bedeutung neurowissenschaftlicher Reduktionismen für das Menschenbild und in diesem implizierte Begriffe wie Subjektivität, Personalität und Leiblichkeit (36–41). Das anschließende Kapitel stellt die neuen bildgebenden Verfahren der Neurowissenschaften vor (42–44), um anschließend ausführlich deren weltanschaulich-religiöse Interpretationen zu besprechen. Der Vf. unterscheidet hier zwei wesentliche Typen: Die Möglichkeit, neurowissenschaftliche Ergebnisse als Begründung oder Bestätigung einer natürlich-mystischen Theologie zu verwenden, was v.a. am Beispiel Newbergs, Aquilis und Austins exemplifiziert wird (45–53), und die Möglichkeit, umgekehrt diese Ergebnisse im Rahmen einer neurobiologisch gestützten Religionskritik zu verwenden, wofür v.a. die Deutungen Persingers besprochen werden (53–60). Das Kapitel wird mit einer Reflexion auf die grundsätzlich vorgängig weltanschauliche Gebundenheit dieser Deutungsversuche und einem ersten Zwischenfazit beschlossen (61–65). Das folgende vierte Kapitel (66–84) bezieht die gewonnenen Ergebnisse nun auf den christlichen Glauben in Praxis und Theologie und ist seinerseits unterteilt in eine Besprechung der Relation von religiösem Erleben und sprachlicher Deutung (68– 76) und in eine Besprechung der Rolle des subjektiven Erlebens und der Gefühle im Rahmen des christlichen Glaubens (76–84). Eine Besprechung des Verhältnisses von außergewöhnlicher religiöser Erfahrung und religiöser Alltagserfahrung (85– 91), die nach der Einteilung des Buches schon zum folgenden Kapitel gehört, rundet diesen Gedankengang ab. Dieser Zusammenhang kann als die argumentative Mitte des ganzen Buches betrachtet werden. Das fünfte Kapitel bietet, von der Einleitung abgesehen, eine ausgewogene Besprechung der sog. Nahtoderlebnisse im Rahmen des christlichen Glaubens als Beispiel für eine als außergewöhnlich eingestufte religiöse Erfahrung (92–113). Der Vf. zeigt hier in einer ausgewogenen und anschaulichen Darstellung, dass Nahtoderfahrungen von höchster religiöser Relevanz sein können, aber nicht müssen und setzt sich von bekannten esoterisch-verengenden Deutungen, wie etwa derjenigen von Kübler-Ross, wohltuend deutlich ab, wenn man auch die Hochschätzung von out-of-body-Erlebnissen zur Stützung eines prinzipiellen LeibGeist-Dualismus als Überfrachtung der Beweislast empfinden mag. Das abschließende sechste Kapitel führt in die durch die Neurowissenschaften aufgeworfene Fragestellung nach einer prinzipiellen Willensfreiheit des Menschen oder einem deterministischen, den Willen ausschließenden Weltbild ein (114–152). Dabei werden die damit verbundenen philosophischen Fragen zwar recht kurz, aber dennoch für ein Buch dieser Art konzise dargestellt (114–130), um diese Ergebnisse anschließend auf einen theologischen Freiheitsbegriff reformatorischer Prägung zu beziehen (130–152). Dieser Darstellung der christlichen Freiheit als relatives Befreitsein vom Zwang der Sünde, die als gebundene Freiheit in Bezogenheit zu Gott und den Mitmenschen beschrieben werden kann – eine Darstellung, die man in populären Darstellungen dieser Art über das Thema häufig vermisst –, wird erfreulicherweise ein breiter Platz eingeräumt, so dass – ähnlich dem Achtergewicht der hebräischen Poesie der Psalmen – sich auch der Schlussteil dieses Buches mit Genuss lesen lässt. Inhaltlich zeigt der Vf. die weltanschauliche Gebundenheit von ontologischen Reduktionismen auf, so dass lediglich methodischen Reduktionismen ein relativer Wert zugestanden wird. Neuronale Korrelate von geistigen Inhalten können auf kompatibilistische Weise als notwendige Bedingungen derselben verstanden werden, unterscheiden sich jedoch vom Inhalt genauso, wie sich Empfindungen von Erfahrungen unterscheiden und letztere nicht auf erstere reduziert werden können. Die sprachliche Erfassung von geistigen Inhalten und mit ihr deren in Gemeinschaften und Traditionen vermittelte Bedeutung ist ein durch neuronale Korrelate der Inhalte nicht beschreibbares, unreduzierbares Element. Darüber hinaus lässt der Vf. aber erkennen, dass er selbst nicht für eine kompatibi- 67 listisch-monistische Option, sondern für eine dualistische Option, die auch deutlich top-down-Konzeptionen zulässt, votiert. Hinsichtlich der religiösen Erfahrungen zeigt der Vf. plausibel auf, dass diese nicht in bestimmten Empfindungen und deren neuronalen Korrelaten aufgehen, sondern ebenfalls der sprachlich sozialen Vermittlung bedürfen und aus theologischer Sicht durch das Konzept der gewissheitsstiftenden Erfahrung des Heiligen Geistes ergänzt werden müssen. Aus der Alltagserfahrung herausgehobene (»mystische«) Empfindungen können mit der Erregung bestimmter Hirnareale einhergehen. Aber die Erregung bestimmter Gehirnareale ist dabei genauso wenig hinreichend, um von religiösen Erfahrungen sprechen zu können, wie die introspektive Selbstdiagnose bestimmter aus der Alltagserfahrung herausgehobener Empfindungen. Darüber hinausgehend zeigt der Vf., dass sich wichtige religiöse Erfahrungen, die in den Bereich der Alltagserfahrung gehören, nicht auf bestimmte Klassen von Erlebnissen reduzieren lassen und entsprechend nicht mit neuronalen Erregungen bestimmter Gehirnregionen verbunden sein müssen. Die Frage, was als religiös zu betrachten ist, ist somit keine Frage der Erregung bestimmter Hirnareale, sondern die Definitionsmacht des Religiösen liegt auf der immer sprachlich-kommunikativ vermittelten Sozialität und Intersubjektivität. Positive Effekte der Beschäftigung des Dialogs mit philosophisch interpretierter Neurowissenschaft einerseits und Theologie andererseits können in einer Hochschätzung der Bedeutung der Affektivität für menschliches Handeln und Glauben bestehen, aber auch in einer Warnung vor rein subjektivistischen Zugängen zur christlichen Religiosität des Menschen, die auch dann, wenn sie nicht reduktiv-neurowissenschaftlich gedeutet wird, mit diesen Deutungen gemeinsame strukturelle Probleme teilt. Nach seiner Anlage wendet sich das Buch an einen breiten Adressatenkreis: von Oberstufenschülern und Religionslehrern über das engagierte Gemeindeglied und den gebildeten interessierten, aber durchaus kirchenfernen Laien bis hin zu Theologiestudierenden. Naturgemäß ist es nicht einfach, eine solche vielfältige Adressatengruppe unter einen Hut zu bringen. Man wird bei diesem Versuch nicht allen Ansprüchen gerecht werden können: Die historische Einführung in die Problemgeschichte zu Beginn des Buches etwa ist recht knapp gehalten und setzt wohl schon Bekanntschaft mit der Geistes- und Philosophiegeschichte vor- 68 aus, was aber für den Argumentationsgang des Buches kein Schaden ist. Sicherlich könnte man auch kritisieren, dass viele materialethische Probleme, die mit dem Thema verbunden sind, nur angerissen werden und sich das Buch eher auf grundsätzliche Überlegungen beschränkt. Gerade dieses Faktum bildet aber andererseits auch einen positiven Wert, da die Darstellung dadurch für den anvisierten breiten Leserkreis erst rezipierbar wird. Im Großen und Ganzen wird man diagnostizieren müssen, dass dem Vf. seine Aufgabe erstaunlich gut gelingt: Ausgewogene Urteile, die die Vorteile verschiedener Positionen erkennen lassen – auch derer, die der Autor nicht favorisiert – verbinden sich mit einer dezidierten Positionsbestimmung des Autors, ohne dass diese aufdringlich apologetisch erscheint. Auch wenn gerade unterschiedliche fachtheologische Leserinnen und Leser naturgemäß nicht jeder Problemlösung des Vf.s zustimmen werden, so wird man das Buch doch rundherum empfehlen können: Es gibt nicht nur eine Einführung in die neueren philosophischen und religiösen Debatten um die Neurowissenschaften, sondern es bietet – als wohl wichtigste Leistung – auch eine vorzügliche aufklärende Einführung in theologisches Denken für den neurowissenschaftlich interessierten religiösen Skeptiker. Prof. Dr. Markus Mühling, Heidelberg / Jena Hermann Ringeling: Umbruch der Sitten – miterlebt und mitbetrieben. Ein Ethiker blickt zurück, Zürich: Theologischer Verlag 2007, ISBN: 978-3290-17417-0, 280 S., e 24,00. Hermann Ringeling, langjähriger Mitherausgeber der Zeitschrift für Evangelische Ethik, blickt zurück und beteuert im Vorwort, »keine Autobiographie« geschrieben zu haben (7). In der Tat hat R. zum einen mehr, zum anderen weniger vorgelegt als eine übliche Autobiographie. Zum einen ist das Buch mehr als eine Autobiographie: Der emeritierte Berner Ethiker (geb. 1928) integriert in den narrativen Duktus des Rückblicks zahlreiche ethische Reflexionen, Zeitungsnotizen und Auszüge aus seinen Schriften (»Das Folgende aus den Lutherischen Monatsheften: ...«; 143), bis hin zum vollständigen Abdruck kleinerer Texte wie z.B. einer Predigt (sieben Seiten im Kleindruck, 243–250). Dieses Verfahren ist sehr informativ, ge- winnt man so doch einen authentischen Eindruck vom jeweiligen Gesprächs- und Erkenntnisstand. Mitunter wirken die z.T. recht langen Einschübe allerdings retardierend und stellen die Geduld des Lesers auf eine harte Probe. Zum anderen ist das Buch weniger als eine Autobiographie: Bestimmte biographische Daten fehlen bzw. werden an unverhoffter Stelle nachgetragen oder vorgezogen. Mit dem chronologischen Aufriss, der sich bis 1998 an Dekaden orientiert und danach kleinschrittiger vorgeht (1998–2003, 2003–2006), verbindet sich ein thematischer Aufriss, der prägende Zeitströmungen und wesentliche Themen der Forschung R.s fokussiert (z.B. »Protestkultur und die Pille 1958–1968«, »Umsturz der autoritären Moral 1968–1978«). Natürlich kann diese Zuordnung nicht glatt aufgehen – im Zweifel erhält die thematische Orientierung den Vorzug, während die Biographie einen recht lockeren Rahmen abgibt und weit mehr in Gestalt unterhaltsamer Anekdoten als in einer kontinuierlichen Lebensgeschichte präsentiert wird. Als ein Beispiel, das einen Eindruck vom Ganzen vermittelt, kann das Kapitel »Ein Recht auf das eigene Leben 1978–1988« (123–152) angeführt werden. R. beginnt damit, dass er 1977 nach einem halben Jahrhundert der erste deutsche Rektor der Universität Bern wurde, und schließt daran einen Rückblick auf die Berufung des ehemaligen Münsteraner Assistenten (ab 1964) und Hamburger Oberkirchenrats (ab 1967) nach Bern im Jahr 1971 an. Diese wiederum wird nicht in biographischen Details geschildert, sondern zum Anlass genommen, kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz sowie darüber hinaus den Wandel der Umgangsformen zu reflektieren. Danach gelangt R. zum »Recht auf das eigene Leben« als dem »große[n] Thema der Zeit« (127), näherhin den Fragen im Umkreis von Beginn und Ende des Lebens. Auch hier wird mit der Chronologie wieder großzügig verfahren. Kerndatum für die chronologische Einordnung ist wohl das Scheitern eines Schweizer Volksbegehrens für die Straflosigkeit von »Schwangerschaftsunterbrechungen« im Jahr 1978. Referiert werden jedoch auch die Diskussion in den Jahren zuvor sowie die folgende Entwicklung in der Schweiz und in Deutschland bis in die jüngste Zeit. Dabei bedenkt R. erfrischend selbstkritisch (»ein Frühdenker war ich da nicht«, 128) die Entwicklung der eigenen Haltung von einer Ablehnung der Fristenlösung 1977 (128ff) bis zur Entscheidung, »Recht und Unrecht des Schwangerschaftsabbruchs und damit allerdings auch die Achtung vor dem Leben konsequent dem Bereich der privaten Moral zu überlassen« (138), die R. in Auseinandersetzung mit der Reform des Abtreibungsrechts (1992/95) im wiedervereinigten Deutschland entfaltet. Chronologisch ähnlich ausgreifend ist R.s anschließende Darstellung seiner Position zur Sterbehilfe (139ff), die mit der maßgeblichen Beteiligung an den für die Schweiz wegweisenden Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften von 1976 einsetzt und bis zur Auseinandersetzung mit der Entwicklung in den Niederlanden und in Belgien Anfang des neuen Jahrtausends reicht. Sie kreist – in dieser Frage ohne größere Positionsverschiebungen – von Anfang an um die »Frage nach der Zumutbarkeit einer als sinnlos erscheinenden Lebensverlängerung« (144) und vermeidet objektivierende Festlegungen über das ›Wesen‹ des menschlichen Lebens zugunsten individueller Entscheidungsspielräume. Neben der Würdigung des Freiheitsgewinns wird aber auch der neue Zwang zu einem ›eigenen‹ Leben kritisch angesprochen (150f). Eingestreut in die sachliche Darstellung der Sterbehilfeproblematik ist das persönliche Bekenntnis R.s, mit seiner Frau Mitglied der Sterbehilfe-Vereinigung »Exit« zu sein (148). Diese Verknüpfung von sachlicher und persönlicher Ebene prägt auch sonst den Stil und die Anlage des Buches: Im Kapitel »Deutsches Unwesen 1928–1948« werden mit der Darstellung von Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus politisch-ethische Gedanken über Staat und Gesellschaft verbunden – einschließlich eines längeren Auszugs aus der Rede zum 25. Abiturjubiläum 1970. Ausgehend von der freiwillig vorgezogenen Emeritierung 1991 gelangt R. im Kapitel »Freiheit, Gleichheit, Vielfalt 1988–1998« zur Reflexion von Alter und demographischem Wandel. Im Kapitel »Aufklärung und Steuerung 1998–2003« wird der eigene Weg zum Nichtraucher auf den entsprechenden gesellschaftlichen Trend bezogen und die grundsätzliche Frage nach der Berechtigung repressiver Steuerungsimpulse diskutiert. Die enge Verzahnung von chronologischen und thematischen Gliederungsaspekten erweist sich letztlich als programmatisch: Das Individuelle wird zum Typischen, die eigene Biographie in ihrer Besonderheit zur exemplarischen. Die Themen des wissenschaftlichen Lebenswerks werden nicht mühsam gesucht, sie begegnen R. 69 gewissermaßen auf dem eigenen Lebensweg. Insgesamt entsteht so auf originelle Weise eine bunte Collage, die einen lebendigen Eindruck theologischer Zeitgenossenschaft vermittelt. Jeglicher autoritärer Gestus wird vermieden. R. beansprucht keinen Erkenntnisvorsprung theologischer gegenüber philosophischer Ethik, ja er hätte »nichts dagegen einzuwenden«, sich »als philosophischen Ethiker mit christlichem Hintergrund zu bezeichnen. […] ›Ethiker‹ genügt durchaus, weil es genügt, wissenschaftlich und überzeugend zu argumentieren« (251). Dass R. sich nicht scheut, in kontroversen Fragen pointiert Position zu beziehen, fordert an einigen Stellen zum Widerspruch heraus. So empfindet es der Rezensent als schwer erträglich, wenn R. die Auffassung eines medizinischen Kollegen wiedergibt, der zufolge ein Kind mit Down-Syndrom zwar »ein anhängliches, auch zufriedenes Kind« würde, sich aber »damit nicht von einem großen Hund« unterschiede, und dann fortfährt: »Er riet indirekt zur Abtreibung. Und das, wie auch ich meine, mit Recht« (132f; neutraler allerdings 208f). 70 Der »Umbruch der Sitten« als Generalthema des Buches und auch von R.s wissenschaftlichem Werk konzentriert sich auf das »alltägliche[] Leben, wo die Sitten ihren Ort haben« (196). Daraus ergibt sich seit der 1962 veröffentlichten Dissertation zur Gleichberechtigung der Frau (»Die Frau zwischen gestern und morgen«) und der Habilitationsschrift über »Theologie und Sexualität« mit dem bezeichnenden Untertitel »Das private Verhalten als Thema der Sozialethik«, die 1968 – im Umbruchs-Jahr par excellence – erschien, ein durchgängiges Interesse an Ehe- und Familienethik als einem klassischen Themenfeld evangelischer Ethik, das R. unter den Bedingungen zunehmender Individualisierung und der Entstehung einer Pluralität von Lebensformen reflektiert sowie mit neuen Problemfeldern insbesondere der Bioethik verbunden hat. Diese Perspektive sollte auch in der gegenwärtigen evangelischen Ethik nicht verloren gehen. Mit der kritisch-konstruktiven Offenheit, in der R. den von ihm erlebten »Umbruch der Sitten« aufmerksam begleitet hat, hat er Maßstäbe gesetzt. PD Dr. Frank Surall, Bonn