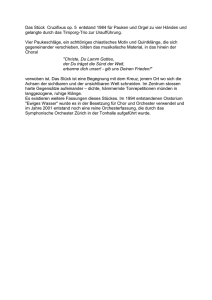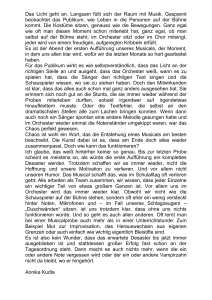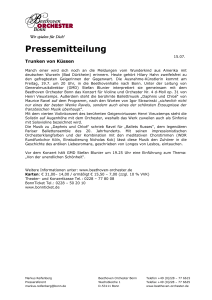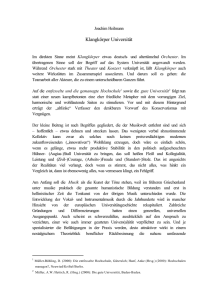Untitled
Werbung

III Chaplin und andere Indikativ 0’37“ Nach dem traurigen Ingmar Bergman gestern wird es heute wieder heiterer – zumindest abschnittsweise. Dabei unterbrechen wir das Prinzip, einzelne Filmregisseure musikalisch zu porträtieren, und unternehmen einen kleinen Streifzug durch die Filmgeschichte. Musik hat von Anfang an den Film begleitet. Schon an jenem Dezemberabend des Jahres 1895 in einem Pariser Bistro soll ein Mann Klavier gespielt haben, als die Gebrüder Lumière - im Film - die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof von La Ciotat zeigten, und das Publikum schreiend flüchtete, um nicht von der Lokomotive überrollt zu werden. Der Stummfilm hatte Musik dringend nötig, um das Fehlen der akustischen Realität zu verdecken. Als Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts der Tonfilm zu sprechen begann, stieß diese Neuerung keineswegs auf allgemeines Wohlgefallen. Einer der entschiedensten Gegner der klingenden Sprache war Charlie Chaplin. Er sah die Zukunft im „musikalisch stummen Film“. Das konnte er sich leisten, denn er war durchaus musikalisch und hat die meiste Musik in seinen Filmen selbst erfunden. Chaplin konnte zwar Noten weder lesen noch schreiben, doch er summte und pfiff einem Arrangeur so lange die Melodien vor, bis sie auf dem Papier standen. Ein einziges Mal hat Chaplin zu klassischer Musik gegriffen, doch dieser Fall hat es in sich. Im Film „Der große Diktator“ spielt er eine Doppelrolle: Den kleinen Frisör im jüdischen Ghetto und Hynkel , Diktator von Thomanien, nämlich Deutschland. Nachdem Goebbels Hitlers Allmachtsfantasien geschürt hat, möchte der allein sein. Musik setzt ein, die des Führers Spiel mit einem Luftballon als Weltkugel begleitet. Das ist der „musikalisch stumme Film“, der Chaplin vorschwebte. Hitler liebkost den Globus, wirft ihn in die Luft, mit der Hand, dem Fuß, dem Hintern. Sanft und träumerisch ist der Führer – ganz wie die Musik, die Chaplin dieser Szene unterlegt: Das Vorspiel zu Wagners romantischer Oper „Lohengrin“. Der Luftballon-Globus platzt, Schnitt, im Frisörsalon. Aus dem Radio die Sendung „Wir schaffen alle im Rhythmus der Musik“. Charlot nimmt das ganz wörtlich und rasiert seinen Kunden exakt im Rhythmus des Ungarischen Tanzes Nr. 5 vom Wagner-Antipoden Brahms. Schaum anrühren, einseifen, Messer schärfen, Schaum abkratzen – alles perfekt synchron, und auf dem letzten Schlag setzt er dem leicht verdatterten Mann den Hut auf. Brahms: Ungarischer Tanz Nr. 5 2’02“ Katja und Marielle Labeque, Klavier Philips 426435 LC 0305 Katja und Marielle Labeque spielten den Ungarischen Tanz Nr. 5 von Johannes Brahms Das ist ebenso hinreißend wie ein anderer Fall von Arbeitsmusik, wenn auch die Tätigkeit dabei durch das Gesetz nicht ganz gedeckt ist. In Dänemark erfreuten sich während der 70er Jahre die Filme der Olsen-Bande großer Beliebtheit. Unser Streifen heißt „Schlagbohrer mit Musik“. Regie Erik Balling. Wir befinden uns in einem Opernhaus. Der Bedienstete eines dänischen Schlossherrn sitzt vor der Kavaliers-Loge auf einem Koffer, den er sorgsam bewachen soll. Darin steckt eine wertvolle chinesische Vase, auf die die Olsen-Bande scharf ist, die der Baron aber noch für einen Versicherungsbetrug benötigt. Durch den Keller gelangt die Bande ins Gebäude, und muss zuerst unbemerkt den Orchestergraben erreichen. „Das ist doch leicht“, meint einer der Diebe. „Nein“, erwidert der Anführer, „am königlichen Theater ist gar nichts leicht. Alles ist schwer. Das kommt durch die eigentümliche Arbeitsatmosphäre in diesem Hause. Das Orchester hat dauernd Stunk mit den Opernsängern, die Sänger verachten das Ballett, die Balletttänzer die Schauspieler, die Schauspieler krachen sich untereinander und die Techniker sind überzeugt, dass überhaupt nur sie arbeiten. Deshalb sind alle Passagen zwischen den einzelnen Sparten verrammelt und durch Wände getrennt, und diese Wände müssen wir abtragen. Dann kommen wir in den Zuschauerraum“. Das Durchbrechen der Wände geschieht mittels Hammer und Meißel, Stemmeisen und Motorsäge, Schlagbohrer und schließlich einer kleinen Ladung Dynamit. Und zwar stets genau an den lauten Stellen der Musik. Mit der Taschenpartitur in der Hand leitet der Bandenchef diesen Arbeitseinsatz. Der Dirigent und die Schlagzeuger im Orchestergraben schauen zunächst leicht irritiert, das Forte scheint ihnen dies Mal etwas merkwürdig zu klingen. Am Schluss lächeln jedoch alle vergnügt: Endlich einmal wirkliches Fortissimo. Der Name des Komponisten auf dem Einband der Partitur ist erkennbar: Friedrich Kuhlau. Geboren 1786 in Uelzen, ging er in jungen Jahren nach Dänemark, wo sich seine Opern noch heute einiger Beliebtheit erfreuen. Man sollte meinen, die Ouvertüre von Kuhlaus Oper „Die Räuberburg“ sei für solchen Stoff naheliegend, aber nein, es ist die zur Oper „Elfenhügel“. Nach Elfen klingt der Lärm zwar weniger, aber die Musik hat genau den Schuss an Naivität, mit der die Banditen ans Werk gehen. Das Wichtigste ist jedoch: Die Ouvertüre zum „Elfenhügel“ schließt mit der Hymne „König Christian stand am hohen Mast“, der späteren dänischen Nationalhymne. Wenn sie ertönt, muss das Publikum aufstehen. Ebenfalls der Bewacher, der bislang auf dem Vasen-Koffer gesessen hatte. In diesem Moment ergreift einer der Räuber den Koffer und verschwindet. Kuhlau: Ouvertüre zu „Elfenhügel“ op. 100 10’49“ Odense Sinfonie Orchester, Ltg. Othmar Maga Unikorn U.K. DKP 9110 LC 01411 Das Odense Sinfonie Orchester, geleitet von Othmar Maga, spielte die Ouvertüre zur Oper „Der Elfenhügel“ von Friedrich Kuhlau. Der eine große Ausnahme in der Filmmusik bildet. Zwar ist eine genaue Statistik der Klassiker im Kino bislang nicht erstellt worden, aber den ersten Platz dürfte vermutlich Mozart einnehmen. Dicht gefolgt von Wagner. Allein der „Walkürenritt“ taucht seit Stummfilm-Zeiten drei Dutzend Mal in den unterschiedlichsten Streifen auf. Zum musikalischen Inventar von Liebesschnulzen aus Hollywood gehörte lange Zeit Rachmaninows zweites Klavierkonzert. Darauf spielt Billy Wilder – oder sein Komponist Alfred Newman - in der Komödie „Das verflixte siebte Jahr“ an, wo er seinen Helden sagen lässt: „Rachmaninow verfehlt nie seine Wirkung“. Der Held ist gerade Strohwitwer und möchte damit seine hübsche Nachbarin herumkriegen. Er legt die Platte auf, und schon kommt in einer Traum-Überblendung die Nachbarin durch die Tür. Ein Vamp wie aus dem Bilderbuch, lange blonde Haare, hauteng gekleidet, armlange schwarze Handschuhe, Zigarettenspitze - keine andere als die Monroe. Die Kamera schwenkt nach links, unser Held sitzt am Klavier und spielt das Konzert nun eigenhändig. Der Vamp räkelt sich auf dem Flügel und spricht: „Das ist nicht fair. Immer wenn ich Rachmaninows zweites Konzert höre, verliere ich die Fassung. Darf ich mich neben Sie setzen?“ Nach einigen weiteren Takten: „Es erschüttert mich, ich bekomme am ganzen Körper eine Gänsehaut. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin, wer ich bin und was ich tue. Spielen Sie weiter! Hören Sie niemals auf!“ Der Held beendet gleichwohl das Spiel, küsst sie, doch alles nur ein Traum. So todsicher war das Stück also nicht, schließlich ziert es auch den Streifen „Der Kongress der Pinguine“. Gleichwohl bleibt die schwierige Frage: Warum hier der zweite Satz aus Rachmaninows zweitem Klavierkonzert – und nicht etwa Beethovens Violinkonzert? Abgesehen davon, dass man sich auf einer Geige nicht räkeln kann, muss es wohl am Instrument liegen. Daniela (19), von der Zeitschrift „Bravo“ befragt, welche Musik gut zum Verführen geeignet sei, antwortet jedenfalls: „Die ungarischen Rhapsodien von Chopin.“ Nun hat Chopin wenig ungarische Rhapsodien geschrieben, streng genommen keine einzige, aber das ist nicht so wichtig, und die Linie Chopin – Liszt – Rachmaninow ja gar nicht so falsch. Entscheidend ist das Klavier, das schon im Schlager Glück bei den Frauen bringt. Oder liegt es daran, dass zumindest dem zeitweilig schreibunfähigen Rachmaninow eine Hypnose half, deren Ergebnis das Zweite Klavierkonzert ist? Die Wege der Musik sind zuweilen geheimnisvoll. Wir hören eine Pianistin, Hélène Grimaud, und das Philharmonia Orchestra unter Vladimir Ashkenazy – und fragen nicht weiter nach der Gänsehaut. Rachmaninow: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2, c-Moll, op. 18, 2. Satz 11’57“ Hélène Grimaud, Klavier, Philharmonia Orchestra, Ltg. V. Ashkenazy Teldec 384376 LC 06019 Ein bedeutendes Kapitel der Filmgeschichte hat Luis Bunuel geschrieben, vor allem mit seinen frühen und seinen späten Filmen. Musik lernte er durch seine Eltern kennen, die ihn in die Oper mitnahmen. So wurde er ein halber Wagnerianer. Mit dreizehn beginnt er Geige zu spielen, auf der er am liebsten improvisiert. Ein ausgesprochen musikalischer Regisseur wie Ingmar Bergman oder Stanley Kubrick ist er dennoch nicht geworden. Die großen späten Filme enthalten kaum Musik und die der mittleren, mexikanischen Periode nur konventionelle. Einiges ist musikalisch immerhin bemerkenswert. Den surrealistischen Stummfilm „Le Chien andalou“, Der andalusischer Hund, hat Bunuel bei der Pariser Uraufführung 1928 mit Schallplatten von Tangos und Wagners „Tristan“ begleitet. Dazu im Bild: Wie Ameisen über eine Hand laufen, Eselkadaver in einem Flügel liegen oder einer Frau mit einem Rasiermesser ein Auge durchschnitten wird. In seinem ersten Tonfilm „L’Age d’Or“, Das goldene Zeitalter, ertönt Beethovens Violinkonzert, wozu ein Schauspieler einer im Rinnstein liegenden Geige einen Fußtritt versetzt. Nicht nur dem spanischen Bürgertum und der katholischen Kirche, auch der gesellschaftlich akzeptierten Musik nähert sich Bunuel mit Blasphemie. Das Hohe lässt sich leicht erniedrigen und das Ernste gut verulken; dazu hat die Klassik im Kino ebenfalls nicht selten gedient. In Bunuels Film „Viridiana“ ist die Heldin Novizin in einem Kloster, erhält einen Heiratsantrag ihres Onkels, lehnt ihn empört ab, der Onkel bringt sich um. Viridiana macht daraufhin aus seinem Landgut ein Asyl für Arme und Obdachlose. Als sie einmal abwesend ist, feiert das Lumpenproletariat ein Fest mit einem Essen als Höhepunkt. Edles Kristall, teures Porzellan und wertvolle Kerzenleuchter stehen auf dem Tisch. Die Tafelgenossen und –genossinnen verschlingen fetttriefend Hammel und Hähnchen mit den Händen, schlürfen Suppe ohne Löffel, betrinken sich stark, beschimpfen sich mit Obszönitäten, zwei Frauen beginnen eine Prügelei. Da kommt ein Alter auf die Idee, ein Foto zur bleibenden Erinnerung zu machen, wozu sich alle auf die eine Seite des Tisches setzen, und plötzlich wird die Szene zum „Abendmahl“ von Leonardo da Vinci. Mit abstoßend aussehenden Bettlern als Jünger und auf dem Platz Jesu sitzt ein Blinder. Ein weiterer Alter kommt tänzelnd herein, mit einem Mieder umgebunden und einem Hochzeitschleier um den Kopf. Andere gesellen sich seinem Tanz hinzu, ein Paar kopuliert hinter dem Sofa, worüber der Blinde in Wut gerät und mit seinem Stock das Tischgeschirr zertrümmert. Zu solch ekelhaftem Treiben läuft eine Schallplatte, die der transvestitische Tänzer zuvor aufgelegt hatte. Händel: Messias, Halleluja 3’45“ The English Concert Choir – The English Concert, Ltg. Trevor Pinnock Archiv 423630 LC 00113 The English Concert Choir und das English Concert mit dem „Hallelujah“ aus Händels Oratorium „Der Messias“. Die Leitung hatte Trevor Pinnock. Hegel, der Philosoph, stellte zwar die Musik höher als sein Vorgänger Kant, hatte aber Probleme mit ihrem Inhalt. Wir wissen nicht, worum getrauert wird, wenn Musik traurig klingt. Im Kino hätte Hegel Antworten gefunden. Den Inhalt des langsamen Satzes aus Mozarts Klarinettenkonzert können wir – abgesehen von formaler Beschreibung – kaum benennen. Liegt dieses Stück jedoch unter der folgenden Handlung, kommen wir der Sache schon näher. „Padre, Padrone“, Mein Vater, mein Herr, heißt ein Film der Gebrüder Paolo und Vittorio Taviani, der auf einem authentischen Geschehen beruht. Ein armer Bauer auf Sardinien – ganz urgeschichtlicher Patriarch - meldet seinen Sohn Gavino aus der Grundschule ab, er muss für ihn arbeiten. Am Tage und nachts einsam die Schafe in den Bergen hüten, Felder bewirtschaften, ein archaisches, elendes Leben. Der einzige Lichtblick für Gavino ist Musik, die er zum ersten Mal durch Wandermusikanten kennen lernt, den Walzer aus der „Fledermaus“ auf einem Akkordeon. Die Spannungen zwischen dem Sohn und dem allmächtigen Vater nehmen zu, erst recht, als der Sohn vom Militärdienst zurückkehrt, wo er sich ein Radio gebaut hat. Wir sehen den Vater nachdenklich auf dem Feld stehen, dann spricht er zu seinem Maultier: „Jetzt gehe ich nach Hause und bringe ihn um.“ Der Vater eilt über den kärglichen Acker, und mit dem Schnitt dieser Einstellung setzt die Musik Mozarts ein. Bei der Wiederholung des Themas im Orchester beginnt der Vater zu laufen. Schnitt. Er lauscht an der Tür seines Sohnes. Der sitzt in seinem Zimmer und hört das Konzert aus einem kleinen Radio. Wortlos tritt der Vater ein, das Thema erscheint im Solo. Er wäscht sich die Hände in einem Becken voll Wasser, ein Teller Suppe wird in Großaufnahme auf den Tisch gestellt, alles mit lauten Geräuschen verbunden, die die leise Musik stören. Bevor der Vater den ersten Löffel zu sich nimmt, spricht er zu dem erwachsenen Sohn: „Mach das Radio aus, oder ich schlage dich grün und blau.“ Der Sohn erhöht die Lautstärke, ergreift den Vater und drückt ihn zu Boden, lässt ihn aber wieder hochkommen. Beide Männer stehen sich gegenüber, als der Vater plötzlich das Radio ergreift und es im Wasserbecken versenkt. Der Sohn ersetzt die verstummte Musik, indem er das Thema pfeift. „Was pfeifst Du„, entgegnet der Vater“, „schlag doch zu.“ Das tut Gavino dann auch. Nun lauscht die Mutter an der Tür und hört drinnen den atavistischen Kampf zwischen Vater und Sohn, bei dem sie – mit Musik – die Partei des Vaters ergreift: Sie singt ein sardisches Volkslied. Weit mehr als in „Außer Atem“, „Jenseits von Afrika“, „Greencard“ oder den anderen Streifen, die sich des Mozartschen Klarinettenkonzerts bedienen, tritt in „Padre, Padrone“ durch den filmischen Kontext hindurch sein Inhalt hervor. In diesem sozialen Milieu aus Unterdrückung, Angst und Brutalität, in dieser Welt, wo Menschen wie die Tiere leben, ist Kunstmusik erst recht der Vorschein eines ganz Anderen, das Symbol für Humanität. Deshalb will der Vater sie mit aller Gewalt ausmerzen, wogegen sich der Sohn zur Wehr setzt. Am Ende des Films ist aus Gavino, der als Analphabet seine Kindheit und Jugend einsam und wortlos mit den Schafen verbracht hat, ein Professor der Sprachwissenschaft geworden. Mozart: Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur, KV 622, 2. Satz 6’50“ Wolfhard Pencz, Bassettklarinette, SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Ltg. Michael Gielen INT 830.868 LC 04226 Das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, geleitet von Michael Gielen, spielte den langsamen Satz aus dem Klarinettenkonzert KV 622 von Mozart. Der Solist war Wolfhard Pencz. Noch märchenhafter als die Entwicklung in „Padre, padrone“ ist der Schluss von „Pretty Woman“ (Regie: Garry Marshall). Steinreicher Finanzmann (Richard Gere) bändelt auf einer Geschäftsreise in Los Angeles mit einer hübschen, charmanten, klugen Prostituierten an (Julia Roberts). Zu ihren Unternehmungen zählt ein gemeinsamer Opernbesuch. Auf dem Programm steht – natürlich – Verdis „La Traviata“, die vom Wege Abgekommene. Doch beide wissen, diese Beziehung kann nicht von Dauer sein, sie trennen sich. Er lässt sich zum Flughafen fahren, sie ist zurück in ihrer heruntergekommenen Behausung. Ein melancholisches Ende, wenn der Held nicht seinen Entschluss ändern würde. Er dreht um, kauft einen Blumenstrauß, fährt zu ihrer Wohnung, der Chauffeur hupt, die strahlende Roberts erscheint am Fenster, der Held klettert mit den Blumen zwischen den Zähnen die Feuerleiter hinauf, finale Umarmung. Das ist so schön wie die Musik, die dazu erklingt, das Duettino aus dem zweiten Akt mit den Schlussworten: „Liebe mich wie ich dich liebe in Ewigkeit.“ Verdi: La Traviata, 2. Akt, Nr. 9, Duettino 2’30“ Teresa Stratas, Sopran, Fritz Wunderlich, Tenor, Bayrisches Staatsorchester, Ltg. Guiseppe Patané Orfeo C 344932 LC 08175