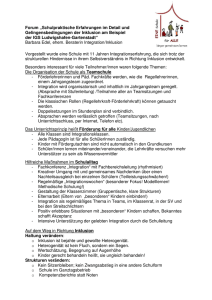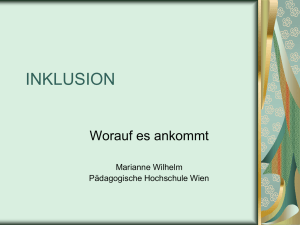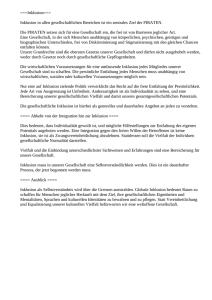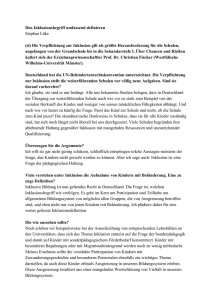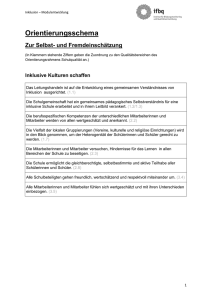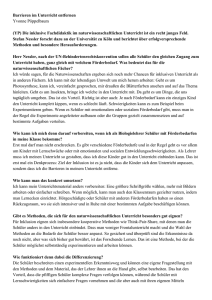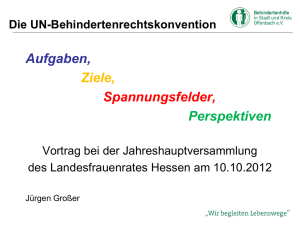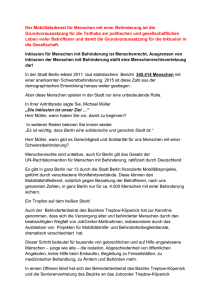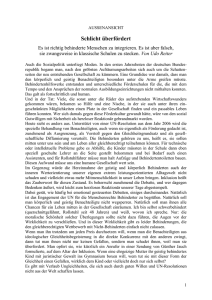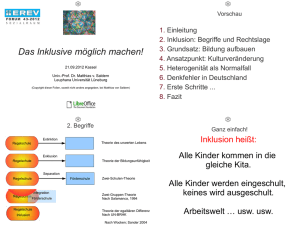Momentaufnahmen, Erkenntnisse und Folgerungen aus dem Projekt
Werbung

„Auf dem Weg zu einer inklusionsorientierten Arbeit in der Diakonie Württemberg“ Momentaufnahmen, Erkenntnisse und Folgerungen aus dem Projekt Inklusion Oktober 2012 bis September 2015 Erkundungen und Erkenntnisse Der gemeinsame Weg von Diakonischem Werk und Evangelischer Landeskirche in Württemberg hat sich gelohnt. Das Ringen um ein gemeinsames Verständnis von Inklusion, die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, die kritische Reflexion und das offene Abwägen von Chancen und Grenzen haben das Projekt geprägt und vieles in Bewegung gebracht. Inklusion wird in einem weiten Sinne verstanden, im Blick sind alle Menschen mit eingeschränkten Teilhabechancen. Um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, braucht es die Sensibilisierung für jegliche Art von Ausgrenzung und Barrieren, die Förderung von Selbstartikulation und Selbstorganisation sowie die Entwicklung inklusionsorientierter Haltungen und Handlungsformen. Dies verlangt einen Kulturwandel durch entsprechende Veränderungsprozesse von Einrichtungen und Systemen. Der Dank gilt der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und der Lechler-Stiftung für die großzügige Unterstützung und allen Ehrenamtlichen, die das Projekt im Zeitraum Oktober 2012 bis September 2015 entscheidend mitgestaltet haben. Inklusion lebt von Beteiligung. Die angemessene Beteiligung von Menschen mit eingeschränkten Teilhabechancen ist Voraussetzung für das Gelingen von Inklusion. Sie ist weit mehr als ein „Mit-DabeiSein“. Sie braucht klare Regelungen und Rahmenbedingungen, denn Assistenz, Publikationen in leichter Sprache oder Gebärdensprach-Dolmetscher kosten Geld. Beteiligungsprozesse erfordern wechselseitige Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, sich auf längere Prozesse einzustellen. Beteiligung verändert Bilder voneinander, fördert das gegenseitige Verständnis, macht aber auch Grenzen deutlich. Angemessene Beteiligung heißt: Es ist jeweils zu klären, wer, wo, wann und wozu beteiligt werden soll. Menschen mit Behinderung haben bei mehreren Veranstaltungen deutlich gemacht, dass sie von einer „Pseudo-Beteiligung“ nichts halten und sich für die Teilhabe von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf stark gemacht. Alle von Ausgrenzung betroffenen Menschen sind im Blick. Im Projekt standen Menschen mit Behinderungen und psychischen Beeinträchtigungen im Mittelpunkt. Doch auch arme, arbeitslose, wohnungslose, alte Menschen, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder Menschen mit Migrationshintergrund sowie Flüchtlinge sind an vielen Stellen von Exklusion betroffen. Sie haben die Sorge, nicht genügend im Blick zu sein, wenn sich Aufmerksamkeit und Finanzmittel auf die Inklusion von Menschen mit Behinderung oder auf Flüchtlinge konzentrieren. Inklusion muss alle von Ausgrenzung betroffenen Menschen und ihre jeweiligen Bedarfe im Blick haben. Arbeiten zu können im Sinne einer sinnvollen Beschäftigung ist eine zentrale Teilhabekategorie in unserer Gesellschaft. Arbeiten, sich einbringen und etwas beitragen können, ist eine Frage des Selbstwertes und Selbstbildes. Inklusion lässt die wenigsten kalt. Zu unseren Erfahrungen gehört, dass das Schlagwort Inklusion vielfältige Reaktionen auslöst und kaum jemanden kalt lässt. Die einen sehen darin ein berechtigtes, auch biblisch begründetes Anliegen. Andere sprechen von einem ideologisch aufgeladenen Begriff, der eine sachgerechte Diskussion verhindere. Spannend war hier unsere Diskussion über die „Grenzen von Inklusion“. Dabei wurde herausgearbeitet, dass der Rechtsanspruch durch die UN-Behindertenrechtskonvention nicht zur Disposition stehen darf. Dass jedoch über Umfang, Geschwindigkeit und benötigte personelle und finanzielle Ressourcen zu diskutieren ist. Diese Auseinandersetzungen dienen der Klärung von berechtigten Interessen und Möglichkeiten der Umsetzung. Das „Konturenpapier eines diakonischen Verständnisses von Inklusion“ hat hier wichtige begriffliche Unterscheidungen und tragfähige Perspektiven für Teilhabegerechtigkeit entwickelt. Sie gründen im Verständnis des Menschen als Ebenbild Gottes und einer von allen Zuschreibungen unabhängigen Würde. Inklusion braucht fachübergreifende Kooperation. Inklusionsorientierung ist ein Prozess, der viele zielgerichtete und koordinierte Schritte braucht. Hier trugen die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, die ausgeprägte Orientierung am Gemeinwesen und die Förderung von Kooperationen vor Ort zum Projekt-Erfolg bei. Eine Erkenntnis ist deshalb: Inklusion braucht fachübergreifende Kooperation, vernetze Akteure, gesammeltes Know-how, unterschiedliche Perspektiven und Koordination. Hier hat das im Rahmen des Projektes gegründete „Netzwerk Inklusion in der Landeskirche“ (NIL) das vernetzte Denken und Handeln in Landeskirche und ihrer Diakonie vorangebracht. Regel- und Sondersysteme sind neu auszubalancieren. Für diakonische Einrichtungen der Behindertenhilfe ist die politisch gewollte Dezentralisierung eine Herausforderung, der sie sich stellen. Sie bestehen jedoch zurecht darauf, dass für den dafür notwendigen Umbau finanzielle Mittel bereit gestellt werden und neue Formen der Leistungserbringung refinanziert werden. Wenn beispielsweise eine Nachtwache nicht mehr für 50 sondern ‘nur‘ noch für 12 oder 24 Menschen zuständig ist, muss sich auch die bisherige Finanzierungslogik ändern. Dazu ist ein allgemein gültiges, fachlich anerkanntes Instrument erforderlich, um den individuellen Bedarf messen zu können. Angehörige schwerst mehrfach behinderter Menschen sorgen sich um eine verlässliche Unterstützung, wenn vertraute Einrichtungen verkleinert oder komplett aufgegeben werden. Im Projekt wurde deutlich, dass genau geprüft werden muss, wer welche Unterstützungs-Bedarfe hat und wie leistungsfähige und bedarfsgerechte Strukturen aussehen müssen, die Selbstbestimmung und Wahlfreiheit ermöglichen. Es müssen noch viele Barrieren beseitigt werden. Nach wie vor behindern bauliche und sprachliche Barrieren die Wahrnehmung selbstbestimmter Teilhabe. Vielerorts ist Barrierefreiheit nur unvollständig umgesetzt, entsprechen Gebäude nicht den gängigen DIN-Normen. Oftmals erschweren schon kleine Schwellen den ungehinderten Zugang. Viel ist noch zu tun, damit Menschen mit Hör- und Sehbehinderungen mit Hilfe technischer Unterstützung Informationen auch erfassen können. Nicht zuletzt schließen fehlende Angebote in leichter Sprache viele Menschen von Informationen und von Wissen aus. Auf den Anfang kommt es an. Eine inklusive Gesellschaft baut auf einer gemeinsamen Erziehung, Bildung und Betreuung aller Kinder auf. Inklusionsorientierung bedeutet, dass alle in höchstmöglichem Maß gemeinsam aufwachsen, lernen und leben können. Gleichzeitig muss aber jede und jeder Einzelne die für sie oder ihn notwendige Förderung und Unterstützung bekommen. Die Kunst des Zusammenlebens verschiedener Menschen will gelernt sein, am besten von Anfang an. Hier ist es im Projekt gelungen, den Gesetzgebungsprozess für ein inklusives Schulgesetz in Baden-Württemberg mitzugestalten. traits von Projekten und Vorhaben in Diakonie und Landeskirche erstellt (www.diakonie-wue.de/inklusion). Hier wird deutlich: Unsicherheiten lassen sich am besten mit Begegnungen überwinden. Diese helfen, Vorurteile abzubauen und führen dazu, Haltungen und Wertvorstellungen zu überdenken. Für Rückenwind sorgte die Mitarbeit am Schwerpunkttag der Sommersynode 2013, am „Wort des Landesbischofs zur Inklusion“ sowie am Film „Fremdwort Inklusion“. Inklusion ist kein Selbstläufer. Nächster Schritt ist ein Gesamtkonzept Inklusion. Wie die Einrichtungen der Behinderten- und Jugendhilfe sind auch Kirchengemeinden in der Regel offen für Inklusion, fühlen sich aber häufig überfordert. Dies zeigte eine Umfrage, an der sich über 500 Pfarrämter beteiligten. Deshalb haben wir im Projekt zielgerichtete und überschaubare Schritte aufgezeigt und Unterstützung angeboten. Wir haben Por- Das Projekt hat gezeigt, dass ein breit und systematisch angelegtes Gesamtkonzept Inklusion für die Landeskirche und ihre Diakonie der konsequente nächste Schritt ist auf dem Weg zu einer inklusiven Kirche. Im Projekt gemachte Erfahrungen und geknüpfte Wissens-Netzwerke können so in die Breite kommen, nachhaltig genutzt und vermehrt werden. Folgerungen und Empfehlungen Für die Landeskirche und ihre Diakonie: Inklusion wird in kirchlicher und diakonischer Arbeit in unterschiedlicher Weise gelebt. Um Inklusion systematisch, zielorientiert und nachhaltig voranzubringen, braucht es jedoch einen handlungsfeldübergreifenden Aktionsplan, der die verschiedenen Bemühungen um Inklusionsorientierung reflektiert, koordiniert und in einem systematischen Gesamtkonzept zusammenführt und weiterentwickelt. Inklusion braucht Kümmerer, Brückenbauer und Ressourcen. Deshalb hat die Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren eine große Bedeutung für die weiteren Prozesse, ebenso die Bereitstellung entsprechender Mittel und die Beratung von Kirchengemeinden vor Ort. Inklusion benötigt, wenn sie gelingen soll, die Orientierung am Gemeinwesen. Lebensräume inklusiv zu gestalten, erfordert die Vernetzung von Akteuren vor Ort und eine Zusammenführung verschiedener Themen wie Quartiersentwicklung, Teilhabe an Arbeit, Gesundheit oder Migration. Wichtig ist, dass sich Kirchengemeinden und soziale Institutionen als Teil des Gemeinwesens begreifen, sich mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren vernetzen und in kommunale Teilhabeplanungen einbringen. Prozesse der Konversion bieten die Chance zu verstärkter Zusammenarbeit von diakonischen Einrichtungen und Kirchengemeinden. „Kirche mit allen“ im Sinne von Galater 3, 28 könnte das Leitbild bei der Förderung einer inklusiven Kultur in Kirche und ihrer Diakonie sein, das zu einer Offenheit für den Umgang mit Anders-Sein und Vielfalt motiviert Hier haben unter anderem die Veranstaltungen von „Miteinander Kirche sein“ und „Empowerment“ schon vieles vorangebracht. Diakonie und Kirche sollten im Sinne einer Selbstverpflichtung langfristig dafür sorgen, dass Gebäude und Veranstaltungen so gut wie möglich barrierefrei erreichbar und nutzbar sind sowie Informationen so aufbereitet sind, dass sie von möglichst vielen Mitgliedern der Gesellschaft genutzt werden können. Für Politik und Gesellschaft: Die Bemühungen um eine Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Kampagnen wie die von der Liga mitgestaltete Inklusionskampagne „DuIchWir“ wollen Bewusstsein schaffen. Behindertenbeauftragte auf Landes- und Kommunalebene sollen notwendige Prozesse zielführend koordinieren. Inklusion gibt es nicht zum Nulltarif. Damit Menschen mit Behinderung die ihnen garantierten Rechte auch wahrnehmen können, braucht es entsprechende Ressourcen. Mittel für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention müssen bereitgestellt werden, um beispielsweise den Umbau von Regel- und Sondersystemen im sozialen und Bildungsbereich ohne Verlust an Qualität bewältigen zu können. Damit Beteiligung keine Worthülse bleibt, sind unterstützende Rahmenbedingungen notwendig. Assistenz muss professionalisiert und bezahlt werden. Menschen mit Behinderungen können wichtige Aufklärungsund Lobbyarbeit leisten und müssen gegebenenfalls für ihre Mitarbeit eine Aufwandsentschädigung erhalten. Sie brauchen entsprechende Rahmenbedingungen und personelle Ressourcen, um sich selbst im politischen Raum vertreten und Verantwortung übernehmen zu können. Die forcierte gesellschaftliche Teilhabe und Ermöglichung von Wunsch- und Wahlrechten darf nicht zu einer vorschnellen Auflösung bewährter Förder- und Spezialeinrichtungen führen. Es braucht eine sorgfältige Neujustierung des Verhältnisses von allgemeiner und spezifischer Infrastruktur und der Zusammenarbeit von Regel- und Sondersystemen. „Alle gemeinsam“ als alleiniges Leitbild reicht nicht. Inklusionsorientierung bedeutet, dass alle in höchstmöglichem Maße gemeinsam aufwachsen, lernen und leben, gleichzeitig aber auch jede und jeder Einzelne die für sie oder ihn notwendige Förderung und Unterstützung erhält. In diesem Sinne ist eine von Anfang an inklusionsorientierte Bildung, Erziehung und Förderung grundlegend für eine Gesellschaft der Vielfalt. Baugrundstücken und Fördermitteln erbracht werden. Das gilt auch für die Teilhabe an Arbeit in verschiedensten öffentlich geförderten und unterstützten Formen. Eine große Herausforderung für die Politik besteht darin, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen für von Ausgrenzung betroffene Gruppen wie Menschen mit Behinderung und psychisch Kranke, arme Familien, Wohnungslose, Arbeitslose oder Flüchtlinge. Hierauf sollten von Politik und Gesellschaft große Anstrengungen in Form von Programmen, Leitende Vision könnte das Bild einer solidarischen und gerechten Gesellschaft sein, in der es „normal ist, verschieden zu sein“ (Richard von Weizsäcker). Bis dahin ist es noch ein weiter Weg vielfältiger kleiner und großer Schritte. Stuttgart, im Oktober 2015 Strategiegruppe Projekt Inklusion Projektergebnisse, Arbeitshilfen und Veranstaltungs-Dokumentationen stehen unter www.diakonie-wue.de/inklusion zum Download bereit. Herausgeber Diakonisches Werk Württemberg, Heilbronner Straße 180, 70191 Stuttgart Kontakt: Wolfram Keppler Tel. 0711/1656 167; [email protected] Lechler Stiftung