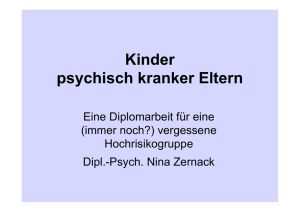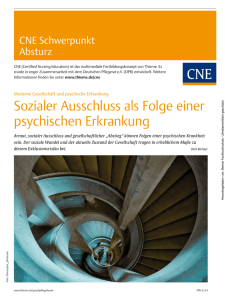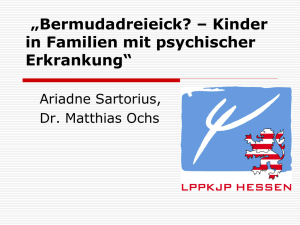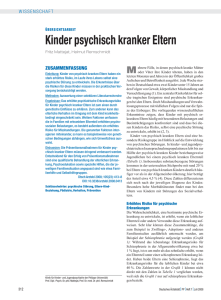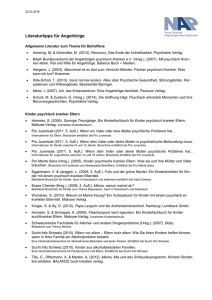Titel Interventionen für Kinder psychisch kranker Eltern Abstract In
Werbung
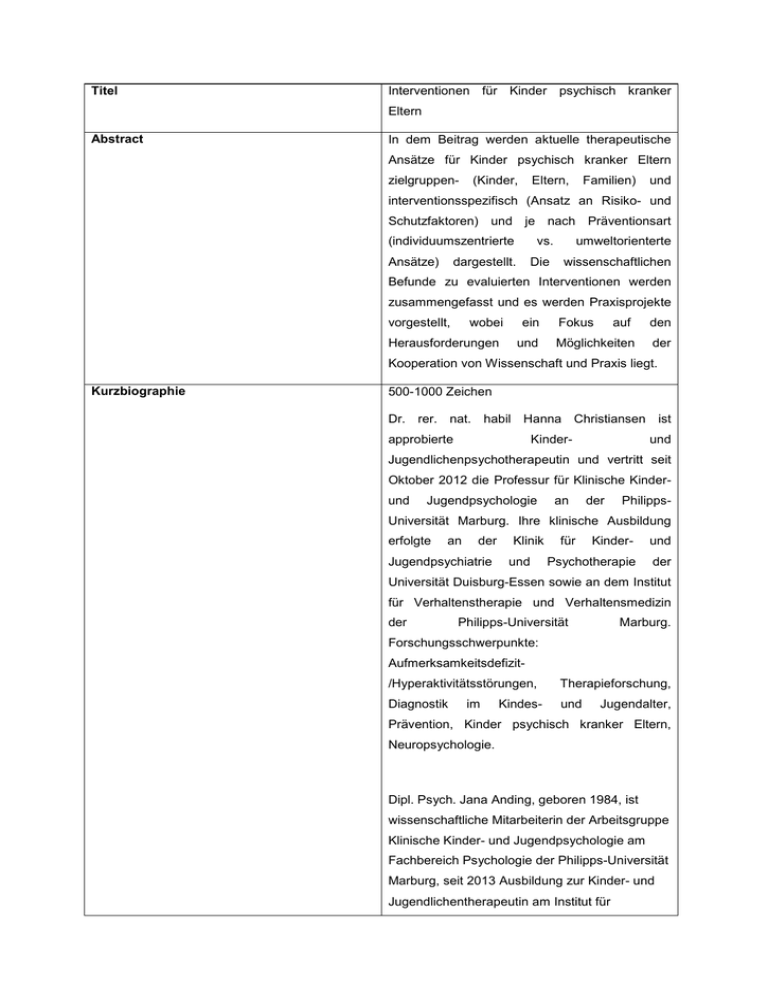
Titel Interventionen für Kinder psychisch kranker Eltern Abstract In dem Beitrag werden aktuelle therapeutische Ansätze für Kinder psychisch kranker Eltern zielgruppen- (Kinder, Eltern, Familien) und interventionsspezifisch (Ansatz an Risiko- und Schutzfaktoren) und je nach Präventionsart (individuumszentrierte Ansätze) dargestellt. vs. umweltorienterte Die wissenschaftlichen Befunde zu evaluierten Interventionen werden zusammengefasst und es werden Praxisprojekte vorgestellt, wobei Herausforderungen ein und Fokus auf Möglichkeiten den der Kooperation von Wissenschaft und Praxis liegt. Kurzbiographie 500-1000 Zeichen Dr. rer. nat. habil Hanna Christiansen ist approbierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und vertritt seit Oktober 2012 die Professur für Klinische Kinderund Jugendpsychologie an der Philipps- Universität Marburg. Ihre klinische Ausbildung erfolgte an der Jugendpsychiatrie Klinik und für Kinder- und Psychotherapie der Universität Duisburg-Essen sowie an dem Institut für Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin der Philipps-Universität Marburg. Forschungsschwerpunkte: Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörungen, Therapieforschung, Diagnostik und im Kindes- Jugendalter, Prävention, Kinder psychisch kranker Eltern, Neuropsychologie. Dipl. Psych. Jana Anding, geboren 1984, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Klinische Kinder- und Jugendpsychologie am Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität Marburg, seit 2013 Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichentherapeutin am Institut für Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin der Philipps-Universität Marburg. Forschungsschwerpunkte: Postpartale psychische Belastungen von Müttern und Vätern, Kinder psychisch kranker Eltern. Dipl. Psych. Luisa Donath absolvierte ihr Psychologiestudium an der Philipps-Universität Marburg mit den Schwerpunkten Pädagogische und Kinder- und Jugendpsychologie. Seit 2013 befindet sie sich in der Ausbildung zur Kinderund Jugendpsychotherapeutin am Institut für Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin in Marburg und forscht unter Prof. Hanna Christiansen in Marburg zu ADHS im Kindesalter. Hanna Christiansen, Jana Anding, Luisa Donath Interventionen für Kinder psychisch kranker Eltern Einleitung Nach internationalen Studien versorgen zwischen 23 bis 32 % der erwachsenen psychiatrisch stationären Patienten Kinder unter 18 Jahren (Fraser, 2006; Maybery et al., 2009; Östman & Hansson, 2002; Pretis & Dimova, 2008). Für Deutschland schwanken die Zahlen z. T. sehr stark (9 – 61 %; Lenz, 2007; Mattejat & Remschmidt, 2008; siehe auch Lenz in diesem Band). Legt man die Zahl der Familien und Raten psychisch Erkrankter zusammen, so kann von 3.8 Millionen betroffener Kinder und Jugendlicher ausgegangen werden (Statistisches Bundesamt, 2006; Röhrle & Christiansen, 2009; Wittchen, 2000). Eine eigene Auswertung von Basisdokumentationsdaten (BADO) dreier großer Fachkliniken (die Vogelsbergklinik im hohen Vogelsberg, die Schön-Kliniken in Bad Arolsen und die ElbeKliniken in Stade) von 15904 Patienten und Patientinnen ergab, dass insgesamt 65 % der stationären Patienten Kinder haben und zwischen 50 - 94 % der Kinder bei ihren Eltern leben (Christiansen, 2012a). Die häufigsten psychischen Erkrankungen der Eltern stellen dabei depressive und affektive Erkrankungen dar. Ein Vergleich mit der Normalbevölkerung (Beziehungs- und Familienpanel pairfam; http://www.pairfam.de/) zeigt allerdings, dass Eltern mit psychischen Erkrankungen signifikant weniger Kinder haben (Bauer & Pierchalla, 2013): Von den 25-27-Jährigen der Normalbevölkerung haben im Durchschnitt 27.8 % und von den 35-37-Jährigen 75.2 % Kinder; von den 25-27-jährigen Patienten haben hingegen je nach Klinik nur zwischen 6 und18.9 % und von den 35-37-Jährigen nur zwischen 40.9 und 69.2 % Kinder (Bauer & Pierchalla, 2013). Obschon Patienten mit psychischen Störungen demnach weniger häufig Kinder haben, gehen diese elterlichen Erkrankungen mit einer Vielzahl von Entwicklungsrisiken für die Kinder einher. So zeigten in unserer Studien 15 38.4 % der Kinder psychisch kranker Eltern bereits selbst wieder psychische Auffälligkeiten (Christiansen, 2012a). Nach internationalen Studien entwickeln zwischen 41-77 % der Kinder psychisch kranker Eltern schwere psychische Störungen im Verlauf ihres Lebens (review Hosman et al., 2009; Wille et al., 2008; Greif Green et al., 2010; Kersten-Alvarez et al., 2011; Kessler et al., 2010). Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist das Risiko, psychisch zu erkranken für diese Kinder je nach Störung der Eltern bis zu achtfach erhöht (review: Hosman et al., 2009). Dies zeigt sich bereits im Kindes- und Jugendalter: 48.3 % der Patienten in kinder- und jugendpsychiatrischer Behandlung haben ein Elternteil mit einer schweren psychischen Störung (Mattejat & Remschmidt, 2008). Weitere Risikofaktoren dieser Kinder sind eine erhöhte Kindersterblichkeit, unsichere Bindungsmuster, Entwicklungsverzögerungen und –störungen und eine insgesamt schlechtere schulische Leistung und Anpassung. Transgenerationale Transmission psychischer Störungen Wie kommt es zu diesen erhöhten Raten psychischer Erkrankungen bei den Kindern psychisch kranker Eltern? Welche Risikofaktoren wirken sich wie auf die kindliche Entwicklung aus, so dass es zu Störungen kommen kann? Aufbauend auf dem Modell von Goodman & Gotlib (1999) haben Hosman et al. (2009) dazu ein Modell der transgenerationalen Transmission psychischer Störungen aufgestellt. Danach werden zunächst vier großen Bereiche, 1) die elterliche Ebene, 2) die familiäre Ebene, 3) die Kindebene und 4) die Ebene des sozialen Umfeldes unterschieden, die mit ihren jeweiligen Systemen miteinander interagieren. Weiter werden fünf Transmissionsmechanismen unterschieden und zwar 1) genetische, 2) pränatale, 3) die Eltern-Kind-Interaktion, 4) familiäre und 5) soziale Einflüsse außerhalb der Familie. Die kindlichen Entwicklungsphasen werden berücksichtigt und es wird angenommen, dass mit jeder Entwicklungsphase spezifische Prozesse und Aufgaben verbunden sind, die spezifisch mit den vier Ebenen und fünf Transmissionsmechanismen interagieren. Schließlich werden die Konzepte der Äquiund Multifinalität in dem Modell berücksichtigt. Damit ist gemeint, dass eine spezifische Störung das Resultat verschiedener Ursachen sein kann (Äquifinalität) bzw. ein spezifischer Risikofaktor sich auf unterschiedlichste Weise manifestieren kann (Multifinalität). Im Folgenden werden die unterschiedlichen Komponenten des Modells sowie Befunde aus der Forschung dazu dargestellt. Abbildung 1: Transgenerationale Transmission psychischer Störungen. Aus Hosman et al. (2009), S. 253 Risikofaktoren Elterliche Faktoren Verschiedene Studien konnten zeigen, dass Kinder von Eltern mit rezidivierenden oder chronischen Störungen ein erhöhtes Risiko haben, selber zu erkranken, im Vergleich zu Kindern, deren Eltern nur eine isolierte Episode durchlaufen haben (Ashman et al., 2002; 2008; Beardslee et al., 1987; Foster et al., 2008; Horwitz et al., 2007; Halligan et al., 2007). Weiter haben Kinder von Eltern, die an mehreren Störungen erkrankt sind, also hohe Komorbiditäten aufweisen, ebenfalls ein größeres Erkrankungsrisiko im Vergleich zu Eltern, die an einer isolierten Störung leiden (Goodman, 2007; Kim-Cohen et al., 2006). In verschiedenen Studien konnte ferner gezeigt werden, dass Kinder ebenfalls einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, wenn beide Eltern psychisch erkrankt sind (Bijl et al., 2002; Birmaher et al., 2009; Clark et al., 2004; Stelzig-Schöler et al., 2011). Dabei sind neben klassischen psychologischen Faktoren wie bspw. dem Modelllernen auch genetische Faktoren relevant und Faktoren wie die assortative Paarung, d. h. die Bevorzugung von Partnern, die einem selber sehr ähnlich sind, so dass dann u. U. genetische Risikofaktoren von beiden Eltern zum Tragen kommen können (Mattejat & Remschmidt, 2008). Beginnt die elterlichen Erkrankung vor dem 30. Lebensjahr, erhöht sich das Erkrankungsrisiko für die Kinder drastisch und auch hier wird angenommen, dass zum einen genetische Faktoren zum Tragen kommen und sich zum anderen aversive psychosoziale Lebensumstände, wie sie z. B. mit Teenagerschwangerschaften in Zusammenhang gebracht werden, negativ auswirken (Kluth et al, 2010; Wickramaratne & Weissman, 1998). Stress und Verlust in der Schwangerschaft wirken sich insbesondere im ersten Trimenon ungünstig aus und wurden in einigen Studien mit späteren psychotischen Erkrankungen der Kinder in Zusammenhang gebracht (Goodman, 2007; Khashan et al., 2008; Kim-Cohen et al., 2006; Malaspina et al., 2008). Familiäre Faktoren Ein vielfach replizierter Befund zeigt, dass elterliche psychische Störungen oftmals mit reduzierten elterlichen Fähigkeiten insbesondere geringerer Feinfühligkeit und reduzierten Erziehungskompetenzen zusammenhängen und dies wiederum Bindungsstörungen sowie Störungen der Emotionsregulation und langfristig internalisierende und externalisierende Störungen der Kinder begünstigt (Bifulco et al., 2002; Duggal et al., 2001; Elgar et al., 2007; Harnish et al., 1995; Hippwell et al., 2000; Leinonen et al., 2003; Lovejoy et al., 2000; Maughan et al, 2007; Murray et al., 2003; Rogosch et al., 2004). Pathologisches elterliches Modell- und Bewältigungsverhalten kann dazu führen, dass dieses von den Kindern übernommen wird und Kinder dann z. B. selber Substanzen zur Emotionsregulation nutzen (Sidebotham & Heron, 2006; Chronis et al., 2007). Und schließlich konnte in verschiedenen Studien gezeigt werden, dass familiäre Disharmonie, häusliche Gewalt, finanzielle Schwierigkeiten und kritische Lebensereignisse wie z. B. der Verlust eines Elternteils die Auswirkungen der elterlichen psychischen Erkrankung auf die Kinder weiter verstärken und zu ungünstigeren Entwicklungsausgängen der Kinder beitragen können (Ashman et al., 2002; 2008; Beardslee et al., 1987; Foster et al., 2008; Horwitz et al., 2007; Halligan et al., 2007; Wille et al., 2008). Faktoren auf der Kindebene Vulnerable Kinder zeichnen sich gegenüber resilienten Kindern durch eine Reihe von Faktoren aus, die ihr Erkrankungsrisiko erhöhen. Z. B. wurde Delinquenz mit den Temperamentsfaktoren einer hohen Verhaltensaktivierung, geringen Hemmung und sozialen Ansprechbarkeit in Verbindung gebracht. Störungen in der emotionalen Entwicklung/geringe Emotionsregulationsfertigkeiten, erhöhte Stressreaktivität, unsichere Bindung, negativer Selbstwert, geringe kognitive und soziale Fertigkeiten sowie ein geringes Wissen über die elterliche psychische Erkrankung sind weitere Faktoren, die mit einem erhöhten Entwicklungsrisiko für Verhaltensauffälligkeiten der Kinder einhergehen (reviews: Beardslee & Podorefsky, 1998; Goodman & Gotlib, 1999; Gopfert et al., 2004; Hosman et al., 2009; Ijzendoorn et al., 1992). Im 13. Kinder- und Jugendbericht (http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/13-kinderjugendbericht,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf) wird festgestellt, dass betroffene Kinder oft nicht über die elterliche Erkrankung aufgeklärt werden und dies u. a. zu Schuldgefühlen und Ängsten führen kann. Die vertrauten, bekannten Eltern zeigen für die Kinder fremde, nur schwer verständliche Verhaltensweisen und werden für sie „unverstehbar“. Insbesondere Symptome der Eltern, wie z. B. die erhöhte Reizbarkeit und gedrückte Stimmung Substanzabhängigkeiten, bei Depression oder Persönlichkeitsstörungen impulsive oder Durchbrüche bei Aufmerksamkeitsdefizit- /Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) des Erwachsenenalters, werden von den Kindern oftmals als Reaktionen auf ihr eigenes Verhalten interpretiert. Die Kinder nehmen an, dass sie etwas falsch gemacht haben und die Mutter/der Vater deshalb wütend, ärgerlich, reizbar oder zurückgezogen und traurig ist (Christiansen, 2012b). Auf Kindebene kommen ferner genetische Faktoren zum Tragen. Zum einen spielt Vererbung eine Rolle (s. o. elterliche Risikofaktoren), zum anderen kommen epigenetische Prozesse zum Tragen, die beispielhaft an zwei Studien veranschaulicht werden. In einer Studie von Caspi et al. (2003) konnte gezeigt werden, dass Kinder, die zweimal das kurze Allel des Serotonin-Transportergens aufwiesen sowie in der Kindheit Misshandlungserfahrungen gemacht hatten, ein deutlich erhöhtes Risiko für eine depressive Episode im Erwachsenenalter aufwiesen verglichen mit Kindern, die mit zwei langen Allelen des Gens ausgestattet waren (siehe Abbildung 2). Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Misshandlung in der Kindheit, dem SerotoninTransportergen und der Wahrscheinlichkeit, an einer depressiven Episode zu erkranken. Aus Caspi et al. (2003), S. 388 In einer nachfolgenden Studie von Uher et al. (2011) konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass dies v. a. auf rezidivierende/chronische depressive Störungen zutrifft und nicht bedeutsam mit einzelnen depressiven Episoden zusammenhängt, der Effekt also differenziell für spezifische Subtypen ist (siehe Abbildung 3). Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Misshandlung in der Kindheit, SerotoninTransportergen und einer persistierenden depressiven Störung vs. einer einzelnen depressiven Episode. Aus Uher et al. (2011), S. 59 Umwelt-/Kontextfaktoren Armut/prekäre Lebensbedingungen sind mit höheren Raten psychischer Störungen der Kinder assoziiert, wie auch z. B. das Aufwachsen in einem schlecht situierten Stadtteil, eine geringe Schulqualität, fehlende soziale Unterstützung und Stigmatisierung (Überblick in: Goodman & Gotlib, 1999; Hosman et al., 2009; Lenz & Schulz, 2008; O‘Connell, 2008; Rutter, 1999; 2009; Rutter & Quinton, 1977). Costello et al. (2003) konnten zeigen, dass Verbesserungen im Einkommen im vier Jahres Verlauf längsschnittlich mit einer Reduktion psychischer Störungen der Kinder einhergingen. In der Bella-Studie, dem Modul zur psychischen Gesundheit des Kinder- und Jugendsurveys zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (Wille et al., 2008) sowie in einer großen epidemiologischen Studie von Kessler et al. (2010) konnte nachgewiesen werden, dass die identifizierten Risikofaktoren (s. o.) kumulieren, d. h. je mehr vorliegen, desto höher ist die Rate psychischer Störungen und Auffälligkeiten bei den Kindern und Jugendlichen (siehe Abbildung 4). Abbildung 4: Zusammenhang zwischen der Anzahl Risikofaktoren und psychischen Störungen/Auffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen. Aus Wille et al. (2008), S. 139. Schutzfaktoren Ebenfalls auf den vier Ebenen (Eltern, Kind, Familie, Umwelt) des transgenerationalen Transmissionsmodell von Hosman et al. (2009) werden analog zu den Risikofaktoren Schutzfaktoren verortet. Als Schutzfaktoren konnten eine Reihe von Faktoren identifiziert werden, die oftmals das Gegenteil der Risikofaktoren sind, wie z. B. positive Temperamentsmerkmale (robust, aktiv, offen, kontaktfreudig) oder gute Emotionsregulationsfertigkeiten auf der Ebene des Kindes. Insbesondere die altersadäquate Aufklärung der Kinder über die elterliche Störung hat sich dabei als bedeutsamer Schutzfaktor erwiesen. Auf der elterlichen Ebene ist die angemessene Behandlung der elterlichen Störung zentral, auf familiärer Ebene die gemeinsame familiäre Krankheitsbewältigung und Kommunikation und hinsichtlich des sozialen Umfelds hat sich vor allem die soziale Unterstützung als ein zentraler Schutzfaktor erwiesen (Gladstone et al., 2006; Lenz, 2007; Pretis & Dimova, 2008; Röhrle & Christiansen, 2009). Tabelle 1 gibt einen Überblick über die identifizierten Schutzfaktoren getrennt für die verschiedenen Ebenen. Tabelle 1: Schutzfaktoren, die auf den vier Ebenen Kind, Eltern, Familie, Umfeld zum Tragen kommen Ebene Kind Schutzfaktoren • robustes, aktives, kontaktfreudiges Temperament • emotionale Einfühlungs- und Ausdrucksfähigkeit • gute soziale Problemlösefähigkeiten • mindestens durchschnittliche Intelligenz • Selbstvertrauen, positives Selbstwertgefühl • hohe Selbstwirksamkeitserwartungen • ausreichende alters- und entwicklungsadäquate Aufklärung über die Erkrankung der Eltern • stabile Bindung an mindestens eine primäre Bezugsperson Eltern Familie • angemessene Behandlung des erkrankten Elternteils • angemessene Krankheitsbewältigung • adäquater elterlicher Umgang mit der Erkrankung • gute Paarbeziehung • gute familiäre Krankheitsbewältigung • gute familiäre Kommunikation • Offenheit in der Familie im Umgang mit der Erkrankung • emotional positives, zugewandtes, akzeptierendes und zugleich angemessen forderndes, kontrollierendes und stabiles Erziehungs- und Familienklima Umfeld • Rituale • keine prekären Lebensumstände und -bedingungen • stabiles soziales Netz/soziales Unterstützungssystem • stabile Beziehungen außerhalb der Familie • Schule, Arbeit • Gemeindeaktivitäten, soziale Teilhabe Anschließend an die Studie von Caspi et al. (2003) konnten Kaufman et al. (2004) zeigen, dass bei zwei kurzen Allelen des Serotonin-Transportergens (s. o. Risikofaktoren) und Misshandlungserfahrungen in der Kindheit das Risiko für die Entwicklung einer depressiven Störungen durch soziale Unterstützung signifikant gemildert werden kann (siehe Abbildung 5), d. h. Schutzfaktoren können sich mildernd auf Risikofaktoren auswirken. Abbildung 5: Zusammenhang zwischen dem Serotonin-Transportergen, sozialer Unterstützung und Depressionswerten bei Probanden mit Misshandlungserfahrungen in der Kindheit. Aus Kaufman et al. (2004), S. 17319 Ähnlich wie bei den Risikofaktoren zeigt sich auch bei den Schutzfaktoren ein Kumulationseffekt, d. h. je mehr Schutzfaktoren vorliegen, desto geringer ist die Rate an psychischen Störungen und Auffälligkeiten bei den Kindern und Jugendlichen (Wille et al., 2008, siehe Abbildung 6). Abbildung 6: Zusammenhang zwischen der Anzahl Schutzfaktoren und psychischen Störungen/Auffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen. Aus Wille et al. (2008), S. 141. Betrachtet man den Zusammenhang von Risiko- und Schutzfaktoren, so zeigt sich, dass der Effekt dann am günstigsten ist, wenn viele Schutzfaktoren und nicht mehr als zwei bis drei Risikofaktoren vorliegen (siehe Abbildung 7). Abbildung 7: Interaktion von Risiko- und Schutzfaktoren und Rate psychischer Störungen/Auffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen. Aus: Wille et al. (2008), S. 142. Präventionsprogramme Die bestehenden Interventionen für Kinder psychisch kranker Eltern lassen sich analog zu dem Modell der transgenerationalen Transmission (Hosman et al., 2009) hinsichtlich der vier Ebenen Eltern/Familie, Kind und Umfeld differenzieren. Auf der Eltern-/Familien-/Kindebene dominieren individuumszentrierte selektive, d. h. an Risikopopulationen bzw. indizierte, d. h. an Populationen mit bereits bestehenden Auffälligkeiten gerichtete Programme. Auf der Umweltebene gibt es umweltorientierte Programme, die zum einen zwischen Interventionen für Fachkräfte, z. B. Ärzte, Psychologen/Psychotherapeuten und zum anderen Netzwerkinterventionen z. B. auf Gemeindeebene unterscheiden. Im Folgenden werden Befunde zu diesen Ebenen dargestellt. Gemeinsame Komponenten von Eltern-/Familien-/Kindprogrammen Fast alle Programme beinhalten Screenings, um das Risiko und die Versorgungssituation der Kinder einzuschätzen sowie Psychoedukation über Ursachen und Erscheinungsbilder der jeweiligen elterlichen Erkrankung, aber auch über die Risiken für die Kinder und entsprechende Hilfsmöglichkeiten, um Gefühle der Hilflosigkeit abzubauen. Innerfamiliäre Entlastungen können beispielsweise durch Trainings in Stressbewältigung, durch Erhöhung der Erziehungskompetenzen, durch Verbesserung der innerfamiliären Kommunikation oder auch durch den Aufbau eines familienexternen Betreuungssystems erfolgen, z. B. in Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe. Emotionsregulationstrainings können beim Ausleben und dem Abbau von Ängsten und Schuldgefühlen helfen, aber auch beim Aufbau positiven Selbstwerterlebens. Die Aktivierung familienexterner Kontakte trägt zu einer familiären Dezentrierung und damit einhergehenden größeren Autonomie der Kinder bei. Strukturelle Maßnahmen können die Herausnahme des Kindes aus der Familie sein. Therapie, Frühinterventionen und Rückfallprophylaxe bei den Eltern wirken entlastend auf die Kinder. Unterstützende Maßnahmen für die Eltern helfen beispielsweise, die Eltern in einem ambulanten Setting zu halten, stationäre Aufenthalte zu reduzieren und so die Interaktion mit den Kindern besser aufrechterhalten zu können. Häufig nimmt bei den Interventionen auch die Inanspruchnahme von psychosozialen Diensten ab, die Erziehungssituation für die Kinder verbessert sich und es zeigen sich langfristig Entwicklungsvorteile für die Kinder, wenngleich Maßnahmen dieser Art selten in randomisierten kontrollierten Studien untersucht wurden (Röhrle & Christiansen, 2009). Eine aktuelle Meta-Analyse (Siegenthaler et al., 2012) zu präventiven Interventionen für Kinder psychisch kranker Eltern identifizierte zunächst eine hohe Anzahl an Studien zu dem Thema (K = 4095), aber an qualitativ hochwertigen Studien mit belastbaren Ergebnissen, die quantitativ meta-analytisch ausgewertet werden können, verblieben nur 13 randomisiert kontrollierte Studien. Die Mehrzahl dieser Studien richtete sich an Eltern und es wurden vor allem Erziehungsfertigkeiten der Eltern trainiert. Vier der Studien basierten auf dem von Beardslee et al. (2009) entwickelten Programm „Hoffnung, Sinn und Kontinuität“, ein Familienprogramm, das Psychoedukation und die innerfamiliäre Kommunikation in den Vordergrund stellt und sich sowohl an die Eltern, die Kinder und die gesamte Familie richtet. Nur in zwei der in die Meta-Analyse eingegangenen Studien wurden kognitiv verhaltenstherapeutische Gruppenangebote für Jugendliche durchgeführt. Die Ergebnisse der Meta-Analyse zeigen, dass Interventionen für Kinder psychisch kranker Eltern insgesamt mit einer 40 % Risikoreduktion einhergehen und dies ein homogener Effekt ist. In einer eigenen Meta-Analyse zu dem Thema (Christiansen et al., in Vorbereitung; siehe auch Christiansen et al., 2010) konnten wir ebenfalls kleine bis mittlere, allerdings heterogene Effekte nachweisen. Interventionen für Kinder und Jugendliche resultierten in einer Reduktion der Verhaltensauffälligkeiten mit insgesamt robusten, aber kleinen Effekten (g = .346), die allerdings im Langzeit-Follow-up erhalten blieben (g = .338). Interventionen für Mütter und Säuglinge resultierten in heterogenen kleinen Effekten (g = .337), die sich im Verlauf der Zeit weiter verringerten. Prä-Post-Studien zeigten insgesamt mittlere und heterogenen Effekte (g = .691). Spezifische Interventionen für Kinder psychisch kranker Eltern im Vergleich zu keiner Intervention resultierten in einem kleinen aber homogenen Effekt (g = .240), wohingegen der Vergleich mit Treatment as Usual (TAU) moderate, allerdings heterogene Effekte (g = .542) produzierte. Studien, die eine intensive Intervention mit einer Minimalintervention verglichen, resultierten in kleinen homogenen Effekten (g = .192). Moderatoranalysen zeigten, dass eine hohe Studienqualität und Interventionen im Gruppensetting die Effekte reduzierten, wohingegen Effekte größer waren, wenn die Kinder noch keine Auffälligkeiten aufwiesen und klinisches Fachpersonal die Intervention durchführte. Insgesamt richtete sich die große Mehrzahl der Studien an Kinder von Eltern mit Depression und Substanzmissbrauch, wohingegen andere Störungsbilder vernachlässigt wurden. Insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Rate von Eltern mit affektiven Erkrankungen (s. o.), aber auch hoher Prävalenzen anderer Störungsbildern wie z. B. ADHS mit 5 % und zudem ausgesprochen hoher Heritabilität, sind dringend weitere Studien notwendig. Diese sollten breiter angelegt sein, die Zielgruppen genauer spezifizieren (ob Mutter-Säugling-Programme, Familienprogramme, Jugendlichenprogramme) und Wirkfaktoren theoretisch ableiten und überprüfen. Da zudem Komorbidität eher die Regel als die Ausnahme darstellt gilt es auch, allgemeine Störungspfade zu identifizieren, die einer Mehrzahl psychischer Störungen zugrunde liegen können (Multifinalität, s. o.), wie beispielsweise Emotionsregulationsdefizite (Berking, 2008). Interventionen, die solche allgemeinen Defizite in den Vordergrund stellen, könnten sich als wirkungsvoll erweisen, insbesondere auch hinsichtlich der Reduktion von Komorbiditäten und Risikofaktoren, da diese häufig in Clustern auftreten und präventive Programme, denen ein breites Wirkmodell zugrunde liegt, langfristig sehr viel effektiver sein können (The National Academies, 2009). Zukünftige Studien sollten demnach theoriebasiert sein, die Ergebnismaße genau spezifizieren, über ausreichende Teststärke zur Prüfung der Effekte verfügen, und mögliche Mediatoren wie z. B. die Akzeptanz der Intervention aber auch Moderatoren (z. B. sozioökonomischer Status, aktuelle elterliche Krankheitsepisode, isolierte vs. chronische etc., s. o.) berücksichtigen. Schließlich sind Implementations- und Disseminationsstrategien zu prüfen sowie die Effizienzstudien. Umweltebene Durchführung von über Effektivitätsstudien hinausgehenden Auf der Umweltebene können Interventionen unterschieden werden, die sich an Fachkräfte richten (Ärzte, Psychologen/Psychotherapeuten, Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe etc.) und solche, die sich an das soziale Netz richten. Ebene der Fachkräfte Auf Fachkräfteebene gibt es z. B. Projekte, wie das Projekt „Auryn“ in Leipzig, die regelmäßig in die Einrichtungen der Erwachsenenversorgung gehen und dort Vorträge und Workshops zu dem Thema Kinder psychisch kranker Eltern halten. Die Notwendigkeit, dieses Thema in die Einrichtungen der Erwachsenenversorgung zu tragen zeigt sich in einer Studie von Franz et al. (2012). An der Studie nahmen 186 Psychiater aus sieben Fachkliniken teil. Die Mehrzahl der befragten Ärzte wusste zwar, ob ihre Patienten Kinder haben, aber nur 34.5 % konnten angeben, wer die Kinder aktuell versorgt und nur 4.6 % konnten Angaben dazu machen, ob die Kinder ihre Eltern in der Klinik besuchten. Da in Studien nachgewiesen wurde, dass Kinder dann erhöhten Erkrankungsrisiken ausgesetzt sind, wenn sie wenig über die Erkrankung der Eltern wissen (s. o.). besteht hier die Möglichkeit, Angehörigeninformationen altersgerecht auch an Kinder zu vermitteln und diese so zu entlasten. Das Bewusstsein für die Kinder kann allerdings auch schon früher, beispielsweise in den ausbildenden Fächern geweckt werden. Allerdings zeigt eine Übersichtsarbeit von Herpertz-Dahlmann & Herpertz (2010), dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen erwachsenenpsychiatrischen und kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen gering oder nicht vorhanden ist. Dies ist schon für das Medizinstudium festzustellen: kinder- und jugendpsychiatrische Lehrveranstaltungen haben entweder einen sehr geringen Umfang oder sind z. T. sogar an einigen Fakultäten von der curricularen Lehre ausgeschlossen (Herpertz-Dahlmann & Herpertz, 2010). Die Dringlichkeit einer guten und vernetzen Zusammenarbeit zeigt sich dabei nicht nur in der Studie von Franz et al. (2012), sondern auch in der Studie von Mattejat & Remschmidt (2008), wonach knapp 50 % der kinder- und jugendpsychiatrischen Patienten ein psychisch krankes Elternteil haben (s. o.). Die Radboud Universität in Holland hat im Jahr 2009 eine über vier Jahre angelegte randomisierte kontrollierte Studie begonnen, das Basic Care Management (BCM). In diesem Programm werden Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen/des Jugendamtes trainiert, in belasteten Familien Unterstützung anzubieten und elterliche Kompetenzen zu stärken. Erste Pilotstudienergebnisse zeigen positive Effekte hinsichtlich einer Verbesserung des Elternverhaltens und einer Reduktion der Risikofaktoren der Kinder (van Doesum & Hosman, 2009). Ein solch niedrigschwelliges, aufsuchendes Angebot mit trainierten Fachkräften ist ein gutes Beispiel für eine gelungene präventive Intervention auf Fachkräfteebene. Netzwerkebene Auf dieser Interventionsebene existieren Programme zur Reduktion von Vorurteilen. Auf schulischer Ebene gibt es beispielsweise das Projekt „Verrückt – na und?! Seelisch fit in der Schule“, in dem ein Experte in eigener Sache und ein trainierter Mediator gemeinsam in Schulen gehen und dort über psychische Störungen aufklären (Richter-Werling, 2013; www.verrueckt-na-und.de). Dieses Projekt ist mittlerweile bundesweit verbreitet und stellt auch Materialien zur Verfügung (http://cms.irrsinnig- menschlich.de/unterseiten/materialien.html). Allerdings liegen hinsichtlich der möglichen positiven Auswirkungen dieses Anti-Stigma-Projektes auf die Kinder psychisch kranker Eltern noch keine Ergebnisse vor. Studien zu Selbsthilfegruppen konnten zeigen, dass angeleitete Selbsthilfegruppen z. B. der Krankenkassen oder von Verbänden wie z. B. der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder psychisch kranker Eltern oder auch entsprechende Angebote über das Internet effektiv sind und sich positiv auf die psychische Gesundheit auswirken, im Vergleich zu einer reinen Wartekontrollgruppe (Kling et al., 2010; O’Brien & Daley, 2011). Allerdings liegen auch hier noch keine spezifischen Befunde zu Kindern psychisch kranker Eltern vor. Beispielhaft haben Finnland und Schweden auf nationaler Ebene das Familieninterventionsprogramm von Beardslee et al. (2009; s. o.) implementiert. Kinder psychisch kranker Eltern in diesen Ländern haben das Recht, dass ihre Bedürfnisse hinsichtlich Aufklärung über die elterliche Erkrankung und nach Unterstützung angemessen befriedigt werden (Pihkala et al., 2011). Dieses Recht ist auch Grundlage eines Gesetzes aus dem Jahr 2010 in Norwegen, wonach in Einrichtungen der Erwachsenenversorgung die Kinder angemessen mitversorgt werden müssen (Pihkala et al., 2011). Eine solche gesetzliche Grundlage verpflichtet zum einen die Einrichtungen der Erwachsenenversorgung nach den Kindern zu fragen und entsprechende Angebote vorzuhalten, zum anderen schärft sich auf diese Weise der Blick für die betroffenen Kinder und mögliche Bedürfnisse können so frühzeitig erkannt und befriedigt werden und so zu einer guten Entwicklung der Kinder beitragen. Zur Situation in Deutschland Auch in der Bundesrepublik sind mittlerweile eine Vielzahl von präventiven Angeboten, Initiativen und Projekten für Kinder psychisch kranker Eltern entstanden. So finden sich allein auf der Internetseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder psychisch erkrankter Eltern (www.bag-kipe.de) aktuell über hundert Projekte, Initiativen oder Einrichtungen aus dem gesamten Bundesgebiet, die sich in der Bundesarbeitsgemeinschaft vernetzt haben. Ein umfassender Überblick über die bestehenden präventiven Hilfen für die Zielgruppe in Deutschland gestaltet sich dabei schwierig, da es sich bei den Angeboten häufig um zeitlich befristete lokale Projekte und Initiativen handelt und die wenigsten Angebote fest in den Versorgungsstrukturen verstetigt sind. Reinisch, Heitmann und Griepenstroh (2011) berichten in einem Übersichtsbeitrag über die Ergebnisse einer systematischen Literaturrecherche zu Studien, Initiativen und Angeboten zur Prävention psychischer Störungen bei Kindern mit psychisch kranken Eltern in Deutschland. Die identifizierten präventiven Angebote in Deutschland sind dabei analog zu den beschriebenen Präventionsebenen zu verorten: So unterscheiden die Autoren zwischen eher individuumszentrierten (fallbezogenen; siehe oben Eltern-/Kindebene) und strukturellen (fallübergreifenden; siehe oben Netzwerkebene/Fachkräfteebene) Angeboten. Im folgenden Abschnitt sollen exemplarisch einige Präventionsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche erläutert werden, wobei hierzu jeweils beispielhaft praxisbezogene Projekte und Programme in Deutschland aufgeführt werden. Eine Auflistung deutschlandweiter Angebote für Kinder psychisch kranker Eltern findet sich auf der Internetseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder psychisch erkrankter Eltern (www.bag-kipe.de). Mutter-Kind-Behandlung in der Psychiatrie Das Angebot einer gemeinsamen stationären Aufnahme von Eltern mit psychischen Erkrankungen und ihren Kinder in der Erwachsenenpsychiatrie konzentriert sich meist auf die Behandlung von psychisch kranken Müttern mit Säuglingen (Lenz, 2005). Ein Beispiel guter Praxis ist die Mutter-Kind-Behandlung im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (Leitung Dr. Christiane Hornstein). Mütter mit postpartalen psychischen Störungen und ihre Säuglinge/Kleinkinder im Alter von Null bis 24 Monaten werden dort in einer speziellen Mutter-Kind-Einheit gemeinsam aufgenommen und behandelt. Das interaktionale Therapieprogramm der Mutter-Kind-Behandlung setzt sich aus fünf Modulen zusammen, die neben der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung der Mutter auch therapeutische Müttergruppen, die videogestützte Einzelpsychotherapie der Eltern-Kind-Beziehung sowie die Unterstützung der Eltern-Kind-Beziehung im Alltag und die Arbeit mit Vätern und Angehörigen umfasst. (www.mutter-kind-behandlung.de). Zunehmend werden auch in anderen Kliniken in Deutschland gemeinsame Behandlungsansätze für Mütter/Väter und ihre Säuglinge/Kleinkinder zu entwickelt und umgesetzt; solche Beispiele guter Praxis können wegweisend für eine zukünftige Versorgung sein. Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern Neben einer Häufung von Belastungen und Konflikten innerhalb der Familie geht die psychische Erkrankung eines Elternteils nicht selten auch mit einer sozialen Isolation der Familie einher (Gurny, Cessée, Gavez, Los, & Albermann, 2007). Betroffene Familienverfügen demnach häufig nicht über ein stabiles und tragfähiges außerfamiliäres soziales Netzwerk. Patenschaftsprojekte dienen somit der Netzwerkförderung mit dem Ziel, betroffenen Kindern eine dauerhafte und verlässliche Unterstützung durch einen gesunden erwachsenen Ansprechpartner außerhalb der Familie zur Verfügung zu stellen (Reinisch, Heitmann & Griepenstroh, 2011). In der Regel werden Patenschaften deshalb nicht in akuten Krisensituationen, sondern in stabilen Phasen in den Familien installiert. Den Kindern wird somit eine kontinuierliche Bezugs- und Vertrauensperson zur Seite gestellt und die Möglichkeit geboten, in Belastungssituationen auszuweichen, ohne in Loyalitätskonflikte zu geraten. In akuten Krisensituationen können die Kinder bei ihren Paten untergebracht und versorgt werden. Die Paten schützen und unterstützen somit nicht nur die Kinder, sondern stehen auch den Eltern als Ansprechpartner zur Seite und bieten konkrete Entlastung im Alltag, indem sie etwa in regelmäßigen Abständen auch in stabilen Phasen zu vereinbarten Zeiten die Kinderbetreuung übernehmen (Szylowicki, 2001). . In ganz Deutschland gibt es mittlerweile eine Reihe von Vereinen und Institutionen, die Patenschaften vermitteln. Zu diesen zählen unter anderem PFIFF (Pflegekinder und ihre Familien Förderverein) in Hamburg, wo bereits seit mehr als 10 Jahren Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern vermittelt werden, AMSOC (Ambulante Sozialpädagogik Charlottenburg e.V.) in Berlin, der Kinderschutzbund in mehreren Städten (z. B. Marburg, Günzburg), die AWO (Arbeiterwohlfahrt) in Göttingen. Auch diese Projekte haben dazu beigetragen, das Bewusstsein dafür zu stärken, dass solche stabilen und langfristigen Angebote förderlich für die Entwicklung der Kinder und zugleich auch kostensenkend sein können, so dass in einigen Städten/Kommunen (z.B. in Hamburg, Bremen, Marburg) feste Budgets für diesen Bereich aufgebaut werden konnten. Vorwiegende Einzelberatung von Kindern und Eltern Im ambulanten Bereich gibt es eine Vielzahl von Beratungsangeboten, die sich vor allem auf die kindgerechte Aufklärung, Persönlichkeitsentwicklung und Unterstützung der betroffenen Kinder, aber auch auf die Unterstützung der elterlichen Erziehungskompetenzen und die Erarbeitung von Lösungsstrategien spezialisiert haben. Neben den Einzelberatungen finden auch Familienberatungen statt, um das alltägliche Familienleben positiv zu fördern und alltägliche Hürden konstruktiv zu bewältigen. Beispiele für entsprechende Angebote in Deutschland sind unter anderem KIPKEL (Kinder psychisch kranker Eltern) im Kreisgebiet Mettmann (www.kipkel.de), desweiteren die Projekte Pampilio in Lübeck (http://www.diebruecke-luebeck.de/behandlung-reha/kinder-jugendliche/das-kinderprojektpampilio) und kim - Kinder im Mittelpunkt in Kiel (http://www.kim-sh.de). Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche Neben Einzelberatungen für Kinder und Jugendliche bieten viele Vereine und Institutionen Gruppenprogramme sowohl zur Psychoedukation als auch zur gezielten Stärkung von Ressourcen und Schutzfaktoren der Kinder und Jugendlichen an. In diesen Gruppen geht es u. a. um die Enttabuisierung der psychischen Erkrankung der Eltern, die altersangemessene Informationsvermittlung, die Förderung der emotionalen Wahrnehmung und des Selbstwertgefühls und die Entlastung von Schuldgefühlen. Den Kindern wird die Möglichkeit geboten, sich gegenseitig auszutauschen und somit ein Gefühl der Solidarität und Zugehörigkeit herzustellen. Von Vorteil ist es, wenn begleitend Elterntreffen stattfinden. Ein solches Angebot bieten die z. B. Auryn-Gruppen, die in mehreren Städten deutschlandweit vertreten sind, z.B. in Frankfurt, Trier und Leipzig (Dierks, 2001; Lenz, 2007). Weitere Projekte sind z. B. die Seelensteine in Halle/Saale (http://www.seelensteine.org ), Sunny Side Up in Berlin (http://www.sunnysideup-berlin.de), (http://www.kinderschutzbund-frankenthal.de/content/ch.html), Chillies Skipsy in in Frankenthal Konstanz (http://www.awo-konstanz.de/skipsy.html), Ich bin wichtig! in Kaufbeuren (http://www.kjfaugsburg.de/web/ejv.nsf/id/pa_ichbinwichtig.html), Windlicht (http://www.margaretenhort.de/sozialpsybetr/windlicht.htm) und in Hamburg Sonnenkinder in Bonn/Rhein-Sieg (http://www.hfpk.de/angebote.html). Präventive Ansätze auf der Familienebene Angebote auf der Familienebene setzen sich in der Regel aus Eltern-, Paargesprächen, Einzelgesprächen mit den Kindern und aus Familiengesprächen zusammen. Dabei geht es um die Aufklärung der Eltern und Kinder über die psychische Erkrankung des betroffenen Elternteils. Es soll ein familiäres Verständnis der Erkrankung sowie eine Paar- und Familiendynamik aus einer mehrgenerationalen Perspektive erreicht werden. Darüber hinaus sollen die innerfamiliäre Kommunikation, Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten im Umgang mit der Erkrankung gestärkt werden. Die Eltern werden außerdem über Risiken und Schutzfaktoren der kindlichen Entwicklung aufgeklärt. Ein Beispiel für ein familienorientiertes Interventionsprogramm ist das CHIMPs-Projekt (Children of mentally ill parents), das in Hamburg am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf angeboten und wissenschaftlich evaluiert wird (Wiegand-Grefe, Werkmeister, Bullinger, Plass & Petermann, 2012; WiegandGrefe, Cronemeyer, Plass, Schulte-Markwort & Petermann, 2013). CHIMPS basiert auf dem familienorientierten Präventionsprogramm „Hoffnung, Sinn und Kontinuität“ von William Beardslee (2009), das ebenfalls vom Diakonischen Werk Baden verwendet wird. In dessen Projekt „Vergessene Kinder im Fokus“ soll die Familienintervention in einem großen Praxisprojekt evaluiert werden mit dem Ziel, Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern zu verstetigen. Mit der Projektevaluation sollen gesundheits-, familien- und sozialpolitische Verantwortungsträger sowie Krankenkassen in Baden-Württemberg für die Beteiligung an einer Regelfinanzierung gewonnen werden (http://www.ekiba.de/html/content/projekt_vergessene_kinder.html?t=6759ae9132daed1f301 d795fa9db44cf). Kombinierte Präventionsprogramme Bundesweit existieren auch einzelne Projekte und Initiativen, in denen sowohl fallbezogene, als auch fallübergreifende Elemente der Prävention bei Kindern psychisch kranker Eltern kombiniert werden. Diese sehen zum einen die Unterstützung der betroffenen Familien vor (z. B. mit Gruppen- oder Einzelangeboten), zum anderen fallübergreifende Öffentlichkeitsarbeit z. B. in Form von Informationsveranstaltungen, Publikationen, Vernetzung von Multiplikatoren und die Pflege der Internetpräsenz. Weitere Bausteine sind die Qualifizierung von Fachkräften und Multiplikatoren durch Schulungen und die Schaffung und Weiterentwicklung von Kooperationsbeziehungen zwischen den Einrichtungen der Psychiatrien, niedergelassenen Jugendhilfen und den Psychiatern Gesundheitsämtern. und Psychotherapeuten, Beispiele für solche Kinder- und kombinierten Präventionsprogramme sind das Würzburger Präventions- und Qualifikationsprojekt des evangelischen Beratungszentrums Würzburg (http://www.wuerzburger-projekt.de/) und das bereits erwähnte Modellprojekt „Vergessene Kinder im Fokus“ der badischen Landeskirche, das sich explizit die Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit zur Aufgabe gemacht hat (http://www.ekiba.de/html/content/projekt_vergessene_kinder.html?t=6759ae9132daed1f301 d795fa9db44cf). Fazit Vor dem Hintergrund des transgenerationalen Transmissionsmodells psychischer Störungen (Hosman et al., 2009) kann angenommen werden, dass die elterliche psychische Erkrankung ein allgemeiner Faktor ist, der sich im Sinne der Multifinalität auf unterschiedliche Weise manifestieren kann und durch weitere Risiko- aber auch Schutzfaktoren beeinflussbar ist. In einer Wachstumsstudie (launch & growth) (Garber & Cole, 2010) konnte nachgewiesen werden, dass die elterliche psychische Störung der Auslöser für einen Kaskadenprozess ist, der unter anderem erhöhten familiären Stress, familiäre Dysfunktionen und niedrigen Selbstwert bei den Kindern auslöst und darüber das Erkrankungsrisiko der Kinder erhöht. Weiter konnte in der Studie nachgewiesen werden, dass eine Reduktion der elterlichen Störung (launch-Faktor) zu einer verbesserten Entwicklung der Kinder beiträgt (growthFaktor). Folglich sollte die elterliche psychische Störung immer adäquat und zügig behandelt werden, und vor dem Hintergrund der dysfunktionalen Kognitionen und Schuldvorwürfe der Kinder sollten diese in die Behandlung einbezogen werden, indem sie altersadäquat über die elterliche Erkrankung aufgeklärt werden. Vorbildlich sind in dieser Hinsicht die skandinavischen Länder, die diese Bedürfnisse der Kinder erkannt haben und ihnen sogar gesetzlich verankert Unterstützung diesbezüglich zusichern. Ferner haben sich nach einem ausführlichen Review von Allen (2011), das dieser im Auftrag der englischen Regierung erstellt hat, insbesondere die frühen Hilfen (vor dem 3. Lebensjahr) als wirksam bei der Prävention von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen erwiesen. Allen (2011) stellt fest, dass es evidenzbasierte Programme zu frühen Hilfen gibt, die nachweislich langfristig die Entwicklung von Kindern positiv beeinflussen, aber bislang nur sporadisch Anwendung finden. Dies führt dazu, dass es immer noch sehr viel mehr und häufig auch eher favorisierte Programme zu späten Interventionen gibt, die dann ansetzten, wenn Probleme und Störungen bereits bestehen und bekanntermaßen teuer und weniger effektiv sind. Folglich sollte bei der Prävention für Kinder psychisch kranker Eltern auch immer bedacht werden, dass frühe Hilfen, wie beispielsweise das Family Nurse Partnership Programm von Olds et al. (1993; 1999; 2004; 2006; 2007; 2009), das Triple-P-Programm (Bayer et al., 2009; Sanders, 2011; Wilson et al., 2012) oder auch das Incredible Year Programm (Bayer et al., 2009; Webster-Stratton et al., 2011) dazu beitragen können, Familien mit psychisch kranken Eltern frühzeitig zu entlasten, ihre Erziehungskompetenzen zu fördern, Entwicklungsrisiken der Kinder zu erkennen, Schutzfaktoren zu fördern und so zu einer langfristig guten Entwicklung von Familien und Kindern beitragen können. Literatur Allen, G. (2011). Early Intervention: The Next Steps An Independent Report to Her Majesty’s Government. http://www.dwp.gov.uk/docs/early-intervention-next-steps.pdf Ashman, S.B., Dawson, G., & Panagiotides, H. (2008). Trajectories of maternal depression over 7 years: Relations with child psychophysiology and behavior and role of contextual risks. Development and Psychopathology, 20(1), 55-77. Ashman, S.B., Dawson, G., Panagiotides, H.,Yamada, E., & Wilkinson, C.W. (2002). Stress hormone levels of children of depressed mothers. Development and Psychopathology, 14(2), 333-349. Bauer, M.-V. & Pierchalla, H. (2013). Kinder psychisch kranker Eltern – epidemiologische Daten und Präventionsansätze. Diplomarbeit: Fachbereich Psychologie Philipps-Universität Marburg. Bayer J, Hiscock H, Scalzo K, Mathers M, McDonald M, Morris A, Birdseye J, Wake M. (2009). Systematic review of preventive interventions for children's mental health: what would work in Australian contexts? Aust N Z J Psychiatry, 43(8): 695-710 Beardslee, W.R. & Podorefsky, D. (1988). Resilient adolescents whose parents have serious affective and other psychiatric disorders: Importance of selfunderstanding and relationships. American Journal of Psychiatry, 145(1), 63-69. Beardslee, W.R., Hoke, B., Salt, P., Wright, E. (2009). Hoffnung, Sinn und Kontinuität. Ein Programm für Familien depressive erkrankter Eltern. Tübingen: DGVT-Verlag. Beardslee, W.R., Schultz, L.H., & Selman, R.L. (1987). Level of social-cognitive development, adaptive functioning, and DSM-III diagnoses in adolescent offspring of parents with affective disorders: Implications of the development of the capacity for mutuality. Developmental Psychology, 23(6), 807-815. Berking, M. (2008). Training emotionaler Kompetenzen. TEK – Schritt für Schritt. Heidelberg: Springer Medizin-Verlag. Bifulco, A., Moran, P.M., Ball, C., Jacobs, C., Baines, R., Bunn, A., et al. (2002). Childhood adversity, parental vulnerability and disorder: Examining intergenerational transmission of risk. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43(8), 1075-1086. Bijl, R.V., Cuijpers, P., Smit, F. (2002). Psychiatric disorders in adult children of parents with a history of psychopathology. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol., 37, 7-12. Birmaher, B., Axelson, D., Monk, K., Kalas, C., Goldstein, B., Hickey, M.B., et al. (2009). Lifetime psychiatric disorders in school-aged offspring of parents with bipolar disorder: the Pittsburgh Bipolar Offspring Study. Archives of General Psychiatry, 66(3), 287-296. Caspi, A., Sugden, K., Moffitt, T.E., Taylor,A., Craig, I.W., Harrington, H.L., McClay, J., Mill, J., Martin,J., Braithwaite,A., & Poulton, R. (2003). Influence of Life Stress on Depression: Moderation by a Polymorphism in the 5-HTT Gene. Science, 301, 386-389. Christiansen (2012a). Vortrag auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPS), Bielefeld: „Prävalenz Kinder psychisch kranker Eltern in Deutschland“. Christiansen, H. (2012b). Wieso ist Papa so komisch? Fiduz, 29, 18-19. Christiansen, H., Behner, C., Beardslee, W., Mattejat, F., & Röhrle, B. (in Vorbereitung). Preventive interventions for children of mentally ill parents - results of a preliminary first meta-analysis. Christiansen, H., Mattejat, F., & Röhrle, B. (2010). Wirksamkeitsbefunde Kinder psychisch kranker Eltern. In: S. Wiegand-Grefe, F. Mattejat, A. Lenz (Hrsg.), Kinder mit psychisch kranken Eltern. Klinik und Forschung (S. 458-481). Göttingen: Vandenhoek & Rupprecht. Chronis, A.M., Lahey, B.B., & Pelham, W.E. (2007).Maternal depression and early positive parenting predict future conduct problems in young children with attentiondeficit/hyperactivity disorder. Developmental Psychology, 43(1), 70-82. Clark, D.B., Cornelius, J., Wood, D., & Vanyukov, M. (2004). Psychopathology risk transmission in children of parents with substance use disorders. American Journal of Psychiatry, 161(4), 685-691. Costello, E.J., Compton, S.N., Keeler, G., & Angold, A. (2003). Relationships between poverty and psychopathology: a natural experiment. JAMA, 290, 2023-9. Dierks, H. (2001). Präventionsgruppen für Kinder psychisch kranker Eltern im Schulalter („Auryngruppen“). Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 50 (7), 560-568. Duggal, S., Carlson, E., Sroufe, L.A., & Egeland, B. (2001). Depressive symptomatology in childhood and adolescence. Development and Psychopathology, 13, 143-164. Elgar, F.J., Mills, R.S.L., McGrath, P.J., Waschbusch, D.A., & Brownridge, D.A. (2007). Maternal and paternal depressive symptoms and child maladjustment: The mediating role of parental behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 35(6), 943-955. Foster, C.E., Webster, M.C., Weissman, M.M., Pilowsky, D.J., Wickramaratne, P.J., Rush, A., et al. (2008). Course and severity of maternal depression: Associations with family functioning and child adjustment. Journal of Youth and Adolescence, 37(8), 906-916. Franz, M., Kettemann, B., Jäger, K., Hanewald, B. & Gallhofer, B. (2012). Was wissen Psychiater über die Kinder ihrer Patienten? Psychiatrische Praxis, 39, 211-216. Fraser, C., James, E.L., Anderson, K., Lloyd, D., & Judd, F. (2006). Intervention programs for children of parents with a mental illness: A critical review. International Journal of Mental Health Promotion, 8, 9-20. Garber, J., & Cole, A.D. (2010). Intergenerational transmission of depression: a launch and grow model of change across adolescence. Developmental Psychopathology, 22, 819-830. Gladstone, B.M., Boydell, K.M., & McKeever, P.M. (2006). Recasting research into children’s experiences of parental mental illness: Beyond risk and resilience. Social Science and Medicine, 62, 2540-2550. Goodman, S.H. & Gotlib, I.H. (1999). Risk for psychopathology in the children of depressed mothers: A developmental model for understandingmechanisms of transmission. Psychological Review, 106(3), 458-490. Goodman, S.H. (2007). Depression in mothers. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 107-135. Gopfert, M., Webster, J., & Seeman, M.V. (2004). Parental Psychiatric Disorder: Distressed Parents and their Families (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press. Greif Green, J., McLaughlin, K.A., Berglund, P.A., Gruber, M.J., Sampson, N.A., Zaslavsky, A.M., & Kessler, R.C. (2010). Childhood Adversities and Adult Psychiatric Disorders in the National Comorbidity Survey Replication I. Archives of General Psychiatry, 67, 113-123. Gurny, R., Cassée, K., Gavez, S., Los, B. & Albermann, K. (2007). Kinder psychisch kranker Eltern: Winterhurer Studie. Zürich: Fachhochschule Zürich. Halligan, S.L., Murray, L., Martins, C., & Cooper, P.J. (2007). Maternal depression and psychiatric outcomes in adolescent offspring: A 13-year longitudinal study. Journal of Affective Disorders, 97(1-3), 145-154. Harnish, J.D., Dodge, K.A., & Valente, E. (1995). Mother-child interaction quality as a partial mediator of the roles of maternal depressive symptomatology and socioeconomic status in the development of child behavior problems. Child Development, 66(3), 739- 753. Herpertz-Dahlmann, B. & Herpertz, S. (2010). Kinder- Jugend- und Erwachsenenpsychiatrie. Eine Kooperation über die Lebensspanne. Nervenarzt, 81, 1298-1305. Hipwell, A.E., Goossens, F.A., Melhuish, E.C., & Kumar, R. (2000). Severe maternal psychopathology and infant-mother attachment. Development and Psychopathology, 12(2), 157-175. Horwitz, S.M., Briggs-Gowan, M.J., Storfer-Isser, A., & Carter, A.S. (2007). Persistence of maternal depressive symptoms throughout the early years of childhood. Journal of Women’s Health, 16(5), 678-691. Hosman, C.M.H., van Doesum, K.T.M., van Santvoort, F. (2009). Prevention of emotional problems and psychiatric risks in children of parents with a mental illness in the Netherlands: I. The scientific basis to a comprehensive approach. Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health (AeJAMH), Volume 8, Issue 3. http://cms.irrsinnig-menschlich.de/unterseiten/materialien.html http://www.pairfam.de Kaufman, J., Yang, B.-Z., Douglas-Palumberi, H., Houshayar, S., Lipschitz, D., Krystal, J.H., & Gelernter, J. (2004). Social support and serotonin transporter gene moderate depression in maltreated children. PNAS, 101, 17316-17321. Kersten-Alvarzez, L., Hosman, C.M.H., Riksen-Walraven, J.M., van Doesum, K.T.M., & Hoefnagels, C. (2011). Which preventive interventions effectively enhane depressed mothers’ sensitivity? A Meta-Analysis. Infant Mental Health Journal, 32, 362–376. Kessler, R.C., McLaughlin, K.A., Greif Green, J., Gruber, M.J., Sampson, N.A., Zaslavsky, A.M., Aguilar-Gaxiola, S., Alhamzwaiw, A.O., Alonso, J., Angermeyer, M., Benjet, C., Bromet, E., Chatterji, S., de Girolamo, G., Demyttenaere, K., Fayyad, J., Florescu, S., Gal, G., Gureje, O., Haro, J.M., Hu, C-y., Karam, E.G., Kawakami, N., Lee, S., Lépine, J.-P., Ormel, J., Posada-Villa, J., Sagar, R., Tsang, A., Üstün, T.B., Vassilev, S., Viana, M.C., & Williams, D.R. (2010). Childhood adversities and adult psychopathology in the WHO World Mental Health Surveys. The British Journal of Psychiatry, 197, 378-385. Khashan, A.S., Abel, K.M., McNamee, R., Pedersen, M.G., Webb, R.T., Baker, P.N., Kenny, L.C., & Mortensen, P.B. (2008). Higher risk of offspring schizophrenia following antenatal maternal exposure to severe adverse life events. Archives of General Psychiatry, 65, 146-52. Kim-Cohen, J., Caspi, A., Rutter, M., Tomás, M.P., & Moffitt, T.E. (2006). The caregiving environments provided to children by depressed mothers with or without an antisocial history. American Journal of Psychiatry, 163, 1009-18. Kling, A., Forster, M., Sundell, K., & Melin, L. (2010). A randomized controlled effectiveness trial of parent management training with varying degrees of therapist support. Behavior Therapy, 41, 530-42. Kluth, S., Stern, E., Trebes, J., & Freyberger, H.-J. (2010). Psychisch kranke jugendliche und erwachsene Mütter im Vergleich. Erste Ergebnisse aus dem Modellprojekt „Chancen für Kinder psychisch kranker und/oder suchtbelasteter Eltern“. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 53, 1119-1125. Leinonen, J.A., Solantaus, T.S., & Punamaki, R.L. (2003a). Parental mental health and children’s adjustment: The quality of marital interaction and parenting as mediating factors. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44(2), 227-241. Lenz, A. (2005). Kinder psychisch kranker Eltern. Göttingen: Hogrefe. Lenz, A. (2007). Kinder psychisch kranker Eltern – ein Überblick über Forschungsstand und Präventionsprogramme. In B. Röhrle (Hrsg.), Prävention und Gesundheitsförderung. Bd. III: Kinder und Jugendliche (S. 519-556). Tübingen: DGVT-Verlag. Lenz, C., & Schulz, S. (2008). Das Risikopotenzial elterlicher psychischer Störungen für die Kinder – Eine Meta-Analyse. Diplomarbeit. Fachbereich Psychologie der Philipps-Universität Marburg. Lovejoy, M.C., Graczyk, P.A., O'Hare, E., & Neuman, G. (2000). Maternal depression and parenting behavior: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 20, 561-92. Malaspina, D., Corcoran, C., Kleinhaus, K.R., Perrin, M.C., Fennig, S., Nahon, D., Friedlander, Y., & Harlap, S. (2008). Acute maternal stress in pregnancy and schizophrenia in offspring: a cohort prospective study. BMC Psychiatry, 21, 8:71. Mattejat, F., & Remschmidt, H. (22008). Kinder psychisch kranker Eltern. Deutsches Ärzteblatt, 105, 413-418. Maughan, A., Cicchetti, D., Toth, S.L., & Rogosch, F.A. (2007). Early-occurring maternal depression and maternal negativity in predicting young children’s emotion regulation and socioemotional difficulties. Journal of Abnormal Child Psychology, 35(5), 685- 703. Maybery, D., Reupert, A., Goodyear, M., Ritchie, R., & Brann, P. (2009). Investigating the strengths and difficulties of children from families with a parental mental illness. Australian eJournal for the Advancement of Mental Health, 8(2) Murray, L., Cooper, P., & Hipwell, A. (2003). Mental health of parents caring for infants. Archives of Women’s Mental Health, 6(Suppl2), S71-S77. O‘Connell, K. (2008). What Can We Learn? Adult Outcomes in Children of Seriously Mentally Ill Mothers. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 21, 89-104. O’Brien, M., & Daley, D. (2011). Self-help parenting interventions for childhood behaviour disorders: a review of the evidence. Child: Care, Health and Development, 37, 623-637. Olds, D. L, Eckenrode, J., Henderson, C., Kitzman, H., Cole, R., Luckey, D. Holmberg, J. & Baca, P. (2009). Preventing child abuse and neglect with home visiting by nurses. In K. A. Dodge & D. L. Coleman (Eds). Preventing child maltreatment: Community approaches (pp. 29-54). New York: Guilford Press. Olds, D. L. (2006). The nurse-family partnership. An evidence-based preventive intervention. Infant Mental Health Journal, 27(1), 5-25. Olds, D. L., Henderson C.R., Phelps, C., Kitzman, H. & Hanks, C. (1993). Effect of prenatal and infancy nurse home visitation on government spending. Medical Care, 31(2), 155-174. Olds, D. L., Henderson, C. R., Kitzman, H. J., Eckenrode, J. J., Cole, R. E. & Tatelbaum, R. C. (1999). Prenatal and infancy home visitation by nurses: Recent findings. The Future of Children, 9 (1), 44–65. Olds, D. L., Kitzman, H., Cole, R., Robinson, J., Sidora, K., Luckey, D. W., Henderson, C. R., Hanks, C., Bondy, J. & Holmberg, J. (2004). Effects of nurse home-visiting on maternal life course and child development: Age 6 follow-up results of a randomized trial. Pediatrics, 114 (6), 1550-1559. Olds, D. L., Kitzman, H., Hanks, C., Cole, R., Anson, E., Sidora-Arcoleo, K., Luckey, D. W., Henderson, C. R., Holmberg, J., Tutt, R. A., Stevenson, A. & Bondy, J. (2007). Effects of nurse home visiting on maternal and child functioning: Age-9 follow-up of a randomized trial. Pediatrics, 120(4), e832-e845. Östman, M., & Hansson, L. (2002). Children in families with a severely mentally ill member. Prevalence and needs for support. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 37, 243-8. Pihkala, Hl, Sandlund, M., & Cederström, A. (2011). Children in Beeardslee’s family intervention: Relieved by understanding of parental mental illness. International Journal of Social Psychiatry, 58, 623-628. Pretis, M., & Dimova, A. (2008). Vulnerable children of mentally ill parents: towards evidence-based support for improving resilience. Support for Learning, 23, 152-159. Richter-Werling, M. (2013). Das Schulprojekt “Verrückt? Na und! Seelisch fit in der Schule” – Ein Baustin zur Förderung der Seelischen Gesundheit in der Schule. In: B. Röhrle& H. Christiansen (Hrsg.), Prävention und Gesundheitsförderung Bd. V. Hilfen für Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen, S. 221-234. Tübingen: DGVT-Verlag. Rogosch, F.A., Cicchetti, D., & Toth, S.L. (2004). Expressed emotion in multiple subsystems of the families of toddlers with depressed mothers. Development and Psychopathology, 16(3), 689-706. Röhrle, B., & Christiansen, H. (2009). Psychische Erkrankung eines Elternteils. In: A. Lohaus und H. Domsch (Hrsg.), Psychologische Förder- und Interventionsprogramme für das Kindes- und Jugendalter (S. 259-269). Heidelberg: Springer. Rutter, M. (1999). Psychosocial adversity and child psychopathology. British Journal of Psychiatry, 174, 480-493. Rutter, M. (2009). Understanding and testing risk mechanisms for mental disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50, 44-2. Rutter, M., & Quinton, D. (1977). Psychiatric disorder – ecological factors and concepts of causation. In: H. McGurk (Hrsg.), Ecological Factors in Human Development, 173-187. Amsterdam: North-Holland. Sanders, M.R. (2011). Development, evaluation, and multinational dissemination of the triple P-Positive Parenting Program. Annu Rev Clin Psychol, 8, 345-79. Sidebotham, P. & Heron, J. (2006). Child maltreatment in the ‘children of the nineties’: A cohort study of risk factors. Child Abuse & Neglect, 30, 497-522. Siegenthaler, El, Munder, T., & Egger, M. (2012). Effect of Pre ventive Interventions in Mentally Ill Parents on the Mental Health of the Offspring: Systematic Review and MetaAnalysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51, 8-17. Statistisches Bundesamt (2006). Datenreport 2006. Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik Deutschland. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung. Stelzig-Schöler, R., Hasselbring, L., Yazdi, K., Thun-Hohenstein, L., Stuppäck, C., & Aichhorn, W. (2011). Incidence and risk factors for mental abnormalities in children of psychiatric inpatients. Neuropsychiatry, 25, 192-198. Szylowiki, A. (2001). Patenschaften für Kinder pschisch kranker Eltern. Soziale Praxis, 21, 103-107. The National Academies (2009). Preventing Mental, Emotional, and Behavioral Disorders Among Young People. Progress and Possibilities. www.national-academies.org Uher, R., Caspi, A., Houts, R., Sugden, K., Williams, B., Poulton, R., & Moffitt, T.E. (2011). Serotonin transporter gene moderates childhood maltreatment’s effects on persistent but not single-episode depression: Replications and implications for resolving inconsistent results. Journal of Affective Disorders, 135, 56-65. van Doesum, K.T.M., & Hosman, C.M.H. (2009). Prevention of emotional problems and psychiatric risks in children of parents with a mental illness in the Netherlands: II. Interventions. Australien E-Journal for the Advancement of Mental Health (AeJAMH), 8, Issue 3. van Ijzendoorn, M.H., Goldberg, S., Kroonenberg, P.M., & Frenkel, O.J. (1992). The relative effects of maternal and child problems on the quality of attachment: a meta-analysis of attachment in clinical samples. Child Development, 63, 840-58. Webster-Stratton, C., Rinaldi, J., & Jamila, M.R. (2011). Long-Term Outcomes of Incredible Years Parenting Program: Predictors of Adolescent Adjustment. Child Adolesc Ment Health, 16, 38-46. Wickramaratne, P.J. & Weissman, M.M. (1998). Onset of psychopathology in offspring by developmental phase and parental depression. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 37(9), 933-942. Wiegand-Grefe, S., Cronemeyer, B., Plass, A., Schulte-Markwort, M., & Petermann, F. (2013). Psychische Auffälligkeiten von Kindern psychisch kranker Eltern im Perspektivenvergleich. Kindheit und Entwicklung, 22(1), 31–40. Wiegand-Grefe, S., Werkmeister, S., Bullinger, M., Plass, A., & Petermann, F. (2012). Gesundheitsbezogene Lebensqualität und soziale Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern. Kindheit und Entwicklung, 21(1), 64–73. Wille, N., Betge, S., Ravens-Sieberer, U. & the BELLA study group (2008). Risk and protective factors for children’s and adolescents’ mental health: results of the BELLA study. European Child and Adolescent Psychiatry, 17, 133-147. Wilson, P., Rush, R., Hussey, S., Puckering, C., Sim, F., Allely, C.S., Doku, P., McConnachie, A., & Gillberg, C. (2012). How evidence-based is an 'evidence-based parenting program'? A PRISMA systematic review and meta-analysis of Triple P. BMC Medicine,, 2,10:130. Wittchen, H.U. (2000). Bedarfsgrechte Versorgung psychischer Störungen. Abschätzungen aufgrund epidemiologischer, bevölkerungsbezogener Daten. Stellungnahme im Zusammenhang mit der Befragung von Fachgesellschaften durch den Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen. München: MPI für Psychiatrie. www.verrueckt-na-und.de