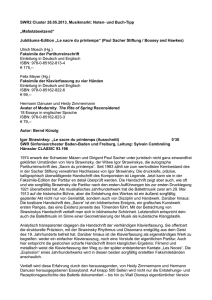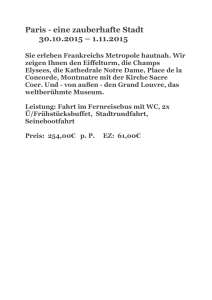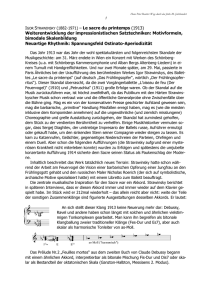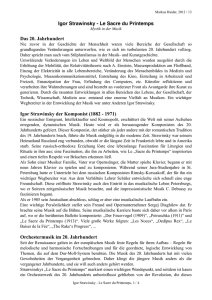8. Sinfonie konzert - Staatstheater Darmstadt
Werbung

8. Sinfonie kon z e r t Kurtág – Strauss – Strawinsky 8. Sinfoniekonzert Sonntag, 25. Juni 2017, 11.00 Uhr Montag, 26. Juni 2017, 20.00 Uhr Staatstheater Darmstadt, Großes Haus György Kurtág (*1926) Stele (ΣΤHΛH) op. 33 (1994) 1. Larghissimo. Adagio – 2. Lamentoso. Disperato, con moto. Nicht zu schnell aber wild, gehetzt, ungeduldig – 3. Molto sostenuto „Kinder und Tiere verstehen meine Musik am besten.“ Igor Strawinsky Richard Strauss (1864–1949) Also sprach Zarathustra. Frei nach Friedrich Nietzsche op. 30 (1896) Der Sonnenaufgang – Von den Hinterweltlern – Von der großen Sehnsucht – Von den Freuden und Leidenschaften – Das Grablied – Von der Wissenschaft – Der Genesende – Das Tanzlied – Nachtwandlerlied Pause Igor Strawinsky (1882–1971) Le Sacre du Printemps (1913) Bilder aus dem heidnischen Russland, Nach einem Libretto von Igor Strawinsky und Nikolaus Roerich Premier tableau: Adoration de la terre (Anbetung der Erde) Introduction – Les Augures printaniers (Die Vorboten des Frühlings) – Danses des adolescentes (Tanz der Jünglinge) – Jeu du rapt (Das Spiel der Entführung) – Rondes printanières (Frühlingsreigen) – Jeux des cités rivales (Kampfspiele der feindlichen Stämme) – Cortège du Sage (Zug des Weisen) – Adoration de la Terre (Anbetung der Erde) – Danse de la terre (Tanz der Erde) Second tableau: Le sacrifice (Das Opfer) Introduction – Cercles mystérieux des adolescentes (Mystischer Reigen der jungen Mädchen) – Glorification de l’élue (Verherrlichung der Auserwählten) – Évocation des ancêtres (Beschwörung der Ahnen) – Action rituelle des ancêtres (Ritualtanz der Ahnen) – Danse sacrale (Opfertanz) – Élue (Die Auserwählte) Das Staatsorchester Darmstadt Dirigent Will Humburg Dauer des Konzerts: ca. 2 Stunden Ton- und Bildaufnahmen sind aus rechtlichen Gründen nicht gestaltet. Gönnen Sie sich den Luxus der Unerreichbarkeit und schalten Ihre Mobiltelefone aus. György Kurtág wurde 1926 in Lugos geboren und wuchs in einer multi­eth­ nischen Umgebung auf. In der Budapester Musikakademie traf er György Ligeti, mit dem ihm eine lebenslange Freundschaft verband. Seine Lehrer waren Ferenc Farkas, Pál Kadosa und Leó Weiner. Anders als sein Freund Ligeti, der nach dem Aufstand 1957 im Westen geblieben war, ging Kurtág zurück nach Budapest. In Paris besuchte er 1957/58 Kurse bei Messiaen und Milhaud, traf Stockhausen in Köln, verbrachte aber auch in Paris etliche Stunden mit der Psychologin Marianne Stein, die, wie er sagte, sein Leben in zwei Hälften geteilt habe. György Kurtág begann danach mit dem Komponieren von neuem und beschäftigte sich insbesondere mit dem Werk Anton Weberns. Seinem 1959 entstandenen Streichquartett gab er programmatisch die Opuszahl 1, obwohl sein noch tonales Früh­werk in der Tradition der Spätromantik, Bartóks und der ungarischen Folklore vorangegangen war. In der Mitte der 1990er Jahre war er Fellow des Wissenschaftskollegs in Berlin und „Composer in Residence“ der Berliner Philharmoniker. Inzwischen ist Kurtág mit vielen internationalen Ehrungen bedacht worden, auch mit dem Siemens-Musikpreis, dem höchst-dotierten Musikpreis in Deutschland. Sein Oeuvre ist eher schmal, er bevorzugt kammermusikalische Besetzungen in seinen hochverdichteten und doch fragil klingenden Werken, wie in seinem Streichquartett „officium breve“ op. 28, das aus vielen Miniaturen besteht. Neben Vokalzyklen schrieb Kurtág in den siebziger Jahren überwiegend Kammermusik, wobei eine Tendenz zu höherer Dichte, noch lapidarerer Kürze, noch größerer Einfachheit festzustellen ist. Ein zweites Streichquartett mit dem Titel „Hom­mage à Mihály András – 12 Mikroludien“, und sein drittes Quartett, das „Officium breve in memoriam Andreae Szervánszky“, versammelt zauberhafte Miniaturen, verwenden diverseste Techniken vom verbissen festgehaltenen Einzelton bis zum komplexen Kanon, konsonante Terzen und Quinten ebenso wie Dissonanzen und Geräusche. (Bitterli) Ein Werk, das bezeichnend ist für Kurtágs kreativen und spielerischen Umgang mit der abendländischen Musiktradition, ist „Hommage à R. Sch.“ G y ö r g y Ku r t á g 3 4 von 1990. Die sechs kurzen Stücke haben die Besetzung Klarinette, Bratsche und Klavier, wie sie Robert Schumann, dem die „Hommage“ gilt, in seinen „Märchen­erzählungen“ verwendet hat. Auf Schumann verweisen auch vier der Stück­titel: „Merkwürdige Pirouetten des Kapellmeisters Johannes Kreisler“. Er spielt auf die Figur von E.T.A. Hoffmann an, die auch durch Schumanns „Kreisleriana“ geistert. Nach einigen Werken für größere kammermusikalische Ensembles schrieb er mit „Stele“ 1994 als Auftragswerk der Berliner Philharmoniker eines seiner ersten groß besetzten Orchesterwerke. Der Titel, der Partitur in grie­chischer Sprache vorangestellt, verweist auf eine Säule, einen Grabstein. „Stele“ hat drei ineinander übergehende Sätze. Es ist eine Elegie für den Freund András Mihály (1917–1993), der auch Widmungsträger wurde. Kurtág hatte schon vorher mit seiner Klavier-Miniatur „Mihály András in memoriam“ aus dem Zyklus „Játékok“ einem Nekrolog auf den Freund geschrieben, und am Ende von „Stele“ nutzt er Musik aus dem Klavierstück. Kurtág hat sich selbst verschiedentlich und widersprüchlich über sein Werk geäußert. Es ist schwer, die emotionale Komplexität des Werks in Worte zu fassen, aber Kurtág nennt es Musik über „jemanden, der ver­wundet auf einem Schlachtfeld liegt. Um ihn herum Kampf, aber er sieht auch den sehr klaren und blauen Himmel.“ In seinem lesenswerten Buch über die Musik des 20. Jahrhunderts „The Rest is Noise“, schrieb Alex Ross, Musikkritiker des The New Yorker, zu „Stele“: „Ein Stück, in dem wiederum Beethovens Geist umgeht. Zu Beginn spielen Gs in ver­schie­denen Oktavlagen unmissverständlich auf Beethovens „Leonoren-Ouvertüre“ Nr. 3 an – eine Darstellung der obersten Treppenstufen, die zu Florestans Kerker hinabführen. Auch Kurtág führt uns in einen unter­irdischen Raum, den wir jedoch nicht wieder verlassen.“ Er schafft eine düstere Atmosphäre, und am Ende diese Adagios hört man eine Tubenquartett „feierlich“. Es ist nicht nur eine „Hommage à Bruckner“, wie der Kom­ ponist über die Noten schreibt, sondern auch eine Reminiszenz wagnersche Klänge (z. B. Todesverkündigung der „Walküre“). Nach diesem fahlen Beginn folgt der 2. Satz ohne Pause, gekennzeichnet zunächst durch ein 5 gehetztes Tempo, als würde da jemand verfolgt. Der transzendente Moment nach dem Höhepunkt ist ein in kurzes Schweigen, und dann, als ob er von weit draußen käme, der sanfte Klang von sechs Flöten, bevor das volle Orchester seine Fahrt wieder aufnimmt. Im Finale wird ein glocken­ ähnlicher Ton rituell wiederholt. Gedämpft und äußerst unheimlich, in einem weit gespreizten Akkord verankert, ist es eine schwer fassliche Mischung aus Verzweiflung und Trost. Kurtág hat gemeint: „Meine Muttersprache ist Bartók, und Bartóks Muttersprache war Beethoven.“ Die Worte klangen allgemein, bevor er „Stele“ geschrieben hat, aber im Kontext dieser Werks mit seinen Anspielungen auf „Fidelio“ und – subtiler – im 3. Satz auf den „See der Tränen“ in der Oper „Herzog Blaubarts Burg“ haben sie eine besondere Bedeutung. Peter Bitterli resümierte: „György Kurtág schafft sein Werk vor dem Hinter­grund der Vergänglichkeit, der Beschränktheit, vielleicht der Sinn­losigkeit des menschlichen Lebens. Er prägt Zeichen, Münzen als Fährgeld für Charon. Er fixiert die Spuren der eigenen Existenz und derjenigen anderer, Lebender und Toter. ‚Zeichen, Spiele und Botschaften‘ heißen seine Werke, ‚Omaggio a Luigi Nono‘, ‚Drei alte Inschriften‘, ‚Grabstein für Stephan‘ oder ‚Stele‘. (…). Die Stücke und Splitter aber bergen eine ungeheure Kraft und gleichzeitig eine ungeschützte Sensibilität. Sie stellen sich nackt zur Schau, sie geben auf kleinstem Raum alles, sie sind die Existenz selbst, sie verweisen auf die fundamentale Tragik der condition humaine.“ In der ZEIT porträtierte Christine Lemke-Matwey György Kurtág zu seinem 90. Geburtstag: „Man sagt, dass es bei ihm nur wenige Noten gebe, die sich nicht auf die musikalische Tradition bezögen. Auf Bach natürlich, aber auch auf Boulez, auf Stockhausen und Luigi Nono genauso wie auf Strawinsky, Debussy, Mozart, Schütz und Monteverdi. Man darf sich das nicht allzu wörtlich vorstellen, es geht nicht um ein neo­romantisches ‚Erkennen Sie die Melodie?‘, sondern um ein Konzentrat, mannigfach ein­geköchelt und reduziert. Das erklärt auch die sagenhafte Kürze seiner meisten Werke. Wie schwarze Löcher, voll­ gepfropft mit Wissen, mit Rezeption.“ R i c h a r d S t r a uss 6 Kann man Philosophie vertonen? Aber zuerst: Ist „Also sprach Zarathustra“, Untertitel: „Ein Buch für alle und Keinen“, überhaupt Philosophie im eigentlichen Sinne? Die Lexika verneinen das. Da ist von „metaphysischer Geschmacklosigkeit“ die Rede. „Zarathustra“ sei im Wesentlichen eine Folge von Ansprachen des Protagonisten. Im „Zarathustra“ zeigt sich Friedrich Nietzsche als Aphoristiker. Es ist keine logische oder konstruktive Komplexität, sondern „Zarathustra“ ist Dichtung, hat ästhetische Qua­ litäten. Das Buch wird bis heute kritisiert: „Als Botschaft von fruchtbaren Lei­t­ideen muss man das Werk missglückt nennen. Wie in den unerschöpflich reichen aphoristischen Büchern, so ist auch hier das Große im Einzelnen zu finden – nicht in der Gesamtkonzeption: in Hunderten von genialen Einsichten, neuartigen Wertungen heiter-vernichtenden Polemiken,“ urteilt das Kindler-Lexikon. Man las das Buch zu seiner Zeit gern als Text gegen das Philistertum, denn Nietzsches Polemik sprach den kultur­kritischen Individualisten im wilhelminischen Kaiserreich aus der Seele. Und auch im politisch rechten Spektrum fand es Leser, die in den Pas­sagen der Erzählung, in denen vom „Übermenschen“ die Rede ist, will­kommene Bestätigung fanden. Und was interessierte Strauss an diesem Text? Die ersten Gedanken zu einer Tondichtung „Zarathustra“ notierte Strauss noch vor Beginn der Arbeit an „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ (1894/95) und begann unmittelbar nach deren Uraufführung mit ausführlichen Entwürfen. Schon während der Komposition instrumentierte er die fertigen Teile. Ursprünglich sollte das Werk den Untertitel tragen „symphonischer Optimismus in Fin de siècle-Form, dem 20. Jahrhundert gewidmet“; stattdessen beginnt die Partitur mit „Zarathustras Vorrede“ aus Nietzsches phi­lo­sophischem Gedicht, allerdings lediglich als eine Art Einstimmung für den Hörer. Eigentliche Bedeutung als „Programm“ besitzt die Vor­rede nicht. Strauss hält sich bei den Überschriften der einzelnen Abschnitte zwar an den Wortlaut der Kapitelüberschriften, nicht aber an deren Reihenfolge. In dem Werk musikalisierte Philosophie sehen zu wollen, wäre 7 also verfehlt, zumal der Komponist zu Nietzsche wegen dessen Ausfällen gegen Wagner ein eher gespaltenes Verhältnis hatte. Vermutlich war allein schon der vage Bezug zu Nietzsche ein Statement, denn „Zarathustra“ ist – nicht nur für Strauss – eher eine Symbolfigur für die eine Freiheit des Individuums (daher heißt es im Titel „frei nach Nietzsche“), das geistig seiner Zeit voraus ist. Dass der Zusammenhang zwischen Buch und Kom­position eher an der Oberfläche zu finden ist, hatte schon der damalige Kritikerpapst Eduard Hanslick in seinem Verriss der Wiener der Erstaufführung benannt: „Wer die Strauss’sche Symphonie unbefangen anhört, ohne sich um das detaillierte Programm zu kümmern, der wird gewiß keinen Zusammenhang mit Nietzsches ‚Zarathustra‘ darin entdecken“, schrieb er. Die „Rahmenhandlung“ ist die: Zarathustra geht ins Gebirge, denkt, 10 lange Jahre, steigt hinab, belehrt die Menschen und kehrt in die Berge zurück. Nietzsches Buch ist vierteilig, wie eine Sinfonie, und besitzt eine sehr musikalische, schwärmerische Sprache. Als sinfonische Dichtung ist „Zarathustra“ ein großartiger Wurf, nicht nur wegen seines oft zitierten Beginns. Strauss ist ein genialer Instrumentator. Das Orchester ist mit Orgel, 6 Hörnern und einer zweiten Tuba größer als je zuvor bei ihm, aber der Komponist nutzt das nicht nur zur Klangballung und zu Effekten, sondern zu ausdifferenzierten und geteilten Streicherstimmen und zu einer delikaten, teils impressionistischen Behandlung der Holzbläser. Auch ohne Programm kann man der Musik folgen. Schon bei den sinfonischen Dichtungen von Liszt schimmern formal immer die Elemente der klassischen Sinfonik durch. So ist es auch bei Strauss’ „Zarathustra“: Er übernimmt die Gegensätzlichkeit von Themen in den Ecksätzen, lyrische und tänzerische Elemente in den Binnensätzen. Musikalisch beruht das Werk auch auf der Konfrontation der Tonarten, C-Dur und H-Dur. Ihre tonalen Komplexe beherrschen nicht nur für sich einzelne Teile des Verlaufs, sondern werden in vielfältiger Art verknüpft. Die Einleitung (C-Dur) schildert die Natur und den Sonnenaufgang. Man orientiert sich auch an dem immer wieder zierten Beginn. Die Ausdrucks­gegensätze folgen einer inneren musikalischen Logik. Strauss spannt lange Melodie- 8 Ig o r S t r a w i n s k y bögen, die die lyrischen Stellen und die Walzer­seligkeit aus dem „Rosenkavalier“ vorwegnehmen. Man hört Durchführungs-Passagen, eine brütende und düstere Fuge in dem Teil, der mit „Wissenschaft“ überschrieben ist. Ein langes „Tanzlied“ steht an Stelle des Tanzsatzes aus der alten sinfonischen Form. Nach Schlägen einer Mitternachtsglocke inmitten eines tumult­ artigen Abschnitts findet das Stück ein idyllisches und ver­klärtes Ende. Wie auch immer man zu der dichterischen „Vorlage“ stehen mag, Nietzsche gab den Hinweis selbst: „Unter welche Rubrik gehört ei­gent­lich dieser ‚Zara­thustra‘? Ich glaube beinahe, unter die ‚Symphonien‘. „Also sprach Zarathustra“ wurde am 27. November 1896 durch das Frankfurter Städtische Orchester unter Leitung von Richard Strauss uraufgeführt. 1900 waren die Beziehungen zwischen Russland und Frankreich vielfältig. Die beiden Länder waren Bündnispartner, und sie pflegten regen kul­ turellen Austausch, der einen Höhepunkt fand, als Sergej Diaghilev auf den Plan trat. Nachdem er schon in Russland als Organisator von Kunst­ ausstellungen aufgefallen war, widmete er sich dem Export von rus­sischer Kunst, ab 1906 speziell nach Paris. 1907 organisierte er die Konzerte russischer Musik mit der Beteiligung von Rimsky-Korsakow, Glasunow, Skrjabin, Rachmaninoff und Schaljapin. Obwohl Musiker wie Dukas und Debussy die Bedeutung der russischen Musik kannten, war doch die Erstaufführung von Mussorgskys „Boris Godunow“ 1908 für die meisten Franzosen eine Offenbarung: sie glaubten in diesem Werk, das von Rimsky stark bearbeitet, ja verfälscht worden war, den Inbegriff dessen zu entdecken, was Debussy „die russische Seele“ nannte. Unter Diaghilev formierte sich das „Russische Ballett“, das nicht nur die denkbar besten Tänzer wie u. a. Nijinsky, die Pawlowa, die Karsawina und Ida Rubinstein präsentierte, sondern auch den Rahmen für viele denkwürdige Uraufführungen von Werken gab, die eigens von Diaghilev mit konzipiert worden waren. Die weitaus stärkste Persönlichkeit des Balletts war für alle Igor Strawinsky, der 1910 mit dem „Feuervogel“ Triumphe feierte, die sich ein Jahr darauf mit „Petruschka“ wiederholten. 9 Die Übereinstimmung zwischen Strawinskys Schaffen und dem Geschmack des Pariser Publikums, schien vollkommen zu sein, bis 1913 das dritte Ballett, „Le Sacre du printemps“, den bis dahin heftigsten Skandal der Musikgeschichte auslöste. An diesen Tumult im brandneuen Théatre des Champs-Elysees, erinnerte sich Jean Cocteau: „Ich sah Maurice Delage (den Komponisten), der vor Entrüstung puterrot angelaufen war, den kleinen Maurice Ravel, der sich aufplusterte wie ein Kampfhahn, Leon-Paul Fargue, den Dichter. Sie mussten dem Rhythmus folgen, weil stampfende und zischen­den Logen­insassen sie mit vernichtenden Bemerkungen überschütteten. Ich weiß nicht, wie es möglich war, dass dieses Ballett in einem solchen Aufruhr zu Ende getanzt wurde? Ich stand zwischen den beiden mittleren Logen, fühlte mich im Auge des Hurrikans ganz wohl und klatschte mit meinen Freunden. (…) So hörten wir dieses Geschichte machende Werk in­mitten eines solchen Tumults, dass die Tänzer das Orchester nicht mehr hörten, den ihnen der stampfende und schreiende Nijinsky in den Kulissen schlug. (…) Man müsste tausend Nuancen von Snobismus, Übersnobis­­mus, Gegensnobismus aufzählen, die für sich allein ein ganzes Kapitel benötigen würden. Das Publikum spielte die ihm zugedachte Rolle, es empörte sich sofort. Man lachte, spuckte, pfiff, ahmte Tierlaute nach, und vielleicht hätte man es schon nach einiger Zeit aufgegeben, wenn nicht die Menge der Ästheten und einige Musiker in ihrem Über­eifer das Publikum in den Logen beschimpft und sogar geschubst hätte. Der Lärm degenerierte zum Handgemenge. Stehend in ihrer Loge, mit verrutschtem Diadem, schwang die alte Gräfin de Pourtales ihren Fächer und schrie, ganz rot im Gesicht: ‚Das ist das erste Mal seit sechzig Jahren, dass man wagt, sich über mich lustig zu machen‘. Die brave Dame war ehrlich, sie glaubte an ein abgekartetes Spiel. (…) ‚Le Sacre du printemps‘ wurde im Mai 1913 in einem neuen Saal ohne Patina gespielt, der zudem noch zu bequem und kalt war für ein Publikum, das an Gefühlsaufwallungen in engen Sitz­reihen, in einer Hitze aus rotem Samt und Gold gewohnt war. Ich glaube nicht, 10 dass das ‚Sacre‘ in einem weniger bombastischen Theater adäquater auf­genommen worden wäre, aber dieser luxuriöse Saal symbolisierte im ersten Augenblick den Irrtum, der darin bestand, dass man ein kräftiges und jugendliches Werk mit einem dekadenten Publikum konfrontierte, mit einem verweichlichten Publikum, das in den Girlanden-Stil Ludwig XVI., den weichen Diwans und den Kissen von einem Orientalismus ruhte, für den man (sonst) das Russische Ballett tadeln muss. Unter diesen Umständen macht man einen Ver­dauungsschlaf in einer Hängematte, man verjagt das wahre Neue (…). Eine Provinz schlimmer als die Provinz, im Herzen von Paris …“ Die Presse äußerte sich nach der Uraufführung meist negativ: Wenn nicht gerade die Musik voll Abscheu verurteilt wurde, die man ja wegen des Tumultes nicht richtig hatte hören können, so herrschte doch in den Berichten eine Mischung aus Bewunderung und Hass vor, die gerade jene Faszination ausmachte, der das Publikum gegen seinen Willen aus­gesetzt war. Der Kritiker Leon Vallas prägte zwar das Bonmont vom „Massacre du printemps“, jedoch wusste er sich sehr klug über die Musik auszudrücken, die nicht nur von Cocteau, sondern auch von einigen anderen als „urgeschichtlich“ eingestuft wurde. Es war wohl mehr ein Wunschbild, eine Sehnsucht nach ursprünglicheren Formen menschlichen Lebens – nach all den Verfeinerungen des Impressionismus und dem Pessimismus der wagnerschen Musikdramen –, was die Leute auf „Sacre“ projizierten, der im Grunde genommen ein höchst artifizielles Werk ist. Die Reduktion der Melodien auf einige tatsächlich sehr primitiv wirkende Formeln wird längst wettgemacht durch die äußerst kunstvolle rhythmische Struktur und das Raffinement der Orchestration, die weit über das bei Rimsky und Debussy Gewohnte hinausgeht. Als 1914 „Sacre“ im Konzert dann ohne skandalöse Begleitumstände gehört werden konnte, entdeckte Pierre Lalo, dass die Musik weder hässlich noch barbarisch sei. Strawinsky feierte nun als Meister des Klangs und 11 des Rhythmus’ Triumphe. Der Skandal des vorausgegangenen Jahres wurde noch erwähnt, doch er war schon ein Stück Musikgeschichte. 1920 brachte Diaghilev den „Sacre“ in einer neuen choreographischen Version heraus, die nun sehr frei war und keine durchlaufende Handlung mehr aufwies. Ohne den ganzen ethnologischen Ballast von altrussischen Kostümen, der noch in der Uraufführung zu sehen war, traf „Sacre“ nun auf ein Publikum, das sich überhaupt nicht mehr feindselig verhielt und den „tollen Orkan dieser Musik“ genoss. Das Jahrhundertereignis „Le Sacre du printemps“ wurde vom Komponisten zunächst als Vision einer rituellen Frühlingshandlung gesehen, als er an den letzten Seiten seines „Feuervogel“-Balletts arbeitete: Weise Männer sitzen im Kreis und schauen auf den Todestanz eines jungen Mädchens, das geopfert werden soll, um den Gott des Frühlings günstig zu stimmen. Es sind „Bilder aus dem heidnischen Russland“, zusammengehalten von einer Hauptidee: dem Geheimnis des großen Impulses der schöpferischen Kräfte des Frühlings. Es gibt keine Handlung, aber eine choreographische Sukzession. Eine heidnische Komponente soll und kann man dem „Sacre“ nicht austreiben, die animalische Freude an kraftvollen Bewegungen und der Fanatismus der jäh wiederholten Gebärden machen aus diesem Werk ein berauschendes Fest der Vitalität und Lebenswut, das gerade in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als so viele Ideale des alten Europa zerbrochen waren, voll verstanden und bejaht wurde. Es handelt sich dabei, außer bei den unüberhörbaren rhythmischen Impulsen, und einige Intervallkonstellationen im Bau der Melodien, die auf eine nicht zu definierende Urzeit der Menschheit zurückgehen und nicht einem bestimm­ ten musikalischen Nationalstil zurückzuführen sind. So klingt Strawinskys „Sacre“ irgendwie russisch und ist doch universal, er mag die Pariser zum Heimweh nach ursprünglicher Lebensfreude inspiriert haben und er ist doch unverwechselbar modern, ein authentischer Ausdruck des heutigen Menschen, der in einer brutalen und technisierten Welt überlebt, ohne zu resignieren. (Theo Hirsbrunner) 13 Sacre ist: Abschaffung des Prinzips der Entwicklung, die Eliminierung der Wertigkeit von Akkordfunktionen, die Gestaltung von Sätzen auf der Basis reihender Motiv-Variation und die Ablösung der homophonen oder polyphonen Anlage von Satzstrukturen durch das Prinzip der Schichtung mehrerer Material- und Gestaltungsebenen. Dass „Le Sacre du printemps“ bis heute eine große Karriere als Orchester-Partitur machte, hat mit seiner immensen Energie zu tun. Pierre Boulez schrieb: „Die über­ragende Bedeutung des Rhythmus’ schlägt sich nieder in der Reduktion von Polyphonie und Harmonik auf untergeordnete Funktionen. Strawinsky hat die Richtung des rhythmischen Impulses geändert. Im „Sacre“, existiert zunächst nur ein fast körperlich wahrnehmbarer Grundpuls. Dieser Grundpuls wird nun verviel­fältigt, teils regelmäßig, teils unregelmäßig. Dabei entstehen natürlich die erregendsten Wirkungen durch die un­regel­ mäßige Folge, das Phänomen des Unvorhersehbaren innerhalb eines vorhersehbaren Zusammenhangs“. „Le Sacre du printemps“ ist bis heute ein Epoche machendes Werk, das nichts von seiner Urkraft eingebüßt hat. Gernot Wojnarowicz Open Air-Konzert zum Heinerfest Sonntag, 01. Juli 2017, 19.00 Uhr, Georg-Büchner-Platz Werke u.a. von Mozart, Strauß, Rossini, Schostakowitsch und Mancini Das Staatsorchester Darmstadt Mitglieder des Staatstheaterensembles Moderation Gernot Wojnarowicz Dirigent Felix Bender 10. Kammerkonzert Donnerstag, 06. Juli 2017, 20.00 Uhr, Kleines Haus Franz Schubert Trio für Violine, Viola und Violoncello B-Dur D 581 Ludwig van Beethoven Trio für Violine, Viola und Violoncello D-Dur op. 9 Nr. 2 Bernd Alois Zimmermann Trio für Violine, Viola und Violoncello Ernst von Dohnányi Serenade C-Dur op. 10 für Violine, Viola und Violoncello Violine Mark Buschkow Viola Adrien Boisseau Violoncello Aleksey Shadrin Kehrauskonzert Freitag, 07. Juli 2017, 20.00 Uhr, Großes Haus Werke u.a. von Wagner, Tschaikowsky und Smetana Das Staatsorchester Darmstadt Der Opernchor des Staatstheaters Darmstadt Choreinstudierung Thomas Eitler-de Lint Mitglieder des Staatstheaterensembles Moderation Gernot Wojnarowicz Dirigent Christoph Gedschold konzerthinweise 12 14 1. Sinfoniekonzert Jörg Peter Brell, Johannes Knirsch, Andrey Kalashnikow, Georgi Montag, 11. September 2017, 20.00 Uhr, Großes Haus Hagel-Höfele, Danielle Schwarz, Yvonne Anselment*, Lily Nagaosa- Sonntag, 10. September 2017, 11.00 Uhr, Großes Haus Wolfgang Amadeus Mozart Konzert A-Dur für Klarinette und Orchester KV 622 Anton Bruckner Sinfonie Nr. 9 d-Moll Klarinette Sharon Kam Dirigent Will Humburg 1. Kammerkonzert Donnerstag, 14. September 2017, 20.00 Uhr, Kleines Haus Werke von Bach, Mozart und Liszt Klavier Kit Armstrong Besetzung 15 8. Sinfoniekonzert Das Staatsorchester Darmstadt Erste Violinen Wilken Rank, Guillaume-Thomas Faraut, Makiko Sano, Horst Willand, Jane Sage, Theodor Breidenbach, Gyula Vadasz, Susanne Apfel, Antje Reichert, Annette Weidner, Miho Hasegawa, Damaris Heide-Jensen, Alexander Sachs*, Carolin Korn* Zweite Violinen Megan Chapelas, Sorin-Dan Capatina, Sylvia Schade, Christiane Dierk, Martin Lehmann, Kenneth Neumann, Nikolaus Norz, Almut Luick, Anne-Christiane Wetzel, Elisabeth Überacker, Min Ha Park, Stephanie Weimer-Meeßen* Violen Klaus Opitz, Tomoko Yamasaki, Uta König, Zeynep Tamay, Guilleme Selfa-Oliver, Barbara Walz, Almuth Kirch, Vladimir Babeshko*, Ari Kanemaki*, Christoff Schlesinger* Violoncelli Michael Veit, Kanghao Feng, Albrecht Fiedler, Friederike Eisenberg, Sabine Schlesier, Bianca Breitfeld*, Sebastián Escobar Avaria*, Zherar Yuzengidzhyan* Kontrabässe Stefan Kammer, Balasz Orban, Friedhelm Daweke, Berov*, Christoph Prüfer* Flöten Iris Rath, Eumin Seong, Kornelia Bleek* Oboen Michael Schubert, Sebastian Röthig, Heidrun Finke, Anna-Maria Hampel, Christian Petrenz* Klarinetten Claudia Dresel*, Philipp Bruns, David Wolf, Felix Welz, Detlef Mitscher*, Roland Dreher* Fagotte Hans Höfele, Tabea Brehm, Jan Schmitz, Rosalie Suys*, Reinhard Philipp* Hörner Filipe Abreu, Juliane Baucke, Martin Walz, Christane Bigalke, Yvonne Haas, Carla Gedicke*, Ulrich Grau,* Marlene Pschorr*, Grigory Yabubovich* Trompeten Manfred Bockschweiger, Tobias Winbek, Marina Fixle, Michael Schmeißer, Jens Böcherer* Basstrompete Ulrich Conzen Posaunen Tabea Hesselschwerdt, Ulrich Conzen, Bernhard Schlesier, Markus Wagemann Tuba Eberhard Stockinger, Matthias Fitting* Pauken Frank Assmann, Matthäus Pircher Schlagzeug Matthäus Pircher, Jürgen Jäger, Gabriel Lopez-Garcia, Geza Huba*, Steffen Welsch*, Marius Fink*, Raphael Löffler*, Klaus Wissler* Tasten Joachim Enders, Bartholomew Berzonsky, Jason Tran Harfe Marianne Bouillot, Constanze Stieber Cymbalon Bruno de Souza Barbosa Stand der Besetzung: 20. Juni 2017 / * = Gäste GMD Will Humburg Orchesterdirektion und Konzertdramaturgie Gernot Wojnarowicz Orchesterbüro Magnus Bastian Referentin GMD & Orchesterdirektion Franziska Domes Notenbibliothek Hie-Jeong Byun Orchesterwarte Matthias Häußler, Nico Petry, Willi Rau 16 Freundeskreis Sinfoniekonzerte Darmstadt e.V. Liebe Musikfreunde, der Freundeskreis leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, den Sinfoniekonzerten am Staatstheater Darmstadt eine besondere Attraktivität zu verleihen. Er verdankt seine Gründung im Jahre 1989 einer Anregung von Herrn Drewanz, dem damaligen GMD, und er hat sich seitdem unentbehrlich gemacht. Höhepunkt der Spielzeit 2014/2015 war aus unserer Sicht das von uns geförderte Jubiläumskonzert am 16.11.2014. Außerdem ermöglichten wir 2014/2015 Konzerte mit Sabine Meyer und Frank Peter Zimmermann. Im Juni 2016 unterstützten wir das Konzert mit Lise de la Salle, und im Oktober 2016 förderten wir das Konzert mit Antoine Tamestit. Zeigen auch Sie Kunstverstand und Initiative! Werden Sie Mitglied im Freundeskreis Sinfoniekonzerte Darmstadt e.V. Wir freuen uns auf Sie! Anfragen und Informationen: Geschäftsführerin Karin Exner, Marienhöhe 5, 64297 Darmstadt | Tel. 06151.537165 [email protected] Vorsitzender Dr. Karl H. Hamsch stellvertretende Vorsitzende Jutta Rechel Schatzmeister Helmut Buck „Ich betrachte den Rhythmus als den ersten und wichtigsten Teil der Musik. Ich denke, dass er wahrscheinlich vor der Melodie und Harmonie existiert hat.“ Oliver Messiaen Wir danken dem Blumenstudio Petra Kalbfuss für die Blumenspende. Bessunger Str. 54, 64285 Darmstadt Telefon 06151 . 63984 Impressum Spielzeit 2016 | 17, Programmheft Nr. 41 | Herausgeber: Staatstheater Darmstadt Georg-Büchner-Platz 1, 64283 Darmstadt, Telefon 06151.2811-1 Intendant: Karsten Wiegand | Geschäftsführender Direktor: Jürgen Pelz Redaktion und Texte: Gernot Wojnarowicz | Mitarbeit: Daria Semenova Sollte es uns nicht gelungen sein, die Inhaber aller Urheberrechte ausfindig zu machen, bitten wir die Urheber, sich bei uns zu melden. Gestalterisches Konzept: sweetwater | holst, Darmstadt Ausführung: Hélène Beck | Herstellung: Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden „Die Spannung besteht darin, immer das Unbequemste zu finden.“ György Kurtág 18