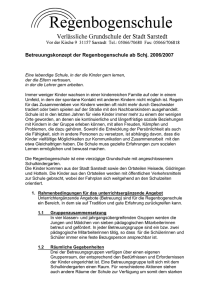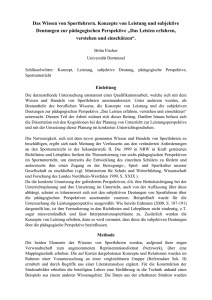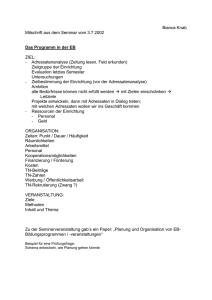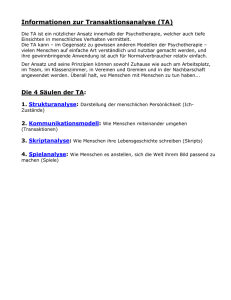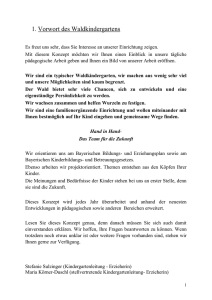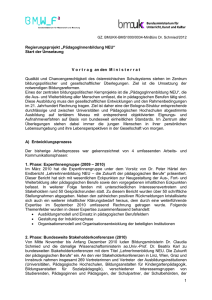Pädagogische Haltung
Werbung
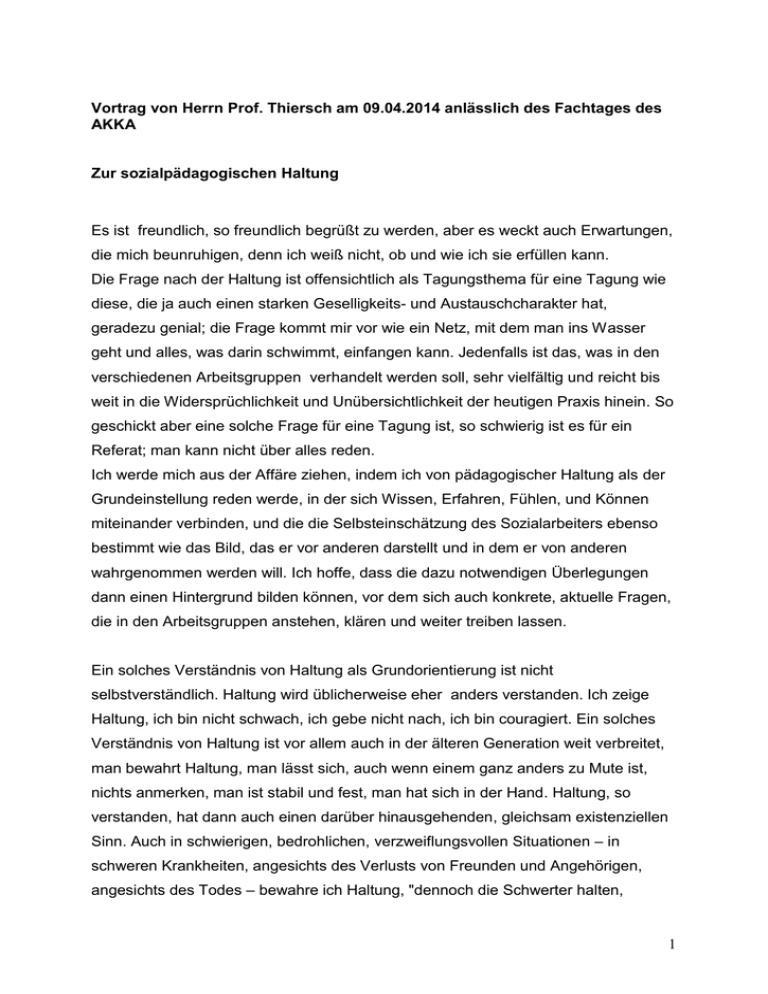
Vortrag von Herrn Prof. Thiersch am 09.04.2014 anlässlich des Fachtages des AKKA Zur sozialpädagogischen Haltung Es ist freundlich, so freundlich begrüßt zu werden, aber es weckt auch Erwartungen, die mich beunruhigen, denn ich weiß nicht, ob und wie ich sie erfüllen kann. Die Frage nach der Haltung ist offensichtlich als Tagungsthema für eine Tagung wie diese, die ja auch einen starken Geselligkeits- und Austauschcharakter hat, geradezu genial; die Frage kommt mir vor wie ein Netz, mit dem man ins Wasser geht und alles, was darin schwimmt, einfangen kann. Jedenfalls ist das, was in den verschiedenen Arbeitsgruppen verhandelt werden soll, sehr vielfältig und reicht bis weit in die Widersprüchlichkeit und Unübersichtlichkeit der heutigen Praxis hinein. So geschickt aber eine solche Frage für eine Tagung ist, so schwierig ist es für ein Referat; man kann nicht über alles reden. Ich werde mich aus der Affäre ziehen, indem ich von pädagogischer Haltung als der Grundeinstellung reden werde, in der sich Wissen, Erfahren, Fühlen, und Können miteinander verbinden, und die die Selbsteinschätzung des Sozialarbeiters ebenso bestimmt wie das Bild, das er vor anderen darstellt und in dem er von anderen wahrgenommen werden will. Ich hoffe, dass die dazu notwendigen Überlegungen dann einen Hintergrund bilden können, vor dem sich auch konkrete, aktuelle Fragen, die in den Arbeitsgruppen anstehen, klären und weiter treiben lassen. Ein solches Verständnis von Haltung als Grundorientierung ist nicht selbstverständlich. Haltung wird üblicherweise eher anders verstanden. Ich zeige Haltung, ich bin nicht schwach, ich gebe nicht nach, ich bin couragiert. Ein solches Verständnis von Haltung ist vor allem auch in der älteren Generation weit verbreitet, man bewahrt Haltung, man lässt sich, auch wenn einem ganz anders zu Mute ist, nichts anmerken, man ist stabil und fest, man hat sich in der Hand. Haltung, so verstanden, hat dann auch einen darüber hinausgehenden, gleichsam existenziellen Sinn. Auch in schwierigen, bedrohlichen, verzweiflungsvollen Situationen – in schweren Krankheiten, angesichts des Verlusts von Freunden und Angehörigen, angesichts des Todes – bewahre ich Haltung, "dennoch die Schwerter halten, 1 wissend dass sie (die Welt) zerfällt" zitierte man früher Gottfried Benn. Von solcher Haltung wird im Folgenden nicht die Rede sein. Zur Aktualität und Problematik der gegenwärtigen Rede von sozialpädagogischer Haltung Von Haltung, so wie sie hier verstanden werden soll, als Grundeinstellung in der sozialen Arbeit, ist in der letzten Zeit vielfältig die Rede. Die Gesellschaft für Heimerziehung hat gerade darüber ein Buch publiziert, es gibt Tagungen zum Thema. Das führt auf die Frage, warum dieses Thema zur Zeit offenbar dringlich ist. Es hat, denke ich, sehr vielfältige und unterschiedliche Gründe, die auch in manchem anklingen, was in den Arbeitsgruppen mit der Frage nach Haltung assoziiert werden soll. Ich erinnere an einige dieser Konstellationen. Angesichts der Vielfältigkeit des gegenwärtigen Methodenangebots und seiner Differenziertheit taucht immer wieder die Frage auf, was die hinter allen Einzelheiten und technischen Details liegende Grundkonzeption ist, welche Haltung sich in und hinter ihnen repräsentiert. Angesichts der so unterschiedlichen und widersprüchlichen, ja sich ausschließenden Interessen der in eine „Fallgeschichte“ verwickelten Menschen und der daraus resultierenden unterschiedlichen Erwartungen an die Solidarität des Sozialarbeiters stellt sich die Frage nach Nähe, und Distanz und der zwischen den verschiedenen Positionen vermittelnden und verbindenden Einstellung. Die Frage danach drängt sich vor allem – und oft verzweiflungsvoll – auf, wenn sich der Alltag der Arbeit in Amtserwartungen zu verlieren droht, in Erwartungen an Einsparungen, an die Modularisierung der Arbeitsvollzüge, an ausführlich detaillierte Dokumentation, an Prüfbarkeit und Absicherung gegen eventuelle Einsprüche. Was ist – so stellt sich die Frage – hinter all diesen Erwartungen die Intention der Arbeit? Wozu – etwas drastischer formuliert – bin ich denn Sozialarbeiter geworden? Die Frage nach der Grundeinstellung aber stellt sich neuerdings auch, und ich denke besonders gravierend, angesichts der vielfältigen öffentlichen Unterstellungen, Soziale Arbeit versage, habe kein angemessenes Konzept für die heutigen Aufgaben. Es gab in der letzten Zeit immer wieder schreckliche Skandale, es kann gar nicht in Frage stehen, dass sie streng und umfassend aufgearbeitet werden müssen. Aber es braucht auch organisationelle Arrangements der Klärung und, vor 2 allem, der Prävention. Die Art aber, wie solche Skandale immer wieder in der Öffentlichkeit – in den Medien ebenso wie in der Politik – verhandelt werden, ist beunruhigend und fatal. Ich verdeutliche das Problem am Gegenbild: In einer Kinderklinik – so wurde berichtet – sind zwei Frühgeborene durch unzureichende Behandlung der Klinik gestorben. Der Klinikchef nahm Stellung: Dies sei fürchterlich, die Klinik aber sei international renommiert, es kämen jedes Jahr Hunderte von Kindern gesund zur Welt, die Klinik habe seit Jahren ein elaboriertes Krisenmanagement, man werde es verbessern. Mein Punkt ist nun, dass in diesem Fall kein Kritiker und keine Öffentlichkeit auf die Idee käme über den Umgang der Medizin mit Frühgeborenen und über Grundsätzliches zur Klinikorganisation zu diskutieren. Die Klinik bleibt, natürlich, auch in solchen Krisen zuständig für die Bearbeitung und Verbesserung ihrer Arbeit. – Gerade die grundsätzlichen kritischen Diskussionen werden in der Sozialen Arbeit, vor allem auch von Nichtsozialarbeitern, geführt. Jeder fühlt sich berufen zu Kritik und zu neuen Konzepten. Der Skandal wird als Indiz dafür genommen, dass die Arbeit des Jugendamts prinzipiell infrage gestellt werden muss und , dass es an Organisationen und Methoden fehle, um heutigen Problemen gerecht zu werden, dass sie nur – um einen ehemaligen Ministerpräsidenten zu zitieren – Kuschelpädagogik oder Verständigungspädagogik treiben und endlich begreifen müssten, dass es auf Forderungen, und Entschiedenheit ankomme. – Solche Attacken provozieren natürlich die Frage nach Eigenart, Notwendigkeit und Angemessenheit der in der Sozialen Arbeit praktizierten Intentionen, nach der Haltung, der Grundeinstellung in unserer Arbeit. Also: Was bestimmt die Grundeinstellung unserer Arbeit, die pädagogische Haltung? So dringlich die Frage ist, so scheint sie mir doch auch vielfältig missverständlich. Ich muss deshalb, ehe ich mich auf sie einlassen kann, noch Vorbemerkungen machen, um Missverständnisse nicht erst aufkommen zu lassen. Ich habe eingangs Haltung als Ineinander von Wissen und Erfahrung, von Wissen, Fühlen, und Können bestimmt. Dies hört sich selbstverständlich an, ist es aber nicht. Ich muss verdeutlichen, was gemeint ist. 3 Haltung als Grundeinstellung, die sich in der Einstellung hinter den konkreten Aktionen und Begegnungen zeigt, scheint etwas Unmittelbares, Selbstverständliches. Haltung in diesem Sinn wird immer wieder mit Echtheit, mit Authentizität des Verhaltens zusammen gebracht. Das aber kann dazu verführen, dass man, jenseits aller methodischen Raffinessen und Unterschiedlichkeit in den Aufgaben davon ausgeht, dass es nur darauf ankomme, die richtige Haltung zu repräsentieren, sich authentisch in die Arbeit einzubringen. Dies aber wäre vereinfacht und darin fatal. – Haltung als Grundeinstellung ist immer aus sehr unterschiedlichen, in ihr dann zusammenfließenden Hintergründen gewachsen, sie entwickelt sich aus den je individuellen menschlichen Dispositionen und Erfahrung in der Biografie, sie ist bestimmt aus Lernerfahrungen, also aus Theoriewissen, aus Berufserfahrungen und ihrer Verarbeitung, vor allem auch im Miteinander der Arbeit im Kollegenkreis. Haltung ist – schließlich und vor allem – geprägt durch die kulturellen, sozialen und organisationellen Rahmenbedingungen, unter denen sie praktiziert wird. Haltung – um es zu pointieren – zeigt sich zwar in der Unmittelbarkeit der Handlung, ist darin aber das gleichsam zur Selbstverständlichkeit geronnene Ineinander der vielfältigen Lern-, Lebens- und Berufserfahrungen in den Konstellationen der jeweiligen Kultur und Zeit. Ich will das noch unter zwei Aspekten verdeutlichen. Das, was Pädagogen als Haltung verstehen, zeigt sich in unterschiedlichen historischen Kontexten sehr unterschiedlich. Da im vorausgehenden Referat schon mit vielfältigen Bibelassoziationen argumentiert wurde, will auch ich das Problem daran verdeutlichen. Die Haltung des Pädagogen war lange und selbstverständlich bestimmt durch Strenge. „Wen Gott lieb hat, den züchtigt er“ - ich denke, dass es wenig Bibelverse gibt, die pädagogisch so verhängnisvoll gewirkt haben wie dieser, mit dem nicht nur Autorität, sondern auch Gewalttätigkeit, Demütigung Stigmatisierung und Aggresivität und der Kampf um Macht und Durchsetzung begründet wurde. Das eindrückliche Buch von Jürgen Wensierski: "Schläge im Namen des Herrn" zeigt, wie im Namen einer solchen Maxime eine Haltung begründet wurde, die sich bis in die sechziger/siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hat fortsetzen können und die, von uns unserem heutigen Verständnis der christlichen Botschaft aus nur als sadistische Praxis der Menschenverachtung verstanden werden kann. – 4 Das, was sich als Haltung repräsentiert, ist Ausdruck sehr unterschiedlicher theoretischer – anthropologisch-psychologischer und gesellschaftlicher – Annahmen über den Charakter des menschlichen Umgangs und der Erziehung. Pestalozzi etwa beschreibt in seinem Stanser Brief – seinem Bericht über die Erziehung verwahrloster Kinder –, dass Erziehung die Aufgabe der „allseitigen Versorgung“ habe und darin vor allem die des unmittelbaren, intensiven direkten Kontakts zwischen Erzieher und Zögling, des pädagogischen Bezugs, wie man später verallgemeinert hat. Pestalozzi, so beschreibt er es, liebt den Zögling unbedingt und der Zögling ihn wiederum ebenso; in geradezu biblisch blasphemischer Formulierung heißt es, dass er bei ihnen und sie bei ihm seien; es geht also um die innige Verbindung zwischen Kind und Erzieher, die Pestalozzi als so stabil beschrieb, dass Kinder auch dann, wenn er sie prügelte – prügeln musste, wie er meinte – sie ihm dafür dankbar waren, denn sie wussten, dass er es aus Liebe getan hatte. – Siegfried Bernfeld, 150 Jahre später in Wien im Kinderheim Baumgarten berichtet über seinen Umgang mit verwahrlosten Kindern; er vertrat eine geradezu entgegengesetzte Meinung. Er misstraute dem persönlichen Bezug, der erschien ihm als zu belastet mit emotionalen Erwartungen und Okkupationen. Er beschrieb, dass Pädagogen, wenn man sie nach sich und ihrer Arbeit fragte , zu sich selbst und der Art ihres Verhältnisses zu den Kindern wenig zu sagen hätten, dass sie aber beschreiben könnten, was sie an den Kindern sähen und beobachteten, was die Kinder von sich aus wollten. Seine Konsequenz war die Einrichtung von Schülerversammlung und Schülergericht, also von Arrangements, in denen die Kinder, unbelastet von den Ansprüchen und Schwierigkeiten eines direkten persönlichen Bezugs zu Erziehern – unter sich Regelungen finden, ihr Leben auch im Konfliktfall miteinander zu ordnen. Das sind zwei grundsätzliche Positionen, in denen sich pädagogische Haltungen darstellen. Es wäre nicht schwer, die Darstellung solcher Positionen zu erweitern. Hans Ulrich Krause ( Veröffentlichungen der IGfH ) hat in einem Beitrag zur pädagogischen Haltung noch ganz andere, sehr unterschiedliche historische Konstellationen pädagogischer Haltung dargestellt. Das will ich hier nicht tun, ich belasse es bei den gegebenen Andeutungen. Ich will versuchen, einige Momente pädagogischer Haltung, die sich aus dem Konzept der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit ergeben, zu skizzieren. Dabei werde ich manches sehr verkürzen müssen, was ich in anderem Zusamenhang ausführlicher dargestellt habe ( s. z.B. in 5 meinem Buch: Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, 9. Aufl. 2013 und in Klaus Grunwald/ Hans Thiersch: Praxis der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit, 2.Aufl, 2009 Ich brauche dazu aber noch eine Vorbemerkung. Von Haltung reden bedeutet immer auch, einen Anspruch zu formulieren. Das aber hat einen moralisierenden Beigeschmack; es klingt, als wüsste man schon immer, was gut wäre, als sollten Menschen beurteilt, ja verurteilt, jedenfalls in die Pflicht genommen werden. Das aber wäre anmaßend und vor allem immer auch überfordernd – zumal in den heutigen gegebenen Arbeitsschwierigkeiten und gesellschaftlichen Unwilligkeiten, wie ich sie oben ja gerade angedeutet habe. – Dass Haltung einen Anspruch formuliert, ist so; es ist im Charakter des menschlichen Handelns begründet, das immer zwischen Gegebenem und Aufgegebenem ausgespannt ist. Wenn man nicht weiß, was werden soll, wird man niemals das tun können, was möglich ist. Es braucht den Überhang an Erwartungen, damit von da aus Kriterien und Möglichkeiten für das Gegebene möglich sind. Goethe hat es pointiert zusammengefasst, wenn er sagt, dass man niemals das erreichen könne, was möglich ist, wenn man nicht das Gegebene durch das Bild des Besseren überschreite. Gleichheit und Unterschiedlichkeit zwischen Helfern und denen, die auf Hilfe angewiesen sind. Ein erstes, entscheidendes Moment zur Bestimmung von Haltung ist das Wissen, dass wir als Sozialarbeiter in einem helfenden Beruf tätig sind, dass wir in diesem Beruf aber – so trivial das klingt – Menschen unter Menschen sind. Alle Menschen können in Schwierigkeiten geraten, alle Menschen können in die Lage geraten, dass sie anderen in Schwierigkeiten bei- stehen, "denn jeder Mensch braucht Hilf` von allen", hieß es bei Brecht. Also: Es geht um jeden, es geht um alle. In der Bibel heißt es, dass alle gemeinsame Kinder Gottes sind, im Buddhismus, „ tat wam asi“, „das bist Du“. Ich fand es interessant, dass der zeitgenössische Soziologe Richard Sennett in seinem Buch über Respekt (einem wunderbar auch sehr sozialpädagogischen Buch), das Respekt als Grundtugend aller Sozialen Arbeit versteht, darauf hinweist, dass die Tatsache, dass Menschen Hilfe brauchen, natürlich sei und nichts irgendwie Besonderes bedeute. Es liege im Charakter des Sozialen und sei Ausdruck der menschlichen Situation; in ihr erführen Menschen, 6 dass das Leben schwierig ist und angewiesen auf Unterstützung; manche würden durch Zufall, durch verdichtete Umstände, durch ihre Lebensgeschichte oder die soziale Lage in ein Verhalten hineingetrieben, in dem sich Handlungen verhärten, in denen sie unglücklich sind und mit denen die Gesellschaft unglücklich ist, das auf gegenseitige Hilfe angewiesen ist. An dieses Faktum als gleichsam existenzielles Grundfaktum allen Lernens und aller Hilfe immer wieder zu erinnern, scheint mir notwendig, weil in unserer Profession die Gefahr liegt, das zu verdrängen und zu vergessen. Helfen bedeutet immer auch Distanz, verlangt, dass der, der hilft, etwas hat, was dem anderen fehlt, bedeutet also Ressourcen, Wissen, Erfahrung und Abstand. Weil man verstehen, begleiten, helfen und unterstützen will, gerät man in Gefahr, sich über den anderen zu erheben. – Dies ist ein allgemeines menschliches Faktum, das in der strukturellen Asymmetrie allen Helfens angelegt ist; darauf werde ich später noch einmal ausführlich zurückkommen. Hier begnüge ich mich – um die Bedeutung dieses Faktum zu unterstreichen – mit einem Hinweis: Wenn ich Lehrbücher über Beratung studiere, kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass sie von einer Flottilie wohlmeinend kluger Leute verfasst sind, die wissen, wo es lang geht, und die den anderen demonstrieren, wie hilfreich ihr Wissen ist, und wie töricht es ist, dem, was sie vorschlagen, nicht zu folgen. Ich lese sie als eine – ich würde frech formulieren – Versammlung von Selbstgerechten, – ich geniere mich, wie ungeschickt, verbockt und falsch ich es immer anstelle. Also: Wir sitzen alle im selben Boot – das ist das erste. Das zweite ist – und das erinnernd zu betonen scheint mir eben so wichtig, weil es immer auch irritierend ist – wir sitzen alle im gleichen Boot der Erfahrung von Schrecklichkeiten, Abartigkeiten, Missverständlichkeiten, von scheußlichen, abwegigen, für andere schädlichen und oft schwer nachvollziehbaren Erfahrungen und Handlungen. Plato hat einmal gesagt, dass der Unterschied zwischen den guten Menschen und den Verbrechern darin bestehe, dass die einen das träumen, was die anderen tun. Dies scheint mir hilfreich: Auf dem Weg des Träumens erschließen sich Zusammenhänge, Verhängnisse, Abwege, die vielen von uns jedenfalls in ihrem Bewusstsein fremd, unverständlich und abstoßend erscheinen. Das dritte, elementare Moment zur Bestimmung sozialpädagogischer Haltung ist, dass wir uns immer bewusst sein müssen, dass wir in einer sozialstaatlichen 7 Wohlfahrtsgesellschaft leben, also in einer Gesellschaft, in der Hilfe und Ansprüche als Rechtsansprüche von Bürgerrechten verstanden, wahrgenommen und angegangen werden. Gleichheit, also die Aufhebung einer prinzipiellen Differenz zwischen dem, der hilft, und dem, der auf Hilfe angewiesen ist, ist aufgehoben in Bürgerstatus. In unserer Gesellschaft hat – so jedenfalls ist es formuliert – jeder ein Recht auf ein Leben in Würde und jedes Kind ein Recht auf Erziehung und Bildung in förderlichen Verhältnissen. Das sind Ansprüche, die nicht in der Attitüde einer herablassendem Freundlichkeit oder mildtätigen Caritas erfüllt werden können, sondern die im Wissen um die Gleichheit zwischen Bürgern erfüllt werden müssen. Bürger müssen gerade da, wo sie auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind, in ihrem Status als Bürger anerkannt werden. Also: alle Menschen brauchen wechselseitige Hilfe, weil sie in die Situation der Bedürftigkeit geraten können, weil sie auch in den Möglichkeiten von Abgründen und Verwilderungen gleich sind und weil sie als Bürger miteinander leben. Die Betonung der Gleichheit aller in der Sozialen Arbeit hebt aber die Probleme nicht auf, die darin liegen, dass Hilfe als Hilfe eine besondere Form des Umgangs miteinander ist – ich habe es gerade schon angedeutet. Die Bestimmung des pädagogischen Handelns. Um diese spezifische Form des Umgangs näher zu bestimmen, scheint es mir hilfreich, zunächst auf jenen Satz von Herman Nohl zurückzugehen, der die Eigenart des pädagogischen Geschäfts darin bestimmt hat, dass Pädagogen parteilich zu sein haben für die Eigensinnigkeit, für die Entwicklung und die Bildungsprobleme, die Menschen haben und nicht für die Probleme, die sie der Gesellschaft machen; der Pädagoge ist Anwalt dieser Selbstsicht, dieser Entwicklungs- und Lebensprozesse, in denen Heranwachsende und Menschen zu ihrer Form – also aus ihren Schwierigkeiten heraus zu ihren eigenen Möglichkeiten – finden können. – Die Bedeutung dieses Satzes wird, so scheint mir, sehr deutlich im Vergleich zur Frage nach der Aufgabe der Polizei; ich habe das früher mit Walther Specht, dem Vertreter der Mobilen Jugendarbeit, einmal sehr ausführlich durchgespielt. Auch die Polizei kümmert sich um Menschen und oft ja sehr konkret; Polizisten sind an Kenntnis und Geschicklichkeit im Umgang mit schwierigen Jugendlichen oft sehr ausgewiesen und geschickt, und bisweilen auch geschickter als Sozialarbeiter. Aber sie haben einen 8 anderen Auftrag; sie müssen Probleme von der öffentlichen Ordnung aus sehen und von da aus definieren und verfolgen. Das geht natürlich nicht, ohne dass sie sich für die Menschen interessieren, und von da aus bestimmen sich in unterschiedlichen Konstellationen ihre Handlungsmuster, aber der Ansatz liegt bei der öffentlichen Ordnung, die sie zu gewährleisten haben. Unser Auftrag – dagegen gestellt – ist nicht primär die öffentliche Ordnung. Dass Menschen lernen müssen, sich in die öffentliche Ordnung einzupassen, ist selbstverständlich, ist aber, dem pädagogischen Auftrag gegenüber, das zweite, nachrangige, das, was von den je individuellen Entwicklungsmöglichkeiten aus zu bearbeiten und zu klären ist. Dieses, der spezifische pädagogische Ausgang von den Menschen und ihren Entwicklungsmöglichkeiten, kann näher bestimmt werden. Ich habe es versucht, indem ich die pädagogische Haltung in der Trias von Liebe, Vertrauen und Neugier beschreibe. Das sind eher altmodische und darin vielleicht befremdliche Begriffe, ich will sie deshalb umformulieren und konkretisieren. - Liebe meint die unbedingte Anerkennung des anderen als Mensch in seinem Menschsein und seinem Bürgersein. Die unbedingte Anerkennung – das formulieren wir heute recht selbstverständlich, Gott sei Dank, nachdem wir in der Sozialpädagogik in Deutschland im vorigen Jahrhundert gerade dieses Gebot in schauerlicher Weise massenhaft mit Füssen getreten haben, vom Abschieben der so definierten „unerziehbaren Jugend“ bis zur Ausrottung des lebensunwerten Lebens und bis zum schrecklichen Rassenwahn. – - Vertrauen, das zweite Bestimmungsmoment, bedeutet Vertrauen in die Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten des Menschen, das, was in der traditionellen Pädagogik als Bildsamkeit beschrieben worden ist. Jeder Mensch hat Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern, Potenziale freizusetzen – sich also in Bezug auf seine Handlungen, aber ebenso auch in Bezug auf die Einstellungen zu seinen Handlungen und zu sich selbst zu verändern. – - Besonders wichtig scheint mir das dritte Bestimmungsmoment zu sein, die Neugier, Neugier als Grundeinstellung anderen Menschen gegenüber. Ich bin gespannt darauf, was die Kinder/die AdressatInnen in ihrer Eigentätigkeit, ihrem Eigensinn, aus ihren Möglichkeiten, ihren Potenzialen und Fantasien heraus an Lösungsmöglichkeiten und Lebenskonzepten entwickeln und zeigen. Neugier meint das Interesse an der Eigenwilligkeit, der Originalität, vielleicht auch an der Knubbeligkeit gerade auch in 9 Schwierigkeiten: Neugier verlangt, dass ich bei dem, was der andere zeigt, zunächst suche, was es für ihn bedeutet, was in dem, was er zeigt, die Intention ist, – also, noch einmal anders formuliert, - dass ich mich zurückhalte in Interpretationen, Deutungen und Bewertungen von dem, was er oder sie zeigt. Solche Neugier scheint mir in unseren heutigen Verhältnissen besonders wichtig, die so sehr riskant, offen, entgrenzt und unübersichtlich sind, in denen Menschen sich auf sehr eigene, eigenwillige und situativ geprägte Weise bewegen und bewegen müssen. Gerade in unseren pädagogischen Vorstellungen und Hinweisen auf Hilfe und Unterstützung sind wir angewiesen auf diese eigensinnigen Konzepte. „Du sollst dir kein Bildnis machen" war in den sechziger Jahren ein weit verbreitetes Diktum, damals in Anlehnung ja auch an die Romane von Max Frisch. Also: Die pädagogische Haltung ist bestimmt durch die Parteilichkeit für das Werden, für die Chancen und Wege des Werdens des Menschen. Liebe, Vertrauen und Neugier konkretisieren diese Parteilichkeit. Diese allgemeinen Strukturen können nun noch einmal näher bestimmt werden im Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit, die darauf zielt, dass menschliches Leben in der Alltäglichkeit von Lebensverhältnissen erfahren, gelebt und gestaltet wird, dass also die Momente des helfenden und des pädagogischen Handelns im Medium alltäglicher Erfahrungen und der darauf bezogenen pädagogischen Handlungsmuster realisiert werden. Dazu braucht es noch einmal eine genauere Bestimmung des Alltags, also der Situation, in der Menschen sich im Leben erfahren, und der von daher geprägten besonderen Akzentuierungen des pädagogischen Handelns. Konkretisierungen der Lebensverhältnisse im Alltag und der helfenden und pädagogischen Haltung im Medium von Alltags- und Lebensweltorientierung Dazu zunächst eine Vorbemerkung. Dies, dass Menschen in ihrem Alltag verstanden werden müssen, wird leicht als selbstverständlich, als Trivialität angesehen und damit missverstanden; die neuere Diskussion in Philosophie und Soziologie und von da aus dann auch in der Sozialen Arbeit aber hat sehr eindringlich deutlich gemacht, dass diese Trivialität nur vordergründig ist. Die Annahme von Trivialität unterschlägt, in welchen sehr spezifischen, eigensinnigen und oft übergangenen Mustern Alltagsbewältigung praktiziert wird. Diese Analysen und Rekonstruktionen sind ein weites Thema – und ich habe sie ja immer wieder in vielfältigen 10 differenzierenden Texten darzustellen versucht: z.B. in „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit ( 9. Aufl. 2013) oder zusammen mit Klaus Grunwald in „Praxis Lebensweltorientierter Sozialer Arbeit“ ( 2. Aufl. 2011) bzw. in „Lebensweltorientierte Soziale Arbeit“ in Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Online (2014 im JuventaVerlag). Ich beschränke mich hier auf wenige Hinweise. Alltag und Lebenswelt Zum ersten: Unsere AdressatInnen müssen als Menschen verstanden werden , die sich mit den Verhältnissen auseinandersetzen, in denen sie sich vorfinden, also nicht gleichsam als Subjekt, isoliert in ihren Fähigkeiten, ihren Kompetenzen, ihren Einstellungen. Sie müssen gesehen werden, im Gefüge der Strukturen, in denen sie leben, und in ihren Versuchen, sich in diesen Strukturen zu behaupten; menschliches Verhalten – noch einmal anders formuliert – ist immer nur im Kontext dieser Strukturen zu verstehen, als Versuch, mit ihnen zurande zu kommen, sich ihnen unterzuordnen, sie zu verändern, aus ihnen auszubrechen, als Versuch, auf die in den Strukturen ihnen vorgegebenen Verhältnisse und Aufgaben Antworten zu finden. Diese Strukturen sind bestimmt durch den sozialen Raum, in dem die Menschen leben, durch die zeitliche Ordnung, in der sie sich vorfinden, und durch die in ihnen vorgegebenen Beziehungsgefüge. Ich verdeutliche dies hier nur an einigen Beispielen, die zeigen können, wie diese Strukturen prägen und was es bedeutet, wenn sie angstbesetzt sind, wenn sie Menschen also in ihren Möglichkeiten einschränken. - Zum Beispiel gibt es Gruppen junger Menschen, die in dem Bezirk, in dem sie wohnen, gleichsam angewachsen sind; ihn kennen sie, hier fühlen sie sich sicher; sie trauen sich aber nicht heraus zu gehen in die Fremde. Wohnungslose Menschen trauen sich nicht in das ihnen fremd gewordene Milieu des Arztes und es braucht große Mühe, sie, wenn sie gefährlich krank sind, dazu zu überreden. Oder psychiatrisch belastete Menschen haben Angst, auf die Straße herauszugehen oder auf der Straße weiter zu gehen oder gar bis ins Amt. Ich erinnere mich auch an die eindrucksvollen, beängstigenden Geschichten von Menschen, die in Schulden geraten sind, und solche Angst hatten, Bankbriefe zu öffnen, dass sie sie in einem Kasten ungeöffnet gestapelt hatten, Bankbriefe, in denen dann vor allem ja auch die Zinsen angemahnt wurden, die ein mehrfaches der früheren Schulden betrugen. – Die Welt ist angstbesetzt und man denkt, wenn man nicht hinausgeht, sei sie nicht da. – Oder, noch ein ganz anders Beispiel: In einer sehr vom Mann dominierten 11 Familie verliert die Mutter ihr Selbstvertrauen, sie wird krank und traut sich schließlich nicht mehr aus dem Bett: was von ihr erwartet wird, kann sie nicht, sie sieht nicht, wie sie durch den Tag kommen soll, sie sieht , erst recht nicht, wie sie den nächsten Tag bestehen kann – , im Bett aber ist sie sicher. Zum Zweiten: In ihrem Alltag haben alle Menschen das Bestreben, irgendwie mit ihren Verhältnissen zurande zu kommen. Sie sind pragmatisch orientiert, sie agieren „irgendwie“, d.h. sie sehen nicht so sehr auf Prinzipien oder allgemeine Regeln, sie fragen nicht nach Hintergründen und Zusammenhängen, sie sind froh, wenn sie sich auskennen, wenn sie zurande kommen, wenn es klappt. Man will in der Situation überstehen und das unmittelbar Anstehende unaufwendig und verlässlich erledigen. – Diese pragmatischen Lösungsmöglichkeiten müssen gesehen und zunächst einmal respektiert werden: Menschen mit Schwächen, zum Beispiel Analphabeten, entwickeln eine oft faszinierende Fähigkeit, sich trotz ihrer Schwierigkeiten zurecht zu finden, also sich auf der Straße, im Gasthaus, in der Arbeit so einzurichten, dass sie zurande kommen und nicht auffallen. Pragmatismus gibt Sicherheit und Selbstverständlichkeit. Zum dritten: Wenn Menschen mit ihrem Alltag zurande kommen müssen und dies ihnen gelingt haben sie darin ihren Stolz ; sie möchten akzeptiert werden als Menschen, die können, was anfällt. In der Erziehungsberatung kommt es immer wieder zu anstrengenden Diskussionen, wenn Eltern mit Problemen der Kinder kommen und dann verstehen und zugeben müssen, dass sie selbst das Problem sind bzw. haben, und die Berater den Stolz der Eltern und ihr Selbstbild angehen und zusehen, müssen, wie sie ein Arbeitsverhältnis so aufbauen, dass die Eltern gewillt sind, sich darauf einzulassen. - In früheren Seminaren über Beratung hat es mich sehr beschäftigt, dass Studierende der Sozialen Arbeit, befragt, an wen sie sich in Problemen wenden würden, mehrheitlich zunächst auf Freunde und Verwandte oder vielleicht Bücher verwiesen haben, und auf Berater – also sich selbst in ihrer zukünftigen Rolle – erst zuletzt: Man scheut sich, sich vor anderen in seinen Problemen, also in der Unzulänglichkeit der Alltagsbewältigung darzustellen. – In diesem Zusammenhang scheinen mir die alten Analysen von Goffman spannend, der jene Techniken beschreibt, die Menschen praktizieren um zu verbergen, dass sie, an Maßstäben der Normalität gemessen, einen Makel haben; Goffman beschreibt die breite Skala von Ausweichen, Verstecken, Übergehen, Kompensieren, auch mit allem strapaziösen Nebenfolgen, die entstehen, wenn man sich in diesem 12 Stigmamanagement verhakelt, verläuft, wenn man zum Beispiel selber nicht mehr übersieht, was man wem in welchen Kontexten erzählt und wie erzählt hat. – Für uns in der Sozialen Arbeit liegt hier ein großes Problem; das Angebot von Unterstützung und Hilfe ist immer auch eine Zumutung, eine Kränkung. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass deshalb Menschen, die zu uns kommen, auch prüfen und abtasten, ob und inwieweit es sinnvoll ist, dass sie mit uns zusammenarbeiten, ob sie uns vertrauen können. In der Jugendarbeit – um noch einmal ein anderes Beispiel zu nehmen – ist es immer wieder spannend, in welchem oft ja auch sehr provokativen Konstellationen Jugendliche die Sozialarbeiter testen, ob sie, wie es heißt, "echt" sind. –, Respekt vor dem Alltagsarrangement der AdressatInnnen bedeutet, dass man diese Techniken zunächst einmal respektiert, sie also nicht gleich als Täuschung, Lüge oder Bosheit aufzudecken versucht, sondern sie in ihrer Intention sieht. Nun aber: Akzeptieren, verstehen, ernstnehmen der Menschen in ihren Verhältnissen ist das eine, das andere aber ist, dass Menschen in ihrem Alltag in einer widersprüchlichen, gespaltenen Situation leben: Sie leben, wie es Karel Kosik, ein Theoretiker des Alltags, formuliert hat, im „Dämmerlicht von Wahrheit und Täuschung“, im Dämmerlicht einer Situation, die zugleich befriedigend und unbefriedigend, glücklich und unglücklich ist. Menschen sehen, wie sie sich arrangieren können, sie haben ihren Stolz darin, zurande zu kommen, sie haben zugleich aber auch ein Gefühl dafür, dass es in diesem Alltag Unzulänglichkeiten gibt – sie können nicht alles, was sie können sollten, sie müssen sich mit unzureichenden Ressourcen abfinden, sie leben in Verhältnissen, die durch Macht und Unterdrückung bestimmt sind, sie fühlen sich bedrängt und leiden in den Zumutungen der Verhältnisse, sie sind enttäuscht, dass sich das, was sie sich erwartet haben, nicht einlöst; sie haben – etwas allgemeiner und mit Ernst Bloch formuliert – einen Hunger nach einem Leben, das anders sein könnte, als sie es leben. Sie haben Wünsche, Träume und Hoffnungen. Alltags- und lebensweltorientierte Soziale Arbeit An diese Hoffnungen und Wünschen anzuknüpfen, ist Aufgabe der Sozialen Arbeit; sie versteht sich als deren Anwalt, nimmt diese Anwaltschaft aber in einer spezifischen Form wahr. 13 Soziale Arbeit agiert auf zwei Ebenen; sie agiert in den gegebenen Verhältnissen und in ihren darin angelegten, versteckten, übergangenen Potenzialen. Soziale Arbeit agiert, so gesehen, immer doppelbödig, sie meint den Respekt vor den gegebenen Verhältnissen und zugleich die Zumutung, sich in ihnen darauf einzulassen, dass es auch anders, besser, gelingender sein könnte. Franz Hamburger, der Mainzer Sozialpädagoge, versteht, von hier aus gesehen, Soziale Arbeit als Transzendieren: Sie lasse sich auf Verhältnisse ein, verstehe Menschen in ihnen und transzendiere sie zugleich, indem sie die Verhältnisse mit ihren eigenen, besseren Möglichkeiten konfrontiert. – In diesem Transzendieren ist Soziale Arbeit bestimmt durch ihr Wissen um den Bürgerstatus der anderen, sie sieht also die Hoffnungen, Träume und Möglichkeiten der Menschen im Horizont des Projekts soziale Gerechtigkeit.Soziale Arbeit interpretiert und transformiert die Wünsche, Hoffnungen und Möglichkeiten der Menschen im Horizont sozialer Gerechtigkeit. Sie tut dies – und das bestimmt die spezifische Form ihrer Hilfe und deren Grenzen –, indem sie in institutionell-professionell bestimmten Programmen agiert, sie nutzt die Chancen der darin gegebenen Verlässlichkeit und Prüfbarkeit und der mit der Professionalität gegebenen Distanz, die die Freiheit zur Klärung und zum Entwurf neuerer weiterführender Optionen bietet. Sie ist in ihrem Handeln bestimmt durch die Möglichkeiten der institutionell gesicherten Angebote und des wissenschaftlich fundierten methodischen Handelns. In diesem Arbeiten in der Doppelbödigkeit der Verhältnisse, in der Doppelbestimmung des Handelns in der Vermittlung von Respekt und Transzendieren, repräsentiert und konkretisiert sich die zweiseitige, doppelbödige Bestimmung des helfenden und pädagogischen Handelns, wie ich es oben skizziert habe; ich will es im Kontext der Alltagsbestimmungen noch einmal aufnehmen und versuchen es damit genauer zu fassen. Soziale Arbeit ist, wie alles Helfen und Erziehen in ihrer Grundstruktur immer asymmetrisch; gewiss haben sich in den letzten 30 Jahren die Formen des Umgangs zwischen dem, der hilft, und dem, der auf Hilfe verwiesen ist, ganz grundsätzlich verschoben. Die alten Formen autoritärer Nötigung und Rücksichtslosigkeit sind – jedenfalls bei vielen – überwunden; das aber darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Differenz zwischen dem, der die Ressourcen hat zu helfen und dem, der darauf angewiesen ist, strukturell nicht aufgehoben werden kann. 14 Dieses Verhältnis kann im Modus der stellvertretenden Verantwortung oder einer advokatorischen Ethik gestaltet werden, wie Micha Brumlik oder Anne Frommann es formuliert haben. Menschen arrangieren sich in ihrem Alltag in einer Form, die ihren Möglichkeiten nicht entspricht. Soziale Arbeit übernimmt diese Möglichkeiten, repräsentiert also das, was die Menschen selbst, in den pragmatischen Nöten des Alltags verfangen, nicht erkennen und leben können, sie agiert stellvertretend für das, was sie – so die Annahme – wollen würden, wenn sie in ihrem Wollen frei wären. Weil Menschen sich in ihrer eigenen Situation nicht durchschauen, leistet dies Soziale Arbeit für sie als ihr Anwalt. Wenn dies aber im Respekt vor den gegebenen Verhältnissen und den darin gefundenen Lebensmöglichkeiten vermittelt werden muss, dann agiert Hilfe im Modus der Verhandlung – Verhandlung prinzipiell verstanden als Interaktion zwischen gleichberechtigten Partnern, jenseits der in solcher Verhandlung natürlich immer wieder auch nötigen dramatischen Auseinandersetzungen über konkrete Probleme und Alternativen. – Verhandlung, so verstanden, als Vermittlung von Respekt und Zumutung, lässt sich, so scheint mir, in die Formel fassen, dass es nicht darum geht, dass die einen ein Problem und die andere eine Lösung haben, sondern dass es darauf ankommt, die Lösung, die die einen haben, zu respektieren und zugleich zu hinterfragen, um von da aus dann andere Lösungen ins Spiel zu bringen, die in den Problemen, in denen die zunächst gegebene Lösung sich als unzureichend erwiesen hat, weiter führen könnte. Hilfe also nicht als Vermittlung von Problem und Lösung sondern von Problemlösung zu Problemlösung, von respektierter und doch unzulänglicher Problemlösung zu einer weiterführenden, gelingenderen. Um noch einmal auf die oben skizzierten Beispiele zurückzukommen: In der Arbeit mit Gruppen von jungen Menschen auf der Straße, in der Straßensozialarbeit also, geht es darum, anzuerkennen, dass junge Menschen aus vielfältigen Gründen ihre bisherigen Verhältnisse verlassen haben – weil sie sich in ihnen gedemütigt gefühlt haben, weil sie mit ihren Fähigkeiten in ihnen nicht zurande gekommen sind, weil sie sich in ihrer Selbstständigkeit und ihren Freiheitsansprüchen unterdrückt gesehen haben, es geht zum anderen darum, zu sehen und zu akzeptieren, dass junge Menschen hier Freunde und Gruppenzusammenhänge gefunden haben, die ihnen 15 Sicherheit geben, auch zu akzeptieren, dass dies ein Lebensstatus ist, der vielfältige Aufgaben stellt, die pragmatisch angegangen werden müssen und darin Energie, Vitalität und Fantasie verlangen; es geht aber ebenso darum, in dieser Situation – gestützt durch gewachsenes Vertrauen und die Erfahrung, dass Sozialarbeiter in vielen Situationen, vor allem auch in Krisen, nützlich sind – Optionen möglich zu machen, die die jungen Menschen selbst vielleicht so nicht sehen können, Optionen für ein wieder anderes Leben nicht mehr auf der Straße, also zum Beispiel dafür, dass verfahrene und zerrissene Kontakte – zur Arbeit, zur Schule, zu den Eltern – wieder geknüpft werden können. – Oder – das war ja das andere oben schon benutzte Beispiel - die Mutter, die sich in ihrer autoritären Familie selbst aufgegeben hatte, kann, vielleicht, allmählich, und gestützt durch das Vertrauen zur Sozialarbeiterin, sich trauen, zu denken, dass sie ihre Rollen als Mutter für die Kinder und ihren Mann erfüllen möchte und dass sie Wege finden muss, dies zu schaffen. Risiken, Reflexivität, Organisationskultur Aber, so alternativlos solches Verhandeln ist, so ist es doch immer auch in sich gefährdet; es muss gegen die in ihm angelegten Schwierigkeiten ausdrücklich ausgewiesen werden. Die in der Asymmetrie des pädagogischen Handelns liegende Macht verführt zu deren Missbrauch. Die neuen Sexualskandale machen erschreckend deutlich, in welche Abgründe des Machtmissbrauchs Pädagogen geraten können; das aber wäre ein eigenes, differenzierter zu verhandelndes Thema, das ich hier nicht weiter verfolgen kann ( s. dazu meine Arbeit in „Sorgende Arrangements“, hrsg von W.Thole, 2012); ich muss hier bei allgemeinen Bemerkungen bleiben. Bernfeld hat darauf verwiesen, dass der Pädagoge in dem Kind, das ihm gegenübertritt, immer mit drei Kindern zu tun hat, mit dem Kind, das er war, dem Kind, das er hätte sein wollen und dem Kind, das ihm gerade gegenübersteht; die Gefahr, dass dieses reale Kind von den anderen überdeckt wird, ist groß. Dieses Modell lässt sich, scheint mir, auf alle Formen von Hilfe verallgemeinern. Gegen solche Gefährdungen braucht es beim Sozialarbeiter/bei der Sozialarbeiterin die Arbeit an den eigenen biografischen Voraussetzungen, mit denen er den Kindern entgegentritt – an den Bildern, die er auch aus seiner eigenen Geschichte heraus von anderen hat, an den Beispielen, an den Erwartungen, aber auch an den Reizbarkeiten und 16 Enttäuschungen. Es ist in Fortbildungen und Supervisionen immer wieder erregend zu sehen, wie tief und nicht bewusst solche Vorstellungen vom richtigen Aufwachsen oder auch von dem, wie Eltern sich pädagogisch engagieren sollten, sitzen und wie sie das Handeln gleichsam hinter dem Rücken der Absichten bestimmen. Die Asymmetrie des pädagogischen Handelns bestimmt aber nicht nur diese Muster des direkten Umgangs, sie prägt vor allem den institutionellen Rahmen, der den Umgang zwischen SozialarbeiterIn und Adressaten bestimmt. SozialarbeiterInnen agieren, indem sie die Ressourcen und Möglichkeiten ihrer institutionell professionellen Programme – der Beratung, der Zuweisung zu Gruppen und zu neuen Aktivitäten – benützen, damit sich von diesen neuen Ressourcen, Erfahrungen und Sichtweisen neue Lebensräume eröffnen. Diese Aktivierung von Hilfe aber ist in sich ambivalent, sie geht damit einher, dass sie von den verfügbaren Programmen her bestimmt wird; institutionell-organisationelle Programme sind immer dazu verführt, gleichsam von ihren eigenen Möglichkeiten und Schwierigkeiten aus angewandt zu werden, sie sind selbstbezüglich oder – wie man auch formuliert – selbstreferentiell. Die von den Adressaten eingebrachten Probleme werden passend gemacht, sie werden in ihrer Eigensinnigkeit übergangen, kolonialisiert; ein Problem wird z. B. als Beratungsproblem definiert, obwohl eigentlich Familienhilfe angezeigt wäre, aber die ist zu teuer; oder es wird Familienhilfe arrangiert, um eine zu teuere Heimeinweisung zu umgehen. Untersuchungen machen immer wieder deutlich, wie sehr Soziale Arbeit verführt ist, Menschen in ihren Problemen so zu interpretieren, dass sie genau in die Maßnahmen, die sie anbietet, passen. Man könnte hier vielleicht von einer strukturellen Kolonialisierung der Adressaten reden. Diese Gefährdungen, die in der Asymmetrie im Umgang liegen und die in der Selbstreferentialität der Institution angelegt sind, sind strukturell gegeben; sie müssen gesehen und aufgearbeitet werden. Das ist nur möglich im Medium von Reflexivität, von selbstkritisch-kritischer Abwägung und Prüfung über das je Angemessene. – Auch diese Rede von Reflexivität aber muss gegen ein Missverständnis abgesichert werden, das – ich habe es oben schon angesprochen – generell ja auch im Konzept von Haltung angelegt ist: Reflexivität macht methodisch geklärtes Handeln nicht überflüssig, sie ist keine gleichsam frei schwebende Kunst. Reflexivität prüft, ob und in welchen Formen Handeln im konkreten Fall passt. Solche Reflexivität braucht begründete, bewährte, transparente und nachprüfbare Formen; 17 sie braucht eigene Räume und Gelegenheiten für ihre vielfältigen Formen, für Selbstreflexion, Selbstevaluation ebenso wie für Praxisbesprechungen, Kollegialberatungen, Mediation und Supervision; hier hat die Soziale Arbeit Ansätze zu einer Tradition etablieren können, die sie vor anderen pädagogischen Berufen, z.B. Lehrern, auszeichnet, diese Tradition muss gewahrt und weiter ausgebaut werden. Reflexivität – so verstanden – ist aber nicht nur eine Frage von Räumen und Gelegenheiten, sie muss in der institutionellen Ordnung gesichert sein. Reflexivität verweist auf die Kultur der Einrichtung, die es verlangt und erlaubt, ohne theatralische Selbstinszenierungen, Verklemmungen und moralisierende Abrechnungen miteinander umzugehen. Dazu gehört eine Kultur der Akzeptanz, der Motivation, der Lernwilligkeit und der Fehlerfreundlichkeit, wie man heute pointierend ergänzen muss. Es ist – scheint mir – unmöglich, von den Adressaten Veränderungen und Lernen zu erwarten, wenn man dazu nicht auch selbst bereit ist und wenn man dazu in der Institution nicht jene prinzipielle Anerkennung und jene Vorgaben von Vertrauen erfährt, die wir für die Adressaten selbstverständlich einfordern. Das Risiko aber, das im pädagogischen Handeln liegt, kann nicht nur von Seiten des Sozialarbeiters und seiner Haltung aus angegangen werden; pädagogisches Handeln muss vor allem darauf sehen, dass Vorraussetzungen dafür gegeben sind, dass die Adressaten stark sind, dass sie Möglichkeiten und Kraft haben, ihre Position zur Geltung zu bringen. Pädagogisches Handeln kann nur bestimmt werden im Horizont von Mitbestimmung, Mitgestaltung und Partizipation. – Das KJHG ist eine vom Gesetz her gute Vorgabe, weil es versucht, auf den unterschiedlichsten Stufen des Alters, der Problembelastung und der Aufgabe festzulegen, was jeweils an Mitbestimmung und Mitgestaltung möglich und notwendig ist. Diese Vorgaben müssen verstanden werden im Medium eines pädagogischen Handelns, das die im Hilfeprozess angelegte Ungleichheit der Positionen so weit wie möglich aufhebt und Optionen und Realisierungen in gemeinsamen Verhandlungen klärt und gestaltet; die hier liegenden Chancen sind in der Praxis nicht immer ausgeschöpft. – In diesem Zusammenhang drängt die neuere Diskussion auf die Einrichtung von fachlich ausgewiesenen, neutralen Beschwerdestellen oder Ombudsstellen in den verschiedenen Institutionen, die unkompliziert zugänglich sind und AdressatInnen die Möglichkeit bieten zu artikulieren, dass und wo sie das Gefühl haben, dass ihnen 18 Unrecht geschieht, ohne Angst und ohne dass sie negative Folgen befürchten zu müssen. Die ersten Berichte zeigen, wie nötig und hilfreich solche Stellen sind. Die Identität der Sozialen Arbeit Dies ist nun ein anspruchsvolles Konzept, – ich habe mich im Vorhinein ja dafür schon entschuldigt. Dieses Konzept kann nur realisiert werden, wenn es in der Sozialen Arbeit mit Überzeugung und guten Gründen vertreten wird. Soziale Arbeit muss sich in ihrer Haltung ihrer Identität vergewissern und sie nach innen und nach außen offensiv vertreten. Der Kulturwissenschaftler Halmos hat ein Buch zur Geschichte von Therapien vom Schamanismus bis zur Psychoanalyse verfasst und darin deutlich gemacht, dass Therapien – ganz unabhängig von der Zeit und ihrer je eigenen Konzeption – immer dann wirken, wenn sie drei Postulate erfüllen: Der Therapeut muss an sie glauben, es muss ihm gelingen, die auf Hilfe Angewiesen zu überzeugen, dass sein Angebot richtig ist und er muss Zugänge, Verfahren, Riten oder Methoden anbieten, in denen das Ziel erreichbar zu sein scheint. Dieses Konzept macht, scheint mir, deutlich, wie fatal es ist, wenn soziale Arbeit immer wieder gleichsam vor sich her trägt, dass sie selbst so genau nicht wisse, was sie könne und leiste, dass sie immer wieder in Nachbardisziplinen herübersieht, um sich von dort her Sicherheit zu leihen. – Es ist notwendig, dass Soziale Arbeit sich zu ihrer spezifischen Haltung bekennt, also zum Willen und zur Kompetenz, in Alltagsverhältnissen Menschen zur Strukturierung ihres Lebens zu helfen. Sie muss die Dignität dieses Tuns, die notwendige, eigensinnige Würde dieses Tuns gegenüber anderen helfenden Aktivitäten vertreten, zum Beispiel psychiatrischen oder schulbezogenen. Mich freut es immer wieder, wenn z. B. Psychiater darauf abheben, dass es Soziale Arbeit ist, die mit den Patienten an der Ordnung des Alltags, an der Zeitstruktur und an den Beziehungen im Alltag arbeitet; ein Kollege hat pointiert, dass sie als Ärzte ja nur, wenn es hoch kommt, eine Stunde am Tag mit den Patienten zu tun haben, die 23 anderen seien dann das Geschäft der Sozialen Arbeit. Dass die Praxis solcher Einschätzung weithin nicht entspricht, ist ebenso evident, wie, dass die Praxis in der Kooperation mit der Schule – in der Schulsozialarbeit, aber auch in den neuen Ansätzen zur Ganztagsschule – oft sehr unbefriedigend ist. Soziale Arbeit steht im Feld der anderen Professionen immer in Konkurrenz und Auseinandersetzungen um die Selbstbehauptung. Es herrscht der „war of professions“, der Kampf der Professionen untereinander, in dem die Soziale 19 Arbeit eine oft schwierige Position hat und zwischen den anderen zerrieben wird. Das verweist auf Fragen der Selbstdarstellung und der politisch-öffentlichen Vertretung der Interessen der Sozialen Arbeit, die ich im Detail hier nicht weiter verfolgen kann; ohne ein stabiles Selbstbewusstsein von der Bedeutung und Notwendigkeit der eigenen Arbeit, also ohne die Stabilität einer in sich sicheren und offensiven Berufsidentität aber sind solche Auseinandersetzungen substanzlos. Soziale Arbeit muss ihre Identität vor allem aber in der heutigen gesellschaftlichen Situation vertreten. Diese setzt – im Zeichen der zweiten Moderne – auf den Primat der Produktions- und Marktinteressen, auf den – um es mit Helmut Schmidt zu formulieren – Raubtier- Kapitalismus und seine Prioritäten. Es zählt, wer etwas kann und leistet, soziale Probleme sind randständig, sie werden dethematisiert und möglichst der privaten Selbstsorge überlassen. Soziale Arbeit gerät ins Hintertreffen – die neueren Programmen des Primats des Forderns vor dem Fördern machen deutlich, dass das Interesse denen gilt, die sich in der Gesellschaft als produktiv erweisen, also ihrem Humankapital, und dass die anderen – wie man sagt – eben versorgt werden müssen. Soziale Arbeit muss sich der darin liegenden zynischen Überschätzung der Leistungsfähigkeit der Menschen und der ebenso zynischen Unterschätzung der gesellschaftlich bedingten Unzulänglichkeiten versagen und darauf insistieren, dass soziale Gerechtigkeit ein Ziel ist, auf das Gesellschaft sich im Zeichen des Sozialstaats selbst verpflichtet hat und dass sie in ihren sozialpädagogischen Ansätzen über Programme verfügt, in ihrem Aufgabengebiet diese Ziele anzugehen. In der gesellschaftlichen Situation aber ist Soziale Arbeit noch in einer besonderen Weise gefordert; sie agiert im Prinzip der Einmischung; sie muss ihre Sicht der Probleme – das also, was Gesellschaft denen, die in ihr nicht zurande kommen, antut, anmelden und skandalisieren. – Dies aber kann sie nur, wenn sie sich im Verbund, in Vernetzung und Kooperation mit all jenen zusammentut, die in dieser Gesellschaft in unterschiedlichen Zugängen und unterschiedlichen Ansätzen versuchen, das Projekt sozialer Gerechtigkeit voranzutreiben. Einmischen geht einher mit Mitmischen, mit Kooperation ebenso mit denen, die in anderen Berufsfeldern – der Medizin, der Schule, der Justiz – engagiert sind wie mit denen, die im Kontext der sozialen Bewegungen – der Frauenbewegung, der 20 Friedensbewegung, vor allem aber auch der ökologischen Bewegungen und der nichtstaatlichen Organisationen – engagiert sind. Soziale Arbeit in ihrer Identität als Arbeit an sozialer Gerechtigkeit in den gegebenen Alltagsverhältnissen ist, so verstanden, ein Glied, ein Moment, im Kampf unserer Gesellschaft um soziale Gerechtigkeit, um ein humaneres, nachhaltiges Leben, um ein Leben im Horizont der Menschen- und Kinderrechte, so wie sie in der Charta der Vereinten Nationen gefasst sind und als Vision über den so mühsamen Auseinandersetzungen und Kämpfen unserer Zeit stehen." Wir haben“, so hieß es bei Bloch, „von der Arbeit an der Utopie nichts anderes als die Arbeit daraufhin." Nachbemerkungen Im Folgenden werden noch Skizzen zu Fragen aus der Diskussion wiedergegeben, die auf Fragen und Einwände mit eher pointierenden Hinweisen und im Rückbezug noch einmal auf das im Referat Ausgeführte zu antworten versuchen. Die beschriebene, die Soziale Arbeit tragende Haltung als ein anspruchsvolles Konzept und der Appell an die offensive Vertretung dieser Haltung provozierte die Frage, welche Chancen Soziale Arbeit habe, dieses Konzept zu realisieren, ob es – kritisch und anders gefragt – nicht illusionär sei, in den gegebenen Verhältnissen darauf zu vertrauen, dass ein solches Konzept realisiert werden könnte, ob es also nicht müßig, ja irreführend – weil nur Enttäuschung provozierend – sei, sich auf ein solches Konzept einzulassen. Um auf diese Frage, die auch auf Status und Macht der Sozialen Arbeit zielt, antworten zu können, scheint es mir notwendig, knapp in die Geschichte der Sozialen Arbeit zurück zu gehen. Zunächst zum gesellschaftlichen Status der Sozialen Arbeit. Soziale Arbeit ist jung, verglichen mit Theologen, Medizinern und Juristen. Die Akademisierung der Sozialen Arbeit ist gerade 50 Jahre alt. Sie ist aber als eigenständiger Berufsstand nicht nur relativ jung, sie ist in den letzten Jahrzehnten auch ungeheuer rasch gewachsen, so dass sie sich noch nicht überall nach außen durchsetzen und nach innen festigen konnte. Man muss immer wieder daran erinnern, dass zurzeit in ihr mehr Menschen beschäftigt sind als im gesamten öffentlichen Schulwesen. Und: Die Zahl der in der Sozialen Arbeit Tätigen wird sogar 21 weiter wachsen – das wird aus den ja sehr sorgfältigen und immer weiter geschriebenen Untersuchungen der Arbeitsstelle von Rauschenbach und Schilling in Dortmund deutlich – vor allem Kindergarten und Altenarbeit sind Zukunftsbranchen, denen gegenüber die Soziale Arbeit darauf achten muss, dass nicht die traditionelle Aufgabe der Versorgung der exkludierten, verelendeten und verarmten Menschen zu kurz kommt, dass die Arbeitsmarktpolitik und die Ausländer- und Flüchtlingsarbeit nicht vernachlässigt werden, also die in unserer Gesellschaft skandalös untergewichteten Arbeitsfelder. Das Bild ist aber in sich gespalten. Gewiss, der Sozialen Arbeit wird seit einiger Zeit Normalität attestiert und der gerade erschienene Jugendbericht konstatiert, dass sie nun in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei, aber hinter den neueren Untergewichtungen stecken die zunehmend die Situation bestimmenden KapitalInteressen mit ihrer Umdeutung der sozialen Probleme, von denen ja im Referat die Rede war und von denen aus die Fragen nach dem Selbstverständnis der Sozialen Arbeit neu und offensiv angegangen werden müssen. Diese allgemeine Frage will ich hier aber nicht weiter verfolgen. (s. dazu grundsätzlich mein Aufsatz np 2013) Ich komme auf meine Beschreibung der Situation der Sozialen Arbeit zurück. Wenn sie als Beruf noch jung ist und in den Wachstumszuwächsen die Stabilisierung dieses Arbeitsfeldes bisher nur bedingt gelingen konnte, wenn also ihr Status noch gleichsam im Entwicklungsstand ist, so darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Status der Sozialen Arbeit auch unter einem anderen strukturellen und prinzipiellen Aspekt belastet ist: Medizin hilft in Nöten, die alle Menschen, ja bis in die Behinderungen hinein, betreffen, und sie hilft in körperlichen Leiden, in Körperkrankheiten – jedenfalls ist das Bild der Medizin nach wie vor von da aus bestimmt und nicht durch die schwer greifbaren internistischen, psychosomatischen oder psychiatrischen Probleme. Körperliches Leiden aber ist greifbarer als die Probleme, mit denen Soziale Arbeit zu tun hat. Und vor allem sind diese Probleme solche, die aus der gesellschaftlichen Tradition heraus immer noch auch als moralische Probleme verstanden werden – und gerade die derzeitige Gesellschaft remoralisiert ja die Sozialen Fragen wieder sehr: Das Programm „fordern statt fördern“ repräsentiert die geheime Moral, dass Elend und Not vielfältig darin begründet sind, dass Menschen sich selbst nicht hinreichend an die Kandare nehmen, dass sie sich gehen lassen, sich nicht strukturieren können, dass sie dann 22 aber auch dazu neigen, sich auf Hilfen zu verlassen. Man redet dann ja boshaft vom Wohlfahrtskonsum. Damit die Menschen mit ihrem Leben zurande kommen, müssten sie sich – so heißt es – anstrengen, und man müsse sie zur Anstrengung nötigen. Diese moralisierenden Einschätzungen zeigen sich in vielfältigen, oft auch subtilen Urteilen und Maßnahmen. Dieses Moralisieren – das ist ein weiteres Moment – trifft unser Klientel im besonderen Maß, Es ist aufregend, mit welcher Intensität in der Öffentlichkeit über mögliche Betrugsmaßnahmen in Bezug auf Hartz IV geredet wird, angesichts dessen, dass man seit langem weiß – und darin sind die Kriminologischen Forschungen zuverlässig – dass es überall eine Missbrauchsquote gibt, beim Steuerbetrug ebenso wie bei Hartz IV oder beim Einkauf im Großmarkt. Das Faktum des Missbrauchs ist nicht aufregend, aufregend ist nur, ob es thematisiert oder nicht thematisiert wird, ob man es zum Problem macht. Dieses Moralisieren der Probleme – das ist nochmals ein weiteres Argument – finde ich auch unter dem moralischen Aspekt der Frage der Gleichheit schwer erträglich; es ist schwer zu verkraften, dass Arbeitslose dafür bestraft werden sollen, dass sie sich nicht pünktlich und regelmäßig beim Amt melden und dass gleichzeitig Herr Hoeneß verurteilt wird und die Bundeskanzlerin und der bayerische Ministerpräsident den höchsten Respekt davor zum Ausdruck bringen, dass er das Gerichtsurteil akzeptiert. Es wird mit sehr unterschiedlichem Maß gemessen. Und, ich gestehe, dass ich es auch glücklich fände, wenn die Presse sich für die Umstände, unter denen unsere Klientel im Gefängnis Strafen absitzt, ebenso teilnehmend interessierte, wie sie dies bei Herrn Hoeneß tut. Dieses besondere moralisierende Interesse an unserem Klientel, hängt, denke ich, damit zusammen, dass unsere Klientel in unserer Gesellschaft auch eine Funktion des Sündenbocks erfüllt. Man braucht abweichendes Verhalten, um sich der Normalität zu vergewissern. Wenn man mit Wohnungsfragen nicht zurande kommt, sieht man an den Wohnungslosen, wo man landen kann, wenn man sich nicht alle Mühe gibt, auch mit den gegebenen Bedingungen zurecht zu kommen; der Verweis auf die Wohnungslosen erstickt die Kritik und macht gefügig.. – Ich will das verallgemeinern. Die Breite der Diskussion über Disziplin und Disziplinierung, wie sie durch Bernhard Buebs „Lob der Disziplin“ vor einigen Jahren angeregt worden ist – von dem Buch sind, glaube ich, eine halbe Million Exemplare verkauft worden – lässt sich nur mit einer solchen gesellschaftlichen Stellvertreterposition erklären. Alle 23 Befragungen und Untersuchungen zeigen, dass Familien heute relativ friedlich leben, dass, in aller Anstrengung, Überanstrengung und Belastung, Eltern mit ihren Kindern relativ einverständig auskommen und Kinder damit relativ zufrieden sind; es ist ja auch frappant, wie breit und selbstverständlich junge Menschen davon ausgehen, dass sie ihrerseits wiederum Kinder haben wollen. So friedlich, wie es heute in Familien zugeht, ist es jedenfalls in den letzten 100 Jahren noch nicht gewesen- Die schrecklichen Vater-Sohn- und Mutter-Tochter-Konflikte, die dramatischen Auszugsund Ablösungsprozesse, die die Situation in früheren Jahren so massenhaft bestimmt haben, scheinen Vergangenheit. Was bedeutet es nun, dass es trotzdem ein so breites Bedürfnis nach einer öffentlichen Diskussion über das Versagen, die Belastung und Überforderung von Familien gibt? Mir scheint, dass das dazu dient, in unserer ungesicherten und verängstigten Gesellschaft - Oskar Negt spricht davon, dass sie geprägt sei vom „Rohstoff Angst“ein Gefühl von Verlässlichkeit und Stärke zu vermitteln. Man weiß nicht, wie die Zukunft sich gestaltet, wie es weitergeht, man weiß nicht, ob der Frieden erhalten bleibt, wie der Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie gefunden werden kann, was die Globalisierung an Problemen bringen wird, man fürchtet, von Osteuropäern auf der einen und Türken auf der anderen Seite überwandert zu werden , so dass von „uns“ nichts übrig bleibt – und was es sonst alles an schwelenden Gerüchten und Verängstigungen gibt. Dies alles erzeugt eine Verunsicherung, aus der heraus Menschen Sicherheit brauchen und Erziehung ist, scheint mir, ein Gelände, wo es die Möglichkeit gibt zu zeigen, dass Ordnung herrscht, Durchsetzigkeit und Verlässlichkeit. Das wird auf die Familien abgeladen, die sich gegen solche Ermahnungen ja schlecht wehren können und, ich denke, es wird ebenso auf die Soziale Arbeit abgeladen. (s. dazu dann ausführlicher meinen Aufsatz in np 2012) Und schließlich: Diese im Moralisieren noch einmal verdeutlichte Sündenbockfunktion des schwierigen Verhaltens in unserer Gesellschaft geht damit einher, dass es, im Zug des Primats der ökonomischen und marktorientierten Interessen unserer Gesellschaft wieder privatisiert wird: Es zählt, was Menschen in der Arbeits- und Kaufordnung der Gesellschaft leisten, was sie als Humankapital darstellen, soziale Probleme und Schwierigkeiten werden de- thematisiert. Die Moralisierung sozialer Probleme ist ein guter Vorwand dafür, dass man im gesellschaftlichen Aufwand für soziale Probleme zurückhaltend sein kann, ja soll und muss. 24 Soweit zur Frage nach der gesellschaftlichen Position der Sozialen Arbeit; solche Überlegungen aber dürfen andere Fragen nach ihren internen Problemen, also nach ihrer Fähigkeit, sich in ihrer Identität zu behaupten, nicht verdrängen oder verstellen. Diese internen Probleme stellen sich, so scheint mir, auf verschiedenen Ebenen. Zunächst: Im Referat habe ich Bemerkungen zum Konzept der Einmischung und des Mit- mischens gemacht. Ich will das noch einmal aufnehmen und betonen. Einmischen und Mit- mischen sind notwendig, damit die Stimmen derer, die in unserer Gesellschaft zu kurz kommen und mit ihren Problemen nicht zurande kommen, gestärkt werden. Einmischen und Mitmischen zielt auf Koalitionen mit anderen Akteuren im Feld und mit der Politik, es zielt auf gemeinsame Aktivitäten. Dies formuliert sich leicht, in der Praxis aber zeigen sich beträchtliche Probleme, vor allem auch, wenn ich es so ungeschützt formulieren darf, kleinliche der Eifersucht und der Besitzstandwahrung. Ich erinnere mich gut an die traurige Feststellung aus einem Stadtteilprojekt, dass Kooperation mit Sozialarbeitern oft besonders schwierig sei, weil sie das Gefühl hätten, es würde ihnen etwas von ihrer Zuständigkeit genommen. Und: Ich bin viel in der Schulsozialarbeit unterwegs und gestehe, dass ich immer wieder entgeistert bin, welche Vorstellungen manche Sozialarbeiter von Schule und Lehrern haben; dass das durchaus gegenseitig ist – hier ist der Aufklärungsbedarf wechselseitig ungeheuer –, ändert nichts an der notwendigen Selbstkritik der Sozialen Arbeit. Zum Zweiten: In Bezug auf das Prinzip Einmischung und Mitmischung scheint es mir wichtig, darauf zu verweisen, dass hier – jenseits der hier notwendigen Differenzierungen und der notwendigen Aktionen auf den sehr unterschiedlichen lokalen, regionalen, überregionalen Ebenen – Aufgaben der Verbände liegen, die nicht hinreichend offensiv wahrgenommen werden. Die Berufsverbände der Sozialen Arbeit zeigen sich als zerklüftete Landschaft, sie stehen in Konkurrenz und sind jeweils schwach; sie agieren oft nicht zusammen. Das jetzt immerhin auch kirchliche Angestellte sich organisieren dürfen, war überfällig und ist gut. Es fehlen aber Kooperationen, in denen die Macht der Sozialarbeiter und ihrer Verbände deutlich würde. Die öffentliche Repräsentanz der Träger ist in manchen Bereichen exzellent, zum Beispiel in der Ausländerpolitik und in der Armutsberichterstattung; in anderen Bereichen ist sie eher schwach. Dass Soziale Arbeit ein Beruf ist, in dem mehr 25 Menschen arbeiten als in der Automobilindustrie, der also auch unter arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten hohes Gewicht hat, wird in ihrer Präsenz in der Öffentlichkeit nicht deutlich. Zum dritten: Um die Probleme, mit denen Soziale Arbeit konfrontiert ist, und die Lösungen, über die sie verfügt, deutlich zu machen, braucht es Forschung; Forschung und nicht nur Evaluationen, wie sie zurzeit ja auf breiter Front realisiert werden. Es braucht auch nicht nur Begleitforschung. Natürlich ist vielfältige Begleitforschung sinnvoll und ist es sicher ein besonderes Charakteristikum der Sozialen Arbeit, dass sie dies früh erkannt und auch als Mittel der Entwicklung einer guten und effektiven Praxis genutzt hat. Begleitforschung aber ist immer wieder auch dazu verführt, die Arbeit, so wie sie ist, zu unterstützen. Die Kollegen sind doch tüchtig und man möchte sie nicht noch durch Forschung zusätzlich belasten. Solche Begleitforschung aber darf andere Formen von Forschung nicht verdrängen. Es braucht Grundlagenforschung, also zum Beispiel Längsschnittforschungen über die Entwicklung sozialer Probleme ebenso wie über die Entwicklung von Angebotsformen; das bedeutet – und das zu verfolgen wäre überfällig und spannend –, dass der Kontakt der Adressaten mit der Sozialen Arbeit im Ganzen ihres Lebenslaufs untersucht wird. Diese Frage wird für den Themenbereich der Heimerziehung unter dem Titel der care leavers zur Zeit aufgeworfen; man möchte sehen, wie Menschen das später verarbeiten, was sie in der Heimerziehung – aber auch in den unterschiedlichen Maßnahmen der Erziehungshilfen und der oft der damit verbundenen Psychiatrie oder Justiz – erlebt und erfahren haben, was dies für sie in ihren späteren Leben bedeutet. Also: Es braucht Forschung zunächst unabhängig von den in der gegenwärtigen Szene gegebenen Lösungen; es braucht Forschungen, die selbstkritisch nüchtern fragen und prüfen, was unter welchem Aufwand und mit welchen Kosten was bringt, was mit welchen auch unerwünschten und vielleicht sogar vermeidbaren Nebenwirkungen einhergeht, also – in einem weiten Sinn verstanden – evidenzbasierte Forschung. Darin aber scheint es mir wichtig daran festzuhalten, dass Forschung vor allem auch in ihrer ideologiekritischen Intention gesehen und genutzt werden muss; sie konkretisiert den Mut, festzustellen, dass es Dinge mit Effekten und ohne Effekte, dass es Moden und Tatsachen, dass es Meinungen, Meinungsmache und Fakten gibt – ich habe gerade dazu ja gerade Beispiele angeführt. 26 In diesem Zusammenhang taucht auch die Frage auf, inwieweit die Ausbildung Voraussetzungen dazu liefert, dass Sozialarbeiterinnen den Anforderungen ihres Berufs gerecht werden können. Dazu mache ich nur mit schlechtem Gewissen Bemerkungen, denn ich betrachte das Ganze ja nun nur von außen – ich bin jetzt 79, seit 13 Jahren pensioniert, lehre zwar noch, aber doch gleichsam in einer sehr privilegierten Außenseiterposition. – Die derzeitige Phase ist eine des Umbruchs, in der die Hochschulen nicht sehr geschickt waren. Die Verbindung zwischen der Einführung der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge und der Modularisierung der Studieninhalte ist weitgehend fatal; die Überlastung mit Stoff und, dahinter liegend, der Streit um die Stoffverteilung ist kleinkariert und töricht, so wie – wenn ich mir diese boshafte Seitenbemerkung erlauben darf – der Streit um Zuständigkeiten zwischen den Verbänden; auch das ist ja, vor allem im Kontrast zu der oft so hochtrabenden Zielbestimmung im Rahmen der Corporate Identity ebenso ernüchternd wie verzweiflungsvoll und ärgerlich. – Also: Jeder denkt, sein Fach muss vorkommen und so wird der Studienplan überfüllt und man beklagt, dass keine Zeit mehr zur Reflexion bleibt. Sie einzuüben, genauer gesagt, sie als Notwendigkeit und Möglichkeit zu eröffnen und dann einzuüben wäre für die Soziale Arbeit elementar wichtig, denn sie kann nur als reflexiver Beruf praktiziert werden; ich hoffe, das ist im Referat deutlich geworden. – Nun soll man diese gegenwärtigen Verklemmungen nicht überbewerten. Ich unterrichte ja noch immer und die Studenten sind engagiert, kräftig und aktiv, so wie sie es früher waren. Natürlich darf man solche Erfahrungen nicht verallgemeinern, ich habe das Privileg, Zusatzveranstaltungen anbieten zu können, aber sie geben mir doch Anlass zu gelassenen Erwartungen. Engagement und Talent werden sich auch in dem jetzt gegebenen strengeren Studienbetrieb auf breiterer Front wieder durchsetzen. Die Zeit wird Veränderungen bringen und, wie auch sonst, vieles heilen. Zur Zeit gleicht sich manches in unseren Ausbildungen an amerikanische Verhältnisse an; niemand wird leugnen, dass auch da ausgezeichnet gearbeitet, gelehrt, geforscht und promoviert wird; es wird sich, denke ich, vieles einpendeln, man muss warten. – Indem ich dies sage, werde ich aber zögerlich, ob ich hier nicht blauäugig bin; so „richtig“ mir im Studienbetrieb eine gewisse Entwarnung für den Augenblick scheint und so notwendig sie ist, um im Horizont einer Zielperspektive in der hoch notwendigen Anstrengung um Verbesserungen der jetzigen Situation nicht müde zu werden, stellt sich mir doch zunehmend auch die weiterführende Frage, ob sich im 27 heutigen Betrieb ein prinzipieller Wandel des akademischen Verstehens- und Lernbetriebs anbahnt, ein Wandel weg von der Reflexivität hin zum Anwendungswissen im vorgegebenen, nicht hinterfragten Rahmen; das wäre dann der Tod aller kritischen Distanz und aller Reflexivität. Diese ganz allgemeine, vor allem auch durch den Internetgebrauch massiv vorangeschobene Entwicklung hin zum bloßen Anwendungswissen wird ja vielfältig mit beschrieben. Fragen nach dem politischen Gewicht, im Status, in der Außenvertretung und in den Studienverhältnissen in der Sozialen Arbeit standen im Vordergrund der Fragen in der Diskussion. Dies provozierte mich nun wiederum zur Frage danach, warum man so zwar nach Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit fragt, nicht aber nach dem, was im Mittelpunkt des Referats gestanden hatte, nach der Haltung, die die Arbeit tragen muss. Darf man das, so stellt sich mir die Frage, dahingehend deuten, dass das Gesagte selbstverständlich ist und keinen Diskussionsbedarf erzeugt, also als Bestätigung eines Einverständnisses, oder ist das Nichtfragen Indiz dafür, dass man sich nicht an die gleichsam inneren Verhältnisse traut, man könnte vielleicht sagen, an das Eingemachte? – Nun, eine Antwort wäre, dass die Öffentlichkeit einer solchen Diskussion, wie sie hier geführt wurde, eine gute, aber auch allgemeine Atmosphäre erzeugt, in der man sich zu solchen gleichsam persönlichen und das je Individuelle betreffenden Fragen nicht äußern – besser vielleicht: nicht bloßstellen – mag. Wäre es so, wäre die Konsequenz, das gleichsam durch das Format der Veranstaltung begründete Schweigen auf sich beruhen zu lassen und darauf zu trauen, das die angeschnittenen Probleme im Nachgang, im kleinen vertrauten Kreis, im Privaten bedacht werden; da ich im Referat manche biblischen Anspielungen benützt habe, bietet sich auch hier die Reminiszenz an die Weihnachtsgeschichte an, die ja damit endet, dass Maria "alle diese Worte unter ihrem Herzen“ behielt. Das Schweigen und Nichtfragen aber kann auch als Ausweichverhalten interpretiert werden. Es ist leichter, nach Umständen und Rahmenbedingungen zu fragen als nach dem eigenen Handeln, es ist leichter, die Schwierigkeiten bei den anderen zu notieren als bei sich selbst zu suchen: Dies aber, so scheint mir, ist eine Einstellung, die die Auseinandersetzung mit sich und damit einhergehend mit den Schwierigkeiten in der Realisierung einer eigenen angemessenen pädagogischen Haltung verbirgt. Dieses Ausweichen auf äußere Bedingungen, diese Externalisierung von Schwierigkeiten auf die Umstände, ist, scheint mir, in der Sozialen Arbeit weit verbreitet und beherrscht oft die Diskussion. Das ist fatal, weil es 28 Kräfte bindet und die Themen in die Unterhaltung über Arbeitsmöglichkeiten verschiebt. Dass es natürlich wichtig, notwendig und überfällig ist darüber zu diskutieren, will ich hier nicht weiter verfolgen. Mir geht es nur darum, deutlich zu machen, dass es zweierlei ist, von der Organisation und den Rahmenbedingungen und von der Haltung, also der Bestimmung der Arbeit in ihren Strukturen zu handeln, und dass es notwendig ist, dass in der Sozialen Arbeit auch darüber, also über die Möglichkeiten, über die Schwierigkeiten und über die Verfehlungen des Handelns im Umgang mit den Adressaten gehandelt wird. Geschieht das nicht, dann verlieren sich im Druck der Praxis, im Druck der anstehenden Geschäfte auch die kritisch selbstkritischen Impulse, die, so jedenfalls habe ich mich verstanden, mit dem Entwurf einer pädagogischen Haltung gegeben sind. Um das zu verdeutlichen, scheint es mir deshalb notwendig, noch einmal auf die mit der Diskussion über Haltung verbundenen Intention zur selbstkritischen Revision der Sozialen Arbeit zu kommen. Meine Überlegungen zielten darauf, dass sozialpädagogisches Handeln bestimmt ist durch die Notwendigkeit, dass wir uns immer wieder dessen bewusst sind, dass wir Menschen unter Menschen sind, dass die Hilfsbedürftigkeit etwas ist, was alle treffen kann, und dass wir Hilfsbedürftigkeit immer in den Verhältnissen, also nicht nur an Eigenschaften und Kompetenzen, festmachen müssen und dass wir sehen müssen, Menschen in den Verhältnissen und den darin erbrachten Leistungen zu akzeptieren, um von da aus die Menschen in der Verhandlung dessen, was jenseits der gegebenen Verhältnisse auch möglich ist, zu unterstützen. Die Auseinandersetzung verlangt ebenso selbstkritische Reflexivität der SozialarbeiterInnen, die sich bewusst sein müssen, in einem prinzipiell asymmetrischen Verhältnis zu agieren, das dazu verführt, die eigensinnigen Entwürfe und Möglichkeiten der AdressatInnnen zu überfordern, wie – auf der anderen Seite – zur Stärkung einer Gegenposition der AdressatInnnen, die sich den Zumutungen des Sozialarbeiters gegenüber zur Wehr setzen können muss. Dieses Konzept hat seine Pointe darin, dass das Verhalten der AdressatInnnen, wie schwierig und mühsam, auch wie unwillig dem Sozialarbeiter gegenüber es sich zeigen mag, in seiner eigenen Intentionen verstanden werden muss, und dass die SozialarbeiterInnen der Versuchung widerstehen müssen, diese Unwilligkeit als Unwilligkeit oder Feindlichkeit zu interpretieren. In dieser Spannung Vertrauen zur Zusammenarbeit zu erzeugen, ist die Aufgabe. 29 Dieses Konzept ist mühsam für die SozialarbeiterInnen. Es verlangt, dass sie ihren Willen zur Hilfe – der oft schon so strapaziert und in den gegebenen Verhältnissen überstrapaziert ist – noch einmal zur Diskussion stellen und prüfen, inwieweit sie in ihm die eigensinnigen Bedürfnisse der AdressatInnnen uminterpretieren, verfremden und in ihrer Vitalität schwächen. Es gibt Untersuchungen über Gespräche, die in einer aufregenden Weise zeigen, dass und wie Kollegen, die sehr wohlmeinend sind, doch immer gleich und rasch wissen, was man machen sollte und, vor allem, wie dafür die gerade verfügbaren Angebote passend sind. Die AdressatInnen haben keine Chance, eigene Vorstellungen zu entwickeln. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn ich in einem Laden gehe und der Verkäufer gibt sich alle Mühe mir klarzumachen, dass genau das, was er gerade auf Lager hat, das ist, was ich suche. Gefährlich wird eine solche Einstellung, wenn sie dann gestützt wird dadurch, dass die SozialarbeiterInnen Aufwand und Mühe brauchten, um dieses Arrangements zusammen zu bringen und nun enttäuscht sind, dass die AdressatInnen sich wehren. Sie haben sich Mühe gegeben, sie erwarten Dankbarkeit. – Ich erinnere die traurige Geschichte aus der Familienhilfe, in der eine Frau mit dem ihr zugewiesenen Familienhelfer überhaupt nicht klar kam und es sich erst nach einem dreiviertel Jahr, nach vielfältigen unlösbaren Konflikten und einer zunehmend dramatischen Anspannung und Verhärtung des Verhältnisses herausstellte, dass sie, aus welchen Gründen auch immer, mit einem Mann nicht kooperieren wollte und konnte. Sie hatte dies immer wieder angedeutet, aber es war, in den Organisationsnotwendigkeiten und im Alltagsgeschäft des Amtes nicht ernst genommen worden. Dann wurde ihr eine Familienhelferin zugewiesen, und die Verhältnisse entspannten sich. - Diese oft so unbemerkten Möglichkeiten, den Willen, die Intention, die Eigensinnigkeit der Adressaten zu überhören und damit den Einstieg zu einer offenen Verhandlung zu einer wirklich hilfreichen Hilfe zu verspielen und so erst Probleme zu erzeugen, die zu lösen oft schwierig wird, will ich noch an weiteren Beispielen verdeutlichen. – Wir haben eine Untersuchungen zur Heimerziehung anhand unausgelesener Akten gemacht und in diesen – immerhin 300 – Akten haben wir kein einziges Selbstzeugnis der Klienten gefunden. Wir haben Gutachten, auch kluge, gute Gutachten gefunden, aber die Stimme der AdressatInnnen selbst wird nicht gefragt und so eben ungehört. Niemand hatte Gelegenheit zu erzählen, was ihm in seinem Leben schwierig ist, was ihm stinkt, wovon er träumt; es waren immer die fachlich bearbeiteten, gewiss klugen, zuverlässigen und oft auch sehr qualifizierten 30 Erziehungsberichte. Ich kann mir leider gut ausmalen, - und da erschrecke ich sehr wie meine eigenen Kinder in Sprache und Wahrnehmungsmuster von Erziehungsberichten aussehen würden. – Und noch ein drastisches Beispiel: Eine Sozialarbeiterin wurde mit einer Frau konfrontiert, die nach langen Jahren einer durchaus befriedigenden Berufstätigkeit wegen der Insolvenz dieser Firma entlassen worden war und nun mit ihrem Leben nicht mehr zurande kam; sie zeigte massive Symptome psychosomatischer Belastungen In der Unterhaltung ergab sich dann, dass es eine Analphabetin war, die in ihrer Arbeit sich so geschickt arrangiert hatte, dass sie mit ihren Defiziten zurande kam; niemand hatte ihr Analphabetentum merken können. Nach der Insolvenz der Firma aber war sie mit Verwaltungsauflagen – dem Ausfüllen von Papieren, dem Einhalten von ihr schriftlich zugegangenen Auflagen – konfrontiert worden, die sie nicht bewältigen konnte und die sie in Krankheiten flüchten ließ. Soweit; wir hätten sicher noch vieles zu verhandeln, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. ----- 31