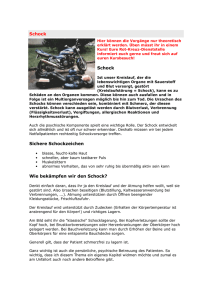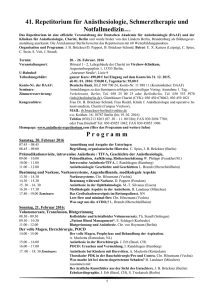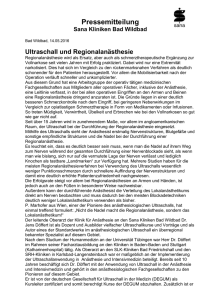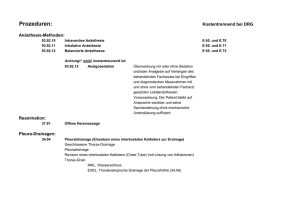Anästhesiologie und Schmerztherapie - KVM
Werbung

Jürgen Mast · Ulli Schilling Anästhesiologie und Schmerztherapie Herausgegeben von Christoph Pölcher VIII Inhaltsverzeichnis 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 12 15 17 19 25 27 29 30 31 32 33 36 Präoperative Vorbereitung . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Prämedikationsvisite . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 Abschätzung des Narkoserisikos . . . . . . . 3.1.2 Abschätzung der Intubationsbedingungen . . 3.1.3 Aufklärungsgespräch . . . . . . . . . . . . . 3.1.4 Präoperative Nahrungskarenz . . . . . . . . 3.1.5 Präoperative Anpassung der Dauermedikation 3.2 Prämedikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 Benzodiazepine . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 Einzelne Substanzen . . . . . . . . . . . . . 3.2.3 Weitere Substanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 39 40 43 45 46 46 50 50 51 52 4 Praxis der Allgemeinanästhesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Vorbereitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Narkoseeinleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1 Narkoseeinleitung beim nüchternen Patienten . . . . . . . 4.2.2 Narkoseeinleitung beim nicht nüchternen Patienten . . . . 4.3 Narkoseführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3.1 Steuerung der Narkosetiefe . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Narkoseausleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Aufwachraum (AWR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 55 57 58 60 64 65 66 68 5 Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Basismonitoring . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1 EKG . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2 Pulsoxymetrie . . . . . . . . . . . . 5.1.3 Nichtinvasive Blutdruckmessung . . . . . . . . 70 70 70 71 73 2 3 Grundlagen der Anästhesie . . . . . . . . . . . 1.1 Entwicklungsgeschichte . . . . . . . . . . . 1.2 Begriffsdefinitionen . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Eigenschaften der Allgemeinanästhesie 1.2.2 Narkosestadien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pharmakologie der Allgemeinanästhesie . . . . 2.1 Inhalationsanästhetika . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Volatile Anästhetika . . . . . . . . . . . 2.1.2 Gasförmige Anästhetika . . . . . . . . 2.2 Intravenöse Anästhetika . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Charakteristika einzelner Substanzen . . 2.3 Opioide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Charakteristika einzelner Substanzen . . 2.3.2 Antagonisierung von Opioiden . . . . . 2.4 Muskelrelaxanzien . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1 Depolarisierende Muskelrelaxanzien . . 2.4.2 Nichtdepolarisierende Muskelrelaxanzien 2.4.3 Charakteristika einzelner Substanzen . . 2.4.4 Antagonisierung von Muskelrelaxanzien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inhaltsverzeichnis 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Erweitertes hämodynamisches Monitoring . . . . . . . . . . . 5.2.1 Invasive Blutdruckmessung . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.2 Arterieller Zugang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.3 Zentraler Venenkatheter (ZVK) . . . . . . . . . . . . . . 5.2.4 Pulmonalarterienkatheter (PAK) . . . . . . . . . . . . . 5.2.5 Pulskonturanalyse und transösophageale Echokardiografie Kapnometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neuromuskuläres Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.1 Relaxometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neuromonitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weiteres Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6.1 Nierenfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6.2 Körpertemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6.3 Laborkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klinische Überwachung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 78 83 93 98 100 103 103 107 108 108 108 108 109 6 Lagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 6.1 Lagerungsschäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 6.2 Lagerungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 7 Künstlicher Atemweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 Maskenbeatmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Larynxmaske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 Endotracheale Intubation . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.1 Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.2 Technik der orotrachealen Intubation . . . . . 7.3.3 Technik der nasotrachealen Intubation . . . . . 7.3.4 Technik der fiberoptischen Intubation . . . . . 7.4 Management des schwierigen Atemwegs . . . . . . . 7.4.1 Definitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.2 Klinische Warnhinweise . . . . . . . . . . . . . 7.4.3 Klinische Screeningverfahren . . . . . . . . . . 7.4.4 Basismaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.5 Vorgehen beim schwierigen Atemweg . . . . . 7.4.6 Vorgehen bei erwartet schwieriger Intubation . 7.4.7 Vorgehen bei unerwartet schwieriger Intubation 7.4.8 Extubation nach schwieriger Intubation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 121 122 125 125 129 130 131 132 132 132 133 133 133 133 135 136 Narkosesysteme und Narkosebeatmung . . . . . . . 8.1 Einteilung Narkosesysteme . . . . . . . . . . . . . 8.2 Narkoseapparate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2.1 Bestandteile von Narkoseapparaten . . . . 8.3 Narkosebeatmung . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3.1 Veränderungen der Ventilation und Perfusion 8.3.2 Beatmungsformen . . . . . . . . . . . . . 8.3.3 Praktische Aspekte der Beatmung . . . . . 8.3.4 Nebenwirkungen der Beatmung . . . . . . 8.3.5 Atemfunktion in der postoperativen Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 138 140 141 143 143 144 148 149 149 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX X Facts | Anästhesiologie und Schmerztherapie 9 Regionalanästhesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 Lokalanästhetika (LA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1.1 Nebenwirkungen von Lokalanästhetika . . . . . 9.1.2 Charakteristika einzelner Substanzen . . . . . . 9.1.3 Adjuvantien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Zentrale Regionalanästhesie . . . . . . . . . . . . . . 9.2.1 Spinalanästhesie (SPA) . . . . . . . . . . . . . 9.2.2 Periduralanästhesie (PDA) . . . . . . . . . . . 9.2.3 Kombinierte Spinal-Epiduralanästhesie (CSE) . . 9.2.4 Zentrale Regionalanästhesie und Blutgerinnung 9.3 Periphere Regionalanästhesie . . . . . . . . . . . . . 9.3.1 Methodische Grundlagen . . . . . . . . . . . 9.3.2 Obere Extremität (axilläre Blockade) . . . . . . 9.3.3 Untere Extremität (Femoralisblockade) . . . . . 9.4 Intravenöse Regionalanästhesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 151 154 155 156 157 157 170 181 182 183 184 188 193 197 10 Anästhesierelevante Begleiterkrankungen . . . . . . . . . . . . . 10.1 Anästhesie bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen . . 10.1.1 Individuelles kardiovaskuläres Risiko . . . . . . . . . . . . 10.1.2 Eingriffsbezogenes kardiovaskuläres Risiko . . . . . . . . . 10.1.3 Arterielle Hypertonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1.4 Koronare Herzerkrankung (KHK) . . . . . . . . . . . . . . 10.1.5 Patienten nach Myokardinfarkt . . . . . . . . . . . . . . . 10.1.6 Patienten mit Erkrankungen der Herzklappen . . . . . . . 10.1.7 Patienten mit Herzrhythmusstörungen . . . . . . . . . . . 10.1.8 Patienten mit Herzinsuffizienz . . . . . . . . . . . . . . . 10.1.9 Anästhesieführung bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Anästhesie bei Patienten mit respiratorischen Erkrankungen . . . 10.2.1 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) . . . . . 10.2.2 Asthma bronchiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2.3 Narkoseführung bei Patienten mit COPD und Asthma bronchiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2.4 Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) . . . . . . . . 10.3 Endokrinologische Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3.1 Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3.2 Erkrankungen der Schilddrüse . . . . . . . . . . . . . . . 10.3.3 Anästhesie bei Patienten mit Nebenniereninsuffizienz . . . 10.3.4 Anästhesie bei Patienten mit Phäochromozytom . . . . . . 10.4 Adipositas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5 Neuromuskuläre Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6 Erkrankungen des ZNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6.1 Anästhesie bei Patienten mit Epilepsie . . . . . . . . . . . 10.6.2 Anästhesie bei Patienten mit Multipler Sklerose . . . . . . 10.6.3 Anästhesie bei Patienten mit Morbus Parkinson . . . . . . 10.7 Anästhesie bei Niereninsuffizienz . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.8 Anästhesie bei Lebererkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . 200 200 200 201 201 202 204 204 206 207 11 Anästhesiekomplikationen . . . . . 11.1 Respiratorische Komplikationen 11.1.1 Hypoxie . . . . . . . . 11.1.2 Laryngospasmus . . . . 11.1.3 Bronchospasmus . . . . 230 230 230 232 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 209 209 210 210 211 212 212 214 216 218 219 220 221 221 222 222 223 226 Inhaltsverzeichnis 11.1.4 Aspiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.5 Pneumothorax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 Intraoperative Hypotension . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.1 Ursachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.2 Praktisches Vorgehen bei intraoperativer Hypotension . 11.3 Intraoperative Hypertonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4 Schock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4.2 Massive intraoperative Blutung und hypovolämischer Schock . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4.3 Allergische Reaktion und anaphylaktischer Schock . . . 11.5 Herzrhythmusstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5.1 Tachykarde Herzrhythmusstörungen . . . . . . . . . . 11.5.2 Pharmakologisches Kurzprofil wichtiger Antiarrhythmika 11.5.3 Bradykarde Herzrhythmusstörungen . . . . . . . . . . 11.6 Lungenarterienembolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.1 Ursache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.2 Pathophysiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.3 Einteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.4 Klinische Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.5 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.6 Differenzialdiagnosen . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.6.7 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7 Das akute Koronarsyndrom (ACS) in der perioperativen Phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7.1 Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8 Postoperative Übelkeit und Erbrechen . . . . . . . . . . . . 11.8.1 Ursachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.2 Prophylaxe und Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . 11.8.3 Einzelsubstanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.9 Intraoperative Wachheit (engl. awareness) . . . . . . . . . . 11.9.1 Ursachen für Awareness . . . . . . . . . . . . . . . . 11.9.2 Risikofaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.9.3 Folgen von Awareness . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.9.4 Möglichkeiten zur Vermeidung von Awareness . . . . . 11.10 Postoperative Bewusstseinsstörungen . . . . . . . . . . . . . 11.10.1 Einschätzung der Bewusstseinslage . . . . . . . . . . . 11.10.2 Ursachen postoperativer Bewusstseinsstörungen . . . . 11.10.3 Narkosemittelüberhang . . . . . . . . . . . . . . . . 11.10.4 Postoperative Erregungszustände . . . . . . . . . . . 11.11 Störung des Wärmehaushalts . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.11.1 Hypothermie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.11.2 Hyperthermie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.12 Maligne Hyperthermie (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 236 242 242 243 244 245 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 248 250 252 258 262 266 266 266 266 267 267 268 268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 269 273 273 274 275 276 276 277 277 277 278 278 279 280 281 283 283 284 285 12 Volumen- und Flüssigkeitsersatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 Infusionslösungen für den Volumen- und Flüssigkeitsersatz . . . 12.2.1 Kristalloide Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2.2 Kolloidale Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3 Perioperatives Volumen- und Flüssigkeitsmanagement . . . . . . 289 289 291 292 293 296 XI XII Facts | Anästhesiologie und Schmerztherapie 13 Transfusion und Gerinnung . . . . . . . . . . 13.1 Blut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.1.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . 13.1.2 Praxis der Bluttransfusion . . . . . . . 13.1.3 Nebenwirkungen bei der Übertragung von Blutprodukten . . . . . . . . . . 13.1.4 Notfall- und Massivtransfusion . . . . 13.2 Blutgerinnung (Hämostase) . . . . . . . . . 13.2.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . 13.2.2 Gerinnungstests . . . . . . . . . . . 13.2.3 Gerinnungstherapeutika . . . . . . . 13.2.4 Störungen der Blutgerinnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 301 301 303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 308 309 309 310 311 314 14 Postoperative Schmerztherapie . . . . . . . . . . . 14.1 Pathophysiologische und anatomische Grundlagen des Schmerzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.1.1 Schmerzentstehung . . . . . . . . . . . . 14.1.2 Anatomische Grundlagen . . . . . . . . . 14.2 Auswirkungen postoperativer Schmerzen . . . . . 14.2.1 Atmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.2.2 Herz-Kreislauf-Funktionen . . . . . . . . . 14.2.3 Gastrointestinaltrakt . . . . . . . . . . . . 14.2.4 Weitere Einflussfaktoren . . . . . . . . . . 14.3 Diagnostik des postoperativen Schmerzes . . . . 14.3.1 Schmerzerfassung . . . . . . . . . . . . . 14.3.2 Schmerzdokumentation . . . . . . . . . . 14.4 Medikamentöse Schmerztherapie . . . . . . . . . 14.4.1 Indikation für systemische Analgesie . . . . 14.4.2 Pharmakologisches Konzept . . . . . . . . 14.4.3 Grundsätze der Schmerztherapie . . . . . . 14.4.4 Patientenkontrollierte Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kardiopulmonale Reanimation (CPR) . . . . . 15.1 Basismaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . 15.1.1 Kreislaufstillstand . . . . . . . . . . . 15.1.2 Herzdruckmassage . . . . . . . . . . 15.1.3 Atemwege und Beatmung . . . . . . 15.2 Erweiterte Maßnahmen . . . . . . . . . . . 15.2.1 Intubation und Beatmung . . . . . . 15.2.2 Defibrillation . . . . . . . . . . . . . 15.2.3 Medikamente . . . . . . . . . . . . 15.2.4 Intraossärer Zugang . . . . . . . . . 15.3 Postreanimationsphase . . . . . . . . . . . 15.3.1 Therapeutische milde Hypothermie . 15.3.2 Intensivmedizinische Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anhang . . . . . . . . . . . . . Abkürzungsverzeichnis . . . . Laborwerte mit Analytentabelle Sachverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 316 316 317 317 318 318 318 319 319 319 320 320 320 320 323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 325 325 327 327 328 328 329 331 332 335 335 335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 337 342 352 1 1 Grundlagen der Anästhesie Von Ulli Schilling Merke: Der Begriff „Anästhesie“ entstammt dem Griechischen und kann mit „Empfindungslosigkeit“ übersetzt werden. 1.1 Entwicklungsgeschichte Die Anästhesie, wie wir sie heute kennen, stellt eine relativ junge Fachdisziplin dar. Ihre Wurzeln lassen sich jedoch bis weit in die Antike zurückverfolgen. Mit dem Beginn der breiten klinischen Anwendung von Äther- und Lachgasinhalationsnarkosen vor ca. 150 Jahren wurde die moderne Anästhesie begründet. Ursprünglich ein Teilbereich der Chirurgie, emanzipierte sie sich als eigenständige Fachdisziplin und hat mit ihrer Weiterentwicklung den operativen Fortschritt überhaupt erst möglich gemacht. • Seit der Antike werden Opium (Laudanum) und andere Substanzen wie Bilsenkraut, Alraune oder Cannabis zur Schmerzstillung eingesetzt. • Im Mittelalter finden getränkte „Schlafschwämme“ Anwendung, deren betäubende Dämpfe eingeatmet werden. • Seit dem 16. Jahrhundert sind die Synthese des Äthers und seine narkotische Wirkung bekannt. • 1798 entdeckt Sir Humphrey Davy die analgetischen und berauschenden Eigenschaften des Lachgases (Stickoxydul). • 1806 isoliert der Apotheker Friedrich Sertürner Morphin aus Opium. • 1845 misslingt Horace Wells zunächst die öffentliche Demonstration einer Lachgasinhalationsnarkose. Merke: 16. Oktober 1846: Der Zahnarzt William Morton demonstriert mit den Worten „Gentlemen, this is no humbug.“ am Massachusetts General Hospital in Boston die erste erfolgreiche öffentliche Äthernarkose. Der „Ether Day“ gilt als offizielle Geburtsstunde der modernen Anästhesie. • 1847 etabliert der Geburtshelfer James Simpson das Chloroform, nach erfolgreichen Versuchen an seiner Familie, in der ärztlichen Praxis. • 1853 führt John Snow, der erste Arzt, der sich ausschließlich der Anästhesie widmet, bei Königin Viktoria eine Chloroformnarkose bei der Entbindung durch. • 1869 praktiziert Friedrich Trendelenburg erstmals eine Intubationsnarkose mittels einer temporären Tracheotomie. • 1878 entwickelt der Chirurg Mc Ewen die orale Intubationstechnik, welche später durch Jackson, Magill und Macintosh entscheidende Verbesserungen erfährt. • 1885 begründet William Halsted die Methode der Nervenblockade mit Kokain als erstem Lokalanästhetikum. • 1893 Gründung der „Society of Anaesthetists“ in London. • 1898 etabliert der Chirurg August Bier die Spinalanästhesie in der Klinik. • 1903 entwickelt die Firma Dräger das erste maschinelle Narkosegerät, ein direkter Vorläufer der heute gebräuchlichen Apparate. • 1923 Veröffentlichung der „Narkosestadien“ durch Arthur Guedel. • 1932 Hellmut Weese führt mit dem Barbiturat Hexobarbital das erste intravenöse Hypnotikum in die klinische Praxis ein. 1 2 1 Grundlagen der Anästhesie • 1942 wird das aus dem Pfeilgift Curare entwickelte Tubocurarin als erstes Muskelrelaxans klinisch eingesetzt. • 1953 Gründung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin (DGAI) und erste deutsche Facharztprüfung für Anästhesie. • 1958 findet Halothan als erster Vertreter halogenierter Kohlenwasserstoffe breite Anwendung als Narkosegas. • 1965 Einsatz von Ketamin zur „dissoziativen Anästhesie“. • 1981 entwickelt der Anästhesist Archibald Brain die Larynxmaske. • 1989 erstmalige Zulassung von Propofol als intravenöses Hypnotikum. • 1997 wird das Edelgas Xenon als „ideales“ Inhalationsanästhetikum vorgestellt. 1.2 Begriffsdefinitionen Folgende Anästhesieverfahren werden unterschieden (* siehe Abb. 1.1, S. 3): Allgemeinanästhesie (Narkose) Pharmakologisch induzierte, reversible Funktionsminderung des zentralen Nervensystems (ZNS) mit Verlust des Bewusstseins und Aufhebung der kompletten Sinneswahrnehmung. Die Beeinträchtigung von Atemantrieb und Schutzreflexen machen in der Regel eine Sicherung des Atemwegs und eine künstliche Beatmung erforderlich. Regionalanästhesie Blockade der neuronalen Reizleitung durch Lokalanästhetika auf zentraler (rückenmarksnaher) oder peripherer Ebene. Die Ausbreitung der Anästhesie kann so auf bestimmte Körperareale begrenzt werden, Bewusstsein und Spontanatmung bleiben erhalten. Balancierte Anästhesie Kombinierter Einsatz intravenöser und inhalativer oder volatiler (dampfförmiger) Anästhetika. Gilt heutzutage als Standardkonzept der Allgemeinanästhesie. Total intravenöse Anästhesie (TIVA) Vollständiger Verzicht auf Narkosegase, es werden lediglich kurzwirksame und gut steuerbare intravenöse Anästhetika verwendet. Kombinationsanästhesie Gleichzeitige Anwendung von Techniken der Regional- und Allgemeinanästhesie (z. B. Periduralkatheter und Vollnarkose bei einem großen Baucheingriff). Neuroleptanästhesie Kombinierte, hoch dosierte Gabe des Opioids Fentanyl und des Neuroleptikums Droperidol. Aufgrund häufiger intraoperativer Wachheitsphänomene und extra-pyramidaler Nebenwirkungen ist diese Form der Anästhesie heute obsolet. 1.2.1 Eigenschaften der Allgemeinanästhesie Die Narkose weist im Gegensatz zum physiologischen Schlaf eine Reihe von Unterschieden auf (* siehe Tab. 1.1, S. 4). Begriffsdefinitionen 3 1 Abb. 1.1 Schema der Anästhesieverfahren Dämpfung des Bewusstseins Als Vorstufen der Narkose gelten: Sedierung Zustand psychomotorischer Indifferenz, der Patient kann schlafen, ist aber jederzeit erweckbar. Eine spezifische Analgesie fehlt, lediglich der psychische Schmerzanteil fällt weg („Schmerzen tun nicht mehr so weh“). Hypnose Zustand erzwungenen Schlafs ohne Erweckbarkeit durch äußere Reize. Das an das Bewusstsein gekoppelte Schmerzempfinden fehlt, unwillkürliche Abwehrbewegungen und vegetative Reaktionen auf Schmerzreize bleiben erhalten. 70 5 Monitoring Von Ulli Schilling Das Monitoring dient der Überwachung der Vitalfunktionen des Patienten und ist bei jeder Anästhesieform obligatorisch. Weiterhin wird es während der Allgemeinanästhesie zur Steuerung der Narkosetiefe herangezogen. Für die meisten Eingriffe ist ein nichtinvasives Basismonitoring ausreichend. Bei großen Operationen oder schwer kranken Patienten kann eine Erweiterung durch invasive Maßnahmen notwendig sein. 5 Merke: Kein noch so modernes Überwachungsgerät kann die Aufmerksamkeit des Anästhesisten ersetzen. 5.1 Basismonitoring Das Basismonitoring umfasst: • Elektrokardiogramm (EKG). • Pulsoxymetrie. • Nichtinvasive Blutdruckmessung. 5.1.1 EKG Das Elektrokardiogramm leitet die summierten elektrischen Potenziale der Herzmuskelzellen ab. Die Veränderungen der kardialen elektrischen Aktivität werden als Kurve grafisch dargestellt. Aussagen zur mechanischen Herzfunktion (Auswurfleistung) können dabei nur sehr eingeschränkt getroffen werden. Die kontinuierliche EKG-Ableitung dient der Überwachung von: • Herzfrequenz (Bradykardie/Tachykardie). • Erregungsbildung und Erregungsleitung (z. B. Arrhythmien, Blockbilder). • Erregungsrückbildung (ST-Streckenanalyse zur Erkennung von Myokardischämien). • Schrittmacherfunktion bei Pacemaker-Patienten. ■ EKG-Ableitungen Die einzelnen Ableitungen können als unterschiedliche Blickrichtungen auf den Ablauf der elektrischen Herzaktivität angesehen werden. Standard ist das 3-Kanal-EKG mit den Extremitäten-Ableitungen I, II und III nach Eindhoven. Es wird dabei nur ein Kanal fortlaufend auf dem Monitor dargestellt. Am häufigsten wird die Ableitung II gewählt. Da diese die gleiche Richtung wie die normale Herzachse aufweist, sind hier die Amplituden von P-Welle und QRS-Komplex in der Regel am deutlichsten ausgeprägt. Supraventrikuläre und ventrikuläre Arrhythmien lassen sich so meist gut unterscheiden. Zur erweiterten EKG-Überwachung kann das 5-Kanal-EKG eingesetzt werden. Es können damit bis zu sieben Ableitungen (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V5) erfasst werden. Auf einem modernen Mehrkanalmonitor sind bis zu drei davon gleichzeitig darstellbar. Die Positionierung der Elektroden wird entsprechend der Lagerung des Patienten und des operativen Zugangswegs variiert (z. B. Elektroden auf dem Rücken bei Bauchlagerung). Basismonitoring 71 ■ ST-Streckenanalyse Integrierte Systeme sorgen bei modernen Monitoren für eine kontinuierliche ST-Streckenanalyse zur Erkennung von Myokardischämien. Als signifikante Zeichen gelten Senkungen oder Hebungen der ST-Strecke. Dabei sollten mindestens die Ableitung II und V5 gleichzeitig dargestellt werden: • Ableitung II: Überwachung der Unterwand des Herzens (Versorgungsgebiet der rechten Koronararterie). • Ableitung V5: Überwachung der Vorderseitenwand des Herzens (Versorgungsgebiet der linken Koronararterie). ■ Klinische Anwendung Die kontinuierliche EKG-Ableitung ist relativ störanfällig. Eine Darstellung von Artefakten kann die Interpretation erheblich erschweren. Häufige Störfaktoren sind: • Abgelöstes Kabel oder lose Klebeelektrode. • Interferenzen durch Elektrokauter. • Bewegungen des Patienten oder chirurgische Manipulation („Wackler“). • Respiratorische Schwankungen. Tipp: Hilfreich zur richtigen Interpretation ist ein Vergleich der EKG-Ableitung mit der Kurve der Pulsoxymetrie und aktuellen Blutdruckwerten. Keinesfalls darf eine falsche Analyse von Artefakten zu überstürzten Therapieversuchen führen (z. B.: „Kammerflimmern“ durch Wackeln an Elektroden). Störquellen müssen umgehend identifiziert und wenn möglich beseitigt werden, da sonst signifikante EKG-Veränderungen wegen Artefaktüberlagerung nicht erkannt werden können. 5.1.2 Pulsoxymetrie Mit der Pulsoxymetrie steht ein nichtinvasives Verfahren zur kontinuierlichen Überwachung der partiellen arteriellen Sauerstoffsättigung (pSaO2) zur Verfügung. ■ Messmethode Die Pulsoxymetrie basiert auf der Lichtabsorption des Hämoglobins der Erythrozyten im arteriellen Blutstrom. Der Grad der Absorption ist proportional zur Hämoglobinkonzentration („Lambert-Beer-Gesetz“). Oxygeniertes (O2-Hb) und desoxygeniertes Hämoglobin absorbieren dabei Licht verschiedener Wellenlänge unterschiedlich stark (* siehe Abb. 5.1, S. 72). Zwei Leuchtdioden im Clip des Pulsoxymeters strahlen infrarotes und rotes Licht ab, welches durch einen gegenüberliegenden Fotosensor aufgenommen wird. Anhand der unterschiedlichen Absorption kann der Anteil des oxygenierten („gesättigten“) Hämoglobins am Gesamthämoglobin spektralfotometrisch bestimmt werden. Merke: Normalwert der pSaO2: 98 % bei Atmung von Raumluft. Die Messgenauigkeit der Pulsoxymetrie ist bei einer pSaO2 im Bereich von 80–100 % gut (± 2 %). Fällt die Sättigung jedoch auf Werte < 80 % ab, verschlechtert sich die Präzision der Methode erheblich. Voraussetzung für die Bestimmung der arteriellen O2-Sättigung ist ein messbarer pulsatiler Blutfluss. Mithilfe des Pulssignals wird die so genannte Hintergrundabsorption durch venöses und kapilläres Blut elektronisch herausgefiltert. 5 72 Monitoring 5 Abb. 5.1 Messmethode der Pulsoxymetrie Die meisten Pulsoxymeter können Dyshämoglobine nicht differenzieren. Carboxyhämoglobin (CO-Hb) weist ein ähnliches Absorptionsverhalten wie O2Hb auf. So wird bei Kohlenmonoxid-Vergiftungen oder starken Rauchern eine falsch hohe pSaO2 gemessen. Auch eine Methämoglobinämie (Meth-Hb) führt fälschlicherweise zur Bestimmung überhöhter Sättigungswerte. In diesen Fällen gelingt eine exakte Messung nur mit speziellen Oxymetern. ■ Klinische Anwendung Mithilfe der Pulsoxymetrie lässt sich eine arterielle Hypoxämie rasch erkennen (Ansprechzeit 5–15 s). Außerdem wird die periphere Pulsfrequenz bestimmt und kann mit dem EKG-Rhythmus abgeglichen werden (Detektion eines Pulsdefizits). In eingeschränktem Maße erlaubt die grafische Darstellung der Volumenpulskurve (Plethysmografie) auch eine Aussage zur peripheren Durchblutung. Bei schlechter Perfusion (z. B. durch Hypothermie, Hypotension oder Vasokonstriktion) können nur niedrige Amplituden oder gar keine Kurve abgeleitet werden. Tipp: Nur bei Detektion und Darstellung eines pulsatilen Signals kann der pSaO2Wert als verwertbar angesehen werden. Bei ungenügender Signalaufnahme muss als Erstes der Messort gewechselt werden. Folgende weitere Faktoren können die Messgenauigkeit der Pulsoxymetrie stören: • Dyshämoglobinämie (CO-Hb, Meth-Hb). • Ausgeprägte Anämie. • Bewegungsartefakte. Basismonitoring 73 • Nagellack (blau, grün oder schwarz). Normalerweise wird zur Messung ein Fingerclip eingesetzt. Bei einer Ableitung am Ohrläppchen lassen sich schnellere Reaktionszeiten erzielen als an den Fingern oder Zehen. Eine Signalaufnahme an Zunge oder Nase ist ebenfalls möglich. 5.1.3 Nichtinvasive Blutdruckmessung Die diskontinuierliche, nichtinvasive Messung des Blutdrucks (engl. noninvasive blood pressure measurement, NIBP) ist wegen der einfachen und komplikationsarmen Anwendung unverzichtbarer Bestandteil des Basismonitorings. ■ Messmethode Die Messung erfolgt mittels Blutdruckautomaten nach dem oszillometrischen Prinzip. Schwingungen (Oszillationen) der arteriellen Gefäßwand werden über eine pneumatische Blutdruckmanschette und einen Druckschlauch auf einen Druckwandler im Monitor übertragen. Dieser übersetzt die mechanischen Schwingungen in elektronische Signale und zeigt den arteriellen Gefäßwanddruck in mmHg an. • Systolischer Blutdruck: Aufblasen der Manschette auf Druckwerte deutlich oberhalb des Blutdrucks und damit Verschluss der Arterie. Das erste Auftreten von Oszillationen beim stufenförmigen Ablassen des Manschettendrucks wird als systolischer Wert (Beginn des arteriellen Blutflusses) definiert. • Arterieller Mitteldruck: Der Punkt, an dem die Oszillationen bei weiterer Entlastung der Manschette ihr Maximum erreichen, entspricht dem mittleren arteriellen Druck (exaktester Wert der oszillometrischen Messmethode). Peripher ermittelte Werte stimmen in der Regel gut mit dem aortalen Mitteldruck überein. Merke: Der arterielle Mitteldruck (engl. mean arterial pressure, MAP) wird vom Herzzeitvolumen (HZV) ) und dem totalen peripheren Widerstand (TPR) bestimmt: MAP = HZV x TPR. Er gilt als Indikator für die Organperfusion. Viele Organe, z. B. das Gehirn, verfügen jedoch zusätzlich über eine Autoregulation ihrer Durchblutung. • Diastolischer Blutdruck: Sobald die Amplitude der Oszillationen bei fortlaufender Manschettenentlastung nicht weiter abnimmt, wird der diastolische Druck gemessen. Dieser Wert ist oszillometrisch nur ungenau zu bestimmen. ■ Klinische Anwendung Für die meisten Eingriffe ist eine nichtinvasive Blutdruckmessung ausreichend. • Normales Messintervall: 5 min. Die Messabstände sollten dauerhaft 2,5 min nicht unterschreiten, um Ischämien und Druckschäden an der Extremität zu vermeiden. • Wache Patienten empfinden die erste Messung wegen des initial hohen Manschettendrucks häufig als unangenehm. • Messort ist in der Regel der Oberarm auf der Gegenseite des venösen Zugangs (keine Flussbehinderung der Infusion). Bei Patienten mit Lymphabflussstörungen (z. B. nach Mammaablatio) sollte die Manschette am kontralateralen Arm angelegt werden. In Sonderfällen ist auch eine Messung am Bein möglich (spezielle Manschette, ungenauere Messwerte). • Bei Anzeige unplausibler Werte durch den Blutdruckautomaten sollte eine Messung an der kontralateralen Extremität oder eine manuelle Nachmessung erfolgen. 5 114 Lagerung 6.2 Lagerungsarten Die unterschiedlichen Lagerungsarten führen zu einer Veränderung von Atmung und Herz-Kreislauf-Funktion: • Respiratorisch kommt es durch Verschiebung des Zwerchfells und Änderung der thorakalen Dehnbarkeit (Compliance) zu einer lagerungsbedingten Abnahme der funktionalen Residualkapazität (FRC). Abhängig von der Körperposition ändert sich auch das pulmonale Ventilations-/Perfusionsverhältnis. • Kardiozirkulär steht die Veränderung des venösen Rückstroms mit entsprechender Beeinflussung von HZV und arteriellem Blutdruck im Vordergrund. Lagerungsart FRC Venöser Rückstrom Klinische Auswirkungen Rückenlage Atelektasebildung Seitenlage () Kopftieflage („Trendelenburg­ lagerung“) • • • • Steinschnittlage • Arterieller Blutdruck • Atelektasebildung • Thrombosegefahr der tiefen Beinvenen Bauchlage () () Gefahr der Vena-cava-Kompression Sitzende oder halbsitzende Lagerung • Luftemboliegefahr (Neurochirurgie) • Arterieller Blutdruck bei Aufrichten des Patienten 6 Arterieller Blutdruck Intrakranieller Druck Intragastraler Druck Beatmungsdruck Tab. 6.2 Veränderung pulmonaler und kardiozirkulatorischer Parameter bei unterschiedlichen Lagerungsarten Fällt die FRC unter die sogenannte Verschlusskapazität (engl. closing capacity), führt das ungenügende Lungenrestvolumen bei der Exspiration zum Kollabieren von Alveolen. Die Folge ist eine Bildung von nicht belüfteten Lungenabschnitten (Atelektasen). Aus diesem Grund ist, insbesondere bei adipösen Patienten, der Gasaustausch in Rücken- oder Kopftieflagerung eingeschränkt. Bei laparoskopischen Eingriffen wird durch eine Druckfüllung des Bauchraums mit CO2 (Kapnoperitoneum) die Ventilation zusätzlich erschwert. Wegen der damit verbundenen Reduktion der Zwerchfellbeweglichkeit kann der Beatmungsdruck deutlich ansteigen. Tipp: Zur Vermeidung von Atelektasen trägt eine PEEP-Beatmung mit ausreichend großen Atemzugvolumina bei. Die Anhebung des Oberkörpers in Rückenlage erleichtert die Spontanatmung bei adipösen Patienten. Ein Blutdruckabfall nach Lagerung kann durch die Gabe eines Vasopressors (z. B. Akrinor®) in der Regel rasch beseitigt werden. Lagerungsarten 115 Die im Folgenden dargestellten Lagerungsarten sind klassische Beispiele, welche durch verschiedene Modifikationen (z. B. Kopftief- oder Oberkörperhochlage) variiert werden. ■ Rückenlage 6 Abb. 6.1 Rückenlage mit abduziertem Arm • Standardlagerung zur Narkoseeinleitung. • Arme in Thoraxhöhe „auslagern“: – Abduktion nicht > 90°. – Innenrotation. – Leichter Beugung im Ellenbogengelenk. – Handgelenk in Pronationsstellung. • Angelegte Arme in Neutralstellung lagern und abpolstern. • Knierolle, Fersenpolster, Schutz des N. ulnaris (z .B. durch Gelkissen). • Kopf in Neutralstellung auf Kissen oder in einer Kopfschale lagern. 116 Lagerung ■ Steinschnittlage 6 Abb. 6.2 Steinschnittlage • Gynäkologische und proktologische Operationen (z. B. Perianalabszess). • Vermeidung extremer Hüftbeugung bei gleichzeitiger Streckung im Kniegelenk (Dehnung des N. ischiadicus). • Polsterung im Bereich des Fibulaköpfchens (Kompression des N. peroneus communis). Lagerungsarten 117 ■ Sitzende/halbsitzende Lagerung 6 Abb. 6.3 Sitzende Position (Neurochirurgie) • Intrakranielle Operationen in sitzender Lagerung. • Schultereingriffe in halbsitzender Lagerung oder „Liegestuhlposition“ (engl. beach chair position). • Erheblicher Blutdruckabfall nach Aufrichten aus der Rückenlage möglich. • Gefahr der Luftembolie bei Eröffnung intrakranieller Venen (negativer Venendruck). • Erhöhtes Thromboserisiko der tiefen Beinvenen (Beine möglichst hoch lagern, Kompression mit elastischen Binden). • Sichere Tubusfixierung und Augenschutz obligatorisch. • Wachlagerung vorteilhaft. 158 Regionalanästhesie ■ Anatomische Grundlagen Ein komplexer Bandapparat stabilisiert die knöcherne Wirbelsäule. Bei der spinalen Punktion im lumbalen Intervertebralraum zwischen den Dornfortsätzen werden von außen nach innen die folgenden Bandstrukturen durchstochen: • Das Ligamentum supraspinale verbindet die Enden der Dornfortsätze. Bei älteren Patienten können starke Verknöcherungen die mediale Punktion durch das Band erschweren. • Das dünne Ligamentum interspinale spannt sich zwischen den Dornfortsätzen auf. • Das derbe Ligamentum flavum verbindet die dorsale Seite des jeweils oberen und unteren Wirbelbogens. Ein leichter Widerstandsverlust nach Durchdringen der festen Bandstruktur und der Dura kann einen Hinweis auf das Erreichen des Subarachnoidalraums geben. Das im knöchernen Wirbelkanal verlaufende Rückenmark erstreckt sich vom Foramen magnum der Schädelbasis bis zur Lendenwirbelsäule. Es endet als Conus medullaris in der Regel in Höhe des ersten oder zweiten Lendenwirbelkörpers (L1/L2), bei 5 % der Erwachsenen allerdings erst zwischen L2 und L3. Kaudal davon ziehen die Nervenfasern als Cau­ da equina (Pferdeschweif) einzeln bis in den Steißbeinbereich. 9 ! Achtung: Um Rückenmarkverletzungen zu vermeiden, wird bei der Spinalanästhesie nie weiter kranial als im lumbalen Intervertebralraum L2/L3 punktiert. Abb. 9.1 Punktion des Subarachnoidalraums Zentrale Regionalanästhesie 159 Das Rückenmark wird von der derben Dura mater umhüllt, welche aus zwei Blättern besteht. Die Lamina externa bildet dabei das Periost des Wirbelkanals. Das innere Blatt der Dura (Lamina interna) ist mit der darunter liegenden, zarten Arachnoidea fest verbunden und bildet den sogenannten „Duralsack“. Beide Hirnhäute werden bei der spinalen Punktion durchstochen. Der dabei punktierte Subarachnoidalraum (Intrathekalraum) enthält Liquorflüssigkeit (Gesamtvolumen ca. 150 ml, davon etwa 75 ml im spinalen Bereich). Als letzte Hülle liegt die gefäßreiche Membran der Pia mater dem Rückenmark direkt auf. Merke: Die von Liquor umflossenen Spinalnervenwurzeln sind der Wirkort des injizierten Lokalanästhetikums. Nervenfasern der afferenten, sensorischen Hinterwurzel und der efferenten, motorischen Vorderwurzel verbinden sich zum Spinalnerv. Über die Foramina intervertebralia verlassen 31 Spinalnervenpaare das Rückenmark: • 8 zervikale. • 12 thorakale. • 5 lumbale. • 5 sakrale. • 1 kokzygeales. [* Siehe Abb. 9.2, S. 160] Die sensible Innervation der Haut wird über definierte Segmente den jeweiligen Spinalnerven zugeordnet. Mithilfe dieser sogenannten Dermatome kann die kraniale Ausbreitung einer sensorischen Blockade bei der Spinalanästhesie bestimmt werden. Trotz einer Innervation aus dem gleichen Rückenmarksegment kann die anatomische Lage tieferer Gewebeschichten (Muskulatur oder Organe) von der Höhe des entsprechenden Dermatoms abweichen. 9 160 Regionalanästhesie 9 Abb. 9.2 Segmentale Innervation der Haut (Dermatome) Zentrale Regionalanästhesie 161 ■ Lagerung und Orientierung Die spinale Punktion kann in sitzender Position oder in Seitenlage durchgeführt werden. Eine sitzende Lagerung des Patienten ist zum Erlernen der Technik besser geeignet. 9 Abb. 9.3 Lagerung und Orientierung bei der Spinalanästhesie Zum Auffinden der Punktionsstelle wird das kraniale Ende der Darmbeinschaufeln des Patienten seitlich beidseits getastet. Eine gedachte Verbindungslinie zwischen den beiden Cristae iliacae schneidet die Wirbelsäule in der Regel in Höhe des vierten Lendenwirbel- 162 Regionalanästhesie körpers (L4). Im darüber liegenden Intervertebralraum L3/ 4 wird in der Vertiefung zwischen den beiden gut tastbaren Processi spinosi punktiert. Da im lumbalen Bereich die Dornfortsätze nahezu horizontal verlaufen, lässt sich die Spinalkanüle meist gut einführen. Eine spezifische Lagerung erleichtert die Punktion. Der Patient wird dabei aufgefordert: • In sich zusammen zu sacken. • Den Kopf auf die Brust zu nehmen. • Den Rücken nach hinten rund zu machen („Katzenbuckel“). 9 Durch dieses von einer Hilfsperson assistierte Lagerungsmanöver wird die Lendenlordose ausgeglichen und die Intervertebralräume durch „Aufklappen“ der Dornfortsätze erweitert. ■ Spinalkanülen [* Siehe Abb. 9.4] Mit der Verwendung atraumatisch geschliffener und möglichst dünner Spinalnadeln (24– 29 G) lässt sich die Häufigkeit postspinaler Kopf- und Rückenschmerzen deutlich reduzieren. Kanülentypen mit stumpfer Pencil-Point®-Spitze zerschneiden die Fasern der Dura mater nicht, sondern drängen sie auseinander und hinterlassen so nur eine kleine Punktionsöffnung. Dünne Nadeln verfügen über eine ca. 3 cm lange, kräftige Einführhilfe (Introducer), da sich die Haut und die derben spinalen Bandstrukturen sonst Abb. 9.4 Verschiedene Typen der Spinalkanüle nicht durchstechen lassen. Eine dicke Spinalkanüle (22 G) sollte nur bei schwierigen Punktionsbedingungen (z. B. starke Verknöcherung) angewendet werden. Alle Nadeltypen sind mit einem Mandrin versehen, um die Verschleppung eines ausgestanzten Gewebezylinders in den Subarachnoidalraum zu verhindern. Zentrale Regionalanästhesie 163 ■ Punktionstechnik (medianer Zugang) Ein Basismonitoring und ein venöser Zugang sind bei jeder Spinalanästhesie obligatorisch. Nach Lagerung des Patienten und Auffinden der Punktionsstelle ist ein streng aseptisches Vorgehen erforderlich: • Hygienische Händedesinfektion. • Mundschutz und OP-Haube. • Sterile Handschuhe und Kittel. • Großzügige Hautdesinfektion. • Steriles Abdecken mittels Lochtuch. Nach ausreichender Einwirkzeit wird der Punktionsbereich mit einem sterilen Tupfer abgewischt, um zu verhindern, dass Desinfektionsmittelreste in den Subarachnoidalraum eingebracht werden. Tipp: Der Patient sollte über jeden Schritt der Spinalanästhesie vorab vom Anästhesisten informiert und dazu aufgefordert werden, Parästhesien oder Schmerzen sofort zu äußern. Mit direkter Kommunikation lassen sich Ängste des Patienten vor der von ihm nicht einsehbaren Punktion deutlich reduzieren. [* Siehe Abb. 9.5, S. 164] • Ausreichende Lokalanästhesie von Punktionsstelle und Stichkanal (Infiltration in den festen Bandapparat oft nicht möglich, dann leicht lateral davon einspritzen). • Einstechen des Introducers (bei asthenischen oder kachektischen Patienten muss mit Vorsicht punktiert werden). • Einführen der Spinalkanüle in den Introducer. Beim weiteren Vorschieben der Nadel stützt sich der Punktierende zur Stabilisierung mit beiden Händen am Rücken des Patienten ab. • Die Stichrichtung verläuft horizontal oder leicht kranial zwischen den Dornfortsätzen und streng in der Mittelinie. Nach durchschnittlich 5–7 cm wird der Subarachnoidalraum erreicht (meist leichter Widerstandsverlust nach Durchdringen des Ligamentum flavum und des Duralsacks). Merke: Der Rückfluss von klarem Liquor nach Entfernen des Mandrins zeigt die korrekte Lage der Spinalkanüle an. Erst dann darf die Gabe des Lokalanästhetikums erfolgen. Bei sehr dünnen Nadeln dauert es einige Zeit, bis Liquor sichtbar wird. Der Patient kann dann zum Husten oder Pressen aufgefordert werden, um den Abfluss zu beschleunigen. • Gleichmäßige Injektion des Lokalanästhetikums, dabei muss die Spinalnadel sicher mit einer Hand fixiert werden. • Entfernen von Kanüle und Introducer nach Wiedereinsetzen des Mandrins. Aufkleben eines Pflasters und rasche Lagerung des Patienten je nach gewünschter Ausbreitungshöhe. 9 246 Anästhesiekomplikationen • • • • • • Arterielle Hypotonie und Tachykardie (fadenförmiger Puls). Blasse, kaltschweißige Haut. Tachypnoe, Hyperventilation. Oligurie. Verlängerte Kapillarfüllungszeit. Verwirrtheit, Unruhe, Bewusstseinsverlust. ■ Allgemeine Schocktherapie Das Ziel einer jeden Schocktherapie ist zunächst die Wiederherstellung eines ausreichenden Sauerstoffangebots für den Organismus. Wichtig ist ein frühzeitiger Therapiebeginn. Grundbausteine der Schocktherapie sind: • Verbesserung der Mikro- und Makrozirkulation durch Volumengabe (bei allen Schockformen indiziert, außer im kardiogenen Schock). • Kreislaufunterstützung mit Katecholaminen. • Sauerstoffgabe. • Frühzeitige Intubation und Beatmung anstreben. Merke: Eine großzügige Volumengabe ist bei allen Schockformen mit Ausnahme des kardiogenen Schocks indiziert. 11.4.2 Massive intraoperative Blutung und hypovolämischer Schock ■ Überblick 11 Intraoperative Blutungen müssen schnell erkannt und zielgerichtet therapiert werden. Je nach Art der Blutung wird zwischen kontrollierbaren und unkontrollierbaren Blutungen unterschieden. Kontrollierbare Blutungen sind Blutungen, die durch chirurgische Maßnahmen schnell unterbunden werden können (z. B. Verletzungen von Gefäßen im Bereich der Extremitäten). Bei unkontrollierbaren Blutungen ist die Blutungsquelle nicht genau bekannt (penetrierende Verletzung) oder können aufgrund von eingeschränkter Zugänglichkeit nicht in kurzer Zeit gestillt werden (z. B. Blutungen im kleinen Becken). Als Massenblutung gilt ein Verlust von mehr als 50 % des Körperblutvolumens innerhalb von 3 Stunden oder ein anhaltender Blutverlust von 150 ml/min. Unbehandelt gehen größere Blutungen mit einem dekompensierten hämorrhagischen Schock einher. ■ Ursachen Intraoperative Blutungen entstehen häufig durch Gefäßverletzungen bei Eingriffen an: • Leber. • Aorta. • Organen des kleinen Beckens. Postoperativ kann es vor allem nach Tonsillektomie oder im Zuge einer postpartalen Uterusatonie zu erheblichen Blutverlusten kommen. Je nach Höhe des Blutverlustes wird der hämorrhagische Schock in 4 Schweregrade eingeteilt. • Grad I: Blutverlust 15 % des zirkulierenden Blutvolumens (ca. 750 ml). • Grad II: Blutverlust ca. 30 % des zirkulierenden Blutvolumens (ca. 750–1.500 ml). • Grad III: Blutverlust ca. 30–40 % des zirkulierenden Blutvolumens (ca. 2.000 ml). • Grad IV: Blutverlust mehr als 40 % des zirkulierenden Blutvolumens (> 2.000 ml). Schock 247 Bis zu einem Blutverlust von ca. 30 % des zirkulierenden Blutvolumens können die hämodynamischen Parameter durch körpereigene Kompensationsmechanismen stabil gehalten werden (kompensierter hämodynamischer Schock). Ab Grad III liegt definitionsgemäß ein dekompensierter Schock mit konstanter Lebensbedrohung aufgrund von Hypovolämie und anämischer Hypoxie vor. ■ Klinische Symptome Leitsymptom des hämorrhagischen Schocks sind Tachykardie und Hypotension. Das Hautkolorit ist blass, die Mikrozirkulation reduziert und die Rekapillarisierungszeit der Akren verlängert. Die Extremitäten sind infolge der zunehmenden Kreislaufzentralisation häufig kühl. Wache Patienten werden mit zunehmendem Blutverlust unruhig und desorientiert. Das Atemmuster ist tachypnoisch. Merke: Besonders junge Patienten können durch Steigerung der Herzfrequenz einen akuten Blutverlust lange Zeit kompensieren. ■ Differenzialdiagnosen Differenzialdiagnostisch müssen vor allem Zustände, die auch mit den Leitsymptomen Tachykardie und Hypotension einhergehen, ausgeschlossen werden. Wichtige Differenzialdiagnosen sind: • Kardiogener Schock. • Anaphylaktischer Schock. • Lungenarterienembolie. • Spannungspneumothorax. ■ Therapie Die wirksamste Therapie ist die chirurgische Versorgung der Blutungsquelle. Weitere Therapieziele sind die Wiederherstellung einer Normovolämie und eine Optimierung des Sauerstoffangebotes. Bei einer massiven intraoperativen Blutung sollte zunächst personelle Hilfe angefordert werden. Weitere Therapieschritte sind (* siehe auch Kap. 13.1.4, S. 308 f.): • Falls noch nicht geschehen, Intubation und Beatmung. • Optimierung des Sauerstoffangebots durch Beatmung mit 100 % Sauerstoff. • Anlage mehrerer großlumiger Zugänge (ggf. Anlage eines Mehrlumen-Shaldon-Katheters). • Bei schwierigen Venenverhältnissen und bei Kindern großzügige Indikation für intraossären Zugang. • Wärmeverluste vermeiden (Hypothermie verschlechtert die Gerinnung!). • Volumentherapie. • Verwenden eines Autotransfusionssystems z. B. cell saver (das Blut wird aufgefangen, gewaschen und retransfundiert). • Nutzung automatischer Transfusionssysteme (z. B. Level 1®). • Einsatz von Katecholaminen. Volumentherapie Ziel der Volumentherapie ist eine Normovolämie mit Wiederherstellung der mikrovaskulären Perfusion. Welches Volumenersatzmittel gegeben werden sollte, wird aktuell kontrovers diskutiert. Theoretisch bieten kolloidale Lösungen aufgrund des höheren intravasalen Volumeneffekts Vorteile. Bisher konnte allerdings keine eindeutige Überlegenheit gegenüber kristalloiden Lösungen nachgewiesen werden. In der klinischen Praxis hat sich 11 248 Anästhesiekomplikationen eine kombinierte Gabe von Kristalloiden und Kolloiden bewährt. Ein Blutverlust von 20 % des Blutvolumens sollte durch Kristalloide und Kolloide ausgeglichen werden. Ab einem Blutverlust von 30 % erfolgt in Abhängigkeit von physiologischen Transfusionstriggern (z. B. Tachykardie trotz Normovolämie bei Hb-Werten < 7 g/dl und ST-Streckenveränderungen) die Gabe von Erythrozytenkonzentraten. Bei weiter fortschreitender Blutung erfolgt die Substitution von FFP im Verhältnis von 1:2 zur EK-Gabe. Bei Blutverlusten > 100 % des zirkulierenden Blutvolumens ist zusätzlich die Gabe von Thrombozytenkonzentraten notwendig. In Abhängigkeit von der klinischen Blutungsneigung sollte eine Thrombozytenzahl von > 50.000/µl angestrebt werden. Katecholamintherapie Wenn durch alleinige Volumensubstitution kein ausreichender arterieller Mitteldruck (MAP > 60 mmHg) zu erreichen ist, muss der Einsatz von Katecholaminen erwogen werden. Aufgrund der überwiegend alphamimetischen Wirkung ist Noradrenalin das Katecholamin der Wahl. Invasives Monitoring Nach Stabilisierung des Patienten sollte zur differenzierten Steuerung der Katecholaminund Volumentherapie die Anlage von arterieller Kanüle, ZVK (wenn noch nicht geschehen) und PiCCO erfolgen. 11.4.3 Allergische Reaktion und anaphylaktischer Schock ■ Überblick 11 Die klassische anaphylaktische Reaktion tritt intraoperativ mit einer Häufigkeit von etwa 1:20.000 auf. Dabei handelt es sich um eine immunologische, IgE-vermittelte Reaktion vom Soforttyp (Typ-I-Reaktion), bei der die Anaphylaxie nach dem Allergenkontakt durch Mastzelldegranulation ausgelöst wird. Voraussetzung für eine Typ-I-Reaktion ist eine vorangegangene Sensibilisierung gegen das Antigen. Das Antigen kann intravenös, durch die Haut, durch den Magen-Darm-Trakt oder über die Luftwege aufgenommen werden. Von der klassischen anaphylaktischen Reaktion muss die anaphylaktoide Reaktion unterschieden werden. Sie kommt wesentlich häufiger (1:3.500) vor und ist durch eine unspezifische Histaminfreisetzung aus Mastzellen und basophilen Granulozyten gekennzeichnet. Auslöser sind häufig Histamin freisetzende Medikamente wie z. B. das Muskelrelaxans Mivacurium. Auch Substanzen, die mit dem Arachidonsäuremetabolismus interferieren und zu einem Überwiegen der Leukotriene führen (z. B. nichtsteroidale Antiphlogistika) oder auch physikalische Stimuli können anaphylaktoide Reaktionen hervorrufen. ■ Ursachen Als Ursachen anaphylaktischer Reaktionen gelten Medikamentenallergien oder latente Kreuzsensibilisierungen (z. B. durch Nahrungsmittel). Medikamente, die häufig eine Anaphylaxie auslösen sind: • Penicilline. • Jodhaltige Röntgenkontrastmittel. • Kolloidale Volumenersatzlösungen. • Muskelrelaxanzien. • Lokalanästhetika. Die durch Medikamente ausgelöste unspezifische Histaminfreisetzung betrifft vor allem prädisponierte Patienten (z. B. Atopiker und Asthmatiker). Von besonderer Bedeutung in der perioperativen Phase ist die Latexallergie. Auslöser können alle latexhaltigen medi- Schock 249 zinischen Produkte sein. Besonders gefährlich ist dabei die aerogene Exposition, z. B. über gepuderte Latexhandschuhe. Häufig bestehen bei betroffenen Patienten Kreuzunverträglichkeiten auf bestimmte Lebensmittel z. B. Bananen, Kiwis, Mangos, Nüsse oder Avocados. Weiterhin scheinen Patienten mit einem häufigen Kontakt zu latexhaltigen Produkten ein höheres Risiko für eine Latexallergie aufzuweisen (z. B. Patienten mit Spina bifida oder urogenitalen Fehlbildungen). ■ Klinische Symptome Klinisch können anaphylaktoide und anaphylaktische Zustände nicht voneinander unterschieden werden. Beide Reaktionen können sämtliche Schweregrade bis hin zum HerzKreislauf-Stillstand aufweisen. Häufige Frühsymptome einer Anaphylaxie während einer Anästhesie sind: • Nicht tastbarer peripherer Puls oder Tachykardie. • Hautrötung. • Anstieg des Beatmungsdrucks (durch Bronchospasmus). • Urtikaria. • Zyanose. • Hypotension (relative Hypovolämie durch Vasodilatation und Volumenverschiebung ins Interstitium). Zu beachten ist, dass das Ausmaß der Hautrötung nicht mit dem Schweregrad der allergischen Reaktion korreliert. Eine therapiebedürftige Kreislaufdepression kann sofort auftreten oder erst im späteren Verlauf hinzukommen. Bei nicht anästhetisierten Patienten können Globusgefühl, Heiserkeit, Stridor, Schwindel, Vigilanzstörungen und auch gastrointestinale Symptome Frühzeichen sein. ■ Differenzialdiagnosen Die Diagnose anaphylaktische Reaktion ist in der Akutphase eine Ausschlussdiagnose. Differenzialdiagnostisch kommen in Betracht: • Volumenmangel. • Septischer Schock. • Kardiogener Schock. • Lungenembolie. • Spannungspneumothorax. • Aspiration. • Fremdkörperaspiration bei Kindern. ■ Therapie Basistherapie Die Therapie erfolgt nach dem Schweregrad der klinischen Symptomatik. Therapeutische Erstmaßnahmen sind: • Beenden der Allergenzufuhr. • Großlumige periphere Zugänge legen. • O2-Applikation über Maske (10 l/min). • Monitorüberwachung. Erweiterte Therapiemaßnahmen Bei respiratorischer Insuffizienz und Stridor sollte eine frühzeitige Intubation und Beatmung erwogen werden. Das Medikament der Wahl bei Anaphylaxie und anaphylaktischem Schock ist Adrenalin. Aufgrund der Alpha-Rezeptor vermittelten Vasokonstriktion 11 292 Volumen- und Flüssigkeitsersatz 12.2.1 Kristalloide Lösungen Als kristalloide Lösungen werden Elektrolytlösungen oder niedermolekulare Glukoselösungen bezeichnet. Sie diffundieren frei durch Kapillarmembranen und verteilen sich rasch und gleichmäßig auf Intravasalraum und Interstitium. Der Volumeneffekt ist daher gering, nur ca. 25–30 % der zugeführten Menge verbleiben intravasal. Merke: Um 1 ml Plasma zu ersetzen, müssen 3–4 ml kristalloide Lösung infundiert werden. Nachteil eines größeren Volumenersatzes mit Kristalloiden ist die Überwässerung des Interstitiums. Mit sogenannten balancierten Lösungen wird versucht, Infusionspräparate herzustellen, welche weitgehend der Zusammensetzung des menschlichen Plasmas entsprechen. Wichtige Eigenschaften sind: • Plasmaisotonie (Osmolarität von 290–300 mosmol/l). • Physiologischer Elektrolytgehalt (insbesondere an Natrium und Chlorid). Aus galenischen Gründen enthalten balancierte Lösungen kein Bikarbonat als Pufferbase. Eine Zufuhr großer Volumina kann zu einer Verdünnungsazidose mit Abnahme der Bikarbonatkonzentration führen. Daher ist der Zusatz metabolisierbarer Anionen (z. B. Laktat, Azetat, Malat) erforderlich, welche unter O2-Verbrauch zu Bikarbonat verstoffwechselt werden. Es existieren eine Vielzahl an unterschiedlichen kristalloiden Infusionslösungen. Im Folgenden werden die wichtigsten Präparate dargestellt. 12 Na Cl K Ca Mg Base Osmolarität Plasma 138 108 5 5 3 27 Isoton NaCl 0,9 % 154 154 – – – – Isoton Ringer-Laktat 130 109 4 3 – 28 Hypoton Glukose 5 % – – – – – – Hypoton Sterofundin® 140 106 4 2,5 1 45 Isoton Jonosteril® 137 110 4 1,7 1,3 37 Isoton Tab. 12.3 Übersicht kristalloider Infusionslösungen (Elektrolytgehalt in mval/l) ■ Isotone Kochsalzlösung NaCl 0,9 % Plasmaisotone Lösung mit unphysiologisch hohem Natrium- und Chloridgehalt (154 mmol/l). Andere Elektrolyte oder Pufferbasen sind nicht enthalten. Wegen der Ausbildung einer hyperchlorämischen Azidose für die Zufuhr in größeren Mengen ungeeignet. ■ Ringer-Laktat-Lösung Infusionslösung mit niedrigem Natriumgehalt (130 mmol/l) und Zusatz von Kalium und Calcium. Das enthaltene Laktat wird in der Leber zu Bikarbonat umgewandelt. Von Nach- Infusionslösungen für den Volumen- und Flüssigkeitsersatz 293 teil sind dabei ein hoher O2-Verbrauch bei der Metabolisierung sowie die Laktatkumulation bei Leberinsuffizienz. Als hypotone Lösungen (276 mosmol/l) sind Ringer-Laktat-Präparate bei Patienten mit erhöhtem Hirndruck kontraindiziert. ■ Glukoselösung G 5 % Hypotone Lösung (253 mosmol/l) von 50 g Glukose in 1 l H2O. Der Energiegehalt deckt mit 200 kcal etwa 10 % des normalen Tagesbedarfs. Nach Metabolisierung der Glukose liegt die elektrolytfreie Lösung als freies Wasser vor. Daher sind Glukosepräparate für den Volumenersatz ungeeignet. Eine größere Zufuhr führt zur hypotonen Überwässerung von IZR und EZR mit Hyponatriämie. Zur parenteralen Ernährung auf der Intensivstation stehen Lösungen mit höherem Glukosegehalt zur Verfügung (G 20 % oder G 40 %). ■ Halb-/Drittel-Elektrolytlösungen Diese bisher insbesondere in der Pädiatrie eingesetzten Lösungen enthalten einen im Vergleich zum Plasma reduzierten Elektrolytanteil mit Zusatz von 5 % Glukose. Initial deutlich hyperton können sie bei rascher Zufuhr zur osmotischen Diurese führen. Nach Metabolisierung der Glukose verhalten sich die Lösungen hypoton. Wegen mangelnder Volumenwirkung und der Gefahr von Hyperglykämie, Hyponatriämie und hypotoner Überwässerung (Hirnödem) ist ihr Einsatz in der pädiatrischen Anästhesie mittlerweile obsolet. ■ Vollelektrolytlösungen Diese isotonen Lösungen (z. B. Sterofundin®, Jonosteril®) enthalten die wichtigsten Elektrolyte in einer Gesamtkonzentration, welche annähernd der des Plasmas entspricht. Malat oder Azetat werden als metabolisierbare Anionen zugesetzt und unter geringem O2Verbrauch leberunabhängig zu Bikarbonat umgewandelt. Diese balancierten Lösungen sind das Mittel der Wahl bei der Routine-Flüssigkeitszufuhr und dem kurzfristigen Volumenersatz. 12.2.2 Kolloidale Lösungen Kolloidale Lösungen enthalten hochmolekulare Substanzen, welche onkotisch wirksam sind. Diese großen Moleküle können nicht frei durch Kapillarmembranen diffundieren und verbleiben daher länger im Gefäßsystem. Merke: Kolloide, deren osmotischer Druck gleich dem des Plasmas ist, werden als Plasmaersatzmittel bezeichnet. Ihre Volumenwirkung entspricht der infundierten Menge. Liegt der osmotische Druck einer kolloidalen Lösung höher als der des Plasmas, bewirkt dies einen Flüssigkeitseinstrom aus dem Interstitium nach intravasal (hyperonkotische Lösung). Die Volumenwirkung dieser sogenannten Plasmaexpander ist somit größer als die zugeführte Menge. Generell werden körpereigene und künstliche Kolloide unterschieden. Körpereigene Substanzen sind: • Humanalbuminlösungen. • Plasmaproteinlösungen. • Gefrorenes Frischplasma. 12 326 Kardiopulmonale Reanimation (CPR) 15 Abb. 15.1 Reanimationsschema (Advanced Life Support) Basismaßnahmen 327 Eine weitere perioperativ häufig vorkommende Ursache für den Kreislaufstillstand ist die fulminante Lungenembolie. Sie führt über eine thrombembolische Verlegung der pulmonalen Hauptstrombahn zum akuten Rechtsherzversagen. ■ Respiratorische Ursachen Bei respiratorischen Störungen kommt es über eine Hypoxie sekundär zum Pumpversagen des Herzens. Dies ist bei Neugeborenen und Kleinkindern die häufigste Ursache für einen Kreislaufstillstand. 15.1.2 Herzdruckmassage Merke: Die Herzdruckmassage ist die wichtigste Maßnahme der CPR. Nur durch eine effektive mechanische Kompression des Herzens zwischen Sternum und Wirbelsäule kann ein Minimalkreislauf zur O2-Versorgung von Gehirn und Herz aufrechterhalten werden. Die Herzdruckmassage wird möglichst ohne Unterbrechungen durchgeführt. Das Verhältnis von Kompression zu Ventilation beträgt beim Erwachsenen 30:2. Für eine effektive Thoraxkompression ist zu beachten: • Druckpunkt: mittleres Sternumdrittel. • Kompressionsfrequenz: 100/min. • Kompressionstiefe: mindestens 5 cm. • Vollständige Entlastung zwischen den einzelnen Kompressionen. • Feste Körperunterlage. Eine wirkungsvolle Herzdruckmassage ist körperlich sehr anstrengend. Es kommt daher rasch zur Ermüdung und nachlassender Effektivität. Die durchführende Person muss deshalb regelmäßig abgelöst werden. In vielen Kliniken stehen mittlerweile auch automatische Reanimationshilfen für eine maschinelle Thoraxkompression zur Verfügung (z. B. Auto-Pulse®). 15.1.3 Atemwege und Beatmung Generell tritt bei der kardiopulmonalen Reanimation mittlerweile die Beatmung gegenüber der effektiv durchgeführten Abb. 15.2 Herzdruckmassage Herzdruckmassage in den Hintergrund. Dennoch muss auch auf eine Sicherstellung der Oxygenierung geachtet werden, insbesondere bei einer respiratorischen Ursache des Kreislaufstillstands. [* Siehe Abb. 15.3, S. 328] 15 328 Kardiopulmonale Reanimation (CPR) Zu den Basismaßnahmen gehören: • Freimachung der Atemwege durch vorsichtige Reklination des Kopfes und Anheben des Unterkiefers (Esmarch-Handgriff). • Entfernung von Fremdkörpern aus der Mundhöhle. • Maskenbeatmung mit 100 % O2 über einen Reservoirbeutel (bei schwieriger Maskenbeatmung Guedel-Tubus einlegen) ! Achtung: Viele Helfer neigen dazu, den Patienten bei der CPR übermäßig zu beatmen. Diese Hyperventilation kann durch einen erhöhten intrathorakalen Druck und den damit verbundenen reduzierten venösen Rückstrom zum Herzen die Effektivität der Thoraxkompression beeinträchtigen (Maskenbeatmung * siehe Kap. 7, S. 121 ff.). Aufgrund der höheren physiologischen Atemfrequenz und der oft respiratorischen Genese eines Kreislaufstillstands wird die Kinderreanimation mit fünf Abb. 15.3 Esmarch-Handgriff Beatmungen begonnen. Danach ist das Verhältnis von Kompression zu Ventilation altersabhängig: • Neugeborene 3:1. • Säuglinge und Kinder bis zur Pubertät 15:2. • Kinder ab der Pubertät 30:2. 15.2 Erweiterte Maßnahmen 15 Zu den erweiterten Maßnahmen der Reanimation (engl. Advanced Life Support, ALS) zählen: • Intubation und maschinelle Beatmung. • Defibrillation. • Medikamente. Vom professionellen medizinischen Personal wird der Advanced Life Support zusammen mit den Basismaßnahmen durchgeführt. 15.2.1 Intubation und Beatmung Die endotracheale Intubation ist das Standardverfahren zur Atemwegssicherung (Aspirationsschutz). Sie soll jedoch nur von geübten Helfern durchgeführt werden. Eine dafür notwendige Unterbrechung der Thoraxkompression sollte nicht mehr als 10 s betragen. Bei unerfahrenem Personal oder schwierigem Atemweg wird mit der Maske beatmet oder Erweiterte Maßnahmen 329 eine alternative Atemwegshilfe eingesetzt (z. B. eine Larynxmaske oder ein Larynxtubus, * siehe Kap. 7, S. 121 ff.). Nach der Intubation ist der Einsatz einer Kapnografie obligatorisch. Diese wird herangezogen zur: • Sicherung der korrekten Tubuslage. • Effektivitätskontrolle der Herzdruckmassage. • Erkennung der Wiederkehr eines Spontankreislaufs (engl. return of spontaneous circulation, ROSC). Merke: Beim intubierten Patienten wird die Herzdruckmassage ohne Ventilationspausen kontinuierlich durchgeführt. Die maschinelle Beatmung erfolgt mit 100 % O2 und beim Erwachsenen mit einer Frequenz von 10/min. 15.2.2 Defibrillation Bei der Defibrillation werden durch einen kurzen Stromstoß mit hoher Amplitude sämtliche Herzmuskelzellen depolarisiert und damit elektrisch synchronisiert. Idealerweise ist der darauf folgende Herzrhythmus ein Sinusrhythmus. ■ Gerätetypen Außerhalb der Klinik werden oft Systeme mit automatischer Herzrhythmusanalyse (engl. automated external defibrillator, AED) eingesetzt. Im professionellen medizinischen Bereich finden jedoch meistens manuelle Defibrillatoren mit EKG-Monitor Anwendung. Die Rhythmusanalyse wird bei diesen Geräten dem Anwender überlassen. Nach Art der Energieabgabe werden zwei Gerätetypen unterschieden: • Monophasische Defibrillatoren (nur positiver Stromimpuls). • Biphasische Defibrillatoren (positiver und nachfolgender negativer Stromimpuls mit entgegengesetzter Richtung). Durch den zusätzlichen negativen Impuls ist bei den modernen, biphasischen Geräten eine geringere Energiemenge zur Defibrillation notwendig. ■ Elektroden und Energiemenge Defibrillatoren sind entweder mit festen Paddles oder Klebeelektroden (Pads) ausgestattet. Die großflächigen, jedoch relativ teuren Klebepads haben den Vorteil einer effektiven Energieabgabe durch Herabsetzen des transthorakalen Widerstands. Sie bieten gleichzeitig die Möglichkeit einer schnellen und sicheren EKG-Ableitung und sollten daher bevorzugt eingesetzt werden. Wichtig bei der Platzierung der Elektroden ist, dass diese so weit voneinander entfernt angebracht werden, dass eine möglichst große Energiemenge das Myokard durchfließt (* siehe Abb. 15.4 u. Tab. 15.1, S. 330). Nasse Haut muss vor dem Aufbringen abgetrocknet werden, da sonst ein Kurzschluss entstehen kann. Die Elektroden sollten mit mindestens 10 cm Abstand von einem Herzschrittmacher aufgebracht werden, um dessen Beschädigung zu vermeiden. Die einzustellende Energieladung richtet sich nach dem Gerätetyp. Beim monophasischen Defibrillator wird der erste Schock mit 200 J abgegeben, alle weiteren mit 360 J. Beim biphasischen Gerät wird initial mit 150–200 J defibrilliert. Abhängig vom Hersteller sind jedoch auch höhere Energiemengen möglich (bis 360 J). Bei Kindern erfolgt die Defibrillation generell mit einer Energiemenge von 4 J/kg KG. 15 330 Kardiopulmonale Reanimation (CPR) Abb. 15.4 Elektrodenposition bei der Defibrillation Geeigneter Elektrodentyp Position der 1. Elektrode (Sternum) Position der 2. Elektrode (Apex) Paddles oder Klebepads Rechts parasternal in der mittleren Klavikularlinie (unterhalb der Klavikula) 5. ICR links in der vorderen Axillarlinie (über der Herzspitze) Klebepads (Alternative Position) Links präkordial (anterior) Paravertebral am Rücken auf Herzhöhe (posterior) Tab. 15.1 Elektrodenposition bei der Defibrillation ■ Rhythmusanalyse und Schockabgabe 15 Abb. 15.5 Defibrillierbare Herzrhythmusstörungen Erweiterte Maßnahmen 331 Merke: Nur das Kammerflimmern und die pulslose ventrikuläre Tachykardie lassen sich erfolgreich defibrillieren. Bei der Asystolie liegt keinerlei kardiale elektrische Aktivität vor. Somit kann auch keine Synchronisierung durch eine Defibrillation erfolgen. Die pulslose elektrische Aktivität zeichnet sich durch ungeordnete Potenziale des Herzens aus, welche jedoch nicht von mechanischen Kontraktionen beantwortet werden (elektromechanische Entkopplung). Auch diese Rhythmusstörung lässt sich nicht durch eine Defibrillation behandeln. Tipp: Die meisten Erwachsenen zeigen bei einem plötzlichen Kreislaufstillstand initial ein Kammerflimmern im EKG. Unbehandelt geht dieses im Verlauf in eine Asystolie oder eine pulslose elektrische Aktivität über. Die Überlebenschance der Patienten sinkt dabei pro Minute um 7–10 %. Beim beobachteten Kreislaufstillstand sollte daher so schnell wie möglich defibrilliert werden. • Nach Aufbringen der Elektroden wird bei defibrillierbarem Rhythmus ein einzelner Schock abgegeben („Single-shock-strategy“). • Beim beobachteten Kammerflimmern am EKG-Monitor (z. B. intraoperativ) sind sofort bis zu drei Defibrillationen in Serie möglich. • Herzdruckmassage zur Schockabgabe so kurz wie möglich unterbrechen und sofort danach wieder aufnehmen (Pause < 5 s). • Kurze Rhythmusanalyse und ggf. erneute Schockabgabe alle 2 min, evtl. Energieladung erhöhen. ! Achtung: Während der Defibrillation darf der Patient nicht berührt werden, da der Stromstoß sonst auf andere Personen übertragen werden kann. Vor der Schockabgabe muss daher vom Auslöser (in der Regel der Arzt) ein Warnruf: „Alle weg vom Patienten“ erfolgen. 15.2.3 Medikamente Die erste Wahl für die Applikation von Medikamenten bei einer CPR stellt der periphere Venenzugang dar. Ist die Anlage einer intravenösen Kanüle nicht zeitnah möglich, wird als Alternative der intraossäre Zugang empfohlen. Alle Medikamente sollten über eine laufende Infusion oder einen Bolus von mindestens 20 ml NaCl-Lösung eingeschwemmt werden. Die im Folgenden angegebenen Dosierungen beziehen sich auf den Erwachsenen. ■ Adrenalin Das Standardmedikament bei der CPR ist Adrenalin. Seine positive Wirkung besteht in einer alphaadrenergen, systemischen Vasokonstriktion. Diese führt zu einer Umverteilung des durch die Thoraxkompressionen erzeugten HZV. Die koronare und zerebrale Perfusion werden dadurch verbessert. Merke: Alle 3–5 min wird 1 mg Adrenalin i. v. verabreicht. Bei Kammerflimmern oder pulsloser Kammertachykardie wird die erste Gabe nach der dritten Defibrillation empfohlen. Der Inhalt einer Ampulle (1 mg = 1 ml) wird dabei zusammen mit 9 ml NaCl 0,9 % auf eine 10 ml-Spritze aufgezogen (Verdünnung 1:10.000). 15