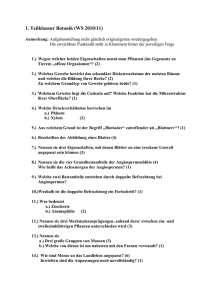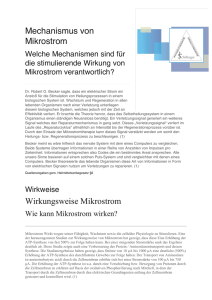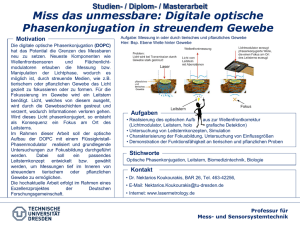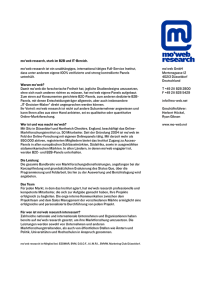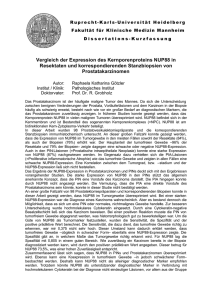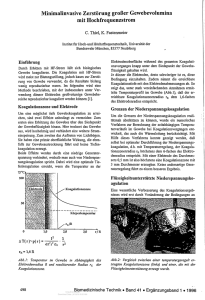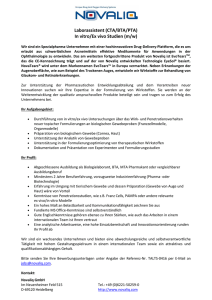Schädelöffnung nach Schlaganfall rettet auch älteren Patienten das
Werbung

seite 9 Tumorentwicklung: Das Woher ist entscheidend n Von Krebs befallene Gewebe enthalten wichtige Informationen, durch die die Entwicklung eines Tumors besser nachvollzogen werden kann. Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit, einen Tumor operativ komplett entfernen und eine anschließende Strahlentherapie vermeiden zu können. Die Erkenntnis ist nicht nur auf den Gebärmutterhalskrebs anwendbar, sondern universell auf die Behandlung aller Krebserkrankungen. Dazu sind neue Erkenntnisse von Forschern der Universitätsmedizin Leipzig im Fachmagazin „The Lancet Oncology“ erschienen. Bösartige Tumoren folgen spezifischen Ausbreitungsmustern. Die Geweberäume, die ein Krebsbefall im Verlauf seiner Ausbreitung (maligne Progression) einnimmt, entsprechen den Stadien der Embryonalund Fetalentwicklung des betroffenen Gewebes. Diese bahnbrechende Erkenntnis stammt von Prof. Michael Höckel, Direktor der Leipziger Universitätsfrauenklinik, der seit 15 Jahren zur Behandlung von Gebärmutterhalskrebs forscht. Zerstörerische Tumoren wachsen, indem sie pathologisch reaktivierte Entwicklungsprozesse in rückwärtiger Abfolge durchlaufen. Dabei nehmen sie fest definierte Geweberäume, sogenannte Kompartimente, ein. Auf der Grundlage dieser Erkenntnis hatte Höckel für den Gebärmutterhalskrebs bereits die totale mesometriale Resektion, eine neue Operationsmethode in Form Foto: Stefan Straube Leipziger universitätsmediziner veröffentlichen erkenntnisse im Fachmagazin „the Lancet Oncology“ Prof. Michael Höckel (schwarzes Hemd) leitet am UKL die Frauenklinik. der Kompartimentresektion, entwickelt. Bei der Operationsmethode wird das tumorbefallene Gewebe präzise entlang seiner embryonalen Entwicklungsstruktur entfernt. Gewebe, das sich aus anderen Vorläuferstrukturen entwickelt hat, kann trotz unmittelbarer Nähe zum Tumor geschont werden. Eine zusätzliche Strahlentherapie ist nicht mehr erforderlich, da mit der Kompartimentresektion die gewebliche Voraussetzung für den lokalen Tumorrückfall beseitigt wird. Nach dieser Operationsmethode an der Universitäts- frauenklinik Leipzig ist der Krebs in 95 Prozent der Fälle nicht wieder aufgetreten. Bei konventionellen Operationsmethoden liegt die Quote bei 85 Prozent. Auch die Nachwirkungen des Eingriffs haben sich verringert: Das Komplikationsrisiko ist von 28 auf 15 Prozent gesunken. Die Wissenschaftler belegen, dass die Kompartimenttheorie nicht nur auf die frühen Krebsformen, sondern auch auf die fortgeschrittenen Krebserkrankungen anwendbar ist. Eine neue aus der Kompartimenttheorie abgeleitete Stadien- einteilung, das „ontogenetische Tumorstaging“, konnte die Prognose der Erkrankung signifikant besser einschätzen als die konventionelle Stadieneinteilung. Onkologische Behandlungsergebnisse können durch Umsetzung der Theorie nachhaltig verbessert werden, meint Höckel: „Die Arbeiten ermöglichten ein neues Verständnis für das Wesen der Krebserkrankung, das die klinischen Manifestationen besser erklären kann, nämlich: Krebs ist eine pathologisch reaktivierte Entwicklung im Rückwärtsgang.“ Krebs tritt als fortschreitender Befall des Organismus mit neugebildetem Gewebe auf. Krebszellen wandern in gesundes Gewebe ein und zerstören es. Bislang wurde der Tumorbefall als ein chaotischer Prozess angesehen, bei dem sich die Tumorzellen ungerichtet und ohne Beeinflussung durch Gewebegrenzen immer weiter ausbreiten. Entsprechend dieser Vorstellung besteht das Prinzip einer konventionellen Operation in der Entfernung des Tumors mit einem allseitigen Rand tumorfreien Gewebes, die sogenannte weite Exzision. Trotz sorgfältiger Durchführung kommt es aber nicht selten im ehemaligen Operationsgebiet zum Tumorrückfall. Mit einer zusätzlichen Bestrahlung wird bei dieser Methode versucht, das Rückfallrisiko zu verringern. Das Herausschneiden gesunden Gewebes und die zusätzliche Bestrahlung können jedoch erbliche Schäden verursachen. Deshalb haben Höckel und sein Team die Kompartimentresektion entwickelt, die sich in der klinischen Praxis bewährt. Diana Smikalla Schädelöffnung nach Schlaganfall rettet auch älteren Patienten das Leben n Ein operativer Eingriff innerhalb von 48 Stunden nach einem Schlaganfall verbessert die Überlebenschancen bei Patienten über 60 Jahren. Eine Gemeinschaftsstudie unter Beteiligung von Leipziger Wissenschaftlern belegt, dass die Entfernung eines Teils der Schädeldecke Betroffenen das Leben rettet, sie jedoch nicht vor schwerer Behinderung bewahrt. Die Studie wurde im hochrangigen„New England Journal of Medicine“ veröffentlicht. Patienten, die älter als 60 Jahre alt sind und einen sehr schweren Schlaganfall erlitten haben, profitieren davon, die Schädeldecke über dem betroffenen Gewebe vorübergehend zu entfernen, um den Druck vom Hirn zu nehmen (im Fachausdruck Hemikraniektomie). Dadurch werden ihre Überlebenschancen fast um die Hälfte erhöht. Allerdings behalten die Betroffenen starke Behinderungen zurück und sind in der Regel pflegebedürftig. Diese Erkenntnisse sind das Ergebnis einer Studie von 13 deutschen Schlaganfallzentren, darunter die Neurologie und Neurochirurgie der Leipziger Universitätsmedizin. Vor einigen Jahren hatte eine Studie bereits hervorgebracht, dass Schlaganfallpatienten unter 60 deutlich häufiger überleben, wenn ein solcher Eingriff vorgenommen wird. Ist die Schwellung zurückgegangen, wird der Schädelknochen nach drei bis sechs Monaten wieder eingesetzt. Bei jüngeren Patienten steigt die Überlebenschance durch diese Methode um das Dreifache und Behinderungen, die zu einer dauerhaften Bettlägerigkeit führen, bleiben seltener zurück. Deshalb ist die Operation bei ihnen seit Jahren ein Standardverfahren in Schlaganfallzentren. In der aktuellen Studie wurden nun erstmals die Vor- und Nachteile einer Hemikraniektomie für ältere Patienten untersucht. „Bislang lag die Überlebenschance für ältere Patienten bei konservativer intensivmedizinischer Betreuung bei etwa 30 Prozent. 70 Prozent der Patienten verstarben innerhalb weniger Tage. Durch die Operation wird die Sterblichkeitsrate auf 33 Prozent verringert“, so Prof. Dr. Jürgen Meixensberger, Direktor der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Leipzig. Allerdings bleibt nach der Operation ein Drittel der Patienten pflegebedürftig. „Die Patienten können nun auf Grundlage gesicherter Erkenntnisse über die Risiken dieser Operation und dem zu erwartenden Behinderungsgrad wesentlich besser aufgeklärt werden“, ergänzt Dr. Carsten Hobohm, Neu- Foto: Stefan Straube Wissenschaftler der universitätsmedizin Leipzig an studie von 13 deutschen schlaganfallzentren beteiligt Auf der „Stroke Unit“ des Uniklinikums Leipzig werden Patienten nach einem Schlaganfall behandelt. rointensivmediziner in derselben Einrichtung. „Im Arztgespräch gilt es, gut abzuwägen, denn für Betroffene und Angehörige ist es eine schwere Entscheidung.“ In die Multicenterstudie unter Federführung der Universitätsklinik Heidelberg wurden insgesamt 112 Schlaganfallpatienten zwischen 61 und 82 Jahren einbezogen. DS | Liebigstrasse aktueLL