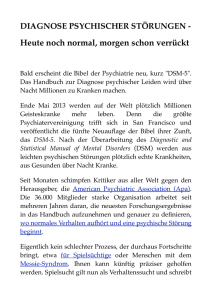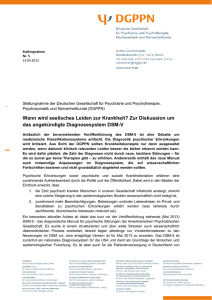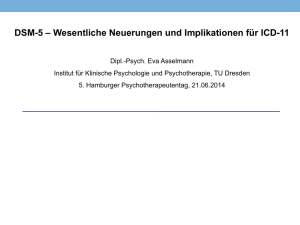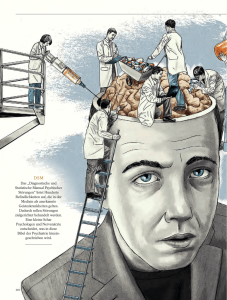DSM-5: Bedeutung für die Begutachtung
Werbung
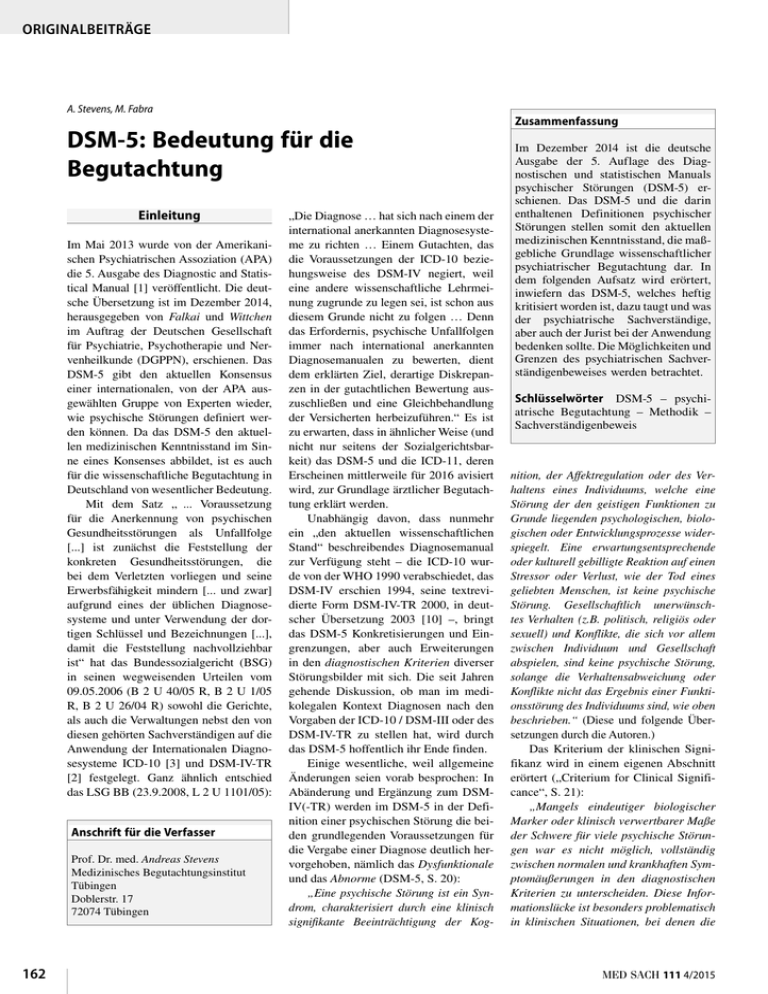
Originalbeiträge A. Stevens, M. Fabra DSM-5: Bedeutung für die ­Begutachtung Einleitung Im Mai 2013 wurde von der Amerikanischen Psychiatrischen Assoziation (APA) die 5. Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual [1] veröffentlicht. Die deutsche Übersetzung ist im Dezember 2014, herausgegeben von Falkai und Wittchen im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN), erschienen. Das DSM-5 gibt den aktuellen Konsensus einer internationalen, von der APA ausgewählten Gruppe von Experten wieder, wie psychische Störungen definiert werden können. Da das DSM-5 den aktuellen medizinischen Kenntnisstand im Sinne eines Konsenses abbildet, ist es auch für die wissenschaftliche Begutachtung in Deutschland von wesentlicher Bedeutung. Mit dem Satz „ ... Voraussetzung für die Anerkennung von psychischen Gesundheitsstörungen als U ­nfallfolge [...] ist zunächst die Feststellung der konkreten Gesundheitsstörungen, die bei dem Verletzten vorliegen und seine Erwerbsfähigkeit mindern [... und zwar] aufgrund eines der üblichen Diagnosesysteme und unter Verwendung der dortigen Schlüssel und Bezeichnungen [...], damit die Feststellung nachvollziehbar ist“ hat das Bundessozialgericht (BSG) in seinen wegweisenden Urteilen vom 09.05.2006 (B 2 U 40/05 R, B 2 U 1/05 R, B 2 U 26/04 R) sowohl die Gerichte, als auch die Verwaltungen nebst den von diesen gehörten Sachverständigen auf die Anwendung der Internationalen Diagnosesysteme ICD-10 [3] und DSM-IV-TR [2] festgelegt. Ganz ähnlich entschied das LSG BB (23.9.2008, L 2 U 1101/05): Anschrift für die Verfasser Prof. Dr. med. Andreas Stevens Medizinisches Begutachtungsinstitut Tübingen Doblerstr. 17 72074 Tübingen „Die Diagnose … hat sich nach einem der international anerkannten Diagnosesysteme zu richten … Einem Gutachten, das die Voraussetzungen der ICD-10 beziehungsweise des DSM-IV negiert, weil eine andere wissenschaftliche Lehrmeinung zugrunde zu legen sei, ist schon aus diesem Grunde nicht zu folgen … Denn das Erfordernis, psychische U ­ nfallfolgen immer nach international anerkannten Diagnosemanualen zu bewerten, dient dem erklärten Ziel, derartige Diskrepanzen in der gutachtlichen Bewertung auszuschließen und eine Gleichbehandlung der Versicherten herbeizuführen.“ Es ist zu erwarten, dass in ähnlicher Weise (und nicht nur seitens der Sozialgerichtsbarkeit) das DSM-5 und die ICD-11, deren Erscheinen mittlerweile für 2016 avisiert wird, zur Grundlage ärztlicher Begutachtung erklärt werden. Unabhängig davon, dass nunmehr ein „den aktuellen wissenschaftlichen Stand“ beschreibendes Diagnosemanual zur Verfügung steht – die ICD-10 wurde von der WHO 1990 verabschiedet, das DSM-IV erschien 1994, seine textrevidierte Form DSM-IV-TR 2000, in deutscher Übersetzung 2003 [10] –, bringt das DSM-5 Konkretisierungen und Eingrenzungen, aber auch Erweiterungen in den diagnostischen Kriterien diverser Störungsbilder mit sich. Die seit Jahren gehende Diskussion, ob man im medikolegalen Kontext Diagnosen nach den Vorgaben der ICD-10 / DSM-III oder des DSM-IV-TR zu stellen hat, wird durch das DSM-5 hoffentlich ihr Ende finden. Einige wesentliche, weil allgemeine Änderungen seien vorab besprochen: In Abänderung und Ergänzung zum DSMIV(-TR) werden im DSM-5 in der Definition einer psychischen Störung die beiden grundlegenden Voraussetzungen für die Vergabe einer Diagnose deutlich hervorgehoben, nämlich das Dysfunktionale und das Abnorme (DSM-5, S. 20): „Eine psychische Störung ist ein Syndrom, charakterisiert durch eine klinisch signifikante Beeinträchtigung der Kog- 162 Zusammenfassung Im Dezember 2014 ist die deutsche Ausgabe der 5. Auflage des Diagnostischen und statistischen Manuals psychischer Störungen (DSM-5) erschienen. Das DSM-5 und die darin enthaltenen Definitionen psychischer Störungen stellen somit den aktuellen medizinischen Kenntnisstand, die maßgebliche Grundlage wissenschaftlicher psychiatrischer Begutachtung dar. In dem folgenden Aufsatz wird erörtert, inwiefern das DSM-5, welches heftig kritisiert worden ist, dazu taugt und was der psychiatrische Sachverständige, aber auch der Jurist bei der Anwendung bedenken sollte. Die Möglichkeiten und Grenzen des psychiatrischen Sachverständigenbeweises werden betrachtet. Schlüsselwörter DSM-5 – psychiatrische Begutachtung – Methodik – Sachverständigenbeweis nition, der Affektregulation oder des Verhaltens eines Individuums, welche eine Störung der den geistigen Funktionen zu Grunde liegenden psychologischen, biologischen oder Entwicklungsprozesse widerspiegelt. Eine erwartungsentsprechende oder kulturell gebilligte Reaktion auf einen Stressor oder Verlust, wie der Tod eines geliebten Menschen, ist keine psychische Störung. Gesellschaftlich unerwünschtes Verhalten (z.B. politisch, religiös oder sexuell) und Konflikte, die sich vor allem zwischen Individuum und Gesellschaft abspielen, sind keine psychische Störung, solange die Verhaltensabweichung oder Konflikte nicht das Ergebnis einer Funktionsstörung des Individuums sind, wie oben beschrieben.“ (Diese und folgende Übersetzungen durch die Autoren.) Das Kriterium der klinischen Signifikanz wird in einem eigenen Abschnitt erörtert („Criterium for Clinical Significance“, S. 21): „Mangels eindeutiger biologischer Marker oder klinisch verwertbarer Maße der Schwere für viele psychische Störungen war es nicht möglich, vollständig zwischen normalen und krankhaften Symptomäußerungen in den diagnostischen Kriterien zu unterscheiden. Diese Informationslücke ist besonders problematisch in klinischen Situationen, bei denen die MED SACH 111 4/2015 Originalbeiträge Symptompräsentation selbst (besonders bei den milden Formen) nicht von vornherein krankhaft ist sondern auch bei Individuen angetroffen werden kann, für die die Diagnose einer psychischen Störung unangemessen wäre. Aus diesem Grund wurde ein allgemeines diagnostisches Kriterium verwendet, welches Leiden und Beeinträchtigung fordert...“. Wozu Diagnosen? Die Entscheidung des BSG, medizinische Sachverständige auf die internationalen Diagnosesysteme festzulegen, hat Konsequenzen von erheblicher Tragweite: Um diese ermessen zu können, hat man sich zunächst den Sinn von medizinischen Diagnosen im Allgemeinen und psychiatrischen Diagnosen im Besonderen zu vergegenwärtigen: Es handelt sich dabei nämlich um Definitionen, die es Fachleuten und ebenso Laien ermöglichen sollen, sich gewissermaßen „mit einem Wort“ über 1. die Symptomenkonstellation, 2. das Ausmaß in etwa zu erwartenden Leidens und Funktionsminderung, 3. die Therapiemöglichkeiten und 4. die Prognose eines Störungsbildes zu verständigen. Das DSM-5 stellt insoweit den aktuellen Versuch dar, eine Klassifikation psychiatrischer Störungsbilder vorzunehmen und Diagnosen zu operationalisieren, wobei das erzielte Ergebnis gegenüber den Vorversionen nach Auffassung der Autoren nur zum Teil einfacher und einleuchtender geworden ist. Dem wissenschaftlich arbeitenden Sachverständigen bleibt jedoch – nicht zuletzt aufgrund der Vorgaben des BSG (s.o.), die nach Auffassung der Autoren dem Grunde nach auch in den anderen Rechtsgebieten Geltung haben müssen – keine andere Wahl, als sich mit diesen, den aktuellsten Kriterien, auseinanderzusetzen. Anwendung des DSM-5 im medikolegalen Kontext Aufgabe eines medizinischen Sachverständigen vor oder im Gerichtsprozess ist es, seine Auftraggeber (Gerichte, Sozialversicherungen, Versorgungsämter, Privat- und Sachversicherungen u.a.m.) durch ärztliche Beweiserhebung darüber zu beraten, ob vom Antragsteller – der in der Regel dann auch gutachtlich untersucht wurde – geltend gemachte Umstände zutreffen oder nicht. In der Auffassung der Antragsteller impliziert die Behauptung, an einer bestimmten Gesundheitsstörung zu leiden, häufig, dass damit auch gewisse Beeinträchtigungen nachgewiesen sind. Aus Sicht des Sachverständigen impliziert die Diagnose aber nur einen gewissen Kontext der Ätiologie, der Therapie und der Prognose. Das Leistungsvermögen folgt nicht aus der Diagnose und muss gesondert erfasst werden. Mitunter ist ja auch nur über das Leistungsvermögen Beweis zu erheben, z.B. wenn Aussagen zu bestimmten Fähigkeiten (beispielsweise über die Flugtauglichkeit oder die Fähigkeit, ein Kraftfahrzeug zu führen) gefragt sind. Mitunter gelten Aussagen künftigem Verhalten, wie bei der kriminalprognostischen Begutachtung. Für die Begutachtung ist ferner maßgeblich, dass das Stellen einer Diagnose die Anwendung einer Namenskonvention ist, nicht mehr und nicht weniger. Eine Diagnose beinhaltet weder unmittelbar eine Aussage zur Kausalität (eine gesicherte Diagnose ist aber Voraussetzung für die Darlegung des medizinischen Kenntnisstandes über die Ätiologie der Störung) noch eine Aussage über die mit der Diagnose verbundene Invalidität, Funktionsminderung, Verantwortlichkeit etc.. Wie im DSM-IV-TR [2] darf auch im DSM-5 eine Diagnose nur dann vergeben werden, wenn dargelegt ist, dass die damit bezeichnete Störung im konkreten Fall, nicht etwa im Allgemeinen, zu einer wesentlichen Funktionsbeeinträchtigung führt. Eine nachgewiesene Funktionsbeeinträchtigung ist also Voraussetzung, nicht Konsequenz der Diagnose. Dieser Umstand wird deswegen hervorgehoben, als gerne folgende zirkelschlüssige Unlogik angewendet wird: Bei einer Person wird ohne Beachtung des Kriteriums der Funktionsbeeinträchtigung eine Diagnose gestellt, sodann aus der Diagnose geschlussfolgert, dass auch eine bestimmte Funktionsminderung vorliegen müsste, und schließlich erklärt, dass also auch das für die Diagnose geforderte Kriterium der wesentlichen Funktionsminderung erfüllt sei. So wird das zu Beweisende in die Prämissen eingesetzt. In diesem Punkt gehen die allein an die Diagnose gebundenen MdE-Vorschläge Foersters et al. [7] nicht konform mit den Vorgaben des DSM. Einer bereits mit der Diagnose begründeten pauschalen Festsetzung herabgesenkten psychosozialen Funktionsniveaus wird im DSMIV-TR wie auch im DSM-5 ausdrücklich widersprochen. Es findet sich ein eigener Abschnitt („Cautionary Statement for Forensic Use of DSM-5“), in dem der Sachverhalt, weshalb aus einer Diagnose keine Beeinträchtigung etc. abzuleiten ist, ausführlich erläutert wird. Der Sachverständige fungiert in diesen Tätigkeiten ausschließlich als Berater, der medizinische Sachkenntnis neutral und wissenschaftlich begründet zu vermitteln hat. Hier ergibt sich eine grundsätzliche Verschiedenheit zwischen Sachverständigen- und Behandlerrolle: Der Sachverständige entscheidet nämlich nicht selbst über den streitigen Sachverhalt, sondern er klärt den Auftraggeber allein darüber auf, welche Schlussfolgerungen sich aus den zur Verfügung stehenden Informationen (Anknüpfungstatsachen, Akteninhalten, Angaben des untersuchten Menschen, Tatsachenfeststellungen des Sachverständigen, wissenschaftlichem Kenntnisstand) ziehen lassen. Im Gegensatz zum Behandler, der mit dem (schriftlich dokumentierten) Einverständnis seines Patienten für einen definierten Zeitraum „Herr des Verfahrens“ wird, verbleibt die Verfahrenshoheit für den Sachverständigen stets beim Auftraggeber, dies mit allen sich daraus ergebenen rechtlichen Konsequenzen. Die Sachverständigentätigkeit ist somit eine epistemische. Dem Sachverständigen obliegt es, die am Ende der gutachtlichen Erhebungen zur Verfügung stehenden Informationen zu ordnen und die in den Beweisfragen vorgelegten Behauptungen jeweils einer der Kategorien zuzuweisen: (1)Vom Sachverständigen nicht durch Tatsachenfeststellung überprüfbare Behauptung, diese kann a) glaubhaft sein, d.h. sie ist mit den übrigen Informationen vereinbar und es ergeben sich keine negativen Antwortverzerrungen, b) nicht glaubhaft sein, d.h. sie ist mit den übrigen Informationen nicht vereinbar oder es ergeben sich negative Antwortverzerrungen. MED SACH 111 4/2015 163 Originalbeiträge (2) vom Sachverständigen durch Tat­ sachenfeststellung überprüfbare Be­hauptung; diese kann a) durch Beweis (als zutreffend) zur nachgewiesenen Tatsache werden, b) als nicht zutreffend, nicht festgestellt oder sogar widerlegt zurückgewiesen werden. Als „glaubhafte aber unbewiesene Sachverhalte“ (Typ 1a) werden Angaben gewertet, die in ein allgemeines, vom Sachverständigen wissenschaftlich begründet vertretenes System von Überzeugungen widerspruchsfrei eingeordnet werden können. Voraussetzung ist, dass sich keine Anhaltspunkte für negative Antwortverzerrung bei der Untersuchung ergeben, dies schließt die ärztliche und die psychologische Beschwerdenvalidierung ein. Diese Zuordnung führt weder zu der Annahme, dass Behauptungen vom Typ 1a „wahr“ und damit bewiesenen Tatsachen (Typ 2a) gleichwertig sind, noch zu der, dass Behauptungen vom Typ 1b widerlegt, also bewiesenermaßen „falsch“ sind: Ein Übergang zwischen den epistemischen Kategorien 1 und 2 ist nicht möglich. Die „nachweisbaren Tatsachen“ (Typ 2) sind diejenigen Sachverhalte, die der Sachverständige im Grunde selbst feststellen kann (wenn sie denn vorliegen). Er kann ihr Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein bezeugen. Genügen für den Sachverständigenbeweis Behauptungen des Typs 1a? Wir meinen: Nein. Denn z.B. in der gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) ist die Gesundheitsstörung im Vollbeweis zu sichern, auch in der Haftpflichtversicherung, mit Ausnahme des Folgeschadens. Der Vollbeweis verlangt ein derart hohes Maß an Sicherheit, dass „ … bei vernünftiger Abwägung den Zweifeln Schweigen geboten wird“ (BGH NJW 70, 946). Zwar ist es nicht Aufgabe des Sachverständigen, darüber zu urteilen, unter welchen Gegebenheiten der Vollbeweis erfüllt ist und unter welchen nicht, dies zu entscheiden obliegt allein dem Auftraggeber, im Letzten ist es eine richterliche Entscheidung. Gleichwohl wird man davon ausgehen können, dass eine ausschließliche Behauptung einer der Parteien (Kategorie (1), s.o.) dem Anspruch des Voll- oder Strengbeweises in den meisten Fällen nicht genügen dürfte. Hier tritt wieder der Unterschied zwischen dem Sachverständigen und dem Entscheidungsträger hervor: Letzterer mag die Behauptung Typ 1a zur Grundlage seiner Entscheidung machen (er ist frei in der Beweiswürdigung), wenn Typ 2 nicht zur Verfügung steht – der Sachverständige darf aber nicht aus dem Typ 1 (unbewiesen) gewissermaßen „heimlich“ den Typ 2a (bewiesen) machen und Beweise erfinden, wo keine sind (etwa über Alpträume, Panikattacken oder Bewegungsstörungen, die er selbst an dem zu begutachtenden Menschen nicht wahrgenommen hat). Es ergibt sich nun das Problem, dass für die meisten Diagnosen im DSM-5 nur einige der oft zahlreichen Symptome im Sinn des Typs 2 nachgewiesen werden können, die anderen aber sich auf subjektive Erlebensweisen oder episodische Zustände beziehen, die der Sachverständige nur nach Typen 1a und 1b ordnen kann. Da in der Psychiatrie dieselben Beweisanforderungen gelten wie in anderen Fächern, kann der Sachverständige den Beweis einer Diagnose nur auf Beobachtungen oder Feststellungen gründen, die er selbst getroffen hat. Weiter unten wird ausführlich besprochen, wie der Sachverständige vorgehen kann, wenn die beweisbaren Symptome nicht hinreichen, um die Diagnose zu stellen. Die Tauglichkeit des DSM-5 und der darin beschriebenen Symptome, das Vorliegen einer psychischen Störung zu beweisen, ist beschränkt durch die große Anzahl von Symptomen, deren Vorliegen der Sachverständige weder nachweisen noch widerlegen kann. Sind behauptete Symptome, die dem Typ 2 entsprechen, also grundsätzlich nachweisbar sind, trotz geeigneter Untersuchungsbedingungen nicht beobachtbar resp. feststellbar, so sind sie nicht bewiesen, der Sachverständige kann die entsprechende Behauptung also nicht bestätigen. Eine zusätzliche Kategorie „evtl. vorhanden, aber gerade jetzt nicht beobachtbar“ ist entbehrlich, denn dies entspricht Aussagen vom Typ 2b, ebenso Spekulationen darüber, ob die fehlenden Symptome vielleicht unter anderen Bedingungen, bei einer Begutachtung durch eine andere Person, zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, unter anderer Medikation, nach einem anderen Verlauf des Vortages, etc. aufgetreten wären. Gewiss treten psychische Symptome nicht mit deterministischer Zuverlässigkeit stets 164 auf, sodass aus dem beobachteten Ausbleiben in der Begutachtung (etwa, wenn es beim Besprechen des traumatisierenden Ereignisses im gutachtlichen Interview bei behaupteter PTBS nicht zu belastenden Erinnerungsbildern (Subkriterium B1 nach DSM-5), dissoziativer Reaktion (B3), intensiver … Belastung (B4) oder deutlicher sympathikotoner Reaktion (B5) kommt) nicht auf allzeitige Abwesenheit geschlossen werden darf. Andererseits fordert das DSM-5, s. z.B. die Definition der Angststörungen, dass die Symptome mit hoher Zuverlässigkeit und nicht nur unter besonderen Umständen auftreten. Lassen sich also im Grunde beobachtbare Phänomene in der Begutachtung, unter Anwendung suffizienter Methodik und hinlänglicher Dauer der Untersuchung nicht erkennen, so sind sie zum einen nicht als Tatsache festgestellt (Typ 2b) und zum anderen bzgl. des Leidens und der Absenkung des psychosozialen Funktionsniveaus schwerlich relevant. Fehler sind sowohl hinsichtlich der Zuordnung der Behauptung zu den Kategorien 1 = nicht beweisbar und 2 = beweisbar als auch hinsichtlich der Untersuchungstechnik möglich und erfahrungsgemäß häufig. Ein Sachverständiger, der bei einer geltend gemachten PTBS den zu Begutachtenden nicht mit Details des Traumas konfrontiert sondern mitteilt, der Hergang sei ja schon bekannt (als gelte es, den Geschehenshergang zu ermitteln), wird wesentliche Symptome einer PTBS nicht beobachten können. Aufgrund unzulänglicher Methodik würden die Behauptungen des Antragstellers der Kategorie 1 zugewiesen werden, jedoch fehlerhaft, denn es handelt sich um Sachverhalte, die grundsätzlich einer Überprüfung zugänglich sind (Typ 2). Bei der Diagnose z.B. einer Major Depression soll die „nahezu täglich herabgesenkte Stimmung“ und der „bedeutsame Verlust an Interessen und Lebensfreude“ entweder durch Dritte beobachtet, oder aber von dem betroffenen Menschen selbst behauptet worden sein. Der Sachverständige muss sie selbstredend selbst beobachten, schon weil dies grundsätzlich auch möglich ist (Typ 2), die bloße Behauptung eines grundsätzlich beobachtbaren Phänomens reicht bei der Begutachtung eben nicht zum Sachverständigenbeweis. Das DSM-5 eröffnet MED SACH 111 4/2015 Originalbeiträge zwar die Möglichkeit, die Diagnose einer Major Depression auch dann zu vergeben, wenn der Untersucher die entsprechenden Symptome nicht beobachtet, um eine Behandlung einzuleiten. Im Einvernehmen mit dem Patienten (dem der Therapeut sagen mag: „Im Moment kann ich bei Ihnen nichts Krankhaftes feststellen, aber nach dem, was Sie mir sagen, kann es sein, dass Sie an einer Depression leiden“), mag dies genügen. In der Begutachtung ist aber, wie schon oben angemerkt, der „Vertragspartner“ nicht der Antragsteller, sondern der Auftraggeber. Begnügt sich dieser im Sinn geringerer Beweisanforderungen mit Informationen vom Typ 1a (glaubhafte, untereinander konsistente und nicht widerlegte Behauptungen), so kann der Sachverständige entsprechend verfahren. Gilt die Anfrage an den Sachverständigen dagegen (erwiesenen) Tatsachen und handelt es sich um Symptome, die im Grunde der Beobachtung zugänglich sind, genügt Typ 1a (glaubhafte Behauptung) nicht. Dasselbe gilt hinsichtlich der bei Gutachten relevanten negativen Antwortverzerrung. Auch deren Vorliegen ist grundsätzlich beweisbar oder mit hoher Treffsicherheit auszuschließen (z.B. liegt die positive und negative prädiktive Power der psychologischen Validierungsverfahren bei 0.9), sofern und nur sofern geeignete Verfahren ärztlicher und psychologischer Beschwerdenvalidierung eingesetzt werden. Tatsachen des Typs 2 werden im gutachtlichen Interview und der körperlichen, ggfs. apparativen und psychologischen Untersuchung auf der Befundebene erhoben. Sie werden vom Sachverständigen im Kontakt mit dem zu begutachtenden Menschen wahrgenommen. Was die Erhebung von Befundtatsachen (Typ 2) in der Psychiatrie angeht, so gelten für deren objektive Feststellung dieselben Einschränkungen wie in anderen Fächern, man denke an die Interpretation von Röntgenbildern, an die Bestimmung des Bewegungsumfangs nach der Neutral-Null-Methode, an die Wahrnehmung und Bewertung eines Herzgeräusches, an Mess- und Urteilsfehler überhaupt. Überall dort, wo Menschen beobachten und messen, dokumentieren, treten Fehler auf – und zwar sowohl mit zufälliger Varianz als auch infolge syste- matischer Verzerrungen, sog. Biases. In manchen Ländern wird derartigen Einflüssen dadurch begegnet, dass bei der Untersuchung ein zweiter Arzt anwesend ist, der von der Gegenseite benannt wurde (in Frankreich: „Expertise a deux experts, expertise amiable et contradictoire“). Kritik zum DSM-5 im medikolegalen Kontext Wie ist nach diesen methodischen Vorbemerkungen die Eignung des DSM-5 für die Begutachtung zu bewerten? Das DSM-5 fasst den aktuellen Kenntnisund Meinungsstand der psychiatrischen Fachgesellschaften zusammen. Der Benutzer hat insoweit stets im Auge zu behalten, dass es im Konsens einer vorwiegend aus Psychotherapeuten und therapeutisch arbeitenden Psychiatern bestehenden Interessengemeinschaft entstanden ist, was dazu führte, dass von Seiten der nicht-therapeutisch arbeitenden Wissenschaftler einschließlich forensischer Psychiater in erheblichem Umfang Kritik dran geübt wurde. Der erste und aus der Sicht der Autoren für den in Deutschland tätigen Sachverständigen führende Kritikpunkt ergibt sich daraus, dass die diagnostischen Kriterien des DSM-5 aufgrund eines Konsensus unter ausgewählten Fachleuten über Symptom-Cluster formuliert wurden, ohne dass in ausreichendem Umfang wissenschaftliche Daten zugrunde lagen [8]. Dies erlaube, durch Auswahl und Nutzen persönlicher Beziehungen und „Antibeziehungen“ der Mitglieder der einzelnen Work-Groups und zum Editorial Board im Wege von Konsensusentscheidungen die Anzahl von Diagnosen und dazugehöriger Kriterien beliebig zu vergrößern. Der daraus abgeleitete Vorwurf lautet, dass die psychiatrischen Behandler durch die Vermehrung von Symptomen und Diagnosen nicht nur eigene Interessen bedienten, sondern Hand in Hand mit der Pharmaindustrie arbeiteten, um möglichst viele Menschen, die nicht psychisch krank sind, sondern lediglich durch alltagsübliche Probleme belastet und maximal der Beratung bedürfen, zu psychisch Kranken zu erklären und auf diese Weise einer Behandlung zuzuführen. Die Skepsis wird gemehrt, da etliche der Mitglieder der Arbeitsgruppe, nämlich 69 %, aktuelle finanzielle Beziehungen zur Pharmaindustrie angegeben haben, künftige oder vergangene Beziehungen jedoch nicht erfasst wurden. Die meisten psychiatrischen Diagnosen, so Frances [8], würden sogar von nicht psychiatrisch ausgebildeten Hausärzten gestellt; von dieser Arztgruppe werden auch die meisten Psychopharmaka verordnet, sodass auf diesem Wege der Verkauf der Psychopharmaka die Fachärzte für Psychiatrie umgeht. Dazu muss man wissen, dass in den USA Pharmaka direkt bei den Konsumenten beworben werden dürfen. Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die im DSM-5 verankerten diagnostischen Schwellen, sowohl was die Anzahl der erforderlichen Symptome wie auch die Mindestdauer der Symptomatik betrifft. Die Anzahl der für die Diagnose geforderten Kriterien und auch die Zeitkriterien fungieren als „Cut-off-Werte“, wobei Daten, die die Cut-offs rechtfertigen würden, nicht vorliegen. Wiederum Frances hat darauf hingewiesen, dass nach den epidemiologischen Studien über 30 % der Bevölkerung innerhalb eines Jahres die Kriterien für eine psychiatrische Diagnose erfüllen, wohingegen überall sonst in der epidemiologischen Statistik der Normbereich so definiert sei, dass nur die äußersten 2,5 % am linken oder rechten Ende der Verteilung als krankheitswert (abnorm) definiert würden. In diesem Zusammenhang seien die epidemiologischen Studien genannt [11, 12], die nach Metaanalyse von Studiendaten aus diversen europäischen Ländern eine Jahresprävalenz psychischer Erkrankungen von 27,4 % (2005) und 38,2 % (2011) schätzten. Die weit höhere Zahl (nach ICD-10) als psychisch krank klassifizierter Menschen 2011 im Vergleich zu 2005 komme nicht durch einen echten Anstieg der Häufigkeit der Störungsbilder, sondern durch Überdiagnose (Missachtung der diagnostischen Kriterien) und ungeeignete Methodik (Fragebögen statt psychiatrische Befunderhebung) zustande. Young et al. [13] haben darauf hingewiesen, dass die Symptom-Cluster sich von Ausgabe zu Ausgabe des DSM vermehrt haben, sodass immer mehr Möglichkeiten existieren, durch eine Kombination von Symptomen zu einer psychiatrischen Diagnose zu gelangen. Damit habe man immer mehr Möglichkei- MED SACH 111 4/2015 165 Originalbeiträge ten geschaffen, Menschen als psychisch krank zu klassifizieren. So eröffne das DSM-5 636120 verschiedene Möglichkeiten, Symptome für eine PTBS zu kombinieren, 425 für eine depressive Störung, 945 für kognitive Störungen nach einem Schädelhirntrauma, 2036 für eine Alkoholabhängigkeit und 382 für eine Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ. Angesichts einer solchen Vielfalt von ­diagnostischen Subtypen seien die Diagnosen „völlig amorph“. Nicht ohne Zynismus bemerken Young et al. dass, berücksichtige man auch noch Komorbiditäten, beispielsweise der PTBS mit der depressiven Störung, Angst und Substanzmissbrauch durch die möglichen Symptomkombinationen über eine Quintillion unterschiedlicher Störungsbilder allein als „Traumafolgestörungen“ nahe der PTBS entstehen, dies sei „beruhigender Weise etwas weniger als die geschätzte Anzahl der Sterne im Universum“ (S. 70). Seitens der forensisch tätigen Psychiater ist das DSM-5 dahingehend kritisiert worden, dass auch die aktuellen diagnostischen Kriterien kaum für eine forensische Beurteilung taugten (s. oben). Man hätte sich gewünscht, dass die Autoren des DSM-5 darauf geachtet hätten, inwiefern eine Diagnose beziehungsweise die dafür erforderlichen Kriterien durch den Sachverständigen empirisch begründet erhoben werden könnten. Der der Weisung des Bundessozialgerichtes (BSG 2006, a.a.O. siehe oben) folgende Sachverständige in Deutschland hat sich in Anwendung der internationalen Diagnosesysteme, hier im Speziellen des DSM-5, das Folgende zu vergegenwärtigen und ggfs. seinem Auftraggeber darzulegen: In Deutschland existiert kein Standard, der die Qualität dessen bestimmt, was als „sachverständige Aussage“ zu akzeptieren ist. Etabliert sind jedoch beispielsweise in den USA die Daubert Standards (US Supreme Court 509 US 579, 1993). Demnach zählt als sachverständige Aussage („expert testimony“) nur, was den folgenden Kriterien genügt: A) Die der Aussage zugrunde liegende Methode ist empirisch überprüfbar, das heißt, die in ihrer Anwendung getätigte Aussage ist falsifizierbar. Dies bedeutet, dass Aussagen zu solchen Behauptungen, die der Sachverständi- ge nicht überprüfen kann, weil sie nicht zu falsifizieren sind (da keine empirische Methode zur Verfügung steht) nicht als „sachverständige Aussage“ gewertet werden könnten (s. oben, Behauptungen vom Typ1). Behauptungen z.B., dass der Untersuchte an Alpträumen gelitten habe (s.o.), oder dass dieser bestimmte Handlungen „unbewusst“ – nämlich dissoziativ – unternommen habe, sind einer empirischen Überprüfung nicht zugänglich. Der Sachverständige müsste dazu also streng genommen schweigen und kann ein im Diagnosemanual gelistetes Symptom, welches im Rahmen der sich ihm eröffnenden Möglichkeiten nicht falsifizierbar ist, seinem Auftraggeber nicht als wissenschaftlich nachgewiesen im Sinn des Typs 2 (s. oben) darstellen. B) Die Methode ist in einer Fachzeitschrift veröffentlicht und einem Peerreview-Verfahren unterzogen worden. Dies bedeutet, dass sich Experten mit der Methode befasst haben und Meinungen anderer Experten über das Verfahren vorliegen. Daraus geht nicht hervor, dass die Methode bestimmte Leistungen erbringt, allerdings erlaubt eine solche Veröffentlichung, zu sehen, was die Meinung von Experten über das Verfahren ist, diese Meinung mag positiv oder negativ sein. Ein der Expertenwelt bislang nicht zugänglich gemachtes Verfahren, über das also keine anderen Beurteilungen vorliegen, soll demnach nicht zu einer sachverständigen Aussage befähigen. Hier findet sich also eine Maßgabe, die auf das DSM-5 in hohem Maße zutrifft, denn das DSM-5 wurde unter internationalen Experten diskutiert, und zahlreiche davon haben sich sehr kritisch über das DSM-5 geäußert. C) Die Gütekriterien – also Sensitivität, Spezifität, Reliabilität und Validität des Verfahrens – sollen bekannt sein. Nur so ist etwa eine Aussage dazu möglich, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Testergebnis das Vorliegen einer bestimmten Gesundheitsstörung vorhersagt. Kriterien mit unzureichender Sensitivität werden in vielen Fällen die gesuchte Störung nicht anzeigen, obwohl sie vorliegt, umgekehrt zeigen solche mit geringer Spezifität das Vorliegen einer Störung an, obwohl sie gar nicht besteht. Gütekriterien für die meisten DSM-5-Diagnosen sind nicht bekannt. Schon aufgrund der Vielzahl der ein und demsel- 166 ben Störungsbild zugeordneten Kriterien ist zu erwarten, dass die Gütekriterien zu schlecht sind, um wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen (s. unten!). D) Der Sachverständige hat die Methode richtig angewendet. Im Grunde könnten sich die Parteien unter Berufung auf den Grundsatz der Parteiöffentlichkeit durch Anwesenheit während der Untersuchung davon überzeugen, dass der Sachverständige die Methoden richtig angewendet hat. Da dies in der Regel jedoch nicht in Anwesenheit der Parteien geschieht, muss der Sachverständige die fehlende Parteiöffentlichkeit dadurch ersetzen, dass er den Untersuchungsablauf nebst Auswertungen, die er vorgenommen hat, detailliert darstellt. Nur so sind sie nachvollziehbar und nur so kann später, auch durch andere geprüft werden, ob die Methoden richtig eingesetzt wurden. Würde man also die Daubert-Standards auf die gemeinhin vorgenommene psychiatrische Diagnosestellung und insbesondere das DSM-5 als Grundlage einer wissenschaftlichen Expertenaussage anwenden, so ergäben sich beträchtliche Zweifel: So erwiesen sich die in den Feldstudien ermittelten diagnostischen Übereinstimmungen für etliche Diagnosen als weit hinter den Erwartungen zurück bleibend [9]. Für die meisten Diagnosen beziehungsweise ihre Kriterien sind gar keine Feldstudien durchgeführt worden, weil die diagnostischen Kriterien nach den Feldstudien von Regier et al. nochmals geändert wurden [13]. Z.B. liegen für die nach DSM-5 definierte PTBS gar keine Feldstudien vor, die diagnostische Übereinstimmung/Sensitivität/Spezifität der Kriterien für diese in der Begutachtung so bedeutsame Störung sind daher bis dato unbekannt. Für die generalisierte Angststörung wurde immerhin die Rater-Übereinstimmung angegeben, mit Kappa = 0,2 bei weitem unzureichend, für die major depressive Episode mit Kappa = 0,25 ebenfalls unzureichend, für die leichte kognitive Störung mit Kappa = 0,5 als mäßig geschätzt. Frances [8], der die Arbeitsgruppe für die Erstellung des DSM-IV leitete, wies darauf hin, dass Kappawerte unterhalb 0,6 im Allgemeinen als unzureichend betrachtet werden. Entsprechend lautete die Einschätzung Frances‘, das DSM5 habe „die Feldversuche nicht bestan- MED SACH 111 4/2015 Originalbeiträge den“. Diese Aussage gilt, obwohl die Feldversuche unter optimalen Bedingungen durchgeführt wurden, nämlich in großen medizinischen Einrichtungen, vor allem Universitätskliniken. Mutmaßlich wäre das Ergebnis noch schlechter ausgefallen, hätte man niedergelassene Psychiater oder Allgemeinärzte, die in Amerika wie in Deutschland eine große Zahl psychiatrischer Diagnosen stellen, beteiligt. Die ICD-10 schneidet in dieser Hinsicht nicht besser ab: nach diversen Feldstudien in 39 Ländern waren die InterraterReliabilitäten enttäuschend, mit Kappa = 0.12 für die histrionische Persönlichkeitsstörung, Kappa = 0.21 für die impulsive Persönlichkeitsstörung und Kappa = 0,23 für Angst- und depressive Störungen gemischt. Der Versuch, bessere Ergebnisse mit der wissenschaftlichen Version der ICD-10 [12] zu erzielen, führte nicht weiter, denn bspw. für die rezidivierende depressive Störung ergab sich nur eine Interrater-Reliabilität mit Kappa = 0.3, für die Anpassungsstörung und die Störung Angst und Depression gemischt sogar nur Kappa = 0.09 und für die histrionische Persönlichkeitsstörung Kappa = 0.25. Nach wie vor fehlen jegliche Angaben zur Sensitivität und Spezifität, um die diagnostischen Kriterien der Psychiatrie in den Rang einer wissenschaftlichen Methode zu erheben. So erklärte der Direktor des amerikanischen National Institute of Mental Health, dass man keine Forschung nach den DSM-5 Kriterien durchführen werde, da diese Kriterien nicht als valide betrachtet werden können (http://www.nimh.nih.gov/about/ director/2013/transforming-diagnosis.shtml): „it is, at best, a dictionary, creating a set of labels and defining each. …The weakness is its lack of validity. Unlike our definitions of ischemic heart disease, lymphoma, or AIDS, the DSM diagnoses are based on a consensus about clusters of clinical symptoms, not any objective measure. In the rest of medicine, this would be equivalent to creating diagnostic systems based on the nature of chest pain or the quality of fever. Indeed, symptom-based diagnosis, once common in other areas of medicine, has been largely replaced in the past half century as we have understood that symptoms alone rarely indicate the best choice of treatment. Patients with mental disorders deserve better“. Die Kritik bzgl. Anwendbarkeit des DSM-5 im medikolegalen Kontext ließe sich fortsetzen [13], worauf an dieser Stelle aber verzichtet wird. Konsequenzen für die praktische Arbeit des medizinischen Sachverständigen Der um Objektivität bemühte Sachverständige wird, um die eingangs angestellten Betrachtungen wieder aufzugreifen, seine Beurteilung nach Möglichkeit und in erster Linie auf diejenigen Kriterien gründen, die er im Rahmen seiner Untersuchung selbst feststellen kann (Typ 2). Dies allerdings führt dazu, dass manche Diagnosen nicht gestellt werden können, weil die Anzahl objektiv überprüfbarer (falsifizierbarer) Kriterien zu gering ist, um die Mindestanzahl der geforderten Symptome zu erreichen. Der Sachverständige wird also nicht umhin können, sich auch zu solchen Diagnosekriterien (Typ 1) zu äußern. Er muss allerdings in seinem Gutachten klar zu erkennen geben, dass mit wissenschaftlichen, empirischen Methoden das Vorliegen mancher Gesundheitsstörungen nach den Kriterien des DSM-5 nicht beweisbar ist. Vielfach ist dieser Nachweis auch gar nicht nötig, denn es mag genügen, eine relevante Leistungsminderung/Funktionsstörung im Vollbeweis zu sichern und die Diagnose als sehr wahrscheinliche Vermutung zu formulieren. Der Rückgriff auf ICD-10, ICD-9, DSMIII oder andere überholte Nomenklaturen, wie es in Deutschland gerne praktiziert wird, ist aus den oben genannten Gründen keine gangbare Alternative, sie leisten auf keinen Fall besseres. Niemals aber sollte der Sachverständige nicht prüfbare Behauptungen des Untersuchten (Typ 1) als Tatsachenfeststellung ausgeben mit dem Argument, der Beweis sei mit der Behauptung schon erbracht, da ein Befund grundsätzlich darüber nicht zu erheben sei. Dies würde eine Umkehr der Beweislast bedeuten: Von wenigen Ausnahmefällen abgesehen ist der Antragsteller beweispflichtig und der Beweis wird nicht dadurch erbracht, dass jener eine Gesundheitsstörung behauptet, die einem wissenschaftlichen Nachweis nicht zugänglich ist. Konkret betrifft dies z.B. einige Konstellationen der somatic symptom disorders und manche episodi- schen Störungen, wie einige Angststörungen, Zwangsstörungen u.a.m.. Die hier vorgeschlagene Lösung lautet, dass der Sachverständige zunächst klar feststellt, vom Vorliegen welcher Symptome er sich objektiv überzeugen konnte. Reichen diese bereits aus, um eine Diagnose zu stellen, bedarf es keiner weiteren Schritte. Reichen sie nicht aus, so sollte der Sachverständige für jedes der Symptome diskutieren, ob das Symptom konsistent („glaubhaft“, s.o. Typ 1a) ist oder nicht. Er vergleicht dazu den behaupteten Umstand mit den von ihm erhobenen Befunden und prüft, ob die Behauptung damit vereinbar ist. So würde etwa die Behauptung, jemand sei aufgrund von ausgeprägten Angstzuständen außerstande, die Wohnung zu verlassen, durch geringe Fußsohlenbeschwielung, geringe Ablaufspuren an Straßenschuhen, geringe Bemuskelung an Händen und Füßen, und fehlende Handflächenbeschwielung sowie fehlende Arbeitsspuren an den Händen und Füßen gestützt. Finden sich jedoch bei der Untersuchung ausgeprägte Arbeitsspuren, kräftige Bemuskelung und ebenso kräftige Beschwielung an den Füßen, vielleicht noch Kratzspuren von Strauchwerk an den Unterschenkeln, wäre bzgl. der behaupteten Angststörung nicht von konsistenten Informationen auszugehen. Ebenso wäre die Behauptung, an erheblicher Müdigkeit zu leiden und spätestens alle zwei Stunden sich hinlegen zu müssen, nicht vereinbar mit der Beobachtung, dass der Untersuchte eine sechsstündige, durchaus anstrengende Begutachtung ohne Müdigkeitsanzeichen und ohne Pause durchgestanden hat. Zusätzlich zu einer solchen Plausibilitätsprüfung sollte der Sachverständige die anamnestischen Angaben und insbesondere die Beschwerdenschilderung einer allgemeinen Validitätsprüfung unterziehen durch die Verwendung von Beschwerdenvalidierungstests oder Beschwerdeninventaren mit geeigneten Validitätsskalen. Wohlgemerkt leisten solche Testverfahren nicht den Nachweis, dass ein bestimmtes Symptom oder eine Gesundheitsstörung vorhanden oder nicht vorhanden ist, sondern sie dienen im Rahmen der epistemischen Prüfung lediglich der Bewertung der Glaubhaftigkeit. Dies muss insofern hervorgehoben werden, als von den Deutschen Psychiatrischen Fachgesellschaften (DGPPN) und ihren führenden Mitglie- MED SACH 111 4/2015 167 Originalbeiträge dern als Argument gegen die angestrebte Validierung psychiatrischer Diagnosen behauptet wurde, keines der (Beschwerden- und Leistungs-)Validierungsverfahren sei geeignet, das Vorhandensein einer psychischen Erkrankung nachzuweisen oder zu widerlegen und deshalb seien diese Verfahren nutzlos [4, 5, 6]. Dieser Einwand ist nur insofern richtig, als die Beschwerdenvalidierungsverfahren ebenso wenig dazu konstruiert wurden psychiatrische Diagnosen zu stellen oder zu widerlegen, wie ein Reflexhammer, eine MS zu diagnostizieren. Ohne ihn kommt man gleichwohl bei der Untersuchung nicht aus. Der kundige Sachverständige verwendet Validierungstests im Sinne eines allgemeinen Instrumentes zur Überprüfung der Kooperation eines zu Untersuchenden und der Glaubhaftigkeit seiner Aussagen, wobei es auf die zu stellende Diagnose erst in zweiter Linie ankommt. Der Sachverständige kann nach entsprechender epistemischer Prüfung seine Mitteilungen dahingehend erweitern, dass er dem Auftraggeber sagt, er habe einerseits Tatsachen feststellen können, die für das Vorliegen einer bestimmten Störung sprechen, darüber hinaus die behaupteten, nicht beweisbaren Symptome untersucht und trotz Einsatz von Verfahren, die mit hoher Sensitivität negative Antwortverzerrung feststellen können, keine Zweifel an der Schlüssigkeit der Symptomschilderung, ferner sei die Symptomschilderung konsistent zu den übrigen Feststellungen. Insofern sei mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Störung bei dem untersuchten Menschen tatsächlich vorliege. Vielleicht erscheint dies dem Leser redundant; es ist jedoch ein Unterschied, ob der Sachverständige diejenigen Symptome, die zu der Diagnose „noch fehlen“, schlicht als vorhanden, weil nicht direkt widerlegt, unterstellt und dem Auftraggeber gegenüber so tut, als habe er sie selbst beobachtet, oder ob der Sachverständige seine Aussage dahingehend einschränkt, dass er aufgrund eigener Beobachtungen die Diagnose zwar nicht stellen kann, sie aber unter Hinzuziehung weiterer Informationen mit geringerem Beweiswert, für wahrscheinlich hält. Es obliegt dann dem Auftraggeber, zu entscheiden, ob seinen Beweisanforderungen damit genüge getan ist. Ebenso muss der Sach- verständige dem Auftraggeber zu erkennen geben, wenn er mit seinen Methoden über den angefragten Sachverhalt (siehe die dissoziative Störung oder bestimmte Angststörungen) keine wissenschaftliche Befunderhebung anstellen kann. Es darf auch ein Blick auf die nosologische Validität der Kriterien nicht unterbleiben, denn im Gegensatz zur Situation des Behandlers steht der Sachverständige qua Auftrag dem Auftraggeber und der sozialen Gemeinschaft gegenüber in strenger(er) Verpflichtung, valide und reliable Aussagen zu treffen. Der Sachverständige soll nicht eine Gesundheitsstörung deshalb feststellen, weil dies vom Untersuchten oder sozial erwünscht ist (wenn z.B. aus politischen Gründen eine Entschädigung gewährt werden soll und eine Diagnose dafür Voraussetzung ist) sondern nur dann, wenn sich genügend Tatsachen ergeben, die für das wirkliche Vorliegen einer psychischen Krankheit sprechen. Die Entscheidung, mit der die sachverständige Aussage getroffen wurde, soll neutral sein und frei von persönlichen ­Biases, etwa weil die untersuchte Person dem Sachverständigen sympathisch ist, weil der Sachverständige eine bestimmte sozialpolitische oder religiöse Auffassung vertritt, weil der Sachverständige befürchtet, sonst vom Auftraggeber keine weiteren Aufträge mehr zu erhalten, weil er Auseinandersetzungen mit Behandlern vermeiden möchte, weil der Sachverständige bestimmten politischen Strömungen oder der Folklore (siehe insbesondere die so genannten Traumafolgestörungen) nicht entgegenstehen will usw.. Freilich erfordert dies Mut, denn kritische Sachverständige sind gerade bei solchen Antragstellern, die in Wahrheit nicht berechtigte Ansprüche durchsetzen möchten, unbeliebt (s. die Internetforen zum Zweck der persönlichen Verunglimpfung kritischer Sachverständiger durch anonyme Schreiber), auch den Sachbearbeitern/Schadensregulierern bereiten sie Verdruss und Mehrarbeit, weil, anstatt den Fall schnell abschließen und entschädigen zu können, Widersprüche bearbeitet und weitere Sachaufklärung betrieben werden muss. Transparenz bedeutet, dass die Abbildung der Sachverhalte und deren Bewertung nicht durch persönliche Eigenschaften, Auffassungen oder (wirtschaftliche) Interessen des Sachverständigen verzerrt 168 wird, dieser im Optimalfall selbst nicht „sichtbar“ ist. Durch die verlässliche und nachvollziehbare Anwendung eines allgemeinen diagnostischen Regelsatzes und eine wissenschaftliche Methodik (d.h. Beschränkung auf falsifizierbare Sachverhalte) wird eine Gleichbehandlung der zu Begutachtenden gewährleistet. Literatur 1 American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 2013 2 American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text revision). Washington, DC: American Psychiatric Association, 2000 3 Dilling H, Mombour W, Schmidt M H: Internationale Klassifikation psychischer Störungen - ICD-10 Kapitel V (F) Klinisch-diagnostische Leitlinien. Bern: Huber Verlag, 1991 4 Dressing H, Foerster K, Widder B, Schneider F, Falkai P: Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) zur Anwendung von Beschwerdenvalidierungstests in der psychiatrischen Begutachtung. www.dgppn. de, 3, 28.01.2011 5 Dressing H, Widder B, Foerster K: Kritische Bestandsaufnahme zum Einsatz von Beschwerdenvalidierungstests in der Psychiatrischen Begutachtung. VersMed (2010), 4: 163–167 6 Dressing H, Frommberger U, Freyberger H: Begutachtungsstandards bei Posttraumatischer Belastungsstörung, Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN). Nervenarzt (2009), 80: 1394–1398 7 Foerster K, Bork S, Kaiser V, Grobe T, Tegenthoff M, Weise H, Badke A, S­ chreinicke G, Lübcke J: Vorschläge zur MdE-Einschätzung bei psychoreaktiven Störungen in der gesetzlichen Unfallversicherung. MedSach (2007), 103: 52–56 8 Frances A: Saving normal, an Insiders Revolt against Out-of-Control of Psychiatric Diagnosis, DSM-5, Big Pharma and the Medicalization of Ordinary Life. New York: Harper Collins Publishers, 2013 9 Regier D A, Narrow W E, Clarke D E, Kraemer H C, Kuramoto S J, Kuhl E A, Kupfer D J: DSM5 field trials in the United States and Canada, Part II: test-retest reliability of selected categorical diagnoses. Am J Psychiatry (2013), 170: 59–70 10 Saß H, Wittchen H-U, Zaudig M, Houben I: Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen – Textrevision DSMIV-TR. Göttingen: Hogrefe, 2003 11 Wittchen U H, Jacobi F, Rehm J et al: The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010; Eur Neuropsychopharmacol (2011), 21: 655–679 12 Wittchen U H, Jacobi F: Size and burden of mental disorders in Europe: a critical review and appraisal of 27 studies. Eur Neuropsychopharmacol (2005),15: 357–376 13 Young G, Lareau C, Pierre B: One Quintillion Ways to have PTSD-Comorbidity: Recommendations for the Disordered DSM-5. Psychol Inj and Law (2014), 7: 61–74 MED SACH 111 4/2015