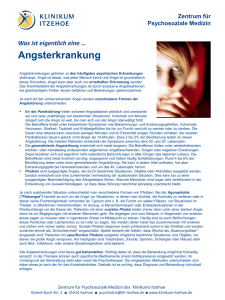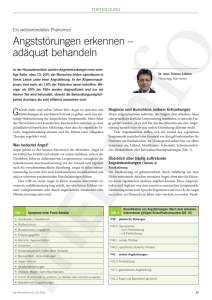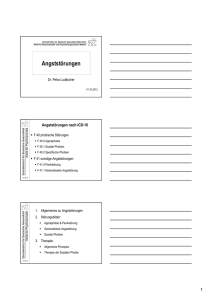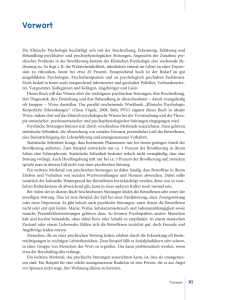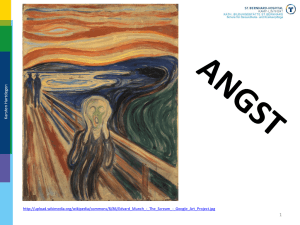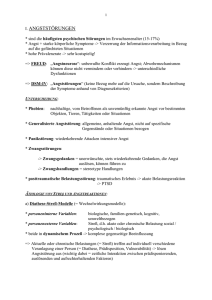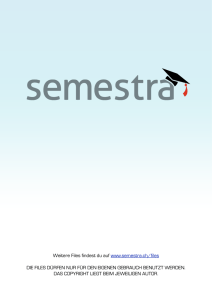file downloaden
Werbung

Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] Phobien Hans Reinecker Göttingen: Hogrefe, 1993 S. 1-102 Susi Kolarik Rte de la Glâne 109 1752 Villars-sur-Glâne 026/402 46 73 1 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] 1. Beschreibung (4-12) 1.1 Alltags- und Wissenschaftssprache (4-6) In der Psychologie wird Angst als theoretischer Begriff, als Konstrukt aufgefasst. Merkmale und Indikatoren bilden z.B. subjektive Angaben einer Person über ihren Gefühlszustand oder Beobachtungen von Flucht- und Vermeidungsverhalten. Nach Lewis (1970) und Strian (1983) sind bei Angst folgende Komponenten zu berücksichtigen: - Angst ist ein emotionaler Zustand einer Person, der von Betroffenen zumeist als unangenehm und bedrohlich erlebt wird. - Die Angst bezieht sich auf eine Beeinträchtigung der eigenen Existenz oder des Lebens von Freunden und Angehörigen. - Angst der Person ist zumeist auf eine zukünftige Bedrohung bezogen. - Der Auslöser der Bedrohung ist für die Person mehr oder weniger unbestimmt. - Das Gefühl der Angst ist von subjektiv erlebten und zumeist beobachtbaren körperlichen Prozessen begleitet. Die Grenzen zur Behandlungsbedürftigkeit von Angst sind fliessend und unscharf. Bei folgenden Kriterien kann man jedoch von pathologischer Angst sprechen: (1) Die Angstreaktionen der Person sind einer Situation nicht mehr angemessen; (2) Die Angstreaktionen sind überdauernd (d.h. chronisch); (3) Das Individuum besitzt keine Möglichkeit zur Erklärung, zur Reduktion oder zur Bewältigung der Angst; (4) Die Angstreaktionen führen zu einer massiven Beeinträchtigung des Lebensvollzugs der Person. 1.2 Ebenen von Angst (6-8) a) Subjektiv-verbale Ebene Sie wird auch „kognitive Ebene“ genannt und bildet für Diagnostiker und Kliniker meist die erste Zugangsebene zur Angst des Patienten. Sie beinhaltet Gedankeninhalte („ich werde sterben“), sowie verbal geäusserte Befürchtungen („alle schauen mich an“). Durch die Stabilisierung von Ängsten bildet die Person interne Schemata oder Angststrukturen, die bei der Konfrontation mit einer phobischen Situation sehr rasch aktiviert werden und zur Aufrechterhaltung von Ängsten beitragen. b) Motorisch-verhaltensmässige Ebene Entscheidendes Kriterium dafür ist die direkte Beobachtbarkeit konkreter Verhaltensmuster in einzelnen Situationen. Als besonders charakteristisch für die Verhaltensebene der Angst können Strategien des Ausweichens, der Flucht und der Vermeidung angesehen werden. Für die verhaltenstheoretische Diagnostik und v.a. für die Intervention bietet diese Ebene gewissermassen die „via regia“ des Zugangs zu einem Problem. c) Somatisch-physiologische Ebene Praktisch alle Ängste treten zusammen mit einer Reihe von somatischen Beschwerden auf, die zumeist diffus, oszillierend und ohne funktionelle oder pathologische Grundlage sind; z.B. Gefühle der Schwäche, Schwindelgefühle, Sehstörungen, Gefühle eines Klosses im Hals 2 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] oder in der Magengrube, Harn- oder Stuhldrang, Zittern in den Beine, Gefühle der Derealisation usw. Es können ganz unterschiedliche Kombinationen der drei Ebenen von Angst vorliegen. Nach Rachman & Hodgson (1974) tritt Synchronizität (d.h. in etwa gleichermassen hohe Ausprägungsgrade in allen drei Reaktionssystemen) insbesondere bei massiven Angstreaktionen auf. Bei subklinischen Ängsten wie z.B. Prüfungsangst zeigen sich hingegen starke Variationen in den einzelnen Ebenen. Für den Kontext der Behandlung ist zu beachten, dass den einzelnen Ebenen differentielle Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die A-Synchronizität (Synonym: De-Synchronizität) meint die tatsächliche Manifestation von Ängsten auf unterschiedlichen Ebenen, d.h. nicht die mangelnde Synchronizität, die durch unterschiedliche Messinstrumente zustande kommt. 1.3 Zur Klassifikation von Phobien im DSM-III-R (9-12) Klassifikation wird hier verstanden als die Zuordnung heterogener Phänomene anhand einzelner möglichst klarer Kriterien zu einzelnen Gruppen, wobei individuelle Ausprägungen und Merkmale zunächst keine Berücksichtigung finden. Im DSM-III-R werden Phobien als eigene Klasse der Angststörungen gefasst; im ICD-9 wurden Ängste und Phobien noch als „Neurosen“ klassifiziert. Nach Marks (1987) erscheint eine Untergliederung von Phobien unter folgenden Gesichtspunkten durchaus sinnvoll: (1) (2) (3) Die Klassifikation ist – trotz gewisser Überlappungen – für Zwecke der Beschreibung, der Ätiologie und der Therapie hilfreich. Phobische Reaktionen sind ein eigenes Störungsbild, spielen jedoch auch bei vielen psychiatrischen Störungen eine wesentliche Rolle (Komorbidität), deswegen ist eine genaue Beschreibung sinnvoll. Phobien besitzen eine sehr grosse Varianz, weshalb es sinnvoll ist, dass man ein Kontinuum von Phobien unterstellt. Situationale und biologisch-genetische Merkmale des Auftretens von Ängsten müssen entsprechend berücksichtigt werden (z.B. die natürliche Schutz-Funktion von Ängsten). Durchgesetzt hat sich die Einteilung der Phobien in Agoraphobien, soziale Phobien und spezifische Phobien: - Agoraphobie: Eine stark generalisiert Angst, bei der nicht so sehr die Angst vor den einzelnen Situationen im Vordergrund steht, sondern die Angst des Patienten um die eigene Unversehrtheit (Angst zu sterben, verletzt sein, ohne Hilfe zu sein usw.). - Soziale Ängste: Sie weisen einen besonders weiten Bedeutungsbereich auf, und es ist sehr schwierig, die Frage der klinischen Relevanz bzw. der Behandlungsbedürftigkeit zu beantworten. - Spezifische Phobien: Die Angst ist an einen ganz speziellen (in vielen Fällen durchaus konkreten) Auslöser gebunden. Unterschieden werden Situations- oder Objektphobien (Angst vor bestimmten Tieren, Flugangst) und krankheits-, verletzungs- und organbezogene Ängste (Angst vor chirurgischen Eingriffen, AIDS-Angst, Herzphobien). 2. Epidemiologie, Nosologie und Verlauf (13-37) 2.1 Epidemiologie von Phobien (13-20) Epidemiologie meint die Verteilung (Häufigkeit) einer Störung in einer abgegrenzten Population und ihren Bezug zu sozialen und demographischen Merkmalen. Prävalenz meint 3 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] den Bestand, die Häufigkeit einer speziellen Störung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Stichtag (Punktprävalenz) bzw. in einem bestimmten Zeitraum (Streckenprävalenz). Inzidenz meint das Neuauftreten einer Störung in einem bestimmten Zeitraum. Während in die Prävalenzrate auch die Dauer (Chronizität) einer Störung eingeht, beinhaltet die Inzidenzrate v.a. das Morbiditätsrisiko. Die Prävalenzraten für die einzelnen Angststörungen sind von mehreren Faktoren abhängig (Marks, 1987): a) von der speziellen Zusammensetzung und Auswahl der Stichprobe; b) von der Ergebungsmethodik („case definition“); c) von der Dauer der Erhebung (Lebenszeit- vs. Punktprävalenz) Epidemiologische Daten geben keine genaue Auskunft über die Behandlungsbedürftigkeit. In verschiedenen Studien fand man, dass sich nur ca. ein Viertel der Personen mit phobischen Störungen in Behandlung befindet. Agoraphobien Sie stellen innerhalb der Phobien die häufigste Störung dar (ca. 50%, vs. je ca. 25% soziale und spezifische Phobien). In den westlichen Industriestaaten geht man von einer durchschnittlichen Häufigkeit von 3% aus (6-Monats-Prävalenz). Frauen sind öfters betroffen, es ist von 2/3 bis 4/5 die Rede. Es gibt kaum Unterschiede hinsichtlich sozialer Schicht und Intelligenz. Das Alter bei Beginn der Agoraphobien wird mit durchschnittlich 27 Jahren angegeben. Eine zielführende psychiatrische Behandlung erfolgt erst nach durchschnittlich 8-12 Jahren (Marks, 1987). Bei rund 3/4 der Patienten zeigt sich eine deutliche Behinderung der Arbeitssituation. Soziale Phobien Sie beinhalten eine multiple und komplexe Angst in einer Vielzahl von Situationen, in denen die Beachtung durch andere Menschen die zentrale Rolle spielt. Die Häufigkeit wird mit 1.7% angegeben (6-Monats-Prävalenz), wobei Frauen etwas häufiger betroffen sind (60:40). Das Alter bei Beginn der sozialen Phobien liegt bei 15-21 Jahren, was vermutlich mit Prozessen der sozialen Umstellung, der Neuorientierung in der Gemeinschaft usw. zusammenhängt. Das Alter bei Behandlungsbeginn wird mit 27-34 Jahren angegeben. Kennzeichnend sind Defizite in sozialen Fertigkeiten; rund 50% der Betroffenen sind alleinstehend. Soziale Phobien betreffen v.a. Personen aus höheren sozialen Schichten. Dieser Befund kann allerdings damit zusammenhängen, dass diese Personen sich häufiger selbst zuweisen. Spezifische Phobien Es ist von einer 6-Monats-Prävalenz von 4-7% auszugehen, wobei sehr wenige dieser Ängste behandlungsbedürftig sind. Frauen überwiegen deutlich, z.B. bei Tierphobien machen sie 90% der Fälle aus. Bei den spezifischen Phobien gibt es eine enorme Varianz. Dies betrifft auch die Beeinträchtigung bzw. die Behandlungsbedürftigkeit. Sie dürfen aber nicht einfach als unbedeutend eingestuft werden. Unter folgenden Bedingungen fällen Betroffene die Entscheidung, eine Behandlung anzufangen (Marks, 1987): - Situationale oder personale Umstellungen - Informationen über Behandlungsmöglichkeiten (z.B. auch Angst um die Kinder) - Damit andere, entscheidende Probleme behandelt werden können (Sucht, Partnerprobleme, Depressivität usw.). Genetische Befunde Die genetischen Studien beziehen ihre Daten üblicherweise aus Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien. Eine grosse Schwierigkeit ergibt sich für die Interpretation der einzelnen 4 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] Studien dadurch, dass mit der Angabe von durchschnittlichen Werten (Konkordanzraten) wohl keine eindeutige Bestimmung eines genetischen Beitrags möglich ist. Das Vorliegen einer Angststörung in einer Familie bildet möglicherweise sowohl einen genetischen, als auch einen Umwelt-Belastungsfaktor für das heranwachsende Kind. Bei der Interpretation genetischer Studien bleibt immer die Frage, in welchem Bereich die Vulnerabilität für die Ausformung einer Störung zu suchen ist. Insgesamt muss man wohl von einer engen Interaktion externer Faktoren mit einer Schwachstelle im Bereich des Locus Coeruleus ausgehen; eine niedrige Schwelle führt zu einer starken Aktivierung des zentralen noradrenergen Aktivität und bildet damit die Voraussetzung für massive Panikattacken (Pitts & McClure, 1967). Bei der Entstehung von Phobien ist das individuelle Erleben von Belastungen und deren Interpretation bzw. Bewältigung offenbar viel bedeutsamer als familiäre Aspekte. Unbestritten bleibt jedoch, dass genetische Faktoren für die Ätiologie von Phobien eine Rolle spielen. Viel mehr weiss man dazu nicht. 2.2 Nosologie (20-34) Nosologische Gesichtspunkte von Phobien beinhalten jene Merkmale, die in klinisch-psychologischer Hinsicht bei den unterschiedlichen Störungsbildern zu berücksichtigen sind. Dazu gehören die Berücksichtigung deskriptiver Merkmale, sowie Hinweise aus verschiedenen theoretischen Überlegungen. Besondere Bedeutung besitzen die Abgrenzungen zu sowie die Überschneidung der Phobien mit anderen Störungen. Phobien in „reiner“ Form treten eher selten auf. Agoraphobie Es gibt im Grunde keine spezielle Kombination von Ängsten, keinen „roten Faden“, der genau angibt, welche Situationen notwendig und hinreichend sind, um von „Agoraphobie“ zu sprechen. Das nosologisch entscheidende Charakteristikum scheint eine ganz spezielle Art von Befürchtungen zu sein. Auf der Ebene der agoraphobischen Verhaltensmuster gruppieren sich agoraphobische Reaktionen mehr oder weniger lose um die Angst um die eigene Unversehrtheit. Die Dauer der Ängste beträgt meistens 10-30 Minuten. In der retrospektiven Befragung werden Dauer und Intensität deutlich überschätzt. Die Angst hört auf, wenn die Person aus der Situation flieht oder wenn sie externe Hilfe bekommt (z.B. Notarzt). Agoraphobische Patienten sind auch interozeptiven Stimuli gegenüber sehr sensibel, was vermutlich viel zur Aufrechterhaltung der Angst beiträgt. Innerhalb der einzelnen Angststörungen ist folgende nosologische Differenzierung wichtig: Agoraphobiker: Vermeiden die Öffentlichkeit, Reisen etc. aus Angst vor anderen Menschen dahingehend, dass ihnen selbst etwas zustossen könnte. Soziale Phobiker: Vermeiden oft dieselben Situationen; im Zentrum steht aber die Angst vor anderen Menschen, vor Kontakten etc. Zwänge: Betroffene vermeiden ebenfalls ähnliche Situationen (Öffentlichkeit, Toiletten, Kontakte mit anderen Menschen) aus Angst vor Kontamination, Beschmutzung etc. Depressionen: Hier muss der soziale Rückzug als Folge der depressiven (affektiven) Verstimmung angesehen werden; mit depressiven Zuständen geht entsprechende Antriebslosigkeit und die Vermeidung sozialer Situationen einher. 5 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] Bei der Nosologie von Ängsten spielen Vorstellungen, Kognitionen, Bewertungen eine nicht zu unterschätzende Rolle; diese Antizipationen (deren genaue Elaboration Patienten zumeist wieder vermeiden) sind in klinischen Interventionen und in der Behandlung zentraler Bestandteil. Soziale Phobie Von sozialen Phobien spricht man, wenn die allgemeine, normale Angst vor sozialen Kontakten ein Ausmass erreicht hat, das den Verhaltensspielraum des Patienten stark einschränkt. Ein besonderes Kennzeichen besteht in einem hohen Ausmass an Vermeidung. Betroffene haben Angst in einer Vielzahl von Situationen, deren gemeinsames Merkmal die Erwartung des Patienten ist, von anderen Menschen beobachtet und bewertet zu werden. Sie haben v.a. Angst davor, sich blamieren zu können. Alkohol erleichtert vielen Betroffenen das Zusammensein mit anderen, was in der Folge zu einem sekundären Problem wird: Rund 20% der behandelten sozialen Phobiker sind als Alkoholiker anzusehen. Bei der sozialen Angst können unterschiedliche Determinanten im Vordergrund stehen: a) Defizite in sozialen Fertigkeiten b) Wissens-Defizite c) Ein hohes Ausmass an autonomer sozialer Angst. Differential-diagnostisch abzugrenzen sind soziale Phobien vom Zustandsbild der „sozialen Dysfunktion“, welche als Persönlichkeitsstörung gilt. Spezifische Phobien Spezifische Phobien lassen sich klar abgrenzen und beziehen sich auf eine spezielle Situation bzw. auf ein „Thema“. Betroffene leiden wie alle Angstpatienten unter Gefühlen der Panik, des Kontrollverlustes und unter ähnlichen somatischen und psycho-physiologischen Zuständen, wie dies bei Panikattacken bekannt ist. Sie sind normalerweise in ihrem Lebensvollzug nicht so stark beeinträchtigt wie z.B. Agoraphobiker, weil der Stimulusbereich sehr eng ist und die Situation meist gut vermieden werden kann. - Tierphobien: Es sind die speziellen Merkmale des Tieres selbst, die gefürchtet werden, nicht nur die Berührung mit dem Tier. Sie sind meist als subklinisch anzusehen. 90-95% der Betroffenen sind Frauen, was mit kulturellen Normen und Erwartungen erklärt werden kann. - Blut- und Verletzungsphobien Eine sinnvolle Alarmreaktion, die phylogenetisch verankert ist, bei Betroffenen jedoch so ausgeprägt ist, dass Behandlungsbedarf besteht. Frauen sind viel öfters betroffen. Patienten berichten vom Gefühl, umzufallen, in Ohnmacht zu fallen usw., in der Realität passiert das aber kaum. Die erlebte Übelkeit lässt sich als Folge einer di-phasischen vaso-vagalen Reaktionen sehen: In einer ersten Phase steigen Blutdruck und Herzrate stark an; in der zweiten Phase ist der rapide Abfall des Blutdrucks mit Schwäche und Übelkeit verknüpft; dies erscheint zumindest einem aus der Evolution bekannten TotstellReflex ähnlich. - Krankheitsphobien Marks (1969) geht davon aus, dass rund 15% der behandelten Phobiker Krankheitsphobien haben. Bei Betroffenen sind stark hypochondrische Züge feststellbar. Die Angst ist allgegenwärtig, weil der Patient auf alle möglichen Signale seines Körpers mit Angst reagiert. Er geht sehr oft zum Arzt. In neuerer Zeit überwiegt bei den Krankheitsphobien die AIDS-Phobie, welche ein grosses Problem darstellt, weil einerseits die Befürchtung bis zu einem gewissen Grade eine reale Berechtigung hat, und andererseits auch eine medizinische Ausschlussdiagnose nur kurzfristig beruhigen kann. 6 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] - Situationale Phobien - Flugphobien: Die Angst kann sich auf völlig unterschiedliche Aspekte des Fluges beziehen und wird meist mit Alkohol oder Medikamenten bekämpft. Rund 10% der Menschen, die nicht fliegen, tun dies aus Angst nicht. - Klaustrophobien: Bezieht sich auf enge Räume, Aufzüge, Eingeschlossen sein im Bus/Zug, oder auf die Form der Immobilität bei einem Friseur oder Zahnarzt. - Ängste vor Naturereignissen - Sphinkter-Phobien: Sie führen zu grossen Einschränkungen, weil Betroffene u.U. nicht mehr in der Lage sind, eine öffentliche Toilette zu benutzen. Ähnlich sind umgekehrte Ängste: Die Angst, in der Öffentlichkeit einem Harndrang nicht widerstehen zu können. Sphinkter-Phobiker bewegen sich nur an Orten, wo sie die Toiletten kennen. - Sexualphobien: Spielen bei rund 1/3 aller funktionellen Sexualstörungen eine wichtige Rolle. Die Angst hängt meist mit mangelndem sexuellem Wissen oder mit verschiedenen traumatischen Vorerfahrungen zusammen. Exkurs: Aversionen als spezifische Phobien? Es scheint eine Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen Aversionen und Angst zu geben. Aversionen betreffen Speisen, akustische Reize und taktile Empfindungen. Zu den Geschmacks-Aversionen gibt es viele Untersuchungen. Es ist nicht klar, ob durch die raumzeitliche Verzögerung von Essen (CS) und dem aversiven Stimulus (UCS) bzw. der Übelkeit (UCR) eine Koppelung (d.h. Lernen) überhaupt möglich ist. Ausserdem berichten 1/3 der Betroffenen, dass sie schon immer unter der Aversion gelitten haben, d.h. kein Lernprozess stattgefunden hat. Bei 1/6 bestehen Aversionen, ohne dass die betreffende Speise je gegessen wurde. Erlernte Aversionen bilden also nur eine Teilmenge aller Aversionen; hinsichtlich des Erwerbs und der speziellen Vermeidung lassen sich durchaus Parallelen zu spezifischen Phobien ziehen. 2.3 Verlauf phobischer Störungen (34-37) Marks & Herst (1970) wiesen für phobische Störungen nach, dass Remissionen zumeist nur partiell erfolgen. Die Verläufe sind in der Regel chronisch, relativ selten sind episodische Verläufe mit Phasen deutlicher Besserung. Tierphobien beginnen meist vor dem 10. Lebensjahr, der Gipfel bei sozialen Phobien ist im Bereich von 15-20 Jahren zu sehen. Für viele spezifische Phobien findet sich ein Beginn um das 20. Lebensjahr, während Agoraphobien üblicherweise erst im dritten Lebensjahrzehnt ihren Anfang haben. Möglicherweise muss für Agoraphobien von einem zweiten Gipfel in der Verteilung knapp nach dem 30. Lebensjahr ausgegangen werden. Ohne zielführende Behandlung erfüllen 93% der Patienten mit Angststörungen auch nach sieben Jahren noch die Kriterien für dieselbe Störung. Diese Stabilität wird damit erklärt, dass Patienten im Durchschnitt nur zu einem Drittel so sehr gestört sind, dass dies zu einer deutlichen Beeinträchtigung des beruflichen und sozialen Lebens führt. Bei den meisten Patienten mit Phobien zeigt sich in verschienenen Untersuchungen eine hohe Komorbiditätsrate. Die zusätzlichen Störungsbilder sind v.a. Depressionen, Alkoholund Medikamentenmissbrauch. Bei Phobikern zeigen sich praktisch immer zusätzliche somatische Beschwerden. Die zumeist recht diffusen psychosomatischen Beschwerden sind Bestandteile der somatischen Ebene von Ängsten im Sinne des Drei-Ebenen-Modells (Lang, 1985; Rachmann, 1990). Die meisten Patienten erhalten im Verlauf ihrer Phobie eine unspezifische pharmakologische Behandlung. Patienten mit Ängsten werden in der allgemeinen Gesundheitsversorgung kaum richtig erkannt und ebenso wenig zielführend behandelt. Zusammenfassend ergibt sich ein pessimistisches Bild: Patienten mit Phobien sind zu rund einem Drittel aller Fälle stark 7 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] beeinträchtigt, die Dauer der Störung liegt bei rund 20 Jahren und insgesamt ist mit einem stabil-chronischen Verlauf zu rechnen. 3. Diagnostik (39-64) Vorbemerkungen Das Ziel des verhaltensdiagnostischen Vorgehens besteht in einer präzisen Beschreibung der einzelnen Ebenen der Angstreaktionen und in einer Erklärung der Ängste vor dem Hintergrund der individuellen Bedingungen des einzelnen Patienten. Erklärungen in der Verhaltensdiagnostik haben den Charakter von hypothetischen Bedingungsmodellen. Der Therapeut sollte es nach einigen wenigen Therapiesitzungen explizit zu Papier bringen. Gegenüberstellung pragmatischer Unterschiede von klassischer und funktionaler Diagnostik: Klassische Diagnostik Verhaltensdiagnostik Norm-orientiert, d.h. Bezug zu überindividuellen (normativen) Gesichtspunkten Annahme weitgehend stabiler Persönlichkeitseigenschaften („trait-Ansatz“) z.B. Ängstlichkeit An individuellen Gesichtspunkten und Kriterien orientiert Annahme einer Situationsabhängigkeit/Interaktionistische Modelle (z.B. ängstliches Verhalten einer Person in Situation x) Zeichen-Ansatz, d.h. eine Testantwort gilt als Stichprobenansatz, d.h. beobachtete Reaktionen Hinweis auf ein spezielles Persönlichkeitsmerkmal sind eine Auswahl aus ähnlichen Reaktionsmustern Ziel: Erfassung globaler und allgemeiner Ziel: Erfassung spezifischer Verhaltens-Muster Merkmale auf unterschiedlichen Ebenen Diagnostik mit „Erkenntnis“-Anspruch „assessment“, d.h. Beurteilung von Verhalten 3.1 Diagnostik von Angststörungen im DSM-III-R (APA, 1987): Grundlage für eine funktionale Analyse? (40-43) Im Vergleich zu älteren Klassifikationssystemen bzw. zu Alternativen im ICD-10 erfolgt die Klassifikation von Ängsten im DSM-III-R stark deskriptiv orientiert. Theoretische Gesichtspunkte treten in den Hintergrund, weil die Ätiologie einzelner Störungen weitgehend offen ist. Für Verhaltensdiagnostiker haben die Klassifikationen den Charakter von Kürzeln: Sie dienen zur Kennzeichnung einer heterogenen Klasse von Merkmalen auf der Verhaltens-, der kognitiven und der physiologischen Ebene. Sehr positiv bewertet wird die Tatsache, dass im DSM-III-R nicht mehr von „Neurosen“ gesprochen wird. Ansonsten werden die Unterschiede zwischen DSM und ICD für Angststörungen als nicht grundlegend bewertet. Das Ziel der Verhaltensdiagnostik geht über die Klassifikation hinaus: Es sollen diejenigen individuellen und spezifischen Verhaltensweisen einerseits und die situativen Bedingungen andererseits, die für die Aufrechterhaltung der Phobien verantwortlich sind, identifiziert werden. 3.2 Funktionale Analyse (43-53) Die zentralen Fragen für das verhaltensdiagnostische Vorgehen sind nach Kanfer & Saslow (1965): (1) Unter welchen Bedingungen wurde das Verhalten erworben und welche Faktoren halten es momentan aufrecht? (Problemanalyse) (2) Welche spezifischen Verhaltensmuster bedürfen einer Veränderung in ihrer Auftrittshäufigkeit, ihrer Intensität, ihrer Dauer oder hinsichtlich der Bedingungen, unter denen sie auftreten? (Zielanalyse) 8 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] (3) Welches sind geeignete praktische Methoden, um angestrebte Veränderungen bei einer Person zu erzielen? (Therapieplanung) Problemanalyse Für die erste Phase des Kontaktes mit Patienten sollten folgende Fragen geklärt werden: (1) Warum kommt der Patient mit seinen Beschwerden gerade jetzt und warum gerade zu mir? (2) Welche Erwartungen bringt der Patient mit und welche Annahmen verbindet er mit Psychotherapie? (3) Über welche psychotherapeutischen Vorerfahrungen verfügt der Patient? (4) Wie lange Zeit besteht die Phobie des Patienten, welche Schwankungen gibt es im Verlauf der Störung? (5) Wie kommt der Patient mit seinen diversen Einschränkungen bisher zurecht? Damit gewinnt der Therapeut eine erste Übersicht, und er erhält wichtige Hinweise für die Therapieplanung. Für die funktionale Analyse phobischen Verhaltens kann der Aspekt der Präzisierung auslösender Bedingungen und der einzelnen Facetten der konkreten Angstreaktionen nicht genug betont werden. Gemeinsam sollten möglichst alle Situationen identifiziert werden, in denen die einzelnen Angstreaktionen auftreten. Dies ist wichtig für die individuelle Problemanalyse, die weit über die Klassifikation der Störung hinaus geht. Die Schaffung eines für den Patienten plausiblen Verständnisses der Therapie ist hierbei von ausschlaggebender Bedeutung. Exkurs: Zur Rolle der Genese Viele Patienten messen dieser genetischen Analyse eine Art Schlüsselfunktion zu: Erst wenn eine Klärung der „Ursachen“ der Angst erfolgt ist, lasse sich die Angst zielführend und dauerhaft behandeln. Bei der Erfassung der Genese sollten zwei Aspekte unterschieden werden, deren ungenaue Betrachtung bzw. Verwechslung zu vielen Kontroversen beiträgt: (1) Es ist aus wissenschaftslogischen Gründen niemals möglich, die Genese eines Problems zu erfassen. Als „Ursachen“ müssen alle Determinanten angesehen werden, die zum Auftreten des Problems beigetragen haben. Niemand kann jedoch die Entstehung von Phobien beobachten. Die Schilderungen des Patienten sind immer retrospektiv und somit mindestens z.T. verzerrt, und ausserdem bestehen sie aus einer Mischung aus Erinnerungen und Erklärungen (Attributionen) der Ursachen. Trotzdem ist diese Erfassung von Bedeutung, da die Aussagen zumindest Heurismen für die ätiologische Forschung abgeben. (2) In therapeutischer Hinsicht ist die Analyse der Genese einer Phobie für den einzelnen Patienten deshalb höchst bedeutsam, weil sie dem Erklärungsbedürfnis des Menschen entspricht. Es ist höchst besorgniserregend und aversiv, wenn man verschiedene Empfindungen, Schmerzen, psychophysiologische Veränderungen etc. nicht einordnen und erklären kann. Wichtige Aspekte für die Vermittlung eines plausiblen Modells sind Transparenz des verhaltensdiagnostischen und therapeutischen Vorgehens und die Verständlichkeit bei der Vermittlung der psychologischen/psychotherapeutischen Denkweise. Das Ziel besteht darin, dass der Patient die wesentlichen Elemente des Modells begreift und übernimmt, so dass er selbst in der Lage ist, zur Veränderung seines Problems beizutragen. Zielanalyse Die Frage der Präzisierung von Zielzuständen muss explizit von der deskriptiven Verhaltensanalyse getrennt werden. Aus der Beschreibung und funktionalen Analyse (Bedingungs- 9 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] Modell) ergibt sich keineswegs direkt eine Zielklärung, weil in die Ziele einer Veränderung notwendigerweise normative Komponenten eingehen. Viele Patienten wollen einfach wieder so werden wie früher, dies ist jedoch ein unmögliches und sehr unpräzises Ziel. Die explizite Zielbestimmung ist auch dazu da, damit Patient und Therapeut dasselbe Ziel verfolgen. Therapieplanung In die Planung des therapeutischen Vorgehens fliessen praktisch alle Daten und Überlegungen aus der Verhaltens-Analyse und Zielbestimmung mit ein. Dazu kommt das Hintergrundwissen des Therapeuten über ätiologische Modelle von Ängsten sowie über prinzipiell mögliche Strategien der Therapie. Prinzipien für eine konkrete Therapieplanung: - - Berücksichtigung der Ziele des Patienten / Präzise Zielfestlegung (evtl. mit einzelnen Schritten) als Voraussetzung für Veränderung / Klärung, ob die Motivation zur Veränderung gesichert ist. „primum non nocere“ / Überlegungen, ob Verfahren (kurzfristig / langfristig) schädigende (Neben-) Effekte haben könnten. Auch: Berücksichtigung von Aspekten des Aufwands, der Kosten und des Nutzens von Interventionen. Auswahl effizienter Strategien, nicht nur vor dem Hintergrund subjektiver Präferenzen des Therapeuten / Nach Möglichkeit Berücksichtigung von Präferenzen des Patienten / Prinzip: Veränderung als Prozess, Berücksichtigung des Vorgehens in kleinen Schritten / Berücksichtigung des Prinzips der Grenzen von Veränderungen. Prinzip der minimalen Intervention (Kanfer, 1975), d.h., Nutzung von Selbsthilfemöglichkeiten des Patienten / Hilfe zur Selbsthilfe / vgl. auch Argumente zur Kurzzeittherapie. Maximale Transparenz der einzelnen Therapieschritte: Information des Patienten über das Vorgehen / Selbst gesetzte Ziele des Patienten als wichtige motivationale Bedingung / Grenzen der Transparenz z.B. auch im Rahmen der Gesprächsführung (vgl. etwa paradoxe Interventionen). Berücksichtigung von Rahmenbedingungen der Intervention / d.h. keine unrealistischen Planungen ... / Berücksichtigung der Lebenssituation des Patienten, der Finanzierung von Psychotherapie / Planung von Hilfsmitteln / Ko-Therapeut / In vivo Übungen etc. Notwendigkeit von Evaluation der einzelnen Schritte / therapiebegleitende Diagnostik (sensibel gegenüber Veränderungen / Feinsteuerung bei Misserfolgen – nicht einfach „herumprobieren“ ...). 10 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] 3.3 Datenquellen und Instrumente (53-64) Damit keine Aspekte der Störung vernachlässigt werden, sollte sich der Diagnostiker keinesfalls nur auf eine Ebene der Datenerfassung stützen. Ein Rückgriff auf Verfahren der klassischen Diagnostik (Persönlichkeitstests etc.) wird in der Verhaltenstherapie als nicht zielführend angesehen, da das Ziel ist, möglichst präzise, verhaltensnahe und auf spezielle Situationen bezogenen Beschreibungen von Angstreaktionen auf verschiedenen Ebenen zu erfassen. 3.3.1 Verhaltensdiagnostische Exploration (54-55) Am Beginn der Datenerhebung steht die verhaltensdiagnostische Exploration der vom Patienten berichteten Beschwerden. Der Therapeut stellt immer präzisere und detailliertere Fragen (Prozess der „Trichterung“). Als Leitfaden dient das theoretische Wissen des Therapeuten, vor dessen Hintergrund Informationen gesammelt, geklärt und schliesslich zu einem Gesamtbild aggregiert werden (idealerweise in einem hypothetischen Bedingungsmodell). 3.3.2 Strukturierte klinische Interviews (55-56) Die Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-III-R enthalten präzise Kriterien für das Vorliegen bzw. den Ausschluss einer psychischen Störung. Als besondere Merkmale strukturierter klinischer Interviews sind folgende Aspekte anzusehen (Wittchen & Uhland, 1991): (1) Präzise Angaben von diagnostischen Kriterien für einzelne Störungen; (2) Berücksichtigung von Verlaufsaspekten der Störung; (3) Kriterien zur Abgrenzung einzelner Störungen; (4) Methodologischer Aspekt: Bezug zu gut erfassbaren Merkmalen; (5) „Theoretische Indifferenz“, die eine Interpretation überflüssig macht; (6) Wie in den DSM-III-Achsen werden sowohl der Schweregrad der Störung als auch psychosoziale Merkmale berücksichtigt. 3.3.3 Verhaltensbeobachtung (56-57) Die Erhebung von Daten durch direkte Beobachtung ist insofern eine ganz entscheidende Informationsquelle, als (a) die spätere Intervention selbst vorwiegend am Verhalten (im weitesten Sinne) ansetzt und (b) Veränderungen auf der Verhaltens-Ebene als entscheidende Kriterien der Therapie angesehen werden. Idealerweise sollte die Erfassung des Verhaltens durch direkte und möglichst systematische Beobachtung erfolgen, was praktisch sehr schwierig ist. Gut ist z.B. eine Stichprobe des Kriteriumsverhaltens in einer natürlichen Situation; sie liefert für die Verhaltensdiagnostik und Interventionsplanung häufig unschätzbare Daten. Bei einer solchen Exposition kann eine Reaktivität auftreten: Das Verhalten tritt nicht oder nur in verzerrter Form auf. Solche reaktiven Effekte sind zwar therapeutisch erwünscht, stellen aber für eine reliable und valide Datenerhebung ausgesprochene Störquellen dar. 3.3.4 Selbstbeobachtung und Selbstaufzeichnung (57-59) Die Selbstbeobachtung stellt eine Ergänzung der direkten Beobachtung dar. Ein grosser Vorteil besteht darin, dass dies eine erste Stufe auf dem Weg zu einer effektiven Selbstregulation des Patienten darstellt. So wird der Patient schon früh am therapeutischen Prozess beteiligt und entwickelt dabei Eigenaktivität und Eigenverantwortung. 3.3.5 Situations-Verhaltens-Test (59-60) Dies sind standardisierte Verfahren, die sehr genau den theoretischen Prinzipien eines verhaltenstheoretischen Ansatzes entsprechen, nämlich der Situationsabhängigkeit von Verhaltensmustern. Hauptgegenstand der Erfassung und Beobachtung ist der Grad der 11 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] Annäherung bzw. des Vermeidungsverhaltens gegenüber der spezifischen Situation. Standardisierte Verhaltens-Tests haben insbesondere für Forschungsprojekte grösste Bedeutung; hier ist es unabdingbar, präzise und möglichst objektive Stichproben des Kriteriumsverhaltens festzulegen und deren Veränderungen im Verlaufe einer Intervention zu erfassen. 3.3.6 Externe Datenquellen (60) Sie sind eine wichtige Ergänzung; z.B. objektive Daten über bisherige Klinikaufenthalte, die berufliche Situation usw. Weitere Daten kommen z.B. von relevanten Bezugspersonen. Hausärzte oder Vorgesetzte können die soziale Bedeutung eines Therapieeffektes häufig präziser einschätzen als der Patient oder der Therapeut. Der Rückgriff auf externe Daten darf nicht hinter dem Rücken des Patienten erfolgen, es muss sein Anliegen sein, seine eigenen Angaben zu präzisieren. 3.3.7 Rollenspiel (60-61) Ein Rollenspiel bietet einen gewissen Ersatz für direkte Beobachtungen. Es ist anders zu bewerten als der Bericht des Patienten, weil er anstatt über die Situation gewissermassen aus der Situation heraus berichtet. Für den Einstieg in ein Rollenspiel muss der Patient von bisherigen Mustern der automatisierten Informationsverarbeitung weg kommen. Kontrollierte Informationsverarbeitung bedeutet, dass der Patient sich sehr konkret und detailliert mit der Situation auseinandersetzt. So können Denk- und Verhaltensmuster umstrukturiert werden. 3.3.8 Standardisierte Inventare und Skalen (61-62) In der Verhaltensdiagnostik gibt es relativ wenige standardisierte Messinstrumente zur Erfassung von Ängsten und Phobien, weil eine vergleichende Erfassung in diesem Themenbereich gar nicht das Ziel der Bemühungen darstellt. Ein anderer Grund dafür ist, dass die Validierung grosse Probleme bereitet. Man hält sich deswegen oft an die Augenscheinvalidität. Standardisierte Verfahren bilden in der Praxis eher die Rolle von ScreeningVerfahren. Oft erfolgt keine standardisierte Auswertung: Der Therapeut bespricht mit dem Patienten die ihm wichtig erscheinenden Punkte. 3.3.9 Psychophysiologische Erhebungsverfahren (62-64) Praktisch arbeitende Therapeuten sollten mit psychophysiologischen Merkmalen von Phobien sehr fundiert vertraut sein. Einige praktikable, wenig aufwendige Erhebungsmethoden sind: - Erfassung durch externe Beobachtung: Diese bietet sich insbesondere bei relativ gut erfassbaren, grobe Merkmalen an, z.B. Erröten, starkes Schwitzen usw. - Physiologische Parameter weisen eine Reihe relativ gut beobachtbarer VerhaltensKorrelate auf, z.B. „Schmerzverhalten“, hilfesuchendes Verhalten, Medikamentenverbrauch usw. - Selbstbeobachtung (muss trainiert und genau instruiert werden). Ängste dürfen nie nur als psychische Probleme gesehen werden. Es muss dem Patienten aber klar gemacht werden, dass Therapie darin besteht, dass der Patient konkret erlebt, dass mit dem neuen Verhalten nicht die von ihm befürchteten Katastrophen verbunden sind. 12 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] 4. Phobien: Theoretische Modelle (65-101) Der Autor warnt vor der fatalen Trennung in Kognitionen und Verhalten; die Unterscheidung auf der Gegenstands-Ebene muss keinesfalls eine entsprechende Unterscheidung auf der theoretischen Ebene (Erklärungen) nach sich ziehen. Es gibt bis heute kein einheitliches und umfassendes theoretisches Modell der Phobien. Als Erkenntnisquellen kommen praktisch alle aus der klinisch-psychologischen Ätiologieforschung bekannten Ansätze in Frage. 4.1 Klassische Angsttheorien: Das Modell von MOWRER (66-75) Das Zwei-Faktoren-Modell von Mowrer (1939, 1947) besitzt eine hohe integrative Funktion und hat sich als heuristisch äusserst fruchtbar herausgestellt. Vorläufer I. P. Pawlow (1927) befasste sich mit „experimentellen Neurosen“ bei Tieren. Er stellte fest, dass sie auf drei Arten erzeugt werden können: (1) Durch extreme Stimuli, die zu einer Überforderung des kortikalen Erregungsprozesses führen (im Prinzip eine Art Trauma-Theorie); (2) Durch extrem starke kortikale Hemmungsprozesse, die die Ausbildung von adäquaten Anpassungsreaktionen verhindern (im Sinne von Lern- und Verhaltensdefiziten); (3) Durch Überforderung von Erregungs- und Hemmungsprozessen, die vor allem durch extrem schwierige Diskriminationsleistungen hervorgerufen werden können (eine Art Konflikt-Modell). Die Übertragbarkeit dieser experimentellen Befunde auf menschliches Verhalten wurde immer wieder kritisiert. Insbesondere psychologische Konfliktmodelle (Dollard & Miller, 1950) lassen sich jedoch z.T. direkt auf die Neurosentheorie von Pawlow zurück führen. O. H. Mowrer Er hat das Zwei-Faktoren-Modell der Entstehung und Aufrechterhaltung von Ängsten entwickelt. Der Rahmen dieses Modells eignet sich in höchstem Masse für verschiedene Ergänzungen und Aktualisierungen im Lichte neuer theoretischer und experimenteller Befunde. Grundannahmen Es können nicht nur unbedingte Situationen die Funktion von Auslösern der Angstreaktionen übernehmen; durch eine raum-zeitliche Koppelung neutraler Stimuli (NS) mit der ursprünglich angstauslösenden Situation (UCS) können diese neuen Situationen selbst die Funktion der Auslösung von Angst übernehmen – sie werden zu konditionierten Stimuli (CS). Durch Generalisierung können ähnliche Stimuli ebenfalls eine Angstreaktion auslösen. Dieser erste Faktor Mowrers entspricht dem Prinzip des klassischen Konditionierens. Die Koppelung von CS und CR gewinnt im Laufe der Zeit insofern „funktionelle Autonomie“, als damit eine Bildung eines sekundären Angst-Triebes verbunden ist. Zu dieser Stabilisierung kommt es durch den zweiten Faktor: Verhaltensweisen zur Reduktion von Angst werden sehr effizient (negativ) verstärkt. Der nunmehr konditionierte Angstauslöser (CS) führt zu sehr raschen und stabilen Vermeidungsreaktionen, die durch das Ausbleiben der (erwarteten) aversiven Reaktion (UCR, Angst, Schreck, Schmerz...) negativ verstärkt werden. Eine Löschung ist unmöglich, weil das Individuum nicht mehr prüft, ob die traumatischen Beziehungen noch bestehen. 13 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] Freud (1926) hatte in seiner zweiten Angsttheorie ebenfalls eine Art Signal-Modell entwickelt: Im Prinzip fürchtet das Individuum unbewusste Gedanken, Impulse etc. (ES-Angst); der Phobiker zeigt allerdings eine Angst-Reaktion auf verschiedene Items, d.h. es handelt sich um eine Art „Verschiebung“ der Angst. Die Auswahl der phobischen Items erfolgt nach klassisch-psychoanalytischer Auffassung anhand des Symbolcharakters dieser konkreten Situationen (z.B. Höhen, Enge, weite Plätze, Spinnen, Katzen, Messer). Wenn diesen Symbolen der mystische Charakter genommen und dafür das Konzept einer semantischen Verknüpfung eingesetzt wird, gelangt man zu den modernen Lerntheorien (Rescorla, 1988; Rachman, 1991; Rapee, 1991; Reiss, 1991). Empirische Belege (1) In Laborexperimenten mit Tieren wurden durch aversive Konditionierung entsprechende Flucht- und Vermeidungsreaktionen ausgelöst, die sich nach dem Zwei-Faktoren-Modell gut erklären lassen. Es bleibt die Frage der Übertragbarkeit auf die Situation ausserhalb des Labors und auf Menschen. (2) Retrospektive Untersuchungen von Personen unter traumatischen Bedingungen (z.B. von Piloten im Zweiten Weltkrieg): Entgegen der Erwartungen gemäss Zwei-FaktorenModell kommt es in den meisten Fällen nicht zu einer Angststörung. (3) Relativ konsistente Hinweise gibt es aus dem Bereich der Aversionstherapie: Aversive Vermeidungsreaktionen (auch auf verschiedenen Ebenen physiologischer Prozesse) zeigen sich gegenüber dem Zielstimulus (z.B. Alkohol) als Folge einer entsprechenden Kon- 14 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] ditionierungsprozedur. Diese Befunde stützen besonders den ersten Faktor von Mowrers Modell. (4) Auch die Geschmacks-Aversion wird als partieller Beleg herangezogen. Sie sind deshalb so stabil, weil Konfrontationen vermieden werden. (5) Befunde aus der klinischen Praxis: Patienten geben oft ein oder mehrere traumatische Ereignisse als den Beginn ihrer Ängste an. Diese Angaben sind als UrsachenZuschreibungen (Attributionen) anzusehen. Die Life-Event-Forschung zeigt, dass nicht alle Belastungen zu Phobien führen; entscheidend ist offenbar die Bewertung der Situation als gefährlich. Fazit: Phobien können durch klassisches Konditionieren erworben werden, und operante Faktoren spielen bei der Aufrechterhaltung eine wichtige Rolle. Da das Modell von Mowrer jedoch nicht alle Phobien und deren Aufrechterhaltung erklären kann, muss es auch andere Mechanismen geben. Schwächen und Probleme (1) Klare Konditionierungs-Bedingungen führen keineswegs geradlinig zur Entwicklung einer Phobie. Mögliche Faktoren sind hier individuelle Differenzen, die Interpretation der Bedrohung und die Möglichkeit zu aktivem, zielgerichteten Handeln. (2) Die Vermeidungsreaktionen in der Aversionstherapie sind nicht unbedingt im Sinne der phobischen Reaktion zu sehen. Marks & Gelder (1967) sprechen eher von einer Indifferenz gegenüber dem Stimulus (z.B. Alkohol). (3) Die stillschweigend unterstellte Äquipotenzannahme muss als unzutreffend angesehen werden: Als Stimuli (CS) kommen nur solche mit einer gewissen biologischen Relevanz („preparedness“) in Frage. Neuere Befunden haben gezeigt, dass Phobien offenbar auch entwickelt werden können, wenn CS und UCS zeitlich und räumlich getrennt sind; entscheidend ist offenbar eine gewisse „Zusammengehörigkeit“ (dieselbe Modalität). (4) Emotionale Reaktionen (wie Ängste) lassen sich offenbar auch erwerben, ohne dass das Individuum selbst in Kontakt mit der aversiven Situation gerät. (5) Die (retrospektiven) Angaben von Patienten über die Entstehung ihrer Phobien können nicht als valide Belege für das theoretische Modell von Mowrer (1947) angesehen werden. Trotzdem ist es für Patienten wichtig, über eine plausible Erklärung ihrer Phobie zu verfügen. Diese Befunde widerlegen das Modell von Mowrer nicht im klassischen Sinne. Es erklärt viele Phobien zumindest partiell. 4.2 Neuere Lerntheorien (75-83) Eysenck (1979; 1987) unterscheidet zwischen einer Typ-A- und einer Typ-B-Konditionierung. Für Typ-A sind folgende Merkmale kennzeichnend: 1) UCS und CS sind verschieden (z.B. unterschiedliche Sinnesmodalität); 2) Der UCS löst nur Teile der UCR aus, und 3) Motivationale Bedingungen (z.B. Hunger) sind entscheidende Voraussetzungen für den Lernprozess. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Konditionierung des Speichelflusses. Für Typ-B sind folgende Merkmale kennzeichnend: 1) UCS ist dem CS sehr ähnlich (zumindest betrifft dies dieselbe Sinnesmodalität); 2) Der UCS löst die gesamte UCR aus, und 3) Der UCS besitzt motivationale Eigenschaften (z.B. traumatische Bedingungen, die für den Organismus Bedeutung besitzen. Beispiel aversive Konditionierung: Die Darbietung eines aversiven Reizes (UCS) beinhaltet die gleichzeitige Präsentation von verschiedenen konditionierten Stimuli (CS, z.B. Geruch, 15 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] Geschmack,...). Da die UCR (bzw. die mit ihm sehr ähnliche CR) für das Individuum ebenfalls stark aversiven Charakter besitzt, ist jede Darbietung eines CS zugleich mit unangenehmen emotionalen Komponenten verknüpft (eine Stimulus-Komponente der CR). Diese aversive Komponente der CR wirkt – auch in Abwesenheit vom UCS – als „Verstärker“ der CS im Sinne des Klassischen Konditionierens (Kimble 1961). Eysenck (1968) hat diesen Prozess als Inkubation bezeichnet. Die Unterscheidung in Typ-A- und Typ-B-Konditionierung bedeutet einen Fortschritt, da damit verschiedene Bedingungen auf situativer bzw. auf motivationaler Ebene ausdifferenziert und präzisiert werden. Die Konditionierung nach dem Typ-B hat grösste Relevanz für die Erklärung von Prozessen der interozeptiven Konditionierung (Hochschaukelungsprozesse bei Körper- und Organ-bezogenen Phobien). Hier bildet die physiologische Reaktion (CR) gewissermassen als noxischer, aversiver Reiz (S‾) eine kontinuierliche Verstärkung derjenigen konditionierten Situation (CS), die den Auslöser für die CR bildet. Revusky & Garcia (1970) fanden den GARCIA-Effekt: Versuchstiere lernten eine Koppelung zwischen dem CS und dem dazugehörigen unkonditionierten Stimulus. Dieser Befund stellt insofern eine Herausforderung für die klassische Lerntheorien dar, als 1) eine mögliche Koppelung über längere Zeiträume demonstriert wurde; 2) Die Koppelung nicht mit dem zeitlich und räumlich nächsten, sondern mit einem dazugehörigen Stimulus erfolgte. 16 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] Für das Lernen ist offenbar nicht Kontiguität (zeitlich und räumlich gemeinsam auftretende Ereignisse) entscheidend, sondern Kontingenz, d.h. inwiefern das Auftreten eines Stimulus (CS) eine Veränderung der Wahrscheinlichkeit eines anderen Stimulus (UCS) vorherzusagen in der Lage ist. Die Zusammengehörigkeit hat offenbar eine ganz zentrale biologischevolutionäre Wurzel. Rescorla (1988) ist ein typischer Vertreter eines modernen Verständnisses von Konditionierungsprozessen. Er sagt, Konditionierung bedeute das Lernen von Beziehungen zwischen Ereignissen. Eine dieser Beziehungen ist die Kontiguität. Lernprozesse müssen selektiv sein, andernfalls würde der Organismus eine sozusagen unsinnige Menge irrelevanter Assoziationen lernen. Entscheidend am Aspekt der Kontingenz ist die Information, die ein CS für einen UCS liefert. Klassisches Konditionieren kann somit als Prozess der Informationsverarbeitung und der Hypothesenprüfung angesehen werden. Bei der Entstehung von Phobien sollte eine Trennung (Unterscheidung) in Prozesse der „Kognition“ und der „Konditionierung“ vorgenommen werden. Hier gilt es, den Aufwand zu berücksichtigen, der bei der Informationsverarbeitung notwendig ist. Nach Shiffrin & Schneider (1977) erfolgt die Orientierung des Organismus a) automatisiert, wenn verschiedene Verarbeitungsmuster gewissermassen „eingeschliffen“ sind, wenn die Verarbeitung rasch, durch Rückgriff auf das Kurzzeitgedächtnis erfolgt und insgesamt wenig Aufmerksamkeit erfordert; b) kontrolliert, wenn eine Neuorientierung erforderlich ist, wenn eine langsame, serielle Informationsverarbeitung ansteht und wenn hohe Aufmerksamkeit verlangt ist, weil die neue Information erst beurteilt, bewertet und verarbeitet werden muss. Erwartungen spielen bei der Entstehung und Stabilisierung von Phobien eine ausschlaggebende Rolle, weil sie die Prozesse der Informationsverarbeitung steuern. Die Betroffenen entwickeln eine Angst-Sensitivität; die Erwartung einer Schädigung ist die Quelle der Angst. Das angeführte Verständnis von „Lernen“ als die aktive Schaffung von (problematischen) Verknüpfungen zwischen Ereignissen muss man als eingebettet in emotionale und motivationale Prozesse sehen (Mowrer, 1947; Rachman, 1990). Die Prozesse, nach denen Phobien erworben werden, sind für „sinnvolle“ und „sinnlose“ Ängste dieselben. Es gibt die Vermutung, dass Organismen im Laufe ihres Lebens viele problematische Verknüpfungen lernen; im Sinne eines Angst-Hemm-Systems jedoch werden diese Ängste relativ rasch gelöscht oder bewältigt. Klassisches Konditionieren als Prozess der Hypothesenprüfung und Informationsverarbeitung bildet zwar ein fundiertes Verständnis von Lernprozessen; dennoch bildet dies nur einen Aspekt einer Phobientheorie. Sicherheits-Signal-Hypothese Diese Ergänzung zum Zwei-Faktoren-Modell von Mowrer bildet einen wichtigen Bestandteil zur Erklärung der agoraphobischen Symptomatik. Ein Kennzeichen agoraphobischen Verhaltens besteht offenbar in der Suche nach Sicherheit angesichts vieler bedrohlicher Situationen. Als Sicherheitssignale dienen den Betroffenen sowohl konkrete Gegenstände und befreundete Personen, als auch spezielle Verhaltensmuster (Fertigkeiten usw.). Die Tatsache, dass viele Ängste erst durch kontinuierliche Übung und Bewältigung überwunden werden und damit entsprechende Fertigkeiten zu Sicherheitssignalen werden, spielt sowohl für die Entwicklung, als auch für die Behandlung von Phobien eine wichtige Rolle. Z.B. eine Frau, die lange Zuhause war und durch fehlende Übung soziale Fertigkeiten verloren hat, entwickelt nun aus ihrer Hilflosigkeit eine Agoraphobie. Der Therapeut stärkt diejenigen Fertigkeiten des Patienten, die ihm Sicherheit bieten. Die verschiedenen effizienten Verfahren zur Behandlung von Phobien haben als ein wichtiges gemeinsam Element offenbar 17 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] die Ausdehnung des Verhaltensspielraums, das Neulernen von Verhaltensstrategien und damit eine Zunahme von Sicherheit. Dies bedeutet auch, dass der Patient seine bisherigen vermeintlich zielführenden Verhaltensmuster aufgibt, weil sie den Kreislauf von Angst und Vermeidung aufrechterhalten (Gray, 1971). 4.3 Theorie der Preparedness (83-90) Die Theorie der Preparedness (Seligman, 1971) versucht, einen Beitrag zur Klärung der Probleme mit der Äquipotenzannahme (nicht alle neutralen Stimuli können Phobien auslösen) und der Selektivität von Phobien (Phobien sind nicht gleichverteilt) zu leisten. Sie versucht dem Umstand Rechnung zu tragen, dass alle Lernprozesse als biologisch eingebettet gesehen werden müssen (Marks, 1987). Preparedness meint die Art und Weise, in der eine Verknüpfung zwischen Stimuli bzw. zwischen Stimuli und Reaktionen geschaffen wird. Die Theorie geht von der Annahme aus, dass die Evolution die Organismen in einer Weise ausgestattet hat, die ihr Überleben erleichtern; dazu gehört u.a. auch, bestimmte Relationen in einer komplexen Umgebung leichter wahrzunehmen und zu erlernen, weil sie sich als biologisch-evolutionär bedeutsam herausgestellt haben. Seligman erarbeitete vier Annahmen: (1) Charakteristika des Erwerbs von Phobien; (2) Die sogenannte „Irrationalität“ von Phobien; (3) Merkmale der Zusammengehörigkeit von CS und CR; und (4) Die hohe Löschungsresistenz phobischer Reaktionen. ad (1): Merkmale des Erwerbs von Phobien Dies betrifft die Annahme, dass es unter evolutionärem Gesichtspunkt sehr sinnvoll ist, wenn bedeutsame Verknüpfungen rasch (z.T. in einem Durchgang) gelernt werden. Dafür spricht, dass für den Erwerb verschiedener Phobien eine altersspezifische Vulnerabilität existiert. Anmerkung: Der Begriff der „preparedness“ ist vom Konzept der „Prägung“ zu unterscheiden: Während „preparedness“ vor allem die Fähigkeit von Organismen meint, rasche und stabile Verknüpfungen zwischen Situationen zu bilden, versteht man unter „Prägung“ einen Lernprozess innerhalb sensibler Phasen. Prägung bezieht sich auf einen speziellen Auslöser (z.B. Mutterfigur) und ist praktisch irreversibel (Lorenz, 1981). ad (2): Zur „Irrationalität“ von Phobien Gemeint ist damit die Tatsache, dass das Individuum um die Ungefährlichkeit einer Situation (kognitiv?) Bescheid weiss, dass es sich angesichts der phobischen Situation aber ängstlich verhält. Die meisten Phobien sind durch rationale Argumentation kaum zu beeinflussen, was auf eine biologisch-evolutionäre Relevanz der Ängste und auf die Bildung von Assoziationen schliessen lässt. „Irrational“ ist aus heutiger Sicht nicht der richtige Begriff: Der Patient hat in der entsprechenden Situation nicht die Wahl, sich in die Situation zu begeben; es ist sinnvoll davon auszugehen, dass sein Verhalten (Angst, Vermeidung) und sein Denken (Kognitionen, Wissen) von unterschiedlichen Systemen gesteuert werden. Bei vielen Phobien hat man es mit automatisierter Informationsverarbeitung zu tun, die durch Argumentation, Überzeugung oder kontrollierte Verarbeitung nur sehr schwer in den Griff zu bekommen ist. ad (3): Merkmale der Zusammengehörigkeit von Stimuli Bestimmte Verknüpfungen zwischen Stimuli werden offenbar sehr rasch gelernt und können auch erfolgen, wenn das Intervall zwischen den beiden Situationen sehr lang (Minuten bis Stunden) ist. Das Selektionskriterium besteht nach Seligman (1971) darin, inwiefern eine spezifische Situation evolutionäre Relevanz für den prä-technologischen Menschen besitzt. 18 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] Neueren Überlegungen zufolge besitzt der Mensch eine biologische Disposition, bestimmte Merkmale besonders rasch als „gefährlich“ zu erkennen. Solche Merkmale sind z.B. Fortbewegungsarten und Formen, die der menschlichen sehr unähnlich sind. Unerklärt ist allerdings, warum es kaum Phobien vor einigen sehr ungewöhnlichen Tierformen gibt (Octopuss, Seepferdchen usw.). Insgesamt kann man festhalten, dass Ängste mit biologischer Relevanz überrepräsentiert sind. ad (4): Löschungsresistenz In der Theorie der Preparedness spielt die Löschungsresistenz eine sehr wichtige Rolle. Sie wird als Hinweis dafür gesehen, dass Phobien eine biologisch-evolutionäre Relevanz besitzen (Seligman, 1971). Heute ist man der Meinung, dass Phobiker Löschung (exposure) vermeiden, z.B. wegen eines sekundären Krankheitsgewinns. Unter echten therapeutischen Bedingungen zeigt sich diese Löschungsresistenz gerade nicht. Resümee Man muss aufpassen, dass man erstens wegen der hohen Plausibilität der Theorie nicht auf empirische Belege verzichtet, und man zweitens keine zirkuläre Argumentation betreibt (abgekürzt: Preparedness -> Löschungsresistenz bzw. Löschungsresistenz -> Preparedness). Zusammengefasst sprechen viele Argumente dafür, dass es eine menschliche Prädisposition gibt, auf die Wahrnehmung von unerwarteten und neuen Situationen entsprechend rasch zu reagieren. 4.4 Psychophysiologische Modelle (90-96) Dass Ängste nicht nur das kognitive und Verhaltenssystem betreffen, zeigt sich auf unterschiedlichen somatischen Ebenen: - Kardiovaskuläres System (z.B. Schwitzen, Herzrasen,...) - Gastro-intestinales System (z.B. Durchfall, Bauchschmerzen,...) - Genitalsystem (z.B. Urindrang, Menstruationsstörungen,...) - Atmungssystem (z.B. Kloss im Hals, Hyperventilation,...) - Neuromuskuläres System (z.B. Zittern, Missempfindungen,...) Die Voraussetzung einer Betrachtung körperlich-somatischer Aspekte von Phobien besteht in der Drei-Ebenen-Analyse: (1) subjektiv-verbale Ebene, (2) motorisch-verhaltensmässige Ebene, (3) physiologisch-somatische Ebene. Psychophysiologische Komponenten von Phobien Als für die Phobien wichtigsten Ebene gelten: (1) Elektrodermale Veränderungen: V.a. Schwankungen und Fluktuationen der Hautleitfähigkeit (2) Kardiovaskuläre Veränderungen: V.a. die objektive und die subjektiv wahrgenommene Veränderung der Herzrate, des Blutdrucks und des peripheren Blutdrucks. (3) Veränderung der Atemfunktion: Hängt mit (2) zusammen; beide sind von der sympathischen und parasympathischen Innervation beeinflusst. Häufig diskutiert wird die Rolle der Hyperventilation, sowohl als Ursache als auch als Folge von Phobien. Der Interaktion von psychophysiologischen Aspekten mit Merkmalen der Wahrnehmung und Bewertung sowie der Motorik kommt grösste Bedeutung für die Entstehung, den Verlauf und die Therapie phobischer Beschwerden zu. 19 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] Biologische Merkmale Der Autor weist auf die Relevanz des adrenergen Systems für die Aktivierung von Angst hin. Bei Angstpatienten ist die Konzentration von Epinephrin und Norepinephrin (Neurotransmitter, die an der Übertragung von Nervenimpulsen beteiligt sind) deutlich erhöht. GABA-Rezeptoren (Gamma-Amino-Butter-Säure; hemmendes Transmittersystem) sind den Benzodiazepin-Rezeptoren sehr ähnlich; die körpereigenen GABA-Rezeptoren besitzen offensichtlich eine Schlüsselfunktion für die angsthemmende Wirkung von Benzos. Es spricht einiges dafür, dass Strukturen des limbischen Systems an der Angstreduktion entscheidend beteiligt sind. Möglicherweise muss von zwei unterschiedlichen endokrinologischen Komponenten der Angst und der Phobien ausgegangen werden: Das noradrenerge System, welches eine Art unspezifisches oder allgemeines Alarmsystem bildet, und das Benzodiazepinsystem, das als Angst-Konflikt-System funktioniert (Pi & Simpson, 1987). Neurophysiologische Aspekte Die Bewertung von wahrgenommenen Bedrohungen besitzt engste Zusammenhänge mit dem limbischen System und der Formatio Reticularis (Strian, 1983). Informationen werden selegiert, strukturiert, gespeichert und in entsprechender Form bewertet. Diese Struktur bildet eine Art Hintergrund für zukünftige Erfahrungen und Erlebnisse. Weiter verweist der Autor auf die endokrinen Rückmeldungen auf der Ebene des Hormonsystems über den Hypothalamus. Resümee Das allgemeine Systemmodell von Kanfer et al. (1990) bildet einen Versuch, der verschiedentlich geforderten Berücksichtigung unterschiedlicher Ebenen von Ängsten und ihrer Interaktion und Rückkoppelungen zumindest im Prinzip gerecht zu werden. Die Analyse auf den drei erwähnten Ebenen bringt zwar viele Probleme mit sich, dennoch ist sie in diagnostischer, theoretischer und therapeutischer Hinsicht ausgesprochen zielführend. 4.5 Modellvorstellungen über kognitive und emotionale Prozesse (96-101) Wie bereits angesprochen ist eine Trennung zwischen kognitiven und behavioralen Prozessen weder aus theoretischen, noch aus Gründen der Behandlung sinnvoll, u.a. weil sie z.T. auf einem unpräzisen Verständnis der entsprechenden Begriffe beruht. Im Rahmen des DreiReaktions-Systems geht der Autor davon aus, dass die Ebene kognitiver Prozesse für eine Theorie der Phobien höchste Relevanz besitzt. In Anlehnung an das System-Modell von Kanfer et al. (1990) muss dabei (a) die Komplexität der ins Auge gefassten Ebenen und (b) die enge Interaktion der einzelnen Ebenen Berücksichtigung finden. In seiner Theorie der Emotionen geht Lang (1979, 1985, 1986) davon aus, dass Emotionen propositional repräsentiert und in Netzwerken organisiert sind, wobei die propositionale Repräsentation der Emotionen sich wiederum trennen lässt in (1) Informationen über Reaktionen, die im wesentlichen als Struktur für Verhaltensmuster anzusehen ist (z.B. über die Notwendigkeit von Flucht und Vermeidung). (2) Informationen über Situationen und ihre Bedeutung: Dies impliziert im Wesentlichen das Lernen durch Klassische Konditionierung. 20 Phobien (Reinecker, 1993) Susi Kolarik; [email protected] Die Organisation dieser kognitiv-emotionalen Struktur kann man sich im Sinne eines Netzwerkes mit unterschiedlichen Ebenen vorstellen; dabei spielen Strukturen des Kurz- und Langzeitgedächtnisses sowie die Repräsentation von Informationen in Schemata eine wichtige Rolle. Lang (1985) fand, dass v.a. die Reaktionskomponenten für das Gedächtnis eine Schlüsselfunktion besitzen. Wie schon James (1884) sagte, macht die Rückmeldung über eigenes emotionales Verhalten einen zentralen Bestandteil emotionalen Erlebens aus. Heute spricht man bei Angstpatienten von einer selektiven Wahrnehmung und Informationsverarbeitung. Therapie besteht in einer Veränderung der propositionalen Struktur der Emotionen durch die konkrete Erfahrung, dass eine Gefahr aktuell nicht gegeben ist. Klinische Untersuchungen zur Netzwerkstruktur phobischer Ängste (Foa & Kozak, 1986) verdeutlichen, dass die Pathologie durch drei Merkmale dieser Struktur gegeben ist: a) Sie ist hochgradig persistent (überdauernd). b) Sie ist intern kohärent (nicht zu widerlegen; dies hängt mit der selektiven Informationsverarbeitung zusammen). c) Sie ist hochgradig irrational i.S. einer willkürlichen Verknüpfung ohne Realitätstest. Kognitive Aspekte spielen eine grosse Rolle, weil die Fehlinterpretation bedeutender Informationen (z.B. die Interpretation des Herzschlages als Anzeichen für den bevorstehenden Tod) mit zur Entstehung, Stabilisierung und Aufrechterhaltung der chronischen Ängste beiträgt. Es ist jedoch sehr schwer zu entscheiden, ob kognitive Aspekte der klinischen Angstzustände als ätiologische Bedingungen oder möglicherweise als sekundäre Effekte der emotionalen Störung angesehen werden müssen. Zusammenfassend wird festgehalten, das Konzepte über die propositionale Struktur von Phobien sehr brauchbar, plausibel und heuristisch fruchtbar sind, was sehr wertvoll ist für die Planung und Durchführung des individuellen therapeutischen Vorgehens. In gewisser Weise problematisch ist sicher der hohe Abstraktions- und Komplexitätsgrad der einzelnen Modellvorstellungen, die eine direkte empirische Prüfung erschweren. 21