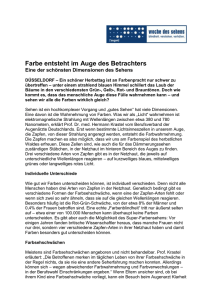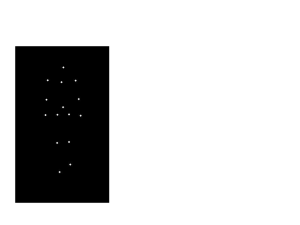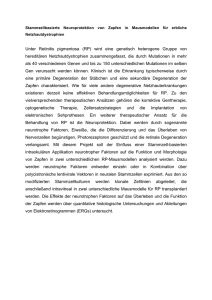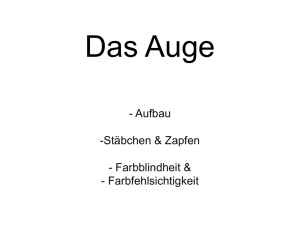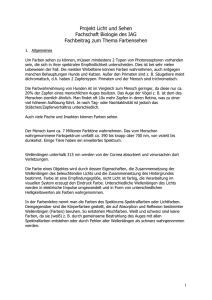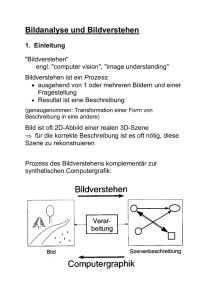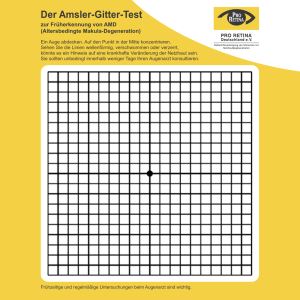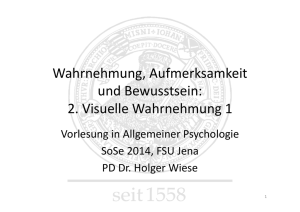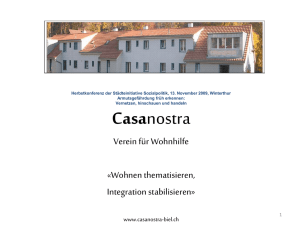licht am ende des molekularen tunnels
Werbung

Das menschliche Auge ist ein äußerst komplexes und damit auch störanfälliges Organ. Bestimmte genetische Defekte in den Zapfen, einer Art von Sinneszellen in der Netzhaut, kann zu dem schweren Augenleiden Achromatopsie führen. Der Pharmako­ loge Professor Martin Biel hat im Tiermodell einen Weg gefunden, den defekten Abschnitt des Erbmoleküls DNA durch eine korrekte Kopie zu ersetzen und so den betroffenen Tieren das Sehen zu ermöglichen. susanne wedlich licht am ende des molekularen tunnels D as Auge ist ein Wunderwerk der Natur – und muss gerade deshalb als Munition im Kampf gegen die Evolution herhalten. Ein derart komplexes Organ könne sich unmöglich nur über Anpassung und Selektion in einer Viel- zahl von Zwischenschritten entwickeln, lautet die Argumentation seit Darwins Zeiten. Schließlich könne das Auge nur in vollendeter Form seine Funktion erfüllen. Doch die Wissenschaft hat längst geklärt, dass es sich beim Auge um eine fast einzigartige Intensifikation der Funktion handelt. Die Untersuchung einfachster Organismen lieferte hier den Schlüssel zur Erkenntnis: Am Anfang der Entwicklung steht wohl ein lichtsensitiver Bereich auf der Haut, der sich noch nicht Auge nennen kann – und trotzdem einen kleinen Vorteil im Überlebenskampf bietet. Von diesem Ausgangspunkt aus war dann jede Modifikation in Richtung komplexer Augen eine Verbesserung. Lichtsensitive augenähnliche Organe haben sich in der Tierwelt unabhängig voneinander mindestens 40 Mal entwickelt – und alle Zwischenstufen vom einfachsten bis zum höchstentwickelten Auge lassen sich heute noch bei lebenden Arten nachweisen. Zudem finden sich ungezählte Variationen der unterschiedlichen Anlagen. Diese Variationen betreffen auch die Fotorezeptoren in der Retina, der Netzhaut. Beim Menschen finden sich hier zwei Typen von Sinneszellen. Die sogenannten Stäbchen, von denen sich bis zu 130 Millionen in einer einzigen Netzhaut befinden, unterscheiden keine Farben. Sie erlauben aber das Sehen in der Dämmerung und Dunkelheit. Schon deshalb gilt nach dem Volksmund: „In der Nacht sind alle Katzen grau.“ Nur rund sechs Millionen Zapfen einer Netzhaut ermöglichen dagegen das Farbsehen sowie das scharfe Sehen bei Tageslicht. Es gibt drei Arten von Zapfen, die mit unterschiedlicher Empfindlichkeit auf verschiedene Wellenlängen des Lichts reagieren und so nur je eine Farbe erkennen. Der S-Typ der Zapfen ist der Blaurezeptor, der M-Typ ist zuständig für Grün, während der L-Typ die Farbe Rot erkennt. In ihrer Funktion aber stimmen sie überein. Trifft Licht auf einen Fotorezeptor, werden Ionenkanäle in der Zellmembran geschlossen. Der Impuls gelangt dann über nachgeschaltete Neuronen ins Gehirn, wo ein Bild entsteht. Die Arbeitsgruppe von Professor Martin Biel beschäftigt sich mit der Rolle von Ionenkanälen in gesunden und im kranken Organismus. „Unser Schwerpunkt liegt auf dem Herzen und dem Gehirn“, sagt der Pharmakologe. „Seit Langem untersuchen wir den Sehvorgang in der Retina, die funktionell auch zum Gehirn gehört. Der Fokus liegt bei diesen Projekten auf einer Familie von Ionenkanälen, die in den Fotorezeptoren der Netzhaut exprimiert werden und eine Schlüsselposition im Sehprozess einnehmen.“ Diese Moleküle werden als CNG für cyclic nucleotidegated-Kanäle bezeichnet. Sie wirken bei der Weiterleitung eines visuellen Signals wie eine Art molekularer Schalter: Die Kanäle setzen zelluläre Vorgänge, die durch einen Lichtreiz ausgelöst werden, in eine Veränderung der Kal- 72 naturwissenschaften 3 Schematische Darstellung der Genersatztherapie. Therapeutische Viren werden unter die Netzhaut der Achromatopsie-Mäuse injiziert. Nach einer Inkubationszeit von ca. zehn Wochen kann die virusvermittelte Expression des CNGA3-Proteins (grünes Signal im vergrößerten Ausschnitt der therapierten Netzhaut) beobachtet werden. ziumkonzentration und andere molekulare Prozesse um. Die Reaktion der Ionenkanäle ist die Voraussetzung für die Generierung von Reizen in der Netzhaut, die schließlich an das Gehirn weitergeleitet werden. „Abgesehen von diesen normalen physiologischen Vorgängen, interessieren uns vor allem Fehler im molekularen Netzwerk des Sehprozesses“, sagt Martin Biel. „Denn gerade für pathologische Prozesse in diesem Bereich sind die CNG-Kanäle von großer Bedeutung.“ Genetische Mutationen können hier zu schweren erblichen Augenerkrankungen führen wie die Achromatopsie, die Zapfendystrophien sowie die Retinitis pigmentosa. Für keines dieser Leiden gibt es bislang eine Therapie. Mit der Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), dem Exzellenzcluster „Center for integrated Protein Science Munich“ (CIPSM) sowie LMUexcellent haben Martin Biel und seine Arbeitsgruppe deshalb in den letzten Jahren Mausmodelle für diese Erkrankungen etabliert und im Detail charakterisiert. „Diese Mausmodelle sind extrem wertvoll, um einen tieferen Einblick in Krankheitsprozesse zu gewinnen“, erläutert der Pharmakologe. „Zudem bieten sie die Grundlagen, um molekulare Therapien zu konzipieren und zu überprüfen.“ Ein möglicher Ansatz ist die Genersatztherapie. Dabei wird eine korrekte Kopie des defekten Gens in die betroffenen Zellen eingeschleust. Als Vehikel für die therapeutische Fracht dienen häufig molekular veränderte Viren, die sich im Organismus nicht mehr unkontrolliert ausbreiten und verändern können. In der Gruppe von Martin Biel wird hierfür ein entsprechend entschärftes Adeno-assoziiertes Virus, kurz AAV, verwendet. ERFOLG IM TIERMODELL Das virale Vehikel kam unter anderem im Mausmodell für Achromatopsie zum Einsatz. Menschen, die an dieser schweren Augenerkrankung leiden, besitzen von Geburt an keine funktionsfähigen Zapfen. Sie können daher nur Graustufen unterscheiden, sehen extrem unscharf und sind überempfindlich gegenüber hellem Licht. Im Laufe ihres Lebens kommt es zu einer fortschreitenden Degeneration der Netzhaut. Die Krankheit wird in der überwiegenden Mehrheit der Fälle durch Mutationen im CNGA3-Gen oder CNGB3-Gen ausgelöst. Diese genetischen Veränderungen führen zum Defekt des betreffenden Ionenkanals und damit der Zapfen. Einem Team um Martin Biel und Professor Mathias Seeliger vom Universitätsklinikum Tübingen ist es im Tiermodell gelungen, das wegen des genetischen Defekts fehlende Protein in den Zapfen der Netzhaut zu exprimieren. Mit Erfolg: Die Mäuse erlangten die Sehfähigkeit. Ebenfalls beteiligt war die Arbeitsgruppe von Dr. Tim Golisch, Max-Planck-Institut für Neurobiologie in Martinsried bei München. Im Versuch schleusten die Forscher mit Hilfe der Viruspartikel eine korrekte Kopie als Ersatz für den defekten DNA-Abschnitt in die Zielzellen. „In unserem Mausmodell fehlte der Ionenkanal CNGA3“, berichtet Martin Biel. „Die Tübinger Kollegen haben die Tiere mit den von uns entwickelten AAV-Vektoren behandelt.“ Erstmals konnte auf diesem Weg mit CNGA3 ein großer Membran-Protein-Komplex in den Zapfen der Netzhaut exprimiert werden. In funktionellen Studien konnten die Forscher zudem zeigen, dass die Lichtrezeptoren der therapierten Tiere wieder auf Lichtreize reagieren und diese Information an nachgeschaltete Zellen des Sehsystems weitergeben. „Diese Fotorezeptoren waren von Geburt an funktionslos“, sagt Martin Biel. „Es hat uns sehr gefreut, dass sie dank unse- 73 NATURWISSENSCHAFTEN rer Therapie zum ersten Mal normal auf Licht reagierten und damit den Tieren das Sehen ermöglichten.“ Die Behandlung zeigte noch einen weiteren positiven Effekt: Das Absterben der Zapfen und die Degeneration der Netzhaut wurden deutlich verlangsamt. „Dieser Aspekt ist für uns natürlich von besonderer Bedeutung“, ergänzt Martin Biels Mitarbeiter Stylianos Michalakis, der Erstautor der Studie. „Noch lässt sich nicht beurteilen, ob solche Gentherapieansätze beim Menschen wirksam sein können. Unsere Ergebnisse lassen aber hoffen, dass auf diesem Wege neue Optionen zur Vorbeugung und Behandlung genetischer Blindheit entstehen werden.“ Dafür spricht auch, dass sich das in München entwickelte Mausmodell bereits in einer weiteren Kooperation bewährt hat. In Zusammenarbeit mit der Gruppe von Dr. Botond Roska am Friedrich-Mischer-Institut in Basel konnte die Sehfähigkeit blinder Mäuse mit Retinitis pigmentosa wiederhergestellt werden. Diese Erkrankung umfasst mehrere Ausprägungen genetisch bedingter Augenleiden, denen eines gemein ist: Die Patienten verlieren ausnahmslos ihre ohnehin eingeschränkte Sehfähigkeit, weil die Zapfen der Netzhaut absterben. „In diesem Projekt wurde das durch Licht aktivierbare Protein Halorhodopsin aus Bakterien verwendet, um die Lichtempfindlichkeit der Zapfen wiederherzustellen“, berichtet Martin Biel. Tatsächlich gelang es auf diesem Weg, eine Alternative für die natürliche – aber in diesem Fall defekte – Signalübermittlung zu schaffen. Die „wiedererwachten“ Zapfen leiteten visuelle Reize an die nachgeschalteten Neuronen der Retina weiter und aktivierten so die entsprechenden Bereiche im Gehirn. Der Erfolg der Versuche zeigte sich auch daran, dass sich die vormals blinden Mäuse in ihrem Verhalten an visuellen Signalen orientierten. ZEITGEWINN SCHAFFT LUFT FüR MÖGLICHE THERAPIE Martin Biel und seine Mitarbeiter möchten nun verschiedene Ansätze der Gentherapie im Mausmodell etablieren. Doch auch damit sind die Möglichkeiten noch nicht erschöpft: „Ein weiterer wichtiger Aspekt erblicher Augenerkrankungen ist die Neurodegeneration, deren Mechanismen wir derzeit ebenfalls im Mausmodell untersuchen. Bei dieser Art der Erkrankung sterben die Nervenzellen der Retina ab, was ebenfalls zu Blindheit führt, weil visuelle Reize nicht mehr weitergeleitet werden können.“ Breiter angelegte Therapieansätze zielen darauf ab, die oft rasch voranschreitende Neurodegeneration zu verlangsamen oder anzuhalten. Der Zeitgewinn könnte genug Luft für eine spätere gentherapeutische Intervention schaffen. Schwerpunkt in Martin Biels Gruppe ist derzeit die Suche nach Proteinen, die sich als Zielmoleküle für neue Therapeutika im Kampf gegen die Neurodegeneration eignen. „Neue Erkenntnisse in diesem Bereich könnten möglicherweise auch für neurodegenerative Erkrankungen außerhalb der Retina relevant sein“, betont der Pharmakologe. Ein mögliches Ende des Forschungsbedarfes ist damit in Zukunft nicht abzusehen – selbst wenn sich Martin Biel auf ein Fotosystem des menschlichen Auges beschränkt: Die Stäbchen und Zapfen galten bis vor einigen Jahren auch als die einzigen Sinneszellen der Netzhaut, bis die Ganglienzellen genauer untersucht wurden. Sie bilden an der Innenseite der Retina eine Art Nervenzellschicht. Die Ganglienzellen erhalten letztlich Signale der Fotorezeptoren, die sie – in ihren zum Sehnerv gebündelten Ausläufern – an das Gehirn weiterleiten. 74 NATURWISSENSCHAFTEN 7 Erfolgreiche Verlangsamung der Zapfen-Fotorezeptordegeneration durch Genersatztherapie. Vergrößerte Ausschnitte aus der Netzhaut therapierter Achromatopsie-Mäuse. Die Zapfen wurden mit einem Marker (rotes Signal) visualisiert; die Zellkerne wurden zur Verdeutlichung ebenfalls mit einem spezifischen Marker gefärbt (blaues Signal). Oben: in der untherapierten Achromatopsie-Maus degenerieren die Zapfen mit der Zeit (fast kein Zapfen-Marker Signal zu erkennen). Unten: durch die Therapie wird die Zapfendegeneration deutlich verlangsamt, sodass zum gleichen Zeitpunkt deutlich mehr lebende Zapfen zu finden sind (rotes Signal). Der Maßstabsbalken entspricht 50µm. Vor einigen Jahren wurde schließlich nachgewiesen, dass die Ganglienzellen mit dem lichtempfindlichen Protein Melanopsin auch ein eigenes Fotosystem enthalten. Dessen Signale dienen vor allem der Anpassung der inneren Uhr des Organismus. Dieser Biorhythmus steuert viele Prozesse im Körper, von der Körpertemperatur bis zum Blutdruck, und muss mit der Außenwelt synchronisiert werden. Der sogenannte Zeitgeber ist hier das Sonnenlicht. Im Überschwang wurde nach dieser bahnbrechenden Entdeckung in mehreren Fachartikeln postuliert, dass die Retina der Säugetiere noch ein weiteres Fotosystem enthalten müsse. Dieses hypothetische vierte Fotosystem, das auf den Cryptochrom-Proteinen beruhen sollte, erfülle mehrere Funktionen, so die Vermutung. Zum einen solle es am Pupillenreflex beteiligt sein, also an der Verengung der Pupille bei Lichteinfall. Zum anderen sollten die Cryptochrome helfen, den inneren Rhythmus des Organismus an den äußeren Tag-Nacht-Zyklus anzupassen, etwa bei Licht-Dunkel-Wechseln, die vom 24 Stunden-Takt abweichen. Der Hypothese vom vierten Fotosystem in der Retina ging Martin Biel in Zusammenarbeit mit amerikanischen, britischen und kanadischen Kollegen nach. Untersuchungsobjekt der Wahl waren auch in diesem Fall Mäuse mit ganz spezifischen Gendefekten. Die Tiere konnten weder das Protein Melanopsin aus dem neu nachgewiesenen Fotosystem, noch Stäbchen oder Zapfen bilden. Im Versuch zeigte sich schließlich eindeutig, dass diese Tiere keinerlei visuelle Reize wahrnehmen konnten. Die Mäuse zeigten praktisch keinen Pupillenreflex mehr und auch keine Anpassung an die äußeren Lichtverhältnisse. Die Forscher konnten auch keine Koordinierung der Aktivität der Tiere mit einem kurzphasigen Hell-Dunkel-Wechsel nachweisen. Letztlich lassen die Ergebnisse nur den Schluss zu, dass ohne die drei bekannten Fotosysteme, die sich in ihrer Funktion ergänzen, keine Informationen über die Lichtverhältnisse der Außenwelt an das Gehirn weitergeleitet werden. Die Hypothese vom vierten Fotosystem war damit zweifelsfrei widerlegt. Diese Resultate sind auch für Martin Biels aktuelle Projekte von Bedeutung. „Ob und welche klinische Relevanz sich hieraus ergibt, lässt sich noch nicht abschätzen“, sagt der Pharmakologe. „Wir wollen aber gezielt Therapien für Erkrankungen der Retina entwickeln. Die Voraussetzung dafür ist das möglichst lückenlose Verständnis ihrer Funktion – selbst wenn sich dabei herausstellt, dass hypothetisch geforderte Strukturen gar nicht existieren.“ Prof. Dr. Martin Biel ist seit 1999 Professor für Pharmakologie am Department Pharmazie der LMU. Zudem forscht der Pharmakologe am Center for Integrated Protein Science Munich (CIPSM). [email protected] http://www.cup.uni-muenchen.de/ph/aks/biel/Main/Biel 75 naturwissenschaften